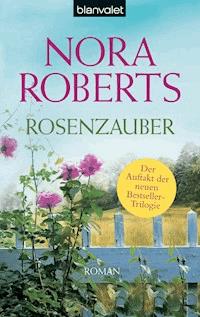4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die MacGregor-Serie
- Sprache: Deutsch
Familie, Liebe, Leidenschaft: Der faszinierende MacGregor-Clan.
Familienpatriarch Daniel MacGregor ist fest entschlossen, seinen drei Enkeltöchtern zum großen Glück zu verhelfen. Doch die drei unabhängigen jungen Frauen denken gar nicht an die Ehe. Sie wollen ihr Single-Leben genießen und ihre Karrieren verfolgen. Die Zeiten sind ohnehin vorbei, wo ein Großvater sich in die Traummann-Wahl einschalten sollte! Doch das sieht Daniel anders. Und als Laura, Gwen und Julia überhaupt nicht zufällig drei absolut hinreißenden Männern begegnen, fliegen die Funken. Hat Daniel die richtige Wahl getroffen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Nora Roberts
Die MacGregors 6
Hochzeitsfieber bei den MacGregors
Roman
Aus dem Amerikanischen von Emma Luxx
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
AUS DEN TAGEBÜCHERN DES DANIEL DUNCAN MACGREGOR
Wenn ein Mann sein neunzigstes Lebensjahr erreicht, ist er versucht, auf sein Leben zurückzuschauen und Bilanz zu ziehen, seine Triumphe und Fehler zu betrachten. Oft denkt er vielleicht: »Was wäre gewesen, wenn ich dieses statt jenem getan hätte?« oder »Wenn ich doch nur das getan hätte.«
Nun, ich habe keine Zeit für solchen Unsinn.
Ich schaue nach vorn, und das habe ich immer gemacht. Ich bin ein Schotte, der die meiste Zeit seines langen Lebens fern von seinem Geburtsland gelebt hat. Meine Heimat ist Amerika. Ich habe hier eine Familie gegründet und Kinder großgezogen. Ich habe meine Enkel heranwachsen sehen. Ich habe fast sechzig Jahre lang eine einzige Frau geliebt, mit ihr gelebt, sie bewundert, mit ihr gearbeitet. Und um sie herum, wenn es keinen anderen Weg gab.
Meine Anna ist mir das Wertvollste. Zwischen uns … nun, wir hatten eine tolle Zeit.
Ich bin ein reicher Mann. Oh, nicht nur was Geld, Besitztümer und Grundeigentum anbelangt, sondern auch, was meine Familie betrifft. Die Familie kommt für mich zuerst. Das ist etwas, das schon immer so war und immer so sein wird. Meine Anna und ich haben drei Kinder. Zwei Söhne und eine Tochter. Mein Stolz auf sie ist fast so groß wie meine Liebe.
Obwohl ich zugeben muss, dass es zu gewissen Zeiten notwendig war, diesen drei starken Individuen einen Schubs in die richtige Richtung zu geben, um sie daran zu erinnern, was sie dem Namen MacGregor schuldig sind. Zu meinem Bedauern muss ich einräumen, dass meine Kinder in dieser Hinsicht immer etwas langsam waren, und ihre Mutter hat sich schon Sorgen gemacht.
Doch mit einem bisschen Hilfe haben sie alle gut geheiratet. Mit »gut« meine ich, dass sie die Gefährten ihres Herzens gefunden haben, und diese Verbindungen haben Anna und mir zwei weitere Töchter und einen feinen Sohn, die wir alle abgöttisch lieben, geschenkt. Sie sind sozusagen aus gutem Stall und können sich mit einem MacGregor messen.
Jetzt habe ich elf Enkelkinder – drei davon sind nur ehrenhalber MacGregors, weil sie eigentlich Campbells sind. Campbells, Gott helfe uns, aber gute Kinder sind sie trotzdem. Sie alle waren die Freude unserer – Annas und meiner – späten Jahre, in denen wir sie heranwachsen sahen.
Wie ihre Eltern haben auch sie es nicht eilig, ihren Pflichten nachzukommen, und ihnen ist gar nicht klar, wie reich einen die Ehe und eine Familie macht. Darüber grämt sich ihre Großmutter Tag und Nacht. Ich bin kein Mann, der einfach tatenlos zuschaut, wie sich seine Frau Sorgen macht, oh nein, das bin ich gewiss nicht. Ich habe mir alles sehr sorgfältig überlegt.
Meine drei ältesten Enkelinnen sind im heiratsfähigen Alter. Sie sind starke, intelligente, schöne Frauen. Sie haben in der Welt ihren Weg gemacht, ganz allein. Diese Dinge – das hat Anna mich gelehrt – sind für eine Frau genauso wichtig wie für einen Mann. Mit Laura, Gwendolyn und Julia habe ich eine Anwältin, eine Ärztin und eine Geschäftsfrau an der Hand. Meine Mädchen sind intelligent und reizend, was erfordert, dass die Männer, die ich für sie aussuche, etwas ganz Besonderes sein müssen. Mit weniger sollen sie sich nicht zufriedengeben müssen.
Ich habe mir schon ein feines Trio ausgeguckt. Alle drei kommen aus bestem Haus. Und gut aussehende Burschen sind es auch. Ah, ich sehe die schönen Paare und die niedlichen Babys schon vor mir!
Aber immer hübsch der Reihe nach. Eine nach der anderen zu verheiraten ist der Plan. Es ist sicherlich das Beste, wenn ich meine ganze Aufmerksamkeit jeweils nur auf eine von ihnen konzentriere. Deshalb fange ich mit Laura an, sie ist schließlich die Älteste. Wenn ich es nicht schaffe, dass die junge Laura an Weihnachten Orangenblüten schnuppert, will ich nicht mehr Daniel MacGregor heißen.
Und wenn Laura unter der Haube ist, kommt mein Liebling Gwen an die Reihe. Julia wird wahrscheinlich die härteste Nuss von den dreien, aber ich arbeite daran.
Ich gebe ihnen lediglich einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Ich bin ja schließlich kein Mensch, der seine Nase in fremde Angelegenheiten steckt, sondern nur ein besorgter Großvater im Winter seines Lebens … und ich gehe selbstverständlich davon aus, dass es ein sehr langer Winter werden wird. Ich werde noch meine Urenkel aufwachsen sehen.
Aber wie soll ich das, wenn diese Mädchen nicht heiraten und Babys bekommen? Ha! Schön, wir werden uns darum kümmern … damit Anna sich keine Sorgen mehr zu machen braucht, natürlich.
TEIL EINSEIN MANN FÜR LAURA
1. KAPITEL
Das Klingeln des Telefons brauchte sechs Anläufe, ehe es ihm gelang, eine Ecke ihres schlafenden Gehirns zu durchdringen. Beim achten Läuten schließlich schaffte sie es, eine Hand unter der Decke hervorzustrecken. Sie haute auf den Wecker, und Kermit, der Frosch, krachte mit seinem fröhlichen Gesicht auf den Boden. Es war der dritte tote Kermit in diesem Jahr.
Ihre langen, unberingten Finger tasteten auf der glänzenden Oberfläche des Walnussnachttischs herum, fanden endlich den Hörer und nahmen ihn mit unter die Decke.
»Hallo.«
»Es hat zehnmal geklingelt.«
Laura MacGregor zuckte unter der dröhnenden Anklage zusammen, dann gähnte sie. »Ja?«
»Zehnmal. Noch ein Klingeln mehr, und ich hätte das Überfallkommando gerufen. Ich habe dich schon in einer Blutlache liegen sehen.«
»Bett«, brachte sie mühsam heraus und kuschelte sich in die Kissen. »Ich schlafe. Gute Nacht.«
»Es ist fast acht.«
»Acht was?«
»Acht Uhr morgens.« Jetzt hatte Daniel MacGregor die Stimme identifiziert und wusste, welche seiner Enkelinnen am helllichten Tag noch im Bett herumlungerte. »Ein schöner klarer Septembermorgen. Du solltest ihn genießen, anstatt ihn zu verschlafen, Mädchen.«
»Warum?«
Er schnaubte. »Das Leben geht an dir vorbei, Laura. Deine Großmutter macht sich Sorgen um dich. Sie hat gerade erst gestern gesagt, dass sie kaum einen Moment Ruhe findet, weil sie sich so um ihre älteste Enkelin sorgt.«
Anna hatte nichts dergleichen gesagt, aber der Trick, seine Frau vorzuschieben, wenn er seiner Familie seinen Willen aufzwingen wollte, war eine alte Angewohnheit. Der Große MacGregor schätzte Traditionen.
»Alles bestens. Prima. Schlaf jetzt, Grandpa.«
»Hör zu, steh auf. Du hast deine Großmutter schon seit Wochen nicht mehr besucht. Sie verzehrt sich vor Sehnsucht nach dir. Nur weil du glaubst, eine erwachsene Frau von vierundzwanzig Jahren zu sein, heißt das noch lange nicht, dass du deine liebe alte Granny vergessen sollst.«
Er zuckte bei diesen Worten ein bisschen zusammen und warf einen Blick auf die Tür, um sich davon zu überzeugen, dass sie geschlossen war. Wenn Anna hörte, dass er sie als liebe alte Granny bezeichnete, würde sie ihm das Fell über die Ohren ziehen.
»Komm am Wochenende rauf«, verlangte er. »Und bring deine Cousinen mit.«
»Muss Akten studieren«, murmelte sie und begann wieder wegzudriften. »Aber bald.«
»Möglichst bald. Wir leben nicht ewig, weißt du.«
»Doch, ihr schon.«
»Ha. Ich habe dir ein Geschenk geschickt. Es muss heute Morgen ankommen. Darum steh jetzt auf und mach dich hübsch. Zieh ein Kleid an.«
»Alles klar. Danke, Grandpa. Mach’s gut.«
Laura ließ den Hörer einfach auf den Boden fallen, kuschelte sich unter die Decke und glitt wohlig in den Schlaf zurück.
Zwanzig Minuten später wurde sie höchst unsanft durch ein erbostes Rütteln an der Schulter geweckt. »Verdammt, Laura, du hast es schon wieder gemacht.«
»Was?« Sie schoss hoch, die dunklen Augen weit aufgerissen, das schwarze Haar zerzaust. »Was?«
»Den Hörer nicht aufgelegt.« Julia MacGregor hatte die Hände in die Hüften gestemmt und rauchte vor Zorn. »Ich erwarte einen Anruf.«
»Ich … äh …« Sie konnte noch keinen klaren Gedanken fassen. Laura fuhr sich mit der Hand durch das vom Schlaf zerzauste Haar. Der Morgen war einfach nicht ihre Tageszeit. »Ich glaube, Grandpa hat angerufen. Vielleicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern.«
»Ich habe nichts gehört.« Julia zuckte die Schultern. »Ich war wohl unter der Dusche. Gwen ist schon im Krankenhaus. Was wollte Grandpa denn?« Als Laura sie weiterhin verständnislos anstarrte, lachte Julia und setzte sich auf den Bettrand.
»Wahrscheinlich nur das Übliche. Deine Großmutter macht sich Sorgen um dich.«
»Ja, jetzt, wo du es sagst, fällt es mir langsam wieder ein.« Laura verzog den Mund zu einem kleinen Lächeln und ließ sich in die Kissen zurückfallen. »Wenn du ein bisschen schneller aus der Dusche gekommen wärst, hättest du drangehen können. Dann hätte Grandma sich um dich Sorgen gemacht.«
»Ich war erst letzte Woche dran.« Julia warf einen Blick auf ihre antike Armbanduhr. »Ich muss los. Ich schaue mir dieses Haus in Brookline an.«
»Noch eins? Hast du nicht erst letzten Monat ein Haus gekauft?«
»Das war vor zwei Monaten, und es ist praktisch fertig.« Julia schüttelte ihre feuerrote Lockenmähne zurück. »Es wird Zeit, ein neues Projekt in Angriff zu nehmen.«
»Solange es dir Spaß macht. Mein großer Plan für heute war es, bis mittags zu schlafen und am Nachmittag ein paar Akten zu lesen.« Laura rollte die Schultern. »Die Chancen dafür stehen bestens, wie ich sehe.«
»Du hast die Wohnung für die nächsten paar Stunden ganz für dich allein. Gwen schiebt eine Doppelschicht, und ich bin kaum vor fünf zurück.«
»Ich bin nicht mit Kochen dran.«
»Ich bringe von unterwegs etwas mit.«
»Pizza«, sagte Laura wie aus der Pistole geschossen. »Mit einer Extraportion Käse und schwarzen Oliven.«
»Kannst du eigentlich nur an Essen denken?« Julia stand auf und zog die moosgrüne Jacke glatt, die sie zu einer eleganten schwarzen Hose trug. »Bis heute Abend dann«, rief sie auf ihrem Weg nach draußen. »Und vergiss nicht wieder, den Hörer aufzulegen.«
Laura betrachtete die Zimmerdecke, blinzelte ins Sonnenlicht und erwog, sich die Decke erneut über den Kopf zu ziehen. Eigentlich könnte sie noch eine Stunde schlafen. Abzuschalten, wann immer sie wollte, war noch nie ein Problem für sie gewesen, und diese Fähigkeit hatte ihr während ihres Jurastudiums gute Dienste geleistet.
Aber der Gedanke an Pizza hatte ihren Appetit geweckt. Bei der Entscheidung zwischen Schlafen und Essen sah Laura sich stets ihrem größten Dilemma ausgesetzt. Als schließlich das Essen das Rennen gemacht hatte, warf sie die Decke zurück. Sie trug ein schlichtes weißes, ärmelloses T-Shirt und seidene metallicblaue Boxershorts.
Sie wohnte schon seit ihrer Collegezeit mit ihren beiden Cousinen zusammen, und vor zwei Jahren hatten sie dieses Haus an der Bostoner Back Bay bezogen. Auf die Idee, einen Morgenrock anzuziehen, wäre sie gar nicht gekommen. Das hübsche kleine Stadthaus – eins von Julias jüngsten Restaurationsobjekten – spiegelte ihre unterschiedlichen Geschmacksrichtungen wider. Julias Liebe für Antiquitäten wetteiferte mit Gwens Wertschätzung für moderne Kunst und ihrer eigenen Vorliebe für Kitsch.
Sie lief leichtfüßig mit einer Hand auf dem glatten Eichengeländer die Treppe nach unten, warf einen kurzen Blick durch das geschliffene Glasfenster der Eingangstür, um festzustellen, dass es in der Tat ein strahlender Herbstmorgen war, dann ging sie nach hinten in die Küche.
Obwohl jede der Cousinen einen wachen Verstand besaß, den sie gewissenhaft in ihrem jeweiligen Wissens- und Erfahrungsbereich einsetzte, war keine von ihnen in diesem speziellen Raum mit Talent sonderlich gesegnet. Trotzdem wirkte die Küche mit ihren gelben Wänden, die sich hübsch von dem dunkelblauen Tresen abhoben, und den Schränken mit den Glastüren ausgesprochen gemütlich.
Laura war immer froh gewesen, dass sie sich alle drei so gut verstanden. Gwen und Julia waren nicht nur ihre besten Freundinnen, sondern auch ihre Cousinen. Zusammen mit dem Rest der MacGregor-Brut, wie Laura sie für sich nannte, bildete die weitverzweigte Verwandtschaft von Daniel und Anna eine Familie, die sich sehr nahestand, auch wenn die einzelnen Mitglieder ziemlich unterschiedlich waren.
Sie warf einen Blick auf die saphirblaue Uhr in Form einer Katze an der Wand, deren Augen wie Diamanten funkelten, während sich der Schwanz rhythmisch hin und her bewegte. Sie dachte an ihre Eltern und fragte sich, ob diese ihren lang verdienten Urlaub auf den Westindischen Inseln auch genossen. Mit Sicherheit. Caine und Diana MacGregor waren eine unzerstörbare Einheit. Ehemann und Ehefrau, Eltern, Partner in derselben Anwaltskanzlei. Fünfundzwanzig Jahre Ehe, die Erziehung zweier Kinder und der Aufbau einer der angesehensten Anwaltskanzleien in Boston hatten an ihrer gegenseitigen Ergebenheit nichts geändert.
Laura wollte sich lieber gar nicht vorstellen, wie viel Mühe und Arbeit es ihre Eltern gekostet haben mochte, dies alles zu bewerkstelligen. Sie selbst fand, es sei wesentlich einfacher, sich immer nur auf eine Sache zu einer Zeit zu konzentrieren. Und für sie war das jetzt die Juristerei. Einspruch, dachte sie und grinste den Kühlschrank an. Im Augenblick war es das Frühstück.
Sie schnappte sich den Walkman, der auf dem Tresen lag, und steckte sich die Ohrhörer in die Ohren. Ein bisschen Musik zum Frühstück kann nicht schaden, entschied sie und spulte das Band zurück.
Royce Cameron parkte seinen Jeep hinter einem kleinen schnittigen Spitfire in flammendem Rot ein. Autotyp und Farbe schienen gleichermaßen Hallo, Polizei, noch ein Knöllchen wegen zu schnellen Fahrens, bitte! zu schreien. Er schüttelte den Kopf, dann ließ er seinen Blick über das Haus wandern.
Es war ein Prachtstück. Das war natürlich in dieser piekfeinen Gegend nicht anders zu erwarten gewesen … und bei diesen Besitzern.
Aber er dachte nicht an Geld oder Klasse, während er das Haus betrachtete. Mit seinen kühlen blauen Augen musterte er die Fassade. Massenhaft Glas, überlegte er, während ihm der frische Herbstwind durch sein dichtes nerzbraunes Haar fuhr. Massenhaft Glas bedeutete massenhaft Einbruchsmöglichkeiten. Er begann den mit Steinplatten belegten, rechts und links von leuchtenden Herbstblumen gesäumten Weg hinaufzugehen, dann überquerte er den Rasen, um die Atriumtüren, die sich zu einem kleinen Innenhof hin öffneten, genauer unter die Lupe zu nehmen.
Er überprüfte sie und fand sie verschlossen. Allerdings hätte ein ordentlicher Fußtritt genügt, um sich Einlass zu verschaffen. Seine Augen blieben kühl, sein Mund wurde schmal in einem Gesicht, das die Frau, die er fast geheiratet hätte, einmal als kriminell bezeichnet hatte. Er hatte nicht nachgefragt, was sie damit meinte, weil es zu dieser Zeit mit ihnen schon rapide abwärtsgegangen war und es ihn einfach nicht interessiert hatte.
Es konnte kalt sein, dieses Gesicht, und das war es jetzt, als er erwog, sich Zugang zu diesem hübschen alten Haus zu verschaffen, das unzweifelhaft bis unters Dach mit all den wertvollen Sachen vollgestopft war, an denen reiche Frauen sich so ergötzten. Seine Augen waren von einem blassen frostigen Blau, das sich ganz unerwartet erwärmen konnte. Sein Mund bildete eine entschlossene Linie, die sich je nach Stimmungslage entweder charmant verziehen oder hart zusammenpressen konnte. Sein energisches Kinn wurde von einer kleinen Narbe geziert, das Resultat eines abrupten Kontakts mit einem Brillantring an einer geballten Faust. Er war hochgewachsen, weit über eins achtzig, und hatte den Körper eines Boxers oder eines Raufbolds.
Er war beides gewesen.
Während ihm jetzt der frische Wind sein bis zum Hemdkragen reichendes Haar zerzauste, wurde ihm klar, dass er mit einem jämmerlich geringen Zeitaufwand von weniger als dreißig Sekunden im Haus sein könnte.
Selbst wenn er keinen Schlüssel für die vordere Eingangstür besäße.
Er ging um das Haus herum und klingelte mehrmals hintereinander laut und vernehmlich, während er durch die geschliffene Glasscheibe in der Haustür einen Blick ins Innere zu werfen versuchte. Hübsches Fenster, dachte er, die wie Eisblumen anmutenden Verzierungen betrachtend. Und so sicher wie Alufolie.
Er klingelte noch einmal, dann kramte er den Schlüssel aus seiner Tasche, schob diesen ins Schloss und verschaffte sich Zutritt zu dem Haus.
Es duftete feminin. Das war sein erster Gedanke, als er die Eingangshalle mit dem glänzenden Parkettfußboden betrat. In der Luft lag der Duft nach Zitronen und Ölen und eines verführerischen Parfüms. Rechter Hand lag die elegant geschwungene Treppe, während zu seiner Linken die Tür zum vorderen Wohnzimmer einladend offen stand.
Ordentlich wie in einem Nonnenkloster, dabei riecht es betörend wie in einem Edelbordell, dachte er. Frauen versetzten Royce immer wieder in Erstaunen.
Es war genauso, wie er es sich vorgestellt hatte. Die wunderbaren alten Möbel, die weichen Farben, die teuren Staubfänger. Und die Klunker lassen sie auch überall rumliegen, dachte er, als er auf einem kleinen runden Tisch ein Paar Brillantohrringe entdeckte.
Er nahm einen Minikassettenrecorder aus seiner Gesäßtasche, um bei seiner Wanderung durchs Haus alles, was ihm wichtig erschien, auf Band zu sprechen.
An der kirschholzgetäfelten Wand hing ein buntes Ölgemälde, das seinen Blick gefangen nahm. Es war in derart leuchtenden Farben und kühnen Formen gehalten, dass es eigentlich in diesem ruhigen Raum völlig fehl am Platz hätte wirken müssen, stattdessen aber fand er, dass diese Ode an das Leben und die Leidenschaft genau dorthin passte.
Er hatte eben die Signatur in der unteren Ecke erspäht – D. C. MacGregor – und geschlossen, dass es das Werk eines der zahlreichen MacGregor-Abkömmlinge war, als er den Gesang hörte.
Obwohl, Gesang konnte man es beim besten Willen nicht nennen, überlegte er, während er, nachdem er seinen Kassettenrecorder abgeschaltet und in die Tasche zurückgeschoben hatte, wieder auf den Flur ging. Schreien, Heulen, Jaulen, Winseln waren wohl bessere Umschreibungen für das Stimmenmassaker an einer von Whitney Houstons Hymnen an die Liebe.
Immerhin bedeutete es, dass er doch nicht allein im Haus war. Er ging dem Lärm über den Flur entgegen, und als er durch die Tür in eine sonnenüberflutete Küche trat, breitete sich auf seinem Gesicht ein breites Grinsen reinster männlicher Wertschätzung aus.
Sie war groß und schien fast nur aus Beinen zu bestehen. Deren schlanke verführerische Form machte den völligen Mangel an stimmlichem Talent zumindest in seinen Augen bei Weitem wett. Und die Art, wie sie sich, den Kopf im Kühlschrank, vorbeugte und im Rhythmus der Musik den Unterleib bewegte, hatte einen derart hohen Unterhaltungswert, dass sich kein Mann, ob lebendig oder tot, auch nur mit einer Silbe darüber beschwert hätte, dass sie gottserbärmlich falsch sang.
Ihr Haar war schwarz wie die Nacht, glatt wie ein Regenvorhang und reichte ihr bis zu einer Taille, die geradezu darum bettelte, von zwei Männerhänden umspannt zu werden.
Und sie trug Unterwäsche, die mit zu dem Aufregendsten gehörte, was er je gesehen hatte. Wenn das Gesicht mit dem Körper auch nur annähernd mithalten konnte, war heute wirklich sein Tag.
»Entschuldigen Sie.« Er hob die Augenbrauen, als sie, statt wie erwartet, wenn nicht gar erhofft, zusammenzuzucken oder aufzukreischen, fortfuhr, in dem Kühlschrank herumzukramen und unbeirrt weitersang. »Also, nicht, dass mir Ihr Auftritt keinen Spaß machen würde, aber Sie sollten vielleicht doch noch ein bisschen üben.«
Ihre Hüften zuckten so verzückt, dass er unwillkürlich einen anerkennenden Pfiff ausstieß. Dann kletterte ihre Stimme in so schwindelerregende Höhen, dass eigentlich die Gläser im Schrank hätten zerspringen müssen, und sie drehte sich mit einem Hühnerschenkel in der einen und einer Getränkedose in der anderen Hand um.
Sie zuckte nicht zusammen, aber sie schrie auf. Royce hob zum Zeichen seiner Friedfertigkeit eine Hand und versuchte sich an einer Erklärung.
Die Musik plärrte noch immer durch die Kopfhörer, und alles, was Laura sah, war ein wildfremder Mann mit vom Wind zerzausten Haaren, ausgewaschenen Jeans und einem Gesicht, auf dem sich genug Lasterhaftigkeit für ein Dutzend Teufel widerspiegelte.
Sie zielte auf seinen Kopf und schleuderte die Getränkedose auf ihn. Er fing das Geschoss einen Zentimeter vor seinem Gesicht mit einer Hand ab. Aber sie war bereits zum Tresen herumgewirbelt. Als sie mit einem federnden Satz auf ihn zusprang, hatte sie ein Brotmesser in der Hand und einen Blick in den Augen, der ihn warnte, dass sie nicht zweimal überlegen würde, bevor sie ihm die Gurgel durchschnitt.
»Immer mit der Ruhe.« Er hielt beide Hände hoch und sprach sanft.
»Keine Bewegung«, sagte sie laut, während sie sich millimeterweise am Tresen entlang auf das Telefon zuschob. »Wenn Sie auch nur den kleinen Finger rühren, steche ich Ihnen das Messer mitten ins Herz.«
Er schätzte, dass er sie in etwa zwanzig Sekunden entwaffnen konnte, aber einer von ihnen – höchstwahrscheinlich er – würde anschließend mit Sicherheit genäht werden müssen. »Ich bewege mich nicht. Hören Sie, ich habe geklingelt, aber Sie haben nicht aufgemacht. Ich bin nur hier, um …« Erst in diesem Augenblick schaffte er es, seinen Blick von dem Gesicht loszureißen, was dazu führte, dass er die Kopfhörer sah. Im Zeitlupentempo tippte er mit einem Finger an sein Ohr, führte diesen über seinen Kopf an das andere Ohr und sagte mit übertriebenen Lippenbewegungen: »Nehmen Sie die Kopfhörer ab.«
Sie hatte eben erst durch das laute Rauschen des Blutes in ihren Ohren hindurch die Musik wieder gehört und riss sich jetzt die Kopfhörer herunter. »Ich sagte, keine Bewegung. Ich rufe die Polizei.«
»Gut.« Royce versuchte sich an einem lässigen Lächeln. »Aber Sie würden in diesem Fall ganz schön dumm dastehen, denn ich mache nämlich nur meinen Job. Schon mal was von ›Cameron Security‹ gehört? Sie haben auf mein Klingeln nicht reagiert. Whitney hat wohl zu laut gesungen.« Er ließ sie nicht aus den Augen. »Ich würde nur gern meinen Ausweis herausholen.«
»Mit zwei Fingern«, befahl sie. »Und langsame Bewegungen.«
Das hatte er auch vor. Was sich in diesen großen dunklen Augen spiegelte, war viel mehr Wut und Ungestüm als Angst. Eine Frau, die einen fremden Mann ohne mit der Wimper zu zucken mit einem gezückten Küchenmesser in der Hand anschauen konnte, sollte man besser nicht herausfordern. »Ich habe um neun Uhr einen Termin wegen einer Alarmanlage.«
Sie schaute auf den Ausweis, den er ihr hinhielt. »Einen Termin? Mit wem?«
»Mit Laura MacGregor.«
Sie legte ihre freie Hand auf den Telefonhörer. »Ich bin Laura MacGregor, Kumpel, und ich habe keinen Termin mit Ihnen vereinbart.«
»Ich habe mit Mr. MacGregor gesprochen.«
Sie stutzte. »Welcher Mr. MacGregor?«
Royce lächelte wieder. »Na, der MacGregor. Daniel MacGregor. Ich sollte mich um neun mit seiner Enkelin treffen und ihr die sicherste Alarmanlage der Welt installieren.« Ein charmantes Lächeln blitzte auf. »Ihre Großmutter macht sich Sorgen.«
Laura nahm die Hand vom Telefon, aber das Messer ließ sie nicht sinken. »Wann haben Sie mit ihm gesprochen?«
»Letzte Woche. Er hat mich extra in seine Festung nach Hyannis Port kommen lassen, um mich höchstpersönlich unter die Lupe zu nehmen. Ein beeindruckendes Haus. Ein beeindruckender Mann. Nachdem wir uns einig waren, haben wir zusammen einen Scotch getrunken und eine Zigarre geraucht.«
»So?« Sie hob eine Augenbraue. »Und was hat meine Großmutter dazu gesagt?«
»Zu unserem Geschäft?«
»Zu den Zigarren.«
»Sie war nicht im Zimmer. Und aus der Tatsache, dass er die Tür abschloss, bevor er die Zigarrenkiste aus einem Exemplar von Krieg und Frieden, bei dem die Seiten fehlten, herauskramte, glaubte ich entnehmen zu können, dass sie etwas dagegen hat, wenn er raucht.«
Laura atmete tief aus und steckte das Messer in den Holzblock zurück. »Schön, Mr. Cameron, Sie können durchgehen.«
»Er sagte, Sie würden mich erwarten. Ich nehme an, dass das nicht der Fall war.«
»Nein, war es nicht. Er hat heute Morgen angerufen und etwas davon gesagt, dass er mir ein Geschenk geschickt hat. Glaube ich.« Sie zuckte die Schultern und warf sich das Haar zurück, dann bückte sie sich nach dem Hähnchenschenkel, den sie vor Schreck fallen gelassen hatte, und warf ihn in den Müll. »Wie sind Sie reingekommen?«
»Er hat mir einen Schlüssel gegeben.« Royce kramte den Schlüssel aus der Tasche und legte ihn in die Hand, die Laura ihm hinhielt. »Ich habe geklingelt. Mehrmals.«
»Hm.«
Royce warf einen Blick auf die Getränkedose. »Sie können gut zielen, Miss MacGregor.« Er schaute ihr wieder ins Gesicht. Ein Mund, wie geschaffen für wilde, sündige Küsse, dachte er, und Augen mit dem Schmelz von Zartbitterschokolade. Und wahrscheinlich das unglaublichste Gesicht, das ich je gesehen habe.
Es gefiel ihr nicht, wie er sie jetzt taxierte, genüsslich, dachte sie, mit einem unverschämten Starren, das etwas Beunruhigendes hatte. »Sie haben gute Reflexe, Mr. Cameron. Andernfalls würden Sie jetzt mit einer Gehirnerschütterung auf meinem Küchenfußboden liegen.«
»Vielleicht wäre es das ja wert gewesen«, sagte er mit einem Grinsen, das entwaffnend sein sollte, aber einfach nur sexy war, und gab ihr die Dose zurück.
»Ich ziehe mir nur rasch etwas an, dann können wir uns über Alarmanlagen unterhalten.«
»Sie brauchen sich meinetwegen nicht umzuziehen.«
Sie legte den Kopf schräg und streifte ihn mit einem langen Blick, der angefangen von seinem allzu anerkennenden Gesichtsausdruck bis hin zu seiner »Ich-lass-mich-doch-von-dir-nicht-zum-Narren-halten«-Haltung alles in sich aufnahm. »Doch. Weil Sie sich nämlich, wenn Sie mich nur noch zehn Sekunden weiter so anstarren, doch noch eine Gehirnerschütterung holen werden. Ich bin gleich wieder da.«
Sie rauschte an ihm vorbei zur Tür. Royce drehte sich um und schaute ihr nach, wie sie auf diesen atemberaubenden, ewig langen Beinen davonging. Und stieß wieder einen Pfiff aus.
Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber Laura MacGregor ist eine Wucht, dachte er mit einem sehnsüchtigen Seufzer.
2. KAPITEL
Laura saß in der Anwaltskanzlei von »MacGregor und MacGregor«, umringt von Büchern, an einem langen Eichentisch. Sie hatte sich den ganzen Morgen in der Bibliothek vergraben, wild entschlossen, noch einen zusätzlichen Präzedenzfall zu finden.
Wenn ihre Eltern in der nächsten Woche aus dem Urlaub zurückkehrten, würde sie ihre Nachforschungen erfolgreich abgeschlossen haben müssen. Zwar hatte ihre Mutter den Fall Massachusetts von Holloway übernommen, und Laura recherchierte nur für sie, aber das hatte sie nicht daran gehindert, zu dem Fall eine ganz besondere emotionale Beziehung zu entwickeln.
Und wenn sie ihre Sache gut machte, konnte sie sich damit vielleicht im Gerichtssaal einen Platz neben ihrer Mutter verdienen. Und vielleicht, ganz vielleicht, erlaubte man ihr sogar, eine Zeugenbefragung durchzuführen.
Sie sehnte sich nach der intensiven Atmosphäre des Gerichtssaals, dem Drama, das sich dort zwischen Anklage, Verteidigung und Geschworenen entfaltete. Sie wusste, wie wichtig Nachforschungen waren, wie nötig es war, jeden Schritt im Voraus zu planen und peinlich genau zu sein. Sie war bereit zu lesen, zu lesen und noch einmal zu lesen, bis sie schielte, aber bei Gott, sie würde sich ihre Sporen verdienen. Und vielleicht bald ihren eigenen Fall.
Amanda Holloway hatte ihren Ehemann getötet. Über die Tat gab es keinen Zweifel. Aber die Schuldfrage war, juristisch gesehen, eine andere Sache. Amanda war fünf schlimme Jahre lang körperlich und seelisch misshandelt worden. Fünf Jahre, in der ihr die Knochen und das Rückgrat gebrochen worden waren, dachte Laura. Es war leicht zu sagen, dass sie einfach hätte weggehen – wegrennen – und nie zurückschauen sollen. Tatsächlich hatte Laura sich dabei ertappt, dass sie selbst etwas in der Art gedacht hatte. Aber Amanda Holloway war nicht weggelaufen und schon gar nicht gerannt. Und am Ende hatte etwas bei ihr ausgehakt.
In einer heißen Nacht im Hochsommer, nachdem sie wieder einmal geschlagen, wieder einmal vergewaltigt worden war, hatte sie den Dienstrevolver ihres Mannes genommen, auf ihn gezielt und das ganze Magazin leer geschossen, während er schlief.
Schade, dass sie nach der Vergewaltigung mehr als eine Stunde damit gewartet hat, dachte Laura kühl. Der Zeitabstand von einer Stunde kam einer vorsätzlichen Tötung gleich. Und die Tatsache, dass John Holloway Polizist gewesen war, dem nur Gutes nachgesagt wurde, machte die Angelegenheit nicht besser.
Manch einer hätte auf die Idee kommen können, dass in dieser Nacht nur der Gerechtigkeit Genüge getan wurde, aber die Justiz sah das nüchterner. Doch Laura war entschlossen, das Recht zu benutzen, um Amanda Holloway das Gefängnis zu ersparen.
Es macht wirklich Spaß, sie zu beobachten, dachte Royce. Im Augenblick glich sie in nichts der Frau, die in Hemd und Höschen gesungen hatte, oder jener kühlen, höflichen, die ihm in einem schlichten Pullover und lässigen Jeans gegenübergesessen und sich über Alarmanlagen unterhalten hatte. Heute hatte sie diesen Wasserfall aus dunklen Haaren zu einem komplizierten Zopf gebändigt, der ihr über den Rücken herabfiel. In den Ohrläppchen trug sie schlichte goldene Tropfen und um das Handgelenk eine schmale goldene Uhr sowie ein ab und zu im Licht aufblitzendes brillantbesetztes Armband.
Ihre weiße Seidenbluse wirkte sehr klassisch, und über ihrer Stuhllehne hing eine dunkelblaue Jacke. Der Raum roch nach Leder, poliertem Holz und Frau.
Im Augenblick sah Laura MacGregor klassisch, teuer und sehr unnahbar aus. Unnahbar, sinnierte Royce, es sei denn, ein Mann hätte gesehen, wie sie in diesen Seidenboxershorts mit den Hüften wackelte.
Er lehnte sich gegen den Türrahmen. »Sie sehen wie eine Anwältin aus.«
Ihr Kopf schoss hoch. Er bewunderte die Geschwindigkeit, mit der sie sich erholte. Die Überraschung blitzte nur für eine Sekunde in diesen schokoladenbraunen Augen auf, bevor sie wieder kühl wurden. »Ich habe letzten Sommer die Prüfung vor der Anwaltskammer abgelegt. Ich bin Anwältin. Brauchen Sie eine?«
»Im Moment nicht, aber ich werde an Sie denken, wenn es so weit ist.« Tatsache war, dass er schon seit fast einer Woche an sie dachte.
Vom Wind zerzaustes Haar, diese faszinierende kleine Narbe, diese herausfordernden, waghalsigen Augen, das alles zusammen machte ihn zu einem Mann, der eine Frau nicht unberührt ließ. Da sie aber nicht die Absicht hatte, sich berühren zu lassen, wollte sie, dass er ging. »Die Kanzlei ist bis Ende des Monats geschlossen.«
»Das hat mir die Rezeptionistin unten auch schon gesagt. Aber ich bin nicht gekommen, um mir Rechtsbeistand zu holen.« Er kam ins Zimmer – seine Bewegungen erinnerten an die einer Raubkatze kurz vor dem Sprung – und hockte sich auf die Tischkante.
»Warum sind Sie dann hier?«
»Ich hatte in der Nähe zu tun. Ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, dass wir am Samstag mit Ihrer Alarmanlage anfangen.«
»Das ist schön. Mein Großvater wird sicher erfreut sein.«
»Er hat recht damit, das, was ihm viel wert ist, zu beschützen. Er ist auf Sie und Ihre Cousinen sehr stolz. Der Stolz leuchtet ihm regelrecht aus den Augen, wenn er von Ihnen spricht.«
Lauras Blick wurde weicher, und ihr Körper verlor etwas von seiner steifen Abwehrhaltung. »Er ist der wunderbarste Mann auf der Welt. Aber er kann einen auch zur Verzweiflung treiben. Wenn er könnte, würde er uns alle in seiner Festung in Hyannis einsperren.«
»Boston kann für ein hübsches junges Mädchen ein gefährliches Pflaster sein«, sagte Royce mit einem Dröhnen in der Stimme, das entfernt an Daniel erinnerte und bei dem Laura lächeln musste.
»Nicht schlecht. Noch ein bisschen mehr Stimmvolumen, und Sie sind perfekt.«
»Und er hat recht, es kann gefährlich sein. Sie sind drei alleinstehende junge Frauen in einem großen Haus, das vollgestopft ist mit wertvollen, leicht verkäuflichen Dingen. Eine von Ihnen ist die Tochter eines früheren Staatspräsidenten, und alle drei sind Sie Enkelinnen eines der reichsten Männer des Landes. Und Sie sind schön. Das alles macht Sie zu potenziellen Zielscheiben.«
»Wir sind keine Dummköpfe, Mr. Cameron.«
»Royce.«
»Wir sind keine Dummköpfe«, wiederholte sie. »Wir schlendern nicht durch dunkle Seitengassen, öffnen keinem Fremden oder sammeln unsere Männerbekanntschaften in obskuren Bars auf.«
»Nun, das ist lobenswert.«
Ihre Schultern verspannten sich wieder. »Mein Großvater ist überängstlich, aber wenn es ihn beruhigt, dass wir eine komplizierte Alarmanlage einbauen lassen, tun wir das eben.«
»Sie glauben nicht, dass Sie Sicherheit brauchen?«
»Ich denke, dass meine Cousinen und ich in unserem Haus absolut sicher sind.«
»Haben Sie schon mal daran gedacht, dass ein Mann in Ihre Küche kommen könnte, während Sie in Ihrer Unterwäsche sicher vor dem Kühlschrank herumtanzen?«
»Sie hatten einen Schlüssel, und ich war nicht in Unterwäsche in der Küche.«
»Ich wäre ohne Schlüssel genauso schnell und leicht drin gewesen. Und was war das denn dann, wenn es keine Unterwäsche war?«
»Mein Schlafanzug«, gab sie spitz zurück.
»Ach so, das ist natürlich ein Riesenunterschied.« Royce grinste zu ihr hinunter und ergötzte sich an der schwelenden Wut in ihren dunklen Augen.
»Hören Sie, installieren Sie einfach diese verdammte Anlage, und wir benutzen sie, okay? Und jetzt habe ich …« Sie zuckte zurück, als er sich zu ihr hinunterbeugte. »Was machen Sie denn?«
Er holte langsam tief Atem. »Nur kurz mal schnuppern. Ich mag Ihr Parfüm.« Und seine Augen glitzerten vor Belustigung. »Sie sind plötzlich so nervös.«
»Ich mag es nicht, wenn man mir so nah auf die Pelle rückt.«
»Gut.« Er wich ein bisschen zurück, aber nur ein bisschen, sodass sie noch immer nicht die gewünschte Bewegungsfreiheit hatte. »Wie lange brauchen Sie noch dafür?«, fragte er und wedelte mit der Hand in Richtung der Gesetzestexte und Lehrbücher.
»Bis ich fertig bin.«
»Was halten Sie davon, wenn ich zurückkomme? Sagen wir, gegen sieben. Wir könnten zusammen essen gehen.«
»Nein.« Sie sagte es entschieden und steckte ihre Nase wieder in ihr Buch.
»Sind Sie gebunden?«
»Offensichtlich.«
»Ich meine nicht durch Arbeit. Ich dachte an einen Mann.«
»Das geht Sie nichts an.«
»Gut möglich. Aber wissen Sie, ich mag es, wie Sie aussehen, ich mag es, wie Sie riechen. Ich mag, wie Sie reden, wie Sie sich bewegen. Es könnte interessant sein herauszufinden, wie Sie … denken«, schloss er, während sie den Blick hob und ihn aus verengten Augen anstarrte.
»Wollen Sie wissen, was ich gerade im Moment denke?«
Er lächelte, dann grinste er und lachte laut auf. »Nein. Wenn Sie Ihre Meinung bezüglich des Essens ändern sollten, meine Nummer haben Sie ja.«
»Oh ja, die habe ich.«
Er wollte sich gerade erheben, als sein Blick auf den Rücken der Akte fiel, die unter einem Bücherstapel halb vergraben war. »Holloway«, murmelte er, dann schaute er Laura wieder an. »Der Mordfall?«
»Ja.«
»Ich kannte John Holloway.«
»Ach ja?« Sein Lachen hatte ihr gefallen, es hatte ihr sogar so gut gefallen, dass sie fast in Versuchung geraten war, sein Angebot anzunehmen. Doch jetzt wurden ihre Augen und ihre Stimme frostig. »Haben Sie noch mehr Freunde, die ihre Ehefrauen misshandeln?«
»Ich habe nicht gesagt, dass wir Freunde waren. Ich sagte, ich kannte ihn. Er war Polizist. Und ich auch.«
Als er sich diesmal anschickte, sich zu erheben, legte sie ihre Hand auf die seine. Jetzt schaute sie ihn nachdenklich an. »Haben Sie mit ihm zusammengearbeitet?«
»Nein. Aber wir haben ein paar Monate lang auf demselben Revier gearbeitet. Ich wurde versetzt. Er war ein guter Polizist.«
»Er war …« Sie schloss die Augen. »Oh, das ist typisch. Er hat seine Frau jahrelang misshandelt, aber er war ein guter Polizist. Die Uniformen halten die Reihen eisern geschlossen.«
»Ich bin kein Polizist mehr«, bemerkte Royce mild. »Und privat habe ich ihn praktisch nicht gekannt. Er hat seine Arbeit getan und seine Fälle aufgeklärt. Sein Privatleben hat mich nicht interessiert.«
»Aber mich interessiert sein Privatleben.« Sie beobachtete ihn, während sie sprach. Er weiß etwas, dachte sie. Doch er hielt sich bedeckt. »Sie haben ihn nicht gemocht, stimmt’s?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Es war nur so ein Gefühl. Ich musste bei ihm immer an eine geladene Pistole mit einer kaputten Sicherung denken. Früher oder später geht so ein Ding los.«
»Sie haben doch bestimmt noch Kontakte zur Polizei und kennen Leute, die ihn kannten. Polizisten können Anwälte in der Regel nicht ausstehen, aber …«
»Vielleicht, weil Anwälte den Abschaum so schnell wieder auf die Straße zurückschmeißen, dass die Polizei mit Aufräumen gar nicht nachkommt.«
Sie atmete tief durch. »Amanda Holloway ist kein Abschaum. Ihr mangelte es schlicht an Menschenkenntnis, sodass sie leider Abschaum geheiratet hat.«
»Gut möglich, aber ich kann Ihnen auch nicht weiterhelfen.« Er stand auf und trat einen Schritt zurück. »Ich bin am Samstagmorgen zwischen acht Uhr dreißig und neun Uhr bei Ihnen.« Er lächelte wieder. »Sosehr ich es auch begrüßen würde, denke ich doch, es ist besser, wenn Sie diesmal keinen Schlafanzug anhaben. Es würde meine Leute nur ablenken.«
»Und wie sieht er aus?«
Laura riss ihren Blick von ihren schwarzen Wimpern los, die sie sich überflüssigerweise eben vor dem Badezimmerspiegel tuschte, und schaute ihre Cousine an. »Wer?«
»Dieser Excop und Sicherheitsexperte, den Grandpa uns auf den Hals gehetzt hat, um uns vor den Bostoner kriminellen Elementen zu beschützen.« Gwen beugte sich über Lauras Schulter, sodass ihre Gesichter nah beieinander waren.
Niemand hätte sie für Cousinen gehalten und noch weniger – da sie sowohl auf der MacGregor’schen wie auch auf der Blade’schen Seite des Stammbaums miteinander verwandt waren – für zweifache. Gwens rotgolden schimmernde Haarkappe, die kurz geschnitten war wie bei einem Jungen, hob sich extrem von Lauras rabenschwarzer Mähne ab. Gwen hatte den Teint ihrer Mutter geerbt, die sahneweiße Haut, die blauen Augen, die je nach Lichteinfall fast lavendelfarben leuchteten, das rotblonde Haar.
Und sie war klein und zierlich gebaut. Eine Mischung, die ihrem Aussehen den trügerischen Anschein von Zerbrechlichkeit verlieh. Aber sie konnte, falls nötig, eine Doppelschicht im Krankenhaus schieben, anschließend noch eine Stunde im Fitnessstudio trainieren und hatte immer noch überschüssige Energie.
Sie war, wie Laura fand, schön, klug und kommandierte die Leute gern herum.
»Willst du mir etwa erzählen, dass du dich nicht mehr erinnerst, wie er aussieht?«, fragte Gwen herausfordernd.
»Hm? Doch, ich erinnere mich. Ich habe gerade an etwas anderes gedacht. Er ist attraktiv genug, nehme ich an.«
»Details, Laura, die Wahrheit liegt im Detail.« Gwen hob eine Augenbraue. »Cameron, richtig? Ein guter schottischer Name.«
»Das würde Grandpa freuen.«
»Mit Sicherheit.« Gwen fuhr sich mit der Zunge über die Zähne. »Ist er verheiratet?«
»Ich glaube nicht.« Laura wandte ihr Interesse wieder der überflüssigen Wimperntusche zu. »Auf jeden Fall trug er keinen Ring.«
»Und er ist wie alt? Ungefähr dreißig?«
»So ungefähr, schätze ich.« Ihr Blick wanderte wieder zu Gwen. »Sind wir auf der Jagd?«
»Nein, ich sammle nur Daten. Er ist alleinstehend, attraktiv, hat eine eigene Firma, ist um die dreißig und ein Cameron. Meine weibliche Intuition sagt mir, dass Grandpa ihn für dich ausgesucht hat.«
»Das wissen wir bereits.« Laura schraubte die Wimperntusche zu und ihren Lippenstift auf. »Grandpa hat ihn angeheuert, damit er uns eine Alarmanlage einbaut, was er heute Vormittag tun wird.«
Gwen seufzte, dann klopfte sie mit dem Fingerknöchel gegen Lauras Kopf. »Hallo? Du schaltest doch sonst nicht so langsam. Ich rede vom Heiraten.«
»Hei…« Mit einem erstickten Laut legte Laura den Lippenstift beiseite. »Niemals.«
»Aber warum denn nicht? Grandpa tönt schon seit letztem Jahr herum, dass keins seiner Enkelkinder genug gesunden Menschenverstand oder Pflichtbewusstsein hat, um endlich zu heiraten und eine Familie zu gründen.«
»Und Grandma sehnt sich so schrecklich nach süßen kleinen Babys, die ihr auf dem Schoß herumturnen«, schloss Laura trocken. »Ich sage dir, es ist völlig ausgeschlossen, dass er sich auf Royce Cameron als potenziellen angeheirateten Enkel versteift hat. Der Mann ist einfach nicht der Typ, den ein überängstlicher Großvater aussuchen würde.«
Gwen hockte sich auf den langen roséfarbenen Tresen. »Weil?«
»Er hat etwas Gefährliches an sich. Man sieht es in seinen Augen … etwas Ungezähmtes.«
»Mmmh. Das wird ja immer besser.«
»Als Liebhaber, klar, warum nicht? Bestimmt ist er gut im Bett.« Laura grinste, während sie sich ihr Haar bürstete. »Aber ich bezweifle, dass es das ist, was der Große MacGregor im Sinn hat.«
Gwen langte müßig nach dem Lippenstift, schraubte ihn auf und wieder zu. »Im Gegenteil, ich würde sagen, dass es genau das ist, was er im Sinn hat. Der Junge hat Geist«, fuhr sie mit einem tiefen Brummen fort. »Und er hat Feuer im Blut. Er wird starke Söhne und Töchter zeugen.«
»Lächerlich.« Aber ein bisschen mulmig wurde es Laura doch. »Das ist absurd. Er könnte nicht … er würde nie …«
»Er kann und wird«, widersprach Gwen entschieden. »Und bis jetzt funktioniert es offensichtlich.«
»Was meinst du damit? Wovon sprichst du?«
»Ich meine, dass Samstagmorgen ist.« Gwen warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Punkt acht an einem Samstagmorgen, und du musst nirgendwohin. Nicht genug damit, dass du schon wach bist, du bist sogar schon angezogen. Und hast dir völlig überflüssigerweise deine Wimpern getuscht, deine Lippen angemalt und …«, sie beugte sich vor und schnupperte, »… dein bestes Parfüm aufgelegt.«
»Ich will doch nur …«
»Und auf ihrem Bett liegt eine neue Bluse«, ergänzte Julia, die eben hereinkam und sich an den Türrahmen lehnte. »Eine rote Seidenbluse.«
»Aha, eine rote Seidenbluse für einen Samstagvormittag zu Hause.« Gwen rutschte vom Tresen herunter und tätschelte Lauras Schulter. »Ich diagnostiziere einen akuten Fall von starker körperlicher Anziehungskraft.«
»Ich fühle mich nicht angezogen von ihm. Ich bin nur … ich will in die Stadt, das ist alles. Ein paar Weihnachtsgeschenke einkaufen. Deshalb bin ich schon auf und angezogen.«
»Du gehst samstags nie einkaufen«, stellte Julia erbarmungslos klar. »Du gehst überhaupt nur höchst ungern einkaufen, was ich sehr bedaure. Und Weihnachtsgeschenke kaufst du grundsätzlich nie vor Mitte Dezember. Jedenfalls war das bisher immer so.«
»Heute ist eben eine Ausnahme.« Laura rauschte verärgert an den beiden vorbei in ihr Zimmer.
Die Bluse lag auf dem Bett und leuchtete wie ein rotes Alarmsignal. Laura zischte sie an. Sie knallte die Tür zu und entschied, sie trotzdem anzuziehen. Ich liebe leuchtende Farben, dachte sie und schnappte sich die Bluse. Und Seide liebte sie auch. Warum also sollte sie das verdammte Ding nicht anziehen?
Während sie sich die Bluse zuknöpfte, brummelte sie wütende Schmähungen in sich hinein. Sie fühlte sich von Royce Cameron kein bisschen angezogen. Er war nicht im Entferntesten ihr Typ. Der Mann war arrogant, unhöflich und selbstgefällig. Und er hat mich in einer höchst lächerlichen Situation überrascht, erinnerte sie sich.
Und außerdem bin ich doch überhaupt nicht auf der Suche nach einer Beziehung, dachte sie, als sie in ihre dunkelgraue Hose schlüpfte. Ganz abgesehen davon, dass ein Mann wie Royce sowieso nicht an etwas so Zivilisiertem wie einer Beziehung interessiert sein würde, wollte sie für sich selbst noch ein paar Jahre absoluter Freiheit.
Ein Mann und insbesondere ein Ehemann konnten warten.
Als unten der Türsummer ertönte, schniefte sie. Sie ließ sich Zeit damit, ihre Schuhe anzuziehen. Um sich zu beweisen, dass es ihr egal war, wie sie aussah, ging sie an dem Spiegel vorbei, ohne auch nur einen einzigen Blick hineinzuwerfen, bevor sie sich auf den Weg nach unten machte.
Er war in der Eingangshalle. Abgewetzte Lederjacke, ausgewaschene Jeans, vom Wind zerzaustes Haar. Er redete mit Julia und Gwen und lachte über irgendeine Bemerkung von Julia. Laura war schon halb die Treppe unten, als er sich umdrehte, als diese merkwürdig intensiven blauen Augen mit den langen dunklen Wimpern den ihren begegneten. Als dieses langsame, gefährliche Lächeln seine Mundwinkel nach oben bog.
Als ihr Herz einen verrückten Satz machte, der sie warnte, dass sie vielleicht doch noch Schwierigkeiten bekommen könnte.
»Morgen, Slim«, sagte er und ließ seinen Blick sehr langsam an ihr herunterwandern. »Hübsche Bluse.«
3. KAPITEL
Royce lief keiner Frau nach. Und schon gar keiner, die mangelndes Interesse erkennen ließ – oder die widersprüchliche Signale aussendete. Wenn ihm eine Frau über den Weg lief, die ihn anzog, ließ er es sie wissen. Geradeheraus, keine Spielchen, keine Tricks. Und von da an war es seiner Meinung nach Sache der Frau, den Ball zurückzugeben. Oder auch nicht.
Da Laura MacGregor den Ball nicht aufhob, ja, offensichtlich nicht einmal gemerkt hatte, dass er ihn ihr zugespielt hatte, hätte er eigentlich die Schultern zucken und seiner Wege gehen müssen.
Aber er schaffte es aus irgendwelchen Gründen einfach nicht.
Es war jetzt fast drei Wochen her, seit er sie zum ersten Mal, und vier Tage, seit er sie zum letzten Mal gesehen hatte. Und sie war immer noch in seinem Kopf. Nicht nur das Bild von ihr in diesem sexy Unterzeug, das sie in der Küche angehabt hatte, obwohl es ihm mit ärgerlicher Regelmäßigkeit immer wieder durch den Kopf schoss. Es war ihr Gesicht, das ihn verfolgte, die kalte Zielstrebigkeit, die sich darin gespiegelt hatte, als sie sich das Messer geschnappt und ihn niedergestarrt hatte. Es war die Intelligenz und Entschlossenheit in ihren Augen, als sie von Recht und Gerechtigkeit gesprochen hatte. Es war das anmaßende Lächeln, das um diesen unglaublich verführerischen Mund gespielt hatte, als sie an dem Tag, an dem er mit der Installation ihrer Alarmanlage anfangen wollte, die Treppe herunterkam.
Es war, wie er sich zuzugeben gezwungen sah, das ganze verdammte Päckchen.
Er saß in seinem kleinen engen Büro, rieb sich die müden Augen und fuhr sich durchs Haar, das dringend einen neuen Schnitt brauchte. Sie hatte ihn letzte Nacht wach gehalten, und das machte ihn verrückt. Er sollte einfach sein Adressbuch hervorkramen und sich eine freundliche Frau suchen, mit der er den Abend verbringen konnte. Eine, die unkompliziert und anspruchslos war.
Aber warum, zum Teufel, wollte er niemanden, der unkompliziert und anspruchslos war?
Er wollte verdammt sein, wenn er zum Hörer griff und Laura anrief. Er hatte ihr gezeigt, dass er interessiert war, und sie hatte dankend abgelehnt. Er hatte ihr gesagt, dass er erreichbar wäre, falls sie ihre Meinung änderte. Sie hatte sie nicht geändert. Er hatte sich zum letzten Mal mit zwölf wegen einer Frau zum Narren gemacht, damals, als er bis über beide Ohren in die ältere Schwester seines besten Freundes verknallt gewesen war. Marsha Bartlett war damals sechzehn gewesen. Er war ihr volle zwei Monate auf Schritt und Tritt nachgelaufen wie ein herrenloses Hündchen und hatte die Spötteleien der gesamten siebten Klasse der Saint Anne’s Elementary School heldenhaft ertragen.
Marsha Bartlett hatte ihn nie eines Blickes gewürdigt und später irgendwann einen Kieferorthopäden geheiratet. Und Royce war nach dieser Erfahrung nie mehr einer Frau nachgelaufen.
»Werd endlich erwachsen, Cameron«, befahl er sich und wandte sich wieder seinem Monitor zu, um noch ein bisschen mit dem Alarmsystem für ein Bürogebäude in Südboston herumzuspielen, das er vorgeschlagen hatte.
Als das Telefon klingelte, ließ er es viermal läuten. Beim fünften Mal nahm er fluchend ab. Offensichtlich puderte sich seine Sekretärin gerade mal wieder die Nase.
»Cameron Security.«
»Spreche ich mit Cameron persönlich?«
Royce erkannte die Stimme auf Anhieb. Der schottische Akzent war unverkennbar. »Richtig, Mr. MacGregor.«
»Das ist gut, hinter Ihnen bin ich her. Sie haben meine Enkelinnen kennengelernt.«
»Die Anlage ist eingebaut und funktioniert.« Und die Rechnung – saftig, saftig – war gestern rausgegangen. »Es ist die beste, die man mit Geld kaufen kann.«
»Davon gehe ich aus, Junge. Ich will, dass meine Frau wieder ruhig schlafen kann. Sie macht sich Sorgen.«
»Das sagten Sie bereits.«
»Und Sie haben die Anlage persönlich getestet?«
»Wie Sie gewünscht haben. Jeder Versuch, ins Haus einzudringen oder die Anlage außer Betrieb zu setzen, hat zur Folge, dass die nächste Streife alarmiert wird, und außerdem höre ich es auf meinem eigenen Piepser.«
»Gut, gut. Aber diese Mädchen müssen die Anlage natürlich auch einschalten. Sie sind jung, wissen Sie, und sie haben den Kopf voll mit ihrem eigenen Kram. Meine Frau macht sich Sorgen, dass sie vergessen könnten, sie einzuschalten.«
»Mr. MacGregor, ich kann Ihnen natürlich nur garantieren, dass die Anlage funktioniert, wenn sie in Betrieb ist.«
»Exakt, exakt. Deshalb habe ich Anna gerade heute Morgen gesagt, dass Sie alles getan haben, was Sie tun konnten. Aber sie hat sich das jetzt in den Kopf gesetzt und kommt einfach nicht mehr davon los. Ich habe mir gedacht, wir könnten die Anlage ja vielleicht noch einmal testen, einfach nur, um meine Frau zu beruhigen, verstehen Sie. Wenn Sie irgendwann vorbeifahren könnten, egal, um welche Uhrzeit, und einfach versuchen würden, ins Haus zu kommen …«
»Moment mal, bitte. Damit wir uns auch richtig verstehen – Sie bitten mich, in das Haus Ihrer Enkelinnen einzubrechen?«
»Nun ja, verstehen Sie, wenn Sie das schaffen, wüssten wir immerhin, dass etwas im Argen liegt. Und wenn nicht … na ja, dann könnte ich meine Frau beruhigen. Sie ist schon sehr alt«, fügte Daniel mit gesenkter Stimme und ein Adlerauge auf die Tür gerichtet hinzu. »Ich mache mir Sorgen um ihre Gesundheit. Aber natürlich bezahlen wir Ihnen Ihren Zeitaufwand und die Mühe.«
»Wissen Sie, was auf Einbruch steht, Mr. MacGregor?«
Daniel lachte dröhnend. Zweifellos hatte er da einen Prachtburschen für seine Laura ausgesucht. »Nun, Royce, ich bin mir sicher, dass Sie das als ehemaliger Polizist sehr gut selber wissen. Und Sie wissen auch, wie man es anstellt, sich nicht erwischen zu lassen. Im Übrigen wollte ich Ihnen auch noch sagen, dass ich mir überlege, hier bei uns im Haus ebenfalls ein neues Sicherheitssystem installieren zu lassen. Es ist ein großes Haus, und ich möchte nur das Beste. Geld spielt keine Rolle.«
Royce lehnte sich in seinen Stuhl zurück und betrachtete sinnend die Decke. »Versuchen Sie etwa, mich zu bestechen, Mr. MacGregor?«
»In der Tat, Mr. Cameron. Sind Sie ein einfallsreicher junger Mann?«
»Na sicher. Allerdings wird Sie das einiges kosten.«
»Was ist schon Geld im Vergleich mit unserem Seelenfrieden und der Sicherheit unserer Lieben?«
Royce kippelte mit seinem Stuhl und wartete einen Herzschlag lang. »Ich bin schon einer Menge durchtriebenen Leuten in meinem Leben begegnet, Mr. MacGregor, aber Sie sollten Unterricht geben.«
Daniel MacGregors dröhnendes Lachen hallte in Royces Ohr wider. »Gut, dann machen wir es so, wie wir gesagt haben, und wenn in Boston alles in Butter ist, rufen Sie mich an. Dann vereinbaren wir einen Termin, an dem Sie raufkommen und meine Alarmanlage auf den neuesten Stand bringen.«
Es würde ihm eine Menge Geld einbringen. Royce kalkulierte die Nullen, während er jetzt aus dem Mondlicht in den Schatten der großen alten Bäume huschte, die das Haus umgaben.
Er blieb stehen und schaute auf die dunklen Fenster. Es bereitete Royce kein Problem, wie ein Einbrecher zu denken. Er hatte während seiner Jahre bei der Polizei zahllose Einbrüche bearbeitet. Genau aus diesem Grund hatte er irgendwann beschlossen, ins private Sicherheitsgeschäft einzusteigen. Die meisten Leute hatten keine Ahnung, wie verletzlich sie waren, während sie in ihren Betten träumten.
Er näherte sich dem Haus wie ein Dieb, wobei er die Bäume und Büsche als Deckung benutzte. Die sorgsam geschnittene Hecke schirmte den gepflegten Garten vor nachbarschaftlichen Blicken und dem Verkehr auf der Straße ab.
Wenn er ein richtiger Einbrecher wäre, hätte er das Haus bereits genauestens unter die Lupe genommen, die Zugangsmöglichkeiten studiert und wie es gesichert war. Er wäre in Arbeitsklamotten gekommen, mit einem Klemmbrett unterm Arm und bei hellem Tageslicht. Niemand hätte ihn beachtet. Stattdessen aber war er jetzt mitten in der Nacht hier, auf die »Bitte« eines vorsichtigen und überängstlichen Schotten hin.
Er würde ziemlich schnell erkennen, dass die Alarmanlage hochempfindlich war. Natürlich nur, wenn er solide elektronische Kenntnisse hätte, und Royce hatte, um sich in Stimmung für den Job zu bringen, entschieden, dass er ein Einbrecher mit einem Abschluss in Elektronik war.
Fünfzehn Minuten später trat er einen Schritt zurück und kratzte sich am Kinn. Er war verdammt gut. Als Einbrecher nicht ganz so gut wie als Sicherheitsexperte. Die Alarmanlage war nahezu idiotensicher. Wenn er sie nicht selbst entworfen hätte, würde er es niemals schaffen, die vielfältigen Sicherungen und Fallen, die er eingebaut hatte, kurzzuschließen.
Doch da die Anlage von ihm selbst stammte, würde er ins Haus gelangen – falls er es wollte –, wenn er sich noch etwa zehn Minuten weiter so anstrengte. Ein Einbrecher allerdings musste schon sehr entschlossen und findig sein und obendrein noch eine gute Portion Glück mitbringen, um so weit zu kommen. Der Große MacGregor konnte beruhigt schlafen, so viel konnte er jetzt schon sagen.
Er wollte sich eben befriedigt zurückziehen, als ein Licht aufflammte. Auf der anderen Seite der Atriumtür stand deutlich sichtbar Laura MacGregor in einem leuchtend gelben T-Shirt, das ihr bis zum halben Oberschenkel reichte, und einem Louisville-Schläger in der Hand.
Er beobachtete, wie ihr der Mund offen stehen blieb, als sie ihn erkannte. Ihre Augen schleuderten wütende Blitze.
»Was, zum Teufel, tun Sie hier?«
Ihre Stimme klang gedämpft durch die Scheibe, aber er konnte sie verstehen. »Kontrolle«, antwortete er laut. »Auf Kundenwunsch.«
»Ich habe keine Kontrolle angefordert.«
»Aber Ihr Großvater.«
Er sah, wie sich diese wütenden Augen verengten, sah, wie ihre Finger den Griff des Schlägers fester umklammerten, bereit, ihn zu schwingen. Dann wirbelte sie herum, wobei sie ihm einen atemberaubenden Blick auf die volle Länge ihres Oberschenkels gewährte, und schnappte sich das Telefon.
Royce kratzte sich wieder am Kinn, seine Finger strichen gedankenverloren über den Rand der Narbe. Wenn sie vorhatte, die Cops zu rufen, würde er eine Menge Erklärungen abgeben müssen. Er hatte genug Freunde bei der Polizei, um das Schlimmste zu verhüten, aber er wusste, dass dieselben Freunde keine Scheu haben würden, ihn zu ihrer Belustigung über Nacht in eine Zelle zu sperren.
Die Kosten für die Kontrolle verdoppelten sich.
Einen Moment später knallte Laura den Hörer auf die Gabel. Sie marschierte zur Kontrolltafel der Alarmanlage, gab den Code ein, dann schloss sie die Tür auf.
»Ihr seid beide Vollidioten, Sie und mein Großvater.«
»Sie haben den Großen MacGregor angerufen.«
»Natürlich habe ich das. Denken Sie vielleicht, ich glaube Ihnen auch nur ein Wort, wenn Sie mitten in der Nacht in schwarzen Einbrecherklamotten und Einbruchswerkzeugen draußen auf meinem Rasen stehen? Eigentlich sollte ich Ihnen aus Prinzip damit eins überbraten«, sagte sie, während sie den Schläger gegen die Wand lehnte.
»Ihre Selbstbeherrschung ist bemerkenswert.« Sein Grinsen blitzte auf, in seinen Augen tanzten Fünkchen der Belustigung. »Dafür kann Ihre Großmutter jetzt wenigstens wieder ruhig schlafen.«
»Meine Großmutter schläft immer ruhig. Es ist er.« Verzweifelt warf sie die Hände in die Luft. Die Bewegung bewirkte, dass das T-Shirt gefährlich hochrutschte. »Der Mann bleibt die ganze Nacht wach und sinnt darüber nach, wie er unser Leben verkomplizieren könnte. Es gehört zu seinen vornehmsten Zielen, seine Familie in den Wahnsinn zu treiben. Aber immerhin erfüllt es mich mit Genugtuung zu wissen, dass seine Ohren für den Rest der Nacht klingeln werden.«
»Haben Sie ihm tüchtig eingeheizt?« Royce nutzte die Situation lächelnd zu seinem Vorteil aus und kam näher. »Wenn Sie im Bett gewesen wären, wie das um diese Zeit eigentlich üblich ist, hätten Sie von meiner Anwesenheit nie etwas erfahren. In den nächsten zwei Minuten wäre ich weg gewesen.« Er streckte die Hand aus, um mit den Spitzen ihrer Haare zu spielen, die wie ein weicher schwarzer Vorhang über ihren Ellbogen lagen. »Warum schlafen Sie denn noch nicht?«
»Ich hatte Hunger«, brummte sie.
»Ich auch.« Er ging noch ein bisschen näher heran und entschied, dass das Schicksal den Sessel genau dorthin gestellt hatte, um sie davor zu bewahren, zurückzuweichen. »Was gibt’s denn zu essen?«
Ihr Herz hämmerte jetzt gegen ihre Rippen. Die geschwungene Lehne des Armsessels presste sich in ihren Rücken. Er sah im Augenblick mehr als gefährlich aus. Mit diesen heißblütigen Augen, diesem verruchten Lächeln sah er absolut tödlich aus. Er sah … sehr verführerisch aus. »Hören Sie, Kumpel …«
»Ich laufe Ihnen anscheinend immer in die Arme, wenn Sie Schlafzeug anhaben.« Er ließ seinen Blick träge über sie hinwegwandern, bevor er sie wieder anschaute und seine Hände rechts und links von ihr auf die Lehne des Sessels hinter ihr legte. »Glauben Sie nicht, dass es ein bisschen zu viel verlangt ist, wenn Sie erwarten, dass ich jetzt so einfach wieder gehe?«
Ihre Haut fing an zu kribbeln. »Ich erwarte, dass Sie ein Nein akzeptieren.«
»Wirklich?« Er beugte sich vor, nur ein kleines bisschen, ihre Körper streiften sich ganz leicht, sein Atem strich wie eine Feder über ihren Mund. »Ich wäre bereit zu schwören, dass Sie damit gerechnet haben.«