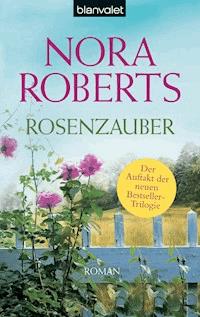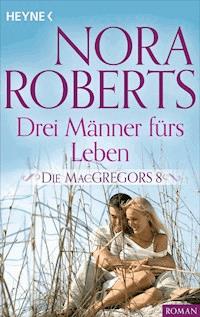
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die MacGregor-Serie
- Sprache: Deutsch
Familie, Liebe, Leidenschaft: Der faszinierende MacGregor-Clan
Ein Mann muss heiraten, um das Glück zu finden – glaubt Daniel MacGregor. Seine drei Enkel sehen das ganz anders. Sie wollen die Ehe möglichst lange vermeiden. Das denken die drei Cousins zumindest, bis Duncan, DC und Ian plötzlich drei höchst verführerische Frauen treffen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Layne, eine beeindruckende Geschäftsfrau; Cat, die faszinierende Sängerin und die junge Naomi, die gerade das Leben entdeckt. Sie wissen nicht, dass ihr Großvater Daniel seine Finger im Spiel hat, wenn es um das Liebesglück in seiner Familie geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Nora Roberts
Die MacGregors 8
Drei Männer fürs Leben
Roman
Aus dem Amerikanischen von Emma Luxx
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
AUS DEN TAGEBÜCHERN DES DANIEL DUNCAN MACGREGOR
In meinem Alter fliegt die Zeit dahin, die Jahreszeiten jagen sich. Man sollte jeden Augenblick bis zur Neige auskosten.
Aber natürlich habe ich bereits mit dreißig genauso gedacht!
In den letzten Jahren konnte ich erleben, wie vier meiner geliebten Enkelkinder Liebe gefunden, geheiratet und Familien gegründet haben. Erst Laura, dann Gwen; Julia, dann Mac. Ihre Augen strahlen vor Glück, in ihren Stimmen schwingt Zufriedenheit mit. Sie haben sich alle ein Haus gebaut und sich ein Leben mit dem Gefährten ihres Herzens eingerichtet.
Aber warum haben sie bloß so verdammt lange dazu gebraucht, frage ich euch.
Ha! Wenn ich nicht gewesen wäre, würden sie sich immer noch allein durchs Leben wursteln, und Anna hätte kein einziges Urenkelkind zum Knuddeln und Verwöhnen. Aber erwarte ich etwa Dankbarkeit? Weit gefehlt. Solange ich das Oberhaupt dieser Familie bin, tue ich meine Pflicht, ohne ein Dankeschön zu verlangen. Es ist mir Freude und Verpflichtung zugleich, dafür zu sorgen, dass meine Küken bequem – und angemessen – auf der Stange hocken.
Man sollte eigentlich meinen, dass sich die anderen Enkelkinder beim Anblick all dieses ehelichen Glücks um sie herum besinnen und dem Beispiel ihrer Geschwister, Cousinen und Cousins folgen würden. Aber nein, die MacGregors sind ein sturer und unabhängiger Haufen. Und Gott segne sie dafür.
Doch zum Glück bin ich ja noch da, um die Dinge ins Lot zu bringen. Ich sah drei meiner Enkeltöchter vor den Altar treten und gab meinem ersten Enkelsohn einen unauffälligen Schubs in die richtige Richtung. Manche behaupten, es wäre Einmischung gewesen. Ha! Ich nenne es Weisheit. Und jetzt habe ich beschlossen, dass es Zeit ist, meinem Enkel und Namensvetter, Daniel Campbell MacGregor, eine Prise Weisheit zu verabreichen.
Er ist ein feiner Junge mit einem messerscharfen Verstand, auch wenn er ein paar Mucken hat. Und er sieht gut aus, ein bisschen so wie ich in dem Alter. Deshalb fehlt es ihm nicht an weiblicher Gesellschaft. Was in meinen Augen Teil des Problems ist. Zu viel Quantität und nicht genug Qualität.
Wir müssen einen Weg finden, dieses Problem zu lösen.
D. C. ist Künstler. Ein Maler. Auch wenn ich bei der Hälfte seiner Bilder beim besten Willen nicht sagen könnte, was ich da eigentlich sehe, hat er großen Erfolg mit seiner Arbeit. Was der Junge jetzt braucht, ist eine Frau, die diesen Erfolg mit ihm teilt und ihm Kinder schenkt, damit sein Leben einen Mittelpunkt bekommt.
Aber natürlich nicht irgendeine Frau, sondern eine mit Rückgrat, die klug ist und ehrgeizig … und einem anständigen Stammbaum. Nämlich die Frau, die ich schon für ihn ausgesucht hatte, als die beiden noch Kinder waren. Ich habe mich bis jetzt in Geduld geübt, weil es wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Schließlich kenne ich den Jungen und weiß ihn zu nehmen.
Ein bisschen verdreht ist er schon, mein D. C. Der Typ Mann, der oft links abbiegt, wenn man ihm sagt, dass er besser rechts abbiegen sollte. Ich nehme an, es kommt von den acht Jahren in seiner Kindheit, als sein Vater unser Staatsoberhaupt war und es für ihn so ungeheuer viele Regeln gab, die er befolgen musste.
Nun, mit etwas Hilfe von einer guten alten Freundin werden wir es schon schaffen, dem jungen Daniel Campbell einen kleinen Schubs in die richtige Richtung zu geben – und ihn denken lassen, dass er das alles allein entschieden hat.
Ein weiser Mann braucht kein Dankeschön. Nur die richtigen Resultate.
TEIL EINS D. C.
1. KAPITEL
Licht strömte durch die hohen Fenster ins Zimmer, überflutete die saphirblauen und rubinroten Farbkleckse und den Mann, der gleich einem Kämpfer vor der Leinwand stand und seinen Pinsel wie ein zweischneidiges Langschwert führte.
Er hatte das energische Gesicht eines Kriegers, mit ausgeprägten Zügen, hohen Wangen und einem Mund, der zwar voll, aber jetzt vor Konzentration fest zusammengepresst war. Die Augen unter den zusammengezogenen dunklen Brauen waren von einem strahlend hellen Blau.
Sein Haar fiel ihm über die Ohren und ringelte sich über dem Kragen des mit Farbklecksen übersäten Jeanshemds, das er statt eines Kittels trug. Die Ärmel waren hochgekrempelt, sodass man das Spiel der gut entwickelten Muskeln sehen konnte, während er mit dem Pinsel die Farbe auf die Leinwand brachte.
Er besaß auch die Statur eines Kriegers, mit breiten Schultern, schmalen Hüften und langen Beinen. Seine Füße waren nackt und seine großen Hände mit Farbe beschmiert.
Vor seinem geistigen Auge spielten sich Gefühlsausbrüche ab – Leidenschaft und Lust, Begierde und Verlangen. Und all das brachte er auf die Leinwand, während der Fußboden unter dem ohrenbetäubenden Lärm der Rockmusik, die aus den Boxen der Stereoanlage dröhnte, erbebte.
Jedes Gemälde war für ihn eine Schlacht, eine, die zu gewinnen er entschlossen war. Wenn er in der richtigen Stimmung war, arbeitete er, bis sein Arm schmerzte und er die Finger nicht mehr bewegen konnte. War er nicht in der richtigen Stimmung, kam es vor, dass er der Leinwand für Tage, wenn nicht gar für Wochen den Rücken kehrte.
Es gab Leute, die behaupteten, D. C. MacGregor mangele es an Disziplin. Die fragte er grundsätzlich, was, zum Teufel, er mit Disziplin solle.
Plötzlich blitzten seine Augen triumphierend auf. Dann klemmte er sich den Pinsel zwischen die Zähne und griff nach einem Palettenmesser, um ein kühnes Smaragdgrün aufzutragen.
Jetzt hatte er es. Die Schlacht war fast geschlagen. Der Schweiß lief ihm in Rinnsalen über den Rücken. Die Sonne, die glühend heiß durch die Scheiben schien, verwandelte das Atelier in einen Backofen, weil er wieder einmal vergessen hatte, die Klimaanlage einzuschalten oder ein Fenster zu öffnen, um die frische Frühlingsluft hereinzulassen.
An Mahlzeiten hatte er ebenso wenig gedacht wie daran, seine Post heraufzuholen, seine Anrufe entgegenzunehmen oder einen Blick aus den herrlich großen Fenstern seines Apartments zu werfen. Aber die Lust am Malen packte ihn stets so plötzlich und heftig, dass er darüber alles andere vergaß.
Als D. C., den Pinsel noch immer wie ein Piratenmesser zwischen die Zähne geklemmt und das Palettenmesser wie einen Dolch in der Hand haltend, einen Schritt von der Leinwand zurücktrat, verzog sich sein entschlossener, leicht bedrohlich wirkender Mund zu einem Lächeln.
»Das ist es«, murmelte er, nahm den Pinsel aus dem Mund und stellte ihn in ein Glas mit Terpentin. Dann begann er mit mechanischen Bewegungen das Messer zu säubern, während er sein Werk studierte. Dringlichkeit, entschied er. Ja, er würde es einfach »Dringlichkeit« nennen.
Jetzt erst fiel ihm auf, wie stickig es im Zimmer war und dass die vertrauten Gerüche von Terpentin und Farben schwer in der Luft hingen. Er ging über den rohen Holzfußboden zu einem der Fenster, schob es hoch und atmete tief die frische Luft ein.
Die großen Fenster mit dem Blick auf den C&O Canal waren es gewesen, die ihn veranlasst hatten, diese Wohnung zu kaufen, nachdem er sich entschieden hatte, wieder nach Washington zurückzukehren. Er war hier aufgewachsen und hatte acht Jahre seines Lebens als Sohn des Präsidenten im Weißen Haus verbracht.
Er hatte ein paar Jahre in New York gelebt und gearbeitet, und er hatte sie genossen. Auch in San Francisco hatte er gelebt und gearbeitet, und er hatte es ebenfalls genossen. Und doch hatte während der rastlosen Zeit zwischen zwanzig und dreißig immer irgendetwas an ihm gezerrt. Heimweh.
Washington war sein Zuhause.
Die Hände in den Taschen seiner verschlissenen Jeans, lehnte er am Fenster und blickte hinaus. Die Kirschbäume standen in voller Blüte, der Kanal glitzerte in der Nachmittagssonne, Jogger trabten den Pfad am Wasser entlang.
Während D. C. einen Moment müßig darüber nachdachte, welcher Wochentag wohl heute sein mochte, merkte er plötzlich, dass er kurz vor dem Verhungern stand. Ohne die Musik abzustellen, die noch immer auf voller Lautstärke lief, ging er hinunter in die Küche.
Das Penthouse erstreckte sich über zwei Ebenen, wovon die obere als Schlafzimmer vorgesehen war. Dort hatte er sich allerdings sein Atelier eingerichtet, während er auf einer Matratze auf dem Boden im angrenzenden Gästezimmer schlief. Er war bisher noch nicht dazu gekommen, sich nach einem richtigen Bett umzuschauen.
Die meisten seiner Sachen steckten noch in den Umzugskartons, mit denen sie vor fast zwei Monaten angekommen waren. Dort waren sie seiner Meinung nach gut aufgehoben, bis er die Zeit fand, sich einen Schrank zu besorgen.
Auf der unteren Ebene lag das weiträumige Wohnzimmer mit Fenstern nach allen Seiten, die noch keine Vorhänge hatten. In der Mitte stand eine einsame Couch – das Preisschild hing noch daran – und ein wunderschöner Duncan-Phyfe-Tisch mit einer daumendicken Staubschicht darauf sowie eine Stehlampe mit einem eingedellten Metallschirm. Der Kiefernholzboden war hier ebenfalls nackt und musste dringend gesaugt werden.
Die Essnische, die von der Küche abging, war leer, die Küche selbst ein einziges Tohuwabohu. Die wenigen Teller und Töpfe, die sich nicht verdreckt in der Spüle türmten, befanden sich auch noch in den Kartons. Er ging geradewegs zum Kühlschrank und war höchst überrascht, diesen bis auf drei Flaschen Bier, eine Flasche Wein und zwei Eier leer vorzufinden.
Er wäre bereit gewesen zu schwören, dass er eingekauft hatte.
Eine gründliche Durchforstung der Schränke förderte ein paar Scheiben verschimmeltes Brot, eine Tüte Kaffee, sechs Schachteln Cornflakes und eine Dose Suppe zutage.
Resigniert riss er eine Packung Cornflakes auf und stopfte sich eine Handvoll in den Mund, während er mit sich rang, ob ihm der Sinn eher nach einer Tasse Kaffee oder einer Dusche stand. Er hatte eben beschlossen, sich Kaffee zu machen und ihn mit unter die Dusche zu nehmen, da klingelte das Telefon.
Er registrierte ohne großes Interesse, dass das Lämpchen des Anrufbeantworters blinkte, und nahm, auf den trockenen Cornflakes herumkauend, den Hörer ab.
»Hallo.«
»Da ist ja mein Junge.«
Der eisige Blick wurde warm, der harte Mund weich. D. C. lümmelte sich gegen den Tresen und grinste. »He, Grandpa, was führst du denn diesmal wieder im Schilde?«
»Manche würde sagen, nichts Gutes«, erwiderte Daniel mit dröhnender Stimme. »Hörst du deinen Anrufbeantworter eigentlich nie ab? Ich habe dir in den letzten Tagen mindestens ein Dutzend Mal auf diese verdammte Maschine gesprochen. Deine Großmutter wollte schon das nächste Flugzeug nehmen, um sich davon zu überzeugen, dass du nicht tot im Bett liegst.«
D. C. hob nur eine Augenbraue. Es war eine allseits bekannte Tatsache, dass Daniel seine stets heiter gelassene Ehefrau vorschob, wenn er seine Enkel nerven wollte. »Ich habe gearbeitet.«
»Lobenswert. Das ist wirklich sehr lobenswert, mein Junge, aber ab und zu kannst du auch mal eine kleine Verschnaufpause einlegen, oder?«
»Das mache ich gerade.«
»Und jetzt zu meinem Anliegen. Ich wollte dich bitten, mir aus der Patsche zu helfen. Es fällt mir nicht leicht, glaub mir.« Der schwere Seufzer, den Daniel ausstieß, veranlasste seinen Enkel, besorgt die Stirn zu runzeln.
»Worum geht es denn?«
»Es wird dir nicht gefallen, und Gott weiß, dass ich dir das nicht verübeln kann. Aber ich stecke wirklich in der Klemme. Deine Tante Myra …«
»Ist alles in Ordnung mit ihr?« D. C. richtete sich kerzengerade auf. Myra Ditmeyer war die älteste und beste Freundin seiner Großmutter, zudem seine heiß geliebte Patentante und ein hoch geschätztes Mitglied des MacGregor-Clans. D. C. verehrte sie und erinnerte sich jetzt schuldbewusst daran, dass er sich noch kein einziges Mal bei ihr gemeldet hatte, seit er wieder in Washington war.
»Oh, ihr geht es prächtig, Junge. Mach dir um sie keine Sorgen. Die Frau ist munter wie ein Fisch im Wasser. Aber … nun, sie hat außer dir noch ein Patenkind. Ich weiß nicht, ob du dich an das Mädel erinnern kannst. Du hast sie als Junge ein- oder zweimal gesehen. Layna Drake, sagt dir der Name etwas?«
Es dauerte eine Weile, dann erschien vor D. C.s geistigem Auge das Bild eines mageren kleinen Mädchens mit Haaren, so flauschig wie eine Pusteblume. »Was ist mit ihr?«
»Sie ist wieder in Washington. Du kennst die Drakes – die Kaufhauskette. Das ist ihre Familie. Sie arbeitet jetzt in der Hauptfiliale, und Myra … Nun, am besten rede ich nicht lange um den heißen Brei herum. Morgen Abend findet ein Wohltätigkeitsball statt, und Myra ist völlig am Boden zerstört, weil das Mädchen keine Begleitung hat. Deshalb hat sie mich gebeten, dich zu fragen, ob du …«
»Verdammt, Grandpa.«
»Ich weiß, ich weiß.« Daniel seufzte leidgeprüft. »So sind sie nun mal, die Frauen. Junge, was soll ich dazu noch sagen? Sie zerren so lange an einem herum, bis man nachgibt. Jetzt habe ich ihr versprochen, dich zu fragen, ob du Layna vielleicht begleiten würdest. Du tätest mir wirklich einen riesigen Gefallen, wenn du dich dazu aufraffen könntest. Nur dieses eine Mal.«
»Verflucht noch mal, Grandpa, wenn das wieder so eine abgekartete Sache ist …«
Daniel unterbrach ihn mit einem herzhaften Lachen. »Diesmal nicht, Junge. Dieses Mädchen ist nichts für dich, glaub mir. Sie ist zwar recht hübsch und hat gute Manieren, aber dein Typ ist sie ganz bestimmt nicht. Zu kühl und ein bisschen zu hochnäsig. Nein, nein, es würde mir gar nicht gefallen, wenn du in so eine Richtung schielst. Und wenn du dich morgen nicht freimachen kannst, sage ich Myra einfach, dass du schon etwas anderes vorgehabt hättest.«
»Morgen Abend?« D. C. fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. Er hasste Wohltätigkeitsveranstaltungen. »Krawattenzwang?«
»Ich fürchte, ja.« Als Daniel darauf einen gebrummten Fluch hörte, gab er einen mitfühlenden Laut von sich. »Hör zu, ich rufe Myra gleich zurück und sage ihr, dass es dir schrecklich leidtut, du aber nicht kannst. Schließlich gibt es keinen Grund für dich, einen ganzen Abend mit einem Mädchen zu verschwenden, das dich zu Tode langweilen würde, oder? Ich bezweifle, dass ihr auch nur ein einziges gemeinsames Interesse habt. Du solltest lieber endlich anfangen, dich nach einer richtigen Frau umzuschauen. Es wird Zeit, dass du heiratest und ein geregeltes Leben führst, Daniel Campbell. Höchste Zeit. Deine Großmutter macht sich schon Sorgen, dass du eines Tages noch als einsamer alter Mann in deinem Atelier verhungerst. Ich wüsste da auch schon ein Mädchen. Sie ist …«
»Ich mach es.« Die Entscheidung war reiner Reflex. Wenn Daniel nicht allzu viel von Myras Patentochter hielt, bedeutete das zumindest, dass er sich nicht alle naselang ans Telefon hängen würde, um sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen. Vielleicht würde sein Großvater ja in seinen unermüdlichen Bemühungen, seine Dynastie zu erweitern, nachlassen, nachdem er, D. C., ihm diesen Gefallen getan hatte. Einen Versuch war es immerhin wert, obwohl D. C. sich keine sehr großen Hoffnungen machte. »Um wie viel Uhr denn morgen, und wo soll ich diese, wie auch immer sie heißt, abholen?«
»Oh, Gott segne dich. Für diesen Gefallen schulde ich dir etwas. Die Sache steigt um acht im Shoreham Hotel. Am besten holst du Layna in ihrem Elternhaus in der O Street ab.« Daniel rasselte die Adresse herunter. »Ich bin dir wirklich zutiefst dankbar, dass du mir aus der Patsche geholfen hast, D. C.«
D. C. zuckte nur die Schultern und schüttete sich direkt aus der Packung einige Cornflakes in den Mund. Während er dann mit Daniel noch Familienklatsch austauschte, fragte er sich flüchtig, wo, zum Teufel, er seinen Smoking hingepackt hatte.
»Oh, Tante Myra, wirklich.« Über dem Arm einen Traum von fließender weißer Seide, stand Layna Drake in ihrer Unterwäsche da und machte ein peinlich berührtes Gesicht. »Ein Blind Date?«
»Nicht wirklich, Schätzchen.« Myra lächelte beruhigend. »Du hast ihn früher schon einmal getroffen … da wart ihr beide allerdings noch Kinder. Ich weiß, dass es eine Zumutung für dich ist, aber Daniel bittet mich so selten um etwas. Und es ist ja nur ein Abend. Außerdem wolltest du ja sowieso auf den Ball gehen.«
»Ja, aber mit dir.«
»Ich komme doch trotzdem mit. Er ist wirklich ein sehr netter junger Mann, Schätzchen. Ein bisschen reizbar vielleicht, aber trotzdem sehr nett.« Sie strahlte. »Natürlich sind alle meine Patenkinder wundervolle Menschen.«
Myra behielt ihr Lächeln bei, als sie sich hinsetzte und ihre Patentochter musterte. Myra war eine kleine, quirlige Frau mit Haaren, so weiß und weich wie frisch gefallener Schnee, und einem Verstand, der so schnell und scharf sein konnte wie ein Klappmesser. Doch wenn die Situation es erforderte – und das tat sie jetzt –, schaffte sie es, sich mit einer Aura von Zerbrechlichkeit und Hilflosigkeit zu umgeben, die jedermann zu Herzen ging. Ja, ja, die betagte Witwe Ditmeyer, dachte sie amüsiert.
»Daniel macht sich Sorgen um ihn«, fuhr sie fort. »Und ich auch. Der Junge kommt einfach zu selten unter Leute. Aber mal ehrlich, wer hätte denn gedacht, dass Daniel auf so eine Idee kommen würde, als ich ganz nebenbei erwähnte, dass du wieder in Washington seist und vorhättest, auf diesen Ball zu gehen? Ich war einfach …«, Myras Hände flatterten hilflos, »… perplex. Ich schaffte es nicht, ihm seine Bitte abzuschlagen. Obwohl ich mir darüber klar bin, dass es eine Zumutung für dich ist.«
Weil ihre heiß geliebte Patentante plötzlich so unglücklich dreinschaute, gab Layna ihrem Herzen einen Stoß. »Na gut. Ich wollte ja sowieso hingehen.« Mit graziösen Bewegungen stieg sie in ihr Abendkleid. »Kommt er direkt ins Hotel?«
»Nein. Oje!« Myra warf einen Blick auf ihre Uhr und erhob sich. »Er wird gleich hier sein, um dich abzuholen. Wir treffen uns dann auf dem Ball. Du liebe Güte, wie die Zeit verfliegt. Mein Fahrer denkt bestimmt schon, mir wäre etwas passiert.«
»Aber …«
»Wir sehen uns dann in ungefähr einer Stunde, Schätzchen«, sagte Myra, während sie, überraschend flink für eine Frau ihres Alters, zur Tür eilte. »Übrigens, du siehst wundervoll aus«, bemerkte sie noch, ehe sie das Zimmer verließ.
Layna stand in dem am Rücken noch offenen Kleid da und atmete laut aus. Typisch, dachte sie. Das war doch wirklich wieder einmal typisch. Ihre Patentante konnte es einfach nicht lassen, ihr ständig irgendwelche Heiratskandidaten auf einem Silbertablett zu servieren, wobei ihr die manchmal höchst unangenehme Aufgabe blieb, diese so elegant wie möglich wieder loszuwerden.
Die Ehe war etwas, das sie entschieden aus ihrem Lebensplan gestrichen hatte. Layna, die in einem Elternhaus aufgewachsen war, in dem gute Manieren mehr zählten als Liebe und man über gelegentliche Affären höflich hinwegsah, hatte nicht den leisesten Wunsch, sich eines Tages in einer ähnlich gearteten Beziehung wiederzufinden.
Männer eigneten sich gut zur Dekoration, solange sie selbst es war, die die Show leitete. Und im Augenblick war ihr ihre Karriere weitaus wichtiger als Verabredungen an einem Samstagabend.
Sie hatte vor, auf der Leiter des Erfolgs in ihrem Familienunternehmen weiter emporzuklettern, und wenn alles nach Plan lief, würde sie in zehn Jahren ganz oben angelangt sein.
Noch eine Show, die sie zu leiten gedachte.
»Drake’s« war nicht nur eine exklusive Ladenkette, sondern eine Institution. Solange Layna Single war und das auch blieb, konnte sie ihre ganze Zeit und Energie darauf verwenden, den Ruf und den Stil der Firma zu erhalten und sogar noch auszubauen.
Sie war nicht wie ihre Mutter, die »Drake’s« als ihren persönlichen Kleiderschrank betrachtete. Oder wie ihr Vater, dem der Profit immer mehr am Herzen gelegen hatte als innovative Ideen oder Traditionen, die es zu erhalten galt. Sie war sie selbst.
Und ihr war »Drake’s« sowohl Freude wie auch Verpflichtung. Die Ladenkette war, wie sie glaubte, ihre wahre Familie.
Manche mochten das vielleicht traurig finden, aber sie fand es tröstlich.
Sie griff hinter sich und schloss mit einer schnellen Bewegung den Reißverschluss. Zu ihrer Verantwortung »Drake’s« gegenüber gehörte es auch, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen und an einer Wohltätigkeitsveranstaltung wie dieser teilzunehmen. Von einer Art der Arbeit auf die andere umzuschalten bedeutete für sie etwa so viel, wie beim Fahren den Gang zu wechseln. Disziplin hatte sie sich bereits in ihrer frühesten Kindheit antrainiert, und mittlerweile war sie ihr zur zweiten Natur geworden.
Und ihr Job erforderte hin und wieder eine angemessene Herrenbegleitung.
Immerhin schienen bei ihrer Tante Myra diesmal keine Hintergedanken im Spiel zu sein. Es würde ihr ein Leichtes sein, mit einem praktisch Fremden einen Abend lang Konversation zu machen. Darin war sie Expertin.
Sie drehte sich um und nahm die tropfenförmigen brillantbesetzten Perlenohrringe von der antiken Ankleidekommode. Dieses Möbelstück, wie auch die gesamte Einrichtung ihres Schlafzimmers, spiegelte ihren Geschmack wider – schlichte Eleganz, gewürzt mit einer hauchfeinen Prise Extravaganz. Die Kopfseite des ebenfalls antiken Bettes aus Kirschholz war mit wunderschönen Holzschnitzereien verziert, und die dazu passenden Konsolen mit den spiegelblank polierten Platten schmückten frische Blumen und sorgfältig ausgesuchte Accessoires.
Das ist jetzt dein Heim, dachte sie mit leisem Stolz. Sie hatte das Haus ihrer Eltern zu ihrem Heim gemacht.
Vor einem kleinen Marmorkamin stand eine gemütliche Sitzecke und rechts davon ein zierlicher Frisiertisch, auf dem sich eine Kollektion kühn geformter Parfümflakons reihte.
Sie ging zu dem Tischchen, nahm eine Flasche mit ihrem Duft und tupfte sich gedankenverloren zwei Tropfen hinters Ohr, während sie sich für einen Augenblick – für einen ganz kurzen Augenblick nur – gestattete, sich nach einem ruhigen Abend zu Hause zu sehnen. Sie hatte einen Zehnstundentag bei »Drake’s« hinter sich. Ihre Füße schmerzten, sie war müde, und ihr Magen war leer.
Sie schob den Gedanken schnell beiseite und stellte sich vor den großen Garderobenspiegel, um den Sitz ihres Abendkleids zu überprüfen. Es fiel von der Büste kerzengerade bis zu den Knöcheln hinab und ließ die Schultern frei. Zufrieden mit sich schlüpfte sie noch in das dazugehörige kurze Jäckchen, zog ihre hochhackigen Pumps an und warf einen schnellen Blick in ihr Abendtäschchen.
Als es an der Haustür klingelte, seufzte sie nur ein einziges Mal. Zumindest war er pünktlich.
Sie erinnerte sich an D. C. vage aus ihrer Kindheit. Sie war damals zu aufgeregt und beeindruckt gewesen, dem Präsidenten zu begegnen, um sonst noch auf irgendetwas anderes zu achten. Aber sie hatte in den darauffolgenden Jahren ab und zu von ihm gehört.
Ein Künstler, dachte sie, während sie die Treppe nach unten ging. Ein Maler der modernen Schule, die zu verstehen sie nicht vorgab. Layna bevorzugte in allen Dingen das Klassische. Hatte es um ihn nicht vor ein paar Jahren einen Skandal wegen einer Balletttänzerin gegeben? Oder war es eine Schauspielerin gewesen?
Nun ja, es war anzunehmen, dass der Sohn des früheren Präsidenten mit fast allem, was er tat, das Interesse der Sensationspresse auf sich zog, auch wenn es noch so banal war. Und die Tatsache, dass er der Enkel von Daniel MacGregor war, steigerte diese öffentliche Anteilnahme noch. Layna hatte mehr Glück, weil sie hinter den Kulissen arbeitete.
Und da er es nicht einmal geschafft hatte, für den Abend eine geeignete Begleitung aufzutreiben, konnte er bei der Damenwelt ja wohl kaum so ein Hit sein.
Sie setzte ihr für gesellschaftliche Anlässe reserviertes Lächeln auf und öffnete die Tür. Nur die Jahre der strengen Erziehung in einer schweizerischen Klosterschule bewahrten sie davor, dass ihr im nächsten Moment die Kinnlade herunterfiel.
Dieser Mann, der da höchst bedrohlich vor ihr aufragte, mit der schwarzen Krawatte, dem Haar, das die Farbe ihres wertvollen Mahagoni-Esszimmertischs hatte, und den Augen, die so blau und durchdringend waren wie Laserstrahlen, brauchte seinen Großvater, um eine Frau zu finden, die bereit war, mit ihm auszugehen?
»Layna Drake?« Du musst im falschen Haus gelandet sein, war alles, was D. C. denken konnte. Diese in weiße, schimmernde Seide gehüllte, äußerst attraktive Frau hatte nicht die entfernteste Ähnlichkeit mit dem mageren kleinen Mädchen von damals. Und das glatte Haar, das ein ebenmäßiges Gesicht umrahmte, hatte nichts von einer Pusteblume, sondern mutete eher wie gesponnenes Gold an. Ihre Augen hatten ein weiches, verschleiertes Grün.
Sie erholte sich rasch, und ihr routiniert höfliches Lächeln zitterte kein bisschen, als sie ihm eine Hand reichte. »Ja. Daniel MacGregor?«
»D. C. bitte. Daniel ist mein Großvater.«
»Na schön, dann D. C.« Normalerweise hätte sie ihn hereingebeten und für kurze Zeit die Gastgeberin gespielt, um ihnen beiden die Gelegenheit zu geben, miteinander warm zu werden. Aber sie fühlte sich nicht hundertprozentig sicher in seiner Gegenwart. Er war für ihren Geschmack ein wenig zu groß, zu männlich, und diese Augen blickten viel zu dreist. Entschlossen trat sie aus dem Haus und zog die Tür hinter sich zu. »Mit welchem Wagen fahren wir?«
»Mit meinem.« Kühl, hatte sein Großvater gesagt, und D. C. stellte fest, dass der Alte damit ins Schwarze getroffen hatte. Definitiv eine Eisprinzessin, trotz ihres atemberaubenden Äußeren. Es würde ein verflucht langer Abend werden.
Layna warf einen Blick auf den niedrigen Sportwagen, der am Straßenrand parkte, und fragte sich, wie, zum Teufel, sie sich in ihrem langen Abendkleid da wohl hineinquetschen sollte.
Tante Myra, dachte sie, was hast du mir da bloß eingebrockt?
2. KAPITEL
Sie fühlte sich wie mit einem Riesen in eine Sardinenbüchse eingesperrt. Der Mann war mindestens eins neunzig groß. Aber er hatte kein Problem, das Spielzeugauto mit Höchstgeschwindigkeit durch den regen Washingtoner Verkehr zu steuern.
Layna klammerte sich mit einer Hand an den gepolsterten Haltegriff an ihrer Tür, überprüfte mit der anderen den Sitz ihres Sicherheitsgurts und betete, nicht wie ein Insekt an der Windschutzscheibe zerquetscht zu werden, noch ehe der Abend begonnen hatte.
Ein bisschen Konversation würde sie vielleicht von dieser nicht sehr angenehmen Vorstellung ablenken.
»Tante Myra hat mir erzählt«, begann sie, »dass wir uns vor Jahren, als Ihr Vater noch Präsident war, schon einmal begegnet sind.« Das letzte Wort endete in einem spitzen Schreckensschrei, weil er den Wagen in die winzige Lücke zwischen einem Bus und einer Limousine quetschte.
»Das habe ich auch gehört. Sie sind erst vor Kurzem wieder nach Washington gezogen?«
»Ja.« Als sie merkte, dass sie die Augen zusammengekniffen hatte, öffnete sie sie wieder und hob entschlossen das Kinn. Sie fand sich sehr mutig.
»Ich auch.« Sie duftet traumhaft, dachte er, und da es ihn ein bisschen zu sehr ablenkte, öffnete er das Fenster einen Spaltbreit.
»Wirklich?« Ihr stockte der Atem. Sah er denn nicht, dass die Ampel jeden Moment auf Rot umschaltete? Anscheinend dachte er überhaupt nicht daran, vom Gas zu gehen. Sie schluckte ein Keuchen herunter und erstickte fast daran, als er in dem Augenblick, in dem die Ampel von Gelb auf Rot umsprang, über die Kreuzung schoss. »Sind wir spät dran?«
»Warum?«
»Sie scheinen es eilig zu haben.«
»Nicht besonders.«
»Sie sind eben bei Rot gefahren.«
Er hob eine Augenbraue. »Es war Gelb«, sagte er und scherte wieder aus, um einen Kombi zu überholen.
»Ich bin bisher eigentlich immer davon ausgegangen, dass man vor einer gelben Ampel den Fuß vom Gas nimmt, um rechtzeitig bremsen zu können.«
»Nicht, wenn man ans Ziel kommen möchte.«
»Ich verstehe. Fahren Sie immer so?«
»Wie?«
»Als hätten Sie gerade einen Bankraub begangen und wären auf der Flucht.«
Er dachte einen Moment darüber nach, dann lächelte er. »Ja.«
Er bog in die Straße ein, in der sich das Hotel befand, und brachte den Wagen mit einem prahlerischen Bremsenquietschen zum Stehen. »Es spart Zeit«, sagte er lässig, um gleich darauf seine langen Beine zu entfalten und auszusteigen.
Layna blieb sitzen, wo sie war. Und während sie versuchte, ruhiger zu atmen, bedankte sie sich bei ihrem Schöpfer, dass sie schließlich doch noch mit heiler Haut davongekommen war. Sie hatte noch keinen Finger gerührt, als D. C. bereits um das Auto herumgegangen war, dem Portier die Wagenschlüssel in die Hand drückte und ihr die Tür öffnete.
»Wollen Sie nicht Ihren Sicherheitsgurt lösen?« Er wartete, bis sie so weit war, griff dann nach ihrer Hand und half ihr beim Aussteigen. Die körperliche Nähe bewirkte, dass ihm wieder ihr Duft in die Nase stieg, und einen Augenblick später besah er sich die Beschaffenheit und die Form ihrer Hand.
Also gut, eine Klassefrau ist sie, das muss man ihr lassen, räumte er in Gedanken ein. Die Augen einer Meerjungfrau in einem Gesicht, das so fein geschnitten war wie eine Kamee. Ein betörender Kontrast. Obwohl er sich nur selten an Porträts versuchte, zeichnete er doch ab und zu Gesichter, die ihn interessierten.
Es war nicht ausgeschlossen, dass er sich irgendwann genötigt sehen könnte, ihres zu zeichnen.
Ihre Knie waren noch immer weich, aber sie war am Leben. Layna holte tief Luft. »Leuten wie Ihnen sollte man verbieten, sich aus welchen Gründen auch immer hinters Steuer zu setzen, vor allem, wenn es sich nicht um ein Auto, sondern um eine Sardinenbüchse handelt.«
»Es ist ein Porsche.« Da sie nicht die Absicht zu haben schien, sich aus eigenem Antrieb zu bewegen, hielt er ihre Hand weiterhin fest und zog sie mit sich in die Hotellobby. »Warum haben Sie mich nicht einfach gebeten, langsamer zu fahren, wenn es Ihnen zu schnell war?«
»Ich war zu sehr mit Beten beschäftigt.«
Diese Antwort entlockte ihm ein Grinsen, ein schnelles Aufblitzen von Humor. Es nahm dem Gesicht jedoch nichts von seiner Gefährlichkeit. In Laynas Augen erhöhte es sie sogar noch.
»Sieht so aus, als wären Ihre Gebete erhört worden. Wo, zum Teufel, müssen wir hier eigentlich hin?«
Kochend vor Wut fegte Layna zu den Aufzügen und drückte heftiger als nötig einen Knopf. Dann betrat sie vor ihm den Lift und betätigte genauso heftig die Taste für den entsprechenden Saal.
D. C., der hinter ihr stand, verdrehte die Augen. »Hören Sie …« Wie, zum Teufel, hieß sie doch gleich wieder? »Layna, wenn Sie die Absicht haben, die beleidigte Leberwurst zu spielen, wird es ein sehr langer und zäher Abend werden.«
Sie schaute stur geradeaus und gab sich alle Mühe, ihre Wut im Zaum zu halten. Sie wusste, dass sie dazu neigte, sarkastisch zu werden, wenn sie sich nicht zusammennahm. »Ich spiele nicht die beleidigte Leberwurst.« Ihre Stimme war so warm wie ein Winter in der Arktis.
Nur ihre anerzogenen guten Manieren bewahrten sie davor, gleich weiterzugehen, nachdem sie aus dem Aufzug getreten war. So aber drehte sie sich mit einer graziösen Bewegung nach ihm um und wartete auf ihn.
Als er ihren Arm nahm, registrierte er, dass sich ihre Wangen vor Zorn gerötet hatten. Das brachte Leidenschaft in ein kühles und klassisches Gesicht. Wenn er ein wie auch immer geartetes Interesse an ihr hätte, würde er es sich zur Aufgabe machen, diese Wangen so oft wie nur möglich zum Glühen und diese Augen zum Blitzen zu bringen.
Aber da dies nicht der Fall war und er den Abend so schnell und schmerzlos wie möglich hinter sich bringen wollte, versuchte er sie zu besänftigen. »Es tut mir leid.«
Es tut mir leid, wiederholte sie im Stillen zornbebend, während sie sich von ihm in den Ballsaal geleiten ließ. War das alles, was er zu seinem rüpelhaften Verhalten zu sagen hatte? Offensichtlich hatte er weder die diplomatischen Fähigkeiten seines Vaters noch den Charme seiner Mutter geerbt.
Zum Glück war der Saal voller Leute, und es spielte eine Kapelle. Was zumindest bedeutete, dass sie nicht dazu verdammt war, den ganzen Abend mit einem ungehobelten Klotz Konversation zu machen. Sobald der gute Ton es erlaubte, würde sie sich unauffällig von ihm lösen und sich jemanden suchen, mit dem sie sich gepflegt unterhalten konnte.
»Wein?«, fragte er.
»Ja, bitte.«
Er nahm sich vor, sich im Laufe des Abends so oft wie möglich von ihr abzuseilen, während er sich mit ihrem Wein und einem Bier für sich selbst wieder auf den Weg zu ihr machte. Er konnte nur dem Himmel danken, dass sein heiß geliebter Großvater, der leider die lästige Angewohnheit hatte, ständig seine Nase in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken, ihn diesmal ausnahmsweise nicht verkuppeln wollte.
»Da seid ihr ja!« Myra kam mit ausgestreckten Händen auf sie zugeeilt. Oh, waren sie nicht ein schönes Paar? Sie konnte es gar nicht erwarten, Daniel zu erzählen, wie umwerfend ihre beiden Kleinen zusammen aussahen. »D. C., aus dir ist ja ein richtiger Mann geworden.« Sie legte den Kopf schräg, als er sich zu ihr herunterbeugte, um sie auf die Wange zu küssen.
»Hast du mir einen Tanz reserviert, Tante?«
»Selbstverständlich. Deine Eltern sind auch hier. Warum setzt ihr euch nicht für einen Moment zu uns?« Sie trat zwischen Layna und D. C. und legte jedem einen Arm um die Taille. »Ich weiß, dass du dich ein bisschen unters Volk mischen musst, Layna, und natürlich wollt ihr beide auch tanzen – sie spielen wunderbare Musik heute Abend –, aber ich habe ein Recht darauf, egoistisch zu sein und euch für ein paar Minuten zu beanspruchen.«
Mit geübter Geschicklichkeit lotste Myra sie durch die angeregt plaudernde Menschenmenge und schlängelte sich mit ihnen zwischen weiß gedeckten, mit leuchtenden Frühlingsblumensträußen geschmückten Tischen hindurch.
Sie wartete schon sehnsüchtig auf die Gelegenheit, die beiden zusammen zu beobachten, die winzigen Einzelheiten der Körpersprache zu studieren, zu sehen, wie sie sich benahmen. In Gedanken stellte sie bereits die Gästeliste für die Hochzeit zusammen.
»Schaut mal, wen ich euch mitgebracht habe«, verkündete Myra.
»D. C.!« Shelby Campbell MacGregor sprang auf. Ihr Abendkleid aus zitronengelber Seide raschelte, als sie die Arme ausbreitete, um ihren Sohn zu begrüßen. Die kunstvoll hochgesteckten rostbraunen Locken streiften seine Wange. »Ich wusste gar nicht, dass du die Absicht hattest zu kommen.«
»Ich auch nicht.« Er drückte sie einen Augenblick an sich, dann wandte er sich seinem Vater zu, um ihn ebenfalls zu umarmen.
Alan MacGregors silbernes Haar glänzte im Licht, und über sein markantes Gesicht breitete sich ein Schmunzeln aus, als er seinen Sohn anschaute. »Gott, du wirst deinem Großvater von Tag zu Tag ähnlicher.«
Selbst ein Holzklotz kann seine Familie lieben, ging es Layna durch den Sinn. Dennoch verspürte sie so etwas wie Neid, weil die Liebe zwischen Vater, Mutter und Sohn und die Freude darüber, sich wiederzusehen, so offensichtlich war.
Wenn sie ihren Eltern unter ähnlichen Umständen begegnet wäre, hätten sie unpersönliche Wangenküsse und ein höfliches »Hallo, wie geht’s?« ausgetauscht.
Dann drehte sich Shelby zu ihr um und blickte sie unter neugierig erhobenen, schmalen Brauen an. »Hallo.«
»Shelby MacGregor, meine Patentochter Layna Drake«, stellte Myra die beiden Frauen in vor Stolz singendem Tonfall vor.
»Nett, Sie kennenzulernen, Mrs. MacGregor.«
Shelby nahm die angebotene Hand und war erfreut über den festen Händedruck. »Sie sind Donnas und Matthews Tochter, stimmt’s?«
»Ja. Sie leben jetzt in Miami.«
»Bestellen Sie Ihnen schöne Grüße von mir.« Sie wandte sich an ihren Mann. »Alan, das ist Layna Drake, Donnas und Matthews Tochter … und Myras Patenkind.«
»Myra hat uns schon eine Menge von Ihnen erzählt.« Alan schenkte ihr einen herzlichen Händedruck. »Sie sind wieder nach Washington gezogen?«
»Ja, Sir. Es tut gut, wieder hier zu sein. Es ist mir eine Ehre, Sie wiederzutreffen. Ich wurde Ihnen als Kind schon einmal vorgestellt und hatte damals schreckliche Angst.«
Schmunzelnd zog er sich seinen Stuhl hervor. »War ich denn so furchterregend?«
»Nein, Sir, eher Respekt einflößend. Ich hatte gerade meine beiden Vorderzähne verloren und fühlte mich entsetzlich unbeholfen. Aber Sie waren so nett zu mir«, hier lächelte sie, »dass ich mich in Sie verliebte.«
»Wirklich?« Alan zwinkerte seiner Frau zu.
»Sie waren mein erster großer Schwarm. Es dauerte mindestens zwei Jahre, bis Dennis Riley an Ihre Stelle rückte, und das nur, weil er in seiner Pfadfinderuniform so unwiderstehlich aussah.«
Faszinierend, dachte D. C., während er Layna beobachtete. Wo kam bloß plötzlich diese Wärme und Lebendigkeit her? Oh, die Kühle war immer noch da, wie ein leichter Glanz auf der Oberfläche, aber darunter machte sich spritziger Charme bemerkbar.
Wenn sie lachte, war es wie ein Murmeln. Sexy, aber diskret. Er musste zugeben, dass es ein Vergnügen war, sie zu beobachten – diese geschmeidigen, sparsamen Gesten, das glatte, im Licht golden glänzende Haar, die Art, wie sich ihre vollen, schön geformten Lippen beim Lächeln langsam nach oben bogen.
Es war unterhaltsam, ihr zuzuhören, dieser tiefen, kultivierten Stimme zu lauschen. Vor allem, weil er nicht gezwungen war, mit ihr zu sprechen.
»D. C., um Himmels willen.« Myra boxte ihn unauffällig in die Rippen und senkte ihre Stimme zu einem Flüstern herab. »Du hast sie noch gar nicht gefragt, ob sie mit dir tanzen möchte.«
»Was?«
»Frag sie, ob sie mit dir tanzen will«, zischelte sie ungeduldig. »Wo sind deine guten Manieren geblieben?«
»Oh, Entschuldigung.« Zum Teufel mit den Manieren, dachte er, berührte jedoch gehorsam Laynas Schulter.
Sie zuckte leicht zusammen, ihr Kopf fuhr herum, und ihr Blick begegnete seinem. Sie hatte fast vergessen, dass er hier war. Du hast deine Pflichten vernachlässigt, ermahnte sie sich, setzte ein höfliches Lächeln auf und zwang sich, ihre Aufmerksamkeit von den faszinierenden Eltern auf den rüpelhaften Sohn zu verlagern.
»Möchten Sie tanzen?«
Ihr wurde unbehaglich zumute. Falls er so tanzte, wie er Auto fuhr, konnte sie von Glück sagen, wenn sie von der Tanzfläche zurückkehrte, ohne sich sämtliche Knochen gebrochen zu haben. »Ja, gern.«
Mit dem Gefühl, sich einem Feuergefecht zu nähern, folgte sie ihm.
Wenigstens ist die Musik schön, dachte sie. Langsam, verträumt, mit schwermütig klingenden Trompeten. Eine ganze Menge Paare waren entschlossen, dies auszunützen, sodass die Tanzfläche überfüllt war. Überfüllt genug, um Layna hoffen zu lassen, dass ihr Tanzpartner nicht wie ein Irrer durch die Menge pflügen und ihr die Arme ausrenken würde.
Dann blieb er am Rand der Tanzfläche stehen, legte ihr einen Arm um die Taille und begann zu tanzen.
Automatisch passte sie sich seinen Schritten an. Es war die Überraschung, die blanke Überraschung, die bewirkte, dass sich ihr Verstand benebelte. Wer hätte gedacht, dass sich ein so großer Mann so geschmeidig bewegen konnte? Die kräftige Hand auf ihrer Taille fühlte sich weder rau noch tölpelhaft an, sondern nur sehr, sehr männlich und machte ihr nur allzu deutlich bewusst, dass sich zwischen der Hand und ihrer Haut nur eine dünne Barriere aus Seide befand.
Das rotierende Licht über ihnen fiel auf sein Gesicht und auf diese nicht vollständig gebändigte kastanienbraune Mähne. Seine Schultern sind so breit, dachte sie benommen, seine Augen so blau.
Sie gab sich redliche Mühe, solche lächerlichen Gedanken aus ihrem Kopf zu verbannen. »Ihre Eltern sind wundervolle Menschen.«
»Ich mag sie.«
Sie ist schlank und biegsam wie eine Gerte, dachte er. Nein, wie eine langstielige weiße Rose. Er beobachtete, wie das Licht über ihr Gesicht huschte, und zog sie unauffällig noch ein bisschen näher an sich heran. Ihre Körper fügten sich aneinander wie zwei Teile eines komplizierten Puzzles.
Ihr Puls schlug schneller. Ohne zu wissen, was sie tat, legte sie ihm eine Hand auf die Schulter, wobei ihre Finger unabsichtlich seinen Hals streiften. »Äh …« Worüber hatten sie eben noch gesprochen? »Ich hatte ganz vergessen, wie schön Washington im Frühling sein kann.«
»Hm.« Verlangen packte ihn. Woher, zum Teufel, kam es so plötzlich? »Ich möchte Ihr Gesicht zeichnen.«
»Natürlich.« Sie hatte kein Wort von dem gehört, was er gesagt hatte. Sie dachte nur daran, dass eine Frau in diesen blauen Augen mit Wonne versinken könnte. »Ich glaube, für morgen haben sie Regen vorausgesagt.« Ein kleiner Seufzer entschlüpfte ihr, als sich seine Hand auf ihrem Rücken spreizte.
»Fein.« Wenn er jetzt den Kopf senkte, könnte er ihren Mund küssen und herausfinden, ob er damit dieses Verlangen, das ihn so unvermutet überkommen hatte, dämpfen oder noch weiter anfachen würde.
Dann verklang die Musik. Irgendjemand prallte leicht mit ihnen zusammen, was bewirkte, dass die dünne Glasglocke, unter der sie sich einen kurzen Moment lang im Rhythmus der Musik bewegt hatten, in Millionen Scherben zerbarst.
Beide traten einen Schritt zurück. Beide runzelten die Stirn.
»Danke«, sagte Layna mit wieder sorgfältig kontrollierter Stimme. »Das war sehr nett.«
»Ja.« Er nahm ihren Arm, wobei er darauf achtete, den Körperkontakt in engen Grenzen und möglichst unpersönlich zu halten. Er wollte sie so schnell wie möglich an den Tisch bringen und sich unauffällig zurückziehen, bis sein Kopf wieder klar war.
Mehr als bereitwillig ließ Layna sich von der Tanzfläche führen. Sie musste sich schnell setzen, bevor die Beine ihr den Dienst versagten.
3. KAPITEL
Für den Sonntag hatte D. C. sich vorgenommen, lange zu schlafen, reichlich und gut zu frühstücken und danach zwei Stunden in seinem Fitnessclub zu verbringen. Anschließend wollte er entweder wieder nach Hause gehen, um den Nachmittag genüsslich zu vertrödeln, oder einen Spaziergang in die M Street machen, wo derzeit das Blues-Festival stattfand.
Sein Plan wurde durchkreuzt, als er bereits kurz nach Sonnenaufgang aufwachte.
Verärgert versuchte er, wieder in den unruhigen Schlaf zu sinken, mit dem er sich schon die ganze Nacht herumgeplagt hatte. Aber jedes Mal, wenn er abzudriften begann, musste er an sie denken. Das war ärgerlicher, als früh aufzustehen.
Es gab keinen Grund, warum Layna Drake in seinem Kopf herumspuken sollte. Dieser eine Moment, in dem er sich körperlich mit ihr verbunden gefühlt hatte, war nur ein kurzer Abstecher an einem langen und ereignislosen Abend gewesen. Sie hatten einander danach mit ausgesuchter Zuvorkommenheit behandelt, sich unter die Gäste gemischt, Höflichkeiten ausgetauscht und Small Talk gemacht, zusammen und getrennt.
Auf der Heimfahrt hatte er darauf geachtet, ja nicht zu schnell zu fahren, beim Abbiegen, wie es sich gehörte, jedes Mal den Blinker zu setzen und weich abzubremsen. An ihrer Tür hatten sie zum Abschied einen lauwarmen Händedruck ausgetauscht und waren jeder für sich mehr als erleichtert gewesen, dass sie endlich wieder auseinandergehen konnten.
Deshalb war es lächerlich, dass er sich noch immer mit ihr beschäftigte und sich so genau daran erinnerte, wie sie sich angefühlt und geduftet hatte und wie sie ihre Augen beim Tanzen geschlossen hatte.
Es war ihr Gesicht, das war alles. Es betörte ihn. Vom künstlerischen Standpunkt aus gesehen, natürlich.
Also ging er schon zeitig ins Fitnessstudio und verbrachte ein paar Stunden damit, seine Rastlosigkeit in der Sauna auszuschwitzen. Anschließend hatte er das Gefühl, schon wieder einen viel klareren Kopf zu haben. Zurück in seiner Wohnung, war er für das große Frühstück, für das er gestern extra eingekauft hatte, bereit.
Er drehte die Stereoanlage voll auf, krempelte sich die Ärmel hoch und warf die Speckscheiben in die Pfanne. Weil er sich inzwischen schon viel besser fühlte, sang er laut zu der Musik, während er die Eier verquirlte.
Als das Telefon klingelte, fischte er sich mit der einen Hand eine knusprige Speckscheibe aus der Pfanne und griff mit der anderen nach dem Hörer.
»So, du bist also schon auf«, dröhnte Daniels Stimme in sein Ohr. »Stell die Musik leiser, Junge. Sonst wirst du noch taub.«
»Moment.«
D. C. schaute sich suchend nach der Fernbedienung um – er fand sie natürlich nie, wenn er sie brauchte –, dann trabte er mit dem Telefonhörer am Ohr ins Wohnzimmer hinüber, um die Musik von Hand leiser zu drehen. Auf dem Weg dorthin knabberte er an dem Stück Speck.
»Ja, ich bin schon eine ganze Weile auf den Beinen. Ich war bereits in der Sauna und treffe eben alle Vorbereitungen, mir die Arterien zu verstopfen.«
»Eier mit Speck?« Daniel stieß einen sehnsüchtigen Seufzer aus. »Oje, wenn ich daran denke, dass ich mir früher sonntags auch den Bauch mit Eiern und Speck vollschlagen durfte. Deine Großmutter ist wirklich zu streng mit mir. Sie ist so beunruhigt über meinen angeblich zu hohen Cholesterinspiegel, dass ich Glück habe, wenn ich mir Speck auf einem Foto anschauen darf.«
»Ich esse ihn gerade.« Auf D. C.s Gesicht breitete sich ein übermütiges Grinsen aus, während er den knusprigen Speck extralaut kaute. »Ah, köstlich.«
»Du bist ein Sadist, junger Mann.« Daniel seufzte wieder. »Und ich Trottel ruf dich auch noch an, um mich bei dir zu bedanken. Na, ich hoffe, dein Abend mit Myras Patentochter war wenigstens todlangweilig.«
»Ich hab’s überlebt.«
»Nun, ich weiß es zu schätzen. Mir ist klar, dass du mit deiner Zeit Besseres anzufangen weißt. Nicht, dass sie nicht reizend wäre, aber sie ist eben einfach nicht dein Typ. Wir suchen dir ein natürlicheres Mädel.«
D. C. schaute stirnrunzelnd auf das, was von der Speckscheibe noch übrig war. »Ich kann selbst suchen.«
»Schön, und warum tust du es dann nicht? Warum sperrst du dich den lieben langen Tag zusammen mit Farbtöpfen und Leinwänden in deinem Atelier ein? Ha! Dabei solltest du ausgehen und dich mit hübschen Frauen amüsieren. Ist dir eigentlich klar, was für Sorgen sich deine Großmutter um dich macht? Wenn sie sich dich dort in dieser stickigen Wohnung vorstellen muss, mit diesem Farbgeruch und allem?«
»Hm.« D. C., der diesen Vortrag schon so oft gehört hatte, dass er ihn auswendig kannte, ging zurück an den Herd und nahm sich noch ein Stück Speck aus der Pfanne.
»Eine Feuerfalle ist das, diese Wohnung unterm Dach. In deinem Alter braucht man ein eigenes Haus, eine gute Frau und Kinder, die einen Heidenradau veranstalten. Aber ich rufe nicht an, um dir etwas zu erzählen, das du bereits selbst weißt«, fuhr Daniel fort. »Ich kann dir gar nicht genug für das danken, was du für mich getan hast. Vor allem, weil ich mich noch allzu gut an die Abende erinnere, die ich schielend vor Müdigkeit mit irgendwelchen Mädchen verbringen musste, die nicht einen einzigen interessanten Satz herausbrachten. Du solltest mit so etwas wirklich nicht deine Zeit vergeuden. Und du brauchst es mit der kleinen Linda auch nicht noch einmal zu tun.«
»Layna«, brummte D. C., grundlos verärgert. »Sie heißt Layna.«
»Ach ja, richtig. Merkwürdiger Name, findest du nicht auch? Nicht Fisch und nicht Fleisch. Na ja, jetzt hast du es ja hinter dir, und es soll auch nie wieder vorkommen. Wann besuchst du uns denn endlich mal? Deine Großmutter verzehrt sich vor Sehnsucht nach dir.«
»Bald.« Mit finsterem Gesicht warf D. C. den Rest der Speckscheibe in die Pfanne zurück. »Was stimmt denn nicht mit Layna?«
»Mit wem?« Daniel musste in seiner Festung in Hyannis Port die Hand über die Sprechmuschel legen, bis er sein dröhnendes Lachen unter Kontrolle gebracht hatte.
»Mit Layna«, wiederholte D. C. mürrisch. »Ist irgendwas faul mit ihr?«
»Oh nein, überhaupt nicht. Eine hübsche junge Frau. Beste Manieren, soweit ich mich erinnere. Aber sie ist nichts für dich. Ein ziemlich frostiges Ding, findest du nicht? Ihre Eltern sind kalt wie Fische und steif wie ein Brett, wenn mich nicht alles täuscht. Na schön, dann stürz dich jetzt mal auf dein Frühstück, Bursche, und nimm dir bald die Zeit, deine Großmutter zu besuchen, bevor sie mich noch ganz verrückt macht.«
»Okay. Sag ihr, dass ich sie liebe.«
»Oh, das werde ich tun.« Daniel legte auf, wobei er sich fragte, wie lange es wohl dauern mochte, bis sein Enkel der hübschen Layna Drake einen Besuch abstattete.
Es dauerte weniger als eine Stunde, vor allem, weil D. C. plötzlich der Appetit vergangen war, sodass er seine verquirlten Eier in den Ausguss schüttete. Er packte seinen Zeichenblock, die Pinsel und ein paar Holzkohlestifte in seine abgeschabte Lederumhängetasche und beschloss, einen Spaziergang zu machen. Dabei würde er in Ruhe nachdenken können.
Sein Großvater hatte natürlich recht, obwohl ihn dieses Selbstvertrauen, mit dem der Alte auftrat, ein bisschen störte. Es störte ihn sogar ziemlich, fast so sehr wie es ihn störte, dass er ihm ständig handverlesene Heiratskandidatinnen präsentierte.
Er würde verdammt noch mal seine eigene Wahl treffen.
Aber natürlich dachte er dabei nicht an Layna. Er wollte nur ihr Gesicht zeichnen. Und da sie gestern mehr oder weniger vereinbart hatten, dass er heute aus diesem Grund bei ihr vorbeikäme, wollte er es so schnell wie möglich hinter sich bringen. Er war selbst überrascht, dass es ihn so stark drängte, ihr Gesicht zu malen.
Sie reagierte nicht auf sein Klopfen. Leicht eingeschnappt hängte er sich seine Ledertasche über die andere Schulter und sagte sich, dass er besser daran täte, auf die M Street zu gehen und dort ein paar Skizzen anzufertigen. Aber durch die geöffneten Fenster drangen die leichten Klänge eines Chopinkonzerts.
Er zuckte die Schultern und drückte die Türklinke herunter. Die Tür war nicht abgeschlossen, also trat er ein. »Layna?«
Da sie ihm gestern Abend keine Gelegenheit dazu gegeben hatte, schaute er sich jetzt interessiert in der Eingangshalle um. Der Holzfußboden war auf Hochglanz gewienert, und die Wände hatten einen matten Farbanstrich, der ihn an leicht angeröstetes Weißbrot erinnerte. Auf einem antiken Klapptisch stand eine Vase mit weißen Tulpen.
Sein Blick fiel auf zwei Bleistiftskizzen an der Wand – Straßenszenen, hingeworfen mit leichter Hand und einem scharfen Auge für Bewegung und Detail. Er ging zur Treppe, legte eine Hand auf den glänzenden Pfosten und rief ihren Namen. Keine Antwort. Er überlegte, ob er hochgehen und dort nach ihr suchen sollte, dann beschloss er jedoch, sich erst einmal im Erdgeschoss umzuschauen.
Sie war nicht in dem würdevoll eingerichteten Salon und ebenfalls nicht in der reichhaltig mit Büchern bestückten Bibliothek, die nach Leder und Rosen duftete. Nachdem er auch noch einen Blick ins Wohnzimmer, ins Esszimmer und in die Küche geworfen hatte, war er bereits ziemlich gut über ihren Geschmack und ihren Lebensstil informiert.
Alles war elegant, traditionsbewusst, ordentlich, mit überraschend eingestreuten Farbtupfern. Eine konservative Frau, die schöne Dinge liebte, klassischen Möbeln den Vorzug gab, die gute Musik hörte, Bücher las und alles an seinem entsprechenden Ort aufbewahrte.
Plötzlich entdeckte er sie durch das Küchenfenster. Er trat näher und schaute hinaus. Der briefmarkengroße Hof hinter dem Haus war von Blumenbeeten eingefasst, und Layna war eben dabei, sie mit gelben Stiefmütterchen zu bepflanzen.
Sie trug braune Gartenhandschuhe, einen breitrandigen Strohhut und über der schlichten beigen Hose und einem dünnen Sommerpullover eine riesige grüne Gartenschürze.
Er fühlte sich an ein Foto aus einem Country-Style-Magazin erinnert: die kompetente, elegante Frau des Hauses, der es Spaß machte, am Sonntagmorgen ein bisschen in ihrem Garten herumzuwerkeln.
Das Licht war gut, wie D. C. feststellte. Es fiel durch die Zweige der Bäume, die eben grün zu werden begannen. Er blieb am Fenster stehen und warf ein paar schnelle Skizzen aufs Papier.
Es amüsierte und faszinierte ihn, wie präzise sie arbeitete. Sie grub mit einer Schaufel ein kleines Loch und vermischte die ausgehobene Erde mit Dünger, dann nahm sie eine Blumenstaude aus dem Spankorb neben sich und platzierte diese exakt in die Mitte der vorbereiteten Vertiefung, die sie anschließend wieder mit Erde auffüllte und festdrückte.
Sie reihte die Stiefmütterchen auf wie kleine Soldaten.
Er grinste, als er durch die Küchentür nach draußen trat.
Weil sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihre ersten gärtnerischen Gehversuche gerichtet hatte, traf sie der Knall der zufallenden Tür wie ein Schuss. Die Schaufel glitt ihr aus der einen, das Stiefmütterchen aus der anderen Hand, als sie zusammenzuckte und herumfuhr.
»Entschuldigen Sie, wenn ich Sie erschreckt habe.«
»Was? Wie sind Sie hereingekommen?« Sie musste sich eine Hand auf ihr rasendes Herz pressen, während sie ihn sehr verwirrt anstarrte.
»Durchs Haus. Sie haben auf mein Klopfen nicht reagiert.«
Er stellte seine Tasche auf dem schmiedeeisernen Tisch in der Mitte des Hofes ab, wobei sein Blick auf das dicke Gartenbuch fiel, das, aufgeschlagen bei den einjährigen Pflanzen, dort lag. Dann schlenderte er zu ihr und bückte sich nach dem Stiefmütterchen, das ihr aus der Hand geglitten war.
»Man kann doch nicht einfach unaufgefordert ein fremdes Haus betreten.«
»Doch, kann man.« Er ging neben ihr in die Hocke und hielt ihr das Stiefmütterchen hin. »Wenn die Tür offen ist. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich heute vorbeikomme.«
Er riecht nach Juchtenseife, ging es ihr flüchtig durch den Kopf. Und er bewegte sich wie ein großer, geschmeidiger Leopard. »Das haben Sie mit Sicherheit nicht gesagt.«
»Doch. Gestern Abend. Sie sollten die Blumen lieber ein bisschen schwungvoller und nicht ganz so in Reih und Glied einpflanzen, damit die Sache mehr Pfiff bekommt.« Er griff ihr unters Kinn, drehte ihren Kopf nach links und betrachtete sie mit prüfendem Blick. »Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Ihr Gesicht zeichnen wollte.«
Sie befreite sich aus seinem Griff, ebenso verärgert über die Berührung wie über seine Kritik an ihren gärtnerischen Versuchen. »Daran erinnere ich mich nicht.«
»Beim Tanzen. Es ist ein schönes Licht hier draußen. Das trifft sich gut.« Er erhob sich, um seinen Zeichenblock zu holen. »Machen Sie ruhig weiter. Lassen Sie sich nicht stören.«
Beim Tanzen? Layna setzte sich auf die Fersen und versuchte nachzudenken. Sie konnte sich an nichts mehr erinnern, außer dass sie vorübergehend nicht mehr ganz zurechnungsfähig gewesen war.
Und jetzt saß er mit lang ausgestreckten Beinen auf dem kleinen schmiedeeisernen Gartenstuhl und zeichnete sie.
»Sie müssen nicht posieren«, sagte er und warf ihr ein Lächeln zu, das ihr durch und durch ging. »Tun Sie einfach so, als wäre ich nicht da.«
Genauso gut könnte man versuchen, einen im Wohnzimmer herumschleichenden Panther zu ignorieren, dachte sie. »Ich kann nicht arbeiten, wenn Sie mich anstarren. Ich möchte diese Stiefmütterchen aber jetzt einpflanzen, denn heute Nachmittag soll es Regen geben.«
»Sie haben höchstens noch ein Dutzend, also machen Sie eine Pause.« Er zog mit seinem Fuß den zweiten Stuhl unter dem Tisch hervor. »Setzen Sie sich ein bisschen zu mir und erzählen Sie mir etwas.«
Sie richtete sich auf und streifte die Handschuhe ab. »Waren wir uns nicht einig, dass wir uns nichts zu sagen hätten?«
»Wirklich?«, fragte er mit einem entwaffnenden Lächeln. Er wusste, wie er ein widerstrebendes Modell einwickeln konnte, und brachte seinen Charme rücksichtslos zum Einsatz. »Sie mögen Musik. Ich auch. Reden wir also über Musik. Chopin passt zu Ihnen.«
Sie schob die Handschuhe in die Taschen ihrer Schürze. »Und zu Ihnen jammernde Dudelsäcke, nehme ich an.«
Er hob eine Augenbraue. »Haben Sie etwas gegen Dudelsäcke?«