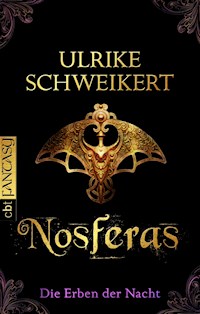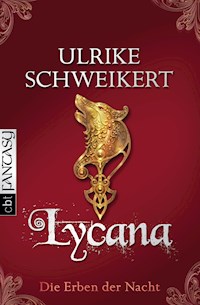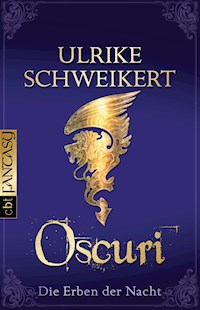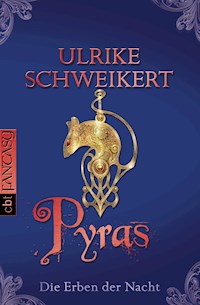5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Würzburg im Jahr 1453: Zu später Stunde preschen drei maskierte Reiter in höchster Eile in die Schmiede von Meister Buchner und verlangen ein neues Hufeisen für eines ihrer Tiere. Der Schmiedelehrling Jos gerät in eine lebensgefährliche Verschwörung, als er zufällig die Unterredung der drei belauscht. Ein Mordanschlag wird geplant und ein Armbrustschütze soll der Täter sein. Doch wem gilt der Anschlag? Warum wird kurz darauf einer der Verschwörer tot aufgefunden? Und was haben der unheimliche Henker der Stadt und seine schöne junge Frau Rebecca mit den Morden zu tun? Jos und seiner Freundin Sara wird schnell klar, dass die Täter es auf die allerhöchsten politischen Kreise abgesehen haben - und dass ihr Verrat Stadt und Land erschüttern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Würzburg im Jahr 1453: Zu später Stunde preschen drei maskierte Reiter in höchster Eile in die Schmiede von Meister Buchner und verlangen ein neues Hufeisen für eines ihrer Tiere. Der Schmiedelehrling Jos gerät in eine lebensgefährliche Verschwörung, als er zufällig die Unterredung der drei belauscht. Ein Mordanschlag wird geplant und ein Armbrustschütze soll der Täter sein. Doch wem gilt der Anschlag? Warum wird kurz darauf einer der Verschwörer tot aufgefunden? Und was haben der unheimliche Henker der Stadt und seine schöne junge Frau Rebecca mit den Morden zu tun? Jos und seiner Freundin Sara wird schnell klar, dass die Täter es auf die allerhöchsten politischen Kreise abgesehen haben - und dass ihr Verrat Stadt und Land erschüttern wird.
Ulrike Schweikert
Die Maske der Verräter
Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2017 by Ulrike Schweikert
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München.
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-012-9
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
1. Buch
PROLOG
Die Verschwörung
Und,habt Ihr schon einen Plan? Wie sollen wir vorgehen?«
Die beiden Männer saßen sich in dem prächtigen Gemach gegenüber, tranken schweren roten Wein und lehnten sich behaglich in den dicken Kissen der Ruhebänke zurück.
»Ein sauberer Schuss, das ist das Einfachste«, sagte der Gast und goss sich Wein nach.
»Ein Schuss kann fehlgehen«, gab der Hausherr zu bedenken. »Wir dürfen kein Risiko eingehen.«
»Ich spreche ja nicht von diesen neumodischen Büchsen!«, erwiderte der Besucher. »Ich halte nichts von Krach und Pulverdampf. Außerdem sind sie zu unförmig und schwer und müssen irgendwo aufgelegt werden. Ich spreche von einem kleinen, gut platzierten Armbrustbolzen. Wir werden in dieser Stadt doch einen passenden Schützen auftreiben!«
»Ich weiß nicht«, sagte der Hausherr gedehnt und rückte sich die Kissen in seinem Rücken zurecht. »Ich möchte die Sache aus der Welt geschafft haben – sicher und endgültig –, und zwar bald! Ich bin für eine Klinge in den Rücken, glatt und schnell.«
Sein Gegenüber lachte. »Ja, das kann ich mir denken. Und gewiss habt Ihr jemanden bei der Hand, der sich für dieses Vorhaben anbietet. Ihr glaubt doch nicht etwa, er würde mit dieser Tat davonkommen? Nein, wenn wir es auf Eure Weise machen, muss jemand mit seinem Hals herhalten!«
»Ja sicher.« Der Hausherr nickte und gähnte gelangweilt. Er strich sich durch sein dichtes graues Haar. »Schließlich haben weder Ihr noch ich vor, selbst eine Klinge in die Hand zu nehmen. Für große Taten muss man immer Opfer bringen!«
Die Frau, die vor der Tür stand und ihr Ohr an den Spalt presste, schürzte voll Abscheu die Lippen.
Opfer bringen, ja, das müssen stets die anderen, und das Blut auf ihre Hände und ihre Seele kommen lassen, während sich die großen Herren ihre Finger höchstens mit teurem Wein beschmutzen!
Schritte näherten sich von der Treppe her. Die junge Frau war so sehr darauf konzentriert, jedes Wort zu verstehen, das hinter der Tür gesprochen wurde, dass sie erst aufschreckte, als eine Stimme sie anrief.
»He, was machst du da?«
Sie drehte sich nicht nach dem Sprecher um, so viel Geistesgegenwart besaß sie noch. Stattdessen raffte sie ihre Röcke und rannte den Gang entlang davon.
»Bleib stehen! Bleib sofort stehen!« Der Mann lief ihr nach.
Hatte er sie erkannt? Ihr Herz schlug wild. Immerhin rief er sie nicht bei ihrem Namen und er hatte sie mit dem vertraulichen »Du« angesprochen. Wie lange jedoch konnte es dauern, bis er den Kreis der möglichen Lauscherinnen so eingegrenzt hatte, dass er unweigerlich auf ihren Namen stieß? So viele Frauen gingen in diesem Haus nicht aus und ein! Was würde dann mit ihr geschehen?
Sabina lief um zwei Ecken herum, riss die Tür zu der schmalen Treppe der Bediensteten auf und eilte die Stufen hinunter. Im Hof war es dunkel. Sie ließ sich nicht die Zeit, sich nach ihrem Verfolger umzusehen. Sie wusste, dass er ihr noch auf den Fersen war. Hier, innerhalb der Mauern des Hofes, würde sie ihm nicht entgehen. Sabina rannte durchdas Tor hinaus, hastete ein paar Gassen entlang und drückte sich dann in eine Nische hinter eine Scheune. Ihr Atem ging schnell und in ihrer Seite stach es. Sie versuchte, über ihren Herzschlag hinweg etwas zu hören. Näherten sich Schritte auf der Gasse? Folgte er ihr noch immer? Außer den üblichen abendlichen Geräuschen der Stadt war nichts zu hören.
Langsam beruhigten sich Herzschlag und Atem, doch ihr Geist blieb in Aufruhr. Er trug nun ein tödliches Geheimnis in sich – tödlich für andere und vielleicht auch für sie selbst. Sie hatte die Stimme des Dienstmannes erkannt, der sie beim Lauschen erwischt hatte. Es war der Leibdiener des Hausherrn. Er machte nicht den Eindruck, als wäre er sonderlich hell im Kopf. Die Frage aber war: Würde er seinem Herrn von diesem Vorfall erzählen? Sie konnte nur hoffen und beten, dass der Diener zu große Angst vor dem Zorn des Herrn hatte und daher lieber schwieg. Denn der Herr war unberechenbar und wusste seinen Verstand wohl zu gebrauchen. Allein der Blick aus seinen kalten blauen Augen ließ alle erschaudern. Es war, als könne er die geheimsten Gedanken lesen und den Menschen bis in die Seele sehen. Sabina liebte ihn nicht gerade und ging ihm, wann immer es möglich war, aus dem Weg. Dabei konnte er durchaus angenehm sein. Wenn er seine Stimme freundlich klingen ließ, dann trat ein glückliches Leuchten in das Antlitz der Angesprochenen, und sie beeilten sich, seinen Wünschen Folge zu leisten. Ja, sie waren sogar dankbar, ihm dienen zu können. Sabina hatte sich in den vergangenen Monaten oft gefragt, ob es ein Engel oder ein Dämon der Hölle war, der ihm diese Gabe verlieh. Heute wäre sie bereit gewesen zu schwören, dass es nur ein Höllenfürst sein konnte.
Bei ihr allerdings ging der Herr stets sparsam mit seiner einschmeichelnden Stimme um. Der jungen Frau wurden meistens nur seine schroffen Befehle zuteil, die jeden, dersie hörte, den Kopf ein wenig tiefer zwischen die Schultern ziehen ließen. Wenn er erfuhr, dass sie seinen schrecklichen Plan belauscht hatte, was würde er dann mit ihr machen? Waren ihr Name und ihre Herkunft Schutz genug? Oder würde er entscheiden, dass das Risiko, sie am Leben zu lassen, zu groß für ihn wäre? Würde er kalt lächelnd den Befehl geben, ihr ein Messer ins Herz zu stoßen oder ihr den Giftbecher zu reichen? Würde er den Mord gar selbst ausführen? Wäre das Letzte, was sie auf dieser Erde sehen würde, seine Gestalt? Groß und aufrecht, wie ein König, Silberfäden im dichten Haar, die Haut im Gesicht noch straff. Und diese blauen Augen, aus denen er sie ansah, ohne auch nur einmal mit den Wimpern zu zucken.
Sabina schloss gequält die Lider. Für einen Moment erwog sie, nicht mehr zum Hof zurückzukehren. Wohin jedoch sollte sie sich dann wenden? Gab es andere Verwandte, bei denen sie Unterschlupf finden konnte? Würden sie sie nicht zurückschicken, wenn sie die Wahrheit nicht kannten? Oder würde er sie selbst verfolgen und zurückholen?
Bedauernd kam sie zu dem Schluss, dass es in dieser Welt keinen Platz gab, zu dem sie fliehen konnte. Vielleicht hatte der Diener sie ja gar nicht erkannt, versuchte sie, sich Mut zuzusprechen. Dann würde sie mit einer Flucht den Stein erst ins Rollen bringen. Jede Minute, die sie dem Hof länger fernblieb, erhöhte das Risiko, dass man sie suchen und nicht finden würde. Wie sollte sie ihre Abwesenheit erklären? Nein, es blieb ihr nichts anderes übrig. Sie musste zurück.
Sorgfältig ordnete Sabina ihre Röcke und machte sich gemessenen Schrittes auf den Weg. Sie schlüpfte durch eine Seitentür in den verlassenen Hof und schlich ins Haus. Als Erstes wechselte sie ihr Gewand und verstaute ihr blondes Haar in einem bestickten Netz. Dann wandte sie sich mit einem bemüht sorglosen Lächeln ihrer Handarbeit zu.
Kapitel 1
Die Schmiede in der Hörrleingasse
Das Pferd schnaubte nervös. Es war eine schöne Fuchsstute, hochgewachsen, mit schlanken Beinen und weißen Fesseln. Ihr Besitzer schlug mit der Gerte gegen ihre Hinterflanke.
»Nun stell dich nicht so an!«, schimpfte der Mann, der ein edles Gewand trug. »Steh still, du Teufelsvieh!« Doch die Stute rollte mit den Augen und wich zur Seite aus, sodass sie ihrem Herrn fast die Zügel aus der Hand riss.
Jos blieb stehen und sah von Reiter und Pferd zu dem Mann, der nun aus dem Halbdunkeln der Schmiede trat. Der war kaum mittelgroß. Unter seiner Lederschürze wölbte sich ein dicker Wanst. Seine Füße steckten in groben Holzschuhen. Seine nackten Arme waren muskulös und von dunklem Haar bedeckt, sein Gesicht glänzte schweißig und war stark gerötet.
Sara trat dicht zu Jos heran. »Er ist ein Hufschmied«, sagte sie leise, obwohl das jeder auf den ersten Blick sehen konnte. Sie schauderte leicht. »Was nun?«, flüsterte sie und sah fragend zu Jos hoch. Der schlaksige Siedersknecht aus der freien Reichsstadt Hall war gut einen Kopf größer als seine Begleiterin. Er war schmal und sehnig, hatte ein waches Gesicht, braunes Haar, das stets widerspenstig nach allen Seiten stand, und erste zögerliche Bartstoppeln an seinem Kinn.
»Tu was!«, drängte Sara. »Jetzt! Du hast gesagt, du willst bei einem Hufschmied in die Lehre gehen. Sind wir nicht deshalb nach Würzburg gekommen?«
Jos antwortete der hübschen blonden Magd an seiner Seite nicht, sondern hielt seinen Blick auf die beiden Männer und die Stute gerichtet. Dennoch konnte er es nicht verhindern, dass seine Gedanken kurz zu der aufregenden Zeit zurücksprangen, die hinter ihnen lag. Sie hatten ihre Heimatstadt Hall verlassen, ihre Familien und Freunde, um sich in Würzburg ein neues, ein besseres Leben zu schaffen. Die Zukunft war ungewiss – trugen sie doch nichts bei sich als ein wenig Geld und ein Empfehlungsschreiben an einen Meister, bei dem Jos lernen könnte. Aber Sara war freiwillig mit ihm in die Fremde gegangen, weil sie ihn liebte, daran zweifelte Jos nicht. Ihr war es gleich, ob sie in Hall oder hier in Würzburg als Magd arbeitete. Hauptsache, sie konnte in Jos’ Nähe bleiben.
Jetzt fuhr sich der Schmied mit der Hand durch das zipfelige Haar und den schon leicht ergrauten Bart und ließ einen Schmutzstriemen auf seiner Wange zurück. »Was kann ich für Euch tun, Herr?«, fragte er und beugte das Haupt. »Neue Eisen?«
Der Vornehme schüttelte den Kopf. »Sie wurde erst vor einer Woche beschlagen, aber jetzt lahmt sie.«
»Hm.« Der Schmied nahm ihm die Zügel aus der Hand, zog das Pferd auf die Gasse hinaus, ließ es ein paar Schritte gehen und führte es dann wieder auf den schmalen, gepflasterten Hof vor der Schmiede zurück. Jos und Sara sahen, dass die Stute sich scheute, den rechten Hinterhuf aufzusetzen.
Der Schmied zog das Halfter durch einen Eisenring und verknotete es. Er spuckte den Strohhalm aus, auf dem er bis dahin gekaut hatte. »Ja, da stimmt was nicht«, pflichtete er dem Edlen bei. »Das Eisen muss runter und dann mal sehen. Könnt Ihr mir aufhalten?«
Der Reiter wich zurück. »Ich? Habt Ihr denn keinen Gesellen oder Lehrling, der Euch hilft, Meister …?«
»Eßwurm, Cuntz Eßwurm, Herr«, stellte sich der Schmied vor und verbeugte sich noch einmal knapp. »Nun ja, für gewöhnlich schon, aber meinen Gesellen habe ich zu Besorgungen geschickt, und der Lehrjunge hat gestern von einem verrückten Gaul einen Tritt in die Rippen bekommen, dass er sich nicht mehr rühren kann. Heute Morgen ist er nicht von seinem Strohsack runtergekommen und hat gar verlangt, ihm einen Bader zu holen! Ich habe ihm zwar angedroht, ihn die Treppe runterzuprügeln, wenn er weiterhin so faul tut, doch nicht mal das hat ihn auf die Beine gebracht.« Der Schmied lachte und ließ eine Reihe fauliger Zähne sehen.
Sara knuffte Jos in die Seite. »Los, sag was! Das ist die Gelegenheit.«
Jos wusste, dass seine Begleiterin recht hatte, dennoch zögerte er, bis Sara ihn zum zweiten Mal in die Seite stieß.
»Worauf wartest du?«
Endlich trat Jos vor, räusperte sich und verbeugte sich vor den beiden Männern. »Ich kann den Huf halten, wenn Ihr es wünscht, Meister Eßwurm.« Er klang zuversichtlicher, als er sich fühlte. Jos hatte zwar schon fast sein sechzehntes Lebensjahr vollendet, und er war seit Jahren daran gewöhnt, hart zuzupacken, um Geld für die Mutter und die jüngeren Geschwister zu verdienen, bisher jedoch war seine Arbeit die eines Haalknechts gewesen. Er hatte das Feuer schüren, Holz hacken und die eisernen Sudpfannen auswaschen müssen, in denen das Salzwasser eingedampft und das Salz gewonnen wurde. Beim Beschlagen eines Pferdes hatte er noch nie geholfen.
Der Schmied betrachtete ihn mit zusammengeschobenen Augenbrauen. »Hast du so was schon mal gemacht?«
Jos schüttelte den Kopf und senkte betreten den Blick.
»Und wie kommst du dann auf den Gedanken, der Herr würde dich Hand an sein edles Ross legen lassen?«
»Ich möchte gerne Hufschmied werden«, sagte Jos und spürte, wie ihm die Hitze in die Wangen stieg. »Es ist mein größter Wunsch! Ich will ordentlich für Euch arbeiten und bitte Euch, mich als Euren Lehrjungen anzunehmen. Ich habe auch ein Empfehlungsschreiben vom Rat der freien Reichsstadt Hall!«, fügte er hastig hinzu und begann, in seinem Bündel zu kramen.
Der Schmied winkte jedoch ab. »Ich habe einen Gesellen und einen Lehrbub, der hoffentlich bald wieder auf den Beinen ist, und was ein fremder Rat sagt, kümmert mich nicht. Was nützt mir ein Schreiben? Batzen will ich sehen, wenn ich mir die Mühe mache, einen solchen Burschen wie dich auszubilden. Außerdem scheinst du mir für einen Lehrjungen schon zu alt.« Wieder sah er ihn aus den wässrigen Augen an, die fast in dem speckigen Gesicht zu versinken schienen. »Aber gut, wenn du mir ein paar Tage zur Hand gehen willst, dann fang gleich an, dich nützlich zu machen, und halte den Huf hoch, damit ich sehen kann, woran das Ross krankt.«
Jos trat zaghaft hinter die Stute, beugte sich herab, umschloss die weiße Fessel mit beiden Händen und hob den Huf vom Boden. Einen Augenblick lang passierte nichts. Vielleicht war die Stute zu überrascht von dem dreisten Zugriff des Fremden. Dann aber riss sie ihr Bein mit einem Ruck los und trat Jos so hart gegen den Oberschenkel, dass er zwei Schritte nach hinten flog, mit dem Rücken gegen einen Stützbalken schlug und mit einem Schmerzensschrei zu Boden fiel. Die Stute schnaubte empört und warf den Kopf hin und her – soweit es der Riemen zuließ. Ihr Besitzer ließ die Gerte ein paarmal auf ihre Seite klatschen und fluchte unfein. Das Pferd schlug noch einmal aus, ehe es sich schnaubend gegen die Wand drückte.
»Tölpel!«, schimpfte der Schmied und zerrte Jos unsanft auf die Füße. »Wie kann man sich nur so dumm anstellen?«
Meister Eßwurm trat neben die Stute, sorgsam darauf bedacht, dass sie nicht nach ihm ausschlagen konnte. Er strich an der Flanke entlang, griff mit der einen Hand nach der Fessel und drückte mit der anderen gegen das Kniegelenk. Wieder wehrte sich das Tier und versuchte aufzusteigen, wurde aber von dem kurzen Zügel daran gehindert. Der Schmied ließ den Fuß los und trat rasch zwei Schritte zur Seite.
»Das Tier hat wirklich einen Dämon im Leib«, brummte er und spuckte aus. »Mal sehen, ob wir es mit der Bremse zähmen können!«
Er verschwand im Halbdunkel der Schmiedewerkstatt, die nur von der roten Glut in der Esse ein wenig erhellt wurde, und kam mit einem Gerät zurück, das aus zwei eisernen Stangen bestand, die man mit einem Seil und einer Querverbindung zusammendrehen konnte. Der Schmied schlang die Zügel noch kürzer um den Ring, sodass die Stute den Kopf kaum mehr bewegen konnte, dann stieß er die beiden Metallenden in ihre Nüstern und zog das Seil so fest, dass Oberlippe und Nase seltsam zusammengequetscht wurden. Die Stute schnaubte leise und verdrehte die Augen, blieb aber ruhig stehen. Die Ohren sanken herab. Ihr Kampfgeist schien erloschen.
»So, jetzt komm her!«, befahl der Schmied und hob den Huf auf.
Jos humpelte heran. Es musste ein Stöhnen unterdrücken, als das Pferdebein gegen seinen schmerzenden Oberschenkel drückte. Mit beiden Händen umklammerte er die Fessel, während Meister Eßwurm mit einer Zange die vernieteten Nagelspitzen abzwickte und das Eisen ein Stück vom Huf hebelte. Mit einem kräftigen Ruck zog er es vollends herunter. Er säuberte den Huf und feilte den seitlich ausgefransten Rand glatt. Jos gelang es kaum, das Bein zu halten, das schwer an seinen Armen hing. Auf den schmerzenden Schenkel wollte er es nicht ablegen.
Ein junger Bursche, kaum zwei Jahre älter als Jos, bog von der Hörrleingasse in den Hof der Schmiede ein. Er war schwer beladen, schleppte einen prall gefüllten Rucksack und trug ein kleines Fässchen in den Armen. Auf seiner Stirn glänzte der Schweiß. Mit einem Stöhnen ließ er das Fass zu Boden sinken.
Der Schmied trat zu ihm. »Hast du alles bekommen, Jacob?«
Der junge Mann nickte.
Meister Eßwurm hob seine fleischige rote Hand und schlug dem Gesellen ins Gesicht. »Und warum hat das so lang gedauert?«
Jacobs Wange glühte, seine Kiefermuskeln zuckten, aber er antwortete mit gesenktem Blick. »Der Kohlenhändler war nicht an seinem Stand, und dann musste ich noch warten, bis der Altreuß Eure Stiefel fertig hatte.«
»Und dann hast du dir noch den einen oder anderen Becher Wein gegönnt?«, fragte sein Meister.
Der Geselle verneinte, doch Jos sah, wie sich nun auch die andere Wange verräterisch rötete.
»Nun, wenigstens hast du den Wein bekommen.« Der Schmied leckte sich über die Lippen. »Ein vorzüglicher Tropfen von den besten Südhängen über Würzburg. Wollt Ihr ihn versuchen, Herr?«, fragte er den Edlen.
Der nickte und trat an den einfachen Holztisch auf der anderen Seite des Hofes, zu dem der Geselle das Fässchen jetzt trug. Jacob lief, zwei Becher zu holen, während der Meister sich daran machte, das Fass zu öffnen.
Jos stand noch immer mit dem Huf in den Händen da. Seine Arme schmerzten und brannten. Er sah Hilfe suchend zu Sara hinüber, die nach wie vor mit ihrem Bündel auf der Gasse stand, aber die zuckte mit den Schultern. Jos ließ den Pferdehuf langsam nach unten sinken.
»Das würde ich nicht machen, wenn ich du wäre«, sagte der Geselle und grinste ihn an.
»Aber warum denn nicht? Der Meister arbeitet doch gerade gar nicht am Eisen. Er trinkt bereits den zweiten Becher Wein!«
Der Geselle nickte. »Ja, das kann dauern.«
»Also dann«, sagte Jos und stellte den Huf auf dem Hofpflaster ab. »Warum sollte ich die ganze Zeit aufhalten, bis mir die Arme am Boden hängen?«
Der Bursche grinste nur noch breiter. »Es ist deine Haut.«
Jacob hatte den Mund noch nicht geschlossen, da stand Meister Eßwurm schon neben Jos. Seine Wangen glühten noch mehr als zuvor und seine Augen waren gerötet. Er hob die Pranke und schlug Jos so hart ins Gesicht, dass er noch einmal nach hinten fiel und mit dem Hinterkopf an die Wand stieß.
»Ich habe dich gewarnt.« Jos hörte die Stimme des Gesellen durch das Rauschen in seinen Ohren.
»Was fällt dir ein?«, brüllte der Meister. »Bursche! Habe ich ›ablassen‹ gesagt? Hä? Hast du auch nur ein Wort aus meinem Mund vernommen, das dir erlaubt hätte, den Huf abzustellen?«
»Nein«, antwortete Jos kleinlaut. Er rappelte sich auf, klopfte sich den Staub vom Kittel und wischte sich das Blut ab, das aus seiner Nase rann. »Ich dachte nur, wenn Ihr mit dem edlen Herrn Wein trinkt, dann kann ich solange …«
»Du sollst nicht denken! Du sollst tun, was der Meister befiehlt. Wenn du jetzt schon aufbegehrst, dann kann ich dich nicht gebrauchen. Scher dich davon!«
»O bitte, nein«, rief Jos aus. »Ich möchte so gern die Arbeit des Hufschmieds erlernen. Ich werde mich anstrengen und gehorchen, ich schwöre es!«
Ein Kichern von der Gasse her ließ ihn den Kopf wenden. Nun stand ein alter Mann an Saras Seite, der die Szene anscheinend beobachtet hatte, schwer auf zwei Krücken gestützt.
»Die Arbeit des Hufschmieds erlernen?«, wiederholte er mit krächzender Stimme. »Bei dem dort?« Er lachte verächtlich und ließ seine wenigen Zahnstumpen sehen. »Der Pferdeschinder kann dir höchstens beibringen, wie man einen Gaul schnellstmöglich zugrunde richtet!«
Meister Eßwurm stürmte auf den Alten zu und packte ihn am Ärmel. »Mach dein Schandmaul zu und verschone uns mit deinem stinkenden Atem«, schimpfte er. »Geh zu deiner Sippe, wo du hingehörst!« Er stieß den alten Mann von sich, sodass der gestürzt wäre, hätte Sara ihn nicht rechtzeitig am Ellenbogen gepackt.
Der alte Mann nickte ihr zu. »Ich danke dir, schönes Kind.« Er ließ seinen Blick ungeniert an der jungen Magd herabwandern, und offensichtlich gefiel ihm, was er sah: Sara war für ein Mädchen groß gewachsen, hatte eine mit Sommersprossen besprenkelte Nase, weizenblonde Zöpfe und eine schlanke Taille.
»Meister Ruprecht Buchner«, stellte er sich vor, ehe er sich wieder an den Schmied wandte. Mit unsicheren Schritten tastete er sich auf den Hof vor und hob das abgezogene Hufeisen auf, das vom Schemel gefallen war, als der Schmied Jos geohrfeigt hatte. Der Alte wog das Eisen in der Hand und betrachtete es aufmerksam.
»Und, weißt du schon, warum die Stute lahmt?«
Meister Eßwurm zuckte mit den Schultern. »Vernagelt scheint sie nicht, was ich so gesehen habe. Muss was mit ihren Beinen sein. Vielleicht hat sie sich gezerrt.«
»Es ist der Huf!«, sagte der Alte bestimmt. »Das sieht man, wenn sie auch nur einen Schritt tut – ich meine natürlich, wenn man etwas von Pferden versteht!«
»Mach dich nicht so wichtig«, fuhr ihn Meister Eßwurm an. »Gar nichts siehst du. Der Huf ist völlig in Ordnung.«
»Ach, und nun nagelst du ihr das Eisen wieder drauf und wunderst dich, wenn sie in einem halben Jahr nur noch für den Schlachter taugt?«
»Was soll mit dem Eisen sein? Abgelaufen ist es noch nicht und der Stollen ist wie neu.«
»Ist es eines von deinen?«, höhnte der Alte und hob das Eisen hoch. »Dann muss man sich nicht wundern! Du bist nicht nur ein Pferdeschinder, sondern auch noch ein blinder Pfuscher!«
Meister Eßwurm riss ihm das Hufeisen aus der Hand. »Es ist nicht meins. Was soll denn damit sein?«, wiederholte er.
Anklagend zeigte der Alte auf das Eisen. »Es ist so hohl geschmiedet, dass es ins Feuer gehört und nicht auf einen Pferdehuf! Kein Wunder leidet das Tier Schmerzen und scheut sich, hart aufzutreten.« Er packte seine beiden Stöcke und humpelte auf die Gasse zurück.
Jos eilte an seine Seite. »Meister, Ihr scheint viel von Pferden und Eisen zu verstehen. Seid Ihr auch Schmied?« Ein wenig zweifelnd betrachtete er die magere Gestalt des Alten, der sich nur mühsam auf den Beinen halten konnte.
Meister Ruprecht verzog das Gesicht zu einer Grimasse. »Musst mich nicht so ansehen, Bursche. Ich weiß auch, dass es mit meinem Körper nicht mehr zum Besten steht, aber vom Schmieden verstehe ich noch allerlei, das kann ich dir versichern, auch wenn ich den Hammer nicht mehr selbst schwinge.«
»Betreibt Ihr trotzdem noch eine Schmiede?«, wagte Sara sich einzumischen, die sich an Jos’ Seite drängte.
Für einen Moment richtete sich der Alte auf und straffte stolz die Schultern. »Eine? Meine Familie betreibt drei Schmieden hier in der Gasse! Mein Ältester, Hermann, hat die Hufschmiede übernommen, Hannes, mein Zweiter, ist der Messerbuchner und meinen Jüngsten, Georg, nennen sie den Nagelbuchner.«
»Und braucht Ihr einen Lehrjungen?«, drängte Sara weiter. »Jos ist tüchtig und weiß zuzupacken, auch wenn man das bei seinen dünnen Armen nicht vermuten würde. Ich weiß es! Er hat in Hall auf dem Haal gearbeitet und im Frühling den Flößern beim Ausziehen der Stämme und beim Holzmachen geholfen. Keine leichte Arbeit, sage ich Euch! Aber Jos hat immer zugepackt, wo ein Mann gebraucht wurde, und von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unermüdlich Hand angelegt. Schließlich musste er für seine Mutter und die Geschwister sorgen, wo doch der Vater so früh starb.«
Jos stieg bei diesem Geplapper die Schamesröte ins Gesicht. Der Alte aber lachte vergnügt.
»Ah, ich sehe, du reist statt mit Empfehlungsschreiben mit einem Herold – und noch dazu mit einem recht hübschen.« Er zwinkerte Sara zu, wandte sich dann aber wieder ernst an Jos. »Du bist also der Siedersknecht Jos aus Hall?«
»Jodokus Andreas Zeuner«, vervollständigte Jos und verbeugte sich höflich. »Und das ist Sara Stricker, zuletzt Magd bei den Nonnen im Kloster Gnadental und zuvor auf der Limpurg bei Schenk Friedrich und seiner Frau Gräfin Susanna von Tierstein.«
»Aha, du warst bei der holden Verwandtschaft unseres fürstlichen Bischofs in Dienst«, stellte der Alte fest, wirkte aber unbeeindruckt. Eher schien er sogar ein wenig verärgert zu sein. Als er sich wieder an Jos wandte, lächelte er allerdings. »Nun gut, dann kommt mit mir. Ich denke, Hermann kann sich deiner annehmen und prüfen, ob du so tüchtig bist, wie die kleine Magd verspricht.«
Jos und Sara folgten dem alten Schmied, der mit kleinen Schritten vor ihnen herhinkte, die Gasse entlang. Jos mit verlegener Miene, Sara voll zuversichtlichem Stolz. Hinter ihnen begann es, vom Turm des Klosters St. Stephan zu läuten. Die Vorstadtkirche St. Peter fiel mit ihren Glocken ein, um zur Abendmesse zu rufen. Den Alten schien das nicht zu kümmern. Er strebte auf eines der Häuser zu, durch deren weite Toreinfahrt Jos ein Schmiedefeuer in der Esse glühen sehen konnte.
»Vater, was bringst du uns mit?«, fragte die Frau unwirsch, die am Herd gestanden hatte und sich nun zu den Neuankömmlingen umdrehte.
Der Alte, dem die steilen Treppen sichtlich die letzten Kräfte geraubt hatten, ließ sich auf einen Hocker sinken. Die Krücken fielen polternd zu Boden.
»Einen Lehrling aus Hall«, erklärte er. »Das ist die Meisterin Margret Buchner, Jos.«
Einige Augenblicke musterten sie sich schweigend. Die Schwiegertochter des Alten musste um die vierzig sein. Ihr Gesicht wirkte müde, die Strähnen, die unter der Haube hervorquollen, waren mehr grau als blond. Sie war von vierschrötiger Gestalt, und beinahe war es nur der schlaffe Busen – kaum sichtbar unter dem Hemd –, der ihren Körper als den eines Weibes auswies. Der harte Zug um ihren Mund verriet, dass man sich besser davor hütete, sie zu verärgern. Selbst Sara sagte kein Wort und zog unter ihrem Blick ein wenig den Kopf ein.
»So, ein neuer Lehrling. Und seit wann ist das deine Sache, uns einen zu suchen, Vater?«
Der Alte ließ sich von ihrem Tonfall nicht einschüchtern. »Ach, er fiel mir sozusagen in den Schoß. Ich habe mich meiner christlichen Nächstenliebe entsonnen und ihn vor dem alten Eßwurm gerettet. Es wäre eine Schande gewesen!«
»Du sprichst in Rätseln, Vater.« Eine Stimme ertönte vom Treppenabsatz her.
Jos und Sara erschraken so, dass sie ein Stück zur Seite sprangen. Rasch gaben sie die Türöffnung frei, um den Sprecher in die Küche treten zu lassen. Das war also der Schmied Hermann Buchner: Er war groß und kräftig, mit sehr kurzem braunem Haar und ebensolchen Bartstoppeln. Seine leuchtend blauen Augen musterten Jos aufmerksam. Die Miene war ernst. Sicher lachte er nicht häufig und war ein gestrenger Meister, doch Jos mochte ihn auf den ersten Blick. Der Alte erzählte die Geschichte von dem anderen Schmied und der lahmenden Fuchsstute und kicherte vergnügt.
»Hast du ein Empfehlungsschreiben?«, fragte Hermann Buchner, als sein Vater geendet hatte.
Jos beeilte sich, es ihm zu reichen.
Der Schmied las es mit gerunzelter Stirn. »Ungewöhnlich, aber ich denke, es ist in Ordnung.«
»Was nützt mir ein Wisch Papier?«, rief da die Meisterin. »Frag ihn lieber, ob er sein Lehrgeld bezahlen kann!«
Mit fahrigen Bewegungen schnürte Jos den Geldbeutel auf und ließ die üblichen Batzenstücke für das erste Jahr in seine Handfläche fallen. Er zögerte kurz, dann streckte er die Münzen dem Meister entgegen.
»Ist er ehelich geboren? Kann er das beweisen?«, mischte sich die Buchnerin wieder ein. »Die Bruderschaft wird ihn nicht annehmen, wenn er nicht aus ordentlichen Verhältnissen stammt.«
»Ich versichere Euch, meine Eltern waren verheiratet und mein Vater ein ehrlicher Haalknecht«, rief Jos ein wenig gekränkt.
»Steht auch in dem Schreiben, Margret«, bestätigte der Schmied. »Du kannst dich also wieder mit deinem Mus beschäftigen und den Jungen mir überlassen.«
Sie maßen sich mit Blicken, und Jos schien es so, als habe der Schmied in seinem Weib einen ebenbürtigen Gegner gefunden, der sich nicht so leicht niederringen ließ.
»Und was ist mit der dort?« Die Meisterin lenkte die Aufmerksamkeit auf Sara.
»Sara Stricker«, stellte Jos sie vor und verstummte dann.
»Ja und?«
Er sah in Saras Blick, dass sie mehr von ihm erwartete. Hatte sie ihm nicht schon in Hall stets zur Seite gestanden, auch in schwierigen Tagen? War sie ihm nicht freiwillig in die neue Stadt gefolgt? Hatte er ihr nicht versprochen, von nun an sein Leben mit ihr zu teilen? Er war Sara voll und ganz zugetan. Aber dennoch wollte das Wort »Braut« nicht über seine Lippen kommen.
»Meine – meine Reisegefährtin«, sagte er lahm und schlug die Lider nieder, um die Tränen der Enttäuschung in ihren Augen nicht zu sehen.
Es wäre ungeschickt, sie als Braut vorzustellen, redete er sich ein. Was sollten der Meister und sein Weib denken? Ein Lehrjunge mit einem dünnen Beutel, der die nächsten Jahre kein Geld verdienen würde und dennoch mit einer Braut daherkäme, die er nicht ernähren konnte? Das war nicht möglich. Es gelang ihm fast, sich selbst davon zu überzeugen, dass es kluge Vorsicht war, die ihn zurückhielt, das schwerwiegende Wort auszusprechen. Jos würde die nächsten Jahre in fremden Häusern leben und mit anderen Männern eine Kammer teilen. Er würde unter der Gewalt eines Meisters stehen, der frei über ihn verfügen konnte. Das war sein Recht. Für eine Braut gab es in diesem Leben noch keinen Platz.
Aber was sollte dann aus Sara werden? Vertrauensvoll war sie ihm gefolgt. War fünf Tage lang mit ihm über die Landstraße gewandert, bis sie die bischöfliche Stadt Würzburg endlich erreicht hatten. Er war für sie verantwortlich.
»Kann sie nicht auch bei Euch bleiben?«, fügte er schnell hinzu und sah abwechselnd den Meister und sein Weib bittend an. »Sie ist eine tüchtige Magd, die Euch willig zur Hand gehen wird.«
Der Schmied wiegte den Kopf hin und her, aber die Meisterin schüttelte den ihren mit Nachdruck. »Wir haben eine Magd. Noch mehr Mäuler müssen wir hier wirklich nicht um den Tisch haben. Sie kann nicht bleiben!«
Sara sah Jos vorwurfsvoll an.
»Wisst Ihr nicht jemanden in Würzburg, bei dem sie Arbeit finden kann?«
»Ohne Empfehlungsschreiben?«, fragte die Meisterin. »Nein, ganz bestimmt nicht!«
Nun blickten beide erschrocken drein. Daran hatten sie gar nicht gedacht, als sie sich zusammen aus Hall aufgemacht hatten. Der Rat von Hall wusste sich Jos verpflichtet und daher hatte der ehemalige Siedersknecht Geld und ein Empfehlungsschreiben erhalten. Doch Sara konnte solche Verbindungen nicht einbringen – sie hatte nichts zur Unterstützung, sollte sie von Jos getrennt werden.
»Aber was sollen wir denn nun machen?«, stieß Jos entsetzt aus.
»Zuallererst wird zu Abend gegessen«, sagte der Alte und rückte seinen Hocker näher an den Tisch. Er nestelte sich sein Messer vom Gürtel und sah erwartungsvoll zu der Meisterin hinüber. »Was gibt es heute? Hört, die Messe ist zu Ende. Die anderen müssten gleich zurück sein. Los, setzt euch«, forderte er Sara und Jos auf und deutete einladend auf die Eckbank, die sich von der Tür bis an die Wand und dann unter dem Fenster entlangzog.
Die Meisterin verzog ablehnend das Gesicht und öffnete den Mund, um zu protestieren, aber der Schmied fiel ihr ins Wort. »Das ist eine gute Idee. Ich denke, ein paar Nächte könnte sie bei den Beginen drüben unterkommen. Mein Sohn Niclas kann euch nachher hinüberbegleiten. Aber zuerst lasst uns essen.«
Damit war das Thema erledigt. Die Meisterin fügte sich, auch wenn sie die Lippen ärgerlich aufeinanderpresste. Sara knickste höflich und fragte, ob sie ihr zur Hand gehen könne. Margret Buchner nickte knapp und zeigte ihr das Bord mit den Tellern und Bechern.
Kurz darauf stürmten die Kinder des Schmieds in die Küche, gefolgt vom Gesellen und der Magd. Alle setzten sich zu Tisch, sprachen das Gebet und langten dann reichlich bei frischem Brot, Käse und Würsten und einem Mus aus Zwiebeln, Lauch und Kohl zu. Unauffällig drückte Jos unter dem Tisch Saras Hand.
»Alles wird gut, ich verspreche es dir«, flüsterte er ihr zu.
»Ich hoffe, du hast recht«, sagte sie seufzend und nahm sich noch ein Stück Brot. »Ich frage mich nur, ob wir das Gleiche darunter verstehen.«
Jos tat so, als habe er den letzten Satz nicht gehört. Er wusste genau, was sie damit meinte, doch ihm fiel nichts ein, was er darauf erwidern könnte, ohne Sara zu kränken. Schweigend schob er sich einen Löffel Mus nach dem anderen in den Mund und starrte beschämt in seine Schale hinab.
Kapitel 2
Der Fremde mit der Maske
Außer dem alten Meister Ruprecht Buchner, seinem Sohn, dem Schmied Hermann, und dessen Weib Margret lebten noch vier weitere Personen im Haushalt Buchner: Der jüngere Sohn des Hauses, Niclas, war zehn Jahre alt, seine Schwester Antonia acht. Zwei ältere Töchter hatten das Elternhaus bereits verlassen und arbeiteten in anderen Handwerkerhaushalten in Würzburg, der älteste Sohn war als Geselle auf Wanderschaft. Dann gab es noch den Schmiedegesellen Claus Dürbach und die Magd Emma Zinck.
Jos wiederholte in Gedanken die Namen, während Niclas ihnen voran auf ein Haus zustrebte, das kaum ein paar Schritte entfernt auf der anderen Straßenseite lag. Er klopfte energisch. Kurz darauf öffnete sich die Tür und eine Frau in einem unscheinbaren Gewand fragte nach ihren Wünschen. Niclas stieß einen Schwall von Sätzen hervor, aus dem die Frau offensichtlich nicht schlau wurde. Fragend sah sie Jos an, der die Gelegenheit zu weiteren Erklärungen ergriff, sobald der Junge Luft holen musste.
»Daher bitten wir Euch, Sara wenigstens für ein paar Nächte ein Lager zu geben«, schloss er und sah die Frau flehend an. Sie war sicher noch nicht alt, wirkte aber erschöpft und bereits verblüht. Aber vielleicht lag das ja nur an dem unförmigen Gewand aus verwaschenem Stoff und dem eng anliegenden Schleiertuch.
Sie zögerte einige Augenblicke, dann lächelte sie Sara an. »Ja, ich denke, das wird gehen. Die Schwestern werden nichts dagegen einzuwenden haben. Platz gibt es genug, seit wir immer weniger werden. Wir sind eine sterbende Gemeinschaft.« Sie seufzte. »Allen Beginenhäusern geht es so, sagt unsere Mutter.«
»Ich will aber keine von ihnen werden!«, stieß Sara hervor.
Die Beginen waren zwar keine Nonnen, die sich hinter Klostermauern vor der Welt verschlossen, aber auch sie versprachen, keusch in Ehelosigkeit nur unter Frauen zu leben. Sie sahen ihre Aufgabe in der tätigen christlichen Nächstenliebe, betreuten Kranke, pflegten Alte und erarbeiteten sich ihren kargen Lebensunterhalt mit Handarbeiten. Das war es ganz bestimmt nicht, was Sara wollte.
Die Begine lächelte. »Aber nein, das musst du ja auch nicht. Wir freuen uns, wenn du uns hilfst, solange du bei uns bist. Und es ist dir freigestellt, unser Haus jederzeit wieder zu verlassen. Allerdings können wir nicht dulden, dass dich dein Begleiter hier in deiner Kammer besucht. Das wirst du sicher verstehen.« Sie warf Jos einen entschuldigenden Blick zu, und plötzlich fand er sie gar nicht mehr so farblos, wie er es zunächst geglaubt hatte.
Jos und Sara nahmen für diese Nacht voneinander Abschied. Jos wartete noch, bis die Tür sich hinter den Frauen geschlossen hatte, dann trat er mit Niclas auf die Gasse zurück.
Sara folgte der Begine ins Haus und sah sich neugierig um. Das Haus war so schmal, dass es in jedem Stockwerk nur zwei Räume gab. Hinter der Haustür erstreckte sich eine kleine Halle, in der Kisten und Säcke lagerten. Dahinter öffnete sich ein Durchgang zu einer Küche. Über eine steile Treppe stiegen sie nach oben. Hier befanden sich die Stube, die im Winter von einem Ofen gewärmt werden konnte, und eine Schlafkammer mit vier Strohmatratzen. Unter dem Dach lagen noch sechs weitere Schlafstätten, doch es lebten nur noch fünf Frauen in der Gemeinschaft des Beginenhauses.
Benigna hieß die Frau, die ihr geöffnet hatte. Sie war erst zwanzig Jahre alt, wirkte aber, als habe sie schon ein Dutzend Jahre mehr erlebt. Sie führte Sara die Stiege hinauf, reichte ihr eine dünne Wolldecke und deutete auf eine der Matratzen, die ihr als Lager dienen sollte. Sara legte Decke und Bündel auf das zerschlissene Leinentuch. Ein modriger Geruch stieg ihr in die Nase. Die Matratzen waren sicher schon lange nicht mehr mit frischem Stroh gefüllt worden. Da hatte es Jos im Haus des Hufschmiedes sicher besser. Sara unterdrückte einen Seufzer und folgte Benigna nach unten in die Stube.
Die anderen Beginen saßen um den schlichten Tisch herum und beteten gemeinsam einen Rosenkranz. Ein kleines Binsenlicht brannte auf dem Tisch und erhellte die Stube nur schwach.
Als Sara eintrat, erhob sich die älteste der Frauen. Benigna trat zu ihr und flüsterte ihr rasch etwas zu, dann trat sie in die Schatten zurück.
»Willkommen in unserem Haus, Sara. Möge Gott der Herr deine Wege behüten. Ich bin Ludmilla, von den Schwestern hier bestimmt, für sie zu sprechen. Ansonsten sind wir untereinander gleich, leben und beten zusammen und widmen unsere Kräfte den Armen und Kranken. Wie ich höre, bist du neu in der Stadt und hast kein Dach über dem Kopf? Ich sehe es in deinen Augen, dass du ein gottesfürchtiges Mädchen bist, daher bleibe bei uns, solange du möchtest.«
Sara knickste und nickte den anderen Beginen zu, die sie neugierig musterten.
»Vielen Dank für eure Güte. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich Arbeit zu finden und euch nicht lange zur Last zu fallen.«
»Du fällst uns nicht zur Last«, sagte Ludmilla. »Du wirst mit uns beten und mit uns die Bedürftigen besuchen. Am Abend spinnen, nähen und sticken wir zusammen. Du gehörst zu uns, bis du beschließt, dich an einem anderen Ort niederzulassen. Und wenn du für immer bleibst, dann soll uns das eine Freude sein.«
Die Dankesworte blieben Sara im Hals stecken. Nur das nicht! Sie wollte nicht mit diesen dürren, farblosen Frauen ihr Dasein fristen, bis Gott beschloss, sie abzurufen. Sicher gefiel ihm so ein Leben, aber diese Aussichten konnten Sara nur einen eisigen Schauder über den Rücken jagen. Sie wollte lachen und tanzen, fröhlich plaudern und lieben. Und sie wollte heiraten und Kinder bekommen, mit einem Mann, der sie liebte und versorgte. Sie wollte mit Jos ihr Leben verbringen, nicht mit ein paar Beginen, die das Leben vergessen hatte!
Aus Furcht, sie könnten in ihren Gedanken lesen, ließ Sara den Blick zu Boden sinken. Sie nahm die Einladung zum Essen an, obwohl sie drüben im Haus des Schmieds üppig gegessen hatte und keinen Hunger verspürte. Vielleicht hätten die Beginen es unhöflich gefunden, wenn sie ihre Gabe ablehnte. Also nahm sich Sara ein klein wenig von dem geschmacklosen Mus.
Während des Essens schwiegen die Frauen und sahen nur auf die Schalen vor sich herab. Sara fiel es schwer, diese Stille zu ertragen. Sie hätte die Frauen gern nach ihrem Leben gefragt oder ein paar heitere Geschichten aus Hall erzählt. Von den dunklen Tagen dort hätte sie natürlich nicht berichtet. Und am wenigsten von Rebecca, der Tochter des Haller Henkers! An sie wollte Sara am liebsten nie mehr denken – zu tief fühlte sie den Stich der Eifersucht auf das hübsche, unantastbare Mädchen, das – wie sie wohl wusste – Jos nicht gleichgültig war. Zum Glück hatten ihre Pfade sich nun getrennt! Jos würde ihr nicht mehr begegnen und ihr Bild würde verblassen. Während sie selbst bei ihm war, lebendig, jung und warm. Alles würde gut werden!
Als Sara später im Dunkeln unter der kratzigen Decke lag, umhüllt vom Geruch des alten Strohs, träumte sie von Jos, wie er sie früher in Hall geküsst hatte, und von ihrer Reise nach Würzburg. Fünf Tage und vier Nächte hatten sie zusammen verbracht. Waren auf der Landstraße gewandert, hatten auf Bauernhöfen Milchsuppe und Brot bekommen und in Scheunen oder Ställen geschlafen. Dreimal wurden sie getrennt: Während Jos im Stall schlief, verbrachte Sara mit den Mägden des Hofes die Nacht in der Gesindekammer. Eine Nacht jedoch hatten sie gemeinsam im Heu gelegen, in einer einsamen Scheune am Wegesrand. Sara war fast ein wenig enttäuscht gewesen, dass sich Jos wie ein Edelmann benommen hatte. Er hatte ihr seinen Umhang gegeben und sie, als es kälter wurde, in seine Arme genommen, aber weiter war nichts passiert. Zumindest hätte er sie wieder küssen können, dachte sie, und die Sehnsucht schmerzte in ihrem Leib.
Sie sollte stolz auf ihn sein, dass er sie nicht in Schwierigkeiten brachte, sagte sie sich, doch die Sehnsucht blieb. Ach, wie wäre es schön, wenn sie als Magd ebenfalls bei dem Hufschmied arbeiten könnte, Jos am Tag bei der Arbeit sehen und nachts mit ihm eine Kammer teilen könnte. Sara wusste, dass das ein törichter Traum war. Dazu müsste er sie heiraten, und das war unmöglich, solange er als Lehrjunge arbeitete und kein Geld verdiente.
»Ach, Jos, ich vermisse dich«, flüsterte sie in die Dunkelheit. Dann betete sie zu Gott, der Heiligen Jungfrau und all den Heiligen, die ihr einfielen, dass alles gut werden würde, dass er sie lieben und sein Leben lang bei ihr bleiben möge.
Jos und Niclas warteten, bis sich die Tür des Beginenhauses hinter der Schwester und Sara geschlossen hatte, dann traten sie auf die Gasse zurück. Inzwischen war die Nacht hereingebrochen und nur noch wenige Menschen waren in der Sandervorstadt von Würzburg unterwegs. Nur noch der Feuerschein der Essen drang aus den Werkstätten der zahlreichen Schmieden auf die Gasse hinaus und warf ein unruhiges rotes Licht auf die Häuserfronten und den Unrat am Boden. Jos und der Junge wollten gerade die Gasse überqueren, als drei Reiter in flottem Trab vom alten Graben her in die Gasse bogen. Sie trugen lange schwarze Mäntel und hatten die Kapuzen ihrer Umhänge tief in die Gesichter gezogen.
»Wir müssen anhalten«, rief der Letzte, dessen Pferd in einen ungleichmäßigen Schritt verfallen war. »Das Eisen ist weg!«
Der Mann vor ihm zügelte sein Pferd und drehte sich im Sattel um. »Was glaubt Ihr wohl, warum wir diese Gasse nehmen?«
Der erste Mann hielt nun ebenfalls an und ließ die beiden Begleiter aufschließen. »Führt keine langen Reden! Wir müssen sehen, dass wir unbemerkt aus der Stadt kommen und unseren Auftrag erledigen!«, hörte ihn Jos zischen. Er hatte Niclas am Hemd gepackt und in einen Hauseingang gezogen, um von den Männern nicht niedergeritten zu werden. Nun verbarg sie der Schatten des Tores anscheinend so gut, dass die seltsamen Reiter sie nicht bemerkten. Niclas machte Anstalten, seinen Platz zu verlassen und die Gasse zu überqueren, doch Jos hielt ihn am Arm fest und gebot ihm, still zu sein. Er spürte wieder dieses seltsame Flattern in der Magengrube, das ihn schon vor mancher Gefahr gewarnt hatte.
»Ohne Eisen kann er nicht mitkommen«, sagte der Zweite beschwichtigend. »Der Weg ist zu weit, das Tier wird lahmen. Macht Euch keine Sorgen, ich habe an alles gedacht. Wir werden keine Schwierigkeiten bekommen. Seht, dort vorn bei Meister Buchner scheint noch jemand in der Schmiede zu sein. Es wird nicht lange dauern.«
»Dann sputet euch«, brummte der erste Reiter und machte eine unwillige Kopfbewegung. Seine Kapuze rutschte ein Stück nach hinten. Statt eines Gesichts enthüllte sie jedoch etwas Schwarzes, in dem sich der ferne Feuerschein spiegelte.
Niclas sog scharf die Luft ein. »Der Leibhaftige!«, keuchte der Junge.
»Unsinn!«, wehrte Jos ab, obwohl der Mann ihm auch unheimlich vorkam. Doch würde der Teufel persönlich hier durch Würzburg reiten? Er starrte auf den Stiefel im Steigbügel. Er kam ihm wie ein gewöhnlicher menschlicher Fuß vor.
Der Mann zog die Kapuze wieder an ihren Platz und ritt in den kleinen Hof der Hufschmiede. Als alle drei abgestiegen waren und ihren Blick von der Gasse abwandten, wagten die beiden Beobachter, sich wieder zu rühren. Sie huschten auf die andere Seite und schlenderten dann in den Hof der Schmiede.
»Ich weiß nicht, ob ich ein passendes Eisen habe«, hörten sie Meister Buchner gerade sagen, als sie auf den schmalen Vorplatz traten, der das weit gespannte Tor mit der Schmiede verband.
»Wir haben es eilig«, zischte der Mann mit dem unheimlich schwarzen Gesicht, der die Burschen so erschreckt hatte.
Dem Schmied allerdings schien er keine Angst einjagen zu können. »Eilig oder nicht, wenn das Eisen nicht passt, dann kommt Ihr nicht weit, und der Gaul wird bald keinen mehr tragen.« Gemächlich trat er in die Werkstatt, drehte eine Öllampe auf und durchsuchte den Inhalt des Regals neben der Esse. Kurz darauf kam er mit zwei vorgefertigten Eisen in der Hand zurück.
Niclas sprang vor. »Soll ich dir aufhalten, Vater?«, fragte er.
Der Schmied runzelte die Stirn. Er warf einen Blick auf die drei verhüllten Besucher. »Nein«, lehnte der Vater barsch ab. »Geh in deine Kammer, sofort! Keine Widerrede.«
Niclas verzog schmollend die Lippen, folgte aber dem väterlichen Befehl.
Der Kapuzenmann, der sich sehr gerade hielt und wie ein Edelmann sprach, sah dem Knaben nach. Wieder fiel der Feuerschein auf sein Gesicht, oder besser gesagt dorthin, wo ein Gesicht hätte sein sollen. Schwarz glänzte es dort. War er ein Mohr? Wie der eine der Heiligen Könige in der biblischen Geschichte? Jos hatte noch keinen solchen Mann gesehen, aber vielleicht gab es sie in fernen Ländern tatsächlich.
»Ist das auch einer deiner Söhne, der hier mit offenem Mund dasteht und uns anstarrt?«, fragte der Mann scharf.
Nun erst entdeckte Meister Buchner den neuen Lehrjungen. »Nein, ist er nicht. Komm her, Jos, du kannst mir aufhalten.«
Der Meister hob den Huf an und legte die Fessel in Jos’ Hände. Anders als die Stute am Nachmittag blieb das Pferd ruhig stehen. Der Schmied befreite die Sohle vom Schmutz der Gasse und hielt dann die beiden Eisen nacheinander an den Huf.
»Und?«
Er schüttelte den Kopf. »Zu groß.«
»Das macht nichts. Nagle das Eisen fest, damit wir endlich weiterkommen!«
Der Schmied ließ sich nicht einschüchtern. »Einen Teufel werde ich tun! Glaubt Ihr, ich riskiere, dass die Hufwand splittert, wenn ich die Nägel zu nah am Rand eintreibe? Und selbst wenn nicht, dann würde das Pferd leicht streifen und an den überstehenden Eisenrändern hängen bleiben. Euer Begleiter wird sich bedanken, wenn er im nächsten Graben landet!«
Der Kapuzenmann murmelte etwas, und Jos kam es vor, als schere es ihn nicht, was mit dem Begleiter passiere. Murrend ergab er sich in sein Schicksal. Er trat an den Tisch heran, der neben dem Tor stand, und ließ sich auf die Bank fallen. »Dann bring mir Wein und beeile dich mit dem Eisen.«
Der Schmied gebot Jos, den Fuß abzulassen und hinaufzueilen, um sich von der Meisterin einen Krug Wein einschenken zu lassen. »Sie soll einen guten Wein nehmen, aber nicht selbst herunterkommen«, schärfte er dem Burschen ein. Jos nickte und eilte davon.
Als er mit Krug und Becher in den Händen zurückkam, hatte der Meister bereits die Glut in der Esse wieder angeheizt. Während er mit den Füßen abwechselnd die beiden Blasebälge trat, die von der Seite Luft in das Feuer bliesen, schob er mit einer Schaufel frische Holzkohle nach. In der anderen Hand hielt er mit der Zange ein bereits roh geformtes Hufeisen, das an der im Feuer liegenden Seite rot zu glühen begann.
Jos ging zu dem seltsamen Fremden an den Tisch und goss ihm Wein ein. Der nahm den Becher, ohne zu danken. Als er trank, sah Jos, dass er eine schwarze Maske trug, die sein Gesicht verbarg. Also nicht der Leibhaftige und auch kein Mann mit schwarzer Haut. Jos war erleichtert, obwohl er ihn immer noch ein wenig unheimlich fand. Als der Becher geleert war, griff der Fremde zum Krug, um sich nachzuschenken. Seine Hand steckte in einem Lederhandschuh, der auf seinem Stulpen ein Wappen trug. Was war das? Eine dunkle Gestalt durchquerte das golden schimmernde Feld, die Hand vorgestreckt. Sie trug etwas. Drei Striche kreuzten sich in der Hand, oben mit rot verdickten Enden.
Vielleicht hatte der Fremde seinen Blick gespürt. Hastig zog er die Hand in den Umhang zurück. »Was stehst du hier noch rum? Pack dich fort!«, fuhr er den Lehrjungen an.
Jos neigte kurz den Kopf und trat zu dem scheckigen Pferd zurück, das sein Eisen verloren hatte. Die Begleiter des Maskenmannes standen ein Stück abseits bei den anderen beiden Pferden. Das eine war ein etwas plumper Brauner mit einer dünnen Blesse, die sich oben nach links bog, und einem weißen Beinling am linken Vorderbein. Das andere Pferd war ein edler Rotschimmel. Hoch gebaut, mit kräftigen, wohlgeformten Beinen.
Anscheinend wurde Jos vom Pferdekörper verdeckt, sodass er nicht zu sehen war, denn die beiden Männer fuhren ungestört in ihrer Unterhaltung fort. Zwar hatten sie die Stimmen gesenkt, doch in der nächtlichen Ruhe, die über der Vorstadt lag, konnte Jos jedes Wort verstehen.
»Was willst du?«, sagte der, dessen Pferd das Eisen verloren hatte. »Du hast dich doch freiwillig gemeldet.«
»Ihr habt nur gesagt, dass Ihr einen treffsicheren Schützen sucht, nichts sonst«, erwiderte der andere. »Wie sollte ich ahnen, worum es geht?«
»Ach, und da dachtest du, du solltest für uns nur auf eine Scheibe schießen? Für so viel Geld? Das kannst du mir nicht einreden. Tu nicht dümmer, als du bist!«
»Ich kann auch mein Pferd nehmen und wieder nach Hause reiten!« Der Mann erhob seine Stimme. »Ich habe bisher ohne sein Geld gelebt, dann kann ich das auch weiterhin tun!«
»Nun reg dich nicht so auf und mäßige deinen Tonfall!«
»Ich soll mich nicht aufregen? Das ist Mord! Ganz gemeiner Mord, was er da plant«, flüsterte der andere.
»Wer sagt denn so etwas?«, versuchte sein Begleiter abzuwiegeln. »Mach dir keine Gedanken. Das geht dich nichts an.«
Statt ihn zu beschwichtigen, schienen diese Worte den Mann eher noch mehr aufzuregen. »O nein, es hat mich nicht zu kümmern, was der Bolzen meiner Armbrust trifft. Hauptsache, er findet das Ziel, das er und seine Hintermänner sich ausgedacht haben.« Er nickte in die Richtung des Maskenmanns. »Und dass ich danach als Mörder am Galgen baumeln werde, das hat mich vermutlich auch nicht zu kümmern!«
»Ach, das ist deine Sorge! Nur keine Angst. Niemand wird dich erwischen. Wenn du deinen Auftrag ausführst, dann werden die Herren dafür sorgen, dass du deine Belohnung genießen kannst!«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht.«
Jos stand wie erstarrt da. Er traute seinen Ohren nicht. Da wurde im Hof des Schmieds ein Mordkomplott besprochen! Was sollte er nun tun? Was konnte er tun? Er wusste ja nicht einmal, wann der Anschlag stattfinden sollte, geschweige denn, auf wen der Armbrustschütze anlegen sollte. Die Männer würden sich kaum dazu überreden lassen, ihr Geheimnis preiszugeben. Nein, eher würden sie Jos und den Meister und vielleicht seine ganze Familie ermorden, um ihr finsteres Geheimnis zu wahren.
Ging seine Vorstellungskraft mit ihm durch? Jos sah zu dem Mann mit der Maske hinüber. In diesem Moment drehte der den Kopf in seine Richtung, als habe er den Blick gespürt. Jos lief ein kalter Schauder über den Rücken. Glänzte es dort nicht rot hinter den beiden Augenschlitzen? Oder war das nur der Widerschein des Feuers in der Schmiede? Vielleicht verbarg sich doch der Satan unter Umhang und Maske. Nein, versuchte Jos sich zu beruhigen, der Satan benötigte keinen Armbrustschützen, um einen Menschen zu töten. – Wenn er doch wenigstens wüsste, wen diese Männer zu ermorden planten!
Diese Frage ließ offensichtlich auch dem Schützen keine Ruhe, denn er drängte seinen Begleiter, ihm endlich das Ziel des Geschosses zu nennen. Jos hielt die Luft an, damit ihm ja nichts entging.
»Das wirst du erfahren, wenn es Zeit ist«, sagte der Reiter des Pferdes, das sein Eisen verloren hatte. »Wenn er beschließt, dass es Zeit ist!«
In diesem Moment sprang der Fremde mit der Maske auf. »Schmied! Wie lange dauert das denn noch?«, rief er erbost.
»So lange, bis das Eisen passt«, gab der Meister ungerührt zurück. Das neue Eisen, das noch in dunklem Rot glühte, mit einer Zange gefasst, trat er in den Hof.
Jos sprang hinzu und packte die Fessel des Pferdes. Es schnaubte unwillig, ließ es aber zu, dass er den Huf anhob. Der Schmied drückte das Eisen gegen den Hufrand. Es zischte leise, weißer Dampf stieg auf, und es stank durchdringend nach verbranntem Horn.
»Passt«, stellte der Schmied zufrieden fest. Er tauchte das Eisen in einen Wassereimer, holte Hammer und Nägel und trieb dann mit geschickten Schlägen acht Nägel ein, sodass ihre Spitzen zwei Zoll tiefer aus der Hufwand traten. Jos sah aufmerksam zu, wie er die Spitzen abkniff, die Reste mit Hammer und Zange zu Nieten schlug und diese dann im Horn in einer Kuhle versenkte, die er mit einer Raspel herausgefeilt hatte. Jos sah auf das braun und weiß gemusterte Bein des gescheckten Pferdes herab. Kurz über dem Huf musste es sich vor längerer Zeit eine Verletzung zugezogen haben. Bis zum Gelenk hinauf zog sich eine helle Linie.
»Ablassen!« Jos ließ den Huf zu Boden sinken.
»Das macht fünf Pfennige, Herr!«, sagte der Meister höflich, aber ohne Unterwürfigkeit zu dem Maskenmann, der zu seinem Rotschimmel getreten war und sich bereits in den Sattel schwang.
»War es mein Gaul, der sein Eisen verloren hat?«, zischte er und ritt auf die Gasse hinaus.
Meister Buchner griff nach dem Zügel des Schecken, den er beschlagen hatte. »Fünf Pfennige«, wiederholte er.
Der Reiter des Schecken brummte unwillig, griff aber in seinen Beutel am Gürtel und ließ die geforderten Münzen in die vorgestreckte Hand des Schmieds fallen.
»Danke Euch und eine gesegnete Nacht«, rief ihm Hermann Buchner nach und schüttelte langsam den Kopf.
»Meister, was glaubt Ihr, wer diese Männer waren und was sie hier wollten?«, fragte Jos, der neben den Schmied getreten war und mit ihm den dunklen Gestalten nachsah, die von der Hörrleingasse nun auf den Platz zwischen dem Kloster und St. Peter hinausritten.
»Vergiss, dass sie hier waren, ja, dass es sie überhaupt gibt!«, sagte der Schmied scharf. Sanfter fügte er hinzu: »Oder tu zumindest so, wenn du noch ein paar Jahre in Frieden auf Gottes Erde leben möchtest. Hier geht es um Dinge, bei denen ein einfacher Mann zu leicht den Kopf verliert.«
»Wisst Ihr etwas darüber?«, drängte Jos.
»Nein, und ich will auch nichts darüber wissen. Aber uns beiden ist wohl klar, dass sie nichts Gutes im Sinn haben, oder?« Der Meister wartete die Antwort des Lehrjungen nicht ab. »Und nun marsch hinauf in dein Bett. Schlafe! Das ist alles, was nun noch für dich wichtig ist. Bei Morgengrauen will ich dich in der Werkstatt sehen – mit wachen Augen und wachem Geist! Ich kenne keine Nachsicht bei Fehlern und Schlamperei!«
Das glaubte Jos ihm aufs Wort, und so verabschiedete er sich hastig und stieg die drei Treppen bis zu der winzigen Dachkammer hinauf, die er sich mit dem Gesellen Claus Dürbach teilte. Der lag schon auf der Strohmatratze und schnarchte mit offenem Mund. Jos dagegen konnte lange keinen Schlaf finden, und das lag nicht an den Geräuschen, die sein Kammernachbar von sich gab.
Ein Mord wurde geplant. Sollte er mit dem Meister darüber sprechen? Ihm sagen, was er gehört hatte? Nur, was sollte das helfen? Er konnte ja weder den Ort benennen noch die Person, der der Anschlag galt. Vielleicht hatten sie gar jemanden im Blick, der sich außerhalb der Landesgrenzen aufhielt. Der Maskenmann hatte mit einem Akzent gesprochen, der sich von dem der Menschen hier in Würzburg deutlich unterschied. Außerdem war es die Sprache der Reichen und Vornehmen gewesen. Die anderen beiden konnten wohl von hier stammen und ihre Sprechweise unterschied sich nicht von den Handwerkern und Händlern der Stadt.
Vielleicht hatte der Meister gar – trotz der Umhänge und der Kapuzen – einen von ihnen erkannt? Jos musste ihn fragen! Aber er ahnte, dass der Schmied nicht erfreut reagieren würde. Hatte er ihm nicht sogar verboten, sich weiter mit diesen Männern zu befassen? Sollte er das Ganze nicht vergessen?
Ein schrecklicher Gedanke kam Jos in den Sinn. Vielleicht kannte der Schmied die Männer nicht nur, vielleicht wusste er sehr genau, worüber sie gesprochen hatten und was für eine Teufelei sie planten. Hatte er deshalb seinen Sohn sogleich in seine Kammer geschickt, weil er wusste, dass diese Männer gefährlich waren?
»Hier geht es um Dinge, bei denen ein einfacher Mann zu leicht den Kopf verliert.« Das waren seine Worte gewesen. Zuerst hatte Jos sie nur als Ahnung eines Mannes aufgefasst, der schon viele Jahre länger auf dieser Erde weilte und dessen Erfahrung weit größer war als die seine. Nun war sich Jos nicht mehr sicher, ob die Lösung so einfach war … Nein, er durfte den Meister nicht fragen. Hatte der nicht angedeutet, zu viel Neugier könnte Jos in Gefahr bringen? Oder war es nicht nur eine Andeutung, sondern eine ernsthafte Drohung gewesen?
Jos zog sich das Kissen über den Kopf und stöhnte leise. Er würde den Meister nicht fragen, doch er würde ihn genau beobachten, das schwor er sich.
Kapitel 3
Hochzeit im Haus des Henkers
Das erste Grau des Morgens schimmerte durch die Pergamentscheibe des winzigen Dachfensters, als Jos die Decke von sich warf und von seinem Strohsack aufsprang. Rasch schlüpfte er in Hemd, Beinlinge und den warmen Kittel. Claus schnarchte noch, aber das kümmerte ihn nicht. Sollte der Geselle zu spät kommen, Jos jedenfalls würde sich an seinem ersten Tag keinen Rüffel vom Meister einhandeln. Ob der Schmied wegen gestern Nacht noch etwas sagen würde? Vermutlich nicht. Schließlich hatte er Jos geraten, nicht mehr daran zu denken. Das allerdings konnte Jos nicht. Die unheimlichen Männer in ihren Kapuzenumhängen standen ihm deutlicher denn je vor Augen und hatten seine Träume vergiftet.
In der Küche war niemand. Allerdings hatte irgendwer bereits die über Nacht sorgfältig abgedeckte Glut wieder angefacht und frisches Holz aufgelegt. Ein Kessel hing an einem Dreibein über den Flammen. Jos beschloss, in die Schmiede hinunterzugehen. Die anderen würden ihm schon Bescheid sagen, wenn es eine Morgensuppe gab.
Auf der Treppe begegnete er der Magd Emma, die zwei Eimer Wasser hinauf in die Küche trug. Sie lächelte ihn freundlich an und wünschte einen Guten Morgen. Sie schien eine nette junge Frau zu sein, kräftig gebaut mit roten Wangen und flachsblondem Haar. Mit ihr würde er sicher keine Schwierigkeiten bekommen – ganz im Gegensatz zu der Meisterin, das war Jos klar, seit er den ersten Blick auf die Buchnerin geworfen hatte. Dennoch wäre es ihm lieber gewesen, wenn es Emma nicht gegeben hätte – zumindest nicht hier in diesem Haus. Dann hätte der Schmied vielleicht zugestimmt, Sara als Magd aufzunehmen.
Während er in die große Halle im Erdgeschoss hinunterstieg, in der sich die Werkstatt der Schmiede befand, träumte Jos davon, wie es wäre, mit Sara zusammen in diesem Haus zu leben. Sie könnten sich immer sehen, würden bei Tisch nebeneinander sitzen und sich heimlich an den Händen berühren oder Küsse tauschen, wenn sie einander in einer düsteren Ecke begegneten. Und dennoch stünde sie unter der Verantwortung des Hausherrn. Er würde dafür Sorge tragen müssen, dass sie satt wurde, etwas zum Anziehen und ein Lager hatte und nicht Jos. Ein wenig schämte er sich für seine Gedanken. Natürlich würde er für Sara sorgen, sobald er eigene Heller verdiente. Er würde das Bürgerrecht erwerben und sie heiraten. Doch spätestens bei diesem Gedanken fühlte Jos wieder den altbekannten Druck auf seiner Brust, der es ihm schwer machte, frei zu atmen. Zum Glück trat er in diesem Augenblick in die Schmiede und eine Stimme riss ihn aus seinen Überlegungen.
»Ah, unser neuer Lehrbub hat sich schon von seinem Lager erhoben. Einen Guten Morgen wünsche ich!«
Jos grüßte zurück. Er hatte die Stimme des alten Meisters sofort erkannt. Bis sich seine Augen an die Düsternis in der Werkstatt gewöhnt hatten, dauerte es noch einige Augenblicke. Ruprecht Buchner saß in einem bequemen Stuhl neben der Esse, in der es noch leicht glühte.
»Du kannst das Tor öffnen und das Feuer schüren«, wies ihn der Alte an. Jos gehorchte. Kühle Morgenluft schlug ihm entgegen, getränkt von den Gerüchen des feuchten Morasts auf der Gasse. Es regnete leicht und die Wolken drückten düster auf die Stadt herab.
»Dass Ihr so früh schon hier unten seid, Meister Ruprecht«, sagte Jos erstaunt, während er Holzkohle in die Esse schaufelte.
»Ach, ich bin jeden Morgen noch vor den Hähnen auf«, erwiderte der Alte. »Der Schlaf ist mir ein scheuer Gefährte geworden. Und hier unten war ich die ganze Nacht.« Er nickte in Richtung eines Bretterverschlags im Hintergrund der Schmiede. »Ich meide diese Treppen, so oft ich kann, seit meine Beine so schwach geworden sind wie die eines neugeborenen Füllens. Die Tage, an denen ich nicht einmal zum Nachtmahl die Küche aufsuchen kann, werden immer häufiger.« Er seufzte. »Nun, ich will nicht ungerecht sein. Gestern war ein guter Tag. Mal sehen, was der Herr im Himmel heute für mich bereithält.«