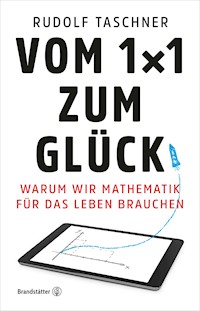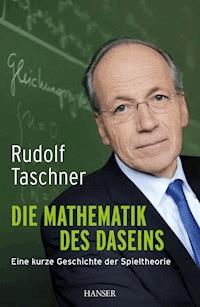
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das Leben ist ein Spiel, das mathematischen Regeln folgt; unsere Entscheidungen können berechnet, ihr größtmöglicher Nutzen kann für alle kalkuliert werden. Diese Idee der Spieltheorie hat im 20. Jahrhundert Wirtschafts-, Politik- und Kulturgeschichte geschrieben. Spieltheoretiker waren Berater im Kalten Krieg. Und ohne dass sie es ahnten, legten sie das Fundament für den Siegeszug des Homo oeconomicus. In seiner fulminanten Geschichte der Spieltheorie spannt Bestsellerautor Rudolf Taschner einen Bogen von der Erfindung der Wahrscheinlichkeitsrechnung im 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart der globalen Finanzmärkte. Ein Buch über die Mathematik als Sinnsuche – fesselnd wie ein Kriminalroman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rudolf Taschner
Die Mathematik des Daseins
Eine kurze Geschichte der Spieltheorie
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches oder von Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2015 Carl Hanser Verlag München
Internet: http://www.hanser-literaturverlage.de
Herstellung: Denise Jäkel
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
unter Verwendung einer Fotografie von Heribert Corn
Datenkonvertierung E-Book: Kösel Media GmbH, Krugzell
ISBN 978-3-446-44479-9
E-Book-ISBN 978-3-446-44480-5
Inhalt
Die Spieler
ISpielen mit Wasser und Diamanten
Wien, zwischen 1870 und 1928
IISpielen mit der Kreide
Wien, 1921
IIISpielen mit den Zahlen
Lyon, 1612
IVSpielen mit dem Zufall
Port Royal des Champs bei Paris, 1655
VSpielen mit der Zeit
Philadelphia, 1746 – Amsterdam, 1636/37
VISpielen mit System
Paris und Port Royal des Champs, 1659 – Sankt Petersburg, 1738
VIISpielen mit Gelehrten
Wien, zwischen 1921 und 1934
VIIISpielen mit zwei Karten
Princeton, New Jersey, 1938
IXSpielen mit Leben und Tod
Budapest, 1908 – Princeton, New Jersey, zwischen 1929 und 1957
XSpielen mit Hasenfüßen und Löwen
Princeton, New Jersey, 1949
XISpielen mit Gefangenen
Stanford bei Palo Alto, Kalifornien, 1949
XIISpielen mit Gewinn
Berkeley bei San Francisco, Kalifornien, 1980
XIIISpielen mit der Polizei
Wien, 2002
XIVSpielen mit Informationen
New York City, 1990
XVSpielen mit der Sprache
Cambridge, zwischen 1928 und 1946
XVISpielen mit Gefühlen
Ios, um 850 v. Chr. – Barcelona, 2014 – Rom, 1900 – Wien, 1786
XVIISpielen mit dem Dasein
Paris, 1662
Dankesworte
Wien, 2015
Glossar
Zahlenspiele
Aufgaben
Antworten
Die Spieler
Carl Menger von Wolfensgrün (1840 – 1921): Nationalökonom, Begründer der Grenznutzentheorie und der Österreichischen Schule der Nationalökonomie
Hans Hahn (1879 – 1934): Mathematiker und Mitbegründer des Wiener Kreises
Claude Gaspard Bachet de Méziriac (1581 – 1638): Mathematiker, Linguist, Universalgelehrter, für ein Jahr Mitglied des Jesuitenordens
Pierre de Fermat (1607 – 1665): Rechtsgelehrter und Hobbymathematiker, zusammen mit Blaise Pascal Erfinder der Wahrscheinlichkeitsrechnung
Benjamin Franklin (1706 – 1790): Drucker, Verleger, Schriftsteller, Naturwissenschaftler, Erfinder und Staatsmann
Nikolaus Bernoulli (1687 – 1759): Neffe des Jakob Bernoulli, Herausgeber der „Ars conjectandi“ seines Onkels, Erfinder des Sankt-Petersburg-Paradoxons
Karl Menger (1902 – 1985): Mathematiker, Mitglied beziehungsweise Nahestehender des Wiener Kreises
Oskar Morgenstern (1902 – 1977): Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Österreichischen Instituts für Konjunkturforschung, zusammen mit John von Neumann Erfinder der Spieltheorie
John von Neumann (1903 – 1957): Mathematiker, mathematischer Physiker, Computerpionier, zusammen mit Oskar Morgenstern Erfinder der Spieltheorie
John Forbes Nash Jr. (1928 – 2015): Mathematiker, Spieltheoretiker, Erfinder des nach ihm benannten Gleichgewichts
Albert William Tucker (1905 – 1995): Mathematiker, Spieltheoretiker, Doktorvater von John Nash
Anatol Rapoport (1911 – 2007): Konzertpianist, Mathematiker, Spieltheoretiker, Biologe und Systemwissenschaftler
Karl Sigmund (geb. 1945): Mathematiker, Spieltheoretiker, Mathematikhistoriker mit der Zeit des Wiener Kreises als Schwerpunkt
Marilyn vos Savant (geb. 1946): Kolumnistin und Schriftstellerin
Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951): Philosoph, Volksschullehrer, Gärtner, Architekt, Erfinder des Sprachspiels
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Komponist
Blaise Pascal (1623 – 1662): Mathematiker, Physiker, Literat, Philosoph, Berater und Freund des passionierten Spielers und Glücksritters Antoine Gombaud, genannt Chevalier de Méré
sowie eine Unzahl weiterer, sowohl historischer wie auch erfundener Personen als Mitspieler
I Spielen mit Wasser und Diamanten
Wien, zwischen 1870 und 1928
„Dieses Buch ist ein Meisterwerk.“
Karl Menger strahlt vor Freude. Er hat sich Lob erwartet, aber dass es von seinem Lehrer Hans Hahn so deutlich ausfällt, überrascht ihn doch.
Keinen seiner Schüler, mit Ausnahme des eigenartigen Kurt Gödel, eines Eigenbrötlers am Institut, schätzte Hahn so sehr wie den jungen Menger. Man musste immer „der junge Menger“ sagen, wenn man ihn meinte. Denn sein Vater, „der alte Menger“, war vor Jahren ebenfalls Professor an der Universität Wien gewesen. Eine Berühmtheit: der Schöpfer der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Zu allem Überdruss trugen Sohn und Vater klanglich den gleichen Vornamen: Nur im Anfangsbuchstaben, dem altertümlichen C beim Vater und dem modernen K beim Sohn, unterschieden sie sich.
Eigentlich hatte der alte Menger gehofft, der Sohn würde in seine Fußstapfen treten. Er selbst stammte aus der tiefsten Provinz, aus Neu-Sandez in Galizien, einer Stadt, berühmt für ihre chassidische Gemeinde und den bis zu seinem Tode 1876 dort lehrenden Rabbiner Chaim Halberstam. Als Sohn einer wohlhabenden Beamtenfamilie, der Vater Anton war Rechtsgelehrter, die Mutter Caroline Tochter eines vermögenden böhmischen Kaufmanns, kam Carl Menger dort 1840 zur Welt. Es war eine kleine, eine verträumte Welt. Seitdem Kaiserin Maria Theresia Galizien 1772 als traurigen Ersatz für das von ihr begehrte und reiche Schlesien erhalten hatte – „sie weinte, aber sie nahm“, spottete der siegreiche Erzrivale und Preußenkönig Friedrich –, siedelten die Habsburger Ärzte, Rechtsanwälte, Lehrer, Beamte in diesem verwunschenen Land an. So hielten sie es mit allen ihren Provinzen, was diesen zwar nicht Freiheit, gar Eigenständigkeit, aber wenigstens ein gewisses Maß an Wohlstand, Sicherheit und Fortschritt bescherte.
Für den jungen Carl Menger war diese Welt zu eng. Er studierte Jurisprudenz in Prag und in der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien, wo er sich als Journalist niederließ. Dabei verfasste er feuilletonistische Artikel, die zuerst in der Lemberger Zeitung – Lemberg war die Hauptstadt Galiziens – und später in der Wiener Zeitung erschienen. Bevorzugt schrieb er Romane und Komödien, die in Serie gedruckt wurden, Gelegenheitswerke, die sein eigentliches Interesse, das Studium der Rechtswissenschaft und der „politischen Ökonomie“, begleiteten. Daneben genoss er die Bekanntschaft mit dem damaligen Staatsminister Richard Graf von Belcredi, der ihn mit Problemen der Volkswirtschaft vertraut machte. So konnte Carl Menger die Wiener Zeitung mit seinen Marktanalysen bereichern – der Beginn seines intensiven Interesses für die Gesetze der Ökonomie.
Es war ein wirtschaftstheoretisches Paradoxon, das den eben erst zum Doktor ernannten Juristen und Wirtschaftsjournalisten monatelang beschäftigte: genauer das „Wasser-Diamanten-Paradoxon“. Niemand kann ohne Wasser leben. So gesehen ist es ein sehr hohes Gut. Nur ganz wenige Menschen brauchen wirklich Diamanten. So gesehen sind Diamanten fast wertlos. Trotzdem zahlt man für Diamanten horrende Summen, für Wasser hingegen fast nichts.
Adam Smith, der im 18. Jahrhundert lebende Begründer der Nationalökonomie, glaubte dieses Paradoxon lösen zu können, indem er zwischen dem „Gebrauchswert“ und dem „Tauschwert“ unterschied: Der Gebrauchswert von Wasser ist sehr hoch, denn jeder benötigt es. Dafür ist der Tauschwert von Wasser gering. Ganz im Gegensatz dazu ist der Tauschwert des Diamanten sehr hoch, daher der hohe Preis, obwohl der Gebrauchswert des Diamanten gering ist. Wirklich befriedigend ist dieser Ansatz einer Erklärung nicht. Denn wie es zum Unterschied in der Höhe des Tauschwerts kommt, bleibt im Dunklen.
Schon vor Adam Smith hatte der schottische Bankier John Law festgestellt: „Wasser besitzt großen Nutzen, aber geringen Wert, die Menge des Wassers ist nämlich viel größer als die Nachfrage danach. Diamanten haben geringen Nutzen, aber großen Wert, da die Nachfrage nach Diamanten viel größer als ihre Menge ist.“ Damit dürfte er den Angelpunkt fixiert haben, mit dessen Hilfe das Paradoxon aufgelöst werden kann.
Carl Menger entwirft zur Erklärung des „Wasser-Diamanten-Paradoxons“ das Bild eines Bauern, der fünf Säcke Weizen sein Eigen nennt. Den ersten Sack Weizen betrachtet er als lebensnotwendig, denn damit bäckt er sein Brot. Er muss nicht verhungern. Mit dem Weizen des zweiten, für ihn immer noch wertvollen Sackes bäckt er noch mehr Brot. Das gibt ihm und den Seinen Kraft. Mit dem Weizen des dritten Sackes, der nicht mehr ganz so wertvoll ist, kann er die Tiere seines Stalls füttern. Den Weizen des vierten Sackes hortet er als Saatgut für das nächste Jahr. Den Weizen des fünften Sackes braucht er eigentlich nicht mehr. Der Bauer brennt aus dem Weizen des fünften Sackes Korn, einen Getreideschnaps.
Sollte dem Bauern einer seiner fünf Säcke gestohlen werden, was würde er tun? Wäre der Nutzen von Weizen stets der gleiche, müsste er eigentlich den Weizen der verbliebenen vier Säcke auf fünf gleich große Haufen aufteilen und mit jedem der Haufen dasselbe anstellen wie mit den Säcken zuvor: den ersten Haufen für das lebensnotwendige Brot verwenden, den zweiten Haufen für das stärkende Brot, den dritten Haufen für das Füttern der Tiere, den vierten Haufen für das Horten des Saatguts und den fünften für das Brennen des Korns. Aber kein Bauer – denn Bauern sind bekanntlich klug – wird so verfahren. Die verbliebenen vier Säcke wird er vielmehr so verwenden wie zuvor beschrieben. Nur das überflüssige Brennen des Schnapses wird er unterlassen.
Bauern sind sogar so klug, dass sie sich nicht bestehlen lassen. Doch verkaufen könnte der Bauer seinen fünften Sack, anstatt ihn selbst zu Korn zu brennen, den er und die Seinen vielleicht nie trinken werden. Wie lautet aus der Sicht des Bauern der angemessene Preis? Carl Menger kennt die Antwort: Es ist jener Preis, den er für den Erwerb des fünften Sackes zahlen würde, mit dessen Weizen er den Schnaps brennt.
Nicht der absolute oder der durchschnittliche Nutzen von Weizen, sondern sein „Grenznutzen“ bestimmt den Preis: jener Nutzen, den dem Bauern über die bereits bei ihm gelagerten Säcke hinaus ein weiterer Sack bringt. Darum, so Carl Menger, ist Wasser so billig: Ein weiterer Liter Wasser zu dem sprichwörtlichen Überfluss des bereits vorhandenen wird als eher bedeutungslos empfunden. Allein inmitten der Sahara wird Wasser mit Diamanten aufgewogen.
Die aus diesen einfachen Gedanken entwickelte wirtschaftliche Theorie machte Carl Menger in der wissenschaftlichen und politischen Welt berühmt. Er wurde zu einer der einflussreichen Persönlichkeiten der Habsburgermonarchie. Die Universität Wien ernannte ihn zum Privatdozenten, später zum Professor an der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät, und Kaiser Franz Joseph höchstselbst wurde auf ihn aufmerksam. Ihm wurde die Ehre zuteil, dem Monarchen drei Monate lang die Grundzüge seiner Volkswirtschaftslehre darzulegen. Des Kaisers achtzehnjähriger Sohn Rudolf bekam ihn als Privatlehrer zugewiesen, und tatsächlich bereisten die beiden zwei Jahre lang ganz Europa. Während dieser Zeit und in den nachfolgenden Jahren bis zum Tod Rudolfs dürfte Menger den hochbegabten und sensiblen jungen Mann zum Freund gewonnen und in ihm Interessen für eine moderne, liberale Staatsführung geweckt haben. Aber alle Hoffnungen, die dem jungen Kronprinzen von Seiten der Liberalen entgegengebracht wurden, machten die Schüsse zunichte, mit denen er 1889 im Alter von dreißig Jahren seine junge Geliebte, die siebzehnjährige Baroness Mary Vetsera, und sich selbst niederstreckte.
Den guten Beziehungen zum Kaiserhaus dürfte es Carl Menger zu verdanken haben, dass sein 1902 in Wien geborener Sohn Karl als legitimes Kind anerkannt wurde. Denn Karls Mutter, Hermine Andermann, war Jüdin. Der katholische Vater und die jüdische Mutter konnten in einem Land, das nur von der Kirche oder der Synagoge durchgeführte Trauungen anerkannte, nicht heiraten. Die beiden lebten in einer eheähnlichen Gemeinschaft, einer, wie man damals sagte, Marriage sui juris. Kinder aus solchen Verbindungen galten als unehelich, was eine gesellschaftliche Ächtung bedeutete. Schon vorzeitig, kurz nach der Geburt seines Sohnes, ließ sich Carl Menger in den Ruhestand versetzen, um seine Familie so vor Tratsch zu beschützen. Umso dankbarer war er dem Kaiserhaus, dass seiner Bitte, den Status des unehelichen Kindes für seinen Sohn aufzuheben, nachgekommen wurde.
Mengers Weggang von der Universität bedeutete für diese einen herben Verlust, der allein dadurch gemildert wurde, dass er auch als von seinen Verpflichtungen befreiter Professor weiter Kontakt zu seinen Schülern hielt. Felix Somary, den Menger in den letzten Jahren seines aktiven Dienstes bereits als Achtzehnjährigen zu seinem Assistenten ernannte, schreibt in seinen Erinnerungen: „Die Wiener Universität stand in jenen Tagen an der Spitze der nationalökonomischen Schulen der Erde: Carl Menger, der führende nationalökonomische Theoretiker, und nach ihm seine großen Schüler Böhm-Bawerk und Wieser, Philippovich, der Meister des objektiven Resümees, Inama-Sternegg, der erste Wirtschaftshistoriker – das war ein einzigartiges Zusammenwirken großer Persönlichkeiten. Die Diskussionen in den Seminarien waren auf hohem Niveau, da auch unter den Studenten meines Jahrgangs ungewöhnliche Begabungen waren, wie Schumpeter, Pribram, Mises, Otto Bauer, Lederer, Hilferding. Keiner von ihnen sollte sein Leben in Österreich beschließen.“
Allen seinen Erfolgen zum Trotz muss man sich Carl Menger als schwermütigen Menschen denken: Seine wissenschaftlichen Leistungen wurden von der deutschen „Historischen Schule der Nationalökonomie“, namentlich von ihrem Hauptvertreter Gustav Schmoller, erbittert bekämpft. Die Ehrungen, die Ernennung zum Hofrat, die Aufnahme in das Österreichische Herrenhaus, bedeuteten ihm, der sein Adelsprädikat „von Wolfensgrün“ nie in Anspruch nahm, wenig: Er sah in der Abkehr vom Liberalismus einen Weg in die Katastrophe und fühlte sich nach Ausbruch und den für das Habsburgerreich bitteren Verlauf des Ersten Weltkriegs darin bestätigt. Die, wie Stefan Zweig sie nannte, „Welt von gestern“ war unwiederbringlich zerbrochen, und die Träume von einer besseren, wirtschaftlich auf festem Fundament stehenden und prosperierenden Welt waren für immer verflogen.
Angesichts eines solchen Vaters, der bei der Geburt des Sohnes und einzigen Kindes immerhin schon 62 Jahre zählte, war die Kindheit des jungen Karl – war sie finanziell auch noch so gut abgesichert und behütet – sicher nicht frei von Trübsal. Das imposante Bild des Vaters vor Augen, legte der Bub schon mit jungen Jahren die strengsten Maßstäbe an sich selbst an. Er ging in eines der besten Gymnasien der Stadt, im Nobelbezirk Döbling zwischen Wienerwald und Stadtzentrum gelegen, und fühlte sich stets verpflichtet, nur exzellente Noten zu erhalten, womöglich der Beste der Schule zu sein. Leicht wurde es ihm dabei nicht gemacht, denn Richard Kuhn und Wolfgang Pauli waren unter seinen Mitschülern, nur zwei Klassen über ihm. Der hochbegabte Richard Kuhn studierte später Chemie, entwickelte die sogenannte Chromatographie so weit, dass sie sich für chemische Analysen eignete, und errang den Nobelpreis für seine Arbeiten über Carotinoide und Vitamine. Noch beeindruckender war Wolfgang Paulis brillanter Intellekt: Er wurde später „das Gewissen der Physik“ genannt, weil sein kritischer Blick bei allen Hypothesen, die Bohr, Heisenberg, Dirac und alle anderen Größen der Quantenphysik zum Besten gaben, stets die Spreu vom Weizen zu trennen verstand. Den Nobelpreis erhielt er für die Entdeckung des nach ihm benannten Ausschließungsprinzips, mit dessen Hilfe die Physik eine Erklärung für das Periodensystem der chemischen Elemente bereitstellen konnte.
Mit Sicherheit versuchte Karl Menger sich an Paulis Intellekt zu messen. Pauli genoss es, seinen Scharfsinn zu zelebrieren. Als einmal der Physiklehrer an der Tafel einen Fehler machte und diesen trotz minutenlangen Suchens nicht finden konnte, grinste Pauli diebisch von einem Ohr zum anderen, bis der Professor dem Wunderschüler vor der erheiterten Klasse zurief: „Pauli, jetzt sagen Sie mir schon, wo der Fehler ist. Sie wissen es doch schon längst.“ Nach dem in Österreich „Matura“ genannten Schulabschluss veröffentlichte Pauli einen wissenschaftlichen Artikel zur Allgemeinen Relativitätstheorie, der selbst Einstein beeindruckte. Und nach wenigen Semestern des Physikstudiums in München verfasste er einen langen Beitrag zur Relativitätstheorie für die Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften, der 1921 auch als selbständiges Buch erschien, von Einstein hymnisch gepriesen und zu einem Klassiker wurde.
Physik: An diesem Fach kann man seine geistigen Kapazitäten messen. Davon war Karl Menger, der Mitschüler und Bewunderer Paulis, überzeugt. Seinen nach Kriegsende 1918 in der Zurückgezogenheit lebenden Vater davon zu überzeugen, dürfte dem Sohn nicht ganz leicht gefallen sein. „Zuerst wolltest du ans Theater, was ich dir gottlob ausreden konnte, und nun kommst du mir mit diesem Hungerleiderstudium!“, hören wir den Vater poltern. Tatsächlich hatte sich Karl nicht nur an Pauli, sondern auch an seinem Kommilitonen Heinrich Schnitzler messen wollen. Dessen Vater Arthur war einer der bedeutendsten Dramatiker deutscher Sprache, und Heinrich selbst nahm sich vor, Schauspieler und Filmregisseur zu werden. Sein ihn bewundernder Freund Karl trug sich seither mit den Gedanken, Theaterstücke zu schreiben. Entwürfe eines Dramas mit der legendären mittelalterlichen Päpstin Johanna als Hauptfigur lagen in der Schublade seines Schreibtischs.
„Vergiss meine Ambitionen für das Theater, Papa, aber glaube mir, dass ich mit dem Studium der Physik die richtige Wahl treffe“, versucht sich Karl seinem Vater zu erklären. „Ich meine, dass ich dafür begabt bin. Ich interessiere mich ernsthaft für die Prinzipien der Naturlehre, für das Goethe’sche ,Was die Welt im Inneren zusammenhält‘. Und im Übrigen wäre es schlecht, würde ich mich den Wirtschaftswissenschaften zuwenden: Nie könnte ich mit dir konkurrieren, und ich will es auch nicht.“ Der alte Menger brummt Unverständliches und entlässt den Sohn aus seinem Arbeitszimmer. Der Weg zum Physikstudium war für Karl Menger geebnet.
In dem großen grauen Gebäude an der Währingerstraße 38 – 42, die vom Zentrum Wiens in die Außenbezirke Währing und Döbling führt, waren die Institute der Chemie, der Physik und der Mathematik untergebracht. Dort gab es die damals nach den neuesten Errungenschaften eingerichteten Labors, die Seminarräume und die Hörsäle. Die beste Zeit hatte das Gebäude allerdings bereits hinter sich, denn nach dem Krieg war die junge Republik ohne moderne Industrie: Die wichtigsten Industriezentren, vor allem jene in Böhmen und Mähren, gingen nach dem Zusammenbruch der Monarchie an die Tschechoslowakei und andere Nachfolgestaaten verloren. Mit einer Zweimillionen-Metropole, bevölkert von viel zu vielen Beamten, als Hauptstadt und mit einem noch stark von der veralteten Agrarwirtschaft durchdrungenen Hinterland, kann ein verarmtes Land, voll von Kriegsinvaliden, Witwen und Waisen, geplagt von der damals grassierenden Spanischen Grippe, keine großen Sprünge machen. An eine intensive Förderung der Forschung war nicht zu denken. Man war froh, wenn die Universität recht und schlecht ihren Betrieb fortsetzen und das Personal mit den geringen Löhnen bei der Stange halten konnte. Pauli hat vielleicht Recht damit, sich an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zu immatrikulieren, wird sich der junge Menger gedacht haben, als er den großen staubigen Hörsaal der Mathematik im unteren Erdgeschoss betritt. Aber man kann nach zwei, drei Semestern immer noch den Studienort wechseln. Die Eltern, zumal den alten Vater, im trist gewordenen Wien allein zu lassen, bringt er zumindest jetzt nicht übers Herz.
Die Allgemeine Relativitätstheorie, mit der sich Mengers Schulfreund Pauli bereits einen Namen gemacht hat, wurde im hoch gelegenen vierten Obergeschoss des gleichen Gebäudes vom brillanten Physikprofessor Hans Thirring, einem Freund und hinsichtlich ihres Pazifismus Bundesgenossen Einsteins erklärt. Allerdings nicht in den Anfängervorlesungen zur Physik, die man in den tiefer gelegenen Stockwerken zu Studienbeginn besuchen musste. Zusätzlich waren im Parterre Mathematik-Vorlesungen zu belegen, mit denen man das Rüstzeug für die Beschäftigung mit theoretischer Physik erwarb. Auch im Stundenplan spiegelte sich dies wider: Die Vorlesungen zur Mathematik fanden um acht und neun Uhr statt, erst um zehn und elf Uhr folgten die Vorlesungen zur Physik. Und so sehen wir den jungen Menger um acht Uhr die wenigen Stufen hinunter zum Hörsaal für Mathematik gehen und den bereits schütter besuchten Lehrsaal betreten.
Ein Professoren-Trio, alle drei von Weltrang, hatte zu dieser Zeit im mathematischen Institut die Forschungs- und Lehrverpflichtungen inne. Wilhelm Wirtinger, aus Ybbs, einer kleinen Stadt hundert Kilometer westlich von Wien, stammend, hatte als junger Mann in Göttingen, der damaligen Hochburg der Mathematik, bei dem berühmten Gelehrten Felix Klein studiert und sich als vielseitig begabter Mathematiker bewährt. Seine große hagere Gestalt, der gepflegte Schnauzbart in seinem hohen, ovalen Gesicht und die Würde, mit der er sein Amt ausführte, verliehen ihm ein achtunggebietendes Äußeres. Und Hofrat Wirtinger – er war der letzte der Wiener Professoren, die noch den Hofratstitel erhalten hatten – hielt Vorlesungen auf allerhöchstem Niveau: ungewohnt anspruchsvoll und nur für Studenten, die sich dafür gut vorbereitet hatten.
Ebenso aus Göttingen kam der im niedersächsischen Elze geborene Philipp Furtwängler als Professor der Mathematik nach Wien. Er war Cousin des Dirigenten Wilhelm Furtwängler und spezialisiert auf Zahlentheorie, jenes Gebiet, das Gauß die „Königin der Mathematik“ nannte. Gödel pries seine Vorlesungen als die besten, die er jemals gehört hatte. Sie waren tatsächlich einzigartig. Denn durch eine Krankheit war Furtwängler von Hals ab gelähmt. Er musste von Assistenten die Stufen zum Hörsaal hinuntergetragen werden, saß während der Vorlesung vor der Tafel in einem Stuhl und diktierte einem seiner Assistenten, was auf die Tafel zu schreiben sei. Gödel, seit seiner Kindheit Hypochonder erster Klasse, immer vom Wahn verfolgt, bald sterben zu müssen, wollte wie Karl Menger eigentlich Physik studieren, entschloss sich aber angesichts der Vorlesungen Furtwänglers, zur Mathematik zu wechseln. Vielleicht auch aus folgendem Grund, den er sich mit seinen bizarren logischen Schlüssen zurechtgelegt haben mag: „Furtwängler, das war offensichtlich, ist wirklich krank. Ich, Gödel, bilde es mir vielleicht nur ein – aber man weiß ja nie. Trotzdem: Wenn der wirklich kranke Furtwängler so alt werden kann, dürfte die Beschäftigung mit Mathematik einem langen Leben zuträglich sein. Sollte ich wirklich krank sein, ist es daher sinnvoll, sich dem Studium der Mathematik zu widmen. Denn sie wirkt lebensverlängernd.“
Der Dritte im Bunde, Hans Hahn, war es, der Karl Menger veranlasste, vom Physik- zum Mathematikstudium zu wechseln. Der Grund dafür war nicht so skurril wie bei Gödel, sondern für normal denkende Menschen nachvollziehbar: Hahn faszinierte Menger weniger wegen der Bravour seines Vortragsstils, sondern vielmehr deshalb, weil er etwas ganz anderes zu sagen hatte, als man von Mathematikern mit ihren Gleichungen und Formelungetümen gewohnt ist. Hahn konzentrierte sich in seiner Vorlesung auf das Grundsätzliche. Die besonders einfach klingenden Begriffe galt es zu erörtern.
„Was ist eine Kurve?“, fragt Hahn das verdutzte Publikum im Hörsaal und schweigt danach ein paar Sekunden. Mit verschmitztem Lächeln unterbricht er die von ihm erzeugte Stille: „Wenn Sie meinen, meine Damen und Herren“ – einige Frauen hatten damals bereits den Mut gefasst, das typische Männerfach der Mathematik für sich zu erobern, manche, wie Eleonore Minor, Hahns spätere Gattin, oder Olga Taußky, mit beachtlichem Erfolg –, „wenn Sie also glauben, diese Frage sei zu simpel, dann vergessen Sie sie einfach. Wandeln Sie wie die vielen anderen auch auf den ausgetretenen Pfaden der klassischen Mathematik des vergangenen Jahrhunderts weiter. Aber besuchen Sie nur die Seminare meiner Kollegen, nicht die meinen. Denn in meinem Seminar werde ich mich dieses Sommersemester nur mit dieser Frage beschäftigen: Was ist eine Kurve?“
Der junge Menger ist wie elektrisiert. Natürlich will er, obwohl erst am Anfang des Studiums, am Seminar teilnehmen.
Nach der ersten Seminarstunde, in der Hahn über die verschiedenen Versuche von Mathematikern berichtete, den Begriff der Kurve exakt zu fassen, wobei keiner der Vorschläge vollauf befriedigte, sehen wir Menger verwirrt und beglückt zugleich nach Hause gehen. Da wurde vor ihm von einem Problem gesprochen, das durch glasklares logisches Denken einer Lösung zugeführt werden müsse. Er sperrt sich in sein Zimmer ein, vergisst alles um sich herum und versucht nur, seine Gedanken möglichst konzise zu Papier zu bringen. Stunden später – der Papierkorb quillt über und Menger ist völlig erschöpft – glaubt er, Licht am Ende des sprichwörtlichen Tunnels zu erblicken.
„Vielleicht ist es nur eine Lokomotive, die dir entgegenfährt.“ Mengers um ein Jahr älterer Schulfreund Otto Schreier, der nun zusammen mit ihm Mathematikvorlesungen hört, versucht den von seinen Ideen Begeisterten auf den Boden der Realität zurückzuholen. Sie treffen einander, wo man in Wien einander immer trifft: im Kaffeehaus. Der junge Menger berichtet dem skeptischen Schreier, welche Gedanken er am Vortag stundenlang wälzte. „Bedenke doch“, redet Schreier nun auf Menger ein, „ein ausgewiesener Mathematiker wie Hausdorff im kleinen Greifswald hat wildeste Beispiele von Kurven untersucht, und er bezweifelt, dass man je eine exakte Definition der Kurve finden werde. Hahn hat das wohl noch gar nicht in seinem Seminar mitgeteilt.“
„Ich werde in Hahns Sprechstunde gehen“, gibt sich Menger überzeugt, die von ihm ersonnene Lösung werde den Segen des Professors finden. Schreier wünscht ihm viel Glück.
Tatsächlich gibt sich Hahn zunächst sehr reserviert, als der blutjunge Menger in sein Zimmer tritt und ihm eröffnet, dass er glaube, die Frage nach dem Wesen einer Kurve beantworten zu können. Doch als der junge Mann mit erregter Stimme seine Ideen zu formulieren versucht, erkennt Hahn das stupende Talent, das Menger für die Beantwortung von Fragen, wie er sie liebte, besitzt. „Machen Sie weiter“, fordert er ihn auf, „Ihre Ansätze sind vielversprechend. Noch mehr: ich glaube sogar, sie sind zielführend.“ Als Menger das Zimmer verlässt, fühlt er sich wie auf Wolken schwebend. Nun weiß er, dass er für die Mathematik bestimmt ist.
Hahn förderte Menger, so gut er konnte. In kürzester Zeit schloss Menger seine Lehrjahre bei ihm mit dem Doktorat ab. Hahn verschaffte ihm eine Assistentenstelle bei einem der weltweit eminentesten Mathematiker, dem in Amsterdam lehrenden Luitzen Egbertus Jan Brouwer. Und als Menger, keine 26 Jahre alt, nach Wien zurückkehrte, bekam er eine Professur für Geometrie zugewiesen – das Manuskript seines Buches war da bereits fast fertig. „Dimensionstheorie“, so sollte der Titel lauten.
Mit dem frisch gedruckten Erstexemplar in der Hand klopft er an der Tür von Hahns Zimmer im Institut. Stolz überreicht er es ihm. „Dieses Buch ist ein Meisterwerk“, das ist nicht nur Hahns hymnisches Urteil.
II Spielen mit der Kreide
Wien, 1921
„Was ist eine Kurve?“
Wir kehren ins Jahr 1921 zurück, zu dem Zeitpunkt, als Karl Menger, vor kurzem erst an der Universität eingeschrieben, gebannt dem Vortrag von Hans Hahn lauscht. In dem kleinen Seminarraum stellt der Professor mit derselben lauten, durchdringenden Stimme wie im großen Hörsaal gleich zu Beginn diese Frage und wiederholt sie theatralisch: „Was ist eine Kurve?“ Er malt einen großen Violinschlüssel an die Tafel: „Sie alle werden sagen, dass dies eine typische Kurve ist. Und Sie haben Recht“, fährt er fort. „Aber durch das Aufzeigen eines für alle einsichtigen Beispiels ist keine Definition erbracht. Im Wort Definition steckt das lateinische finis, das ,Grenze‘ bedeutet. Eine Definition ist eine Abgrenzung. Wir versuchen in diesem Seminar die Grenze so zu ziehen, dass alles, was von der Grenze eingeschlossen wird, den Namen ,Kurve‘ verdient, und nichts, was außerhalb der Grenze liegt, eine ,Kurve‘ genannt wird.“
Hahn malt eine geradlinige Strecke an die Tafel. „Manche von Ihnen werden meinen, dass man hier nicht von einer ,Kurve‘ sprechen soll, weil Kurven stets mit Krümmungen versehen sind. Die Fiaker“, so werden in Wien die Pferdekutscher genannt, „sehen das jedenfalls so: Wenn sie die kerzengerade Prater-Hauptallee entlangfahren, werden sie nie behaupten, sie bewegen sich entlang einer Kurve. Eine Kurve bedeutet bei ihnen, dass sie mit den Zügeln ihre Pferde nach rechts oder nach links steuern müssen. Aber wir hier“, Hahn überstreicht mit seinem mächtigen rechten Arm symbolisch seine Zuhörer, „sind Mathematiker und keine Fiaker.“ Schmunzeln im Publikum. „Wir lassen auch die nicht gekrümmte, die geradlinige Strecke als Kurve zu. Das ist sehr sinnvoll.“ Hahn heftet an die eben gezeichnete Strecke mit der Kreide einen Halbkreisbogen an: „Dieses hakenförmige Gebilde werden Sie alle wohl auch eine Kurve nennen. Die geradlinige Strecke, die ich zuvor zeichnete, ist ein Teil dieser Kurve. Es wäre doch unvernünftig, wenn wir diesen geradlinigen Teil der Kurve plötzlich nicht mehr ,Kurve‘ nennen.“
„Aber nicht jeder Teil einer Kurve muss eine Kurve sein“, unterbricht ihn ein vorwitziger älterer Student.
Hahn horcht erfreut auf: „Ja, weiter“, stachelt er ihn zum Widerspruch an.
„Einen einzelnen Punkt der Kurve würde ich nicht mehr eine ,Kurve‘ nennen“, fährt der Student fort, „und wenn ich eine Kurve in zwei Teile zerlege, die voneinander getrennt sind, mögen die beiden einzelnen Teile noch Kurven sein. Aber die beiden Teile als ein Ganzes betrachtet bilden keine Kurve mehr.“
„Ausgezeichnet“, antwortet Hahn und strahlt den Studenten an. „Damit haben wir wenigstens zwei Wesensmerkmale einer Kurve fixiert: Erstens muss eine Kurve stets aus mehr als nur aus einem Punkt bestehen. Und betrachtet man zwei Punkte der Kurve, muss es gelingen, die beiden entlang der Kurve zu verbinden.“ Und nach einer bedeutsam erscheinenden Pause fährt er fort: „Wie aber sollen wir dies exakt verstehen: dass man zwei Punkte ,entlang der Kurve verbindet‘?“
Menger hört gebannt zu. Nur ganz leise meldet sich sein Gewissen und fragt mit der Stimme seines Vaters: „Das willst du wirklich studieren? Solchen weltfernen akademischen Fragen willst du dein Leben opfern? Sind das nicht Hirngespinste, Luftschlösser, geistige Seifenblasen? Rechtswissenschaft, Medizin, meinethalben auch Technik, das sind handfeste Studien, mit denen man etwas Vernünftiges anfangen kann. Ich will ja nicht von den Wirtschaftswissenschaften sprechen. Hast du es dir wirklich gründlich überlegt?“
Als Hans Hahn mit der Kreide eine Zickzacklinie auf die Tafel zeichnet, verscheucht Menger diese leise bohrenden Fragen. Zu sehr ist er bestrebt, kein Detail des Vortrags zu überhören. „Manche Mathematiker lassen bei Kurven keine Ecken zu“, hört er Hahn dozieren. „Der Rand eines abgerundeten Rechtecks ist in ihren Augen eine Kurve, eine Art Oval, der Rand eines Rechtecks selbst aber nicht. Auch diesen Mathematikern, die sich nur auf ,glatte Kurven‘ versteifen, will ich nicht folgen. Denn der Rand des Rechtecks mit seinen vier Ecken entsteht doch aus dem Grenzübergang von Rändern abgerundeter Rechtecke, wenn die Radien der Kreise bei den Rundungen immer kleiner werden. Wenn ich auch solche Grenzkurven glatter Kurven als ,Kurven‘ zulassen möchte, muss ich genauso eine Zickzacklinie wie die eben gezeichnete eine Kurve nennen.“
Vielleicht hat es Menger noch nicht in diesem Augenblick bewusst erfasst, aber intuitiv dürfte er schlagartig begriffen haben, dass er spätestens jetzt den mit der Stimme seines Vaters bohrenden Gewissensbissen eine Antwort entgegenschleudern kann. Denn solche Zickzacklinien, die Hahn eben an die Tafel malt, kennt er aus den Wirtschaftsseiten der Zeitungen und von den ureigensten Arbeiten seines Vaters und denen seiner Kollegen und Schüler: Es sind die Kurven von Kursen börsennotierter Firmen.
Schon damals, im frühen 20. Jahrhundert, spielten die eigenartigen Graphiken, mit denen die zeitliche Entwicklung des Kurses von Aktien oder Anleihen veranschaulicht wird, für die Makler und Anleger eine wichtige Rolle. Nach rechts hin erstreckt sich die Zeitachse. Von jedem ihrer Punkte aus ist senkrecht der Kurs des betrachteten Wertpapiers eingetragen: weit hinauf, wenn der Kurs phantastische Höhen erklimmt, tief nach unten, wenn er sich im Keller befindet. Das so entstehende Punktgefüge ist der Prototyp einer Kurve. Es ist zwar keine glatte Kurve wie der Violinschlüssel, den Hahn zu Beginn des Seminars an die Tafel malte, aber genauso eine Kurve wie die Zickzackkurve, über die er gerade jetzt spricht. Und es ist eine Kurve, auf welche die Augen vieler gerichtet sind. Denn bei Kurven wie dieser ist viel Geld im Spiel: Entsetzt blicken die Besitzer der Aktien auf sie, wenn die Kurve sich auf Talfahrt befindet. Unbändiger Jubel ertönt, wenn sie plötzlich fast senkrecht nach oben schwenkt.
(1) Hans Hahns Tafelbild zeigt links oben einen Violinschlüssel als glatte Kurve, links unten eine geradlinige Strecke, an die ein Halbkreis anschließt, in der Mitte oben den Rand eines Rechtecks als Kurve mit vier Ecken, in der Mitte unten den Rand eines abgerundeten Rechtecks und rechts eine Zickzacklinie.
Zickzackkurven sind keine Phantasiegebilde von versponnenen Mathematikern, die sich in ihre Elfenbeintürme verkriechen. Die Zickzackkurven der Börse gehen von Hand zu Hand. Von ihrem Verlauf hängen Existenzen von Menschen und Familien, von Firmen und Staaten ab. So ist es naheliegend, sich über ihr eigentümliches Wesen Gedanken zu machen.
Denn sie sind in der Tat eigentümlich: Betrachten wir den Kursverlauf einer börsennotierten Firma mit dem typischen Auf und Ab über den Zeitraum von 1871 bis 1921. Einige der Einbrüche und der in die Höhe schnellenden Ausreißer kann man an den jeweils gleichzeitig stattgefunden habenden historischen Ereignissen festmachen: von der Weltausstellung 1873 in Wien über die Annexion Bosniens 1908 bis hin zu den Verwerfungen des Ersten Weltkriegs. Aber nicht alles lässt sich dadurch erklären. Das unentwegte Hin und Her fand auch in politisch langweiligen Zeiten statt.
Nun nehmen wir eine Vergrößerung dieser Kurve in den Blick: Wir setzen für die Zeitachse den Zeitraum von 1916 bis 1921 fest und tragen für diesen die Kursentwicklung der Firma ein. An dem Auf und Ab von vorher ändert sich nichts. Es ist nicht so, dass die zuvor steil gezeichneten Linien nun entsprechend abgeflacht und ruhig verliefen. In Wahrheit zerfransen sie in unsteter Zickzackform: Die Kurve mag von Ferne besehen einen anderen Eindruck als die vorherige vermitteln. Ihr unruhiges Flattern aber behält sie bei. Genau das Gleiche geschieht, wenn man sich bloß auf den Zeitraum vom 3. Januar 1921, dem ersten Tag, an dem die Börse nach Jahresende wieder geöffnet hatte, bis zum Freitag, dem 4. März 1921 konzentriert: Wo man im vorigen Bild bei 1921 nur einen ruhigen flachen Verlauf vermutet hatte, treten in der Vergrößerung – auch die senkrechte Achse ist entsprechend vergrößert und daher feiner skaliert – plötzlich erhebliche Schwankungen zutage. Und selbst wenn man nur die Woche vom 28. Februar bis zum 4. März in Betracht zieht: An dem unentwegt fahrigen Hin und Her ändert sich nichts.
Wie simpel ist im Vergleich dazu die glatte Kurve des Violinschlüssels, der noch immer auf der Tafel des Seminarraums prangt. Wer die Kursentwicklung der in Augenschein genommenen Firma ganz exakt zeichnen will, muss kläglich scheitern. Vor allem die erste, für den Zeitraum von 1871 bis 1921 gezeichnete Zickzacklinie ist eine fast sträflich grobe Skizze. Aber auch keine der Vergrößerungen gibt das ganz genaue Bild der Kursschwankungen wieder. Keine der unzählig vielen Zacken, die buchstäblich von Augenblick zu Augenblick den Verlauf ändern, kann eine Skizze, möge man sich auch noch so um Genauigkeit bemühen, erfassen.
(2) Links oben ein Kursverlauf über einem langen Zeitintervall. Der im rechten hellgrauen Rechteck erfasste Teil des Kursverlaufs ist rechts oben vergrößert wiedergegeben. Der dort im rechten mittelgrauen Rechteck erfasste Teil des Kursverlaufs ist links unten vergrößert wiedergegeben. Der dort im rechten dunkelgrauen Rechteck erfasste Teil des Kursverlaufs ist rechts unten vergrößert wiedergegeben. Bei jeder Vergrößerung fasert sich der scheinbar aus nur vier Strecken bestehende Kursverlauf zu einer Zickzacklinie aus.
Wollte man die Kurve des Kursverlaufs vollendet präzise darstellen, würde man daran genauso scheitern wie Laurence Sterne bei seiner Biographie des Tristram Shandy: Da der Autor jedes, selbst das kleinste, die Lebensgeschichte seines Helden auch nur im entferntesten betreffende Detail erwähnen will, kommt er trotz eines neunbändigen Werkes, bei dem jeder Band 40 Kapitel umfasst, praktisch nie über die Geburt des Tristram Shandy hinaus. Genauso würde ein pedantischer Graphiker, der sich die Darstellung der exakten Kurve des Kursverlaufs von 1871 bis 1921 vornimmt, am Montag, dem 2. Januar 1871 hängenbleiben.
Wie lang die Kurve des Violinschlüssels ist, kann man ziemlich leicht bestimmen: Am besten zeichnet man in der Kurve nahe beieinanderliegende Punkte ein und ersetzt den Bogen des Violinschlüssels zwischen zwei benachbarten Punkten durch deren geradlinige Verbindung. Dann braucht man nur die Längen der einzelnen kurzen Geradenstücke zu addieren. Zwar erhält man damit nicht exakt die Länge der Kurve selbst, sondern die eines geringfügig kürzeren Streckenzugs. Aber wenn man die eingestreuten Punkte sehr dicht sät, kommt man damit an die wahre Länge der Violinschlüsselkurve beliebig genau heran.
Bei der wilden Zickzackkurve des Kursverlaufs bringt diese Methode der Längenmessung nichts. Sie hat keine „wahre Länge“. Denn bei ihr gilt es unzählig viele Punkte zu verbinden, wobei sich selbst im kleinsten Zeitabschnitt diese überbordende Menge von Punkten nicht vermindert. Es ist schlicht sinnlos, von einer „Länge“ der Kurve des Kursverlaufs zu sprechen. Selbst wenn man behauptet, sie sei unendlich lang, besagt das nicht viel. Was bedeutet „unendlich lang“?
Daran denkt Otto Schreier, als er im Kaffeehaus seinem Schulfreund Menger von Felix Hausdorff erzählt: Vielleicht, in diese Richtung führten die Überlegungen von Hausdorff, ist die Kurve des Kursverlaufs nicht einmal mehr eindimensional. Jedenfalls nicht so eindimensional, wie man sich eine Linie, sei sie geradlinig oder gebogen, eindimensional denkt. Eindimensional in dem Sinn, dass man die Kurve so entlanglaufen kann, wie der Fiaker seinen Weg entlangfährt, ist diese Kurve sicher nicht. Aber zweidimensional, also eine Fläche ausfüllend, ist sie auch nicht. Vielleicht ist die „Dimension“ der Kurve des Kursverlaufs eine „gebrochene Zahl“, irgendwo zwischen 1 und 2 liegend?
(3) Die Länge einer glatten Kurve – wie zum Beispiel des grau gezeichneten Violinschlüssels – wird näherungsweise dadurch erfasst, dass man Punkte der Kurve mit Strecken verbindet und die Längen dieser Strecken addiert. Links sind nur wenige Punkte, in der Mitte mehr Punkte und rechts viele Punkte der Kurve durch Strecken verbunden. Die Längen der Streckenzüge nehmen von links nach rechts zu und beschreiben mit wachsender Genauigkeit die Länge der glatten Kurve.
Menger will sich nicht wie Hausdorff, sondern auf seine Weise dem Problem nähern, systematisch: Es ist klar, dass ein Punkt oder einzelne, verstreut liegende Punkte die Dimension null besitzen. Eine Strecke hat die Dimension eins, auch die Kurve des Violinschlüssels hat die Dimension eins, weil beide Kurven mit einem nulldimensionalen Punkt beginnen und mit einem nulldimensionalen Punkt enden. Ein Quadrat hat die Dimension zwei, weil es von vier eindimensionalen Strecken umrandet wird. Ebenso wird die zweidimensionale Kreisscheibe von der eindimensionalen Kreislinie umrandet. Der dreidimensionale Würfel wird von sechs zweidimensionalen Quadraten umrandet, ebenso die dreidimensionale Vollkugel von der zweidimensionalen Kugelhaut. Auf diese Weise kann man schrittweise zwar nicht die „gebrochenen“ Dimensionen, aber die ganzzahligen Dimensionen in den Griff bekommen: Die Umrandung des Gebildes hat immer eine um eins kleinere Dimension als das Gebilde selbst. Allerdings stellt sich die Frage, ob sich dieser Gedanke auf viel kompliziertere Gebilde als auf einzelne Punkte, Strecken, glatte Kurven, Quadrate, Kreisscheiben, Würfel oder Kugeln übertragen lässt.
Das ist es, was im Gespräch mit Hahn eine Woche später der Professor als „vielversprechenden“, gar als „zielführenden“ Ansatz tituliert. Und darum tauft, sieben Jahre später, Menger sein Buch, in dem diese Gedanken zu einer Theorie entwickelt wurden, „Dimensionstheorie“.
Eine weitere Überlegung gilt es bei der Betrachtung von Kursverläufen anzustellen, die weder Hausdorff noch Menger in den Sinn kam, weil sie nur das geometrische Bild vor Augen hatten:
Wie kommen die unablässigen Schwankungen überhaupt zustande?
Urplötzlich geht das Gerücht, irgendein Fürst Dolgorukow habe im fernen Jekaterinburg ein höchst ansehnliches Aktienpaket der Firma erworben. Blitzartig klettert der Kurs in die Höhe. Aus ungenannter, aber zuverlässiger Quelle wird daraufhin kolportiert, dies sei eine Falschmeldung. Der Kurs fällt. Die Quelle sei von Dolgorukow gekauft, um Unsicherheit zu verbreiten, beeilen sich die Gerüchteköche nun in die Ohren der Börsianer zu träufeln. Manche glauben ihnen und kaufen, manche bleiben skeptisch und stoßen ab, jeder von ihnen etwas früher oder später. Rational nachvollziehen kann man das alles nicht. In einem Wort:
Das Auf und Ab kommt wie vom Zufall gelenkt zustande.
Wenn ein geschulter Fiaker seine Kutsche lenkt, hat er ein Ziel vor Augen und führt die Pferde die Bahn einer glatten Kurve entlang. Bei der wilden Zickzackkurve des Kursverlaufs hingegen drängt sich das Bild eines sternhagelvoll Betrunkenen auf, der nach der Sperrstunde des Lokals die Straße entlangtorkelt. Nie weiß man im Vorhinein, ob er plötzlich nach rechts oder nach links wankt. Ist er dermaßen besoffen, dass er, wie bei der Kurve des Kursverlaufs, praktisch jeden Augenblick die Richtung ändert, kommt er, obwohl er eigentlich nach Hause streben sollte, kaum vom Lokal weg.