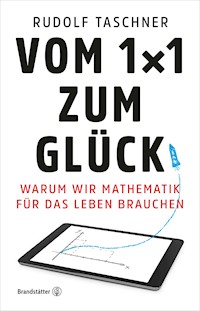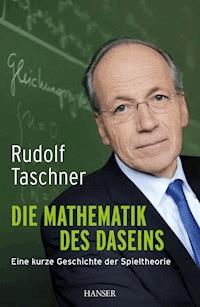Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wer Zahlen beherrscht, der hat Macht. Schon Archimedes besiegte die römische Flotte mit Mathematik, und Rechenmaschinen schlagen den Menschen im Schach und beim Jeopardy. Rudolf Taschner nimmt uns mit auf einen Streifzug durch die Kulturgeschichte der Zahlen. Er erzählt, wie Blaise Pascal schon im 17. Jahrhundert den Computer erfand, wie Isaac Newton mit der Unendlichkeit rechnen lernte, warum Kurt Gödel zugleich an die Allmacht der Zahlen und an Gespenster glaubte – und sich der britische Geheimdienst an der Zahl 007 die Zähne ausbiss. Taschner lüftet dabei die Geheimnisse der Mathematik und Kryptologie so spannend, leichtfüßig und unterhaltsam, dass auch Nichteingeweihte ihrem Zauber erliegen müssen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rudolf Taschner
DIE ZAHL, DIE AUS DER KÄLTE KAM
Wenn Mathematik zum Abenteuer wird
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches oder von Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2013 Carl Hanser Verlag München
Internet: http://www.hanser-literaturverlage.de
Stand entspricht der Druckausgabe ab der 9. Auflage
Herstellung: Thomas Gerhardy
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich unter Verwendung einer Fotografie von Heribert Corn
Datenkonvertierung E-Book: Kösel Media, Krugzell
ISBN 978-3-446-43683-1
E-Book-ISBN 978-3-446-43649-7
Inhalt
Vorwort
Erst die Null macht Zahlen groß
Das Geheimnis des vierten Jahres
Die mächtigen Zahlen des Drachen Tiamat
Zahl und Schrift
Mit Mathematik beginnt die Aufklärung
Der Maharadscha und die große Zahl
Die größten Zahlen der Natur
Von den kleinen zu den großen Zahlen
Die Vermessung der Erde
Astronomisch große Zahlen
Die größte Zahl des Universums
Nicht Rechnen, Schätzen will gelernt sein
Der größte Mathematiker
Ein Märtyrer der Mathematik
Die geniale Idee
Zweiter zu sein zählt nicht
Ägyptische Brüche
Die Rinder des Sonnengottes
Die größten Zahlen der Mathematik
Eine Zahl nach der anderen
Quadrat- und Kubikzahlen
Potenzen und Prozente
Die wichtigste Rechnung und das viele Geld
Donald Knuths Zahlenmonster
Geheimnisvolle Zahlen
4 294 967 297
Die Sucht nach Primzahlen
Eine Zahl, die aus der Kälte kam
Geheimnisse schmieden und lüften
Große Primzahlen
Illusion und Wirklichkeit
Die absolut sichere Methode
Der Zufall verspricht Sicherheit
Normale Zahlen
Kreatives Durcheinanderwerfen
Denken mit Zahlen
Ken Jennings’ und Brad Rutters Debakel
Die „Pascaline“, zur Unzeit konstruiert
Leibnizens Zahlen und Lovelaces Programme
Die elektrische Geburt der Zahlenmaschinen
Gelernters Skeptizismus und Turings Test
Der Anspruch auf Allwissenheit
Ein Gigant aus Göttingen
Kein „Ignorabimus“
Hilbert verbannt das geometrische Empfinden
Unendliche Dezimalzahlen
Ein Hotel voll Paradoxien
Ein unendliches Frage- und Antwortspiel
Hilberts Programm
Allmacht statt Allwissenheit
Der Mathematiker der Intuition
Eine Wissenschaft, auf Sand gebaut
Vorwort
Nichts ist kälter als die Zahl.
Wobei „kalt“ im Sinne von unpersönlich, gefühllos, unerbittlich verstanden wird. Und in der Tat: Wenn jemand im hitzigen Disput „Zahlen auf den Tisch legt“, verstummen die Gegner. An den Zahlen gibt es nichts zu rütteln. Sie stehen für Endgültiges. Das mit Zahlen Versiegelte ist unumstößlich und unwiderruflich.
Während Heraklit den Wandel der Welt im Feuer, in der wärmenden Flamme verwirklicht sah, tritt ihm kühl Parmenides von Elea entgegen, der mit glasklarer Logik verkündet: Es kann kein Entstehen und kein Vergehen geben: Wie kann etwas aus nichts hervorgehen? Wie kann etwas, das existiert, plötzlich nicht mehr sein? Der Wandel, so Parmenides, ist nur Illusion. Seine Botschaft verheißt Bestand und damit Sicherheit. Null bleibt ewig null, eins bleibt ewig eins, und beide bleiben ewig voneinander verschieden. Nicht umsonst fordert der durch die eleatische Schule geprägte Platon von allen, die seine Akademie betreten, von allen, die er zu den künftigen Herrschern der Welt, zu den Philosophenkönigen heranzuziehen verspricht, mathematisches Wissen.
Wer die entscheidenden Zahlen kennt, gar mit ihnen zu manipulieren versteht, hat das letzte, das alles bestimmende Wort. Jenes Wort, das in den Augen aller anderen „zählt“. Es ist das Wort des Mächtigen. Und es ist ein kaltes Wort.
Doch Parmenides irrt.
Davon erzählt dieses Buch. Aus einer Legion von Geschichten über die vermeintliche Macht der Zahlen sind willkürlich einige wenige herausgegriffen. Nicht auf die historische Überprüfbarkeit in allen Einzelheiten – se non è vero, è ben trovato – wurde Wert gelegt, sondern auf die Botschaft, die mit den Erzählungen verbunden ist: Zahlen sind nicht einfach da. Zahlen sind erfunden worden, um Ordnung und Übersicht schaffen zu können. Zahlen haben uns zu dienen, nicht zu beherrschen. Zahlen sind nicht das Fundament des Daseins, denn dieses ist sicher nicht „kalt“. Aber verbindliche Markierungen zu seinem besseren Verständnis sind Zahlen sehr wohl.
Geschichten über Zahlen zu erzählen, Mathematik als eminente kulturelle Errungenschaft einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, ist seit mehr als zehn Jahren das Ziel von „math.space“, angesiedelt im Wiener Museumsquartier, unterstützt von den österreichischen Ministerien für Unterricht, Wissenschaft, Technologie und Finanzen und organisiert von meiner Frau Bianca, in dem in mehreren hundert Veranstaltungen pro Jahr die vielseitigsten Bezüge der mathematischen Zahlenwelt zur Wirklichkeit vor Augen geführt werden. Manches, wenn auch nicht alles von dem, was in diesem Buch berichtet wird, ist im „math.space“ angedeutet, teilweise nur skizziert worden. Schon allein darum, aber auch weil sie mir in allen Phasen meines Lebens unermüdlich und verlässlich zur Seite steht, will ich meiner Frau an dieser Stelle von ganzem Herzen danken. Unsere Tochter Laura lehrte mich durch ihre Fragen, dass jede tiefe Erkenntnis eine zwingende und zugleich einleuchtende Erklärung hat, und unser Sohn Alexander hat mein Manuskript genau gelesen, mich auf peinliche Fehler aufmerksam gemacht und mir mit Zuspruch, aber auch mit Kritik sehr geholfen.
Gedankt sei auch dem Verlag Hanser, ein besonderes merci cordialement Herrn Christian Koth, für das uneingeschränkte Vertrauen in mich als Autor, für die wunderbare Zusammenarbeit, für die schöne Ausstattung des Buches, das, wie ich hoffe, allen Leserinnen und Leser die Scheu vor den kalten Zahlen nimmt. Denn die Geschichten, die um sie herum gesponnen werden, lassen ihre Frostigkeit vergessen.
Erst die Null macht Zahlen groß
Das Geheimnis des vierten Jahres
Es war der Stich einer Mücke, der Tutanchamun das Leben raubte. Sie übertrug ihm, dem Pharao, dem Herrscher über Ägypten, die Malaria, eine mit hohem Fieber verbundene Krankheit, an der Menschen mit schwacher Gesundheit sterben können. Und Tutanchamun war sehr schwach. Schon von Geburt an hatte er kaputte Knochen, nur mit Krücken konnte er gehen, seine Wirbelsäule war verkrümmt. Der Malaria-Erreger hatte bei dem gebrechlichen jungen Mann, der bereits als neunjähriges Kind Pharao wurde und danach nur zehn Jahre regierte, ein leichtes Spiel.
Als 1922 der englische Altertumsforscher Howard Carter und sein Team das Grab des Bedauernswerten fanden, waren sie begeistert: Es war nicht so verwüstet wie die zuvor entdeckten Gräber der Pharaonen. Bei denen hatten sich schon vor Jahrtausenden Grabräuber der in ihnen gelagerten Schätze bemächtigt. Auch aus dem Grab des Tutanchamun wollten Räuber das viele Gold und den wertvollen Schmuck entwenden. Aber sie wurden offenbar bei ihrem Vorhaben gestört, ließen die Beute zurück und flüchteten. Und so fand Carter das Innere des Grabes fast unversehrt vor. Im Licht der Fackeln und Lampen strahlte in der düsteren Gruft das viele Gold, das 3244 Jahre lang – so viel Zeit war seit des Pharaos Tod vergangen – im Dunkel seiner Entdeckung geharrt hatte.
Was veranlasste die Ägypter, ihrem Herrscher, der in Wahrheit nur ein gebrechliches Menschenkind gewesen war, solche Verehrung entgegenzubringen? Eine Verehrung, die über seinen allzu frühen Tod hinausreichte, so dass sie seine letzte Ruhestätte mit wertvollen Schätzen, mit reichen Grabbeigaben, mit Prunk und Zier ausstatteten? Die meisten der Ägypter haben ihren Pharao nie gesehen. Sie schufteten als Bauern und Handwerker an den Ufern des Nils, jenes gewaltigen Flusses, der die ägyptische Wüste bis hin zum Mittelmeer durchzieht und der den Menschen das Leben in der sonst unwirtlichen Gegend ermöglicht. Der Nil spendet ihnen das dringend nötige Wasser, vor allem aber überflutet er immer wieder das Land. Bei diesen Überschwemmungen bringt er von seinem Oberlauf im fernen Süden fruchtbare Erde mit. Sie setzt sich, wenn der Nil wieder in sein Flussbett zurückfindet, am Ackerboden ab und bildet so den Dünger für überreiche Getreideernten. Der Pharao war für die Bauern und Handwerker ein fernes, ein mächtiges Wesen. Sie hörten wundersame Geschichten von diesem geheimnisvollen König, der – so wurde geraunt – ein Sohn der Götter selbst sein solle, vom Himmel herabgekommen, um über Ägypten zu herrschen. Er sei Gebieter über die Welt, so wurde dem einfachen Volk weisgemacht. Er befehle den Fluten des Nils zu kommen und zu gehen.
Und selbst die ganz wenigen, die den Pharao wirklich zu Gesicht bekamen, werden ihn nur an besonders heiligen Tagen erblickt haben. Angetan mit wertvollstem Geschmeide, goldenen Gewändern, die seinen von Leiden geschlagenen Körper verhüllten, wenn er, das Henkelkreuz, das Zeichen des Lebens, wie ein Szepter in der Hand haltend vom Thron aus feierlich verkündete: Nun kämen wieder die Tage, dass der Nil über seine Ufer tritt, das trockene Land befruchtet, Nahrung und Leben schenkt. Nur eine Handvoll Auserlesener wird es gewesen sein, die wirklich um des Pharaos Zustand als kranker und wohl auch schwacher Mensch gewusst haben. Aber diese Kenntnis durfte nicht nach außen dringen, keiner außerhalb des innersten Beraterkreises durfte wissen, dass der Pharao weder stark noch göttlicher Herkunft war. Denn dann wäre der Glaube der Ägypter an dessen Herrschergewalt zerstört, das ganze riesige Reich vom Zerfall bedroht gewesen. Einer musste ja, so waren die Berater des Pharaos überzeugt, die Oberherrschaft über die Arbeit der Bevölkerung haben, einer musste ihnen befehlen, wann zu säen und wann zu ernten sei. Und dieser eine war der Pharao, der Sohn seines Vaters und der Nachfahr seiner Ahnen, die auch schon Pharaonen gewesen waren, egal um was für eine kümmerliche Gestalt es sich bei ihm handelte.
Auch wusste Tutanchamun nicht selbst, wann der Nil mit dem fruchtbaren Schwemmland über seine Ufer treten würde. Seine Berater teilten ihm dieses Wissen mit. Sie waren die eigentlichen Herrscher des Landes, verbargen sich aber hinter der Figur des Pharaos. So hielten es die Berater in jahrtausendealter Tradition – und sie taten es nicht allein aus Respekt vor dem Herrscherhaus, sondern auch, weil sie es wollten: So konnten sie sich von den mühseligen Pflichten fernhalten, die ein Pharao auf sich nehmen musste: Könige und Gesandte anderer Länder empfangen, wenn nötig an der Spitze seines Heeres Feldzüge unternehmen und Kriege führen, bei den hohen Festtagen in den schweren Gewändern stundenlang bei Zeremonien zu Ehren der Götter mit ernsthafter Miene Würde zeigen. Die Berater hatten ein angenehmes, ruhiges, unbeschwertes Leben im Schatten des ruhmreichen Pharaos.
Ein solch schönes Leben konnten sie sich leisten, weil sie wussten, wie man den Zeitpunkt des Nilhochwassers berechnen konnte. Sie beobachteten die Sterne, die über der Wüste Ägyptens Nacht für Nacht glanzvoll strahlten. Und sie stellten fest, dass immer nach dem Erscheinen eines besonders hellen Sterns knapp vor Sonnenaufgang, des Sirius im Sternbild der Hunde, der Nil über die Ufer trat. Diese besondere Zeit des Jahres hieß Hundstage, ein Name, der sich bis in die Gegenwart erhalten hat. Vor allem aber verstanden die Berater des Pharaos etwas, das sonst niemand in Ägypten beherrschte:
Sie konnten zählen.
Nicht nur bis acht oder bis zwölf, das werden die Bauern auch gekonnt haben, sondern weit über hundert, zweihundert, dreihundert hinaus. Dies verstanden damals sicher nur ganz wenige Menschen. Denn fast niemand konnte schreiben, und große Zahlen wie 365 oder 1460 hat man nur dann im Griff, wenn man sie aufzuschreiben versteht.
Tatsächlich waren zuerst diese beiden die entscheidenden Zahlen, die den Beratern des Pharaos zu ihrer Macht verhalfen.
Die Bedeutung der Zahl 365 liegt auf der Hand: Die Priester und Schriftgelehrten Ägyptens wussten, dass es fast genau 365 Tage von einem Aufgang des Sirius bis zum nächsten dauert. So viele Tage umfasst daher das ägyptische Jahr. Die Berater hatten ihre Beobachtungen des Himmels über die Jahrzehnte allerdings sehr sorgfältig vollzogen und ein noch tieferes Geheimnis gelüftet: Schleichend verzögert sich der Aufgang des Sirius so, dass er sich gleichsam jedes vierte Jahr um einen Tag verspätet. Dieses zusätzliche Wissen behielten sie für sich, die Dauer des ägyptischen Jahres teilten sie freizügig dem ganzen Volke mit. Um es den Zahlenunkundigen beibringen zu können, unterteilten sie das Jahr in zwölf Monate und jeden Monat in drei Dekaden, wobei eine Dekade aus zehn Tagen besteht. Somit bestanden alle Monate aus 30 Tagen. Die Gesamtheit der zwölf Monate umfasst 360 Tage. Und wenn die zwölf Monate vorüber waren, fügten die Ägypter zum Jahresabschluss fünf feierliche Zusatztage ein. So gelangten sie zu den 365 Tagen des ägyptischen Jahres1.
Die genaue Kenntnis darüber, wann der Sirius aufgeht, behielten die Berater für sich: Jedes vierte Jahr war es ein anderer Tag, an dem verkündet wurde, dass der Sirius das Kommen des Nils anzeigt. Den Bauern war das ein Rätsel, den Beratern hingegen nicht. Sie wussten: Nach vier Jahren ereignet sich der Aufgang des Sirius um einen Tag später. Nach zehn mal vier Jahren, also nach 40 Jahren, daher schon um eine Dekade später. Nach 30 mal vier Jahren, also nach 120 Jahren, somit um einen Monat später. Und wenn vier mal 365 Jahre vergangen sind, das sind 1460 Jahre, dann ist der große Zyklus zu Ende: jener von den Priestern nach der Göttin Sothis benannte Zyklus, an dem jeder Tag des Jahres an jeweils vier aufeinanderfolgenden Jahren als Tag des Aufgangs des Sirius gefeiert wurde. Doch niemand, außer den Gebildetsten der Schriftgelehrten, konnte mit einer so großen Zahl wie 1460 verfahren.
Und die Schriftgelehrten waren darauf bedacht, dass es so für immer bleiben möge. Also ließen die Zahlenkundigen das Volk im Glauben, der Pharao erführe immer aufs Neue von den Göttern den genauen Zeitpunkt der Anschwellung des Nils. Selbst als im Jahr 237 v. Chr. – drei Generationen, nachdem Alexander der Große mit seinem griechischen Heer Ägypten erobert hatte, die nach ihm benannte Stadt Alexandria mit ihrer weltberühmten Bibliothek gegründet war und mehr Menschen als je zuvor zu lesen, zu schreiben und zu rechnen verstanden – der Pharao Ptolemäus III., auch er ein hochgebildeter Grieche, jedes vierte Jahr einen Schalttag einführen wollte, wehrte sich die Priesterschaft Ägyptens energisch dagegen. Sie setzte nach des Ptolemäus Tod sein Dekret wieder außer Kraft. Denn dann wäre der Nil immer an den gleichen Tagen des Jahres über die Ufer getreten, die Bevölkerung hätte die Weissagungen des Pharaos nicht mehr gebraucht, die Schriftgelehrten hätten ihren Einfluss verloren.
Große Zahlen bedeuten große Macht.
Die mächtigen Zahlen des Drachen Tiamat
Blickten in Ägypten die Zahlenkundigen auf den Sirius, so verfolgten die Astronomen des Zweistromlandes, der Wüstengegend, durch die Euphrat und Tigris als lebenspendende Ströme fließen, den Lauf der beiden auffälligsten Gestirne des Himmelszeltes: der Sonne und des Mondes. Beide gehen in östlicher Richtung auf, erreichen im Süden ihren höchsten Punkt über dem Horizont und gehen in westlicher Richtung unter. Wir wissen heute, dass diese scheinbare Bewegung durch die Drehung der Erde vom Westen zum Osten um ihre eigene Achse entsteht. Auch das ganze Himmelsgewölbe führt innerhalb von 24 Stunden diese scheinbare Drehbewegung von Osten nach Westen durch.
Allerdings bleiben Sonne und Mond nicht an ihrem Ort am Himmelszelt verankert, sondern durchlaufen entlang der Himmelskugel nahe beieinanderliegende Kreise, welche die Sonne beziehungsweise den Mond entlang der zwölf Sternzeichen Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische führen. Der Kreis auf der Himmelskugel, den die Sonne durchzieht, heißt Ekliptik. Das Wort stammt vom griechischen ekleípein und bedeutet „verschwinden“. Warum dieser eigenartige Name gewählt wurde, werden wir bald verstehen. Ziemlich genau 365 Tage und einen Vierteltag benötigt die Sonne, um die Ekliptik zu durchlaufen. Wenn ein Astronom des alten Babylon den Stand der Sonne anvisierte und genau zwölf Stunden später entlang dieser Visierlinie auf das Sternenzelt blickte, wusste er, welches der zwölf Sternzeichen der Sonne genau gegenübersteht.
Unser modernes heliozentrisches Weltbild lehrt, dass nicht die Sonne entlang der Ekliptik läuft, sondern dass sich die Erde im Laufe eines Jahres einmal um die Sonne bewegt. Es sind die verschiedenen Positionen entlang der Erdbahn, die bewirken, dass sich die Sonne entlang der Ekliptik scheinbar vor die Sternzeichen stellt.
Der Mond hingegen umrundet tatsächlich die Erde, und seine Bahn entlang des Sternenzeltes ist ebenfalls eine geschlossene Kreislinie, die er sehr schnell, nämlich innerhalb von 27 Tagen und knapp acht Stunden, einem sogenannten siderischen Monat, durchläuft. Weil aber in dieser Zeitspanne auch die Sonne scheinbar entlang der Ekliptik weitergewandert ist, wird der Mond nach diesem siderischen Monat nicht im gleichen Winkel von der Sonne beleuchtet. Um gegenüber der Sonne wieder die gleiche Position einzunehmen, braucht der Mond ein wenig länger, nämlich den sogenannten synodischen Monat, der ziemlich genau 29 Tage und zwölf Stunden dauert. Nach einem synodischen Monat sieht man den Mond wieder in der gleichen Phase. Die Monate, welche die Astronomen des Zweistromlandes zur Einteilung der Zeit definierten, richteten sich nach diesen Mondphasen: Sie dauerten abwechselnd 29 und 30 Tage. Immer bei Vollmond feierte das Volk des Zweistromlandes seine Götter und pilgerte zu den Tempeln. Man machte sich nicht während des glühend heißen Tages auf den mühsamen Weg, sondern in der angenehm kühlen Nacht. Und um sich nicht zu verlaufen, benötigte man das Licht des Mondes. Auch der jüdische Festkreis ist auf den Vollmond ausgerichtet: Pessach, das Fest, bei dem der Befreiung aus dem ägyptischen Joch gedacht wird, wird am Vollmond des ersten Frühlingsmonats Nissan gefeiert. Und das Osterfest, das sich am jüdischen Pessach orientiert, ist auf den Sonntag danach festgesetzt.
Der Kreis, den der Mond auf dem Himmelszelt durchläuft, führt auch durch die zwölf Sternzeichen des Tierkreises. Er stimmt aber nur fast, nicht genau mit der Ekliptik überein. Fiele die Mondbahn präzise mit der Ekliptik zusammen, erblickten wir bei jedem Neumond eine Sonnenfinsternis, weil sich der Mond, dessen von der Erde abgewandte Seite bei Neumond von der Sonne beschienen wird, direkt vor die Sonne schöbe und sie verdeckte. Und wir erblickten bei jedem Vollmond eine Mondfinsternis, weil zu diesem Zeitpunkt die Erde genau in den Strahl von der Sonne zum Mond träte und ihren Schatten auf den Mond würfe. Weil jedoch die Mondbahn zur Ekliptik in einem Winkel von rund fünf Grad geneigt ist, kommt es bei Neumond nur selten zu einer Sonnenfinsternis und bei Vollmond nur selten zu einer Mondfinsternis.
All dies war den babylonischen Gelehrten bekannt – das Volk selbst wusste davon nichts.
Mit großer Präzision vermaßen die Astronomen die Bahn des Mondes von ihren Zikkuraten aus, den gestuften Tempeltürmen, die sie nicht nur über den Dunst der Stadt, sondern auch über das gemeine Volk erhoben. Zur einen Hälfte liegt die Mondbahn über der Ekliptik, zur anderen Hälfte liegt sie unter ihr. An zwei diametral gegenüberliegenden Stellen auf der Himmelskugel schneidet die Mondbahn die Ekliptik. Diese zwei Punkte auf der Ekliptik heißen die Knoten der Mondbahn. Die babylonischen Gelehrten nannten sie den „Drachenkopf“ und den „Drachenschwanz“.
Denn, so erzählten die Gelehrten ihren staunenden Zuhörern, auf dem Himmelszelt haust der geheimnisvolle Drache Tiamat. Wo sein Kopf lauert, beginnt die Mondbahn sich über die Ekliptik zu heben. Wo auf der Gegenseite der Himmelskuppel sein Schwanz ist, stößt die Mondbahn wieder auf die Ekliptik und sinkt unter sie. Und manchmal, zu einer Zeit, die nur die Götter kennen, verschlingt der Drache mit seinem Kopf die Sonne. Oder der Drache schnürt mit seinem Schwanz die Sonne ein.
Angsterfüllt fragten die Zuhörer die gelehrten Priester: „Was geschieht, wenn der Drache mit seinem Maul die Sonne verschlingt, wenn sein Schwanz die Sonne erdrückt?“
„Die Sonne verschwindet, Finsternis bedroht uns“, antworteten die Priester.
„Und wann wird dies geschehen?“
„Wir müssen die Götter befragen, vielleicht geben sie uns die Antwort. Und wenn Ihr ihnen ein gefälliges Opfer darbietet, werden die Götter den Drachen bezwingen, so dass er die Sonne wieder freilässt und sie weiter auf uns scheinen kann.“
Abb. 1: Von der Erde aus gesehen scheint die Sonne während des Jahres eine durch die Tierkreiszeichen führende Bahn entlang der Himmelskugel zu ziehen, welche die Ekliptik heißt. Die scheinbare Mondbahn entlang der Himmelskugel ist zur Ekliptik ungefähr 5 Grad geneigt und wird vom Mond in einem (siderischen) Monat durchlaufen. Die Schnittpunkte der scheinbaren Mondbahn mit der Ekliptik heißen die Mondknoten Drachenkopf und Drachenschwanz. Nur wenn Sonne und Mond auf der Geraden vom Drachenschwanz zum Drachenkopf liegen, ereignen sich Finsternisse: Sind dabei Sonne und Mond auf gegenüberliegenden Seiten der Erde, erlebt man eine Mondfinsternis. Sind hingegen Sonne und Mond vor der Erde auf dem Sehstrahl des Beobachters zum Mondknoten, erlebt der Beobachter eine Sonnenfinsternis.
Aber statt die Götter zu befragen, beobachteten die Gelehrten mit ihren Visiergeräten haargenau den Mond: Präzise maßen sie die Zeitspannen, die der Mond auf seiner Himmelsbahn benötigt, um vom Drachenkopf zum Drachenschwanz und vom Drachenschwanz wieder zurück zum Drachenkopf zu gelangen. Ein voller Durchlauf ist ein klein wenig kürzer als der siderische Monat. Lange Listen dieser Zeitspannen dürften die Gelehrten angelegt haben. Denn sie verrieten ihnen, was sie dem Volk als Botschaft der Götter verkündeten: Nur wenn sich der Mond in einem der beiden Knotenpunkte befindet, kann sich eine Finsternis ereignen. Doch zugleich muss entweder Vollmond oder aber Neumond herrschen. Dafür ist die Zeitspanne von einem Vollmond zum nächsten maßgeblich, der den Astronomen Babylons wohlbekannte synodische Monat. Mit diesem Wissen konnten die Gelehrten Babylons Sonnenfinsternisse vorausberechnen: Sie finden nur dann statt, wenn sich der Neumond im Drachenkopf oder im Drachenschwanz befindet. Sie können zuweilen sehr lange auf sich warten lassen. Von einer totalen oder ringförmigen Sonnenfinsternis bis zur nächsten über einem bestimmten Ort der Erde muss man im Schnitt 140 Jahre ausharren. So selten dieses Ereignis ist, so faszinierend ist es – und für Menschen, die es sich nicht erklären können, erschreckend.
Am 4. Juli 587 v. Chr. herrschte Vollmond, und zusammen mit vielen anderen beobachtete der griechische Philosoph Thales von Milet in dieser Nacht eine Mondfinsternis. Irgendwie ist es Thales gelungen, den babylonischen Gelehrten das Zahlengeheimnis des Drachen Tiamat zu entlocken: 23 Monate und einen halben Monat später, so verrieten sie ihm, werde der Neumond, nachdem er bereits fünfundzwanzig Mal durch den Drachenkopf und fünfundzwanzig Mal durch den Drachenschwanz gelaufen sein wird, sich zusammen mit der Sonne im gegenüberliegenden Mondknoten befinden und dort eine Sonnenfinsternis hervorrufen. Jetzt brauchte Thales nur mehr zu rechnen: 23 ½ synodische Monate sind 693 Tage, um 37 Tage weniger als zwei Jahre. Folglich wird die Sonnenfinsternis 37 Tage vor dem 4. Juli 585 v. Chr., also 33 Tage vor dem 30. Juni 585 v. Chr., folglich am 28. Mai 585 v. Chr. stattfinden.
Man stelle sich vor: Ein babylonischer Priester spricht zu seinem Volk und sagt:
„Morgen wird der Drache Tiamat die hell leuchtende Sonne mit seinem Maul verschlingen. Schwärze wird sie umhüllen, der Himmel sich verfinstern, Dämmerung einbrechen, Düsternis herrschen. Aber wir haben zu den Göttern gebetet. Die Götter werden dem Drachen gebieten, die Sonne wieder freizulassen. Preist die Götter und bringt in den Tempeln Eure Opfer dar!“
Am nächsten Tag geht kein Bürger Babylons in Ruhe seiner Arbeit nach, alle starren gebannt in den Himmel. Und wirklich: Die Sonne verfinstert sich, wie es der Priester verkündete, und nach Minuten der Düsternis tritt sie wieder aus dem unheimlichen Schatten hervor. Für sein weiteres Dasein und das Dasein seiner Kinder und Kindeskinder hat der Priester mit der Erfüllung seiner Prophezeiung ausgesorgt. Keiner der Babylonier würde es wagen, an seiner Autorität zu zweifeln.
In Wahrheit steckt hinter seiner Vorhersagekraft nichts anderes als Rechenfertigkeit mit großen Zahlen.
Der Legende nach soll Thales tatsächlich die Sonnenfinsternis des 28. Mai 585 v. Chr. vorhergesagt haben. Aber er beförderte nicht mehr wie die Gelehrten Babylons den Aberglauben, sondern bekundete erstmals, dass er sein Wissen dem Vermögen verdankte, mit großen Zahlen rechnen zu können. Es sind nüchterne Zahlen, die sich hinter der magischen Geschichte des Drachen Tiamat verbergen. Allerdings so große Zahlen, dass sie dem lese- und rechenunkundigen Volk unverständlich blieben.
Zahl und Schrift
Mit Zahlen umgehen zu können, war in alter Zeit das Tor zu einem reichen und sorgenfreien Leben. Ägyptische Vermessungsbeamte hatten bereits einen wichtigen Schritt zu diesem Ziel getan: Sie konnten mit Zahlen hantieren, die über ein Dutzend hinausgingen und bei einigen Hundert endeten. So weit musste man rechnen können, um den Bauern die Felder nach den Anzahlen der Klafter, die diese Felder lang und breit waren, zuteilen zu können. Auch um die Getreidesäcke zählen zu können, welche die Bauern ablieferten. Und die Ochsenkarren, die das Getreide zu den Kornkammern lieferten. Aber ein wirklich großes Lebensziel hatte jener Beamte und Schreiber des alten Ägypten erreicht, der sogar über mehrere Hundert, ja über tausend hinaus zu zählen und zu rechnen verstand. Dann durfte er erwarten, einmal in den Hof des Allerhöchsten, zum Pharao, vorgelassen zu werden.
Das Zählen der Ägypter, aber auch das der anderen frühen Hochkulturen, das der Babylonier, der Mayas, der Chinesen, endete im Allgemeinen in Größenordnungen von ein paar Tausend. Beamte und Händler brauchten im alltäglichen Geschäft damals – ganz im Unterschied zu heute – nicht an Millionenbeträge zu denken. Und wenn wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Unsummen zu bewältigen waren, bündelten die Rechenmeister bestimmte Mengen zu neuen Einheiten. So wie wir es auch heute noch tun, wenn wir von Dutzenden sprechen, große Entfernungen in Kilometern und nicht in Metern, große Massen in Tonnen und nicht in Gramm messen.
Auch die Zahlzeichen der alten Kulturen kommen kaum über ein paar Tausend hinaus. Nur zuweilen findet man Symbole für etwas viel Größeres, das aber zugleich als so groß gedacht wird, dass man es bloß bewundern, aber nicht mehr vernünftig mit ihm rechnen kann. Es steht einfach für eine Zahl, die alle menschliche Vorstellungskraft übersteigt, vielleicht nur den Gottheiten zugänglich ist.
Heute kennen nur mehr Experten der Frühgeschichte und Spezialisten der Hochkulturen des Orients und der Antike diese alten Zahlensymbole. Auch wissen nur wenige, dass zum Beispiel die Griechen in der Zeit der Antike ihre Buchstaben zugleich als Zahlzeichen verwendeten. Der erste Buchstabe Α, alpha, steht zugleich für 1, der zweite Buchstabe Β, beta, für 2, der dritte Buchstabe Γ, gamma, für 3, und so geht dies fort bis zum Buchstaben Ι, jota, der für 10 steht. Dann zählten die Griechen in Zehnerbündeln weiter: Die auf jota folgenden Buchstaben Κ, kappa, Λ, lambda, Μ, my, stehen für 20, 30, 40. Wenn sie ΛΒ schrieben, meinten sie 32, und wenn sie ΚΓ schrieben, meinten sie 23. Und nach den Zehnerbündeln benannten die letzten Buchstaben Hunderter: Ρ, rho, symbolisiert 100, Σ, sigma, symbolisiert 200, Τ, tau, symbolisiert 300 und so weiter. Mit den 24 Buchstaben ihres Alphabets, wobei noch drei Sonderzeichen, archaische Buchstaben ihrer eigenen Frühgeschichte, hinzukamen, gelang es ihnen, die für ihr tägliches Geschäft nötigen Zahlen zu schreiben.
Allgemein bekannt ist, wie die Römer die Zahlen bezeichneten. Noch heute lehren wir unsere Kinder, wenn wir zum Beispiel bei Stadtspaziergängen an Inschriften alter Denkmäler vorbeikommen, die römischen Zahlzeichen. Auch sie bestehen aus Buchstaben. Allerdings vermengt mit einer sehr leicht verständlichen Zeichensprache: I ist nicht bloß ein Buchstabe, sondern zugleich ein Strich, der für 1 steht. Dass die Römer dann II, III und IIII für 2, 3 und 4 schrieben, ergibt sich unmittelbar aus dieser Strichsymbolik. Und auch V ist nicht bloß ein Buchstabe – der, nebenbei bemerkt, im alten Rom zugleich für U steht –, sondern zugleich das Symbol einer Hand, bei der die vier Finger und der Daumen voneinander weggestreckt sind, also das Symbol für die Zahl 5. Und aus zwei solchen „Händen“, die zweite verdreht und unter die erste gesetzt, bildeten sie den Buchstaben X, der für die Zahl 10 steht.
Noch im Mittelalter schrieb man in unseren Breiten alle Zahlen nur in römischen Zahlzeichen. Borgte sich ein Bürger von einem anderen einen bestimmten Betrag Geld, ritzte man die Anzahl der verliehenen Gulden in ein kleines Brett, das man das Kerbholz nannte. Das Wort „Zahl“ selbst hieß im Althochdeutschen dal. Das englische Wort tell, welches nicht nur „erzählen“ bedeutet, sondern früher auch „zählen“ bedeutete, ist damit verwandt. Das althochdeutsche dal ist sprachverwandt mit dem Wort Delle, denn damals verbanden die Menschen Zahlen mit dem Bild von Kerben, die in Hölzer geritzt wurden und Geldbeträge symbolisierten. Und zuweilen behauptete ein Schuldner, er sei seinem Gläubiger nur fünf Gulden schuldig, obwohl die Zahl zehn auf dem Kerbholz eingeritzt sei. Der Gläubiger habe ihm „ein X für ein U vorgemacht“, also die Striche des Zahlzeichens V nach unten zu einem X verlängert. Diese Redeweise ist uns bis heute erhalten geblieben.
Das römische Zahlzeichen für 100 lautet C. Denn centum ist das lateinische Wort für „hundert“. Und wenn man nur die untere Hälfte dieses Buchstabens ritzt, verbleibt ein Symbol, das dem Buchstaben L ähnelt, darum steht L als römisches Zahlzeichen für die Hälfte von 100, also für 50. Das römische Zahlzeichen für 1000 lautet M. Denn mille ist das lateinische Wort für „tausend“. Doch in den Anfängen der römischen Geschichte schrieben die Römer statt des M den griechischen Buchstaben Φ, phi. Sie notierten ihn, indem sie direkt an ein C ein I setzten und gleich danach ein gespiegelt geschriebenes C, also CI. Wenn man dies zu einem einzigen Symbol verbindet, erhält man CI, ein stilisiertes M. Und als rechte Hälfte davon bleibt I übrig, ein Zeichen, das an den Buchstaben D erinnert. Darum ist D die römische Abkürzung für 500.
So weit sind die römischen Zahlzeichen uns allen bekannt. Wie aber zählten die Römer über 4999, das sie noch mühselig als MMMMDCCCCLXXXXVIIII notieren konnten, hinaus? (Dass man statt IIII einfacher IV, statt VIIII einfacher IX, statt XXXX einfacher XL, statt LXXXX einfacher XC, statt CCCC einfacher CD und statt DCCCC einfacher CM schrieb, die Zahl 4999 also als MMMMCMXCIX – immer noch umständlich genug – abkürzte, hat sich erst relativ spät eingebürgert.) Und wie konnte ein römischer Finanzminister Zehntausende, gar Hunderttausende von Sesterzen in seiner Buchhaltung notieren?
Eine Lösung bestand darin, dass man die Zeichen C, die für die Darstellung von 500 und 1000 dienten, einfach öfter schrieb: Steht I für fünfhundert, so bezeichnen die Symbole I und I die Zahlen fünftausend und fünfzigtausend. Und steht CI für tausend, so bezeichnen die Symbole CCI und CCCI die Zahlen zehntausend und hunderttausend.
Doch all dieser Finessen zum Trotz: Mühsam war das Schreiben von Zahlen mit römischen Zeichen allemal. Noch mühsamer aber war das Rechnen mit diesen Zeichen. Addieren und Subtrahieren mit römischen Zahlzeichen mag ja noch angehen. Wobei die Römer ein Rechengerät, den Abakus, zur Verfügung hatten, der ihrer Zahlenschreibweise entgegenkam. Aber das Multiplizieren ist mit römischen Zahlzeichen kein einfaches Unterfangen: Wie kann man ermitteln, was LVII, also 57, mit LXXV, also mit 75, multipliziert ergibt?2 Das Dividieren mit römischen Zahlzeichen gar war eine wahre Kunst. Sie wurde an den besten Universitäten des Mittelalters gelehrt.
Selbst die wenigen Menschen höheren Standes, die im Mittelalter lesen und schreiben lernten und denen die römischen Zahlzeichen bekannt waren, konnten wohl nur Zahlen addieren und subtrahieren. Das Multiplizieren und das Dividieren waren ihnen sicher unzugänglich. Es gab aber eine eigene Gilde auserlesener Gelehrter, sogenannter Cossisten, die in den Städten als Rechenmeister angestellt waren, um gegen Bezahlung für die Stadtverwaltung, für die Gewerbetreibenden und für die Kaufleute zu rechnen. Oft galt es, Multiplikationen und Divisionen auszuführen. „Che cosa?“, fragte damals die steinreiche Philippine Welser den Rechenmeister, „was ist das Ergebnis“? Sie ruft ihn einen „Cossisten“ und entlohnt ihn dafür fürstlich, denn er berechnet, was „cosa“, was „Sache“ ist.
Mit Mathematik beginnt die Aufklärung
Nach 1550 verdarb einer der klügsten unter den Rechenmeistern nördlich der Alpen, der aus Staffelstein bei Bamberg stammende Gelehrte Adam Ries, den Kollegen seiner Zunft ihr einträgliches Geschäft. Denn Adam Ries veröffentlichte ein Buch – geschrieben in deutscher Sprache, damit jede Bürgerin und jeder Bürger es lesen könne –, worin er das Rechnen, auch das Multiplizieren und das Dividieren, lehrte.
In diesem Buch erläutert Adam Ries im ersten Kapitel, „Numerirn“, also „Zählen“, übertitelt, dass man statt der so mühseligen römischen Zahlzeichen eine viel einfachere und bequemere Schreibweise für die Zahlen einüben sollte: Sehr sorgfältig erklärt er die arabischen Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, die für die ersten neun Zahlen stehen. Er verdeutlicht, dass man noch eine zehnte Ziffer, die Null, benötigt, um noch größere Zahlen aufschreiben zu können, und führt seine Leserinnen und Leser in die Geheimnisse des Dezimalsystems ein: In einer Zahl besitzt jede Ziffer einen Stellenwert. In 4205 hat zum Beispiel 5 den Stellenwert einer Einer-, 0 den Stellenwert einer Zehner-, 2 den Stellenwert einer Hunderter- und 4 den Stellenwert einer Tausenderziffer. Adam Ries zeigt damit zugleich, wie wichtig die Null als Ziffer ist. Denn 4205 ist eine ganz andere Zahl als 425 und auch eine ganz andere Zahl als 4250 oder gar 42 050.
Die nächsten Kapitel, mit „Addiren“, also Addition, „Subtrahirn“, also Subtraktion, „Multiplicirn“, also Multiplikation, und „Dividirn“, also Division, übertitelt, erklären, wie man mit diesen, in arabischen Zahlzeichen geschriebenen Zahlen die Grundrechnungen durchführt. Die Methode des Adam Ries entspricht genau jener, die noch heute unsere Kinder in den Grundschulen lernen. Vor allem kommt es ihm darauf an, dass man die Methode nicht bloß ungefähr begreift, sondern dass man sie an einer Unzahl von Beispielen übt, um sie sicher beherrschen zu können.
Den Abschluss des Buches bildet ein Kapitel, das mit „Regula Detri“ überschrieben ist. Hier erklärt Ries den sogenannten „Dreisatz“, oder, wie man in Österreich und im süddeutschen Raum sagt, die „Schlussrechnung“, das Herzstück aller in der Wirtschaft wichtigen Rechnungen.
Die Aufgabe besteht immer aus drei Sätzen, zwei Aussagen und einer Frage: „Fünf Maurer errichten in fünf Tagen eine fünf Meter lange Mauer. Jetzt arbeiten zehn Maurer zehn Tage lang. Wie lang ist die Mauer, die sie errichten?“ „6 Ellen Stoff kosten 42 Kreuzer. 91 Kreuzer werden bezahlt. Wie viel Stoff wurde gekauft?“ Fragen dieser Art werden zuhauf gestellt, und Adam Ries zeigt geduldig und ausführlich, wie man ihnen beikommt.
Das Buch des Adam Ries verkaufte sich prächtig. Noch zu seinen Lebzeiten wurde es in mehr als hundert Auflagen gedruckt. Nach dem Werk des Adam Ries hatten die Cossisten ausgedient. Niemand brauchte sie mehr, denn nahezu jede und jeder konnten von da an selber rechnen.
Geistesgeschichtlich kann man die Leistung des Adam Ries nicht hoch genug einschätzen. Zum ersten Mal erlebten die Menschen, dass sie nicht mehr von geldgierigen Gelehrten abhängig waren, die geheimnisvoll Berechnungen durchführten, welche wichtig waren, jedoch dem gemeinen Volk verborgen blieben. Nun gab es diese Geheimnisse nicht mehr. Niemand brauchte mehr Rechenmeister zu bezahlen. Alle konnten das Rechnen genauso leicht lernen wie das Schreiben und das Lesen. Adam Ries befreite die Bürgerinnen und Bürger aus ihrer Unmündigkeit, sie erlebten nach dem Mittelalter zum ersten Mal Aufklärung.
Wenn zuweilen provokant gefragt wird, warum Mathematik in der Schule unterrichtet wird, so lautet die Antwort in Hinblick auf diese Geschichte: Weil Mathematik das erste und das erfolgreichste Projekt der Aufklärung ist.
Doch Adam Ries war nicht der Erste, der arabische Zahlzeichen in Europa einzuführen versuchte. Lange vor ihm, zu Beginn des 13. Jahrhunderts, hatte der italienische Mathematiker Fibonacci ein Buch mit dem Titel „Liber Abaci“ veröffentlicht, worin erstmals außerhalb des arabischen Raumes die Ziffern und das Stellenwertsystem erklärt wurden. Doch was den Verkaufserfolg betraf, war Fibonaccis Buch ein glatter Reinfall: Es wurde kaum gelesen. Womöglich lag es einerseits an der damals viel schwierigeren Verbreitung, der Buchdruck war noch nicht erfunden, andererseits an der lateinischen Sprache, in der es geschrieben war und die nicht mehr die Sprache des Volkes war.
Viele Jahrzehnte vor Fibonacci war der französische Geistliche Gerbert d’Aurillac im Zuge seiner Studien an den Universitäten von Cordoba und Sevilla mit den arabischen Zahlzeichen in Berührung gekommen. Im Jahre 999 wurde Gerbert zum Papst gewählt und nahm den Namen Sylvester II. an. Doch das Wesentliche bei seinem Studium der Zahlen hatte seine Heiligkeit damals nicht verstanden: was es nämlich mit der eigenartigen Ziffer 0 auf sich hat.
Tatsächlich ist Null eine Zahl voller Rätsel. Aber für das Darstellen der Zahlen ist an ihr allein wichtig, dass man mit der Null mühelos riesige Zahlen erschaffen kann: 1 000 000 ist eine Million, 1 000 000 000 eine Milliarde, 1 000 000 000 000 eine Billion und so weiter. Da es bei noch größeren Zahlen umständlich ist, alle Nullen anzuschreiben, kürzt man ihre Anzahl einfach durch eine hochgestellte Zahl ab: 106 steht für eine Million, 109 für eine Milliarde und so weiter.
Wobei nicht außer Acht gelassen werden darf, dass man im englischsprachigen Raum die großen Einheiten ganz anders nennt: Zwar bleibt 106 ähnlich wie im Deutschen „one million“, aber 109 ist bereits „one billion“ und 1012 heißt „one trillion“. Dass man „billion“ mit „Milliarde“ und „trillion“ mit „Billion“ zu übersetzen hat, kann auch bei sonst hochgebildeten Menschen zuweilen zu heillosen Verwirrungen Anlass geben. Bei Fachleuten, die alltäglich mit astronomisch großen Zahlen zu tun haben, spielen allerdings die Namen, seien es Million, Milliarde, Billion, Billiarde, Trillion im Deutschen, seien es million, billion, trillion, quadrillion, quintillion im Englischen, praktisch keine Rolle. Sie sprechen einfach nur von „zehn hoch elf“, wenn sie 1011, also hundert Milliarden, eine 1 mit elf Nullen, meinen. So kommt es nie zu Irrtümern beim Übersetzen.
Allerdings: Sich zum Beispiel hundert Milliarden Euro so vorstellen zu können wie zehn oder hundert Euro, bleibt ein Ding der Unmöglichkeit. Man darf mit Recht jemanden, der einige Millionen Euro sein Eigen nennt, wohlhabend nennen. Auch der Milliardär ist wohlhabend, sogar immens reich, aber Geld hat für ihn eine völlig andere Bedeutung als für einen Millionär. Geld wird in zunehmender Menge abstrakter. Niemand, der Milliarden Euro besitzt, errichtet wie Dagobert Duck dafür einen Geldspeicher, worin die Münzen gehortet werden. Anscheinend bilden gigantische Summen Geldes eine gänzlich andere Währung als überschaubare. Dies war schon vor mehr als 500 Jahren, zur Zeit der Fugger so, die dem Kaiser für seine Unternehmungen riesiges Kapital zur Verfügung stellten und sich dabei ihrer Verantwortung als Bankiers eines ganzen Staatswesens bewusst waren. Ganz anders als die Prasser und Spieler, die es damals schon gab, mit ihrem vergleichsweise mickrigen und ohnehin ständig schrumpfenden Besitz.
Der Maharadscha und die große Zahl
Es ist bezeichnend, dass die berühmteste Geschichte, in der eine riesige Zahl die Hauptrolle spielt, aus Indien stammt, dem Land, in dem die Null und das Stellenwertsystem erfunden wurden. Es ist die Geschichte von den Reiskörnern und dem Schachbrett, die in verschiedenen Varianten erzählt wird. Wenn man sie wie eine Art Märchen fasst, lautet diese Geschichte so:
In ferner Vergangenheit regierte ein junger Maharadscha sein riesiges und fruchtbares Land. Er verliebte sich in eine wunderschöne Prinzessin. Die beiden heirateten, und dem glücklichen Paar stand eine wunderbare Zukunft bevor. Das Land wurde vom Maharadscha weise regiert, die Bauern ernteten gewaltige Mengen Reis, und alle Untertanen des Maharadschas lebten in Wohlstand und Zufriedenheit. Doch das Schicksal schlug böse zu: Die Prinzessin erkrankte schwer, kein Arzt konnte helfen, und innerhalb von wenigen Tagen starb sie. Die Trauer im Land war groß, aber die Trauer des verwitweten Maharadschas war unermesslich. Nichts schien ihn trösten zu können. Er vergaß unter seinen Tränen seine ganze Umgebung, sein ganzes Land, seine Aufgabe, für das Wohl seines Volkes zu sorgen. Und so kam es, dass immer weniger Ernten eingefahren wurden, immer weniger Geld verdient wurde, immer weniger Wohlstand herrschte. Die Verarmung der Bevölkerung nahm ungeahnte Ausmaße an. Die Höflinge des Maharadschas waren ratlos, wussten nicht, wie man den Verfall verhindern könne. Bis einer unter ihnen sich erinnerte, von einem weisen alten Mann gehört zu haben, der weit entfernt in einer Klause in den hohen Bergen wohnte und als der beste aller Ratgeber galt. Die Zeit drängte, man entschied, den weisen Mann an den Hof des Maharadschas zu rufen und ihn zu beauftragen, den Herrscher von seiner Trauer zu befreien und von seinem Schmerz über die verlorene Frau abzulenken.
Als der weise Mann in das Gemach des Maharadschas trat, trug er ein quadratisches Brett mit sich, das in acht mal acht quadratische Felder, abwechselnd schwarz und weiß gefärbt, unterteilt war: ein Schachbrett. Vor den tränenüberströmten Augen des Maharadschas, der ihm gegenübersaß, legte er das Brett auf den Tisch und stellte eigenartige Holzfiguren auf die Felder: acht sogenannte Bauern auf der vorletzten Reihe und auf der letzten Reihe von außen nach innen je zwei Türme, zwei Springer und zwei Läufer. Ganz im Inneren der letzten Reihe einen König, das Abbild eines Maharadschas, und eine Dame, das Abbild seiner Frau. Die Figuren, die der weise Mann auf seiner Seite des Brettes aufstellte, waren schwarz, und dann stellte er die gleichen Figuren in Weiß in der gleichen Formation auf der Seite des Maharadschas auf. Der weise Mann erklärte wie in einem Selbstgespräch – der Maharadscha blickte scheinbar teilnahmslos zu, aber der weise Mann wusste sehr gut, dass er seine Worte genau hörte –, wie die einzelnen Figuren gezogen werden: die Türme zum Beispiel nur waagerecht und senkrecht, die Läufer nur schräg, der König majestätisch, aber schwerfällig, immer nur ein Feld weiter, die Dame jedoch – der Maharadscha horchte merkbar auf –, die Dame ist die mächtigste Figur: Sowohl waagerecht, wie auch senkrecht, wie auch schräg darf sie sich in alle Richtungen beliebig weit bewegen. Auch erläuterte der weise Mann die Bewegungen der Bauern und der Springer, wie Figuren geschlagen werden und was „Schach“ und „Schachmatt“ bedeuten.
„Wollen wir vielleicht eine Partie versuchen?“, fragte dann der weise Mann charmant, und nach so viel Bemühungen um die Vorbereitung konnte der Maharadscha ihm diese Bitte nicht abschlagen. Also nickte er und begann mit dem ersten Zug. Unter der einfühlsamen Anleitung des weisen Mannes gelang es dem Maharadscha sogar, die Partie zu gewinnen. „Nun aber verlange ich Revanche“, sagte der weise Mann, als er Schachmatt gesetzt wurde. Und in der zweiten Partie unterlag der Maharadscha. „Nun verlange ich Revanche“, forderte darauf dieser, und der weise Mann willigte ein, aber erst für den Morgen des nächsten Tages. Für heute sei es genug, es gelte, die Tagesgeschäfte des Regierens zu erledigen.
Tatsächlich gelang es dem weisen Mann, den Maharadscha von seiner Trauer abzulenken. Wie früher wurde das Land wieder klug und gerecht regiert, der Wohlstand des Bevölkerung kehrte zurück, die Ernten waren wieder üppig und die Reislager überfüllt. Jeden Morgen spielten der Maharadscha und der weise Mann zwei Partien Schach, wobei sich der Maharadscha mit der Zeit zu einem begnadeten Schachspieler entwickelte. Und danach widmete sich der Maharadscha seinen Regierungsgeschäften und der weise Mann seinen Meditationen.
So ging es über Wochen und Monate, bis der weise Mann eines Tages dem Maharadscha eröffnete, dass er seine Aufgabe in diesem Land als erfüllt betrachte und wieder in die hohen Berge zurückkehren wolle. „Aber ich kann dich nicht ohne Lohn ziehen lassen“, entgegnete ihm der Maharadscha, „wünsche dir, soviel du willst, ich werde es dir geben. Denn im Vergleich zu meiner Trauer, von der du mich erlöst hast, kannst du dir gar nicht zu viel wünschen.“
„Unermesslich viel soll ich mir wünschen?“, fragte der weise Mann. Als der Maharadscha mit heftigem Nicken bejahte, nahm der weise Mann ein Reiskorn und legte es auf das erste Feld links oben auf das Schachbrett. „Nun gib auf das jeweils nächste Feld doppelt so viel Reis wie auf das vorige, und den ganzen Reis, der sich auf dem Schachbrett stapelt, den magst du mir geben.“
„So wenig!“, empörte sich der Maharadscha, beruhigte sich aber gleich, weil ihm in den Sinn kam, dass der weise Mann zeit seines Lebens fast nichts besessen hatte und eine Schüssel Reis für ihn ein Vermögen bedeutete. Ein Diener wurde gerufen, er solle einen Löffel Reis bringen und die Körner nach der Regel auf die Felder legen, dass er links oben mit einem Korn beginnt und danach auf jedes folgende Feld doppelt so viel geben soll wie auf das vorherige. Also begann der Diener den Reis auf die oberste Reihe der ersten acht Felder aufzuteilen:
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Körner. Nachdem der Diener die 128 Körner abgezählt hatte – insgesamt wurden bisher 255 Körner verteilt –, war der Löffel leer. Darum kam auf das erste Feld der zweiten Reihe ein ganzer Löffel Reis. Und auf den folgenden Feldern musste die Menge verdoppelt werden. Daher hatte der Diener auf die acht Felder der zweiten Reihe
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Löffel Reis aufzuteilen. 128 Reislöffel, dies ist ein halber Topf Reis. Nun wurde bereits eine ganze Dienerschaft beauftragt, den Reis im Saal zu stapeln. Für die acht Felder der dritten Reihe waren
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Töp