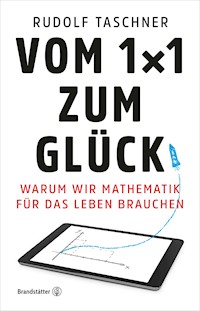Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brandstätter Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Im durchgetakteten Alltag der angeblich modernen Zeit bleibt für Grundsätzliches kaum Raum. Gleichzeitig sehnen sich viele nach einem Moment des Innehaltens, um sich der Tiefe des Daseins wieder bewusst zu werden. In diesen selten gewordenen Augenblicken stellen sich Fragen, die im Alltagsrauschen allzu gern beiseite gewischt werden: Was sind die Angelpunkte unserer Existenz? Woran kann man noch glauben? In früheren Generationen hat die Religion, in die man hineingeboren wurde, die Antwort vorweggenommen. Jetzt ist es nicht mehr so einfach wie einst. Der Mathematiker und Naturwissenschaftler Rudolf Taschner macht in diesem Buch zehn Angebote, er erzählt, woran heute noch geglaubt werden kann, was Menschen Halt gibt und woran es sich für den Einzelnen festzuhalten lohnt: an der Liebe etwa, der Logik oder an der Natur. Leichtfüßig und kenntnisreich entführt uns Taschner in philosophische Gefilde, frei von Dogmatik und festen Glaubenssätzen lädt er ein, sich die Antwort auf die titelgebende Frage wieder zuzutrauen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rudolf Taschner — WORAN GLAUBEN
Rudolf Taschner
WORAN GLAUBEN
10 Angebote für aufgeklärte Menschen
INHALT
VORWORT
Prolog
DER MATHEMATISCHE GOTTESBEWEIS
DER GLAUBE AN 313
DER GLAUBE AN DIE NATUR
DER GLAUBE AN DIE GESCHICHTE
DER GLAUBE AN DEN GENUSS
DER GLAUBE AN DIE ZUKUNFT
DER GLAUBE AN DIE KIRCHE
DER GLAUBE AN DIE KUNST
DER GLAUBE AN GOTT
DER GLAUBE AN DAS ICH
DER GLAUBE AN DICH
Epilog
DER UNBEWEISBARE GLAUBE
VORWORT
Dieses Buch bringt Gedanken über mögliche Glaubensweisen zur Entfaltung. Dies kann, meiner festen Überzeugung nach, nur in der Form eines Essays gelingen. Denn beim Essay, so schreibt Theodor W. Adorno, sind all die heiklen Sujets, über die es nachzudenken gilt, weder „von einem Ersten her konstruiert noch runden sie sich zu einem Letzten“. Und weiter: Der Essay „fängt nicht mit Adam und Eva an, sondern mit dem, worüber er reden will; er sagt, was ihm daran aufgeht, bricht ab, wo er selber am Ende sich fühlt und nicht dort, wo kein Rest mehr bliebe“. Genau in dieser Form zu schreiben ist angemessen, wenn es gilt, das Thema des Glaubens aus verschiedenen Richtungen zu beleuchten, ohne dabei mit endgültigen Urteilen über irgendeine der zehn angebotenen Glaubensweisen den Stab brechen zu wollen. Es versteht sich von selbst, dass die von mir vorgestellten zehn Angebote einander keineswegs ausschließen und ebensowenig irgendeinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Jeder Mensch hat, wie seinen Fingerabdruck, seinen eigenen, unverwechselbaren Glauben, woran auch immer. Es ist ein Glaube, der sich im Laufe des Lebens verfestigen, wandeln, verflüchtigen kann. Gänzlich zerbrechen wird er nie. Man kann zwar als „Ungläubige“ oder als „Ungläubiger“ geschmäht werden, wenn man die Glaubensrichtung desjenigen nicht teilt, der so lästert. Aber absolut ungläubig zu sein widerspricht, so sagt Alexis de Tocqueville, „dem natürlichen Gefühl des Menschen und versetzt seine Seele in einen trostlosen Zustand“. Die in diesem Buch vorgelegten Angebote wollen davor bewahren. Nicht durch Aufdrängen eines Standpunktes – dann wäre es kein Essay. Sondern dadurch, dass die vergnügliche Lektüre zum beflügelnden Nachdenken anregt.
Ratschläge, Kritik, Zuspruch und Widerspruch erfuhr ich im Laufe des Schreibens von Laurentius Eschlböck OSB, Lukas Hartig, Jakob König, Exz. Maria-Pia Kothbauer, Heinz Sichrovsky und Hans Winkler. Ihnen allen sei herzlichst gedankt. „Gratias multas ago“ dem verlässlichen und überaus engagierten Team des Christian Brandstätter Verlags, vor allem aber ein „merci cordialement“ dem Verlagsleiter Nikolaus Brandstätter, der das Wagnis auf sich nahm, einen Essay – die heikelste Gattung Literatur, eine Art Nomade in Papierform – in sein ambitioniertes und von beneidenswertem Erfolg gekröntes Programm aufzunehmen.
Den belastbarsten Rückhalt erfuhr ich in gewohnter und für mich immer wieder bestärkender Weise von meiner Frau Bianca und von unseren beiden Kindern Laura und Alexander. Engagiert studierten sie kritisch mein Manuskript und halfen mir über manche Klippen beim Schreiben hinweg.
Kurt Gödel und Albert Einstein 1954 bei einem ihrer gemeinsamen Spaziergänge in der Nähe des Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey, USA.
Prolog
DER MATHEMATISCHE GOTTESBEWEIS
Kurt Gödel, 1906 in Brünn geboren, gilt als der größte Logiker seit Aristoteles. 1930 faszinierte er die mathematische Welt mit dem sogenannten Unvollständigkeitssatz, der die formale Mathematik in ihren Grundfesten erschütterte. Mit seinem klaren und unbestechlichen Verstand beeindruckte er Albert Einstein, als ihn dieser in Princeton kennenlernte – nicht nur Einstein, auch das Ehepaar Gödel ist vor Hitlers Schergen nach Amerika geflohen. Stundenlang unterhielten sich die beiden Geistesgrößen bei ihren Spaziergängen in den Parks des Institute for Advanced Study. Einstein behauptete einmal, dass er eigentlich nur deshalb von seiner Wohnung ins Institut gehe, weil er sich dort mit seinem Freund Gödel trifft und mit ihm plaudern kann.
Gödel behielt vieles von dem, was er wusste, für sich. Er war alles andere als gesprächig. In Amerika pflegte er nur mit Einstein und nach dessen Tod nur mit dem ebenfalls vor den Nazis nach Amerika geflohenen Wirtschaftsprofessor Oskar Morgenstern Kontakt. Als Gödel vor dem Zweiten Weltkrieg in Wien studierte und als Dozent lehrte – die meisten Vorlesungen sagte der menschenscheue Eigenbrötler ohnehin noch vor ihrem Beginn ab –, nahm er an den Sitzungen des berühmten Wiener Kreises teil: Jeden Donnerstagabend trafen sich Philosophen, Physiker, Mathematiker und andere Wissenschaftler im mathematischen Institut, um die Philosophie völlig neu zu begründen und all den Unfug von ihr zu entfernen, der sich ihrer Meinung nach seit Platon und Aristoteles angesammelt hatte. Nur exakte Definitionen waren geduldet, nur logisch einwandfreie Argumente, nur auf sicherer Erkenntnis beruhende Urteile – alles andere, vor allem das Reden über Gott, wurde als Scheinproblem bloßgestellt und verdammt. Gödel hörte sich all dies interessiert an und schwieg. Nie sagte er im Wiener Kreis ein einziges Wort.
Er machte sich seine eigenen Gedanken, die er streng für sich behielt. Er dachte nicht nur über Mathematik, sondern auch über Gott nach. Und gelangte in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts zu einer in seinen Augen sehr befriedigenden Erkenntnis: Nach Gödels Tod, im Jahre 1978, tauchte in seinem Nachlass ein mathematischer Beweis für die Existenz Gottes auf. Gödel hatte ihn nicht veröffentlicht, weil er besorgt war, man könne ihn als Glaubensbekenntnis auffassen. Der Beweis ist vollkommen korrekt, hieb- und stichfest. 2013 hatten ihn die Informatiker Christoph Benzmüller von der Freien Universität Berlin und Bruno Woltzenlogel Paleo von der Technischen Universität Wien anhand eines eigens dafür entworfenen Computerprogramms überprüft – Gödel wäre darüber ziemlich sicher erbost gewesen. Denn ihm, dem fraglos größten Logiker der Neuzeit, einen Fehler in einer von ihm als wichtig erachteten Abhandlung zu unterstellen, ist eigentlich eine Frechheit.
Bei seinem Gottesbeweis bediente sich Gödel eines raffinierten Arguments des mittelalterlichen Kirchenlehrers Anselm von Canterbury: Wenn Gott als derjenige gemeint ist, über den hinaus nichts Vollkommeneres gedacht werden kann, aber dieser Gott nur als Möglichkeit und nicht als Wirklichkeit existierte, dann trüge er nicht die Fülle der Vollkommenheit in sich. Denn nur möglich, aber nicht wirklich zu sein, bedeutet unvollkommen zu sein. Gott jedoch trägt die Fülle der Vollkommenheit in sich. Darum, so Anselm, ist Gott nicht bloß gedanklich möglich, sondern sogar wirklich: Er existiert.
Den hl. Thomas von Aquin, Immanuel Kant und viele andere Denker überzeugte Anselms Beweis nicht. Thomas von Aquin glaubte andere, stichhaltigere Gottesbeweise liefern zu können. Doch aus der Sicht Gödels klang Anselms Herleitung von Gottes Existenz verführerisch. Und ihm gelang tatsächlich, Anselms Argument auf ein mathematisch sicheres Fundament zu stellen.
Trotzdem sind Gottesbeweise, mögen sie von Anselm von Canterbury, von Thomas von Aquin oder von Kurt Gödel stammen, höchst eigenartig. Nur Zweifler an Gott bedürfen ihrer. Wer an Gott glaubt, hat keinen Gottesbeweis nötig. Anscheinend war das Mittelalter – jene Ära, in der die Kirche größte Machtentfaltung entwickelte, in der Hunderte von Klöstern gegründet, eine Unzahl romanischer und gotischer Gotteshäuser errichtet wurden – eine Zeit, in der man an Gott zu zweifeln begann. Wie ein Ertrinkender verzweifelt nach einem Strohhalm greift, so verlangten die Gelehrten des Mittelalters nach Gottesbeweisen. Denn ihr Glaube begann zu bröckeln.
Aber kein Gottesbeweis bringt den Glauben an Gott zurück. Ein Gott, der bloß existiert, selbst wenn er auf mathematisch sicherer Basis existiert, geht mich nichts an. Weder tanze ich vor noch bete ich zu ihm.
Wie auch Kurt Gödel aus seinem Gottesbeweis für sein eigenes Leben wohl kaum Gewinn ziehen konnte: Seit der Ermordung des von ihm verehrten Leiters des Wiener Kreises, des Philosophieprofessors Moritz Schlick im Jahre 1936, litt er an Depressionen und hatte immer wieder Nervenzusammenbrüche. Sein labiler Geisteszustand wurde durch den Verdacht seines Freundes Einstein, dass der US-amerikanische Geheimdienst, wie einst in Deutschland die Geheime Staatspolizei, überall seine Fänge ausbreite, um einen krankhaften Verfolgungswahn bereichert. Nach Einsteins Tod zog sich Gödel fast völlig von der Öffentlichkeit zurück. Selbst im eigenen Hause wurde er zusehends sonderlich. Sein Essen, so mutmaßte er, könnte vom Geheimdienst vergiftet sein. Nur wenn seine Frau Adele mit seinem Besteck die Speisen vorkostete, griff er, nach stundenlanger sorgfältiger Beobachtung des Gesundheitszustandes seiner Frau, zaghaft zu. Als Adele Gödel für längere Zeit ins Krankenhaus musste, verweigerte Gödel stur jede Nahrungsaufnahme und ist schließlich aus Angst, vergiftet zu werden, verhungert.
Im Übrigen war Kurt Gödel überzeugt, dass Gespenster existieren.
Friday the 13th, Freitag der 13. bringt Unglück, denn 13 gilt als Unglückszahl (wie in China die Zahl 4). Dagegen helfen eine Hasenpfote und das Daumen-Halten – in Amerika: to keep one’s fingers crossed, das Kreuzen der Finger.
DER GLAUBE AN 313
Er besitzt keinen guten Ruf. Trotzdem dürften ihm mehr Menschen anhängen, als man vermuten würde: dem Aberglauben. Denn er besteht seit Urzeiten. Schon Steinzeitmenschen warfen Würfel, die sie aus den Knochen der von ihnen erlegten Tiere schnitzten. Wenn die Würfel günstig fielen, waren sie überzeugt, dass ihnen die Götter oder Geister günstig gewogen sind.
Der römische Historiker Sueton berichtet, dass Kaiser Augustus ein manisch besessener Würfelspieler war: Er warf vier Würfel gleichzeitig und freute sich herzhaft über den „Venuswurf“, der dann zustande kommt, wenn die vier Würfel lauter verschiedene Augenzahlen zeigen. Dann nämlich, so glaubte er, ist ihm Venus, die Göttin der Liebe, hold. Dass man im Werfen der Würfel dem Glück nachjagt, dass man aus den Sternen oder aus dem Blick in eine Kristallkugel das Schicksal ergründen möchte, das alles und viel mehr hat sich bis heute erhalten. In den kuriosesten und wunderlichsten Spielarten begegnet man dem Aberglauben.
Wohl kaum ein anderes Volk auf der Erde ist seit alters her bis in die Gegenwart so sehr dem Aberglauben verfallen wie das chinesische. Dies beginnt schon damit, dass ein Chinese sich möglichst schnell die Hände waschen will, wenn er sich vom Unglück verfolgt fühlt, weil er damit die schlechte Aura, das an ihm klebende Pech, entfernen möchte. Meint er aber, einen guten Lauf zu haben, vermeidet er das Händewaschen, um die an ihm haftende Fortuna nicht wegzuspülen.
Die Farbe Rot wird in China besonders geliebt, und das hat nichts mit dem dortigen kommunistischen Regime zu tun. Sondern seit jeher glaubt man in China daran, dass Rot das Glück und die Freude anzieht. Leider sind viele Chinesen heillos dem Glücksspiel verfallen, und die meisten von ihnen betreten das Casino – am besten nicht durch den Haupteingang, er hat dem Feng Shui zufolge eine schlechte Aura, sondern durch einen Seiteneingang – mit roter Unterwäsche: Egal ob Boxershort, Slip oder Büstenhalter – solange Chinese und Chinesin rot tragen, ist das Glück auf ihrer Seite.
Gelb, einst die kaiserliche Farbe, steht für Toleranz, Geduld und Weisheit, gewonnen aus Erfahrungen. Gelb, vor allem Gold, ist als glücksbringende Farbe vielleicht sogar noch mächtiger als Rot, aber es war früher allein dem kaiserlichen Hof vorbehalten. Ebenso sind auch andere Farben mit Symbolen überfrachtet und kommen nach streng zu befolgenden Regeln zur Geltung: Grün lindert Sorgen und verheißt Ruhe, Hoffnung und Frische; Blau steht für das Wachstum, die Hoffnung und die Treue etc.
Doch erst richtig tobt sich Chinas Aberglaube bei den Zahlen aus.
Die Zahl vier, chinesisch „si“ gesprochen, ist in China die Unglückszahl schlechthin. Denn diese Zahl klingt auf Chinesisch genauso wie Sterben und Tod. Wo immer es geht, wird vier gemieden, sogar wenn diese Ziffer als Einerstelle in Zahlen wie 14, 24 oder 34 vorkommt. 44 ist natürlich ganz schlimm. Mobiltelephonnummern, die mit 4 enden oder in denen die Ziffer 4 häufig vorkommt, sind in China unverkäuflich.
Dafür sind die Zahlen sechs und neun recht beliebt. Das chinesische Wort für sechs klingt im Kantonesischen genauso wie das Wort für Wohlstand. Im Standardchinesischen klingt es wie das Wort für flüssig, im Fluss sein. Darum denkt ein Chinese, wenn er auf die Ziffer 6 stößt, an einen sprudelnden Gewinn. Bei der Zahl neun denkt er an den Kaiser von China, dessen Beamte in einem System von neun Rängen organisiert waren und denen der Kaiser neun verschiedene Ehrenzeichen für besondere Taten verleihen konnte. Der in der chinesischen Mythologie als guter Dämon verehrte Drache hat neun Kinder.
Die absolute Glückszahl Chinas jedoch ist acht. Sie wird im Chinesischen „ba“ gesprochen, und das klingt so ähnlich wie das Wort für den bevorstehenden Reichtum. Verträge unterzeichnet man am besten am 8. des Monats um acht Uhr. Als die Bank of Communications an die Hongkonger Börse ging, beantragte sie die Wertpapiernummer 3328. Diese Zahl endet nicht nur mit der Ziffer 8, wenn man sie im Chinesischen ausspricht, hört man überdies die Devise „leicht reich werden“.
Autokennzeichen und Mobiltelephonnummern mit vielen Ziffern 8 werden zu hohen Preisen verkauft. Den Gegenwert von mehr als 20.000 Euro zahlte ein Geschäftsmann im südlichen Hainan für eine Nummer, die mit 888 endete. Und bei einer Versteigerung einer Nummer mit einer fünffachen 8 ergatterte diese ein Privatmann aus der Provinz Henan für sage und schreibe 75.000 Euro.
So gesehen ist es kein Wunder, dass die in Peking abgehaltenen Olympischen Spiele mit einer feierlichen Zeremonie exakt am 8. 8. 2008 abends um 8 Uhr und 8 Minuten eröffnet wurden.
Welche Zahl ist Ihre Lieblingszahl?“
In fast jedem Interview mit mir als Mathematiker taucht diese Frage auf. Weil viele dem Aberglauben anhängen, bestimmte Zahlen trügen die Aura des Glücks oder des Unglücks in sich. Sie vermuten daher: Wer sich mit Mathematik beschäftigt, hätte zu Zahlen ein besonderes, ein inniges, vielleicht sogar ein erotisches Verhältnis. Ich habe es aufgegeben, mich gegen diese Frage zu wehren und zu betonen, dass für mich jede Zahl gleich viel oder besser: gleich wenig bedeutet. Ich habe mir einfach eine Standardantwort zurechtgelegt und sage schlicht: „313.“
„Warum gerade 313?“, wird sofort nachgefragt.
„313 ist die Zahl des Autokennzeichens von Donald Duck“, antworte ich darauf. (Ich spreche dabei „Duck“ so aus, wie es geschrieben steht. So hatte ich es als kleines Volksschulkind getan und war später schwer enttäuscht, als man mich belehrte, dass es richtig „dak“ auszusprechen sei. Bis heute wehre ich mich dagegen, schon aus Verehrung für Doktor Erika Fuchs, jene großartige Germanistin, die alle vom genialen Carl Barks geschaffenen Donald-Duck-Geschichten mit einzigartigem Sprachwitz ins Deutsche übertrug.)
Die Idee zum Nummernschild 313 für Donalds Karosse stammt vom ersten Donald-Duck-Zeichner Charles Alfred Taliaferro, der auch Donalds Neffen Tick, Trick und Track erfand. Die Zahl 313 soll wohl auf Donalds Geburtstag, den 13. März, hinweisen (Three-Thirteen lautet er im Amerikanischen, weil in den USA die Nummer des Monats vor jener des Tages genannt wird – wir kennen das von Nine-Eleven). Klar, dass ein Pechvogel wie die vom Schicksal verfolgte Ente Donald an diesem Tag geboren sein muss: 3 × 13 symbolisiert ein dreifaches Unglück.
Warum 13 in unseren Breiten als „Dutzend des Teufels“ mit dem Unglück verwoben sein soll, ist nicht leicht zu beantworten. König Philipp von Makedonien, der Vater Alexanders des Großen, wollte zu den zwölf Statuen der olympischen Götter sein eigenes Abbild als 13. Statue hinzufügen und wurde, bevor es dazu kam, von seinem Leibwächter Pausanias meuchlings ermordet. Vielleicht hat es damit zu tun, vielleicht aber wegen eines banalen sprachlichen Grundes: Die Zahl 13 setzt sich im Deutschen wie im Englischen als erste aus den sprachlichen Bausteinen drei und zehn zusammen, während alle Zahlen davor durch unzerlegbare Wörter bezeichnet sind. Für diese Deutung spricht, dass in Italien traditionell nicht 13, sondern 17 als Unglückszahl gilt. Dort erfolgt der gleiche sprachliche Sprung im Zählen von quattordici, quindici, sedici zu diciassette, diciotto, diciannove, also von 14, 15, 16 zu 17, 18, 19 eben bei der Zahl 17. Ein anderer Grund, dass die Nachkommen der alten Römer 17 als Unglückszahl empfinden, mag aus der römischen Schreibweise dieser Zahl herrühren: XVII. Man kann die Buchstaben so vertauschen, dass daraus das lateinische Wort VIXI entsteht, übersetzt: Ich habe gelebt. Und zwar in der Bedeutung: Ich habe mein Leben bereits hinter mir. Doch nur mehr traditionsbewusste Italiener erinnern sich an die Unglück bringende Aura von 17. Für junge, dem nördlichen Europa und Nordamerika aufgeschlossene Italiener ist bereits 13 zur Unglückszahl geworden.
Wie dem auch sei: Aus mathematischer Sicht ist an 313 nichts Besonderes zu bemerken. 313 ist Primzahl, aber das sind auch unendlich viele andere Zahlen. Sie ist überdies das „größere Geschwister“ der Primzahlzwillinge 311 und 313: Zwei Primzahlen bilden nämlich dann ein Zwillingspaar, wenn sie sich um 2 unterscheiden. Primzahlzwillinge sind zum Beispiel 3 und 5 oder 11 und 13 oder 521 und 523 oder 1997 und 1999. Es gibt sie zuhauf. Als Lieblingszahl für einen Mathematiker ist 313 nicht gerade die erste Wahl. 1729 ist mindestens genauso attraktiv.
Doch bei der Frage nach der Lieblingszahl fühle ich mich eben nicht als Mathematiker angesprochen. Sondern als ein Mensch mit seinen Vorlieben und seinen Schwächen, mit seinen Wünschen und seinen Geheimnissen. Wenn ich bei der Frage nach der Lieblingszahl mit „313“ antworte, verstecke ich mich hinter Donalds Figur. Sie ist untrennbar mit 313 verwoben, und ein wenig finde ich mich – wie wohl viele unter uns – in ihr wieder.
Obwohl ich weiß, dass es ein wenig verrückt ist, halte ich bei meinen Spaziergängen auf den Straßen Wiens immer wieder nach Autos Ausschau, ob sie wohl 313 als Kennzeichen tragen. Wenn mir so ein Gefährt vor die Augen tritt, freue ich mich und halte den Tag für gerettet. Ich bin schon zufrieden, wenn 313 wenigstens in der Ziffernfolge des Kennzeichens auftaucht, ja sogar, wenn das Kennzeichen mindestens zweimal die Ziffer 3 und mindestens einmal die Ziffer 1 in sich trägt. Das kommt recht oft vor und lässt mich insgeheim hoffen, dass die Ziele, die ich mir gerade vornehme, erreicht werden. Einmal begegnete ich sogar einem Wagen mit dem Kennzeichen 313 und der Buchstabenkombination DD. 313 mit den Initialen Donalds! Besser konnte ich es gar nicht treffen!
Selbstverständlich weiß ich, dass dieser kleine private Aberglaube nichts anderes als eine lächerliche Marotte ist. Aber ich werde von ihr wohl mein Lebtag nicht loskommen. Sie schadet auch nicht. Im Gegenteil: Wenn 313 genauso wie homöopathische Pillen einen Placebo-Effekt hervorruft, nützt mir mein kleiner Aberglaube. Und er ist im Gegensatz zu den homöopathischen Pillen ohne Kosten verbunden.
Meine Haltung zum Aberglauben eifert jener des großen dänischen Physikers Niels Bohr nach, der einer schönen Anekdote zufolge einmal in seinem Haus von einem Kollegen besucht wurde. Über dem Eingang zum Haus hing ein Hufeisen, was den Besucher maßlos erstaunte: „Sie, Herr Bohr, und ein Hufeisen? Glauben Sie etwa im Ernst daran, dass es Glück bringt?“ Niels Bohr antwortete: „Selbstverständlich nicht! Aber ich habe mir sagen lassen, es hilft auch dann, wenn man nicht daran glaubt.“
Nicht wenige jedoch sind dem Aberglauben heillos verfallen. Die aufgeklärte Welt war bass erstaunt, als man erfuhr, dass der Terminkalender des in den 1980er Jahren mächtigsten Mannes der Welt, des US-Präsidenten Ronald Reagan, von der Astrologin seiner Frau Nancy sorgfältig geplant und eingeteilt wurde. Die Horoskope der kalifornischen Wahrsagerin Joane Quigley, Erbin eines vermögenden Hotelbesitzers und Autorin astrologischer Handbücher, wurden von Nancy Reagan meist am Wochenende auf Camp David telephonisch eingeholt: An ihnen hatte sich die Weltmacht USA zu orientieren. Änderungsvorschläge der politischen Berater des Präsidenten, die aus vernünftigen Gründen vorgebracht wurden, verhinderte Nancy Reagan oft erfolgreich. „Praktisch jeder wichtige Schritt oder jede Entscheidung der Reagans wurde im voraus mit einer Frau in San Francisco abgeklärt, die Horoskope stellte“, so Donald Regan, ein nach Veranlassung von Nancy Reagan aus dem Stab des Präsidenten entlassener Berater. Die Gattin des Präsidenten wollte immer sichergehen, „dass die Konstellation der Gestirne für das jeweilige Unternehmen günstig war“.
„Während die First Lady ihre Augen auf die Sterne richtete, hatte der Präsident seinen Kopf in den Wolken“, schrieb damals das sonst Reagan-freundliche Wall Street Journal despektierlich. Umso erstaunlicher ist es, dass Ronald Reagan jener erfolgreiche Präsident der USA war, in dessen Ära die Zerrüttung der Sowjetunion und ihrer Satellitenstaaten, wohl auch durch die Drohungen des Präsidenten mit SDI, vulgo „Star Wars“, befördert, offen zutage trat, jener Präsident, der in Berlin in Richtung Osten die Worte „Mr. Gorbachev, tear down this wall!“ rief – und tatsächlich: Ein Jahr nach seiner Präsidentschaft verschwand die Mauer. Gläubige der Astrologie finden bei ihm und seiner Gattin reichlich Stoff zur Unterlegung ihrer Überzeugung.
Alle Belege der Statistik, dass astrologische Prognosen genauso haltlos sind wie das Lesen im Kaffeesud oder das Legen von Tarotkarten, prallen an den Anhängern des Aberglaubens ab. Statistik, entgegnen sie listig, ist wie ein Bikini: Sie zeigt viel, aber verbirgt das, was man wirklich sehen will. Tatsächlich ist der Einzelfall, das die jeweils einzelne Person betreffende einzigartige und einmalige Ereignis, dem Zugriff der Statistik entzogen. Auch wenn ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit für das Werfen einer Sechs bei einem Würfel genau 1/6 beträgt, hilft mir dieses Wissen nicht, wenn ich den Würfel nur einmal werfe. Auch wenn statistisch noch so überzeugend belegt wird, dass sich an einem Freitag dem 13. im Schnitt gleich viele Unfälle ereignen wie an jedem anderen Tag: Wenn die dem Aberglauben verfallene Person an einem Freitag dem 13. von der Treppe stürzt, macht sie dieses Datum dafür verantwortlich. Kühl rechnende Gemüter entlarven mit Statistik den Aberglauben als Unsinn. Aber wer will angesichts seines persönlichen Schicksals im kühlen Rechnen verharren?
Die Römer der Antike taten es gewiss nicht. Sie gehörten einem Volk an, das für seinen fast übertriebenen Aberglauben geradezu berüchtigt war. Keine Entscheidung zur Schlacht ohne vorherige Befragung des Orakels, das oft zweideutige Antworten gab – Julius Caesar berichtet davon in seinen Büchern über den Gallischen Krieg. Auguren beobachteten den Flug der Vögel am Himmel. Haruspices – das Wort stammt aus dem Etruskischen, es bedeutet übersetzt „Seher“, in dem Wortteil „-spices“ verbirgt sich der Ursprung dessen, was man heute eine „Spekulation“ nennt – wühlten in den Eingeweiden der geschlachteten Opfertiere. All dies und noch viel mehr fauler Zauber gehörte zum alltäglichen Ritual. Jedes römische Haus hatte seine eigenen kleinen Gottheiten, die Laren und Penaten, die es am kleinen im Haus errichteten Altar ständig zu beschwören galt, um sich vor Unglück zu schützen. Wehe, wehe, es geschah ein Schnitzer beim Aufsagen der Beschwörungsformel – dem Unheil war dann Tür und Tor geöffnet. Nach der Hochzeit wird die Braut vom Bräutigam über die Schwelle getragen, denn stürzte sie beim Eintritt ins Haus, wäre dem Paar mit Sicherheit bitteres Verderben beschieden.
Bezeichnend für den unbändigen Aberglauben der Römer ist, wie Theodor Birt in seinem Buch über römische Charakterköpfe die von den Zeitzeugen mit allerlei Brimborium umrankte Schilderung der Geschehnisse knapp vor der Ermordung des Gaius Julius Caesar überliefert:
Die Tat war auf die Iden des März angesetzt, den 15. des Monats. Allerlei böse Vorzeichen warnten den Herrscher. Aber er verachtete sie. Caesar trug seine Verachtung allen Aberglaubens stets zur Schau. Seine einzige Schwäche war, dass er, wenn er reiste und den Wagen bestieg, dabei einen Zauberspruch dreimal aufsagte. Das kam daher, weil er einmal mit einem Wagen zusammengebrochen war. Jetzt geschah es, dass am Tage vor dem 15. März ein kleiner Vogel, den man den „kleinen König“ oder Zaunkönig nannte, in den Senatssaal flog und da von anderen Vögeln totgebissen wurde. Welche Vorbedeutung! Schlimmer noch, dass Calpurnia, seiner Gattin, in der letzten Nacht träumte, dass Caesar in ihrem Schoße starb.
Am Morgen fühlte Caesar sich unpässlich – er kränkelte jetzt öfter – und zauderte auf Andringen Calpurnias ernstlich in die Senatssitzung, die er selbst anberaumt hatte, zu gehen. Der Senat war schon versammelt. Die Mörder warteten lange auf ihn, umsonst. Ein bleicher Schreck befiel sie. Gelang die Tat heute nicht, so musste alles ruchbar werden. Es war etwa 11 Uhr vormittags. Das Warten war unerträglich. Einer der Senatoren wurde abgeschickt, Caesar zu holen. Da entschloss sich Caesar; er kam wirklich. In seiner Hand trug er einen eben eingetroffenen Brief, der ihm den ganzen Mordplan enthüllen sollte. Aber er verschob es, ihn aufzumachen. Unterwegs bemerkte Caesar einen Wahrsager, einen Haruspex, der ihn kürzlich vor den Iden des März gewarnt hatte. Caesar rief ihn lachend an: „Heute sind ja die Iden, und ich lebe noch!“ Der andere erwiderte ernst: „Die Iden sind da, aber noch nicht vorüber.“
Vor dem Sitzungssaal fand Caesar die Opferdiener, die schon Tiere geschlachtet hatten. Er wollte vor der Sitzung erst opfern. Aber es war schon zu spät geworden. Er unterließ es und betrat sogleich den Saal, der mit des Pompejus gewaltigem Standbild geschmückt war.
Selbst Theodor Birt, der nüchterne Gelehrte, scheint überzeugt zu sein: Hätte Caesar die Eingeweideschauer ihr Amt an diesem Tag vor der Senatssitzung verrichten lassen, er wäre seiner Ermordung entgangen. Die Weltgeschichte hätte einen anderen Verlauf genommen.
Wie eigenartig, dass mit all dieser Leichtgläubigkeit das Römische Reich über viele Jahrhunderte bestehen konnte, große Teile Europas und den gesamten Mittelmeerraum, von den britischen Inseln bis zu Ägypten, von Spanien bis zu Kleinasien reichend, also fast einen Kontinent beherrschte. Noch eigenartiger, dass vor der Schlacht an der Milvischen Brücke mit der Entscheidung des Kaisers Konstantin für das Christentum das Ende dieses Weltreiches eingeläutet wurde. Nun kamen jene Anhänger einer in den Augen der heidnischen Römer verrückten jüdischen Sekte zum Zug, die nicht nur Juden wie Heiden zu missionieren trachteten, sondern auch alle dem Aberglauben frönenden Kulte brüsk ablehnten. Vor Kaiser Konstantin schimpften die sich vor den launischen Göttern fürchtenden Römer die frühen Christen noch verächtlich „Atheisten“.
Launisch waren nicht nur die Götter der Römer, launisch waren auch die griechischen Götter. Bei Gewittern schwang Zeus seine Blitze, bei Erdbeben schlug Hephaistos auf den Amboss, bei Sturmfluten warf Poseidon erregt den Dreizack. Doch im Unterschied zu den Religionen Ägyptens oder Babylons war der griechische Götterhimmel wenig ehrfurchtgebietend. Boshaftigkeiten und Betrügereien, Intrigen und Gemeinheiten beherrschten die von Hesiod und Homer beschriebene Götterwelt: Zeus stellte jedem weiblichen Wesen nach, sei es sterblich oder unsterblich. Die betrogene Hera verfolgte ihn, von Eifersucht getrieben. Aphrodite war von verführerischer Anmut und trieb mit den Liebhabern wie eine Katze mit der Maus ein oft grausames Spiel. Athene, die Göttin der Weisheit, war in Wahrheit eine zickige Jungfrau – kurz: Der Götterhimmel der Griechen war nichts anderes als die Vorwegnahme der Soap-Operas. Und wie bei den billig produzierten Endlosserien waren auch die griechischen Götter zur Unsterblichkeit verdammt. In Wahrheit, dies war den aufgeklärten Griechen schon mehr als 500 Jahre vor Christi Geburt, zur Zeit des Thales von Milet, des Pythagoras und des Heraklit bewusst, konnte man all dies nicht wirklich ernst nehmen.
Es ist nämlich nicht die Statistik, die den Aberglauben als Unsinn entlarvt. Es ist vielmehr die Einsicht, dass all jene Regeln und Verfahren, welche die dem Aberglauben Ergebenen mit peinlicher Akribie verfolgen – das Vermeiden im 13. Stockwerk eines Hauses zu wohnen, sich in die 13. Reihe eines Busses oder eines Flugzeugs zu setzen, so es diese überhaupt gibt, beim Begegnen mit einem Schornsteinfeger mit der rechten Hand einen Knopf des eigenen Anzugs zu berühren, Misteln in Häusern aufzuhängen, um die Bewohner vor Hexen zu bewahren – erbärmlich platt sind. Es ist schlicht die trostlose und zugleich lächerliche Banalität des Aberglaubens, die dazu zwingt, ihn abzulehnen. Jedenfalls in Lebenslagen, in denen man sich der Tiefe des Daseins zu stellen hat. In Situationen wie diesen versagt der Aberglaube schmählich.
Den Griechen der Antike war dies, selbst wenn sie es sich der Tradition der alten Göttermythen zuliebe nicht eingestehen wollten, bereits in ihrem Inneren bewusst. Einer Legende nach wagte sich einst einer von ihnen auf den Olymp, den nebelverhangenen Berg, wo dem Aberglauben zufolge die Götter wohnten. Doch er fand auf seinem Gipfel nur Steine. Was tun, wenn die Himmel von den Göttern geleert sind?
Drei überdimensionale Windräder an der Spitze eines Berges, die Bäume haushoch überragend, künden missionarisch vom Glauben an die Natur, weil sie das Zeichen des alten Gipfelkreuzes ersetzen.
DER GLAUBE AN DIE NATUR
Der Himmel groß, voll herrlicher Verhaltung! Ein Vorrat Raum, ein Übermaß von Welt! Und wir, zu ferne für die Angestaltung, zu nahe für die Abkehr hingestellt.“
Die poetischen Worte Rilkes kommen uns in den Sinn, wenn wir in einer wolkenlosen Nacht, fern von den störenden Lichtern der Großstadt, das sternenübersäte Himmelszelt bewundern.
Was uns Heutige zum Staunen veranlasst, wurde vor mehr als fünf Jahrtausenden im alten Ägypten von den dort wirkenden Priestern als Zeichen und Wunder der im Himmel thronenden Götter gedeutet. In dieser riesigen Wüste, die allein durch den lebenspendenden Nil bewohnbar war, strahlen in fast allen Nächten die Sterne im hellsten Glanz. Das gleißende Band der Milchstraße bildete in den Augen der ägyptischen Astronomen ein Abbild des Nils auf der Himmelskuppel. Oder war es umgekehrt, dass der irdische Nil so fließt, wie es sein Ebenbild im Sternenzelt vorgibt?
Ein auffälliges Ereignis, das sich wundersam wiederholte, spricht dafür: Immer, wenn ein besonders helles Gestirn im Sternbild des Hundes – es trägt heute den Namen Sirius, die alten Ägypter nannten es Sopdet, Göttin des neuen Jahres – knapp vor Sonnenaufgang über dem Horizont erschien, begann der Nil über die Ufer zu treten und mit dem fruchtbaren Schwemmland von seinem Oberlauf die Äcker der Bauern zu überfluten. Die Priester ließen durch den Pharao dem Volk verkünden, dass die Götter jenes himmlische Zeichen setzten, das den fruchtbringenden Nil das Land zu überfluten veranlasst. Sie selbst aber wussten: Der Rhythmus, nach dem der Sirius seinen Aufgang in der Morgendämmerung vollzieht, wiederholt sich nach einem ehernen Gesetz: 365 Tage muss man warten, und er wird wieder erscheinen. Diese Zeitspanne von 365 Tagen ist das ägyptische Jahr. Die Beobachtung der antiken Astronomen war sogar so genau, dass ihnen eine leichte Verzögerung beim Auftauchen des Sirius auffiel. Sie führt dazu, dass sich der Stern nach jedem vierten Jahr um einen Tag verspätet – ein Geheimnis, das die Gelehrten streng für sich behielten.
Dem Volk wurden die Rhythmen der Zeit als göttliche Fügungen vermittelt. So verkündeten die Priester, dass die riesigen Obelisken, die an ihrer Spitze mit einer kleinen vergoldeten Pyramide endeten, die Strahlen des Sonnengottes Ra hier auf Erden darstellen. Und tatsächlich spiegelte sich die Sonne an der Obeliskenspitze im strahlenden Widerschein. Wer aus dem einfachen Volk erkannte darin nicht das segensreiche Wirken der Priester? Tatsächlich jedoch diente der Obelisk den klugen Gelehrten als Zeitmesser: Während des Tages wandert der Schatten im gleichmäßigen Lauf von Westen über Norden nach Osten. Und die Länge des Schattens ändert sich im Laufe des Jahres: Im Sommer ist er kurz und der Tagesweg der Schattenspitze nach innen gekrümmt, im Winter ist er lang und der Tagesweg der Schattenspitze nach außen gekrümmt. Nur zu Frühlings- und zu Herbstbeginn, an den Tag- und Nachtgleichen, wandert die Schattenspitze während des Tages entlang einer kerzengeraden Linie.
Möge das ungebildete ägyptische Volk hinter allen Geheimnissen der Natur die Macht der ewigen Götter vermuten – den Priestern und Pharaonen war es nur recht: So waren sie sich der Fügsamkeit des Volkes sicher. Die Gelehrten selbst aber wussten: Die Geheimnisse ruhen nicht bei irgendwelchen Göttern, sondern in der Natur selbst. Einer Natur, die mathematischen Regeln folgt. Doch nie, nie, nie darf dies verraten werden. Denn der Verlust der Götter bedeutete den Sturz der theokratischen Gesellschaft Ägyptens ins Bodenlose.
Ähnlich waren die anderen frühen Hochkulturen der Menschheit vom religiösen Kult geprägt: Die Gottheiten lenken die Kräfte der Natur, die Priester bilden die Brücke von der Erde zum Himmel – nicht umsonst heißen sie Pontifices, Brückenbauer –, die Gesellschaft erhält durch den geheimnisvollen Kult Stabilität, und die Macht ist in der Hand der wenigen Gelehrten geballt. Nur die Griechen überwanden in der Ära der Antike diese Herrschaftsform, bei der die Staatsgewalt aus der Lehre von den Göttern erwächst. Dazu fehlte den Göttern des Hesiod und des Homer das Ehrfurchtgebietende. Sie waren eher lächerliche Figuren. Schon um 500 v. Chr. behaupteten Thales, Heraklit, Anaximander und die anderen ersten Philosophen, die Wahrheit nicht von Göttern zu vernehmen, sondern in der Beobachtung der Natur zu finden. Es gibt nur Atome und das Leere, lautet die nüchterne Feststellung von Leukipp und Demokrit.
So poesielos kalt wollen die meisten Menschen die Natur jedoch nicht sehen. Sie erblicken in ihr das Zweckmäßige, das Lebenspendende, das Zielgerichtete, das ihnen Wohlgesonnene. Selbst wenn die launischen Götter der Griechen Phantasiegebilde einfallsreicher Poeten sind: Die Schöpfung, egal ob sie von den Göttern hervorgebracht wurde oder nicht, ist ein Wunderwerk. „Omnia in mensura et numero et pondere disposita“: „Alles ist nach Maß und Zahl und Gewicht geordnet“, heißt es im Buch der Weisheit.
Die Zeugnisse für die Ordnung in der Natur scheinen erdrückend zu sein. In den ersten Hochkulturen der Menschheit erblickte man sie bevorzugt am gestirnten Himmel:
Die Sonne durchläuft während eines Jahres auf der Himmelskuppel einen Kreis, die sogenannte Ekliptik, auf der sich die zwölf Sternzeichen Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische befinden. Darum wurde seit ältester Zeit das Jahr in zwölf Monate unterteilt. Bei den alten Ägyptern bestand ein Monat immer aus 30 Tagen, drei sogenannten Dekaden, die jeweils zehn Tage umfassten, und am Ende des Jahres wurden, gleichsam zur Korrektur, noch fünf zusätzliche Tage angehängt. (Der von der Nationalversammlung Frankreichs nach der Revolution von 1789 eingeführte „Republikanische Kalender“ übernahm diese ägyptische Tradition. Die fünf zusätzlichen Tage, die sogenannten „Jours sans-culottides“, wurden jedes vierte Jahr um einen weiteren Schalttag ergänzt.)
Im Zweistromland blickte man bevorzugt auf den Mond, der innerhalb von ziemlich genau 29 Tagen und einem halben Tag seine Phasen wechselt. Darum bestand dort ein Monat abwechselnd aus 30 und aus 29 Tagen. Jeder Monat sollte beginnen, wenn sich am frühen Abend die feine Sichel des zunehmenden Mondes von Neuem zeigt. Zwölf dieser Monate, also insgesamt 6 × 30 + 6 × 29 Tage, das sind 354 Tage, bilden das Mondjahr. Es ist um elf Tage kürzer als das aus 365 Tagen bestehende Sonnenjahr. Die Priester Babylons, die zugleich Astronomen und Mathematiker waren, weil sie die Ordnung des Himmels zu beschreiben verstanden, erfanden einen sinnreichen Trick, mit dem sie das zu kurze Mondjahr mit dem Sonnenjahr ausgleichen konnten: Nach drei Mondjahren fehlen bereits 3 × 11, also 33 Tage für drei Sonnenjahre, das ist bereits mehr als ein Monat. Wenn man daher in jedem dritten Mondjahr noch einen 13. Monat als Schaltmonat einschiebt, gleichen sich die Mond- und die Sonnenjahre ganz gut aus. Doch trotzdem sind die drei Mondjahre mit dem einen Schaltmonat immer noch um drei Tage kürzer als drei Sonnenjahre – auf lange Sicht eine zu große Lücke. Man muss ein wenig öfter als nur alle drei Jahre Schaltjahre mit 13 Monaten einschieben.
Die babylonischen Mathematiker betrachteten zur Verbesserung ihrer ersten Korrektur die auf 3 × 11, also die auf 33 folgenden Vielfachen von elf, also die Zahlen 44, 55, 66, 77 und so weiter. Bei der Zahl 19 × 11, also bei 209, wurden sie fündig. Denn 209 ist fast 210, jene Zahl, die sich als 7 × 30 ergibt. Weil 19 × 11 fast mit 7 × 30 übereinstimmt, erkannten die Gelehrten, dass nach 19 Mondjahren hinreichend genau sieben Monate auf 19 Sonnenjahre fehlen. Nun wussten sie, wie man sehr sinnreich die Mondjahre mit den Sonnenjahren abgleichen kann: Von 19 aufeinanderfolgenden Mondjahren sollen zwölf dieser Mondjahre sogenannte Gemeinjahre oder Normaljahre sein, bestehend aus zwölf Monaten. Die restlichen sieben dieser Mondjahre sollen Schaltjahre heißen und aus 13 Monaten bestehen. Dabei werden diese Schaltjahre ziemlich gleichmäßig in die Serie von 19 aufeinanderfolgenden Jahren verteilt: Es sind dies nach den ersten beiden Normaljahren das 3., das 6., das 8., das 11., das 14., das 17. und das 19. Jahr des Zyklus.
Wie von geheimnisvoller Hand geleitet scheinen die Zahlen sieben und zwölf den Lauf der Zeit im Himmel zu beherrschen: Zwölf Monate bilden in Ägypten ein Jahr und in Babylon das Normaljahr. Sieben Jahre innerhalb des aus sieben plus zwölf bestehenden Zyklus von 19 Jahren sind im babylonischen Kalender Schaltjahre, zwölf Jahre sind Normaljahre. Zwölf Tierkreiszeichen durchmisst die Sonne innerhalb eines Jahres. Und sieben Wandelgestirne sehen wir mit freiem Auge am Himmel: die Sonne, den Mond und die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Auf diese geht die Zählung der sieben Tage der Woche zurück. Überdies manifestiert sich die Zahl sieben im schönen Sternbild der Plejaden, des Siebengestirns, das von Anfang Juli bis Ende April am nördlichen Sternenhimmel sichtbar ist.
Pythagoras von Samos, der um 500 v. Chr. lebende Erfinder der Mathematik, kannte aus seinen Reisen in den Orient bestimmt dieses zauberhafte Wirken der Zahlen sieben und zwölf auf das kosmische Geschehen, das die Zeit regiert. Zugleich wusste er, dass diese beiden Zahlen die Musik regieren: Zwölf aufeinander getürmte Quinten stimmen fast – der kleine, für ein ungeübtes Ohr kaum erkennbare Unterschied heißt das pythagoreische Komma – mit sieben aufeinander getürmten Oktaven überein. Niemand weiß, warum sowohl in den Sphären des Himmels als auch im Erklingen der Töne die beiden Zahlen sieben und zwölf, die Summe von drei und vier und das Produkt von drei mit vier, diese außerordentlich vorrangige Rolle spielen. Pythagoras selbst meinte, dass die Musik vom Himmel herab zur Erde kam. Die Klänge der himmlischen Sphären seien jedoch unseren irdischen Ohren verschlossen.
Thales von Milet, der ein Lehrer des Pythagoras gewesen sein soll, hatte von den babylonischen Priestern darüber hinaus noch weitere und tiefere Lehren über die Ordnung im Bau des Himmelsgewölbes vernommen: