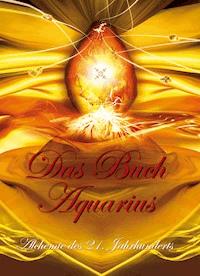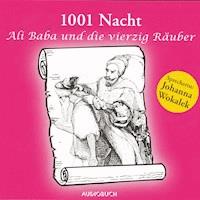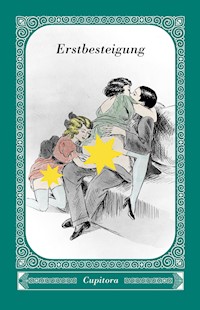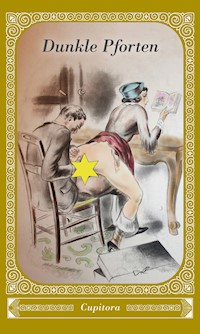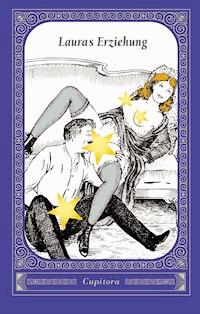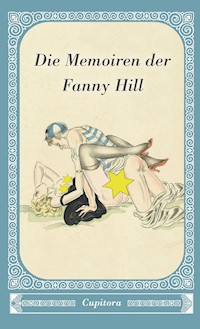
Es währte nicht lange, und schon schüttelte und schwang der junge Galan sein Gerät zwei- oder dreimal; er warf sich auf Madame, und da er mir jetzt seinen Rücken zuwandte, konnte ich mir nur vorstellen, dass er sich in sie versenkt hatte, denn seine Bewegungen und die Unmöglichkeit, ein derart auffallendes Ziel zu verfehlen, schienen diesen Schluss als selbstverständlich zuzulassen. Nun wankte das Bett, und die Vorhänge raschelten so sehr, dass ich kaum das Stöhnen, Flüstern, Seufzen und Keuchen hören konnte, die das Treiben von Anfang bis Ende begleiteten. Der Anblick und die Geräusche erregten mein Innerstes, und ich fühlte flüssiges Feuer in meinen Adern brennen. Die Erregung wurde so heftig, dass mir der Atem stockte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
John Cleland
Die Memoiren der Fanny Hill
ISBN 978-3-95841-777-9
© by Cupitora in der BEBUG mbH, Berlin
Erster Brief
Gnädigste,
ich will mich nun hinsetzen, um Ihnen einen unwiderlegbaren Beweis der Aufmerksamkeit zu liefern, die ich Ihren Wünschen – für mich sind es Befehle – widme. So undankbar die Aufgabe auch sein mag – ich werde doch alle jene skandalumwitterten Stationen meines Lebensweges heraufzubeschwören suchen, die ich schließlich hinter mir ließ, um mich des Segens zu erfreuen, der von der Macht der Liebe, von Gesundheit und Glück verliehen wird. Ich befinde mich ja noch in der Blüte meiner Jugend, und es ist daher nicht zu spät, um die Muße zu genießen, die mir dank Reichtum und glücklicher Umstände gewährt ist. Ich kann meinen Verstand wieder üben, der zweifelsohne nicht vernachlässigt werden darf; er regte mich sogar inmitten des Strudels ausschweifender Vergnügungen, in den ich hineingerissen wurde, zur Beobachtung der Gewohnheiten und Sitten der Welt an – jedenfalls mehr, als es bei meinen unglückseligen Berufsgenossinnen üblich ist. Sie betrachten alle Gedanken oder Überlegungen als ihre eigentlichen Feinde und halten sie daher so fern von sich, wie es ihnen nur möglich ist, falls ihnen nicht gleich deren gnadenlose Unterdrückung gelingt.
Da ich jegliches lange Einleitungsgerede auf den Tod hasse, werde ich Ihnen hiermit Pardon erteilen und keine weiteren Verteidigungsgründe anführen, die Sie auf die ausschweifungsreichen Strecken meines Lebens vorbereiten sollen. Ich werde darüber mit derselben Freiheit schreiben, wie ich es geführt habe.
Wahrheit – volle, nackte Wahrheit: Das ist die Losung! Ich werde mich nicht einmal bemühen, auch nur das Ende eines Tüllschleiers über alles zu breiten, sondern will die Ereignisse so darstellen, wie sie jetzt in aller Natürlichkeit vor mir auftauchen; keinesfalls kann ich mich darum kümmern, ob die Gesetze der Schamhaftigkeit verletzt werden, die sowieso nie für solch rückhaltlose Preisgabe von Intimitäten, wie sie zwischen uns üblich ist, geschaffen wurden. Sie haben ja auch zu viel Gespür und zu viel Kenntnis von den Originalen, um prüde und heuchlerisch die Nase über die Kopien zu rümpfen. Die bedeutendsten Menschen, die den besten und tonangebenden Geschmack haben, schmücken ohne Skrupel ihre Privaträume mit Aktbildern, obwohl sie gemäß den gewöhnlichen Vorurteilen die gleichen Bilder für keine anständige Dekoration von Treppenhäusern und Salons halten.
Das ist also die Voraussetzung und dürfte reichen. Ich beginne nun schnurstracks meine persönliche Geschichte. Mein Mädchenname war Frances Hill. Ich wurde in einem kleinen Dorf in der Nähe von Liverpool in Lancashire geboren. Meine Eltern waren äußerst arm und, wie ich guten Glaubens annehme, äußerst ehrlich.
Mein Vater war durch eine Verstümmelung seiner Glieder untauglich geworden, den beschwerlichen Weg der bäuerlichen Plackerei einzuschlagen; er verdiente sich mit Hilfe der Netzstrickerei seinen mageren Unterhalt. Dieser wurde durch die Arbeit meiner Mutter, die eine Schule für die Mädchen der Nachbarschaft leitete, nicht gerade viel vergrößert. Sie hatten mehrere Kinder gehabt; es blieb jedoch keines am Leben außer mir, die ich von der Natur eine vollkommen gesunde Konstitution mitbekommen hatte.
Bis zum Alter von vierzehn Jahren war meine Erziehung nicht besser als irgendeine andere. Das Lesen oder vielmehr Buchstabieren eines unleserlichen Gekritzels und ein bisschen simple Handarbeit machten das ganze Lehrsystem aus; die ganze Grundlage meiner Tugend war nichts anderes als eine völlige Unwissenheit über das Laster; dazu kam noch die scheue Zurückhaltung, die unser Geschlecht in jenem zarten Lebensalter auszeichnet, da die Dinge mehr durch ihre Neuheit Schrecken auslösen oder uns fortscheuchen als durch irgendetwas sonst. Es ist dies allerdings eine Furcht, die allzu oft auf Kosten der Unschuld überwunden wird, wenn nämlich das junge Fräulein allmählich anfängt, einen Mann nicht länger als ein Raubtier anzusehen, das sie auffressen möchte.
Meine arme Mutter hatte ihre Zeit derart genau eingeteilt zwischen der Beschäftigung mit ihren Schülerinnen und ihren kleinen Sorgen im Haushalt, dass sie nur noch sehr wenig davon für meine Erziehung übrig hatte; sie ließ auch, aus ihrer Unwissenheit über viele Verfehlungen heraus, nie eine entsprechende Anspielung fallen und brachte mir nie einen Gedanken nahe, der mich vor irgendwelchen Gefahren geschützt hätte. Ich war soeben in mein fünfzehntes Lebensjahr eingetreten, als mir das schlimmste Unglück, das es geben kann, zustieß. Ich verlor meine zärtlich geliebten Eltern, die beide, mit ein paar Tagen Abstand, an den Pocken starben. Mein Vater verschied zuerst und beschleunigte dadurch den Tod meiner Mutter. Plötzlich fand ich mich als unglückliches Waisenkind ohne Verwandte; es war nämlich nur Zufall gewesen, dass mein Vater sich dort niedergelassen hatte, da er eigentlich aus Kent stammte. Die grausame Krankheit, die für beide so verhängnisvoll geworden war, hatte auch mich ergriffen, aber die Symptome zeigten sich so mild und günstig, dass ich binnen kurzem außer Gefahr war und, was ich damals noch nicht zu schätzen wusste, auch keinerlei zurückgebliebene Spuren aufwies. Ich übergehe hier das Ausmaß an natürlicher Trauer und das Leid, das ich bei dieser düsteren Angelegenheit empfand. Nach einer kurzen Spanne Zeit zerstreute die Unbesonnenheit jenes Lebensalters nur allzu bald mein Sinnieren über den unersetzlichen Verlust.
Nichts half mir mehr, mich damit abzufinden, als die Pläne, die sofort in meinen Kopf gesetzt wurden – ich sollte nach London gehen und dort einen Dienst suchen. Jede mögliche Hilfe und aller Beistand wurden mir dabei von einer gewissen Esther Davis versprochen, einer jungen Frau, die auf Besuch zu ihren Verwandten gekommen war und nach einem Aufenthalt von ein paar Tagen an ihren Arbeitsplatz zurückreisen wollte. Es gab sowieso im ganzen Dorf niemand mehr, der Interesse daran gehabt hätte, was aus mir wurde, und der Einwände gegen meinen Plan vorbrachte.
Da selbst die Frau, die nach dem Tod meiner Eltern für mich sorgte, mich dazu ermutigte, fasste ich also kurzerhand den Entschluss, den Schritt in die weite Welt zu wagen. Ich wollte nach London gehen, um »mein Glück zu suchen« – eine Redensart, die, nebenbei gesagt, mehr Abenteurer beiderlei Geschlechts, die vom Land kommen, in den Abgrund führt, als sie ans Ziel bringt.
Auch Esther Davis sprach mir Trost zu und spornte mich an, mich zusammen mit ihr hinzuwagen; sie regte meine kindliche Neugier mit all den schönen Sachen an, die in London zu sehen waren: die Grabmäler, die Löwen, der König, die königliche Familie, die prächtigen Komödien und Opern sowie, kurz gesagt, die ganzen Vergnügungen, die künftig zu meinem Lebenskreis gehören sollten. Die vielen Einzelheiten ließen meinen kleinen Kopf schwindeln.
Ich kann mich nicht ohne Heiterkeit an die naive Bewunderung, vermischt mit etwas Neid, erinnern, mit der wir armen Mädchen, deren Sonntagskleidung nicht über Hemden aus Sackleinen und Fähnchen aus billigem Zeug hinausging, das Gewand Esthers betrachteten. Es war von Satinstreifen durchzogen; ihr Häubchen war mit Spitzen eingefasst; farbenprächtige Bänder hingen an ihr herum, und ihre Schuhe besaßen Schnüre aus Silber. All diese Schätze, schlossen wir, gab es also in London; ein Hauptpunkt meines Planes war es nun, mir meinen Anteil an ihnen zu sichern.
Der Gedanke, sich der Gesellschaft einer Städterin zu vergewissern, lag demnach nahe; ebenso verhielt es sich mit den Gründen, die Esther veranlassten, sich während der Reise zur Stadt um mich zu kümmern. Sie erzählte mir, wie es ihrer Art entsprach, dass verschiedene Mädchen vom Lande sich samt ihrem ganzen Anhang herausgemacht hätten, weil sie stets ihre Tugend bewahrten; so konnten sie ihre Herren dazu bringen, dass sie von ihnen geheiratet wurden und ihre Kutschen bekamen und ungeheuer großartig und glücklich lebten; manche, wie es gerade ging, wurden sogar Herzoginnen! Alles schien eitel Glück und Sonnenschein zu sein, und warum sollte ich nicht Anteil daran haben, genauso wie eine andere?
Solche Aussichten reizten mich, die viel versprechende Reise anzutreten und einen Ort zu verlassen, wo ich zwar geboren war, wo jedoch keine Angehörigen lebten, denen ich nachtrauern musste; das heimatliche Dorf war für mich überhaupt unerträglich geworden wegen des Wechsels von einem Klima der Zärtlichkeit zu dem kalten Lufthauch der Wohltätigkeit, der mich selbst noch bei der einzigen Freundin berührte, in die ich meine letzte Hoffnung auf fürsorglichen Schutz gesetzt hatte. Allerdings benahm sie sich insofern anständig mir gegenüber, als sie sich darum bemühte, die mir gebliebenen Habseligkeiten in Bargeld zu verwandeln.
Was davon nach der Bezahlung von Schulden und Begräbnisgebühren noch vorhanden war, übergab sie bei meiner Abreise meiner Verfügungsgewalt. Mein gesamtes Vermögen bestand aus einer höchst dürftigen Garderobe, die in einem recht handlichen Koffer verpackt war, sowie acht Guineen und siebzehn Silberschillingen. Dies bedeutete für mich einen größeren Schatz, als ich ihn bis dahin jemals auf einem Haufen zusammen gesehen hatte. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es möglich war, ihn restlos auszugeben; mich als Herrin einer derart riesigen Summe zu sehen, erfüllte mich mit solcher Freude, dass ich dem Pack guter Ratschläge, der mir als Draufgabe angeboten wurde, nur sehr wenig Aufmerksamkeit schenkte.
Alsbald wurden für Esther und für mich Plätze in der Postkutsche nach London bestellt. Die völlig unwesentliche Szene des Abschieds, bei der ich einige Tränen, halb aus Wehmut, halb aus Freude, vergoss, lasse ich beiseite; aus denselben Gründen überspringe ich auch alles, was ich unterwegs erlebte, zum Beispiel den Kutscher, der mich wie berauscht anglotzte, oder die Pläne, die mir manche Mitreisenden unterbreiteten und die durch die Wachsamkeit meiner Anstandsdame Esther im Keim erstickt wurden. Um ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, muss ich sagen, dass sie mich mütterlich umhegte, wenn sie auch gleichzeitig verlangte, dass ich als Dank für ihre Obhut alle ihre Gepäckstücke schleppte. Ich erledigte das mit der größten Begeisterung, da ich mich in allem, was ich tat, ihr gegenüber zutiefst verpflichtet fühlte.
Sie passte tatsächlich scharf darauf auf, dass wir bei keiner Rechnung zu hoch veranschlagt wurden. Ebenso war sie dahinter her, mit so wenig Geld wie nur möglich auszukommen; Verschwendungssucht war ihr Laster wahrlich nicht.
Es war schon ziemlich spät an einem Sommerabend, als wir die Stadt London erreichten, denn unser Vehikel war sehr langsam, obwohl es zuletzt von einem Sechsergespann gezogen wurde.
Wir fuhren durch die belebtesten Straßen zu unserem Gasthof; der Lärm der Kutschen, der ungewohnte Anblick der Läden und Häuser gefiel mir und erschreckte mich zugleich.
Versuchen Sie sich jedoch nun meine Enttäuschung und Überraschung vorzustellen: Als wir bei unserem Gasthof angelangt waren und unsere Siebensachen entladen und uns ausgehändigt wurden, benahm sich meine Reisebegleiterin und Gönnerin plötzlich sehr befremdlich und zeigte mir die kalte Schulter. Sie hatte mich während der Reise mit der größten Zärtlichkeit behandelt und mich nicht durch das geringste Anzeichen auf den gewaltigen Schlag vorbereitet, den ich von meiner einzigen Vertrauten und Freundin an dem für mich unbekannten Ort empfangen sollte. Wahrscheinlich fürchtete sie, dass ich ihr nun zur Last fiele.
Anstatt mir ihre Hilfe und ihre guten Dienste weiterhin zu versprechen, worauf ich mich verlassen hatte – mehr wünschte ich gar nicht –, meinte sie selbst allem Anschein nach, dass sie ihre Pflicht mir gegenüber genügend erfüllt habe, indem sie mich gesund ans Ziel meiner Reise gebracht hatte. Da sie offenbar in ihrem Benehmen nichts sah, was nicht natürlich und ganz in Ordnung war, umarmte sie mich, um von mir Abschied zu nehmen. Ich war so bestürzt und derart betroffen, dass ich keinesfalls die Geistesgegenwart beweisen konnte, von meinen Hoffnungen und Erwartungen zu sprechen, die ich mit ihrer Erfahrung und Ortskenntnis verknüpft hatte.
Während ich nun dastand, stumm und wie vor den Kopf geschlagen – was sie zweifellos nur als Abschiedsschmerz ansah –, suchte sie mir durch das folgende Geschwätz eine kleine Aufmunterung zu geben: Jetzt wären wir also gesund in London angekommen, und sie müsste zu ihrem Arbeitsplatz gehen; sie könne mir nur raten, auch so bald als möglich einen solchen zu finden; ich brauche keine Sorge deswegen zu haben, denn es gebe mehr Stellen als Pfarrkirchen; sie empfehle mir, mich zu einer Stellenvermittlung zu begeben; wenn sie von einer Gelegenheit hören würde, könne sie mich ja aufsuchen und es mich wissen lassen; in der Zwischenzeit solle ich eine Privatunterkunft suchen und sie benachrichtigen, wo man mich erreichen könne; im übrigen wünsche sie mir viel Glück und hoffe, ich würde ehrbar bleiben und meinem Namen keine Schande machen. Damit nahm sie Abschied von mir und ließ mich stehen, als ob es mir sehr leicht fiele, mir selbst überlassen zu sein.
Als ich auf diese Weise allein zurückblieb, völlig verloren und ohne Freunde, begann ich die Härte der Trennung in ihrer ganzen Bitterkeit zu spüren. Die Abschiedsszene hatte in einem kleinen Zimmer im Gasthof stattgefunden. Kaum hatte mir Esther den Rücken gewandt, als der Schmerz über meine hilflose Lage sich in einem Strom von Tränen Bahn brach; das erleichterte den Druck, der auf meinem Herzen lastete, unendlich. Natürlich fühlte ich mich trotzdem äußerst verwirrt und einsam, da ich nicht wusste, was ich mit mir anfangen sollte.
Einer der Kellner trat zu mir heran und stürzte mich in noch größere Unsicherheit, indem er mich kurz angebunden fragte, ob ich etwas wünsche, worauf ich in aller Unschuld antwortete: »Nein.« Ich bat ihn jedoch, mir zu sagen, wo ich eine Unterkunft für die Nacht finden könne. Er erwiderte, er wolle mit der Wirtin sprechen; sie kam sofort und teilte mir trocken – und ohne im geringsten an der Not, die mir ja anzusehen war, teilzunehmen – mit, dass ich ein Bett für einen Schilling haben könne; sie nehme an, ich hätte Bekannte in der Stadt – hierbei seufzte ich tief und vergeblich – und würde am nächsten Tag für mich selbst sorgen.
Es ist unglaublich, was für unbedeutende Tröstungen sich das menschliche Herz in seiner ärgsten Drangsal sucht. Die simple Gewissheit, für diese Nacht ein Bett zum Schlafen zu haben, dämpfte meine Sorgen. Da ich mich auch schämte, der Besitzerin des Gasthofs zu erzählen, dass ich gar keine Freunde in der Stadt besäße, an die ich mich wenden könne, fasste ich den Entschluss, am nächsten Tag sofort zu einer Stellenvermittlung zu gehen; ich war für dieses Vorhaben mit einigen Adressen ausgerüstet, die Esther auf die Rückseite der Abschrift einer Ballade geschrieben hatte. Dort wollte ich mich nach einer Stelle erkundigen, die für mich als Mädchen vom Lande in Frage kam und wo ich ein Auskommen finden könnte, ehe meine kleine Geldreserve zu Ende war. Esther hatte mir oft wiederholt, dass mein Erfolg davon abhinge, wie ich mich zurechtmachen würde. Wenn ich auch über ihre Art, mich im Stich zu lassen, sehr erschüttert war, so hörte ich deswegen doch nicht völlig auf, mich auf ihren Rat zu stützen; gutmütigerweise fing ich sogar an, ihr Benehmen durchaus vertretbar zu finden und auf meine Unwissenheit vom Leben die Schuld zu schieben, dass ich es in jenem Licht betrachtet hatte, wie ich es zunächst tat.
Dementsprechend zog ich mich also am nächsten Tag so sauber und gefällig an, wie es meine ländliche Garderobe nur erlaubte. Ich ließ mein Gepäck mit der ausdrücklichen Bitte, darauf zu achten, bei der Wirtin und wagte mich auf die Straße. Irgendwelche Schwierigkeiten außer jenen, die bei einem jungen Mädchen vom Land, das kaum fünfzehn Jahre zählt, zu erwarten sind – für das jedes Schild oder Geschäft bereits eine aufregende Falle darstellt –, gab es für mich nicht. Somit ging ich zu der ersehnten Stellenvermittlung.
Sie wurde von einer älteren Dame betrieben, die beim Eingang saß, um die Kundschaft zu empfangen. Ein Buch lag vor ihr, riesig in Format und Stärke, sowie mehrere Listen, völlig bedeckt mit den Adressen von Stellen.
Ich trat zu dieser wichtigen Persönlichkeit, ohne meine Augen zu erheben oder die Leute um mich herum anzuschauen, die dort mit derselben Absicht warteten wie ich selbst. Nach einem ungeheuer tiefen Knicks vor ihr suchte ich in kläglich stotternden Worten mein Anliegen vorzubringen.
Nachdem Madame mich zu Ende angehört hatte, wobei sie den ernsthaften Ausdruck eines kleinen Staatsministers zur Schau trug und mit einem einzigen Blick auf mich erkannte, wer ich war, gab sie mir nicht etwa gleich eine Antwort, sondern ersuchte mich vorerst um den ersten Schilling. Nach dessen Entgegennahme erzählte sie mir, dass Stellen für Frauen äußerst selten seien, besonders wenn eine wie ich zu zart gebaut aussähe für eine harte Arbeit; sie würde aber in ihrem Buch suchen und sich darum kümmern, was für mich zu machen sei. Ich solle doch ein bisschen warten, bis sie ein paar andere Kunden abgefertigt habe.
Daraufhin zog ich mich zurück, ziemlich tief betroffen von der Erklärung, die Ausblick auf eine sehr unsichere Lage eröffnete.
Bald fasste ich wieder etwas mehr Mut und suchte nach Zerstreuung für meine trübseligen Gedanken. Ich wagte meinen Kopf ein wenig zu erheben und blickte im Zimmer umher, wobei meine Augen direkt die Augen einer Dame trafen – denn in meiner äußersten Naivität hielt ich sie für eine solche –, die in einer Ecke des Zimmers saß, angetan mit einem Samtmantel (nicht zu vergessen: mitten im Sommer!). Sie hatte ihren Kapotthut abgenommen, war dick wie ein Polster, rotgesichtig und mindestens fünfzig Jahre alt.
Sie schaute mich an, als ob sie mich mit den Augen fressen wollte, und begutachtete mich vom Kopf bis zu den Füßen, ohne die geringste Rücksicht auf die Verlegenheit und das Erröten zu nehmen, das ihre starren Blicke bei mir verursachten; zweifellos bedeutete das für sie die stärkste Empfehlung und das beste Zeichen, dass ich für ihre Absichten wie geschaffen war. Nach kurzer Zeit, während der mein Aussehen, meine Person, meine ganze Gestalt einer strengen Prüfung unterzogen worden waren – die ich, was mich betrifft, günstig zu beeinflussen suchte, indem ich mich steif machte, meinen Kopf gerade setzte und mein bestmögliches Aussehen unterstrich –, trat sie auf mich zu und sagte zu mir mit denkbar größter Gesetztheit:
»Herzchen, suchen Sie eine Stelle?«
»Ja, wenn es geruht« – mit einem Knicks bis zum Boden.
Auf das hin teilte sie mir mit, dass sie tatsächlich in diese Vermittlung gekommen sei, weil sie selbst ein Dienstmädchen suche; sie glaube, ich sei dafür geeignet mit Hilfe von ein paar guten Ratschlägen; sie halte mein aufrichtiges Aussehen für ein ausreichendes Zeugnis; London sei sonst ein sehr schlimmer und verderbter Ort; sie hoffe, ich würde brav sein und mich fern von böser Gesellschaft halten. Kurzum, sie sagte mir alles, was von einem Menschen, der lange in der Stadt gelebt hat, erwartet werden konnte, und ging dabei weit über das notwendige Maß hinaus, um eine schlichte, unerfahrene Landpomeranze einzuwickeln, die von der Furcht beseelt war, auf der Straße herumlungern zu müssen.
Ich stürzte mich natürlich freudig auf das erstbeste Angebot, das Schutz verhieß, besonders da es vonseiten einer Dame kam, die ernsthaft schien und einer Matrone ähnlich sah; meine schmeichlerische Phantasie versicherte mir nämlich, dass meine neue Herrin etwas Ähnliches sei. Ich wurde somit unter der Nase der guten Frau, die das Vermittlungsbüro führte, angestellt; ich konnte nicht anders als ihr schlaues Lächeln und ihr Achselzucken zu beobachten und deutete das naiverweise als ein Zeichen ihrer Freude, dass ich so schnell eine Stelle gefunden hatte. Wie ich später jedoch erfuhr, verstanden diese beiden alten Hexen einander sehr gut, denn dort war ein Markt, auf dem Mrs. Brown, meine Herrin, oft anwesend war, um sich irgendwelche frischen Waren, die angeboten wurden, für den Gebrauch ihrer Kunden und ihren eigenen Gewinn herauszusuchen.
Madame war so froh über ihren Handel, dass sie – wie ich annehme aus Besorgnis, eine gut gemeinte Warnung oder irgendein Zufall könnte mich noch aus ihren Fingern entschlüpfen lassen – sich eiligst entschloss, mich mit einer Kutsche zu meinem Gasthof zu bringen; dort bemühte sie sich selbst um meine Koffer. So war ich trotz meiner Anwesenheit davon befreit, die geringsten Skrupel wegen einer Erklärung, wohin ich gehen wollte, zu hegen.
Nachdem das erledigt worden war, befahl sie dem Kutscher, zu einem Geschäft in St. Paul’s Churchyard zu fahren, wo sie ein Paar Handschuhe kaufte, die sie mir schenkte. Dann forderte sie den Kutscher auf, zu ihrem Haus zu fahren; dort wurden wir wunschgemäß vor der Tür abgesetzt. Unterwegs war ich von ihr weiterhin aufgemuntert worden, indem sie mich mit den gängigsten Schwindeleien in Atem hielt. Aus keiner Silbe ihrer Reden konnte ich etwas anderes entnehmen, als dass ich durch ein wahres Riesenglück in der Obhut der liebenswürdigsten Herrin gelandet war – um nicht gleich Freundin zu sagen, was gewiss in dieser gebildeten Welt nahe liegend gewesen wäre. Also betrat ich ihr Haus mit dem größten Vertrauen und der ungestörtesten Freude, wobei ich mir selbst versprach, Esther Davis von meinem einmaligen Glück Bescheid zu geben, sobald ich mich etwas zurechtgefunden hatte.
Ich kann Ihnen versichern, dass meine gute Meinung von meiner Stelle nicht gemindert wurde durch den Anblick des sehr schönen rückwärtigen Wohnzimmers, in das ich geführt wurde; es schien mir großartig möbliert zu sein, da ich noch nie schönere Zimmer gesehen hatte als die üblichen in den Gasthöfen an der Landstraße.
Es gab da zum Beispiel zwei vergoldete Pfeilerspiegel und einen Geschirrschrank, auf dem einige Teller, die als Zierrat aufgestellt waren, ins Auge stachen. Alles zusammen bestärkte meine Überzeugung, dass ich in eine Familie von größtem Ansehen eingetreten war.
Nun fing meine Herrin eine lange Rede an. Sie sagte mir, ich solle gut aufgelegt sein und mich daran gewöhnen, mich ihr gegenüber frei zu benehmen. Sie habe mich nicht engagiert, um ein gewöhnliches Dienstmädchen zu bekommen, das die Hausarbeit verrichten müsse, sondern damit ich eine Art von Gesellschafterin für sie sei. Falls ich ein gutes Mädchen wäre, würde sie mehr als zwanzig Mütter ersetzen. Alldem antwortete ich mit den tiefsten und unbeholfensten Knicksen und gewissen einsilbigen Brocken, wie etwa: »Ja! Nein! Gewiss!«
Danach ergriff meine Herrin die Glocke. Das stämmige Dienstmädchen kam herein, das uns auch eingelassen hatte.
»Hier, Martha«, sagte Mrs. Brown, »ich habe soeben diese junge Dame angestellt, um jemanden für meine Wäsche zu haben. Geh hinauf und zeig ihr das Zimmer; ich empfehle dir, sie mit der gleichen großen Achtung zu behandeln wie mich selbst, denn sie gefällt mir derart ausgezeichnet, dass ich gar nicht weiß, was ich alles für sie tun soll.«
Martha war ein schalkhaftes Frauenzimmer und an diese Kunst des Köderns gewöhnt; sie reagierte prompt, machte einen halben Knicks vor mir und bat mich, ihr zu folgen. Auf dieselbe Tour zeigte sie mir ein hübsches Zimmer, zwei Treppen hoch und nach hinten gelegen, wo es ein bequemes Bett gab, in dem ich, wie Martha mir erzählte, zusammen mit einer feinen jungen Dame, einer Cousine meiner Herrin, schlafen sollte, die bestimmt sehr lieb zu mir sein würde. Dann stürzte sie sich in begeisterte Lobeshymnen auf ihre gute Herrin, ihre süße Herrin, und wie furchtbar glücklich ich doch sei, ihren Gefallen zu finden; ich hätte mir nichts Besseres aussuchen können. Auf ähnliche Weise fuhr sie mit ihrem dummdreisten Geschwafel ein Weilchen fort, das dermaßen dick aufgetragen war, dass es bei jedem Verdacht erweckt hätte, der nicht ein derart naives Ding wie ich war, das überhaupt nichts vom Leben ahnte und jedes Wort, das es hörte, für bare Münze nahm. So konnte Martha natürlich leicht merken, was für eine Methode sie bei mir zu gebrauchen hatte; sie wusste mich durchaus richtig einzuschätzen, um mir das Passende vorzusäuseln, das mich mit meinem Käfig versöhnte und blind für die Gitterstäbe machte.
Während dieser heuchlerischen Rede über die Art meiner künftigen Dienste ertönte wieder die Glocke. Wir gingen hinunter, und ich wurde in das gleiche Wohnzimmer geführt, wo ein Tisch mit drei Gedecken vorbereitet war. Meine Herrin hatte jetzt eines ihrer Lieblingsmädchen bei sich, eine beachtliche Stütze ihres Hauses, deren Aufgabe darin bestand, solche jungen Fohlen, wie ich selbst eines war, vorzubereiten und zurechtzutrimmen für den Rennstall. Zu diesem Zweck war sie als Bettgenossin für mich ausgesucht worden; um ihr mehr Einfluss zu verleihen, hatte sie den Titel einer Cousine der ehrwürdigen Präsidentin dieses Klubs zugewiesen erhalten.
Hier wurde ich einer neuen Begutachtung unterzogen, die mit dem völligen Einverständnis von Miss Phoebe Ayres endete; so lautete der Name meiner erwählten Lehrerin, deren Fürsorge und Unterricht ich liebevoll anempfohlen wurde.
Das Abendessen wurde bald auf den Tisch gebracht. Treu ihrer Absicht, mich weiterhin als Gesellschafterin zu behandeln, überging Mrs. Brown in einem Ton, der jeden Einwand hinwegfegte, sogleich meine bescheidenen und verlegenen Beteuerungen, dass ich doch nicht zusammen mit der gnädigen Frau essen könne; das hatte mir meine höchst dürftige Erziehung doch eingeflüstert, dass derartiges sich niemals gehöre oder in Ordnung sein könne.
Bei Tisch wurde das Gespräch hauptsächlich von den beiden Damen geführt; ihre doppelsinnigen Reden wurden dann und wann unterbrochen durch die liebevolle Fürsorge für mich – alles zu dem einzigen Zweck, meine Begeisterung über meine jetzige Lage zu nähren und festwurzeln zu lassen. Vergrößern konnten sie meine Freude nicht mehr – bei einem solchen Neuling, wie ich es war!
Es wurde auch beschlossen, dass ich mich ein paar Tage abseits halten sollte, um nicht gesehen zu werden, bis man Kleider für mich gefunden hatte, die zu meiner künftigen Rolle passen würden, nämlich die der Gesellschafterin meiner Herrin. Von der Beachtung dieses Punktes würde es weitgehend abhängen, was für einen Eindruck meine Erscheinung machte. Wie sie nur zu gut wussten, ließ mich die Aussicht auf den Umtausch meiner bäuerlichen Kleidung gegen die Londoner Raffinessen die Bedingung des Hausarrests willig annehmen. In Wahrheit verhielt es sich so, dass Mrs. Brown verhindern wollte, dass ich von irgendeinem ihrer Kunden gesehen oder angesprochen wurde oder von ihren Schäfchen – so wurden die Mädchen genannt, die für die Kunden ausgewählt worden waren –, bis für meine Jungfernschaft, die ich allem Anschein nach zum Dienst bei der gnädigen Frau mitgebracht hatte, ein guter Absatz gesichert worden war.
Um über einige unwichtige Minuten vor dem Wichtigsten an meiner Geschichte hinwegzueilen, überschlage ich die Zeit bis zum Schlafengehen, während der ich immer glücklicher wurde bei Betrachtung all der Aussichten, die sich mir eröffneten, nämlich einer kinderleichten Arbeit unter so gütigen Menschen.
Nach dem Abendessen wurde ich zu Bett geschickt. Miss Phoebe, die einen gewissen Widerstand bei mir bemerkte, mich vor ihr zu entkleiden und in meinem Hemd hinzulegen, kam, sobald die Hausmagd hinausgegangen war, zu mir her und fing an, mein Brusttüchlein und mein Kleid zu lösen. Sie forderte mich auf, mich ruhig selbst auszuziehen. Ich errötete, als ich mich nackt bis aufs Hemd sah, und beeilte mich, unter die Bettdecke zu verschwinden. Phoebe lachte, und es dauerte nicht lange, bis sie sich neben mich legte. Sie mochte ungefähr fünfundzwanzig Jahre alt sein, wenigstens nach ihrer verdächtigen Rechnung, wobei allem Anschein nach so an die zehn Jährlein abgezogen worden waren. Ein Zugeständnis musste überdies der Verwüstung gemacht werden, die eine lange Abnützung und ungezählte Schändungen ihrem Aussehen zugefügt hatten. Sie befand sich bereits in jenem abgetakelten Zustand, der viele ihrer Berufsgenossinnen zwingt, zu guter Letzt nur noch Theater zu spielen anstatt es zu genießen.
Kaum hatte sich nun diese wertvolle Stütze meiner Herrin niedergelegt, als sie mich – denn nie irrte sie vom Weg ab, wenn er eine Gelegenheit zum Verlustieren bot – auch schon mit größtem Eifer umarmte und küsste. Das war mir neu und kam mir seltsam vor. Da ich jedoch nichts anderes darin sah als pure Freundschaftlichkeit, die sich meiner Meinung nach vielleicht in London auf solche Weise ausdrückte, beschloss ich, ihr in nichts nachzustehen, und erwiderte daher ihre Küsse und Umarmungen mit der ganzen Ungezwungenheit, wie sie für die vollkommene Naivität typisch ist.
Durch mein Verhalten ermutigt, befleißigten sich ihre Hände sogleich eines ungenierten Vorgehens; sie wanderten über meinen ganzen Körper, betasteten, streichelten, kosten ihn – ein Geschehen, das mich durch seine Neuartigkeit eher erwärmte und überraschte, als dass es mich betroffen gemacht oder erschreckt hätte.
Die schmeichlerischen Reden, mit denen sie solche Vorstöße begleitete, trugen auch nicht wenig dazu bei, mein Gewissen zu beruhigen; weil mir nichts Übles bekannt war, fürchtete ich auch nichts, besonders nicht von einer Seite, die mir über jeden Zweifel an ihrer Weiblichkeit erhaben schien dank eines Paars sehr gewichtiger Brüste; sie besaßen eine solche Größe und Fülle, dass sie mehr als genug ihre Geschlechtszugehörigkeit kennzeichneten, wenigstens für mich, da ich niemals einen anderweitigen Vergleich hatte ziehen können.
Ich lag also so zahm und geduldig da, wie sie es sich nur wünschen konnte, während ihre Berührungen keine anderen Gefühle in mir hervorriefen als die eines sonderbaren und noch nie erlebten Vergnügens. Mein ganzer Körper war dem zügellosen Treiben ihrer Hände ausgeliefert. Sie ließ sie wie ein züngelndes Feuer über ihn hingleiten, und unter ihrer Berührung schwand meine Zurückhaltung.
Meine Brüste – wenn das keine zu kühne Bezeichnung für zwei feste, straffe, anschwellende Hügelehen ist, die sich gerade erst zu zeigen begannen und noch kaum zu fühlen waren – beschäftigten und unterhielten eine Zeit lang ihre Hände, die sie dann auf zartem Weg tief er gleiten ließ, bis sie den weichen, seidigen Flaum fühlen konnte; nur wenige Monate zuvor aufgesprossen, zierte er jenen lustvollen Bereich und versprach willkommenen Schutz über den Sitz der köstlichsten Empfindungen zu breiten, wo bis zu diesem Augenblick nur gefühllose Unschuld geherrscht hatte. Ihre Finger spielten und suchten sich in die zarten Keime dieses Mooses zu flechten, das die Natur zu Nutzen und Zierde geschaffen hat.
Aber nicht zufrieden mit diesen äußeren Bereichen, versuchte sie zum Zentrum zu gelangen und fing an zu zerren, sich sanft hineinzudrängen und schließlich einen Finger mitten hineinzuzwängen. Dabei ging sie so unmerklich und schrittweise vor, dass ich, zutiefst erregt, keine Kraft mehr aufbrachte, ihrem Tun Widerstand entgegenzusetzen. Andernfalls wäre ich bei derart seltsamen Annäherungen aus dem Bett gesprungen und hätte um Hilfe gerufen.
Stattdessen hatten ihre wollüstigen Berührungen ein neues Feuer in mir entfacht, das durch meine Adern pulste, ganz heftig aber in dem Zentrum andauerte, das ihm die Natur zugewiesen hat. Dort betasteten nun zum ersten Mal fremde Hände geschäftig die Schamlippen, streichelten, schlossen und öffneten sie, alles mit einem Finger dazwischen, bis ein »Oh!« anzeigte, dass sie mir dort wehtat, wo die Enge der ungeöffneten Passage dem Finger ein tieferes Eindringen verwehrte.
An der Art und Weise, in der ich meine Glieder bewegte, mich träge ausstreckte, seufzte und heftig atmete, sah inzwischen die erfahrene Lustjägerin bestätigt, dass ich mich über ihre Geschäftigkeit viel mehr freute, als dass ich beleidigt war; sie würzte ihr Tun mit wiederholten Küssen und Ausrufen wie: »Oh, was bist du doch für ein entzückendes Geschöpf! Wie glücklich wird der Mann sein, der dich als Erster zur Frau machen kann! Oh, wenn ich nur ein Mann wäre, bloß wegen dir!« und vielerlei ähnlichen hervorgestoßenen Ausdrücken, die immer wieder von Küssen unterbrochen wurden, die derart heftig und feurig waren, wie ich sie nur je vom anderen Geschlecht bekommen habe.
Was mich betrifft, so war ich hingerissen, verlegen und außer mir; solche neuartigen Empfindungen waren zu viel für mich. Meine erhitzten und aufgeschreckten Sinne waren in ein Durcheinander geraten, das mich jeder Freiheit des Denkens beraubte. Tränen liefen aus meinen Augen und besänftigten auf irgendeine Weise das Feuer, das mich überflutet hatte.
Phoebe selbst, die vollblütige und abgebrühte Phoebe, der alle Sorten und Kniffe des Vergnügens bekannt und vertraut waren, fand, allem Anschein nach, in dieser Ausübung ihrer Kunst, junge Mädchen zu verführen, die Befriedigung eines Gelüstes aus jener abwegigen Rubrik, die nirgendwo hineinpasst. Das heißt nun nicht, dass sie die Männer hasste oder dass sie diese nicht ihrem eigenen Geschlecht vorgezogen hätte; als sich ihr aber eine solche Gelegenheit wie diese bot, suchte sie, aus einer Übersättigung an den alltäglichen Vergnügungen, vielleicht auch aus einer verborgenen Neigung heraus, so viel wie möglich an Lust zu profitieren, ohne sich um das Geschlecht zu kümmern. Da sie sich jetzt also vergewissert hatte, dass ich durch ihre Berührungen genügend angefeuert war, warf sie gemächlich die Bettdecken hinunter, und ich sah mich selbst nackt ausgestreckt daliegen, mein Hemd bis zum Hals heraufgerollt, ohne Kraft oder Willen, es zu verhindern. Sogar mein glühendes Erröten drückte mehr Lust als Schamhaftigkeit aus, als die Kerze, die – sicherlich nicht ohne Absicht – noch brannte, ihr volles Licht auf meinen Körper warf.
»Nein!«, sagte Phoebe. »Du darfst nicht etwa denken, mein süßes Mädchen, dass du alle diese Schätze vor mir verbergen kannst! Meine Augen sollen sich ebenso daran erfreuen wie meine Fingerspitzen! Ich muss diese sprossenden Brüste mit meinen Blicken verschlingen! Lass sie mich küssen! Ich kann mich nicht satt daran sehen! Lass sie mich noch einmal küssen! Was ist das doch für ein festes, glattes, weißes Fleisch! Wie herrlich sie gewachsen sind! Und erst diese Köstlichkeit da unten! Oh, lass mich doch die kleine, zarte, liebe Ritze ansehen! Das ist zu viel, das halte ich nicht aus! Ich muss … ich muss!« Damit ergriff sie meine Hand und drückte sie geschwind an eine Stelle, die Sie unschwer erraten werden.
Welcher Unterschied bestand jedoch in der Beschaffenheit zweier Exemplare derselben Gattung! Ein ausgedehntes Dickicht buschiger Locken kennzeichnete die reife, üppig ausgestattete Frau. Die Höhlung gar, in die sie meine Hand führte, nahm diese leicht in sich auf. Sobald sie sie darin spürte, bewegte sie sich hin und her, und zwar mit einer so heftigen Reibung, dass ich meine Hand, die nun feucht und klebrig war, schnell herauszog, während Phoebe gleich darauf ruhiger wurde, nachdem sie noch ein paar Seufzer und herzenstiefe »Oh’s!« ausgestoßen hatte. Sie versetzte mir einen Kuss, der beinahe ihre Seele durch ihre Lippen auszuhauchen schien; dann legte sie die Bettdecken wieder über uns. Was für ein Vergnügen sie empfunden hatte, vermag ich nicht zu sagen; aber das eine weiß ich, dass die ersten Funken der anschmiegsamen Natur, die ersten Ahnungen der Wollust in dieser Nacht in mich gesät wurden. Mir scheint es klar zu sein, dass die Bekanntschaft und die Beziehung mit den Verderbten unseres eigenen Geschlechtes oft genauso verhängnisvoll für die Unschuld ausfällt wie alle Verführungen vonseiten des anderen Geschlechtes. Aber nun weiter mit der Erzählung! Als Phoebe sich endlich beruhigt hatte, während ich immer noch meilenweit davon entfernt war, befragte sie mich geschickt nach Dingen, die für die Absichten, die meine tugendsame Herrin bezüglich meiner Person hegte, interessant waren; meine Antworten, die ganz ungeheuchelt und ohne Verstellung gegeben wurden, konnten sie nur in der Hoffnung auf den bestmöglichen Erfolg bestärken, soweit er von meiner Naivität, Ungezwungenheit und Gefühlswärme abhing.
Nach einer beträchtlich lange dauernden Unterhaltung ließ mir meine Bettgefährtin endlich Ruhe, und ich schlief ein, denn ich war ehrlich müde dank der heftigen Erschütterungen, die ich ausgestanden hatte; die Natur (die allzu stürmisch angeregt und aufgerührt worden war, um ohne das eine oder andere beschwichtigende Mittel abzuflauen) besänftigte mich durch einen jener lüsternen Träume, deren Rauschhaftigkeit kaum geringer ist als die wirklichen Handlungen im Wachzustand.
Am Morgen erwachte ich gegen zehn Uhr, völlig heiter und frisch. Phoebe war bereits vor mir aufgestanden und fragte mich in denkbar freundlichem Ton, wie es mir gehe, wie ich geruht habe und ob ich bereit sei, jetzt zu frühstücken; sie bemühte sich dabei vorsichtig, die Verlegenheit, die sie bei mir spürte, nicht zu vermehren, denn ich wagte sie nicht anzuschauen, sobald die leiseste Erinnerung an die nächtliche Szene im Bett auftauchte. Ich fragte sie, ob sie wolle, dass ich aufstehe und irgendeine Arbeit verrichte, je nachdem was sie mir für eine zuteile. Sie lächelte … In diesem Moment brachte das Mädchen das Teegeschirr herein, und ich vermochte kaum noch meine Kleider hastig anzuziehen, als auch schon meine Herrin hereintrat. Ich wartete darauf, wenigstens getadelt, wenn nicht gar gescholten zu werden, da ich so spät aufgestanden war, aber ich wurde angenehm enttäuscht. Sie pries nämlich mein klares und frisches Aussehen über den grünen Klee. Ich war »eine Knospe der Schönheit«, so beliebte sie sich auszudrücken, »und wie sehr würden mich doch die feinen Herren bewundern!« Auf das alles – ich kann es Ihnen schwören – gab ich Antworten, die meiner Erziehung getreu entsprachen; sie waren so einfach und albern, wie man es nur wünschen kann. Es besteht kaum Zweifel, dass sie den beiden unendlich mehr gefielen, als wenn sie mich als aufgeklärt und mit allerlei Erfahrung und Wissen vom Lauf der Welt gesegnet ausgewiesen hätten.
Wir frühstückten also, und kaum waren die Teesachen weggeschafft worden, da wurden zwei Bündel mit Wäsche und bereits getragenen Kleidungsstücken hereingebracht. Es war alles Notwendige dabei, um mich vollständig aufzutakeln, wie sie es nannten.
Versuchen Sie sich vorzustellen, Gnädigste, wie mein kleines, aber kokettes Herz vor Freude klopfte beim Anblick eines weißen Glanztaffets, geschmückt mit Silberblumen, der in Wirklichkeit natürlich schon ein wenig zerschlissen war, jedoch für mich noch funkelnagelneu aussah! Dann ein Umhang mit Brüsseler Spitzen, geflochtene Schuhe und dazu passend der Rest! alles Eleganz aus zweiter Hand und geschwind in einem einzigen Augenblick für eben diese Gelegenheit ausgesucht vom Eifer und der Betriebsamkeit der wackeren Mrs. Brown. Schon weilte nämlich ein Käufer für mich im Haus, dem meine Reize zur Schau gestellt werden sollten. Er hatte nicht nur darauf bestanden, dass die Erstlingsfrüchte einer eingehenden Betrachtung unterzogen werden sollten, sondern auch darauf, dass sie ihm sofort ausgeliefert würden, falls ich ihm gefiele. Dabei zog er höchst scharfsinnig den Schluss, dass es an einem Ort von der Art meines gegenwärtigen Aufenthalts unvergleichlich schwierig sein würde, einen so leicht verderblichen Wertgegenstand, wie es die Jungfernschaft schließlich war, länger zu bewahren.
Die Besorgnis des Anprobierens und des marktgerechten Herausputzens wurde Phoebe überlassen; sie erledigte das, so gut es irgendwie ging, jedenfalls zu meiner völligen Zufriedenheit, bis auf den einen Punkt, nämlich meine Ungeduld, mich möglichst schnell angezogen zu sehen. Als ich endlich fertig war und mich selbst im Spiegel sah, war ich zweifelsohne viel zu natürlich, viel zu unverstellt, um meine kindliche Freude über die Veränderung verbergen zu können – eine Veränderung, die in Wirklichkeit nur vom Übel war, denn die gefällige Einfachheit meiner bäuerlichen Kleidung passte mir bestimmt viel besser als die linkische, missratene, billige Vorstadteleganz, in der ich mich wohl recht seltsam und fremdartig ausgenommen habe. Die Schmeicheleien Phoebes allerdings – wobei sie ihren Anteil an meiner Ausstaffierung keineswegs vergaß – trugen nicht wenig dazu bei, die bisherigen Vorstellungen, die ich betreffs meiner Person gehegt hatte, kräftig zu festigen. Ich darf es ohne Eitelkeit sagen, dass sie immerhin ungefähr dem tatsächlichen Eindruck, den andere von mir hatten, entsprachen. Vielleicht ist es nicht fehl am Platz, wenn ich hier eine nicht allzu selbstgefällige Schilderung meiner selbst zu geben versuche.
Ich war hoch gewachsen, jedoch nicht allzu groß für mein Alter, denn wie ich bereits vorhin erwähnte, hatte ich kaum fünfzehn Jahre erreicht. Meine Figur war völlig gerade, besaß eine schmale Taille, wirkte natürlich, ja graziös und bedurfte keinerlei Stützen. Mein Haar glänzte kastanienbraun, fühlte sich weich wie Seide an und fiel über meine Schultern in natürlichen Locken; davon hob sich in sehr günstigem Kontrast das Weiß meiner weichen Haut ab. Mein Gesicht war wohl ein bisschen zu rosig, doch die Züge waren zart und zeigten die Form eines runden Ovals, abgesehen von einem Grübchen in meinem Kinn, von dem man nicht behaupten konnte, dass es unschön gewirkt hätte. Meine Augen waren so schwarz, wie man es sich nur irgendwie vorstellen kann, und schienen eher matt als funkelnd zu sein – mit Ausnahme einiger Gelegenheiten, bei denen, wie man mir sagte, sie wahrhaft genügend Feuer sprühten. Meine Zähne, die ich stets sorgfältig gepflegt hatte, waren klein, ebenmäßig und weiß. Mein Busen hob sich gerade leicht, sodass man eher das Versprechen als die tatsächliche Größe der runden, festen Brüste zu ahnen vermochte; das Versprechen würde allerdings bald erfüllt sein. Um mich kurz zu fassen: Ich verfügte über beinahe alle Attribute der Schönheit, wie sie im allgemeinen verlangt werden; zumindest verbot mir meine Eitelkeit, ebendieselbe Meinung bei unseren höchsten Richtern, den Männern, zu bezweifeln. Soweit ich sie überhaupt kennengelernt hatte, äußerten sich alle auch ganz zu meinen Gunsten; ich stieß sogar auf manche aus meinem eigenen Geschlecht, die großzügig genug waren, um mir in diesem Punkt Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, während andere Geschlechtsgenossinnen mich noch uneigennütziger priesen, wenn sie versuchten, gerade jene Details meiner Person und Gestalt herabzusetzen, die ganz offensichtlich ausgezeichnet geraten waren. Ich gebe ohne weiteres zu, dass dieses Selbstlob etwas kräftig ausgefallen ist; aber würde ich mich gegenüber der Natur und einem Aussehen, dem ich eine derart außerordentliche Segensfülle an Vergnügungen und Glück schulde, nicht undankbar zeigen, wenn ich aus einem übertriebenen Gefühl der Bescheidenheit die Erwähnung solcher wertvollen Geschenke unterdrücken würde?
Lassen wir es nun gut sein! Ich war also angezogen, und mein Verstand vermochte kaum zu fassen, dass all dieser glänzende Tand nichts anderes darstellte als eine Umhüllung der Opfergabe für das fällige Opfer. Ich dachte in meiner Harmlosigkeit, dass alles aus reiner Freundschaft und Großzügigkeit seitens der guten, süßen Mrs. Brown geschehe. Übrigens vergaß ich zu erwähnen, dass sie mir unter dem Vorwand, mein Geld in Sicherheit bringen zu wollen, ohne das geringste Zögern den Rest davon, der mir nach den Ausgaben für meine Reise übrig geblieben war, abgenommen hatte.
Nach einer kurzen Spanne Zeit, die ich vor dem Spiegel in schierer Selbstbewunderung höchst angenehm verbracht hatte, wobei mein neues Kleid bei weitem den größten Anteil erheischte, wurde ich ins Wohnzimmer hinuntergeschickt. Dort begrüßte mich die alte Dame und forderte mich auf, mich doch an meinen neuen Kleidern zu erfreuen, die – sie schämte sich nicht, das zu sagen – mir so passen würden, als ob ich bereits mein ganzes Leben nur das Feinste getragen hätte. Was gab es denn schon, wessen sie mich nicht für dumm genug hielt, es zu schlucken? Bei dieser Gelegenheit stellte sie mich auch einem Vetter von ihren eigenen Gnaden vor, einem älteren Herrn, der sich erhob, als ich hereinkam.
Als ich einen Knicks vor ihm machte, begrüßte er mich und blickte ein bisschen beleidigt drein, weil ich ihm nur meine Wange zum Kuss angeboten hatte. Diesen Fehler – falls es einer war – glich er sofort wieder aus, indem er seine Lippen auf meinen Mund klebte, und das mit einer Glut, wofür ich ihm beim Anblick seiner Figur wahrlich keinen Dank wusste. Sein Aussehen war nämlich dermaßen, dass nichts abscheulicher oder abschreckender sein konnte; hässlich oder unangenehm wären viel zu harmlose Wörter gewesen, um sich eine richtige Vorstellung von ihm zu machen.
Versuchen Sie sich einen Mann in den Sechzigern vorzustellen, der klein und wacklig ist, dazu mit einer gelblichen Farbe wie ein Leichnam; ferner stier glotzenden Augen, die mich ansahen, als ob er eben gehängt würde; aus seinem Mund standen zwei Zähne hervor, die man besser als zwei Hauer bezeichnen könnte, nicht zu vergessen die bleiern-fahlen Lippen und ein Atem wie von einer Schindmähre. Überhaupt hatte er ein gewissermaßen gespenstisches Aussehen; vor allem wenn er grinste, was jeden entsetzen musste – wenn es nicht sogar für viele gefährlich wurde, etwa für die Frauen, die ein Kind erwarteten. War er aber auch beschaffen wie ein Hohnbild eines Mannes, so war er doch so blind für die ihm eigene auffallende Missgestalt, dass er meinte, er sei der geborene Lebemann und keine Frau könne ihn ungeschoren treffen. Infolge dieser Überzeugung hatte er von jeher große Summen an solche armen Luder verschwendet, die sich so weit beherrschen konnten, dass sie Liebe für seine Person heuchelten; jenen gegenüber, die keine Vorstellungskraft oder Geduld hatten, um das Grauen, das er einflößte, überwinden zu können, führte er sich ziemlich brutal auf. Unfähigkeit noch mehr als tatsächliche Reizbarkeit ließen ihn in der Mannigfaltigkeit die Aufputschung suchen, die erforderlich war, um den Höhepunkt seines Verlangens zu erreichen; selbstverständlich wurde er nur allzu oft enttäuscht, da seine Kräfte versagten. Dieser Umstand löste jedes Mal einen Wutanfall bei ihm aus, den er, soweit er es wagte, an den daran schuldlosen Zielen seiner vorübergehenden Gier ausließ.
So sah also das Ungeheuer aus, dem meine gewissenhafte Gönnerin, die den alten Knacker schon lange auf diesem Gebiet versorgte, mich ausliefern wollte. Sie hatte mich mit voller Absicht herunterholen lassen, damit ich von ihm geprüft werden konnte. Dementsprechend ließ sie mich vor ihm aufstehen, drehte mich herum, löste mein Brusttüchlein und wies ihn auf das Heben und Senken, die Gestalt und Weiße einer Brust hin, die gerade zu schwellen begann. Dann ließ sie mich umhergehen, zog dabei noch Vorteile aus der Unbeholfenheit meiner Haltung, um das Inventar meiner Reize zu beleben – kurzum, sie ließ sich keinen Trick einer vielbewanderten Marktschreierin entgehen. Auf das alles antwortete er nur mit gnädigem Kopfnicken zur Bekundung seines Einverständnisses, während er mich wie eine ganze Horde von Affen anstierte. Ich warf manchmal einen verstohlenen Blick zu ihm hin; sobald sich seine wilden, gierigen Blicke mit meinen kreuzten, schaute ich schnell woandershin vor lauter Ekel und Entsetzen. Dies deutete er gewiss als nichts anderes als gewöhnliche mädchenhafte Schamhaftigkeit oder wenigstens deren Nachahmung.
Immerhin ließ man mich ziemlich bald gehen, und Phoebe brachte mich in mein Zimmer zurück. Sie blieb bei mir und gönnte mir keinen Augenblick der Muße, der Gedanken in mir hätte aufsteigen lassen, wie es bei jedem der Fall gewesen wäre, der nicht ein Idiot war und eine solche Szene erlebt hatte. Zu meiner Schande muss ich jedoch bekennen, dass meine unbesiegbare Dummheit oder vielmehr ungeheure Naivität mich immer noch hinderte, die Augen im Hinblick auf die Absichten von Mrs. Brown zu öffnen. Noch immer sah ich in diesem so genannten Vetter von ihr nichts anderes als eine grässliche, abschreckende Person, die nichts mit mir zu tun hatte; einzig meine Dankbarkeit gegenüber meiner Wohltäterin veranlasste mich dazu, meinen Respekt auf ihre ganze Vetternschaft auszudehnen.
Phoebe allerdings schickte sich an, den Zustand und besonders das Klopfen meines Herzens in Anbetracht dieses Ungeheuers zu prüfen. Sie fragte mich, was ich eigentlich davon halten würde, mir einen so feinen Herrn als Ehemann vorzustellen (ich vermute, sie nannte ihn einen feinen Herrn, weil er mit Borten und Tressen überladen war). Ich antwortete ihr ganz natürlich, dass ich keine bestimmten Vorstellungen von einem Ehemann hätte, dass ich aber, wenn ich einen zu wählen hätte, ihn gewiss unter den Männern meines Standes suchen würde. Mein Ekel vor dieser scheußlichen, einem Höllenspuk entstiegenen Gestalt hatte mich derart misstrauisch gegenüber allen »feinen Herren« gestimmt, dass meine Gedanken in ein Durcheinander gerieten, als ob alle Männer aus seiner Schicht notwendigerweise in dieselbe Gussform wie er hineingehörten. Aber Phoebe ließ sich nicht so schnell schlagen, sondern verfolgte weiterhin ihre Bestrebungen, mich für die Zwecke meines Aufenthalts in diesem gastfreundlichen Haus herumzukriegen. Während sie allgemein über die Geschlechter redete, fand sie wohl genügend Grund, um sich des Einverständnisses zu vergewissern, das zu guter Letzt doch leidet von mir zu erreichen war; sie besaß allerdings viel zu viel Erfahrung, um nicht den ganz besonderen Ekel vor dem abstoßenden Vetter zu bemerken. Das stellte schließlich ein Hindernis dar, welches nicht so leicht zu entfernen war, wie es für die Abwicklung ihres geplanten Geschäfts, nämlich meines Verkaufs, wünschenswert schien.
Mutter Brown hatte in der Zwischenzeit die Vertragsbedingungen mit dem besoffenen alten Ziegenbock ausgehandelt; die Rechnung belief sich, wie ich später feststellte, auf fünfzig Guineen für die Erlaubnis, um mich zu werben, und hundert Guineen Draufgeld bei der völligen Befriedigung seiner Wünsche, nämlich dem Sieg über meine Jungfräulichkeit. Was mich betrifft, so war ich völlig seinem Belieben und seiner Großzügigkeit ausgeliefert. Nachdem dieser ungerechte Vertrag abgeschlossen worden war, zeigte er sich so scharf darauf, gleich Besitz zu ergreifen, dass er darauf bestand, zum Teetrinken mit mir am selben Nachmittag eingeladen zu werden, wobei man uns allein lassen sollte.
Er wollte den Warnungen der Vermittlerin kein Gehör schenken, dass ich nicht genug vorbereitet wäre für einen solchen Überfall; dass ich zu grün und zu ungebändigt sei, da ich kaum vierundzwanzig Stunden im Hause weile. Es ist jedoch das Kennzeichen der Begierde, ungeduldig zu sein; seine Eitelkeit schützte ihn außerdem vor jeder Vermutung, dass es ein anderes Hindernis als das übliche Widerstreben eines Mädchens bei solchen Gelegenheiten geben könne. Daher lehnte er alle Vorschläge einer Verschiebung des Termins ab, und meine furchtbare Prüfung wurde also ohne eine Ahnung meinerseits auf denselben Abend festgesetzt.
Beim Mittagessen beschäftigten sich Mrs. Brown und Phoebe einzig und allein damit, sich in überschwänglichen Preisungen des wundervollen Vetters auszutoben; wie glücklich sei doch die Frau, die er mit seinen Freundschaftsangeboten beehren würde – kurzum: Meine zwei Klatschbasen haspelten ihre ganze Kunst der Rhetorik ab, um mich glauben zu machen, »dass der Herr bei meinem ersten Anblick sofort stärkstens angetan gewesen sei …, dass er mein Glück herbeiführen würde, wenn ich ein braves Mädchen wäre und mir nicht selber im Wege stehe … dass ich mich auf seine Ehrenhaftigkeit verlassen solle …, dass ich es dann geschafft hätte und einen Wagen bekommen würde, um herumzukutschieren …« Dieses ganze Zeug führten sie in einer Weise an, die durchaus geeignet war, einem dummen unwissenden Mädchen den Kopf zu verdrehen.
Glücklicherweise hatte aber mein Widerwillen schon so tief Wurzeln gefasst, und mein Herz wurde durch meine Sinne dermaßen stark gegen ihn verteidigt, dass ich ihnen, da mir die Fähigkeit, meine Gefühle zu verbergen, abging, keine Hoffnungen auf einen Erfolg ihrer Bemühungen gab. Die Flasche ging sehr schnell rundum, wohl mit der Absicht, wie ich annehme, die in meinem Körper schlummernde Wärme in den Minuten vor dem drohenden Angriff herauszulocken.
Auf diese Weise hielten sie mich lange bei Tisch fest; gegen sechs Uhr abends, nachdem ich mich in mein eigenes Zimmer zurückgezogen hatte und alles zum Teetrinken vorbereitet war, trat meine ehrwürdige Herrin herein. Ihr folgte der Satyr auf dem Fuße, wobei er in der ihm eigenen Weise grinste. Seine verhasste Anwesenheit bestätigte noch einmal alle meine Gefühle des Widerwillens, die in mir das erste Mal, da ich ihn sah, geweckt worden waren.
Er setzte sich mir gegenüber. Während der ganzen Zeit, als wir Tee tranken, liebäugelte er mit mir so läppisch, dass es mir höchst peinlich wurde und mich in Verlegenheit versetzte – lauter Anzeichen, die er offensichtlich auf Schüchternheit und mangelnde Gelegenheit, fremde Leute zu sehen, zurückführte.
Als das Teetrinken beendet war, schützte die gemütliche alte Dame eine dringende Beschäftigung vor (was tatsächlich stimmte); sie musste also fortgehen und bat mich ernsthaft, ihren Vetter freundlich bis zu ihrer Rückkehr zu unterhalten; es sei geradesogut um meinet- wie um ihretwillen. Mit einem »Bitte, mein Herr, seien Sie sehr gut und sehr zart zu dem süßen Kind«, verließ sie das Zimmer. Ich blieb verblüfft, mit offenem Mund, sitzen, denn durch die Geschwindigkeit ihres Abschiednehmens war ich so überrumpelt, dass ich mich nicht dagegen wehrte.
Nun waren wir allein; bei diesem Gedanken überlief mich ein plötzlicher Schauder, ein Anfall von Zittern. Ich war so erschreckt, ohne eine klare Vorstellung, warum und wovor ich Angst haben sollte, dass ich regungslos auf dem kleinen Sofa am Kamin saß, zu Stein geworden, ohne Leben oder Geistesgegenwart, ohne zu wissen, wohin ich schauen oder wie ich mich rühren sollte.
Aber es war mir nicht lange verstattet, in diesem Zustand der Verblüffung zu verharren. Das Ungeheuer hockte sich zu mir auf das Sofa, und ohne weitere einleitende Zeremonien legte er seinen Arm um meinen Hals und zog mich mit Gewalt zu sich hin. Auf diese Weise zwang er mich, trotz meiner Anstrengungen, ihn abzuwehren, seine verpestenden Küsse zu empfangen, von denen es mir geradezu übel wurde. Als er schließlich meine Empfindungskälte und meine Passivität konstatieren musste, nahm er mein Busentüchlein fort und legte das bisher Bedeckte für seine Augen und Hände bloß; ich litt es immer noch, ohne zu zucken, worauf er, frech geworden durch meine Geduld und mein Schweigen – ich besaß keine Kraft, um zu sprechen oder zu schreien –, versuchte, mich auf das Sofa zu legen. Ich spürte plötzlich seine Hand an meinen nackten Schenkeln, die gekreuzt waren, und die er nun zu öffnen sich abmühte; aber da verließ mich meine passive Duldsamkeit, und ich sprang mit einem Satz, auf den er nicht vorbereitet war, von ihm weg. Ich warf mich zu seinen Füßen und bat ihn im rührendsten Ton darum, nicht hart zu sein und mir nicht weh zu tun.
»Dir wehtun, meine Liebe?«, sagte das Scheusal. »Ich will dir nichts Böses antun. Hat dir die alte Dame denn nicht erzählt, dass ich dich liebe? Dass du zu mir freundlich und lieb sein sollst?«
»Ja, das hat sie, mein Herr«, sagte ich, »aber ich kann Sie nicht lieben, ich kann es einfach nicht! Bitte lassen Sie mich allein … Ich werde Sie lieben, aus tiefstem Herzen lieben, wenn Sie mich allein lassen und weggehen …«
Aber ich sprach zu einer Wand. Ob es nun meine Tränen waren oder meine Haltung oder die Unordnung meiner Kleidung – irgendetwas erwies sich als geeignet zu seiner Ermutigung. Vielleicht vermochte er jetzt auch einfach seine Begierde nicht mehr zu bändigen. Jedenfalls fing er schnaufend und schäumend vor Gier und Wut seinen Angriff wieder an. Er fasste nach mir und wiederholte unablässig seinen Versuch, mich auf das Sofa zu legen und festzuhalten. Insofern hatte er Erfolg, als es ihm gelang, mich auszustrecken, den Unterrock über den Kopf zu stülpen und meine Schenkel zu entblößen, die ich aber hartnäckig zusammenpresste, sodass es seinem Knie nicht möglich war, sie zu öffnen und Herr der Hauptstraße zu werden. Seine Kleider waren gelockert, Weste sowohl wie Hosen, und ich konnte schon das Gewicht seines Körpers auf mir fühlen. Ich kochte vor Empörung und starb gleichzeitig beinahe vor Angst. Doch er hörte plötzlich mit seinen Bemühungen auf und fing an, keuchend, schnaufend, fluchend immer von neuem hervorzustoßen: »Alt und hässlich, alt und hässlich!«, wie ich ihn sehr treffend in der Hitze meiner Verteidigung genannt hatte.
Wie mir später klarwurde, hatte das Scheusal anscheinend in seinem heftigen Verlangen und bei unserem Ringen die letzte Phase seines leidenschaftlichen, wollüstigen Anfalls ausgelöst. Er hatte sich zu wenig in der Gewalt, um bis zum Ende durchzustehen, sodass meine Schenkel und meine Wäsche den Erguss abbekamen.