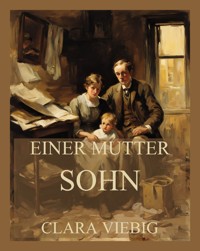Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marie-Luise Büchner ist als Lehrerin in die Fußstapfen ihres Vaters getreten. Mit großer Leidenschaft und einem Herzen für die Kinder wächst sie in einer Berliner Schule im Arbeitermilieu in den Lehrerberuf hinein, macht sich für die Kinder stark und nimmt an ihrem Schicksal auch außerhalb der Schule teil. Aber was ist mit ihren privaten Zielen? Da gibt es den Rektor ihrer Schule, der sie privat an seiner Seite wünscht ,und sie lernt den jungen Arzt Alwin kennen. Welche Richtung wird sie einschlagen? Ein bewegender Roman, in dem die Suche nach einer idealen, von pädagogischen Werten geleiteten Schule steht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Die mit den tausend Kindern
Roman
Saga
Erstes Kapitel
Wer von euch kann das lesen, was hier steht?« Die junge Lehrerin lächelte in die Klasse hinein, der Zeigefinger ihrer Rechten wies auf die Tafel, die gross und schwarz von der Wand herabsah. Kleine Papptäfelchen waren wie auf Schienen in die grosse Tafel hineingeschoben, und von jedem dieser weissen Pappvierecke bohrte sich ein glänzend schwarzer, grosser Druckbuchstabe den Kindern in die Augen.
»Nun?!« Das Lächeln wurde noch stärker, die Stimme noch auffordernder, liebenswürdig zuredend: »Du, Irmchen, du kannst es gewiss lesen?«
Die Kleine mit den zwei winzigen Zöpfchen, die rechts und links hinter den Ohren abstanden, schwieg.
»Ich! Ich! Ich!« Ein Chor von Stimmen erhob sich, ein Durcheinanderschreien. Ausgestreckte Zeigefinger stachen der Lehrerin fast ins Gesicht.
Mit einer geduldigen Handbewegung schob die Blonde die ungebärdigen Kinderarme beiseite: »Wartet, wartet, ihr kommt alle dran — aber, Senta, du kletterst ja sogar auf die Bank! Ich weiss, ich weiss ja, du kannst es, aber setz dich mal schnell! Du, Hildegard, komm du mal her an die Tafel, lies du’s uns vor.«
Ein zierliches Dingelchen mit einem Stupsnäschen schob sich aus der Bank und lief nach vorn, nein, stürzte so eifrig vor, dass es fast über ein mutwillig vorgestrecktes Bein zu Fall gekommen wäre. Es erkletterte den Schemel auf dem Tritt des Katheders — nun reichte es hinauf bis zur Wandtafel, nun tippte sein Fingerchen die Buchstaben an, und nun las es strahlend mit durchdringend dünner Kinderstimme: »Haus!«
»Richtig.« Die Lehrerin nickte zustimmend. Jetzt trat sie an den Setzkasten auf ihrem Tisch, wählte ein anderes Papptäfelchen und vertauschte das mit dem H. »Was habe ich nun geschrieben?«
»Gedruckt,« verbesserte eine Vorlaute.
»Geschrieben oder gedruckt, das ist für uns ja noch dasselbe. Aber, Magdalene, nun komm du mal raus, lies du uns vor, was ich jetzt gedruckt habe!«
Die blasse Kleine stand verlegen, ihre grossen Augen blickten hilflos.
»Ich! Ich! Aber ich, Fräulein, ich weiss es!« Wieder das Durcheinander der Stimmen, das Aufspringen, das Recken der Arme, das Stechen der Zeigefinger, all das ungestüme Verlangen des Andie-Reihe-Kommens.
Und wieder dieselbe geduldige Handbewegung, die die gereckten Arme beiseite schob und die zappelnden Kinderkörper auf die Bank niederdrückte. Und wieder dasselbe Lächeln, und wieder dasselbe liebenswürdige Beschwichtigen: »Ja, ja, schon gut, ihr wisst es alle! Du weisst es ja auch, Kind, sieh nur gut hin. Ich habe das ‚H‘ fortgenommen und statt dessen — nun, was habe ich statt dessen wohl hingesetzt?«
»Ein R,« tönte es zaghaft.
»R?«
»Rrrrrrr,« schnarrte es plötzlich durch die Klasse.
»Das ist doch kein ‚R‘.« Die Lehrerin lachte gutmütig.
Da fingen sie alle gleich an mitzulachen. Ein nicht endenwollendes, ausgelassenes Gelächter: Ein R? Zum Totlachen, zum ganz Mausetotlachen! Für Minuten schien die Klasse der vierzig von einem Freudentaumel erfasst, die Sechsjährigen hüpften auf ihren Plätzen wie von Springfedern geschnellt. »Hau, Fräulein, die sagt ‚R‘! Wie dumm! Hau, was is die so dumm! Rrrrrrrr.«
Kaum dass die Stimme der Lehrerin durchdringen konnte: »Ruhe!« Der Schweiss war Marie-Luise auf die Stirn getreten: Oh, was hatte sie da gemacht! Gelacht. Sie hätte nicht lachen dürfen. Das war ja auch gar nicht zum Lachen; sie selber war viel dümmer gewesen als das dumme Kind. Aber die Stimme der Kleinen hatte so komisch geklungen, so überzeugt von der Richtigkeit und glücklich über die eigene Entdeckung.
In Marie-Luises Gesicht verschwanden schnell die zart angedeuteten Grübchen, sie mühte sich, sehr ernsthaft zu blicken: »Ruhe! Ganz schnell! Legt eure Hände zusammen. Ich zähle bis drei, und wenn ich drei gesagt habe, darf keine mehr lachen. Eins — zwei — drei!«
Nun war es endlich still. Aber das Kind, das noch immer vorne gestanden hatte, den Finger am Mund, völlig eingeschüchtert, weinte plötzlich laut auf, stürzte auf die Lehrerin zu und verbarg seinen Kopf in deren Kleid. Ach, es konnte ja den hässlichen Buchstaben nicht erkennen, wusste nicht, wie das Wort jetzt hiess. Aber sie sollten nicht lachen, nein, es nicht auslachen. »Bei meine Mutti, ich möchte bei meine Mutti!«
Ganz erschrocken beugte sich die Lehrerin nieder: »Aber, Lenchen, was ist dir denn?«
»Fräulein, sie weint, weil Sie böse mit ihr sind,« schrien welche.
»Aber ich bin doch gar nicht böse mit ihr — Ruhe, setzt euch! Mein Lenchen, nun weine doch nicht!« War das ein nervöses Kind! Und wie es schien, auch ehrgeizig und verletzt über das Lachen. Begütigend legte die Lehrerin ihre Hand auf das an ihr Kleid gedrückte Köpfchen. Ach, so ein bleiches, sehr zartes Kind! Marie-Luise fühlte etwas warm zu ihrem Herzen rinnen, in mitleidiger Regung flüsterte sie: »Musst nicht weinen, Lenchen. Komm, ich sag dir’s ins Ohr!« Und sie bückte sich zu dem kleinen Ohr: »M — mmmmmm — nun sag’s!«
Aber Lenchen Krause sagte es nicht. Es war überhaupt nichts mehr aus ihr herauszubringen. Sie sass in ihrer Bank, den Kopf aufs Pult gelegt, und weinte in sich hinein: »Mutti!«
»Fräulein, ihre Mutter is ins Krankenhaus,« wusste die Trude Schindler.
»Im Krankenhaus, es heisst: im Krankenhaus.«
Trude Schindler, ohne sich zu verbessern, fuhr geschwätzig fort: »Sie wohnen bei uns ins Haus — und ihr Vater — na, Fräulein, der —!« Sie zog die Achseln hoch, legte den Kopf, mit der grossen Haarschleife in der strubbligen Mähne, schief auf die Seite und verzog den Mund.
Sah die kaum Siebenjährige in diesem Augenblick nicht genau so aus wie die Frauen, die, Korb oder Tasche am Arm, an den Kellerausgängen und in den Vorfluren standen und klatschten? Die blonde Lehrerin machte »Pssst« und hob abwehrend die Hand: wie unangenehm dieses Kind. Aber das arme kleine Lenchen, die Mutter im Krankenhaus, und der Vater — was war bloss mit dem Vater? Doch jetzt war keine Zeit, zu fragen, das Kichern in der Klasse, das Füssescharren, die Unruhe nahmen sonst kein Ende. Man musste die Kinder wieder durch anderes fesseln, ihre Anteilnahme auf Neues lenken. Marie-Luise klatschte in die Hände: »Also, Kinder, nun wissen wir’s endlich: Das da ist ein ‚M‘, und das Wort« — wieder klatschten ihre Hände wie bei munterm Spiel — »das Wort, das erst Haus hiess, das heisst nun —?«
»Maus,« schrie es jubelnd im Chor.
»Richtig!« Die Lehrerin schien ungeheuer erfreut: »Da haben wir’s ’raus: Maus, Maus. Nun sagt mir aber mal, Kinder, wer von euch hat denn schon mal eine Maus gesehen? Du, Senta, hast du eine gesehen? Ist sie gross, ist sie klein?«
»Gross.«
»Na, na, gross kann man doch wirklich nicht sagen. Sie ist doch klein, ganz klein.«
»Aber ‚Maus‘ sagt doch immer der Herr, der bei uns wohnt, zu meine Schwester, und die is doch schon so gross.«
In das blonde Mädchengesicht stieg eine helle Röte, alle Geister des Humors spielten um die Mundwinkel. Aber ihr Lächeln bezwingend, sagte die junge Lehrerin: »Nein, solch eine Maus meine ich nicht. Ich meine die Maus, die ein graues Fellchen hat und einen langen Schwanz, und die so — husch, husch, seht, so wie ich so flink durch die Küche huscht und sich ein Krümchen holt, was am Boden liegt.«
»Fräulein, wir haben zu Haus ’ne Maus!«
»Wir auch! Wir auch!« Eifersüchtig schrie es im Chor. Sie wollten jetzt alle eine Maus haben. Oh, das war was Schönes, so eine Maus! Dann quiekte die Mutter ganz laut, und die grosse Schwester auch und sprang auf einen Stuhl, und man schrie mit, so laut man nur konnte. »Aber Vater sagte: ‚Die verfluchte Maus‘ und schlug ihr tot.«
»Schlug sie tot, schlug sie tot,« verbesserte die Lehrerin. »Aber warum denn gleich die kleine Maus totschlagen? Ach, die lebt doch auch gern; so gern wie ich, so gern wie du, Senta, wie du, Erika, wie du, Else, wie ihr alle. Und die hat vielleicht in ihrer Wohnung unter der Diele ein Nest mit Kinderchen, denen sie das Krümchen Brot bringen wollte zum Mittagessen. Soll ich euch mal die kleine Maus da an unsere grosse Maltafel malen?«
»Die Kinder auch, die Mausekinder im Nest!«
»Die hat ja gar kein Nest,« schrie die Trude mit der grossen Haarschleife, »die hat nur ’n Loch. Die muss man totschlagen. ’ne Maus is bloss Ungeziefer.«
‚O du unausstehliches Kind,‘ dachte Marie-Luise, aber ihr geduldiges Lächeln blieb. »Nun, wart mal erst ab, Trude, bis du meine kleine Maus siehst; vielleicht, dass du sie dann doch nicht mehr totschlagen willst.« Rasch die Kreide aus dem Tischfach nehmend, zeichnete sie mit energischen Strichen ein Etwas an die Maltafel, das man wohl mit einiger Phantasie für eine Maus ansehen konnte. Bunte Kreide wurde zu Hilfe genommen; die graue Maus lief zu einem roten Ziegelherd, auf dem Kochtöpfe, blaue, grüne, gelbe standen, und trug ein weisses Stück Zucker, so gross wie ihr ganzer Kopf, mit sich fort in ihr Nest unterm Kochherd.
Ein grosses Maltalent war die blonde Lehrerin nicht, andere Lehrerinnen entwarfen weit bessere Bilder, aber die Kinder erkannten doch jubelnd die Maus und den Kochherd, die Töpfe und auch den Zucker. Nun wurde eine Mutter noch hingemalt, und die sprach mit der Maus.
Es war ein Gedicht, das die Kinder gelernt hatten. Ein Kind sprach die Frau:
»Mäuschen, was schleppst du dort
Mir das Stück Zucker fort?«
Ein anderes das Mäuschen. Die kleine Gerda mit dem Stupsnäschen hatte ganz das feine Piepstimmchen dafür:
»Liebe Frau, ach vergib,
Habe vier Kinder lieb;
Waren so hungrig noch.
Gute Frau, lass mir’s doch!«
Selbst Trude Schindler war entwaffnet: das war wirklich ulkig. Sie würde das Mäuschen nun nicht mehr totschlagen wollen.
Und nun sprach die ganze Klasse — vierzig Kin- — der etwas plärrend und durchaus nicht melodisch, aber wie aus einem Munde:
»Da lachte die Frau in ihrem Sinn
Und sagte: ‚Nun, Mäuschen, so lauf nur hin!
Ich wollte ja meinem Kinde soeben
Auch etwas für den Hunger geben.‘ —
Das Mäuschen lief fort, o wie geschwind!
Die Frau ging fröhlich zu ihrem Kind.«
Draussen hub jetzt die Schulglocke an. »Oh,« machten die Kinder bedauernd, sie hätten noch gern mehr von der Maus gehört. Aber für ein Ohr, das vier Stunden lang wie taub gemacht worden ist durch die schrillen Stimmen von Kindern, die alle, alle etwas sagen wollen, war dies blecherne, schetternde Läuten Musik.
Mit einer müden Bewegung fuhr Marie-Luise sich über die Stirn, sie fühlte es da wie einen drückenden Reif. Die Luft in der Klasse war nicht schlecht, halb aufgestellte Oberlichter sorgten für Erneuerung, aber es war doch Schulluft, trocken, staubig, verbraucht. Und von draussen die Luft war die des Schulhofes, der eingebaut lag zwischen hohen Mauern, der nicht das Glück hatte, in den Aussenvierteln der Stadt zu liegen. Freie Weiten, Wiesen, Felder, unbegrenzte Aussichten, wo waren die! — Es war Marie-Luise Büchner nicht ganz leicht gewesen, sich einzugewöhnen; gerade an dieser Schule nicht. Von anderen Kolleginnen waren viele an Schulen, die neuer waren, Verbesserungen und alle hygienischen modernsten Einrichtungen aufwiesen. Und sie wohnten auch näher.
»Was?! Im westlichen Vorort wohnen Sie, Fräulein Büchner? Nicht möglich! Mein Gott, das ist ja so weit!«
Nein, nein, das machte ihr gar nichts! Sie war ja zu froh, endlich, endlich die ersehnte Tätigkeit gefunden zu haben. Andere warteten freilich noch länger: sieben, acht, neun, sogar zehn Jahre. Es grauste Marie-Luise, wenn sie an die vielen unbeschäftigten Junglehrer und Junglehrerinnen dachte: Hunderte, viele Hunderte — waren es ihrer vielleicht gar Tausende?! Seltsam fade und öde wurde es ihr ums Herz, wenn sie sich blasse, abgespannte Gesichter vorstellte, Gestalten, die wie auf der Lauer lagen, wie zum Sprung bereit auf ein Ziel, das sie doch nicht erreichen konnten. Auch sie hatte dieses Ziel kaum erwarten zu können gemeint.
Zweites Kapitel
Sie waren sehr lang gewesen, die sechs Jahre, in denen Marie-Luise gewartet hatte. Es hatte nichts genutzt, dass die Mutter mit ihr nach Berlin übergesiedelt war, in der Meinung, dort ginge es rascher — in der Riesenstadt gab es ja so viele Schulen und so unendlich viele Kinder — aber Klassen wurden sparsamerweise zusammengelegt, und die Geburten, und infolgedessen auch die Schulanmeldungen, gingen zurück; es war nicht mehr solcher Bedarf an neuen Lehrern und Lehrerinnen.
»Deswegen hätte Frau Professor ruhig hier in Prenzlau bleiben können,« sagten die Damen des Kränzchens, wenn sie hörten, dass die Tochter noch immer nicht die ersehnte Anstellung gefunden hatte. »Aber die Büchner wollte ja immer ein bisschen hoch hinaus: nur Berlin, Berlin! Als ob man in der Provinz nicht ebenso gut leben könnte! Der arme Mann mag es schwer gehabt haben mit der Frau; die ist doch schrecklich nervös. Ob Marie-Luise wohl von seinem ausgezeichneten Lehrtalent was geerbt hat?«
Als Marie-Luise ihr Anstellungsgesuch nebst ihrem Examenszeugnis — mit ‚sehr gut‘ bestanden — und allen dazugehörenden Papieren der Berliner Schulbehörde eingereicht hatte, war sie gewiss, man würde den Namen ihres Vaters da kennen. ‚Büchner — Büchner — war das nicht der langjährige Realschuldirektor in Prenzlau, der so ausgezeichnete Resultate erzielt hatte?‘ Sie war ganz getrost, sie verliess sich auch jetzt noch auf ihren Vater, obgleich der schon damals nicht mehr gelebt hatte, als sie ihr Examen machte. Aber wenn er auch nicht mehr lebte, sein Geist war noch in ihr und der Gedanke, den er von Kindheit an in sie gepflanzt und grossgezogen hatte: ‚Du wirst Lehrerin.‘ Und sie wollte das auch gern, sah sie doch, dass alle Sorgen, alle Kümmernisse verflogen waren, sowie der Vater morgens seine Schule betrat. Dann strahlte sein Gesicht. Und er hatte doch genug, was ihn drückte: der tägliche Ärger, die nirgends fehlenden Aufregungen — mit der Mutter war es auch nicht leicht — und dann der grosse, grosse Schmerz um die Söhne, die ihm beide, siebzehn- und achtzehnjährig, im Krieg gefallen waren. Nur sie, das kleine Mädchen, der Nachkömmling, war ihm übriggeblieben. Aber alles das schien vergessen, wenn er vor der Klasse stand. Dann war er so anregend, so heiter, ein ungebeugter stattlicher Mann, der nie ein Ausruhen zu bedürfen schien. Er schickte lieber die Mutter auf Badereisen; er brauche keine Erholung, sagte er. Seine Augen, die auf ihr ruhten, waren immer so klar, seine Stimme immer so frisch. Marie-Luise hatte die letzte Zeit seines Lebens, die plötzlich eintretende tiefe Erschöpfung, ganz vergessen.
»O Vater!« hatte die Tochter mit tiefem Aufatmen gesagt, als ihr Examen vorüber war; eine andere hätte im plötzlichen Gefühl der Erleichterung vielleicht herausgestossen: O Gott!
Und doch war solch ein Examen gar nicht schlimm, wenn man die Nerven behielt, und sich nicht beirren liess durch Blicke, die hinter Brillengläsern sich scharf auf einen richteten. Frank und frei war Marie-Luise in das Examen gegangen, sie begriff eigentlich die anderen nicht, die sich so ängstigten, dass sie blass und zitternd dastanden. Margarete Moebius, ihre Freundin vom Seminar, hatte ihr aufgeregt zugeflüstert: »Ich geh ins Wasser, wenn ich durchfalle!« Unsinn! Marga war ja viel klüger, als sie es war, und war ebenso fleissig gewesen, hatte genau so wie sie durch Wochen und Wochen Dreiviertel der Nächte gebüffelt, sich durch starken Kaffee wach erhalten — die brauchte doch sicher keine Angst zu haben. Aber Marga war durchgefallen; das heisst, nicht ganz, es war ihr freigestellt worden, in einigen Fächern, die Lücken aufwiesen, das Examen zu wiederholen. Ob sie den Mut dazu finden würde? In der ersten Zeit, als sie noch Briefe wechselten, hatte Marga sich dazu immer noch nicht entschlossen gehabt. Aber sie würde sich entschliessen müssen; man kann doch nicht Jahre und Jahre gelernt und seinen Eltern so viel Opfer gekostet haben, ohne dass man dafür nun auch etwas erreichte! Marga, wo mochte die stecken?
Wenn Marie-Luise an ihre Vorbereitungszeit zurückdachte, war diese eng verknüpft mit der einstigen Freundin. Wie hübsch war Marga gewesen, und etwas so Feines hatte sie, man merkte es ihr wahrhaftig nicht an, aus was für kleinen Verhältnissen sie kam. Aus einer Stellmacherwerkstatt. Sie besuchten zu gleicher Zeit das Seminar; sie hatten, wenn auch nicht im selben Hause, so doch nah beieinander ihren bescheidenen Unterschlupf gefunden. Sie teilten alles, was sie von Haus geschickt bekamen, und das war bei der Blonden mit der kräftigen Gestalt und der leuchtenden Haarfülle mehr als bei der Überschlanken mit den melancholischen dunklen Augen und dem schwarzen Haar, das sich wie glatter Atlas an die Schläfen schmiegte. Es war damals eine fast leidenschaftliche Freundschaft gewesen mit Eifersucht und Missverständnissen, mit Tränen und Wiederversöhnen, eine richtige Backfischfreundschaft, obgleich sie aus diesem Alter doch schon heraus waren. Aber daran war Marga schuld gewesen, sie war so temperamentvoll. Ob die jetzt wohl verheiratet war, die Schulmeisterei aufgegeben hatte? Wie man das konnte, das begriff Marie-Luise freilich nicht. Ihr lag nicht anderes am Herzen, ihre Gedanken waren voll damit beschäftigt; selbst in ihre Träume mischten sich keine anderen Sehnsüchte. Damals im Seminar war es zuweilen anders gewesen — das kam wiederum durch Marga — aber jetzt richteten sich all ihre Wünsche nur auf das eine Ziel. Und merkwürdig, in dieser Zeit sah auch kein Mann nach ihr. Es war, als sei eine Luft um sie, die jeden fernhielt.
Wenn Frau Professor Büchner — der Schuldirektor hatte den Titel ‚Professor‘ bekommen, und den führte die Witwe gern — ihre Tochter ansah, konnte sie eine gewisse Bitterkeit nicht unterdrücken: war es nicht wie ein Verhängnis, dass dieses Mädchen ungesehen verblühte? Wenn der Mutter die Tochter beim Mittagessen gegenübersass, das helle Gesicht freundlich lächelte, oder wenn am Abend der Schein der Hängelampe auf den geneigten Scheitel fiel und das reiche Blond vergoldete, dann seufzte es in ihr: schon siebenundzwanzig! Zeit, ach, es war Zeit! Fand denn keiner ihre Marie-Luise? Ob der sie heiratete oder nicht heiratete, das war vorderhand noch Nebensache, man war auf das Heiraten jetzt nicht mehr so aus, die Zeiten waren darin andere geworden, aber wenigstens ein Freund, ein Freund für Marie-Luise! Mit Vorwurf dachte die Frau Professor an ihren Mann: nein, der hätte die Tochter nicht nur auf die Lehrerin hin erziehen dürfen. Nun ging ihr dadurch das Schönste, das Einzige, um das es sich lohnte zu leben, verloren. Oh, ihre arme Marie-Luise, sie lachte jetzt, wenn man von so etwas zu ihr sprach, konnte sogar ärgerlich werden, aber es würde ihr schon kommen, würde ihr dann kommen, wenn es zu spät für sie war!
Frau Büchner war oft unglücklich; sie hatte kein Talent glücklich zu sein, darum konnte sie auch nicht glücklich machen. Sie schob es auf die veränderten Verhältnisse, auf ihre Witwenschaft, auf die kleine Wohnung, die ihr nach der grossen Dienstwohnung in der Prenzlauer Schule erbärmlich vorkam, besonders auf die Verständnislosigkeit der Tochter. War es denn nicht grässlich, dass dieses grosse gesunde Mädchen seit Jahren herumsass und nichts tat als warten, nur warten? Schon froh war, wenn es ihr gestattet wurde, mal hier und mal da zu hospitieren, damit sie nicht alles vergass, was sie gelernt hatte. Ein entsetzlicher Beruf dieser Lehrerberuf! Ihr Mann hatte sich den Tod dabei geholt, ihre Söhne waren auch dadurch hingeopfert worden, denn wäre ihr Mann nicht der Meinung gewesen, er müsse der Prima der Schule mit gutem Beispiel vorangehen, die Jungen, die noch kaum den Kinderschuhen entwachsen, wären nicht in den Krieg gegangen. Und nun sah sie auch noch die Tochter hinsiechen dadurch! Die Frau konnte sich hineinsteigern in einen Jammer, der viel grösser war, viel schwerer zu ertragen schien, als jener bei der Nachricht vom Tod der Söhne. Frau Professor Büchner vergass ganz, dass ihre Tochter weder herumsass noch gefaulenzt hatte in diesen Jahren des Wartens. —
Als sie noch nicht in Berlin wohnten, die Tochter die Mutter noch gut aufgehoben wusste in den vertrauten Prenzlauer Verhältnissen, hatte Marie-Luise eine Hauslehrerinnenstelle angenommen gehabte. Wenn ihr diese Zeit bei ihrem Dienstalter auch nicht mit angerechnet wurde, was tat’s, sie war so jung, kaum zweiundzwanzig, sie konnte noch hoch genug in den Dienstjahren kommen.
Es war ein heller Frühlingstag gewesen, an dem Marie-Luise die Reise nach Niederschlesien angetreten hatte. Es würde keine schwere Stellung sein auf Althaide, die Frau Baronin war Witwe und suchte für ihr einziges Töchterchen, das noch nicht das Alter hatte, um in ein Institut gegeben zu werden, nicht nur eine Erzieherin, sondern auch eine liebenswürdige Gefährtin. Und eine solche schien ihr die Photographie zu versprechen, die Marie-Luise eingesandt hatte. Das Gehalt war freilich nicht bedeutend — fünfzig Mark bei freier Station und freier Wäsche — aber in einer ersten Stellung gab es eben nicht mehr. Und Marie-Luise wollte der Mutter von der Tasche kommen, auch lockten sie Landluft, Wald- und Wiesenduft.
»Wir leben einfach,« hatte die Baronin geschrieben, »aber sehr gesundheitsgemäss. Auch wünsche ich einen geregelten und pünktlich eingehaltenen Stundenplan, damit meine Tochter gleich von Anfang an lernt, was es heisst, Pflichten haben. Doch wird Ihnen Zeit genug bleiben, um sich in unserer schönen Umgebung täglich die Frische neu zu holen, die für Ihren Beruf nötig ist.«
Das war es ja, was Marie-Luise anstrebte: täglich neue Frische. Mit Interesse sah sie in die Landschaft hinaus, durch die ihr Zug eilte. Keine aufregende Landschaft: Äcker mit grünen Saaten und solche, auf denen soeben Kartoffeln gelegt wurden. Gespanne unter blauendem Himmel mit langsamen Rädern dahinfahrend, abseits liegende Dörfer mit Strohdächern und Kirchturmspitzen zwischen Obsthainen versteckt, vereinzelte Menschen auf dem Acker, mit stumpfer Neugier dem dahinschnaubenden Zug nachgaffend. Das war alles nichts Besonderes, aber es hatte für das junge Mädchen doch einen Reiz. Bald würden hier die Obstbäume blühen, ah, und wenn das Korn dann erst golden wogte! Dann war Althaide sicher schön, der Name hatte schon so etwas Anheimelndes.
Als der Tag sich zum Spätnachmittag neigte, liess Marie-Luise die vorletzte Station hinter sich — jetzt war es nur Kleinbahn — der grössere Haltepunkt, ein Städtchen mit vielen Fabrikschornsteinen, war verschwunden, es kam erst unbebautes Feld, dann aber Wald, Heide, und nun hielt der Zug vor der kleinen Bahnhofsbude: Althaide.
Neugierig sah Marie-Luise sich um: wo war die Equipage? Sie sollte doch abgeholt werden. Und wer trug ihren Koffer?
»Hier gibt es keinen Gepäckträger,« sagte eine Stimme, und eine Dame, hoch, schlank, in enganliegendem Jackett und Reithut hob ihren nicht leichten Koffer mit einem Schwung sich selber auf die Schulter: »Kommen Sie nur, Fräulein Büchner!« Das war keine Zofe, das war die Baronin selber. Hinter der Bahnhofsbude stand das Gefährt; keine Equipage, ein kleiner hochrädriger Feldwagen, Marie-Luise fühlte sich hinaufgeschoben, der Koffer kam ihr nach, schon sass die Baronin vorn auf dem Kutschiersitz — ein Schnalzen mit der Zunge — und schon flogen sie.
Es war alles etwas anders, als Marie-Luise sich vorgestellt hatte, aber als das Erste, das Fremde überwunden war, fand sie es schön auf Althaide. Weite, sehr weite, sorglich bestellte Felder, Waldstriche, leichte Hügel in blauer Ferne, und das Dorf zwischen Wiesen. Einzelne Baumgruppen waren auf diese so schön von der Natur hingestellt, dass sich die ländlichen Wiesen ausnahmen wie gepflegte Rasenflächen in einem Park. Ein grosses Rittergut.
Die Baronin stieg zweimal den Tag zu Pferde, oder sie kutschierte in dem kleinen Wagen, in dem sie die neue Erzieherin abgeholt hatte, stundenlang über die Felder. Es wurde nie gefeiert, und keine Stunde, die nützlicher angewendet werden konnte, mit weniger Nützlichem vertan. Zur Sommerszeit stand die Baronin schon um vier Uhr auf, der Tag fing früh an auf Althaide; wenn das Klappern, das die Leute zur Arbeit rief, auf dem Hof ertönte, hatte sie schon ihr Bad hinter sich und ihr Frühstück. Im enganliegenden Jackett, die Füsse in hohen Reitstulpstiefeln, die Reitgerte unterm Arm und ein dickes Notizbuch in der Hand, erteilte sie den Inspektoren ihre Anweisungen. Die standen vor ihr, den Hut abgezogen, und hörten respektvoll zu. Jeder hatte Respekt; auch Marie-Luise hatte den. In der Tat, die Baronin genoss den Ruf mit Recht: ausgezeichnete Landwirtin, gerechte Herrin, vorzügliche Mutter, und dabei noch eine schöne Frau, elegant von Wuchs und vornehm von Gesicht. An Freiern sollte es ihr seit dem Trauerjahr nicht gefehlt haben, aber sie würde nicht wieder heiraten, sie hielt dem verstorbenen Baron die Treue und verwaltete für sein Kind das, was er hinterlassen hatte, auf das Gewissenhafteste. Eigentlich das Ideal einer Frau, das junge Mädchen hätte für sie schwärmen mögen, aber es war doch etwas da, was ein warm aufwallendes Gefühl immer wieder zurückdrängte. Ob das andern auch so ging?
Den Frauen, die zur Feldarbeit mit hinaus mussten, die erst am Abend Zeit hätten finden können für ihre Kinder, nahm die Gutsherrin die Sorge um diese ab. Sie hatte einen Kinderhort eingerichtet — ein niedliches Häuschen gleich hinter den Stallungen — da wurden die Kleinen am frühen Morgen unter die Obhut der Witwe des früheren herrschaftlichen Försters und von deren ältlicher Tochter getan, die sie bis zum sinkenden Abend betreuten. Und auch die grösseren Kinder fanden, wenn sie aus der Schule kamen, hier am Mittag ihr Essen. Im Winter, wenn die Felder draussen verschneit waren, das Dorf, wie in Watte gewickelt, in lautloser Einsamkeit lag und das Tempo der Arbeit sich verlangsamen musste, hielt die Baronin im Schulraum Leseabende ab für die erwachsene Jugend; sie selber las vor, liess singen und arrangierte sogar auch Aufführungen. Bei einer früheren alten Gouvernante, die die Baronin im Dorf angesiedelt hatte, konnten die Mädchen das Nähen lernen und auch feinere Handarbeiten. Es war alles wohlwollend, praktisch und sorgend durchdacht, und doch, und doch —! Es kam Marie-Luise oft vor, als seien die Leute hier etwas undankbar. Bei den Leseabenden, an denen sie auf Wunsch der Baronin mit der kleinen Konstanze teilnahm, erschien ihr die Jugend wie gelähmt; die Burschen wagten es kaum, sich zu räuspern, die Mädchen sassen wie angefroren. Erst wenn die Baronin gegangen war, wachte Leben auf. Dann hörte Marie-Luise noch lange das helle Lachen der Mädchen auf der Dorfstrasse und die tieferen Stimmen der Burschen. Auf die Schneeballschlacht, die sich da entwickelt hatte, funkelten freundlich die Sterne herab, glitzerten und zuckten, als möchten sie hinunterspringen und mittun. Dann ging Marie-Luise wohl nebenan in das Zimmer der kleinen Konstanze. Sie setzte sich im Dunkeln zu der ans Bett.
Die Hand der Kleinen suchte nach ihrer Hand: »Fanden Sie es nett heute abend, Fräulein?«
»Sehr nett.«
»Ich wäre lieber mit Ihnen zu Hause geblieben.«
»Aber warum? Die Geschichte ist doch schön, die deine Mutter uns vorliest.«
»Ich mag sie nicht. Da sind alle so brav drin. Sind Sie immer so brav gewesen, Fräulein Büchner, als Sie jung waren?«
»Aber, Konni, ich bin doch jetzt auch noch jung!«
»Ach, ich meine ja so jung!« Und Konstanze klatschte sich mit der flachen Hand kräftig auf ihre eigene Brust. »Waren Sie damals denn immer brav?«
»Ich hoffe nicht.« Das konnte sich Marie-Luise nicht enthalten zu sagen. Ja, und nun wusste sie auf einmal, warum die Baronin den Dank nicht genoss, den sie doch verdiente: fröhlich muss man selber dabei sein und so recht lachen können.
Das Lachen unterm Sternenhimmel erklang noch von ferne, Konstanze setzte sich auf im Bett, lauschte und seufzte: »Jetzt sind die so lustig!« Und dann plötzlich beide Arme um den Nacken ihrer Erzieherin schlingend und den Kopf von Marie-Luise fest an sich pressend, flüsterte sie ihr ins Ohr: »Haben Sie mich lieb, Fräulein Büchner? Sehr lieb?!« — — — —
Was aus der kleinen Konstanze, ihrer ersten Schülerin, wohl geworden sein mochte? Marie-Luise hatte nie mehr etwas von ihr gehört. Sie war ja auch nur knapp ein Jahr auf Althaide geblieben. Es war eine dumme Geschichte, derentwegen sie gehen musste.
Die Frau Baronin hatte einen Bruder, der war nach Althaide gekommen. »Ich muss Sie bitten, Fräulein Büchner,« sagte die Baronin vorher, »an kleinen Wunderlichkeiten keinen Anstoss zu nehmen. Da die Verhältnisse, in denen mein Bruder bis jetzt lebte, sich geändert haben, ist es meine Pflicht, ihn zu mir zu nehmen. Er ist ein liebenswürdiger, harmloser Hausgenosse.«
Ja, harmlos war er, das sah man seinem semmelblonden Gesicht mit den wässerigen hellblauen Augen unter der niedrigen Stirn an. Er brachte ein Aquarium mit und einen Kanarienvogel. Für den Frosch, der einsam in dem Aquarium wohnte, fing er Fliegen unten in der Küche an der warmen Herdwand, und von Fifi, seinem gelben Vogel, erzählte er täglich bei Tisch lange Geschichten. Ein Wundervogel.
Konstanze hatte anfänglich laut herausplatzen wollen — war Onkel Egon doch komisch! — Aber ein Blick der Mutter traf sie, so dass ihr Lachen in einem verlegenen Husten erstickte.
»E bissel sehre verrickt,« sagte das Stubenmädchen, und schlug den Herrn Baron, wenn der sie beim Aufräumen seines Zimmers mit kicherndem Lachen kneifen wollte, gehörig auf die Finger: »Hände weg, Sie!« Das Stubenmädchen konnte sich wehren, brauchte keine Rücksicht zu nehmen, für sie, die Erzieherin, war es schwieriger. Und bei dem albernen Geschwätz immer ernsthaft zu bleiben, das war das allerschwierigste. Mehrmals flog der Blick der Baronin bei Tisch aufmerksam zu ihr hinüber, und Marie-Luise dachte: sollte die gemerkt haben, dass es um ihre Mundwinkel verräterisch zuckte? Konstanze war schon ein paarmal unter dem Tisch verschwunden, angeblich um ihre heruntergerutschte Serviette aufzuheben.
Marie-Luise traute sich nicht mehr allein in den Park, denn kaum war der Schnee ein bisschen weggetaut, suchte der Baron auch dort schon nach Fliegen; und durchs ganze Haus strich er so. Marie-Luise verschloss fest ihre Türe, nicht dass sie ihn gefürchtet hätte: was konnte ihr geschehen? — aber es wäre ihr peinlich gewesen, ihn so abfahren lassen zu müssen, wie das Stubenmädchen ihn abfahren liess.
»Mein Bruder ist sehr musikalisch,« hatte die Baronin gesagt. Er war am Klavier auch noch am ehesten zu ertragen; dann guckte er vor sich hin, so versunken auf die Tasten, als läse er aus ihnen etwas heraus. Er spielte alles auswendig, und was er von Melodien gehört hatte, behielt er. Nun bearbeitete er das Harmonium, das bis dahin bei den Morgenandachten, die die Baronin jeden Sonntag mit Choralgesang und Predigtvorlesung für Hausgenossen und Dienerschaft abhielt, sie selber gespielt hatte. Er spielte die Choräle immer ganz richtig. Aber heute, was war denn heute in ihn gefahren —?! Erst zu Beginn der Andacht zwei Verse des ‚Befiehl du deine Wege‘ tadellos, aber nun, nach dem Gebet? Der dritte Vers sollte zum Schluss noch gesungen werden, er fing den auch richtig an, aber jetzt auf einmal — dideldum, dideldum — eine Tanzmelodie! Die hüpfte über die Tasten, widerwillig gab sie das Harmonium her, es widersetzte sich quiekend, die Bässe brummten verwirrt. Aber immer drauflos, immer so weiter. Nun: ‚Fuchs, du hast die Gans gestohlen‘ — dann auf einmal: ‚Grosser Gott, wir loben dich‘ — dann: ‚Ernst, Ernst, was du mir alles lernst‘ — von jedem ein bisschen, alles in einem Tanzrhythmus vereinigt, aber alles doch deutlich zu erkennen.
Es huschte, es zuckte über die Gesichter. Die erst betroffen Dastehenden, dann verlegen Gewordenen, jetzt hielten sie sich kaum mehr. ‚Dideldum, dideldum‘ — Konstanze stopfte sich ihr Taschentuch in den Mund und wand sich wie in Krämpfen.
Marie-Luise hatte tapfer gekämpft — oh, der Narr, der arme Narr! — aber nun blieb auch sie nicht länger mehr ernst.
Nur die Baronin bewahrte Haltung; sie winkte zum Gehen. — — –
Das war für Marie-Luise das Ende in Althaide gewesen.
»Ich werde all Ihren Vorzügen gerecht, ich bin Ihnen auch sehr dankbar, Fräulein Büchner — Konstanze hatte eine grosse Zuneigung für Sie — aber ich sehe ein, es ist besser für dieses leicht abgelenkte Kind, dass es gleich in eine ernsthaftere Schulung kommt. Ich gebe meine Tochter ab 1. April in die altbewährte Erziehungsanstalt, Zum heiligen Kreuze‘.«
Drittes Kapitel
Der Abschied von Althaide war insofern nicht ungelegen gekommen, als Frau Professor Büchner dringend wünschte, ihre Tochter wieder bei sich zu haben. Ihr Kind, das einzige Kind, das ihr geblieben war! Als fielen ihr jetzt auf einmal all ihre Verluste ein, und als trüge sie doppelt schwer an ihnen, so war es. Nein, sie konnte nicht allein bleiben und nicht hier in der kleinen Stadt mit dem engbegrenzten Horizont, nicht bei diesen Menschen, deren Verhältnisse alle, alle glücklicher waren als ihre eigenen!
So war es zur Übersiedelung nach Berlin gekommen. Mathilde Büchner hatte die sorglosesten Tage ihres Lebens und die ihr auch am meisten ‚konformen‘, wie sie sagte, in Berlin gehabt, damals, als sie bei einer Tante und einer gleichaltrigen Cousine dort zu Besuch gewesen war. Nun hoffte sie wieder auf solche Tage. Aber sie vergass, dass die Tante tot war, die Cousine verheiratet und gleich ihr alt geworden, und auch, dass Leute, die einstmals Vermögen hatten, jetzt keines mehr haben. Die Cousine nahm sie trotzdem freundlich auf; sie besass von alledem, was sie einst besessen hatte, nur noch ein Haus in einem westlichen Vorort, ziemlich weit ab, und darin trat sie den Büchners nun eine kleine Wohnung ab.
Die beiden Zimmer waren angenehm, auch geräumig, und schauten aus hellen Fenstern hinab in lauter Gärten. Die Küche teilten sie mit den Glässners, das war weniger angenehm, denn Herr Glässner war abgebaut und stand immer bei seiner Frau in der Küche herum. »Aber, Mutter, du brauchst doch nicht so oft in die Küche, was haben wir denn gross zu kochen,« sagte Marie-Luise. Sie war damit zufrieden, dass für sie ein Schlafsofa im Esszimmer stand, überliess der Mutter gern das andere Zimmer ganz allein. Auch die Entfernung von Berlin kam für sie weiter nicht in Betracht. Vorerst konnte sie sich ja die Stunden, in denen sie hospitierte — bald an einer Schule in Tempelhof, bald in Charlottenburg, bald in Schöneberg, auch am Wedding, oder im äussersten Osten — so wählen, dass sie nicht schon vor sieben Uhr morgens von Hause fort musste. Auch als sie Vorleserin bei einer erblindeten alten Dame geworden war, der sie täglich zwei Zeitungen von der ersten Zeile bis zur letzten — Politik, Roman, Feuilleton, Kunst- und Börsenberichte, Boxkämpfe, Heiratsanzeigen, Todesnachrichten und Ausverkäufe — vorlesen musste, störte ihr weiter Weg sie nicht. Auch dann nicht, als sie zwei Jahre lang bei einem Schriftsteller nach Diktat in die Maschine schrieb.
Jetzt freilich musste sie sehr früh am Morgen zur Fahrt nach Berlin aufbrechen. Aber es war Frühling, wurde dann Sommer — was störte sie in diesem ersten Halbjahr der weite Schulweg? Oh, wie die Vögel anstimmten! Es piepte, es zirpte, es flatterte ohne Scheu dicht vor ihr her; die Amsel bohrte den gelben Schnabel ins Rasenbankett, der Fink schwang sich auf den untersten Zweig der Baumreihe — ein Fliegen, ein Wiegen, ein Hin- und Herwippen. Marie-Luise kannte all diese Vögel kaum, sie hätte auch nicht zu sagen vermocht, wer von ihnen jetzt sang, so vielstimmig war das Konzert. Trillern, Flöten, Locken. Wenn sie nicht gedacht hätte, es könnten jetzt doch Menschen kommen, so hätte sie auch gesungen, oder auch nur einen Ruf ausgestossen, einen einzigen kurzen, hellen Schrei. In ihr war Jubel, noch nie hatte sie sich so jung gefühlt. Ihre Jahre, ah, die drückten sie nicht, sie fühlte sich so frisch, so jung, als hätte sie erst gestern das Examen bestanden. Die Jahre, die danach gekommen waren, die waren jetzt weggewischt, sie stand wieder am Anfang, voller Hoffnungen, voller Pläne, voller Eifer, voller Hingabe an ihren Beruf. Herrgott, was stellte der für Aufgaben! Aber sie fühlte sich jedem Anspruch gewachsen. Und die Kinder hingen an ihr, das fühlte sie auch, und das machte sie glücklich. Ein Gefühl, ein Wunsch, das Herz herauszutun, ihr Innerstes, ihr Bestes ihnen zu geben, überwallte sie. Es waren nicht ihre Kinder, und doch war es einem so natürlich, dass man immer sprach: meine Kinder.
Wie konnte der Rektor nur sagen: »Recht gut, Fräulein Büchner, aber ruhig, ein bisschen ruhiger. Sie treiben sonst Raubbau mit Ihren Kräften« –? Und wie komisch von Fräulein Ebertz, der Kollegin, die nebenan die Parallelklasse hatte, zu ihr zu sagen: » So ein Unterrichten, wie Sie es tun, das hält keine aus. Die Ernst, die Sie jetzt vertreten, die machte es auch so wie Sie — und was hat sie davon? Kinder sind ja undankbar, die haben sie gleich vergessen. Nun ist sie erst mal für ein Jahr beurlaubt — nein, nein, Fräulein Büchner, erschrecken Sie nicht« — Marie-Luise musste eine unwillkürliche Bewegung gemacht haben — »die werden Sie noch lange vertreten können, die kann nicht mehr!«
»Was fehlt ihr denn eigentlich?« hatte Marie-Luise kleinlaut gefragt; sie kam sich sehr egoistisch, ganz schlecht vor, dass ihr bei dem Gedanken, dass Fräulein Ernst bald wiederkommen könnte, alles Blut vom Herzen wich und zu Kopf stieg.
»Was ihr fehlt? Na, was uns allen mehr oder weniger fehlt: die guten Nerven. Bei ihr kam’s nur etwas früh. Ich bin schon fünfunddreissig Jahre im Amt, und, Gott sei Dank, bei mir geht’s noch immer, weil ich’s ruhiger nehme. Ich unterrichte noch so ziemlich nach der alten Methode. Wenn ich ein Gedicht aufsagen lasse, sagt es erst eine auf, und dann die andere — alle der Reihe nach — ich verteile keine Rollen wie auf dem Theater. Dann gibt’s auch kein Hallo und keine Unruhe. Sie sind auch so neumodisch — Gedicht aufsagen mit Gesten, mit Hüpfen und Herumtanzen womöglich, Gott bewahr mich! Da zieht man nur schlechte Schauspieler heran. Na, Sie werden ja auch schon noch klug werden. Und wie die Ernst sich aufregte, wenn mal ein Kind einem andern ein Bildchen wegnahm oder ein Zopfband! Lieber Gott, so was kommt eben vor, es sind doch noch unvernünftige Kinder. Und wenn ein unverschämter Kerl von Vater oder eine dämliche Mutter kam und sich beklagte, ihrer Ilse, Hilde oder Annemarie wäre Unrecht geschehen, denn die lögen niemals, was meinen Sie wohl, was die Ernst sich dann auf lange Auseinandersetzungen einliess! Zuletzt war sie so fertig, dass sie mitten in der Stunde anfing zu weinen. Bei mir kommt keiner ran, ich schliesse einfach meine Klassentür zu, bin nicht zu sprechen.«
Diese Kollegin war Marie-Luise nicht sehr sympathisch. Aber das schien nicht gegenseitig der Fall zu sein. Fräulein Ebertz legte der jungen Kollegin die Hand auf die Schulter, in ihr ältliches, sehr alltägliches Gesicht mit der straff zurückgekämmten unkleidsamen Frisur kam ein freundliches, es plötzlich viel angenehmer machendes Lächeln: »Sie müssen es mir nicht übelnehmen, Fräulein Büchner, nicht denken: was geht die das an? Fünfunddreissig Jahre sind lang, ich habe schon manch eine kommen sehen, aber auch manch eine gehen. Es tut mir direkt leid um Sie, wenn ich Sie morgens so anhetzen sehe in der letzten Minute, oder wenn Sie mittags bei der Hitze sich in die Elektrische quetschen und die weite Fahrt — mein Gott, was für ’n Ende! — bis nach Hause fahren. Ziehen Sie nach Berlin, näher zur Schule, ich meine es gut mit Ihnen.«
Was, in die Stadt ziehen, dazu noch näher zur Schule?! In eine dieser Strassen des Ostens, die nur zu ertragen war, wenn man nicht in ihr wohnte! Marie-Luise lachte fast, wenn sie am Morgen ihren Weg zur Bahn machte und zufällig ein Gedanke sich zu Fräulein Ebertz verirrte. Was wusste die von Vogelgesang, von Frühlingsgrün, von der Natur überhaupt und von Frische?! Eine gutmütige Seele und auch gar nicht dumm, aber doch schon recht verschrumpft, eingetrocknet in ihrem Beruf, mechanisch darin geworden, eine Maschine.
Fräulein Ebertz hatte die Aufnahmeklasse, die Kleinen im ersten Jahr. Die gab sie dann weiter und bekam wiederum die Kleinen im ersten Jahr. Und so immer dasselbe, immer die ersten Anfänge, immer wieder diese kleinen Geschöpfe, die noch vor dem Abc erst einmal lernen mussten, dass man nicht aus der Bank herauslaufen und nach Hause gehn darf, wenn man keine Lust mehr hat, in der Schule zu bleiben, dass man aufpassen muss, wenn die Lehrerin spricht, dass man die Nachbarin nicht heimlich zwicken darf und sich auch nicht in der Nase bohren.
Marie-Luise lächelte in sich hinein: ja, es war manches recht komisch. Diese Anfänge hatte sie ja auch durchgemacht, hatte sich auf die Lippen beissen müssen, um nicht laut herauszulachen, wenn die kleine Irma mit den Rattenschwänzchen erzählte: »Mein Vati is Frisör, der ondoliert mir an ’n Sonntag.« Lieber Gott, die paar Härchen! Verlegenes kam im Anfang auch genug vor, da hatte manchmal eine Kleine zu spät angesagt: »Fräulein, ich muss mal austreten.« Nun, so etwas hatte sie ja jetzt bereits hinter sich; sie würde die Aufnahmeklasse auch nicht lange behalten, nächsten Ostern ging sie mit ihren Kindern weiter, stieg mit ihnen in die folgende Klasse hinauf, das hatte ihr der Rektor zugesagt. Aber Fräulein Ebertz — o Gott, wenn sie denken sollte, immer und immer nur die ersten Anfänge! Aber die wollte nichts anderes; es war deren Spezialität, die ganz Kleinen — eine Domäne, die sie gepachtet hatte. Fünfunddreissig Jahre nur Aufnahmeklasse –?!
War es die feuchte Kühle eines Sommermorgens nach einer Eewitternacht, die schon an den Herbst gemahnte und die Marie-Luise heute leicht erschauern machte? Sie nahm die Kühle mit sich fort in die Stadt und behielt sie selbst während des Unterrichts, obgleich die Bänke alle vollbesetzt waren und die Luft, die die Klasse vom eingebauten Hof her empfing, durchaus nicht frisch war. Es steckte Schwüle in dieser Luft. Marie-Luise hatte heute keinen guten Tag, das fühlte sie bald, ohne zu wissen warum, und es ärgerte sie. Sie konnte und konnte ihre gewöhnliche herzhafte Munterkeit heute nicht finden, obgleich sie sich bemühte. Und es war, als ob die Klasse dies spürte. Die kleinen blonden, braunen und schwarzen Köpfe hingen schläfrig, bald gähnte dieses Kind, bald jenes, die Antworten kamen langsam; kein Durcheinanderrufen, kein lebhaftes Fingerheben, lahmgelegt schien das Interesse. Wie, war die Klasse denn so sehr der Spiegel des Lehrers? Marie-Luise entdeckte fast mit Erschrecken, wie sehr selbst schon diese kleinen Kinder hier die Verfassung des Lehrenden abspiegelten. Sie riss sich zusammen und gab sich einen Ruck. Und siehe, es gelang. Jetzt hatte sie die kleinen Geister wieder gefesselt und hielt sie fest in der Hand.
Beim Naheliegenden hatte sie angeknüpft: »Wisst ihr denn, Kinder, warum wir heute alle ein bisschen müde sind?«
»Weil gestern Sonntag war,« sagte die Schindler.
»Wieso? Das verstehe ich nicht, da müssten wir doch gerade recht ausgeruht sein.«
»Wir haben schön ausgeschlafen,« riefen ein paar.
»Na, siehst du, Trude, deine Antwort ist falsch.«
»Nee, Fräulein,« Trude Schindler blieb dabei, »die is nich falsch. Sonnabends is Auszahlung, denn macht Vater ooch an’n Sonntag noch blau, und denn gibt’s immer Krach. Ich hab garnich schlafen können.«
Ach Gott, dieses Kind! Marie-Luise erschrak. Was die schon miterlebte! Für dieses naseweise Ding mit der grossen nickenden Haarschleife, thronend auf einem Strubelkopf, das ihr unsympathisch gewesen, fühlte sie jetzt plötzlich Mitleid. »Na, Trudchen, dann leg dich ein bisschen hin und schlaf dich aus. Kind, du kannst nach Hause gehen, jetzt schon.« Sie erwartete, dass die Schindler froh aufspringen würde, aber die schüttelte verneinend den Kopf, im ganzen Körper Abwehr: »Nee, ich will nich nach Haus!« Und blieb.
Fürchtete sich das Kind, nach Hause zu gehen? In die Klasse senkte sich plötzlich ein Schatten. Vom Hof stieg er herauf, von jenen hohen Hauswänden herab, die den umdüsterten, und kam durch die Fenster hereingekrochen. Nicht nur auf der kleinen Schindler blasses, übermüdetes Gesicht schien sich der Schatten zu legen, er breitete sich auch auf die anderen Kindermit aus, auf die blonden, braunen und schwarzen Köpfchen, auf das Lenchen, die Irma, die Gerda und Senta, auf Hilde, Ilse und Erika, auf Hete und Magda und Lieschen auf all die kleinen Gestalten. Ach, Kinder der Riesenstadt, Kinder in deren übervölkertem Osten! Kinder des Proletariats, die keine behütende Hand zur Schule geleiten kann — Vater muss in die Fabrik, Mutter auf ihre Waschstelle — Kinder, die allein über die Strasse müssen, aus deren Pflaster etwas heraufsteigt, von deren Anschlagsäulen etwas herabsteigt, was verhüllt oder nicht verhüllt, Neugier und Begierden erweckt, die besser nicht erweckt werden würden! Kinder, nach denen aus Eckdestillen, aus dunklen Kellerhöhlen, aus finstern Torfluren eine schmutzige Hand sich reckt! Und schwer die Luft von Gerüchen; es ist nichts zu Bestimmendes, nach was es hier riecht, nicht nach Blut aus Schlächterläden, nicht nach Fauligem von Obstkarren, nicht nach den Müllkästen der engen Höfe. Nach all dem dünstet es nicht hier. Und doch nach was so schwer, so unangenehm?!
Marie-Luise hatte sich nie klar gemacht, warum die Luft hier so drückte. Oh, wieviel leichter war es für die Kinder, unschuldige Kinder zu bleiben, die in anderen, lichteren Strassen wohnten! ‚Arme Trude Schindler‘, dachte die junge Lehrerin, ‚erst sieben Jahr und schon so bewusst dessen, was um sie ist!‘ Sie ging hin und legte der müde in ihrer Bank Kauernden die Hand auf den Strubelkopf. Sie zupfte die grosse Haarschleife zurecht, die nur gross tat, die aber so verfleckt war und so zerknüllt, als sei sie seit Tagen nicht frisch gebunden worden. Und wie sah das Haar aus! Natürlich ein Bubenkopf, aber, schlecht geschnitten, zur verwilderten Mähne geworden. ‚Kämmt dich deine Mutter nie — kannst du dich denn selber noch nicht kämmen?‘ Das hätte Marie-Luise fragen mögen, aber sie fürchtete das Kind dadurch zu demütigen. Sie hatte den Wunsch, dieses Kind, ja gerade dieses, vertraulich an sich heranzuziehen. Es würde nicht leicht sein. Trude Schindler sass verdrossen, und so, als fühle sie die über ihr Haar und dann über ihr Gesicht streichende Hand nicht.
Marie-Luise hatte geglaubt das Bewusstsein einer grossen Aufgabe schon längst zu haben, ihre Pflichten, ihre Verantwortlichkeiten ganz genau zu kennen und den Ansprüchen, die ihr Beruf stellt, gerecht werden zu können mit Leichtigkeit — aber wirklich gerecht werden, oh, konnte man das überhaupt?
‚Der Lehrer soll den Schüler zu einem konkreten Idealismus erziehen,‘ das hatte sie in einem pädagogischen Buch gelesen, ‚soll ihn erziehen zu allem Guten, Wahren, Schönen und Heiligen‘ — oh, du lieber Gott, wie macht man denn das?!