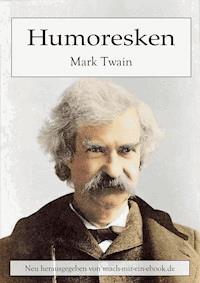17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
»Dieser Twain ist unverschämt modern .« The New York Times Er ist eine der berühmtesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, seit über 100 Jahren tot – und erreicht uns wie ein Zeitgenosse: Twain spricht direkt mit uns und flüstert uns bei diesem Schlussakkord seiner Jahrhundertautobiographie die letzten Geheimnisse seines wechselvollen Lebens ins Ohr. Äußerlich wurden Twain im Laufe seines Lebens alle Ehrungen zuteil, im Inneren überwog zuletzt die Trauer über all die Verluste und Vertrauensbrüche. War die 30 Jahre jüngere Sekretärin Isabel Lyon seine Geliebte, wie gemunkelt wurde, oder eine Intrigantin, die ihn ausnehmen wollte? In seinen vielleicht schwersten Momenten zeigt er sich wütend, ungerecht – und als ein Mensch, der einem über ein Jahrhundert hinweg nahe ist. Man möchte ihm in seiner Einsamkeit beistehen, und er nimmt den Dialog an. Dabei stellt sich heraus, wie nötig und aktuell Twain ist – und das nicht nur, wenn er vorführt, wie man einem außer Kontrolle geratenen US-Präsidenten die Stirn bietet. Mark Twain, der vertraute Freund, hat sich endgültig und für alle Zeiten unsterblich gemacht. »So reich, so erstaunlich.« FAZ »Das Gefühl, das am Ende bleibt: einem höchst aufrichtigen und sympathischen, einem animierenden und kämpferischen Geist begegnet zu sein.« DIE ZEIT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1885
Ähnliche
Über Mark Twain
Mark Twain wurde am 30.11.1835 in Florida (Missouri) geboren. Sein eigentlicher Name ist Samuel Langhorne Clemens. Der Vater starb 1847, und Twain musste im Alter von zwölf Jahren die Schule abbrechen und begann eine Lehre als Schriftsetzer. Mit 17 Jahren ging er nach New York, dann nach Philadelphia, wo er die ersten Reiseskizzen schrieb.Von 1857 bis 1860 war er Lotse auf dem Mississippi, nahm am Sezessionskrieg auf der Seite der Konföderierten teil und war 1861 Silbersucher in Nevada. 1864 lebte er in San Francisco, 1866 als Reporter auf Hawaii und 1867 als Reisender in Europa und Palästina. Er gründete einen Verlag, musste aber 1894 Konkurs anmelden und ging auf Weltreise, um mit Vorträgen seine Schulden abzutragen. Mark Twain starb am 21.4.1910 in Redding (Connecticut).
Hans-Christian Oeser, geb. 1950 in Wiesbaden, freier literarischer Übersetzer, Herausgeber, Reisebuchautor, Publizist, Redakteur, Korrektor und Sprecher. Studium der Germanistik, Politologie, Philosophie und Pädagogik in Marburg sowie Berlin, heute lebt und arbeitet er in Berlin und Dublin.
Andreas Mahler ist Professor an der Freien Universität Berlin am Institut für Englische Philologie/Literaturwissenschaft.
Informationen zum Buch
»Dieser Twain ist unverschämt modern.« The New York Times
Er ist eine der berühmtesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, seit über 100 Jahren tot – und erreicht uns wie ein Zeitgenosse: Twain spricht direkt mit uns und flüstert uns bei diesem Schlussakkord seiner Jahrhundertautobiographie die letzten Geheimnisse seines wechselvollen Lebens ins Ohr.
Äußerlich wurden Twain im Laufe seines Lebens alle Ehrungen zuteil, im Inneren überwog zuletzt die Trauer über all die Verluste und Vertrauensbrüche. War die 30 Jahre jüngere Sekretärin Isabel Lyon seine Geliebte, wie gemunkelt wurde, oder eine Intrigantin, die ihn ausnehmen wollte? In seinen vielleicht schwersten Momenten zeigt er sich wütend, ungerecht – und als ein Mensch, der einem über ein Jahrhundert hinweg nahe ist. Man möchte ihm in seiner Einsamkeit beistehen, und er nimmt den Dialog an. Dabei stellt sich heraus, wie nötig und aktuell Twain ist – und das nicht nur, wenn er vorführt, wie man einem außer Kontrolle geratenen US-Präsidenten die Stirn bietet. Mark Twain, der vertraute Freund, hat sich endgültig und für alle Zeiten unsterblich gemacht.
»So reich, so erstaunlich.« FAZ
»Das Gefühl, das am Ende bleibt: einem höchst aufrichtigen und sympathischen, einem animierenden und kämpferischen Geist begegnet zu sein.« DIE ZEIT
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Mark Twain auf der SS Minneapolis vor der Überfahrt nach England, 8. Juni 1907
Mark Twain
Die Nachricht von meinem Tod ist stark übertrieben
Meine letzten Geheimnisse
Herausgegeben von Benjamin Griffin und Harriet Elinor Smith
unter Mitarbeit von Victor Fischer, Michael B. Frank, Amanda Gagel, Sharon K. Goetz, Leslie Diane Myrick und Christopher M. Ohge
Aus dem amerikanischen Englisch von Hans-Christian Oeser
Vorbemerkung
Mit diesem Band liegt die autorisierte Autobiographie Mark Twains erstmals vollständig auf Deutsch vor. Kaum zu glauben, dass man fast ein ganzes Jahrhundert lang auf ein derart bedeutendes Hauptwerk dieses einzigartigen Schriftstellers, Humoristen und Moralisten warten musste, der zu Recht zu den berühmtesten Persönlichkeiten der Weltgeschichte gehört.
Twain wurden im Laufe seines Lebens alle erdenklichen äußeren Ehrungen zuteil. Im Inneren allerdings überwog zuletzt die Trauer über all die erlittenen menschlichen Verluste und über schmerzliche Vertrauensbrüche. Bisweilen wütend und ungerecht, erhielt er sich dennoch auch in diesem letzten großen Werk seinen ureigenen Humor. Ja, hier zeigt er sich stets als ein Mensch, wie man ihn jederzeit gern zum Freund hätte, denn es gelingt ihm, uns Heutige direkt und persönlich anzusprechen.
Besonders ein Thema verdeutlicht seine erstaunliche Aktualität: Twain kommentiert bitterböse die Amtszeit von US-Präsident Theodore Roosevelt, wobei sich ebenso verblüffende wie erschreckende Parallelen zu den neuesten Entwicklungen in der Welt auftun, in der wir heute leben. Twains Beobachtungen klingen geradezu wie eine prophetische Beschreibung gegenwärtiger Zustände. Auch wenn uns nach der Wahl eines Donald Trump jedes befreiende Lachen im Halse steckenbleibt – haben wir bislang geglaubt, solche Gestalt sei singulär, mithin ein geschichtlicher Ausrutscher, belehrt uns Twain jetzt genüsslich eines Besseren.
Vor allem führt er mit der ihm eigenen satirischen Kunstfertigkeit vor, wie man mit unbestechlichem Blick und kritischem Urteil den Kaiser als so nackt erkennt, wie er es nun einmal ist. Twain schaut so genau hin, dass er die Verkettung von grundlegenden charakterlichen Defekten eines Egomanen, der Anfälligkeit des Wahlvolks für Populismus und der skrupellosen Manipulation durch eine politische Partei als die Tragödie erkennen lässt, die sie schon vor 100 Jahren war. Und ganz nebenbei schafft er so ein Musterbeispiel dafür, wie man, unbeirrt von politischer Propaganda, von Manipulationsversuchen und von Angriffen auf die Freiheit des Denkens, jenen Prinzipien treu bleiben kann, die einem die Menschlichkeit und der gesunde Menschenverstand aufgeben. Dass ihm dies in einer Weise gelingt, die ein Jahrhundert später noch nichts von ihrer Frische, ihrem (zuweilen bösen) Witz und ihrer Wärme verloren hat, macht ihn allerdings einzigartig.
Nur Mark Twain dürfen wir in solch absolut erstaunlicher Weise als unseren zu früh geborenen Zeitgenossen erkennen, dessen Gedanken die wichtigsten und schwerwiegendsten Fragen unserer Tage erhellen und der auf seine unverwechselbare Art neue Sichtweisen beizusteuern vermag, die uns trösten, erheitern und aufrütteln. Mark Twain tut not – zum Glück ist er nun da, um zu bleiben.
Nele Holdack
November 2017
Inhalt
Mark Twains Autobiographie[Autobiographische Diktate März 1907 – Dezember 1909]
Anhang
Das Ashcroft-Lyon-Manuskript
Verzeichnis der behandelten Gegenstände
Personenregister
Register der Länder und Orte
Werkregister
Bildnachweis
Mark Twains Autobiographie
Diktiert am 1.März 1907
Erinnerungen an die Familie Beecher – Miss Clara Clemens singt in North Attleboro, Massachusetts, einem Ort, der für die Herstellung von Billigschmuck bekannt ist – Anekdote vom Staubwedelmann, wie Professor Sloane sie Mr. Clemens erzählt hat
Isabella Beecher Hooker ist tot. Ihre Bekanntschaft machte ich vor etwa vierzig Jahren; sie und ihre Schwester Harriet Beecher Stowe waren in Hartford achtzehn Jahre lang unsere Nachbarn. Ich glaube, ich kannte die ganze Horde der Beecher-Brüder und -Schwestern. Die Männer waren allesamt Prediger und zu ihrer Zeit allesamt mehr oder weniger berühmt. Reverend Henry Ward, Reverend Thomas K., Reverend Charles und Reverend James kannte ich sogar sehr gut; sie alle gelten als vortreffliche Männer, aber natürlich war keiner von ihnen so vortrefflich oder international so bekannt wie Henry Ward, der Erste unter den amerikanischen Kanzelrednern. Sie alle sind tot. Unter ihnen, den Brüdern und Schwestern, gab es nicht einen unbegabten Beecher und nicht einen, der sich keinen ansehnlichen Namen gemacht hätte.
Inzwischen aber ist alles Talent der Beechers dahin; seine letzte Konzentration verließ die Welt mit Isabella Beecher Hooker. Mit Reverend Thomas K.Beecher war ich lange Zeit aufs engste vertraut. In jungem Mannesalter kam er, theologisch noch ein Grünschnabel, von Connecticut nach Elmira, um die Leitung einer kongregationalistischen Kirche zu übernehmen, deren finanzielle Hauptstütze Jervis Langdon, mein zukünftiger Schwiegervater, war, und hatte dieses Amt inne, bis er vor einiger Zeit im Alter von vierundsiebzig Jahren starb. Er war in den Naturwissenschaften sehr bewandert, und seine Kanzelberedsamkeit blieb nur wenig hinter der seines bedeutenden Bruders Henry Ward zurück. Er hatte einen scharfen Intellekt, war glänzend im Gespräch und stets fesselnd – außer wenn es um Theologie ging. Er verfügte über keine eigene Theologie, jedenfalls nicht mehr als jeder andere Mensch auch; zwar besaß er Theologie im Überfluss, doch bezog er sie aus zweiter Hand. Es hätte ihn geängstigt, seinen Gegenstand mit dem ihm eigenen ausgezeichneten Verstand zu prüfen, denn dann hätten ihm beunruhigende Zweifel kommen können. Er war ein sehr freimütiger, geradliniger Mann, und einmal teilte er mir in den klarsten Worten mit, er sei, als er aus Connecticut kam, um die Seelsorge in der Kirche von Elmira zu übernehmen, ein eifriger und entschiedener Ungläubiger gewesen. Das erstaunte mich. Noch mehr erstaunte mich, was er dann sagte: So wie er erzogen worden sei, sei er sich bewusst gewesen, niemals glücklich oder mit sich im Reinen und frei von Ängsten sein zu können, solange er nicht zum Glauben fände, und jenes Hirtenamt habe er ohne alle Gewissensbisse angenommen, da er beschlossen habe, sich zu zwingen, ein gläubiger Mensch zu werden, koste es, was es wolle. Das schien eine sonderbare Äußerung zu sein, aber er tat sie. Außerdem sagte er, binnen einer Frist von ein oder zwei Jahren habe er sein außergewöhnliches Vorhaben vollständig verwirklicht; seitdem sei er ebenso gründlich und vollkommen gläubig wie jeder andere Christenmensch, der auf Erden wandele. Er war einer der besten Männer, die ich je gekannt habe; und er war einer der besten Staatsbürger, die ich je gekannt habe. Bis zum Ende seiner Tage schaute jeder in der Stadt, ob Sünder oder Heiliger, zu ihm auf als einem Mann, dessen Urteil in Angelegenheiten, die die Wohlfahrt der Stadt betrafen, besser und vernünftiger war als das Urteil aller anderen und dessen Lauterkeit und Integrität unangreifbar blieben. Von der gesamten Bürgerschaft wurde er geliebt und verehrt.
Isabella Beecher Hooker stürzte sich vor rund sechzig Jahren als eine der Ersten in die Frauenbewegung, und für den Rest ihres Lebens mühte sie sich mit ihrer phantastischen Energie für diese großartige Sache ab; als fähige und tüchtige Arbeiterin rangiert sie gleich hinter den großen Anführerinnen Susan B.Anthony, Elizabeth Cady Stanton und Mrs. Livermore. Als diese beeindruckenden Schwestern 1848 auf den Plan traten, war eine Frau das, was sie schon immer in allen Ländern und allen Religionen, in allen Barbareien und allen Zivilisationen gewesen war – eine Sklavin, die verachtet wurde. Die betreffenden Vorschriften waren eine Schande für unser Gesetzbuch. Jahr für Jahr bestürmten diese mutigen Frauen die gesetzgebenden Körperschaften des Landes, erduldeten und erlitten jede Art von Vorwurf, Tadel, Hohn und Verleumdung und kapitulierten doch nie, bliesen nie zum Rückzug; ihre wundervolle Kampagne dauerte viele Jahre und ist die wundervollste Kampagne der Geschichte, denn sie brachte eine Revolution zuwege – in der Menschheitsgeschichte die einzige Revolution für die Gleichberechtigung einer halben Nation, die nicht einen Tropfen Blut gekostet hat. Sie zerbrachen die Ketten ihres Geschlechts und befreiten es.
Clara singt in Neuengland. Ich habe einen Brief des Managements aus North Attleboro, Massachusetts, erhalten, in dem ich ganz unbekümmert – um nicht zu sagen: gebieterisch – aufgefordert werde, zu erscheinen und Clara ihrem Publikum anzukündigen, natürlich gratis. Das muss wohl die Idee der Inspizienten sein, denn nach meinen Konditionen hat man mich nicht gefragt; aber vielleicht ist es auch nur ein Versehen, und so habe ich denn die Konditionen mitgeteilt – fünftausend Dollar –, doch höre ich seitdem nichts mehr von diesen Leuten, obwohl sie volle drei Tage Zeit hatten, sich auf mein Angebot zu stürzen. Vielleicht wollen sie mich ja doch nicht haben; mir ist es gleich; ich möchte sowieso nicht hinfahren. Allerdings hat mir der Brief aus North Attleboro diese Stadt nach zwanzig oder fünfundzwanzig Jahren wieder in Erinnerung gerufen, nachdem sie, soweit ich mich entsinne, während dieser ausgedehnten Zeitspanne nie durch mein Gedächtnisfeld gehuscht ist.
Damals, am fernen Rand jenes ungeheuren Zeitraums, führte ich eines Tages mit Professor William M.Sloane, seinerzeit in Princeton, jetzt an der Columbia University, ein Gespräch über North Attleboro. Er erzählte mir, North Attleboro sei ein ganz besonderer Ort: Es sei das Zentrum eines einzigartigen Wirtschaftszweigs – eines Wirtschaftszweigs, der sich in den Vereinigten Staaten nirgendwo sonst finde und dessen Aufgabe es sei, unsere Nation mit billigem, wertlosem Schmuck zu versorgen – Schmuck von verführerischem, ja protzigem Aussehen, Schmuck, der aus fiktivem Gold und echtem Glas gefertigt sei und offen als Imitat verkauft werde. Er sagte, die Schmuckfabriken seien groß und zahlreich und beschäftigten Hunderte und Aberhunderte Mädchen, Jungen und Männer – genau genommen den Großteil der Gemeinde; er sagte, in der Stadt New York gebe es ein riesiges Lagerhaus, das vom Dach bis in den Keller mit diesem Schmuck angefüllt sei, und von diesem Gebäude aus werde das Produkt in jeden Staat der Union geliefert, und zwar in wahrhaft erstaunlichen Mengen. Dann erzählte er mir folgende wunderliche Geschichte.
Als er eines Tages an dem New Yorker Gebäude vorbeikam, ging er aus Neugier hinein, um zu sehen, was es dort zu sehen gäbe. Er fand viele in Vitrinen ausgestellte Schmuckstücke; auf jedem Päckchen lag ein Muster des Inhalts, daneben in Zahlen der Preis. Es war ein garstiger Märztag – schlammig, matschig, dunstig, neblig, verregnet; so richtig nasskalt. In dem Moment trat, demütig und mit hängenden Schultern, ein Mann von ungefähr vierzig Jahren mit traurigem Gesicht ein, offenkundig ein Vagabund. Seine abgetragenen Schuhe waren zerfleddert und von Schneematsch durchnässt; sein Hut ein verbeultes, unförmiges Ding mit schlaffer Krempe; seine übrige Kleidung armselig, fadenscheinig und geflickt; insgesamt bot er einen jämmerlichen Anblick. Unter seinem linken Arm trug er vier Staubwedel der gewöhnlichsten und billigsten Art. Schüchtern ging er auf die Vitrine zu, neben der Sloane stand, und zeigte auf ein mit $ 7,00 ausgepreistes Päckchen – aber er zeigte nur, er sagte nichts. Der Verkäufer holte es hervor und reichte es ihm wortlos; der Vagabund steckte es in seine Tasche und gab ihm die sieben Dollar, noch immer ohne etwas zu sagen; dann ging er, demütig und mit hängenden Schultern, zur Tür und verschwand. Für Sloane war es eine große Überraschung, eine solche Kreatur Geschäfte tätigen, und nicht nur tätigen, sondern mit Bargeld abwickeln, und nicht nur mit Bargeld, sondern mit Bargeld in Höhe von sieben Dollar abwickeln zu sehen. Sloanes Interesse war geweckt, und er sagte zu dem Verkäufer:
»Sie wirken gar nicht überrascht. Kennen Sie diesen Vagabunden? Haben Sie ihn schon einmal gesehen?«
»Aber ja«, sagte der Angestellte, »wir kennen ihn; er wird Staubwedelmann genannt; er ist hier Stammkunde.«
»Erzählen Sie mir von ihm, ja?«
Aber der Angestellte durfte nicht. Er sagte, damit würde er einen Vertrauensbruch begehen; der Staubwedelmann wolle nicht erkannt werden.
Ich vermag mich heute nicht mehr daran zu erinnern, mit welcher List Sloane den Mann wenig später aufspürte, sein Vertrauen gewann und ihm seine Geschichte entlockte, doch an die Geschichte selbst, wie der Mann sie Sloane erzählte, kann ich mich noch gut erinnern. Sie ging etwa so:
Die Geschichte des Mannes
Ich bin kein Vagabund, sondern ziehe mich nur zu Geschäftszwecken so an. In meinem Beruf verdiene ich gut und sicher meinen Lebensunterhalt; ich besitze Grund und Boden, und auf meinem Bankkonto ist immer ein Habensaldo. Mein Geschäft wird von keiner anderen Person im Land auf genau die gleiche Weise betrieben; ich habe es selbst erdacht; ich habe es an den Menschen ausprobiert; ich habe es revidiert, korrigiert, optimiert und schließlich perfektioniert; und jetzt ändere ich daran nichts mehr, denn es bedarf keiner Veränderung. Ich verkaufe Talmischmuck und nichts als Talmischmuck; in nah und fern gehe ich damit hausieren, manchmal westlich bis nach Ohio und südlich bis zum Golf von Mexiko; anfangs reiste ich mit vielerlei Art Schmuck, um den Anforderungen aller Geschmäcker zu genügen, aber nach Maßgabe meiner Erfahrungen sonderte ich nach und nach erst die eine und dann die andere Art aus, bis mein Plan zuletzt perfekt und nicht mehr verbesserungsfähig war und meine Vorräte sich auf nur noch zwei Artikel beschränkten – zwei, nicht mehr; seitdem gehe ich nie mit anderen als diesen beiden hausieren – Verlobungsringe und Eheringe. Dieser Markt flaut nie ab; die Leute hören nie auf, sich zu verloben, und sie hören nie auf zu heiraten. Es ist ein Gewerbe wie das des Bestattungsunternehmers – sicher und stetig, ohne Fluktuationen in guten oder schlechten Zeiten, die Nachfrage bleibt immer konstant.
Sloane unterbrach ihn mit den Worten:
»Aber vergessen Sie nicht die Staubwedel?«
Nein, sagte der Mann, das ist nur ein Vorwand. Ich trage sie immer mit mir herum; ich biete sie stets an, dränge sie aber niemandem auf, denn ich will nicht, dass jemand sie kauft; hin und wieder kann ich es nicht verhindern; jemand kauft einen Staubwedel, und ich muss mich damit abfinden, aber es ist lästig, denn dann muss ich mir an seiner Stelle einen anderen kommen lassen. Der Staubwedel bietet mir guten Schutz. Ein Vagabund ist schlicht und einfach ein Ärgernis, er betreibt sein Gewerbe durchweg in einer von Vorurteilen und Abneigung erfüllten Atmosphäre, während einem zerlumpten und hungrigen armen Kerl, der etwas zu verkaufen hat und offenbar sein Bestes tut, sich sein Brot redlich zu verdienen, alle Welt gewogen ist. Diese Staubwedel bieten mir einen nicht zu überschätzenden Schutz; sie halten Vorurteile ab, so wie ein Regenschirm Regen abhält; niemand empfängt mich jemals unsanft.
Die Geschichte des Staubwedelmannes wird fortgesetzt. Er erzählt, wie er in Eheringe Herzen mit Pfeilen und Initialen eingraviert
Ich hatte ein Gewerbe – Gravuren auf Silberschmiedearbeiten –, doch verschaffte es mir nur einen dürftigen Lebensunterhalt, und vor zehn Jahren gab ich es auf, um mich im Handel zu versuchen, denn ich glaubte ein Talent für den Handel zu haben. Von jenem bis zum heutigen Tag bin ich auf Erden gewandelt und habe die Bauern und Dorfbewohner unseres Landes mit Schmuck aus North Attleboro beliefert. Sie haben beobachtet, dass ich zwölf Dutzend sehr gut aussehende Eheringe kaufte – sagen wir, etwa fünf Cent das Stück; sie haben ein gutes Gewicht, sie haben Würde, sie sind hübsch, und sie haben ein überzeugendes 24-Karat-Aussehen; wären sie aus Gold, wären sie im Einzelhandel zehn Dollar das Stück wert. Zunächst einmal nehme ich sie mit nach Hause und graviere auf die Innenseite zwei Paar Initialen, dazwischen zwei von einem Pfeil verbundene Herzen. Diese Herzen sind bezaubernd. Ich habe andere Motive ausprobiert, doch für das Geschäft auf dem Lande, wo das Gefühl regiert und zu Hause ist, sind Herzen genauso viel wert wie alle anderen inneren Organe eines Menschen zusammengenommen, Lungen und all das, durchbohrt von einem Pfeil, wissen Sie; man würde meinen, von einer Gabel durchbohrte Herzen liefen auf das Gleiche hinaus, tun sie aber nicht; der Handel wäre sofort zum Teufel. Das beweist die Macht des Gefühls; es beweist, wie die Menschen draußen auf dem Lande nun einmal sind – und mittlerweile weiß ich alles über sie; bei meinen Kunden mache ich keine Fehler.
In die Eheringe graviere ich immer Herzen mit Pfeilen, und zu beiden Seiten füge ich Initialen hinzu; alle Initialen taugen dazu; wenn ich wollte, könnte ich immer dieselben verwenden; Sie werden gleich sehen – dem Geschäft schadet das in keiner Weise. Was die Initialen betrifft, so wechsele ich zwar hin und her, aber nur, um mich nicht zu langweilen, notwendig ist es nicht. Sie haben bemerkt, dass ich diesmal nur zwölf Dutzend gekauft habe; das liegt daran, dass ich einige Wochen in New York bleiben werde, bis ich, sobald der April kommt und der Sonnenschein, bereit bin, gen Süden aufzubrechen; dann werde ich große Vorräte angelegt haben und zwei Monate unterwegs sein. Sie haben mich keine Verlobungsringe kaufen sehen. Das liegt daran, dass ich zu Hause ein, zwei Eimervoll habe. Kauft man mehrere tausend auf einmal, gibt es ordentlich Rabatt, das lohnt sich. Jeder Verlobungsring hat einen kleinen Glasdiamanten, ist ein sehr hübsches Ding und fesselt das Auge junger Leute, die kurz vor der Eheschließung stehen. Wenn der Ring echt wäre, wäre er fünfundsiebzig Dollar wert; alles, was ich über fünfzehn Cent hinaus erziele, ist Gewinn, und der Preis richtet sich stets nach den Emotionen der Kunden; manchmal belaufen sich deren Emotionen auf fünfzehn Dollar; kann ich ihn für sieben, acht oder neun loswerden, bin ich zufrieden, denn wenn es um das Herz eines jungen Menschen geht, könnte ich gar nicht anders als zärtlich sein, selbst wenn ich es versuchte; so bin ich nun einmal beschaffen. Auch ich habe geliebt, und ich weiß, wie es sich anfühlt.
Vielleicht denken Sie, der Verlobungsring sei das Prachtstück in diesem Gewerbe, aber da irren Sie; er kommt zwar gleich an zweiter Stelle, doch was das Geschäft betrifft, so rangiert der Ehering ganz oben, und ich will Ihnen sagen, warum: Sie können eine Woche lang geodätische Vermessungen von Bauernhöfen vornehmen und werden auf nicht mehr als zwei, drei Verlobungen oder dergleichen stoßen, aber es wäre höchst ungewöhnlich, wenn Sie einen Bauernhof fänden, auf dem es keinen Bedarf an Eheringen gibt. Nehmen Sie beispielsweise ein Dorf: Ein gewöhnliches Dorf hat nicht mehr als drei oder vier Verlobungen zu bieten, für mich sind das nicht mehr als vierzig Dollar; in der Regel können Sie sie an einem Tag aufstöbern und beliefern – es sei denn, Sie sind im Süden bei den Niggern; dort läuft der Dorfhandel besser; denn im Norden kauft kein Mann einen Verlobungsring, wenn er nicht verlobt ist; ein Nigger dagegen wird Ihnen auch so einen abnehmen, um auf das Schlimmste vorbereitet zu sein. Ja, das Verlobungsgeschäft eines Dorfes können Sie an einem Tag abwickeln, aber manchmal war ich eine ganze Woche damit beschäftigt, ein einziges Dorf mit Eheringen zu versorgen. Ich erinnere mich an ein Dorf in Indiana mit nur achthundertvierzig erwachsenen Einwohnern, insgesamt aber nahmen sie mir zweihundertvierundsechzig Eheringe ab.
Sloane fiel ihm ins Wort.
»Wollen Sie damit sagen, in einer so kleinen Gemeinde wie dieser habe es zweihundertvierundsechzig verheiratete Frauen gegeben, die noch nie mit der Beglaubigung und dem Schutz eines Eheringes ausgestattet worden waren?«
Das habe ich nicht gesagt, oder? Im Moment kommt Ihnen die Statistik noch seltsam vor, aber wenn ich mit meiner Erklärung fertig bin, wird das nicht mehr so sein.
Die Geschichte des Staubwedelmannes wird abgeschlossen
Sehen Sie, so gehe ich vor: Ich schleiche zum Beispiel eine Dorfstraße entlang und mache einen müden, vielleicht entmutigten Eindruck; wenn es ein bisschen matschig und nieselig und trübselig ist, umso besser, weil man dann die Frauenzimmer höchstwahrscheinlich zu Hause erwischt – daheim, vielleicht sitzt sogar die eine oder andere von ihnen am Fenster und näht. Wenn eine Frau am Fenster sitzt und näht, heißt das, dass die Leute in diesem bescheidenen Häuschen sich ein Dienstmädchen leisten können; aber sie wird ihre Arbeit nicht unterbrechen, um die Tür selbst zu öffnen. Verstehen Sie, ein Dienstmädchen an der Tür tut es auch, wenn Sie nichts Besseres bekommen, aber Sie können sich nicht darauf verlassen, dass sie mehr als 25 Prozent dessen wert ist, was die durchschnittliche Hausherrin wert ist. Natürlich würden Sie ein Dienstmädchen nicht einfach links liegenlassen, damit würden Sie sich der Vorsehung entgegenstellen, und das könnte Pech bringen; nein, man nimmt, was man bekommt, und ist dankbar, ohne zu maulen; mit der Zeit erlernt man diese Art Philosophie. Nun denn, während Sie, Trübsal blasend und scheinbar in Sorgen versunken, durch die Straßen schleichen, halten Sie verstohlen Ausschau nach einem Geschäft, und Sie erblicken die Frau am Fenster, bevor sie Sie erblickt; sie ist da, um zu sehen, was sie kann, und viel gibt es nicht zu sehen. Vor dem Häuschen ist ein kleiner Garten und ein Lattenzaun und eine Pforte und ein Fußweg, der direkt zur Eingangstür führt, ungefähr fünf Schritte weit. Als Sie eben durch die Pforte gehen und so traurig wie nie aussehen, hellt sich Ihre Miene plötzlich auf, Sie bücken sich eifrig und klauben scheinbar etwas aus dem Schlamm. Die Frau beobachtet den Vorgang – Sie brauchen nicht zu ihr hinüberzuschauen, um sich zu vergewissern; aus Erfahrung wissen Sie, dass sie stets für ihren eigenen Anteil an dem Schauspiel sorgt. Verstohlen untersuchen Sie den Gegenstand, den Sie gefunden haben; sie beobachtet Sie die ganze Zeit, allem Anschein nach bemerken Sie es nicht; dann lassen Sie den Gegenstand in Ihre Westentasche gleiten und gehen munter weiter; doch nach ein oder zwei Schritten bleiben Sie stehen und fangen an zu grübeln – schauen zweifelnd drein; Sie führen eine Art Gewissenskonflikt vor, der beweist, dass Sie aus einer gottesfürchtigen Familie stammen und in dieser moralischen Lebenskrise zwischen Gut und Böse schwanken – verstehen Sie, die Frau behält Sie im Auge und interpretiert all das –, schließlich straffen Sie sich, setzen eine angestrengte Zurück-zur-Tugend-Miene auf, machen kehrt und gehen widerwillig zurück. Anfangs können Sie keine wirklich gelungene Probe Ihres Widerwillens geben, aber mit etwas Übung beherrschen Sie die Sache so gut, können Sie sie so echt aussehen lassen, dass Sie sich manchmal selber täuschen; manchmal glauben Sie einen Moment lang tatsächlich, Widerwillen zu empfinden. Wenn Sie diese Gangart anschlagen, wissen Sie, dass Ihre Ausbildung abgeschlossen ist und Sie für die Zukunft gerüstet sind. Wie gesagt, Sie gehen widerwillig zurück und hantieren unentschlossen an der Pforte herum; schließlich treten Sie ein und nähern sich der Tür; Sie klopfen; wäre es jemand anders, müsste er warten, bis die Frau ihr Nähzeug in den Korb gelegt und diesen zur Seite gestellt hat, bevor sie zur Tür kommt; in Ihrem Fall aber ist es anders; sie steht schon da, und sobald Sie klopfen, macht sie Ihnen auf, und ihr Gesicht ist voller Interesse, ja Erwartung. Aber das dürfen Sie nicht bemerken; nein, Sie konzentrieren sich auf etwas anderes und beachten es nicht; Sie werden sie enttäuschen – das ist das Spiel. Sie fangen damit an, dass Sie ihr bescheiden und demütig erzählen, wie lange Sie schon nichts mehr zu essen hatten und dass Sie nicht einen Staubwedel haben verkaufen können und wie viele Kinder Sie ernähren müssen – natürlich muss deren Zahl an die Umstände und die Wetterlage angepasst werden – und ob Ihre Frau krank ist oder nicht und was ihr fehlt und wie die Chancen stehen – all solche Sachen –, was die Frau nicht interessiert, denn ihre Aufmerksamkeit gilt Ihrer Westentasche; unterdessen drehen und wenden Sie einen Staubwedel nach dem anderen und schütteln ihn vor ihrem Gesicht und erklären, wie viel besser er ist als jeder andere, der heutzutage auf dem Markt ist, und wie billig diese Staubwedel sind und so weiter und so fort. Wenn Sie ihr schließlich Gelegenheit geben, auch einmal das Wort zu ergreifen, sagt sie genau das, was Sie erwartet und was Sie sich gewünscht haben, nämlich: dass sie keinen Staubwedel braucht; dass es ihr leidtut; dass sie wünschte, sie könnte einen gebrauchen, denn wie gerne würde sie jedem ehrlichen armen Menschen in Not helfen; und als Nächstes bietet sie Ihnen etwas zu essen an. Das ist Ihre Chance. Traurig wenden Sie sich ab, danken ihr inbrünstig und mit viel Gefühl, sagen ihr jedoch, es sei nicht recht, Brot anzunehmen, das Sie sich nicht verdient hätten; dass Sie vielleicht irgendwann einmal darauf zurückkommen müssten, es aber als unehrenhaft empfänden, der Einladung zu folgen, solange Sie noch die Kraft hätten, weiter nach Kundschaft zu suchen. Das ist sehr ergreifend und rührt die Frau zutiefst, Sie aber lassen nicht durchblicken, dass Sie es bemerken; sorgenvoll wenden Sie sich ab, bewegen sich auf die Pforte zu und spüren den sengenden Blick ihrer mitleidigen Augen im Rücken, und – nun ja, Sie sollten es nicht zu weit treiben; der halbe Weg zur Pforte reicht bei weitem; sie versucht, sich auf ihren Vorsatz zu besinnen, die Tür zu schließen und Sie und Ihre kranken Kinder und Ihre anderen Sorgen zu vergessen, und wenn Sie einen Schritt zu weit gehen, wird sie es schaffen; nein, aufgrund Ihrer Erfahrung drehen Sie sich genau im rechten Moment um, gehen zurück und nesteln im Gehen in Ihrer Westentasche, woraufhin Sie ihr willkommen sind. Sie sagen:
»Madam, ich bin ernsthaft in Versuchung, doch glücklicherweise ist mir die Kraft verliehen worden, ihr zu widerstehen. Vor Ihrer Pforte habe ich einen schweren goldenen Ehering gefunden; ich darf ihn nicht behalten, er ist das Eigentum eines anderen. Sie waren so gütig zu mir; Ihr Mitgefühl hat mir gutgetan; vermutlich ist es der Ihrige; falls dem so ist, werden Sie einem armen Burschen für die Rückgabe eine kleine Belohnung geben. Früher, in besseren Zeiten, war ich Handwerksgeselle eines Goldschmieds, und ich weiß, dass der Ring zehn oder zwölf Dollar gekostet haben muss.«
Unterdessen quäle ich die Frau, indem ich umständlich den Schmutz von dem Ring reibe, während sie danach fiebert, ihn zu fassen zu bekommen. Jetzt überreiche ich ihn ihr, und voller Entzücken und Verlangen dreht sie ihn hin und her. Sie findet sofort die Initialen und die von Pfeilen durchbohrten Herzen, und dann geschieht, je nach Charakter, Bildung und gesellschaftlichem Umgang der Frau, eines von zwei Dingen: Entweder gibt sie vor, den Ring, wie von den Initialen bezeugt, als den eigenen zu erkennen, oder sie sagt offen heraus, dass es nicht der ihre sei – sondern der ihrer Tante; in diesen Momenten ist es üblicher, dass die Frau sich heraushält und eine Tante bemüht; mir aber ist es gleich, mir kommt es nicht darauf an, als wessen Ring er sich herausstellt. Es ist ziemlich ungewöhnlich, dass eine Frau den Ring mit absoluter Gewissheit wiedererkennt; in seltenen Fällen tut sie es und behauptet, er gehöre ihrer Tante und müsse dieser am Morgen vom Finger geglitten sein; doch in allen anderen Fällen erkennt sie ihn als das Eigentum einer Freundin von der anderen Seite des Dorfes wieder, die sie besucht habe und die gerade gegangen sei. Diese unbedachte Bemerkung dürfen Sie keinesfalls übergehen, denn das könnte für Sie von Nachteil sein. Sie müssen sie auffordern, Ihnen die Adresse zu nennen, damit Sie, in der Hoffnung, eine Belohnung in Höhe von vier oder fünf Dollar zu erhalten, den Ring zurückbringen können. Dies tun Sie, weil Sie wissen, dass ihr bereits der Gedanke gekommen ist, den Ring zu behalten und ihn seiner imaginären Eigentümerin selber zurückzugeben, etwas, was sie tun kann, indem sie Ihnen eine ziemlich spärliche Belohnung überreicht; indem Sie sie aber nach der Adresse fragten, haben Sie sie in Schwierigkeiten gebracht, erstens, weil es keine Adresse gibt, und zweitens, weil Sie ihr entwischen könnten, falls sie den Einsatz nicht erhöht. Sie brauchen ihr gar nicht erst vorzuschlagen, dass Sie losgehen und die Frau selbst ausfindig machen, denn das wird sie zu verhindern wissen; sie wird am Ring festhalten und, wenn sie kann, Ihre Forderungen hinsichtlich der Belohnung erfüllen.
Na bitte, sehen Sie nicht, was für ein gutes Gewerbe es ist und wie zuverlässig? Es macht keinen Unterschied, ob die Frau sich selbst oder eine Tante oder eine Freundin von der anderen Seite des Ortes repräsentiert; sie wird den Ring behalten und mit Ihnen die Bedingungen über den besten Betrag, der ihr möglich ist, aushandeln. Ich springe mit solchen Leuten keineswegs hart um. Normalerweise erkenne ich am Aussehen der Frau, an ihrer Kleidung, dem Haus und alldem, welche Ausgaben sie sich in etwa leisten kann, und auf dieser Basis verhandele ich. Ein Fünf-Cent-Ring erbringt stets zwei Dollar und obendrein eine Mahlzeit, wenn ich will – was aber nicht der Fall ist. Je nach Stil und Wesensart der Frau bringt er mir zwei Dollar, drei Dollar, vier Dollar ein; und gar nicht so selten, wie Sie vielleicht annehmen, kommt es vor, dass sich Frauen finden, die noch ein, zwei oder gar drei Dollar drauflegen. Wenn ich eine ganze Saison betrachte, zeigen meine Geschäftsbücher, dass mein durchschnittlicher Preis für einen Ehering drei Dollar fünfunddreißig Cent beträgt. Manchmal benötige ich vierzig Minuten, um über einen Ring zu verhandeln; manchmal nur fünfzehn. Hin und wieder ziehe ich ein Geschäft in fünf Minuten durch; auf den ganzen Tag gerechnet, dauert es im Durchschnitt zweiundzwanzig Minuten – sagen wir, vier Ringe pro Stunde. An langen Sommertagen kann ich recht bequem zwölf bis vierzehn Stunden schaffen und mit selbigen Eheringen vierzig Dollar und mehr einstreichen; und ich bin ziemlich sicher, dass ich, je nach Marktlage, zwischendurch mit Verlobungsringen zehn, zwanzig, ja dreißig Dollar erzielen kann. Vermutlich verstehen Sie jetzt, wie es mir gelungen ist, in einer Bevölkerung von acht- oder neunhundert Erwachsenen zweihundertvierundsechzig verheiratete Frauen zu finden, die willens waren, mit mir einen Handel über einen Ehering einzugehen. Das ist meine Geschichte, Sir, und ich glaube, ich habe ihr nichts weiter hinzuzufügen.
Mittwoch, 6.März 1907
Das System des Franzosen, Pfandleihern Zinnuhren anzudrehen und damit großen Profit zu machen; sein ausgeklügelter Plan zur Bezahlung der Pfandleiher; wer ist bei diesen verschiedenen Transaktionen der Dieb?
Die kuriose Geschichte dieses gerissenen Gauners erinnert mich an eine Angelegenheit aus modriger Vergangenheit vor fünfundzwanzig Jahren, die ihr in gewissem Maße ähnelt. Es handelt sich um einen Fall, der damals viel diskutiert wurde, denn es schien mit ihm eine ziemlich knifflige moralische Frage verbunden zu sein. Ein junger Pariser Gentleman erbte ein Vermögen, das er aufgrund der bei einem flotten Lebenswandel üblicherweise benötigten Mittel schnell verprasste. Als ihm klar wurde, dass er bis auf die Taschenuhr sein gesamtes Vermögen verloren hatte, entschloss er sich umgehend, die Uhr zu verpfänden, den Erlös auf eine einzige Orgie zu verwenden und danach Selbstmord zu verüben. Damals lebte er in London. Die Uhr war eine Jürgensen und sechs- bis achthundert Dollar wert. Er brachte sie zu einem Pfandleiher; der Pfandleiher untersuchte sorgfältig ihr Äußeres, dann öffnete er das Gehäuse und untersuchte ebenso sorgfältig das Uhrwerk; zum Schluss tauchte er einen Kamelhaarpinsel in eine Flüssigkeit, berührte damit die Krone des Aufzugswerks und wartete einen Moment die Wirkung ab – dann bekundete er mit seinem Benehmen, dass er zufrieden war. Er gewährte dem jungen Burschen ein Darlehen von einhundertfünfzig oder zweihundert Dollar für drei Monate und behielt die Uhr.
Auf seinem Weg aus dem Laden erging sich der Franzose in tiefen Grübeleien, und noch ehe er weit gegangen war, nahm er eine radikale Änderung seiner Pläne vor und beschloss, die Orgie auf später zu verschieben, ein Experiment anzustellen und zu sehen, was dabei herauskommen würde. Das Betupfen der goldenen Aufzugskrone mit dem Kamelhaarpinsel hatte seine Aufmerksamkeit erregt; zweifellos war die verwendete Flüssigkeit eine Säure und ihr leichtes Auftragen vielleicht der gebräuchliche und einzige Test eines Pfandleihers, um das Gold einer schweren Savonnette auf seine Echtheit zu prüfen. Jedenfalls würde sich herausfinden lassen, ob der Test gebräuchlich war oder nicht, und es mochte gewinnbringend sein, die Angelegenheit in der Praxis zu untersuchen. So die Gedanken des jungen Mannes.
Bald war er auf dem Weg in die Schweiz. Dort kaufte er zwei oder drei Uhrwerke von unbestreitbar hoher Qualität, brachte sie zu einem ebenso fähigen wie obskuren Uhrmacher und ließ sie in schwere Gehäuse aus feinem Gold einbauen – dem Anschein nach; in Wirklichkeit aber waren die Gehäuse aus unedlem, nur vergoldetem Metall; allerdings gab es ein Detail aus gutem Gold, aus echtem Gold, aus Gold, das den Test des Auftragens von Säure bestehen würde, und zwar mit glaubwürdigem Ergebnis; dieses Detail war die Krone des Aufzugswerks. Er nahm die Uhren mit nach London, verteilte sie unter den Pfandleihern und hatte damit keine Schwierigkeiten; sie betupften die goldenen Kronen mit Säure und händigten ihm sein Geld und seinen Pfandschein aus. Er erkannte, dass er eine Methode gefunden hatte, auf auskömmliche Weise seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, denn für jede Uhr konnte er sich einen Reingewinn von ungefähr achtzig Dollar ausrechnen. Er ließ sich weitere Uhren aus der Schweiz kommen und brachte sie bei den Pfandleihern unter. Mit seinen Gewinnen ging er sparsam um, so dass er bald in der Lage war, Uhren dutzendweise zu bestellen. Natürlich kehrte er zu keinem der Pfandleiher zurück, um eine Uhr auszulösen. Zinnuhren konnten seine Leidenschaft nicht wecken.
Selbst in London ist die Zahl der Pfandleiher begrenzt – sie sind nicht in unerschöpflicher Zahl vorhanden. Mit der Zeit würden sie alle versorgt sein – was sollte er dann anstellen? War es ungefährlich, ihnen eine zweite Lieferung zur Verfügung zu stellen? Oder musste er anderswo hingehen und in weiteren europäischen Hauptstädten neue Märkte auftun? Wenn er eine sichere Methode finden könnte, die Sache zu deichseln, würde er es vorziehen, in London zu bleiben, dachte er. Er klügelte eine aus. Es war ganz einfach. Er führte das Experiment durch und hatte Erfolg damit. Er stellte einen billigen Helfer an, der die Uhren bei den Pfandleihern verpfändete, die schon einmal versorgt worden waren, und der ihm das Geld und die Pfandscheine brachte.
Nun denn, jetzt kommen wir zum kuriosesten und interessantesten Teil der ganzen Angelegenheit – und das ist dieser: Im Grunde seines Herzens war der junge Franzose in Fragen der Moral sehr sensibel; er konnte den Gedanken, dass er die Pfandleiher um ihr Geld geprellt hatte, nicht ertragen; sie hatten ihm nichts getan, sie hatten ihn in keiner Weise gekränkt, und er konnte und durfte sie nicht auf dem Gewissen haben. Er war zutiefst bekümmert; anfangs konnte er nicht schlafen. Täglich fügte er seinem Geldvermögen zwei- oder dreihundert Dollar hinzu, und die Betrübnis seines Herzens wog mit jedem Tag schwerer und schwerer.
Schließlich hatte er einen rettenden Einfall, und sein Kummer verflog. Am Nachmittag verließ er mit einer Handvoll Pfandscheinen in der Tasche das Haus und ging die Regent Street entlang. Inmitten der wogenden Menge von Männern und Frauen hielt er Ausschau nach dem richtigen Gesicht – einem Gesicht, das auf ein heimtückisches und unehrliches Herz in der Brust seines Besitzers hindeutete, dem Gesicht eines Menschen, der, wenn er könnte, seine Mitmenschen ausrauben würde, also dem Gesicht eines Menschen, der büßen musste und den nur Leid und Verlust bessern konnten. Jedes Mal, wenn der Franzose, stets bemüht, seine gestrauchelten Mitmenschen aufzurichten, zu bessern und zu läutern, ein solches Gesicht sah, ließ er einen Pfandschein auf den Gehsteig fallen – scheinbar aus Versehen. Das Resultat war stets das gleiche: Der unehrliche Mensch blickte sich scharf um, ob der Franzose seinen Verlust bemerkt hatte, sah aber immer – oder glaubte zu sehen –, dass dieser sich des Unglücks, das ihn heimgesucht hatte, nicht bewusst war; auch steckte der unehrliche Mensch den Schein immer begierig in die eigene Tasche und verschwand mit seiner Beute, statt zu dem Franzosen zu eilen und ihm die Fundsache zurückzugeben, wie jeder lautere und rechtschaffene Mensch es getan hätte. Mit der Zeit ließ der Franzose vor dieser Art von Leuten einige tausend Pfandscheine fallen, und da nicht einer unter ihnen jemals versuchte, ihm den Schein zurückzugeben, wusste er recht wohl, dass alle diese schäbigen Menschen, einer nach dem anderen, losgezogen waren, ihren unrechtmäßig erworbenen Zettel vorgelegt, eine Zinnuhr ausgelöst und dafür etwa zweihundert Dollar gezahlt hatten – doch zweifellos waren sie durch diese bittere Erfahrung in erheblichem Maße gereinigt und geläutert worden.
Sie werden mühelos feststellen, dass es hier irgendwo an Moral mangelt, denn jemand hat jemanden betrogen und jemand ist bestohlen worden; wer aber war es, der den Betrug beging? Und wer war es, der bestohlen wurde? Der Franzose behauptete nie, eine goldene Uhr zu verpfänden; er hätte sich zu einer solchen Äußerung niemals aufgeschwungen; er bot die Uhr an, ohne ein Wort über ihre Beschaffenheit zu verlieren, und bat um ein Darlehen. Der Pfandleiher selber schätzte den Wert der Uhr und setzte die Höhe des Darlehens entsprechend fest, insofern betrog der Franzose den Pfandleiher nicht. Nun gut, hat irgendwer sonst ihn betrogen? Nein. Er bekam sein ganzes Darlehen mitsamt Zinsen zurück, und zwar von dem unehrlichen Finder des Pfandscheins, folglich wurde er in keiner Weise geschädigt. Der Pfandleiher betrog den unehrlichen Finder des Scheins nicht, denn der Pfandleiher wusste nicht, dass es sich um eine Zinnuhr handelte. Für immer und ewig bleibt die Tatsache bestehen, dass es irgendwo bei dieser Transaktion einen Dieb gab, und nunmehr ist vollkommen ersichtlich, dass der einzige unanständige Mensch, der mit der Transaktion zu tun hatte, der unehrliche Finder des Scheins war. Er sah, wie der Pfandschein zu Boden fiel, er hätte ihn der Person zurückgeben können, die ihn hatte fallen lassen, zog es aber vor, ihn zu behalten; mithin stahl er ihn. Indem er dem Pfandleiher für eine Uhr, von der er wusste, dass sie einem anderen Mann gehörte, einhundertfünfzig oder zweihundert Dollar zahlte, beging er einen eklatanten Betrug, und obwohl er selbst betrogen wurde, gibt es keinen Grund, ihn zu bedauern, denn er wurde gleichzeitig gebessert und geläutert, und das war hundert Zinnuhren wert. Dennoch werde ich nicht versuchen weiterzuargumentieren. Es sind hier so viele verschiedene Arten von Moral miteinander vermengt, dass ich ganz verwirrt bin. Außer mit einer bin ich mit keiner von ihnen vertraut.
Dienstag, 26.März 1907
Mr. Clemens hat einen weiteren Urlaub angetreten und einen Blitzbesuch auf Bermuda unternommen – Seine Erfahrungen mit achtzigtausend Dollar in Aktien zu 10 Prozent – Miss Clemens’ Erfolg als Sängerin auf der Konzertbühne; sie hat gelernt, ihr Publikum zufriedenzustellen – Thomas Bailey Aldrich gestorben; aus der fröhlichen Gesellschaft von einst ist bis auf Mr. Howells und Mr. Clemens keiner mehr übrig – Mr. Clemens hat das Werk vollendet, das noch ausstand, seine Autobiographie, oder zumindest genug davon, um das Ziel, das er mit ihrer Abfassung verfolgte, zu erreichen: sie auf seine Bücher zu verteilen und diesen somit eine neue Schutzfrist zu sichern
Ich habe einen weiteren Urlaub angetreten – einen Urlaub, für den mir keine Entschuldigung einfällt, außer dass ich für eine Weile von der Arbeit wegwollte, um die Ruhelosigkeit zu mildern, die mich ab und an überfällt und die vielleicht daher rührt, dass ich fünfunddreißig Jahre lang alle meine Winter mit Müßiggang verbracht und nicht gelernt habe, mich bei der Winterarbeit natürlich und heimisch zu fühlen. Es scheint, als hätte ich etwa einen Monat lang geschwiegen. In der Zwischenzeit sind viele Dinge geschehen, und wenn ich zurückdenke, merke ich, dass jedes Ereignis zu seiner Zeit wichtig und interessant war; dann verlor es rasch an Farbe und Lebendigkeit, und jetzt ist es ganz und gar belanglos. Und genau das ist es, woraus unser Leben besteht – aus einer Abfolge von Episoden und Erlebnissen, die bedeutend scheinen, wenn sie sich ereignen, die jedoch zu Trivialitäten schrumpfen, sobald wir sie mit etwas Abstand betrachten. Unter diesen Bedingungen dürfte ein Tagebuch eine kuriose Bilanz darbieten, denn in ihm sollten alle Vorkommnisse bedeutungsvoll und alle von derselben Größenordnung sein – mit dem Ergebnis, dass die aufgezeichneten Vorkommnisse mit der Zeit alle von derselben Größenordnung sind und diese Größenordnung jämmerlich zusammengeschrumpft ist.
Dieses ist ein elendes, kommerzialisiertes Zeitalter, nur wenige können in einer solchen Atmosphäre leben und von ihr unbeeinflusst bleiben; aber ich stelle fest, dass selbst der Aktienmarkt nicht anders ist als meine übrigen Interessengebiete – er kann meine Aufmerksamkeit nicht lange fesseln. Ich hatte achtzigtausend Dollar in Aktien zu 10 Prozent angelegt und nicht vor, sie zu verkaufen, obwohl ich sie gekauft hatte, um sie zu verkaufen. Sie stiegen, ohne dass ich es merkte, Punkt um Punkt, und jeder Punkt bedeutete einen Gewinn von fünfzehnhundert Dollar, im Laufe von zwei oder drei Wochen kletterten sie um sechsundzwanzig Punkte, wobei jeder Punkt, wie gesagt, für einen Gewinn von fünfzehnhundert Dollar steht. Wäre ich wach gewesen, hätte ich alles verkauft und die neununddreißigtausend Dollar eingestrichen, um das Haus damit zu bauen – denn John Howells hat für uns ein Haus entworfen, das auf der Farm nahe Redding, Connecticut, gebaut werden soll, die wir vor anderthalb Jahren erstanden haben –, aber ich habe geschlafen und bin erst gestern aufgewacht: In der Zwischenzeit waren die Aktien in den Keller gerutscht und hatten bei ihrem Niedergang bis gestern Nachmittag sämtliche sechsundzwanzig Punkte eingebüßt. Daraufhin erwarb ich ein paar weitere Aktien und gab, falls sie um zwei oder drei Punkte fallen sollten, den Auftrag zu einem nächsten Ankauf am heutigen Vormittag. Ich hoffte, sie würden fallen, aber sie taten es nicht. Sie stiegen wieder, und ich habe einen weiteren Fehler zu verzeichnen. Ich hoffte, sie würden weit absinken, da sie aber beschlossen haben zu steigen, will ich versuchen, eine gewisse Genugtuung daraus zu ziehen, ihren Höhenflug zu verfolgen. Jeder zusätzliche Punkt bedeutet jetzt einen Profit von siebzehnhundertfünfzig Dollar, und seit gestern Nachmittag haben sie eine Steigerung um zwei Punkte erzielt.
Das nächste Ereignis von Bedeutung war eine neuerliche Reise nach Bermuda vor ein oder zwei Wochen. Wie früher fuhren wir mit demselben Schiff hin und zurück. Vorübergehend waren die beiden Schiffspassagen und der vierundzwanzigstündige Aufenthalt auf diesen herrlichen Inseln eine Angelegenheit von höchster Bedeutung und größtem Interesse, doch schon sind sie zu einem Nichts geschrumpft und haben ihren Platz unter den übrigen Trivialitäten des Lebens eingenommen.
In den seitdem vergangenen paar Wochen hat Clara die Konzertbühnen Neuenglands im Sturm erobert, am Ende hat sie ihr Handwerk gelernt und bringt nun alle Voraussetzungen mit, um Erfolg zu haben, und sie wird Erfolg haben – ein großes Ereignis für sie und ein großes Ereignis für mich. Wenn ich sage, sie hat ihr Handwerk gelernt, dann meine ich, dass ihre Theorien, die natürlicherweise aus Gusseisen oder irgendeiner anderen unzerstörbaren Substanz zu bestehen schienen, in einem ganz normalen Vorgang von der Erfahrung, der besten aller Lehrmeisterinnen, in alle vier Winde zerstreut worden sind. Ihren Theorien zufolge war es ihre erste Pflicht, den höchsten Ansprüchen ihrer Kunst treu zu bleiben und sich auf keine andere Ebene als die höchste zu begeben; dies bedeutete klassische Musik für jedes Publikum, ob es nun qualifiziert war, sie zu würdigen und zu genießen, oder nicht. Die Erfahrung hat Clara gelehrt, dass sie und ihr Publikum stille Partner sind, dass sie seinen Anteil am Geschäft berücksichtigen muss und ihre Auftritte nicht so gestalten darf, dass sie nur sich selbst zufriedenstellt. Tatsächlich hat sie herausgefunden, dass es ihre erste Pflicht sei, sich selbst zu vergessen und ihre Aufmerksamkeit ganz darauf zu richten, den Saal zufriedenzustellen. Sie hat herausgefunden, dass sie, indem sie sich bemüht, den Saal zufriedenzustellen, mehrere wichtige Dinge erreicht: Sie sendet ihr Herz hinaus zu ihren Zuhörern; einem Naturgesetz zufolge treffen die Herzen ihrer Zuhörer das ihrige auf halbem Wege; jedermann ist zufriedengestellt; alle Scheu und alle Angst sind aus ihrem Gemüt verschwunden, und das Leben auf der Bühne ist ihr zu einer Freude geworden und so schön wie ein Märchen. Sie findet ein untöchterliches Vergnügen daran, dass die Zeitungen inzwischen herzlich gerne einräumen, dass sie auf die Hilfe meines Namens nicht länger angewiesen ist, sondern ihren Weg aufgrund ihrer eigenen Leistung recht gut allein gehen kann. Das ist Unbotmäßigkeit und muss unterdrückt werden.
Thomas Bailey Aldrich ist im Alter von siebzig Jahren aus diesem Leben geschieden. Ich war nicht rechtzeitig aus Bermuda zurück, um am Begräbnis teilzunehmen, und Howells wurde die Teilnahme von den Ärzten untersagt, weil er erst vor kurzem von einem zehrenden Grippeanfall genesen ist. Gestern war er hier, und natürlich gingen wir die Liste der Namen durch. So viele sind nicht mehr! Aus der fröhlichen Gesellschaft, die sich vor mehr als fünfunddreißig Jahren in Boston zu treffen pflegte, ist außer ihm selbst und mir niemand mehr übrig; und von dem New Yorker Kontingent jener Zeit konnten wir uns bis auf Stedman kein bedeutendes Mitglied ins Gedächtnis rufen, das noch am Leben ist. Zu Recht beklagten wir die Anordnung der Prozession – Unordnung wäre der richtige Ausdruck –, denn fast jeder unserer langjährigen Freunde wurde erlöst, bevor er einigermaßen dazu berechtigt war. Howells und ich sind aufgeschoben, aufgeschoben und abermals aufgeschoben worden, bis die Ungerechtigkeit geradezu kränkend wirkte. Es stimmt, dass Aldrich dazu berechtigt war, vor Howells von uns zu gehen, denn er erreichte das biblische Alter von siebzig Jahren schon im letzten November, während Howells selbiges Alter erst am Ersten dieses Monats erreichte; ich aber bin einundsiebzig und vier Monate darüber – rangierte also sechzehn Monate vor Aldrich – und hatte in der großen Prozession das Recht auf Vortritt. Ich brauche hier nicht länger zu verweilen, denn ich habe das einzige Werk vollendet, das in diesem Leben noch ausstand und das unvollendet zu hinterlassen ich mir unmöglich leisten konnte – meine Autobiographie. Wenngleich diese noch nicht abgeschlossen ist und auch bis zu meinem Tod nicht abgeschlossen sein wird, so ist doch das Ziel erreicht, das ich mit ihrer Kompilation verfolgte: Das Ziel bestand darin, sie auf meine vorhandenen Bücher zu verteilen, jedem von ihnen eine neue Schutzfrist von achtundzwanzig Jahren zu sichern und auf diese Weise die kaltherzigen Absichten des Urheberrechtsgesetzes zu unterlaufen, das meine Töchter ausrauben und aushungern will. Ich habe bereits vier- oder fünfhunderttausend Wörter meiner Autobiographie diktiert, und sollte ich morgen sterben, so wäre diese Menge an Literatur durchaus ausreichend für das Ziel, das ich vor Augen hatte, als ich sie hervorbrachte.
Vor zwei oder drei Tagen dinierte Mrs. Kinnicutt bei uns, diese höchst bemerkenswerte Frau und überaus wertvolle Staatsbürgerin, und jene andere höchst bemerkenswerte Frau, Mrs. Draper, wäre ebenfalls gekommen, war aber durch eine andere Verpflichtung verhindert. Mrs. Kinnicutt sagte – aber darauf werde ich später zurückkommen.
Mittwoch, 27.März 1907
Mr. Clemens’ Erfahrungen mit seinen von Mr. Rogers empfohlenen Kupferaktien; sein Entschluss, seine Aktien und Anleihen nach eigenem Gutdünken zu nutzen – Wäre er seinen Eingebungen gefolgt, wären die letzten zwölf Monate finanziell profitabler gewesen als das Jahr 1902 – Mr. Clemens kauft hundert Anteile an drahtlosen Telefonen
Ich möchte noch eine Weile die Dinge katalogisieren, die mir unlängst widerfahren sind, denn ich finde es sehr interessant, festzuhalten, wie wichtig jedes einzelne war und wie schnell es in Vergessenheit geriet und ohne Folgen blieb. Einen Umstand notiere ich mit großer Genugtuung, und zwar diesen: Während Mr. Rogers’ fiskalische Kenntnisse meinen überlegen sind, ist meine fiskalische Unkenntnis hin und wieder seinen fiskalischen Kenntnissen überlegen, und während seine Vorsicht der meinen überlegen ist, ist mein Mangel an Vorsicht das Sechsfache wert. Zum Beispiel: Als er mir vor anderthalb Jahren dazu riet, die Kupferaktien zu kaufen, von denen ich sprach, und mir sagte, ihr Preis werde mit Sicherheit steigen, wollte ich zweitausend Aktien kaufen, die mich sechsundachtzigtausend Dollar gekostet und mein Bankguthaben so gut wie erschöpft hätten. Er sagte, nein, kaufen Sie nur die Hälfte. Aus meiner Sicht war das keine schlüssige Argumentation. Wenn der Preis mit Sicherheit steigen würde, weshalb sollte man dann nicht so viele Aktien kaufen, wie man bezahlen konnte? Aber ich respektierte sein Urteil und kaufte statt der zweitausend nur tausend Aktien. Ich kaufte für 43; der Nennwert lag bei 50. Die Dividende betrug 6 Prozent und würde bald 8 betragen. Kupfer war kostbarer als Gold, und sämtliche Minen der Welt konnten die Nachfrage nicht befriedigen. Diese tausend Aktien hielt ich neun Monate lang; kassierte einmal 8 Prozent Dividende, ein andermal 10 Prozent; dann kletterte der Marktpreis auf 79. Ich dachte daran, alles zu verkaufen. Zweiunddreißigtausend Dollar Gewinn bei einer Investition von dreiundvierzigtausend, alles in neun Monaten, dazu Dividenden in Höhe von vier- oder fünftausend schienen mir für einen so bescheidenen Finanzmann wie mich genug; aber nein, Mr. Rogers sagte: »Verkaufen Sie die Hälfte; etwas Besseres als diese Aktien können Sie nicht bekommen. Verkaufen Sie die Hälfte, behalten Sie den Rest.« Ich gehorchte. Mit etwas Glück hatte ich beim niedrigsten Stand gekauft; mit etwas Glück verkaufte ich beim Höchststand – 79¾. Kaum hatte ich meine Unterstützung für diese hervorragenden Aktien zurückgezogen, begannen sie Punkt für Punkt abzusacken, bis sie vor zwei oder drei Monaten den offenbar niedrigsten Pegelstand von 58 erreichten. Ich konsultierte Mr. Rogers, der sagte, ja, kaufen Sie. Ich dachte daran, alles anzulegen, was ich besaß, aber er war wieder konservativ, war wieder vorsichtig. Er sagte: »Kaufen Sie, was Sie bezahlen können, aber nicht mehr, und lassen Sie ebenso viel Geld auf der Bank, wie Sie abheben.« Also kaufte ich tausend Aktien zu 58. Ich besaß noch fünfhundert zu 43, der durchschnittliche Preis betrug also 53. Ich fasste den Vorsatz, diese fünfzehnhundert Aktien zu verkaufen, sobald der Preis wieder bei 79 läge. Diesen Preis erzielten sie, aber wie ich bereits in einem früheren Kapitel ausgeführt habe, schlief ich zu diesem Zeitpunkt und versäumte es, mir die vierzigtausend Dollar zu sichern, die mir meiner Einschätzung nach zustanden. Wie gesagt, die Aktien begannen abzusacken, bis sie vorgestern, als ich zweihundertfünfzig Aktien zu 53 kaufte, einen Tiefpunkt erreichten, und natürlich ließ ich sie durch dieses Manöver wieder steigen. Sie stiegen, weil ich weitere zweihundertfünfzig kaufen wollte, aber beabsichtigte, weniger dafür zu zahlen. Gestern Nachmittag waren sie um fünfeinhalb Punkte gestiegen. Offenbar bin ich eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten im Finanzgeschäft, denn ich kann nicht verkaufen, ohne dass die Aktienkurse sinken, und nicht kaufen, ohne dass sie steigen. Meinen Berechnungen zufolge hat mein Geldbeutel durch Mr. Rogers’ fachmännischen Rat schwer gelitten. Ich schätze, dass ich, hätte ich jedes Mal, wenn ich kaufen und verkaufen wollte, gekauft und verkauft, heute einen Gewinn von neunzigtausend Dollar auf der Bank haben müsste, doch ist dieses Geld bei der Bank nicht eingetroffen, da Mr. Rogers meine Absichten mit seinem überlegenen Urteil zunichtegemacht hat – und doch sehe ich nicht, wie jemand aus neunzigtausend Dollar, die er nicht besitzt, mehr Befriedigung schöpfen könnte als ich, denn in meiner Phantasie habe ich sie bereits mehrfach ausgegeben und jedes Mal ein wahres Vergnügen dabei gehabt; auch gestattete ich mir Luxusgüter, die ich mir keinesfalls gestatten könnte, wenn mir nicht diese imaginären neunzigtausend zur Verfügung stünden. Ich bin mit meiner finanziellen Überlegenheit gegenüber Mr. Rogers so zufrieden, dass ich beschlossen habe, sie fortan zu nutzen und zu sehen, was dabei herauskommt. Binnen einer Woche wird die kurzzeitige Panik verflogen, werden die soliden, sicheren und Dividende abwerfenden Aktien wieder gestiegen sein; dann werde ich meinen Vorrat verkaufen, sowohl die Aktien wie die Anleihen, die ich seit sechs oder sieben Jahren halte; und ich beabsichtige, das Geld auf die Bank zu bringen und dort zu 3 Prozent liegen zu lassen, bis die nächste Aufregung kommt, selbst wenn ich sechs Monate warten muss. In diesen sechs oder sieben Jahren ist noch jede Aktie, die ich besitze, zehn oder zwanzig Punkte über den Preis gestiegen, den ich gezahlt habe, und später ist jede von ihnen zehn oder mehr Punkte unter den Preis gefallen, den ich gezahlt habe. In Zukunft beabsichtige ich, sie zu einem normalen Kurswert zu verkaufen, sie dann zurückzukaufen und wieder zu verkaufen und dieses Spiel lange so zu treiben. Ich kann mich nicht ruinieren, denn selbst wenn ich sie dann und wann nicht loswerde, kann mir kein Schaden daraus erwachsen, weil die Dividenden weiterlaufen und nicht versiegen werden. Wäre ich meinen Eingebungen gefolgt und hätte Mr. Rogers’ gelehrtes Urteil hintangestellt, so wären die letzten zwölf Monate für mich finanziell profitabler gewesen als das Jahr 1902, denn die Tantiemen meiner alten Bücher haben mir vierzigtausend Dollar eingebracht, ungefähr achttausend mehr, als sie mir üblicherweise pro Jahr einbringen; außerdem zahlt mir die North American Review dreißigtausend für hunderttausend Wörter meiner Autobiographie, womit ich, hätte es den Fehlschlag dieser neunzigtausend Dollar nicht gegeben, tatsächlich die Einnahmen des Jahres 1902 erheblich übertroffen hätte.
Es gibt eine neue Erfindung. Offenbar handelt es sich um ein drahtloses Telefon. Jeder kann den Apparat bei sich zu Hause haben, und er weist ein oder zwei Vorzüge gegenüber dem Telefon auf, das ein Kabel benötigt. Zum Beispiel: Er zeichnet die Nachrichten auf, die er empfängt, und das kann er auch dann tun, wenn niemand anwesend ist; so kann man einen Freund anrufen und ihm eine Nachricht ins Haus schicken, obwohl außer dem Apparat keiner da ist, der sie empfängt; wenn der Freund nach Hause kommt, kann er die Spule zurückdrehen und die Nachricht abhören; außerdem bewahrt der Apparat seine Geheimnisse; sie laufen über keine Zentralstelle, wo sie vom Telefonfräulein abgehört und weitergeleitet werden. Gestern erreichten mich per Post einige Rundschreiben und andere Werbeanzeigen der Firma. Ich fand heraus, dass ich, wenn ich wollte, hundert Aktien für zehn Dollar das Stück erstehen könnte, aber nicht berechtigt bin, mehr zu kaufen. Das kommt mir verdächtig vor; es sieht ganz so aus, als wolle man Witwen und Waisen angeln – und Geistliche. Wenn man Aktien für zehn Dollar das Stück anbietet mit der Prognose, dass sie sich später für eine Million verkaufen lassen, kann man jede denkbare Spekulation in Umlauf setzen und bekommt alle umherschwirrenden Witwen und Waisen und Geistlichen zu packen. Sie werden ihre Kinder und ihre Bibeln verpfänden, nur um genügend Geld für den Kauf aufzubringen. Aber wenn es um die Chance einer eindeutigen, ordentlichen, vollendeten und unverzeihlichen Spekulation geht, bin ich nicht besser als eine Witwe oder eine Waise oder ein Geistlicher; ich möchte immer meine Finger im Spiel haben. Sofort wollte ich hundert dieser Aktien haben; dann dachte ich, nein, ich würde Mr. Rogers die Angelegenheit verheimlichen müssen; später dann, ich würde mein Geheimnis nicht für mich behalten können; bestimmt würde ich es ihm offenbaren, und dann gäbe es sarkastische Bemerkungen. Doch an diesem Punkt meiner Überlegungen nahm ich eine der Anzeigen zur Hand, die mir bis dahin entgangen war. Es war der faksimilierte Brief eines Mannes von hoher wissenschaftlicher Reputation und anerkannter, unbestrittener Redlichkeit. In diesem Brief bat er um hundert Aktien und sagte, er wolle sie dazu verwenden, einen Fehler wiedergutzumachen, den er vor achtundzwanzig Jahren begangen habe, als ihm für fünfhundert Dollar zweitausendfünfhundert Aktien von Bell Telephone angeboten wurden und er sie nicht kaufte. Wahrhaftig, ich wusste, wie sich dieser arme Klugscheißer fühlte! Sein Gejammer erinnerte mich an meine eigenen Erfahrungen mit Aktien von Bell Telephone vor neunundzwanzig Jahren – Erfahrungen, die ich, unter großen Schmerzen, bereits in einem früheren Kapitel dieser Autobiographie festgehalten habe. In seinem Brief konstatierte er, dass er, hätte er die zweitausendfünfhundert Aktien gekauft, bis jetzt zwanzig Millionen Dollar eingenommen hätte. Es traf mich bis ins Mark, lesen zu müssen, wie dieser Mann auf ganz überflüssige Details einging, denn sie riefen mir jene ferne Vergangenheit ins Gedächtnis zurück, als ich 1877 oder 78 dreiundzwanzigtausend Dollar in der Tasche hatte, für die ich keine bestimmte Verwendung fand, und die Leute von Bell Telephone versuchten, mir dafür ein paar Tonnen Aktien anzudrehen. Ich war genauso klug wie dieser andere Schlaumeier, und sie hatten keinen Erfolg; hätten sie jedoch Erfolg gehabt, würde ich jetzt unsere Staatsschulden begleichen und dem Land einen Neustart ermöglichen können.
Nach reiflicher Überlegung überwies ich heute Morgen tausend Dollar und ergatterte hundert Anteile an dieser Lotterie. Nie wieder werde ich etwas verpassen. Zwar werde ich es nicht mehr erleben, dass ich die Staatsschulden zurückzahlen kann, aber in meiner Sterbestunde werde ich Clara und Jean beauftragen, sich darum zu kümmern.
Donnerstag, 28. März 1907
Das Mittagessen des russischen Grafen im St. Regis und seine politische Rede in Erwiderung auf eine Rede von Mr. Clemens im Namen der anwesenden Damen
Es war meine Absicht, die Liste von wichtig-unwichtigen Ereignissen, die mir in letzter Zeit zuteilgeworden sind, weiterzuführen und zu vervollständigen, und noch bis gestern Nachmittag war ein ganzer Korbvoll davon in meinem Kopf, doch zu meinem Erstaunen sind sie heute Morgen alle verschwunden, und der Korb ist leer. Das bedaure ich, denn mit meinen Aufzeichnungen war ich schon so weit gekommen, dass sie mir als Offenbarung dienten, was ein Tagebuch ist und notwendigerweise sein muss: heute feines, kostbares Gold, morgen wertlose Asche. Wie dem auch sei – lassen wir’s dabei bewenden.
Gestern ging ich ins plutokratische St. Regis Hotel, um mit dem russischen Grafen, der vor einer Woche mit uns dinierte, zu Mittag zu speisen. Es waren rund dreißig Damen und Herren zugegen, allesamt prominente Leute und allesamt einflussreich; distinguiert nicht nur wegen ihrer hohen Stellung in der Gesellschaft, sondern auch wegen ihrer Leistungen – die Frauen sowohl wie die Männer. Ich kannte sie beinah alle, und die Zeit verging sehr angenehm. Gegen Ende des Festmahls tat der Graf etwas ziemlich Überraschendes; er schickte ein Mitglied der russischen Botschaft zu mir und ließ mich bitten, aufzustehen und eine Rede zu halten. Es war nur insofern ein überraschender Vorschlag, als er vom Gastgeber kam. Schicklicherweise konnte es bei einem solchen Anlass nur einen Redegegenstand geben, und dieser Gegenstand wäre der Gastgeber selbst und die Rede ein Überschütten seiner Person mit Komplimenten. Den Gebräuchen unseres Landes entsprechend nimmt sich stets ein illustrer Gast dieses Gegenstandes an und trägt eine solche Rede vor, aber er tut es entweder aus eigenem Antrieb oder auf Anregung eines anderen Gastes; die Anregung kommt niemals vom Gastgeber selbst.
Ein geheimer Instinkt bedeutete mir, dass ich in einer peinlichen Lage war, und so schien es mir das Beste, ein oder zwei Augenblicke zu finden, in denen ich meine Gedanken sammeln und entscheiden konnte, was zu tun sei. Dann kam mir ein rettender Einfall zu Hilfe, und ich ging zum Grafen und sagte, ich sei dankbar für die Ehre, die er mir erwiesen habe, aber es stehe mir nicht zu, in einer so bedeutenden Angelegenheit den Vorrang vor Mr. John Bigelow zu erhalten, zumal ich in meinem Leben nie ein öffentliches Amt bekleidet hätte, wohingegen Mr. Bigelow in seiner Eigenschaft als Botschafter die Vereinigten Staaten mit hoher und eindrucksvoller Distinktion an ausländischen Höfen repräsentiert habe; auch fügte ich hinzu, sein Alter verschaffe ihm einen weiteren Vorzug mir gegenüber, er sei nämlich über neunzig und ich erst einundsiebzig – aus diesen Gründen müsse ich auf Mr. Bigelow folgen, statt ihm vorauszugehen. Ich erbot mich, Mr. Bigelow aufzusuchen, ihm diese Überlegungen mitzuteilen und ihn im Namen des Grafen einzuladen, eine Rede zu halten. Der Graf dankte mir, und in selbiger Mission begab ich mich zu Mr. Bigelow. Ich komme nicht umhin, meine eigene Gerissenheit zu bewundern. Jedes Mal, wenn ich daran denke, bin ich stolz darauf – nicht weil ich gerissener war als gewöhnlich, denn das war ich nicht; ich bin immer gerissen. Mögen andere Leute denken, was sie wollen, ich persönlich weiß, dass ich immer gerissen bin und in der Regel um