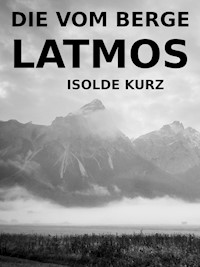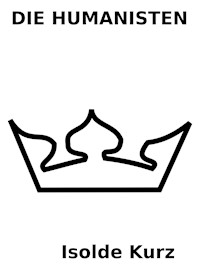Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Isolde Kurz ist auch heute noch eine ambivalente Schriftstellerin. Schon in jungen Jahren selbstständig als Autorin und Übersetzerin, war sie eine Seltenheit im wilhelminischen Deutschland. Später jedoch geriet sie wegen ihres Schweigens im Dritten Reich und ihrer altmodischen Sprache in Kritik. Hervorzuheben sind ihre Werke "Vanadis" und "Florentiner Novellen". Isolde Kurz wuchs in einem liberalen und an Kunst und Literatur interessierten Haushalt auf. Anfang der 1890er Jahre errang sie erste literarische Erfolge mit Gedicht- und Erzählbänden. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isolde Kurz
Die Nacht im Teppichsaal
Erlebnisse eines Wanderers
Isolde Kurz
Die Nacht im Teppichsaal
Erlebnisse eines Wanderers
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962812-09-6
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Der Wanderer
Die Mär von der schönen Galiana
Wie die Florentiner Pisa behüteten
Die Verdammten
Die Dame von Forli
Das brennende Herz
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Widmung
Der Herrin und Gestalterin des Wunderschlosses Bellosguardo im Gedenken an die gemeinsamen Fahrten durch italische Lande!
Der Wanderer
Er war über den Consumapass gekommen um das Casentino nach allen Richtungen zu Fuße zu durchstreifen. Frühsommer lag über der Bergwelt und verjüngte ihre herben Züge durch das zwischen dem dunklen Eichen- und Kastaniengrün vordringende neue Birken- und Buchenlaub; an den Abhängen leuchtete der goldgelbe Ginster; die Sonne hatte schon beträchtliche Kraft. Den Wanderer störte sie nicht, sein sehniger Körper kannte keine Erschlaffung. Er hielt in den Wäldern Mittagsrast, und wenn er irgendwo an verschwiegener Stelle unter der Brause eines Wildbachs gebadet hatte, fühlte er seine Glieder kraftvoll und geschmeidig wie den biegsamsten Stahl.
Er war kein Wanderer, wie sie alle Tage des Weges gehen, um den Kopf zu lüften und die Füße zu vertreten oder auch des bloßen Ankommens wegen, er war vielmehr einer, der immer in Wanderschuhen ging, dem das Wandern Zweck und Sinn des Daseins, ein währender Tempeldienst im Heiligtum des Geschaffenen war. Nicht mehr jung und noch nicht alt, auf dem Scheitelpunkte des Lebens, wo die Waage für eine Weile stillzustehen scheint, ging er seines Weges, besitzlos und wunschlos, als ein Liebender der Natur und ein Gehör für ihr heimliches Weben. Darum verirrte er sich nie, noch fragte er nach der Richtung, er hatte die Landschaft in sich und ging überall wie im eigenen. Alle Vogelstimmen kannte er, und aus dem nächtlichen Sternenschein las er die Stunden ab wie von einem Zifferblatt. Er liebte es mit dem Lauf der Flüsse zu gehen, und am nächsten fühlte er sich dem Göttlichen, wenn er sie an ihrem Ursprung aufsuchen konnte. Darum hatte er unterwegs die rauen Felsenpfade der Falterona nicht gescheut, um dem hochgeborenen Arno als Kindlein an der Wiege zu huldigen und hatte dann, auf das östliche Gebiet hinüberwechselnd, unter den Buchen des Monte Fumajuolo den dort vielfach entsprudelnden Tiberquellen das gleiche getan.
Aber er war nicht nur ein Augenmensch, dem bloß das Sichtbare gehört, er war auch ein Beschwörer, dem die Geister Rede standen. Schlösser und Burgen fragte er ab, was sie im Lauf der Jahrhunderte gesehen hatten; und über welche Stätte er schritt, da gesellte sich ihm der Genius loci und machte ihn seiner Erinnerungen teilhaft. – Es gebe nichts Vergangenes, pflegte er zu sagen, was man so nenne, das sei nur in eine tiefere Schicht hinabgestiegen, aber auf den rechten Anruf komme es gerne wieder hervor.
Denen, die ihn auf seinem Wege kennenlernten, war er ein wanderndes Geheimnis, das, ehe man es lösen konnte, entglitten war. Die Tieferblickenden erkannten einen Mann, der sich aus hartgeprüfter, umhergeworfener Jugend nur eben heil auf die höhere geistige Ebene gerettet hatte, von wo er die Dinge des Lebens tief unter sich sah, und der so aus einem unglücklichen Menschen ein nahezu glücklicher geworden war: denn wer nichts mehr für sich begehrt, der besitzt mit einem Male alles! So hatten wir ihn durch Jahre gekannt, auftauchend, verschwindend, ohne Willkomm noch Abschied; eine Zeit lang mitten unter uns; dann nicht mehr aufzufinden. – Fast hatte er keinen Namen mehr, alle nannten ihn nur den »Wanderer«. Auch er selbst unterschrieb sich auf den Ansichtskarten, die er seinen Freunden gelegentlich aus irgendeinem fernen Ende des Globus sandte, am liebsten »Peregrinus«.
Jenes Tages war er früh von dem heiligen Felsen der Verna aufgebrochen, nachdem er bei den frommen Brüdern genächtigt und zuvor den Abend mit ihnen im Gespräch über ihren großen Stifter verbracht hatte. Vor dem Abstieg hatte er noch bei Sternenschein die höchste Spitze des Berges erklettert, der das Tal des Arno von dem des Tiber scheidet, um den Aufgang der Sonne zu erwarten. Und die Nähe der beiden Schicksalsströme Italiens berührte ihn mit solcher Weihe, dass er ihren Lauf durch Raum und Zeit im Geist begleiten musste wie den Aufbruch zweier Heldenbrüder, die hinausziehen um Weltruhm und Weltmacht zu gewinnen, der eine mit kriegerischen Waffen, der andere mit solchen des Geistes.
An Tagen, die er so in gehobener Stimmung begann, konnte ihm keine Mühsal des Weges etwas anhaben, noch ließ er sich durch einen unliebsamen Zufall stören. Wo ihm aber eine bedeutsame Begegnung bevorstand, da fühlte er es an einem inneren Zuck, wie der Rutengänger, in dessen Händen die Gabel ausschlägt, wenn er die Stelle eines unterirdischen Wasserlaufes betritt.
Der Tag begann zu sinken, als ihm von dem Vorsprung einer steilen Kuppe eine Villa von edlen Umrissen inmitten eines mächtigen alten Parks entgegentrat. Michelangelo habe sie gebaut, behauptete der Wirt in der Osteria am Wege, wo der Fremde ein Glas kühlen Wein und einen Abendimbiss zu sich nahm. Mochte die ländliche Angabe stimmen oder nicht – die Nähe von Michelangelos Geburtsort legte es nahe, dass auch Unbeglaubigtes auf seinen Namen ging – die magische Rute zuckte in seiner Hand: diese Villa musste er sehen. Ein Eindruck von Versunkenheit und Verlassenheit zog ihn besonders an, und ehe noch sein Geist einen Beschluss gefasst hatte, waren schon seine Füße da hinauf in Bewegung, wie um einen ihm gehörigen Gegenstand in Besitz zu nehmen. Ein geschwungener Fahrweg, ungepflegt und steinig, schmiegte sich am Felsgelände hin, nach der Talseite zu von einem engen, doppelreihigen Zypressengang begleitet. Das Tor war verschlossen, ein rostiger Glockenzug musste mehrmals mit Kraft gerissen werden, bis ein alter Mann, dem Aussehen nach der Gärtner, mit verwunderten Augen vor dem Besucher stand.
Ob es erlaubt sei Haus und Garten zu besichtigen, fragte dieser. Der Alte wollte gerne den Besuch des Parks gestatten, aber wegen des Hauses machte er Schwierigkeit, weil er nicht ermächtigt sei, in Abwesenheit der Herrschaft jemanden hineinzuführen. Der Wanderer schritt indessen schon den Kiesweg zwischen den Lorbeerhecken entlang, als könne es nicht anders sein. Der Garten, der gemäß der Bodengestaltung in flachen Stufen angelegt war, ließ freilich erkennen, dass ihm das Auge des Gebieters seit langem fehlte. Die Pracht des Pflanzenwuchses ging schon in Verwilderung über, der die Hand des alten Gärtners nicht mehr zu steuern vermochte. Das tiefgelegte, von Kübelpflanzen umstandene Viereck des Wasserbeckens war verschlammt und sein Sprühstrahl schlief. Den seltsamsten Anblick gewährten die mächtigen Schleppkastanien auf dem Rasenplan vor dem Hauseingang, deren unterste Zweige wie lange Schlangen am Boden schleiften und Fallstricke für die Füße legten. Das Ganze ein Bild des beginnenden Wiedereinbruchs der Natur in die von Menschenhand geschaffene Ordnung. Nur die gut beschnittenen Hecken und der zärtlich gepflegte Blumenflor lobten den Fleiß und die Liebe des alten Mannes. Er war einer von den alten Gärtnern, wie man sie nicht selten auf solchen verwahrlosten italienischen Villen findet, ganz mit dem Boden, den er bebaute, verwachsen und für keine Verpflanzung mehr zu haben. Ich kann den Park nicht so pflegen wie ich möchte, sagte er entschuldigend zu dem Besucher, der durch sein lebendiges Eingehen gleich sein Vertrauen gewonnen hatte. Ich bin ganz allein hier, die junge Herrschaft lebt immer in Paris und ist überhaupt noch niemals hier gewesen. Sie schickt mir auch kein Geld für den Garten. Ich könnte ihn gar nicht erhalten, wenn ich nicht Blumen zöge zum Verkauf für die großen Kirchenfeste in der Umgegend und feines Gemüse, das ich nach Bibbiena liefere. Dafür kann ich gerade das Allernötigste beschaffen. Er hatte Tränen im Auge, als er das sagte. Mein Gehalt ist auch ausgeblieben, seit die alte Herrschaft tot ist, setzte er hinzu. Nun, ich lebe auch so. Ich habe mein kleines Häuschen von zwei Zimmern und einer Feuerstelle, den Küchenbedarf ziehe ich mir selbst, ein paar Hühner halte ich auch – ein Schwein – ich leide keine Not. Die Frau ist tot, die Kinder sind draußen in der Welt. Ich ziehe meine kleine Enkelin auf, das Kind meiner verstorbenen Tochter. Sonst habe ich nichts als meinen Garten, ich stürbe, wenn ich ihn verlassen müsste.
So viel Treue zur Scholle gefiel dem Wanderer, und die offene Menschlichkeit in dem guten Gesicht und in den noch hellen stahlblauen Augen hob ihm den Mann des Volkes aus der Gewöhnlichkeit. Er hatte unterdessen in seiner Gesellschaft alle Baumgänge und Anlagen des Parks durchwandelt, der die ganze Breite der Hügelstufe einnahm, und fühlte sich mehr und mehr gefesselt. Die Lage des Hügels zwischen zwei Flusstälern, dem breiteren westlichen, vom Silberbande des Arno durchschlungenen, und dem engen östlichen mit einem kleinen Wasserlauf, der seinem jungen Zinsherrn, dem Tiber, zustrebte, gab ihm etwas Eigenes, Bedeutsames, das sich nicht so leicht anderwärts wiederholte. Wie schön müsste es sein, hier oben eine Nacht mit Mond und Sternen zu verbringen und in kurzem Abstand Sonnenunter- und -aufgang hinter den sich gegenüberliegenden Höhen zu erleben. Auch das Haus wurde von allen Seiten umgangen. Es war im Stil der italienischen Renaissance-Villen angelegt, ein bei geringer Höhe lang hingestreckter Bau mit vortretender Terrasse, zu der die schön geschwungene doppelte Freitreppe, eine spärlich tröpfelnde Brunnennische umrahmend, emporführte. Man sah es den Räumen von außen an, dass sie nie zum behaglichen Wohnen, nur zu festlicher Glanzentfaltung gedient haben konnten. Oben auf der Terrasse zwischen beiden Aufgängen wuchsen aus einer mächtigen Rosenschale zwei steinerne Putten, um deren Nacktheit ein blühender Rosenbusch neckisch seine Zweige schlang. Hier war jedoch die Grenze des Lebens, die Wohnstätte selber lag entseelt, ihre Fensterladen waren geschlossen wie die schweren Augendeckel eines Toten.
Dem alten Gärtner, der selten mehr die Wohltat eines Gesprächs mit Höhergebildeten genoss, war unterdessen das Herz weit aufgegangen, und er hatte den Wanderer in die ganze Geschichte der herrschaftlichen Familie durch mehrere Generationen, so wie sie ihm selber bekannt war, eingeweiht. Dass dieser zwar nicht um die Persönlichkeiten, wohl aber um die einschlägigen Verhältnisse Bescheid wusste, vermehrte sein Zutrauen und ließ ihm den unerwarteten Besucher fast wie einen alten Bekannten erscheinen. Nun rückte der Fremde mit seinem Wunsch, hier oben schlafen zu dürfen, heraus. Der alte Mann blickte bedenklich: in seiner Gärtnerwohnung sei kein Raum und sie wäre auch zu gering für einen solchen Gast. Der Herrschaft würde ja freilich kein Unrecht geschehen und sie brauchte es auch gar nicht zu erfahren, wenn er den fremden Herrn in einem ihrer Privatzimmer im unteren Stockwerk schlafen ließe, er hätte aber dabei doch das Gefühl, seiner Pflicht untreu geworden zu sein. Der obere Stock aber mit den Räumen für Gäste und Dienerschaft sei im Verfall und auch ganz vollgepfropft mit Gerümpel, bis auf den Teppichsaal, der allein noch heil sei, aber unter den Wandteppichen könne ein Mensch nicht schlafen.
Einen Teppichsaal habt Ihr hier oben? fragte der Wanderer mit angenehmer Überraschung. Und warum soll man in dem nicht schlafen können? Nun, es sei doch nicht angenehm, ganz allein zu sein mit den fremden Gesichtern, die einen von der Wand herab anstarrten, meinte der Gärtner. Er habe einmal mit seiner Enkelin eine Nacht da oben zugebracht, als ihm der Sturmwind das Dach seines Häuschens abgetragen hatte. Aber das Kind habe sich vor den Figuren so gefürchtet, dass auch ihm ganz unbehaglich zumute geworden sei.
Ihr werdet mich aber doch nicht von hier wegschicken, Großvater, ohne dass ich Eure Kunstschätze wenigstens gesehen habe? Eine Sammlung alter Wandteppiche mit figürlichen Darstellungen? Um die hätte sich’s ja allein verlohnt, den Weg hierher zu machen.
Ach nein, Herr, Sie dürfen sich nichts Besonderes vorstellen. Kunstschätze sind es nicht, es sind nur so alte gewebte Dinger, schäbig und angefressen, die schon seit Hunderten von Jahren dahängen und weiter verstauben. Nein, Sie sehen gar nichts daran und lachen mich aus, wenn ich Sie hinführe. Bloß bei Nacht, wenn man die Kerze brennen lässt oder wenn der Mond drüber hinstreift, machen sie so sonderbare Gesichter, dass man denkt, sie schauen einen an. Aber in den unteren Sälen hängen schöne Gemälde, die will ich Sie gerne sehen lassen, damit Sie nicht umsonst herauf gewandert sind.
Er schloss die Eingangstür auf.
Das Innere der Villa war, wie es der Wanderer erwartet hatte. Weite Prunkräume ohne Wohnlichkeit, augenscheinlich zu Empfangszwecken gebaut, eine jener anspruchsvollen Villen, die von den Besitzern nur vorübergehend bezogen werden, um hochstehende Gäste festlich zu bewirten; auf diese Bestimmung wiesen auch die baufälligen Stallungen und Wagenschuppen im Hofe hin. An den Wänden eine lange Reihe von Bildnissen toskanischer Herrscher, bei Cosimo I. beginnend, alle höfisch langweilig, dazwischen ein paar leidliche Kopien nach Werken der großen Kunst. Nur weniges, aber mächtiges Hausgeräte, echt und alt mit der unsäglichen Stimmung von Verwaistheit und Schwermut, wie sie solche seit Menschengedenken nicht benützten Räume ausatmen. In den Schlafgemächern die schönen, freistehenden Riesenbetten mit brokatenen Prachtgehängen und der dazugehörenden reichen Truhe am Fußende, venezianische Spiegel, eingelegte Spinde, kunstreiche Kandelaber, lauter Kostbarkeiten vergangener Geschlechter, unter denen zu ruhen der Eindringling gar keine Lockung spürte.
Auf sein Drängen führte ihn der Alte dann auch eine breite Steintreppe hinauf in das obere Geschoss. Hier war das Reich der Spinnweben und des Verfalls, die Luft stockig, alle Räume mit überzähligem Hausrat angefüllt oder völlig leergelassen, weil die Fenster fehlten.
Und der Teppichsaal?
Hier ist er.
Eine verquollene Tür wird aufgestoßen, und ein langgestreckter, schmälerer Raum, das ganze Haus der Breite nach von West nach Ost durchziehend, mehr Galerie als Saal, empfängt die Eintretenden. Die Schmalwände sind fast ganz von den mächtigen dreigeteilten Fenstern eingenommen, je zwei an einer Seite, die, wenn die Läden geöffnet sind, Licht und Luft in Strömen einlassen, eine schön kassettierte Decke, deren gebräuntes Gold in der Abendsonne aufleuchtet, an beiden Längswänden nichts als die Teppiche. Ein Blick genügt dem Kundigen, um zu erkennen, dass er eine zwar schlecht erhaltene, aber nicht unbedeutende Sammlung vor sich hat. Es geschieht ihm nicht zum ersten Mal, dass er an ganz verwahrloster Stätte einen Kunstwert entdeckt, für den seine Besitzer blind gewesen. Darum pflegt er sich auch festzuhaken, wo er so etwas wie eine Witterung hat; aber eine Ernte wie diese ist doch eine Überraschung.
Da seid ihr ja, dachte befriedigt der Wanderer, denn es schien ihm in diesem Augenblick fast, als ob er der Teppiche wegen gekommen sei. Denn Figurenteppiche waren seine Leidenschaft, er zog sie der Malerei bei weitem vor, und er pflegte zu versichern, dass das größte Meistergemälde sich nicht an ergreifender Ausdruckskraft mit der steifen Ungeschicklichkeit so eines gewebten Teppichbildes vergleichen könne. Sie taten eine ähnliche Wirkung auf ihn wie die Marionetten, die ihn auch in tiefere Entzückung versetzen konnten als die größte Darbietung dramatischer Kunst. Denn die Puppen, sagte er, das seien die wahren Künstler, sie stellten nicht das Einmalige dar, sondern das Absolute, die ewige Idee. Alles Leid der Erde sei in so einem Kasperl beisammen, wenn er hilflos an der Wand lehne und nur die Hand noch leise bewege, überwältigt von Schmerz. Dann sei es schwer, sich der Tränen zu enthalten. So gehe es ihm auch mit der frühen, noch einfältigen Teppichschilderei, denn je ferner der Wirklichkeit, je näher der Vorstellung, die das wahre Leben sei.
Hier an der abgelegensten Stelle des Casentino, in einem Raum, den seit lange nur Spinnen und Asseln bewohnten, fand er seiner Liebhaberei eine Befriedigung, deren Fülle ihm fast den Atem nahm. Bleiben! sagte eine Stimme in ihm, dieselbe, die ihm geboten hatte zu kommen. Die Teppiche an der dem Eingang gegenüberliegenden Nordwand zogen ihn besonders an, sie schienen die ältesten zu sein, ihre Farben waren teilweise verblasst, auch hatten die Motten da und dort an ihnen gearbeitet, aber alle entstammten sie einer schöpferischen Fantasie und edler, zielsicherer Kunstgesinnung. Da gibt es Frauen in Prunkgewändern, gewappnete Ritter, belagerte Festungen, rennende Rosse und gefällte Lanzen, Liebesgärten mit jungen Paaren; ganze Zeiträume voll wilder und zärtlicher Begebnisse, Geschichte oder Legende, sind auf dieser Wand beisammen. Wo der Raum nicht ausgefüllt ist, schieben sich Schmalstücke mit florealen Darstellungen, sogenannte »Verdüren«, ein. Minder fesselt ihn die gegenüberliegende südliche, die mehrfach von Türen unterbrochen ist. Ihre Teppiche sind bei weitem besser erhalten, weil sie nicht aus Wolle, sondern aus Seide gewirkt und mit Goldfäden durchzogen sind, aber an Kunstwert erscheinen sie dem empfindlichen Auge beim flüchtigen Überblick geringer, weil die lebhaft bewegten Gruppen von augenscheinlich historischem Inhalt stark und anspruchsvoll aus der Wand heraustreten. Einem Kind mochte wohl dabei das Fürchten kommen.
Der Betrachter wendet sich wieder zu der ersten Wand zurück, deren Farben sich jetzt in der Abendglut mehr und mehr entzünden, dass auch hier die Formen plastischer herauskommen und die ganze Fläche ein bewegteres, aber nicht unruhiges Leben empfängt. Da und dort rührt ein dargestellter Gegenstand an einen Winkel seiner Erinnerung, wo er den Schlüssel dazu vermutet, ohne ihn sogleich zu finden; die letzte Gruppe ausgenommen, deren Bedeutung nicht zu verkennen ist. Auf die Frage, ob man wisse, was die anderen Bilder darstellten, schüttelt der Führer den Kopf. Er kennt ja die Teppiche von klein auf, denn er ist auf dem Gut geboren, wo sein Vater vordem den gleichen Posten innegehabt, und er hat sie von je missachtet gesehen, ja, er hat sich in früherer Zeit, als noch die alte Herrschaft ab und zu auf der Villa wohnte, in ihre Seele hinein geschämt, dass man nicht daran dachte, die alten verstaubten Lappen wegzunehmen und sie durch eine lustige bunte Papiertapete zu ersetzen, die dem Raum nach seiner Meinung viel besser angestanden hätte. Aber die Bewunderung des Fremden machte ihn nun doch an seinem Kunstgeschmack irre, und da er sah, dass dieser wie gebannt unter den Teppichen verweilte, bald den einen, bald den anderen vor- und zurücktretend aufs genaueste musterte und sich offenbar gar nicht davon trennen konnte, bot er ihm nun selber die Vergünstigung an, die Nacht hier oben zu verbringen. Er wolle ihm eine Lagerstatt im Teppichsaal aufschlagen, auch Tisch und Stuhl und sonst das Notwendigste hineinstellen, damit der Gast bleiben und sein Herz am Anblick der wunderlichen Dinger sättigen könne.
Er setzte sich auch gleich in Bewegung und schaffte mit seiner Enkelin, einem sehr kleinen vierzehnjährigen Mädchen, das über dem Erscheinen des Fremden die Sprache verloren hatte und auf keine seiner Fragen Antwort gab, aber desto eifriger war ihm zu dienen, aus den verschiedenen Rumpelkammern mehr Gegenstände herbei, als der genügsame Wanderer bedurfte, ließ es sich auch nicht nehmen, die Liegestatt aus seinem eigenen zwar groben aber blütenweißen Wäschebestand zu überziehen. Nur eins bereitete ihm Sorge, der Mangel an Beleuchtung.
Wir haben kein elektrisches Licht hier oben, in der Herrschaftswohnung sind wohl Petroleumlampen, aber kein Petroleum, ich selber behelfe mich mit einem altmodischen Öllämpchen und kann dem Herrn nichts anbieten als ein ebensolches.
Dies sagend stellte er eine der hohen toskanischen Messinglampen, ein blitzblank gleißendes Ding mit zierlichen Kettchen, woran Putzschere und Verschlussdeckel hingen, auf den Tisch. Aber die Bimba, wie die Kleine genannt wird, springt leichtfüßig weg und bringt auf der abgebrochenen Spitze eines alten Kandelabers den Stumpen einer armdicken Wachskerze. Auch ein Glas und zwei Karaffen, die eine mit Wasser, die andere mit Wein, holt das eifrige Kind von selbst herbei, wofür sie vom Großvater belobt wird, der kein Ende findet mit Entschuldigungen, dass er einem solchen Herrn nichts Besseres zu bieten habe, und nicht ruht, bis dieser wenigstens seinem Wein die Ehre angetan hat.