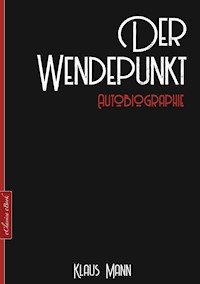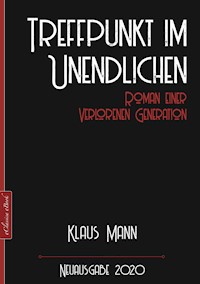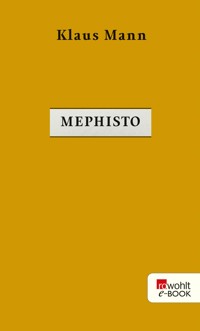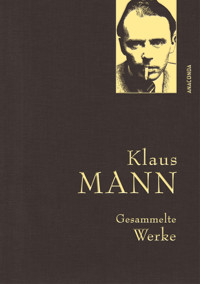9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die essayistischen Schriften Klaus Manns erscheinen in einer fünfbändigen Ausgabe. Das vorliegende Buch enthält die frühen publizistischen Arbeiten des Schriftstellers, von ersten Theaterkritiken des Siebzehnjährigen bis zu seinen Aufsätzen unmittelbar vor dem Exil. Aus einem Enfant terrible wird ein Zeit- und Literaturkritiker von Rang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 709
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Klaus Mann
Die neuen Eltern
Aufsätze, Reden, Kritiken 1924–1933
Über dieses Buch
Die essayistischen Schriften Klaus Manns erscheinen in einer fünfbändigen Ausgabe. Das vorliegende Buch enthält die frühen publizistischen Arbeiten des Schriftstellers, von ersten Theaterkritiken des Siebzehnjährigen bis zu seinen Aufsätzen unmittelbar vor dem Exil. Aus einem Enfant terrible wird ein Zeit- und Literaturkritiker von Rang.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2019
Copyright © 1992, 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung tanatat/Shutterstock
ISBN 978-3-644-00437-5
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
1924
Die freie Schulgemeinde
Arthur Rimbaud
Der lustige Thoma-Abend
Michael
Über Georg Trakl
Der Roland von Berlin
Yvan Goll: Methusalem
Die natürliche Tochter
Schluck und Jau
Jannings als Tenor
Sechs Personen suchen einen Autor
1925
Mrs. Dot
Zurück zur Schule
Brahms-Walzer
Totentanz
Romeo und Julia
Kaspar Hauser
Là-bas
Pädagogium
Der erste Tag
Casino de Montparnasse
Mein Vater Zu seinem 50. Geburtstag
Die Schulgemeinde
Ausgang
Raymond Radiguet
1926
Fragment von der Jugend
1
2
3
4
5
6
7
Die Gedichte Klabund
Unser Verhältnis zur vorigen Generation
Wildes letzte Briefe
Gespräch mit Bruno Frank
Die neuen Eltern
Auf Reisen gelesen
Orpheus in der Unterwelt
René Crevel
Jüngste deutsche Autoren
Auf Reisen gelesen
1927
Dank der Jugend an Rainer Maria Rilke
Begegnung mit Hugo von Hofmannsthal
Der Ursprung dichterischer Gestalten
Nachwort zur Anthologie jüngster Lyrik
Zum Erscheinen der Anthologie jüngster deutscher Lyrik
Nach einer Frühlingsreise
Als ich heiraten wollte
Rückblick auf unsere Tournee
Heute und Morgen
1
2
3
4
5
6
André Gide: Reise zum Kongo
Der religiöse Roman «Die Sonne Satans»
Jean Cocteau
Zuschrift an die «Literarische Welt»
Vierzehn Tage in Neuyork
1928
Bei Pola Negri
Amerikanische Lektüre
Klabund ist tot
Über zwei phantastische Bücher
Körpersinn
Eindruck in der Beckmann-Ausstellung
Stefan George Führer der Jugend
1929
Wildblühende Jugend
Der Ideenroman
Zwei europäische Romane
Jean Desbordes
Die Surrealisten
Frans Masereel
André Gide
Yvan und Claire
Besuch bei Chagall mit einem Kinde
Henri Barbusse
Am Grabe Hugo von Hofmannsthals
Zu André Gides 60. Geburtstag
Erinnerung an Anita Berber
Unzucht zwischen Männern
W.E. Süskind: Jugend
Über mein Stück «Gegenüber von China»
1930
Gottfried Benns Prosa
Antwort auf eine Umfrage über Religion
Antwort auf eine Umfrage bei jungen Dichtern über Tendenzen ihres Schaffens
Die Jugend und Paneuropa
André Gide: Die enge Pforte
André Gide: Kongo und Tschad
André Gide: Uns nährt die Erde
Heinrich Mann: Sie sind jung
Joachim Maaß: Bohème ohne Mimi
Ein führender Roman der Jungen: Perrudja von Hans Henny Jahnn
Ein älterer Roman (Balzac)
Jeremy
Porgy
Julien Green
Jubiläum der Odenwald-Schule
Wie wollen wir unsere Zukunft?
Jugend und Radikalismus
Magnus Hirschfeld: Sittengeschichte des Weltkrieges
Das Bild der Mutter
Woher wir kommen – und wohin wir müssen
1931
André Maurois
Alain-Fournier: Der große Kamerad
Selbstmörder
R.N. Coudenhove-Kalergi: Los vom Materialismus
Salem
Nicht gehaltene Rede beim Hochzeitsessen einer Freundin
Alfred Döblin: Wissen und Verändern!
Hermann Kesten: Glückliche Menschen
Heinrich Mann Zum 60. Geburtstag
Ernest Hemingway
Kommt «das dritte Reich»?
Nichts zu tun …
Liam O'Flaherty: Herr Gilhooley
«Du Geist der Heiligen Jugend unseres Volkes»
André Gide: Europäische Betrachtungen
1932
Ansichtskarte aus Toulon
Klaus Mann verteidigt seine Schwester
Liam O'Flaherty: Verdammtes Gold
Gottfried Benn: Das Unaufhörliche
Jean Giono: Ernte
Peter Mendelssohn: Paris über mir
Die Forderung des Tages
Ricki Hallgarten – Radikalismus des Herzens
Nördlicher Sommer
Jean Giono: Die große Herde
Zwilling der Sexualpathologie
1933
Die Dauerkrise
Antoine de Saint-Exupéry: Nachtflug
Antworten auf eine Enquete der «Literaturzeitung», Moskau
Über Karl Marx
München wird wieder netter
André Gide und Rußland
Der streitbare Zeichenstift
Editorische Bemerkungen
Namenregister
Vorwort
Er kam als ein Enfant terrible in die deutsche Literatur: mit siebzehn Jahren wurde Klaus Mann Theaterkritiker in Berlin; als Achtzehnjähriger brachte er sein erstes eigenes Stück und seinen ersten Roman heraus; ab nun erschienen in schneller Folge Erzählungen, Dramen, Romane, Reisebücher, Kritiken und Essays. Mit vierundzwanzig Jahren schrieb er bereits eine autobiographische Bilanz seines bewegten Lebens.
Kritische Zeitgenossen wie Kurt Tucholsky, Bertolt Brecht und Axel Eggebrecht haben den jungen Klaus Mann damals heftig attackiert: Er spiele sich zu Unrecht als Sprecher seiner Generation auf; seine Karriere sei allzusehr vom Namen des berühmten Vaters begünstigt. Klaus Mann sei Vertreter einer bürgerlichen «Pseudojugend» und habe von den eigentlichen Problemen der Zeit keine Ahnung.
Doch als Anfang der dreißiger Jahre in Europa die Nationalisten immer mehr Zulauf fanden, gehörte Klaus Mann zu den eindringlichen Warnern. Dem stets auf Verständigung und Internationalität bedachten Autor waren Rassenhaß und militärisches Gehabe der politischen Rechten zuwider. Nachdem im Januar 1933 die Nazis in Deutschland die Macht antraten, ging Klaus Mann ins Exil. Der Außenseiter wurde zu einem Repräsentanten der aus ihrer Heimat vertriebenen deutschen Kultur.
Das knappe Jahrzehnt, in dem diese Entwicklung Klaus Manns sich vollzog, von den umstrittenen literarischen Anfängen bis zur Entscheidung für das Exil, spiegelt sich in den journalistischen Arbeiten, die im vorliegenden Band gesammelt sind. Stets hat Klaus Mann in Aufsätzen und Kritiken über seine Lektüren und persönlichen Begegnungen, über Reisen wie über seine politischen Gedanken Auskunft gegeben. So läßt sich die geistige Biographie dieses Schriftstellers in ihren Facetten und Widersprüchen recht genau nachverfolgen.
Damit begründet sich auch das editorische Prinzip der mit diesem Band beginnenden Neuausgabe von Aufsätzen und Kritiken Klaus Manns. Die Texte werden weitgehend chronologisch angeordnet; der Leser ist eingeladen, den Autor auf seinen Wegen und Abwegen zu begleiten. Klaus Mann auf diese Weise als Kind und Zeugen seiner Zeit kennenzulernen, ist ein lohnendes Unterfangen.
«Immer schweifend, immer ruhelos, beunruhigt, umgetrieben, immer auf der Suche», so hat Klaus Mann sich selbst in seiner Autobiographie «Der Wendepunkt» charakterisiert und hinzugefügt, sein Leben sei «die Geschichte eines Schriftstellers, dessen primäre Interessen in der ästhetisch-religiös-erotischen Sphäre liegen, der aber unter dem Druck der Verhältnisse zu einer politisch verantwortungsbewußten, sogar kämpferischen Position gelangt». Zur entscheidenden Zäsur für diesen Prozeß wurde der Machtantritt der Nazis in Deutschland 1933. Mit dem Kampf gegen den Faschismus fand Klaus Mann die Aufgabe seines Lebens.
In den Jahren davor war er «Auf der Suche nach einem Weg» – so hieß programmatisch der Titel seines umfangreichen Aufsatzbandes, der 1931 erschien. Im Nachwort schrieb er damals: «Was bleibt zu tun, was lohnt sich? Ununterbrochene Bemühung des Aufnehmens, des Wählens, Einordnens und Verwertens. Unterwegs sein, diese Welt kennenlernen, von der wir mit unverständigem Anspruch verlangen, daß sie auch uns kenne. In Bewegung bleiben, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wohin es geht.» Diese Sätze lesen sich wie ein Motto, das auch für die vorliegende neue Sammlung seiner frühen Aufsätze und Kritiken gilt.
Er begann als Kritiker für eine kleine Berliner Zeitung, im Herbst 1924. Klaus Mann berichtete über Klassikeraufführungen und Kabarettabende, über Boulevardkomödien und – bisweilen – über literarisch ambitionierte neue Stücke. Von den dreißig Beiträgen, die er seinerzeit im «12 Uhr Blatt» veröffentlichte, wurde ein Dutzend in den vorliegenden Band aufgenommen. Die Artikel wirken bereits erstaunlich sicher in Stil und Urteil. Zumeist haben sie einen sehr kritischen Unterton – einige sind glänzende Verrisse.
Noch im Herbst 1924 erschienen auch Klaus Manns erste Aufsätze in der renommierten «Weltbühne». In seiner Autobiographie betont Klaus Mann, er habe sie anonym eingesandt – und der Herausgeber Siegfried Jacobsohn habe die Texte akzeptiert, ohne den Namen des Verfassers zu wissen. Veröffentlicht wurden sie dann aber doch mit dem Namen des Autors. Dadurch gerieten sie zu einer kleinen Sensation in der literarischen Welt: der älteste Sohn Thomas Manns machte Furore. Nun öffneten sich ihm die Türen; im «Wendepunkt» bekennt er: «Was immer ich zu bieten haben mochte, man nahm es mir ab, man fand es interessant. Die feinsten Blätter und Revuen druckten meine Kurzgeschichten, Plaudereien und Betrachtungen …»
Plauderhaft wirken in der Tat manche der frühen Aufsätze Klaus Manns. Sie sind mit leichter Hand geschrieben, haben aber zugleich einen oft pathetischen Grundton. Der Anspruch, mit dem der junge Klaus Mann auftrat, war es, für seine Generation eine Sprache, eine «Melodie», einen Lebenssinn zu finden. Diese Ambition ist der rote Faden, der sich durch die Artikel des vorliegenden Bandes zieht – bei aller Vielfalt der Themen und Gegenstände, mit denen sich der Autor befaßt.
Die radikale Ablehnung der Eltern-Generation, wie sie noch die Expressionisten propagiert hatten – gipfelnd in dem literarischen Topos «Vatermord» –, war Klaus Manns Sache nicht. Im Gegenteil. Unter seinen Leitbildern und literarisch-philosophischen Mentoren finden sich erstaunlich viele Ältere: von Stefan George und Hugo von Hofmannsthal bis zum eigenen Vater und dem Onkel Heinrich Mann. In dem Essay «Die neuen Eltern» vom Sommer 1926 heißt es ausdrücklich: «Wir halten zu denen, die, neuen Zielen zustrebend, für die sie noch keine Worte haben, einer großen Angst und eines großen Glaubens voll, zu den Vorigen, zu den Vollendeten, zu den Vätern trotzdem zurückschauen – getrennt von ihnen, immer weiter wegstrebend von ihnen, aber lernend dabei, ehrfurchtsvoll vor dem, was diese gelebt und gebildet.»
Orientierung suchte und fand Klaus Mann aber auch durch den Blick über Ländergrenzen hinweg. Besonders mit französischen Schriftstellern verbanden ihn sehr bald viele persönliche Freundschaften. Er betätigte sich als Vermittler, indem er ihre Werke in oft euphorischen Aufsätzen dem deutschen Publikum vorstellte: René Crevel, Jean Cocteau, Julien Green, Jean Desbordes, um nur einige zu nennen.
Diese besondere Beziehung Klaus Manns zur französischen Kultur ist seit langem bekannt. Nicht zuletzt die Essay-Sammlungen, die Martin Gregor-Dellin in den sechziger Jahren herausgab, haben hierauf das Schwergewicht gelegt. Neu zu entdecken im jetzt vorliegenden Band ist dagegen das Interesse, mit dem Klaus Mann auch die Schriftsteller anderer Länder verfolgte. Seine Kritiken zur amerikanischen, englischen und irischen Literatur bezeugen einen weltoffenen, neugierigen, stets aufnahmebereiten Geist.
Eine Persönlichkeit ragt heraus unter den Künstlern, über die Klaus Mann schreibt, schon durch die Zahl der Artikel: André Gide. Der junge Deutsche wird nicht müde, Gide als den repräsentativen Europäer, als maßgeblichen Intellektuellen seiner Zeit zu preisen. Im Kern ist diese Verehrung geprägt durch Gides Versuch, eine höchst eigene Synthese von Freiheit und Gebundenheit zu finden – in der Lebensführung wie in den literarischen Werken. Hierin wurde er für Klaus Mann das wichtigste Vorbild. In seinen posthum veröffentlichten Tagebüchern übrigens nennt Klaus Mann ihn schlichtweg: «Le père Gide».
Auch nach 1933 behielt André Gide diese Bedeutung für Klaus Mann. Von anderen Idolen seiner frühen Jahre hat sich der Schriftsteller dagegen später distanziert. Gottfried Benn ist das bekannteste Beispiel dafür. Noch Anfang 1932 rezensiert Klaus Mann ein Oratorium Benns als «neue Probe des sprachlichen und intellektuellen Genies» dieses Dichters. Im Mai 1933 schon wird er an Benn einen Brief schicken, in dem er dessen Sympathien für den Nationalsozialismus mit ungläubigem Erstaunen kommentiert. Im Herbst 1933 erscheint dann eine scharfe Polemik Klaus Manns, überschrieben: «Gottfried Benn oder Die Entwürdigung des Geistes». Vier Jahre später wird ein weiterer Essay Klaus Manns über Benn zu einem der Auslöser für die Expressionismus-Debatte werden – eine der zentralen kunsttheoretischen Diskussionen unseres Jahrhunderts.
Solche Entwicklungslinien Klaus Manns in ihren Schritten und Widersprüchen nachvollziehbar zu machen, ist ein besonderes Anliegen der jetzt beginnenden Neuausgabe seiner Aufsätze. Der vorliegende Band ist die bisher umfangreichste Sammlung seiner frühen Publizistik. Aufgenommen wurden insgesamt 125 Beiträge.
Auf Vollständigkeit ist die Edition nicht angelegt. Bisweilen überschneiden sich Texte Klaus Manns, der seine Arbeiten stets vielfältig «verwertete»; hier galt es auszuwählen. Auch gibt es manche Artikel, die allzu offenkundig Gelegenheitsarbeiten waren, als daß sie einen Wiederabdruck lohnten. Und nicht zuletzt ist nicht jede kurze Rezension einer aktuellen Neuerscheinung der zwanziger Jahre noch von Interesse für den heutigen Leser.
Der vorliegende Band schließt ab mit dem Zeitpunkt, als Klaus Mann im März 1933 Deutschland verläßt. Es war die wichtigste und folgenreichste Entscheidung in seinem Leben. Die Texte, die in den ersten Jahren von Klaus Manns Emigration entstanden – bis zum Jahr 1938, als er den Spanischen Bürgerkrieg miterlebt und anschließend ins USA-Exil geht –, werden im zweiten Band der neuen Edition seiner essayistischen Schriften erscheinen.
Hamburg, im April 1992 Uwe Naumann I Michael Töteberg
1924
Die freie Schulgemeinde
Aus den vielbesprochenen Mißständen der staatlichen Erziehung erwuchs die pädagogische Revolution, die sogenannte Jugendbewegung. Hauptsitz und Hochburg der Jugendbewegung sind die Landerziehungsheime – genauer gesagt: die «freien Schulgemeinden», denn bloße Landerziehungsheime stehen oft der Jugendbewegung fern, sind Gymnasien, die man ins Freie verlegte und in denen der alte Unfug, mit einem ethischen Beigeschmack vielleicht, weiter betrieben wird.
Um diese «freien Schulgemeinden» ist es ein Seltsames. Ihre Atmosphäre ist kaum zu schildern. Die radikal modernen Erziehungsmethoden neuer Pädagogen ausgeübt, in Praxis umgesetzt an einer Gemeinschaft meist äußerst problematischer, durch die extreme, leidenschaftliche Luft des Erziehungsheimes nicht eben vereinfachter junger Leute. Die Eigenart des einzelnen, die in einer Kadettenanstalt, ja, in einer öffentlich-staatlichen Schule wohl einfach unterdrückt, eingepreßt worden wäre, entwickelt und steigert sich gewaltig durch das Entgegenkommen, durch das tiefernste Auf-den-Einzelnen-Eingehen, das sich hier findet. Leiter, Lehrerschaft und Kameraden bemühen sich mit sittlichem Ernst um die Leiden und um die Freuden des einzelnen – ja, sie betrachten es als Kränkung, für sie ist es «ungemeinschaftlich», wenn jemand es vorzieht, derlei mit sich selbst auszumachen, und nirgends, glaube ich, haben die Einsamen es schwerer als in einem solchen Institut, wo eine höhere Art von Indiskretion zur sittlichen Pflicht erhoben wurde. Trotzdem ist es die Absicht nicht, der einzelne möchte in der Gemeinschaft untergehen, sich ihr, blind und verantwortungslos, hingeben. Die Selbstverantwortung ist eine der wichtigsten Thesen auf der Prinzipientafel der freien Schulgemeinde. Das heißt, man erwartet, daß die Freiheit, die hier herrscht, nicht ausartet zur Anarchie, sondern bezweckt, daß jeder, in Freiheit erzogen zur Selbstzucht, das Rechte, das ihm Gute tue – ungezwungen. Man erwartet es. – So klingt die Sprache der freien Schulgemeinde. So gewaltig ernst. So bar aller Ironie. Unvergleichlich in der Tat ist der leidenschaftliche Ernst, die tiefe Überzeugtheit, mit der hier gelebt und gelehrt wird. Jede «freie Schulgemeinde» hat ihre eigene Theorie, ihre eigene Abart von Pädagogik – allen gemein ist jener tiefe, ja erschütternde Fanatismus. Einer «Schulgemeinde» – das heißt: einer jener Versammlungen der Schüler und Lehrer, in der Fragen des Tages besprochen werden – einer Schulgemeinde beizuwohnen, das ist ein Erlebnis seltener und ergreifender Art. Kein Parlament kann sein Thema mit intensiverer Sachlichkeit verhandeln, als mit der diese Kinder und jungen Pädagogen die Fragen ihres «Gemeinschaftslebens» besprechen. Was fehlt, ist eben Leichtigkeit – Weite. Kein Funke von Selbstironie. Sie glauben alle, ihre Idee bringe das neue, das große Glück – als wenn eine Idee überhaupt «Glück» bringen könnte.
Trotzdem – alle Verschmocktheit, alles falsche Prophetentum zugegeben –, ich glaube: Wer nie das Leben einer solchen modernen Schulgemeinde beobachtet, wenn nicht an ihm teilgenommen, es mitgelebt hat, darf nicht sagen, daß er ganz unsere Zeit kenne. Hier trifft sich jeder Typus des modernen jungen Menschen: Wandervögel und die Söhne der Großindustrie, Anthroposophen und die kleinen décadents mit ihren hoffnungslosen Kompliziertheiten – alles beisammen, alles für sich und doch vereinigt, trotz alles Spottes des einzelnen – vereinigt durch Pathos und Willen eben desjenigen Pädagogen, der Inhalt und Seele des Ganzen ist.
Heißer, merkwürdiger und intensiver noch wird die Stimmung durch die äußerst seltsame, äußerst zweideutige Rolle, die das Erotische hier spielt. So viele Menschen, so viele junge Menschen – Mädchen und Knaben und junge Männer – in einer Gemeinschaft zusammen: Man kann sich denken, welch angespannte Luft, welch elektrizitätsgeladene Luft zwischen den einzelnen zittert. Es ist eine Mischung von Enthaltsamkeit, heiterer, zum mindesten heiter-sein-wollender Zucht und einer ständigen Gier, einer Sinnlichkeit, die jedes Wort bewegt, irgendwie jede Geste zweideutig, oder nicht mehr zweideutig, macht. Ein klösterlicher Zug ist da – ; die Zucht und äußerste Einfachheit des Lebens, diese ethisch betonte, fanatische Einfachheit – das Wegfallen aller leichtsinnigen, leichten Momente, das tiefe, heilige Sich-und-sein-Tun-ernst-Nehmen. – – – Trotz alledem. In den Ernst, ja in die Heiligkeit mischt sich ein Etwas, ein Zweideutiges – kaum zu Wägendes – ; vielleicht aber ist eben diese leise, ewig angespannte Sinnlichkeit das Element, das solch vagen, seltsamen Instituten, wo radikale, fanatische Prinzipien ausgeübt, in Praxis umgesetzt werden an meist problematischen jungen Leuten, die Möglichkeit gibt, nicht auseinanderzufallen, weiterzuexistieren.
Ich glaube nicht, daß ich Stimmung und Atmosphäre der freien Schulgemeinden – eine äußerst gefährliche wie äußerst extreme Atmosphäre – ganz festgehalten habe. Nicht halbwegs auch nur konnte ich die pädagogischen Grundideen einer solchen Anstalt darlegen – schon deshalb nicht, weil jedes dieser Institute in Endzweck und Grundeinstellung vom anderen sich um ein wesentliches unterscheidet.
Wie wichtig, wie ernst eine jede solche Gemeinschaft sich selbst nimmt, wie wichtig, wie ernst sie von der Mitwelt genommen werden sollte – weil der Geist jeder modernen und heutigen Jugend hier gesteigert und sublimiert sich hier zusammenfindet – das wollte ich nur sagen.
Arthur Rimbaud
Ich will gar nicht von seinen Gedichten sprechen, diesen besessenen Wortkatarakten – ich will nur erzählen, wie schön die Büste ist, deren Photographie der Insel-Ausgabe von «Arthur Rimbauds Leben und Dichtung» voransteht.
Auf den ersten Blick meint man einen schönen Proletarierjungen zu sehen. Das macht die rücksichtslos-sinnliche Brutalität des vollen Mundes und des willenstarken Kinns. So sah er aus, der die Freundschaft mit Verlaine, dem unglückseligen décadent mit den Satyrgelüsten, dadurch beendigte, daß er ihn, zum Abschluß einer religiös-philosophischen Debatte, mit einem Knotenstock halb tot prügelte und ihn dann, blutend, am Neckar-Ufer bei Stuttgart liegen ließ. So sah er aus, der Schnürsenkel auf den Straßen von Paris verkaufte, um nicht zu verhungern, der sich, eisernen Leibes, trotzend, aufrecht durch die ganze Welt schlug, Europa hinter sich ließ – Europa und uns alle. So schön, so ungeheuerlich schön war er, dessen Riesenstärke unsre Kultur überwand, der sich frei machte – frei von Verlaine, frei von Paris, frei von Europa. Auf den ersten Blick meint man einen schönen Proletarierjungen zu sehen.
Aber dann erschrickt man über die unsagbare Sehnsucht dieser Augen, die unter der gewaltigen Höhe der Stirne knabenhaft uns anschauen. Wir wissen, daß diese Sehnsucht unstillbar ist, in ihrem tiefsten Wesen. Sie kann sich nicht in der Literatur gestalten und erlösen. Sie läßt die Literatur hinter sich, wie sie alles umfängt, kostet, wegwirft. Was er schrieb, kommt nicht in Frage neben dem, was er war. Die Literatur war für ihn Periode, Abschnitt. Ein Versuch mehr, sich auszuleben, der großen Sehnsucht genug zu tun. Andre bändigen in einsamem Mönchsdienst täglicher Arbeit ihr schon an und für sich nicht gar zu überschwengliches Erleben, um es in die spröde Form einer gemäßigten Gestaltung zu ergießen. Von ihnen aber stammen die großen, die schönen und erfreulichen Werke der Weltliteratur. Sie waren es, die Aufgaben lösten, Leistungen vollbrachten, und ihrer ist der Ruhm, der Dank der Menschheit. Zum Entgelt für ein Leben, das Verzicht war um der Leistung, um der Kunst willen, setzt man ihnen die Krone aufs Haupt. Würde und Glanz umgibt den zufriedenen Abend ihres Lebens. Während jene einsam sterben müssen.
Arthur Rimbaud starb ganz allein, gebrochen und verlassen – ein Krüppel. Ihn hatte die «große Sehnsucht» durch die Welt getrieben. «Bateau Ivre» war er gewesen – ein trunkenes Schiff.
Was galt es ihm, daß er mit siebzehn Jahren berühmt war, «Shakespeare enfant», der Abgott von Paris! Er wollte mehr, wollte alles. Dann sank das Schiff – andern Gefilden, der Heimat zu, wo es stille sein wird.
Was uns von Rimbaud blieb, sind ein paar Verse – mit die ungeheuerlichsten freilich, die je geschrieben wurden – und der gewaltige Mythos seines Leidens.
Der lustige Thoma-Abend
Alles hat seine Grenzen, und, wenngleich niemand ehrliches Mühen schroff verurteilen will, was das Steglitzer Schloßtheater einem geduldigen Publikum gestern abend bot, ging denn doch wohl zu weit. Es gab zwei Einakter Ludwig Thomas zu sehen, die gut und witzig genug sind, als Milieustudien betrachtet nämlich – als bayrische Milieustudien. Da keiner der Steglitzer Schauspieler ein kleines Wörtlein Bayrisch auch nur über die Lippen brachte, verloren die Stücke absolut und gänzlich ihren Sinn – es war wirklich recht peinlich zuzuschauen. In München spielen Gymnasiasten diese Stücke gern zu ihren Abiturfeiern. Aber natürlich machen sie es viel hübscher.
Was hat es, in Gottes Namen, für Sinn und Zweck, wenn in einem Stück, dessen Absicht allein es ist, bayrisches Kleinbürgertum gutmütig zu verulken («Lottchens Geburtstag»), Mutter und Tante ein fatales Gemisch aus Sächsisch-Pfälzisch und Jüdisch kauderwelschen?– Was soll es, zum Teufel, wenn ein Stück nichts will, als einen treu-plumpen und verschmitzten alten Bauern einem schnodderschnäuzigen Berliner Fortschrittsmann gegenüberzustellen – wenn der Bauer nicht spricht wie einer, der Bayern jemals gesehen, sondern wie ein entgleister Hof Schauspieler? («Erster Klasse».) Ich mag keine einzelnen Namen nennen. Einer war so fehl am Orte wie der andere – bis vielleicht auf Alfred Braun als Reisender in Kunstdünger, der ja schließlich Norddeutscher sein mußte und seine Sache recht gut machte. Aber ein lustiger Thoma-Abend war es ja nun nicht. Der Gute ärgert sich gewiß im Grabe. Wie nett habe ich die Stücke bei der Absolvin-Feier des Wilhelm-Gymnasiums zu München gesehen.
Michael
Herman Bangs vielleicht erschütterndstes, sicherlich gelungenstes, stärkstes Buch – Bangs «Michael» im Film. Merkwürdiger Anblick: Titel und Name des lange geliebten Werkes in großen und gewaltig grellen Lettern auf den Reklametafeln des Filmtheaters. «Michael!» – «Michael!» Das ist das Buch vom einsamen Tode. Das ist das Buch vom Meister, der allein ist, und vom Jüngling, der eine Frau liebt. Das ist der traurigste Liebesroman aller Zeiten. – Verliert er an Innigkeit, da seine Visionen auf der Leinwand äußere Bildlichkeit gewinnen, da eine geschickte Regie seine Fabel für den Film zurechtbiegt, ausnutzt, dramatisch vereinfacht? Dort ist eine Situation geändert, vergröbert, vielleicht vereinfacht, auf jeden Fall in ihrer Atmosphäre.
Und doch ist es, als hätte Bang Freude gehabt an diesem Film. Und wir, die wir ihn, sein Werk, sein Wesen lieben, verehren, wir brauchen wohl auch nicht schelten und hochmütig uns gebaren, weil nun das, was uns zum hohen Erlebnis wurde, auf diese Art, die keine schlechtere ist, nur eine andere, heute Hunderte erfreut, vielleicht selbst ergreift. Und wenn wir von jeder neuen Wirkung, die der Film uns bot, gänzlich absehen könnten: der Augenblick allein, da der sterbende Meister aufgeweckt wird von einer großen Halluzination, den Knaben Michael, dem er alles gab, sieht mit der Frau, die der Knabe liebt – da der Einsam-Sterbende also in Ekstase die Vision der «großen Liebe» erschaut – um dieses Augenblicks, um seiner Intensität und Inbrunst willen würde ich allein die Verbildlichung des Michael-Romanes nicht verwünschen.
Ich glaube, daß der Meister des Benjamin Christensen die menschlich stärkste, geschlossenste Leistung des Filmes war. Aber wie sehr bezauberte der dunkle und geheimnisvolle Liebreiz der Nora Gregor als Fürstin Zarnikoff, wie rührend und still war die Anmut der Grete Mosheim. Und wenn auch vor dem Auge des Lesenden die Gestalt Michaels, der bis zum Symbol des sieghaften Lebens überhaupt sich steigert, immer strahlender noch stehen wird, als es sie darzustellen überhaupt möglich sein kann – sicherlich verkörperte Walter Slezak ihn so gut, wie es vielleicht eben möglich ist.
Über Georg Trakl
Er ist der Schwermütigste von allen. Auf jedem Vers, den er schrieb, liegt jene tiefste, hoffnungsloseste, süßeste Melancholie – jene Melancholie, die zu müde, zu schwer ist, um in eigentlichen Worten noch zu sprechen, die in Musik und in Farben zerfließt. Sein Lebenswerk, seine gesamte Dichtung ist eigentlich keine Kunst mehr. Es ist ein ununterbrochenes, verworrensüßes Lied von seiner untröstbaren, von seiner tiefen, tiefen Schwermut. Die paar Dinge, die er lieb hatte auf Erden, kehren immer wieder in seiner Dichtung: die paar Farben – purpurn, braun, blau –, die flötende Amsel, die schmale dunkeläugige Gestalt der Schwester, die er Karfreitagskind nannte, und das Süßeste von allen: die Knabengestalt mit den mondenen Augen und der hyazinthenen Stimme – Elis. Sie sind, glaube ich, das Schönste unter seinen Gedichten, die drei Lieder vom Knaben Elis. Sie stehen an der Grenze zwischen den frühern, noch farbigern, leichtern, künstlichem, deren schönstes wohl «Verfall» und «Traum des Bösen» ist, und den durchaus mystisch-hölderlinisch umnachteten, denen, die jenseits des «normalen» Begriffsvermögens stehen, die in tiefen und irren Worten von der letzten Schwermut zu uns singen.
Die Elis-Lieder beginnen:
Elis – wenn die Amsel im schwarzen Walde ruft,
Dieses ist dein Untergang.
Niemals fügte ein Dichter Worte zu so schwerer, purpurner Pracht. Es gibt da eine Stelle, die heißt:
Dein Leib ist eine Hyazinthe,
In die ein Mönch seine wächsernen Finger taucht.
Eine schwarze Höhle ist unser Schweigen,
Daraus bisweilen ein sanftes Tier tritt,
Das langsam die schweren Lider senkt.
Auf deine Schläfen tropft schwarzer Tau,
Das letzte Gold verfallner Sterne.
Ich nannte den Namen Hölderlins. In der Tat ist nur er hier zum Vergleich heranzuziehen. Vielleicht noch ein paar Stellen aus Nietzsches letzten Dithyramben. Die gebenedeite Nähe des großen Hinabgleitens, des Wahnsinns, die tiefste Trauer, das letzte Weh, das Musik wurde – wo finden wir es sonst wieder?
Trakl erzählt uns die Geschichte seiner Jugend. Er nennt sie «Traum und Umnachtung». Sie beginnt:
Am Abend ward zum Greis der Vater; in dunklen Zimmern versteinerte das Antlitz der Mutter, und auf dem Knaben lastete der Fluch entarteter Geschlechter. Manchmal erinnerte er sich seiner Kindheit, erfüllt von Krankheit, Schrecken und Finsternis, verschwiegener Spiele im Sternengarten, oder daß er die Ratten fütterte im dämmernden Hof …
Oder daß er die Ratten fütterte im dämmernden Hof … Wen rührte kein Schauder an? Wer fühlte sich nicht im Innersten getroffen bei solchen Worten?
Es gibt vielleicht solche, die diese späte, tiefunfruchtbare, weil so sehr müde Kunst mit dem ekelhaften Schlagwort «décadence» abtun. Wenn auf jemand Schlagworte nicht anwendbar sind, so ist es Georg Trakl. Wo die gebenedeite Nähe des großen Hinabgleitens ist, des Wahnsinns, wo letztes Weh, tiefste Schwermut Musik ward – wie sollten da Feuilletonistenschlagworte treffen?
Ein Orgelchoral erfüllte ihn mit Gottes Schauern. Aber in dunkler Höhle verbrachte er seine Tage, log und stahl und verbarg sich, ein flammender Wolf, vor dem weißen Antlitz der Mutter. Mit purpurner Stirne ging er ins Moor, und Gottes Zorn züchtigte seine metallenen Schultern.
Wer solche Sätze schrieb, steht außerhalb.
Ihr sagt von ihm: Seine Technik wiederholt sich. Sein Wortschatz ist kein allzu großer. Wäre er nicht früh gestorben – fast ein Knabe noch –, es wäre auf die Dauer ein wenig langweilig geworden.
Er aber war der Schwermütigste von allen.
Der Roland von Berlin
«Der Roland von Berlin» – – – Und auf dem Umschlag des weißen Programmheftes das lachende, das altbekannte und liebenswürdige Gesicht Paul Schneider-Dunckers. Das spannt die Erwartungen hoch. Ein illustres Premierenpublikum war auf Schönes gespannt. Und Schönes bot man.
Ein gutes Kabarettprogramm mit zwei Attraktionen: Paul Schneider-Duncker und – Elisabeth Bergner. Und das sind Attraktionen der vornehmsten Art.
Es ist schwer, über Schneider-Dunckers im höchsten Sinn amüsante Kunst erläuternd zu sprechen. Die absolute Treffsicherheit seiner Technik ist wichtig – und doch das Wichtigste lange nicht. Was einen Kabarettkünstler groß macht, ist stets das Unfaßbare, das Nicht-mehr-Erklärbare. Nennen wir es «Charme», nennen wir es die «persönliche Atmosphäre». – Nennen wir es gar nicht. Es ist da. Wir klatschen, wir jubeln. Schneider-Duncker singt das Lied von den staunenden Flundern, von den entzückenden Frauen. – Wir wollen immer mehr hören. Er hat so merkwürdige Handbewegungen, über die läßt sich gar nichts sagen, sie sind so komisch – Schneider-Duncker bekommt riesige Blumenkörbe. Er singt das Lied vom samtenen Schuh – – Klatschen wir, wenn wir ganz toll klatschen, gibt er vielleicht noch etwas zu. Nachher noch haben wir Zeit zu überlegen, daß seine «persönliche Atmosphäre» und das Nichtmehr-Deutbare ihn groß machen.
Aber die Bergner trägt eine weiße Perücke zu einem schwarzen Seidenkleid mit gebauschtem Rock und langen, langen schwarzen Handschuhen. Sie spielt eine Schwipsszene. Sie kommt von einem Maskenfest nach Hause und ist auf die liebreizendste Art betrunken. – Tut es ein bißchen weh, nach langem Warten auf neue künstlerische Schöpfung von dieser seltsamen Frau eine Kabarettnummer beschert zu bekommen? – Man vergißt es, während sie da eben lacht und girrt.
Daneben brachte der Abend Gutes und Sovieles. Der musikalische Humorist Lajos Szendy kann ein ganzes Orchester nachmachen und einen Tenor und eine Koloratursängerin dazu. Er kann Richard Wagner verulken, daß alles lacht, und er vermengt seine pathetischen Motive mit «Bananen» und «Wenn ich Dich seh – – ». Maria Ley tanzt vornehm und gut – ein wenig zu vornehm fürs Kabarett, ein wenig gar zu gehalten. – Leidenschaftlich und stark sind die Gesänge der beiden Frauen vom Salon Margherita in Rom: Le Sorelle Fio Renzo.
Ein gutes Kabarettprogramm mit zwei Attraktionen schönster Art.
Gelegentlich und wenn ich gerade Besseres nicht zu tun habe, werde ich an Gott die Frage richten, warum er C. K. Roellinghoffy dem Conferencier, nicht ein bißchen mehr Temperament und Liebenswürdigkeit verlieh.
Yvan Goll: Methusalem
Dieses Stück kommt vier Jahre zu spät. Damals wäre es auch recht gut gewesen – sicher aktuell wenigstens, in Stil und Tendenz. – Man wurde mißtrauisch inzwischen gegen diese Art zu lärmen. Auf steile und literarisch übertriebene Weise wird ein Bourgeois und sein Anhang verhöhnt – das genügt, in Gottes Namen, nicht mehr. Ein bißchen politisches Geschrei – bunt geschminkte Proletarier, in expressionistisch gefügten Satzgebilden dem Schuhfabrikanten vorhalten, daß er schlemme, während sie doch hungerten – es genügt nicht. – Niemand wird dem Stück Witz zusprechen. Es hat scharferdachte, treffliche Situationen, zuweilen kann man schon lachen. Aber Innigkeit fehlt, Ernst und Menschlichkeit. Kein Ton in diesem ganzen Stimmengewirr, der aus der Tiefe kommt. Kein Wort, das trifft, das traurig macht. – «Die Tragödie ist tot», verkündet die marktschreierische Heilbinde, die das Textbuch trägt, «es lebe die Posse!» – Mir ist es aber, als käme dieser unserer armen Zeit ein ernstes, wärmeres, schönes Stück weit besser zustatten als solch lärmendes Machwerk.
Die Aufführung war, unter der Regie Friedrich Neubauers, so grell wirksam, wie das Stück sie verlangt. Man kann sagen, daß sie «das Werk gut zur Geltung brachte». Schade, daß sie nicht genial genug war, es zu retten. – Schauspielerisch war gewiß die beste Leistung der Sohn des Schuhfabrikanten – Hubert von Meyerinck. Der intensive Rhythmus seiner Geste und seines Wortes belebte und steigerte den ihm vorgeschriebenen Text. Julius Hermann hatte als Schuhfabrikant Methusalem einen großen, großen Bauch – so groß, wie die Bäuche der Schieber auf Karikaturen sind. Er war eine amüsante Karikatur – sicher; diese «satirische» Figur, der der Dichter kein Leben und keine Tragik gab, mit eigenem Blut zu erfüllen, gelang ihm nicht. Dasselbe gilt, glaube ich, von allen neueren Darstellern: Sie machten wohl das, was das Stück verlangte, aber sie machten nicht mehr. Vielleicht kann man das nicht recht fordern. Aber wie sehnte man sich den ganzen Abend nach mehr – nach besseren, reineren Tönen.
Vor Jahren vielleicht wäre das Stück aktuell gewesen, da es galt, alte Werke zu ersetzen und umzuwerfen. Heute, da Neues kommen sollte, müssen wir es ablehnen. Es kommt nicht darauf an, übertrieben witzig und grausig und zynisch zu sein – sondern auf Anderes, sondern auf sehr Anderes. Das «Andere» aber fehlt.
Die natürliche Tochter
In eine ehemalige Kirche ist die Goethe-Bühne eingezogen. Und das Geleitwort des Programmheftes sagt uns: Der Geist, der nach dem Hohen schwebt, er solle – in Kunst gewandelt – treu bleiben der Stätte. – Da die Beteiligten also mit so heiligem Ernste zum Werke schreiten, ist es keine Blasphemie oder peinliche Taktlosigkeit mehr: Theater zu spielen im Gotteshaus. Bei solchem Ernste wird die Komödie zum weihevollen Spiel, zum Weihespiel, dargestellt von den drei Altarflügeln der dreiteiligen Bühne.
Das Werk Goethes, das am deutschen Theater niemals heimisch wurde, sucht die junge Bühne zum Leben zu wecken: «Die natürliche Tochter». – Es ist nicht nur Barbarei und Unverstand, wenn die Bühnen sich bis heute gegen die Aufnahme dieser Tragödie wehrten. Sie ist voll kostbarster Schönheit, voll edelster, reinster Klugheit, voll von dem großen Wissen. Aber ein Etwas fehlt ihr, ein Funke, ein Irgendwas, das dem darzustellenden Werke gerade, dem Schaustück, unumgänglich nötig ist. Nennen wir es Leidenschaft? Oder, mit einem weniger hohen Namen, Leidenschaftlichkeit – oder, mit einem minderen, Wirksamkeit? – – Die deutschen Theater hatten so unrecht nicht, wenn sie sich in aller Stille weigerten, diese Tragödie dem Publikum auf der Szene vorzuführen.
Die Goethe-Bühne bemühte sich mit frömmster Andacht um das erlauchte Werk. Sie hatte das Glück, daß Frau Else Heims die Titelrolle verkörperte. Sie war von innigster, innerlichster Anmut, die, vom 3. Akt an, in gewaltiger Steigerung, tieferen, immer größeren Tönen wich. Wie das Leid läutert, wie das Leid groß macht – das wußte diese Frau uns darzustellen. – Ein gutes Ensemble stand ihr zur Seite, in dem freilich niemand die Grenzen des Konventionellen eigentlich überschritt.
Schluck und Jau
Gerhart Hauptmann nennt seine shakespearisch-holbergische Rüpelkomödie von den Kumpanen Schluck und Jau ein «Spiel zu Scherz und Schimpf in fünf Unterbrechungen». In der Inszenierung Paul Henkels (Bühnenbilder: Edward Suhr) sind die Unterbrechungen nicht weniger reizvoll als das Spiel selbst.
Bei jedem Szenenwechsel sieht man in dem dunklen Zuschauerraum in den Flambeaus zu beiden Seiten des Bühnenrahmens mildes Licht aufschimmern, während die Verwandlungen auf offener, beleuchteter Bühne vor sich gehen, hinter luftigen grünen Vorhängen, mit Jagdemblemen, die uns einen Teil des Schauplatzes abschließen.
Auch durch die Aufführung weht wohltuender Luftzug. Dank vor allem der Darstellung des Herrn Gerhard Ritter. Sein schlesischer Trunkenbold Jau, der allerdings in der Nähe des Geenigs von Sachsen geboren zu sein scheint, ist ein Prachtkerl. Ein wahlloser Genießer, dem von der ausgelassenen Hofgesellschaft eingeredet wird, er sei der Fürst, und die Herren seien seine Diener, und der, zur Macht gelangt, seine Derbheit, Brutalität und Herrschgier hemmungslos offenbart. Wie er von der ersten Befangenheit des Traumerwachsens allmählich in eine neue Situation hineinwächst: «Bin ich a Ferscht?!» Wie ungläubiges, verwundertes Lächeln in eine grausam-fanatische Befehlsmiene übergeht. Ganz köstlich, mit welcher Gier er die aufgetragenen Speisen verschlingt, Angeknabbertes wegwirft, wie er den Seifenschaum aus seinem Gesicht mit dem Hermelinmantel wegwischt. Gerhard Ritter begnügt sich keineswegs damit, die äußeren Umrisse dieser Gestalt zu heben; er versteht es vielmehr, sie aus der Komik heraus an die Grenze des Tragischen zu führen.
Sein Kumpan ist Armin Schweizer: Mischung aus devotischer Schneiderseele und unbeschwertem «Kinstler»-Gemüt, lustig, hilfsbereit, uneigennützig. Carl Ludwig Achaz als lyrisch-melancholischer Jon Rand, Werner Hollmann, der Aristokrat, der sich dem Bettler verwandt zu fühlen behauptet, und Fränze Roloff hielten sich auf der Gegenseite tapfer.
Es ist in der Volksbühne seit langem nicht so viel gelacht und geklatscht worden wie gestern abend.
Jannings als Tenor
«Der Tokaier» im Theater in der Königgrätzer Straße
«Bajazzo» im Straßenanzug. Mit Gesangseinlagen von Leoncavallo und glücklichem Ausgang. Keine Dolchstoßlegende wie die Oper («Bei allen Heil'gen, er macht Ernst»), sondern eine Komödie amüsanter Mißverständnisse, mit geschickten Steigerungen und dem effektvollen Witz des routinierten Bühnendialektikers Hans Müller.
Am Schluß des zweiten Aktes hat Emil Jannings als Nachfolger Carusos sein «Lache Bajazzo» zu schmettern. Nachdem aber die Gagen herabgesetzt worden sind, läßt er das (hinter der Szene) durch einen tenoralen Stellvertreter besorgen.
Als Tenor und Kammersänger hat er einen kontraktlichen Anspruch auf Dummheit, und er macht davon ausgiebigen Gebrauch entsprechend seiner Devise: «Dummheit ist Macht». In Wirklichkeit ist er ein Filou. Er mimt nur den Dummen, um die Frauen einzufangen. Namentlich seine Ehefrau. Sie ist der «Tokaier», an dem er vor jedem Auftreten nippt. Ohne diese zwei, drei Schlückchen in der Theatergarderobe geht's nicht. Sagt er. Um das blonde Gänschen von Frau glauben zu machen, sie sei der Anstrich zu seiner Kunst. Aber Agiechen empört sich gegen diese Rolle: «Ich lebe ja gar nicht. Ich mache nur Abenddienst.» Und ist schon bereit, mit dem Schieber Stanislaus in Paris ein ihrer würdigeres Liebesleben zu beginnen, als Hans Müller wieder mit einem neuen Dich Agathe ihrem Beppo in die Arme führt. Als mütterliche Betreuerin eines Riesenbabys in der Gestalt Emil Jannings'.
Jannings bemächtigt sich dieses Kammersängers mit seinem ganzen Impetus. Herrlich die Massivität seiner runden, behäbigen, lächelnden Existenz, sein Gang, seine vorgetäuschte Beschränktheit, die Jungenhaftigkeit, mit der er eine alte Liebe abtut, die ungeschminkte Ausdruckskraft seiner Sprache. Erstaunlich gelöst und nuanciert Carola Toelle, die durch ihre blonde, zarte Anmut und entzückende Keckheit erfreut. Daneben: die schöne Hanna Ralph, Curt Vespermann, der Schieber mit dem Schlafwagenbillett nach Paris, Hans Albers und Rudolf Jünger, der einen ulkigen Theatergarderobier altwienerischen Schlages hinstellte. Ein großer Publikumserfolg.
Sechs Personen suchen einen Autor
Münchener Theaterbrief
Man ist in dieser Stadt, die, alles in allem, dumm ist, wenn auch von einer hohen, unverwüstlichen Liebenswürdigkeit, nicht verwöhnt gerade, was theatralische Leistungen betrifft. Vom Gröbsten und Schlimmsten bekamen wir hier schon vorgesetzt. – Trotzdem war die Leistung dieses Abends, die Inszenierung Otto Falckenbergs von Pirandellos genialer Groteske, nicht relativ nur gut, nicht nur vergleichsweise, sondern absolut, sondern wirklich. Dieses sonderbare Werk, das halb mystisch-geheimnisvolles Spaßgebilde, halb handfeste Komödie, das halb melancholischschwieriges Traumstück und halb prächtiger Publikumsreißer ist, bietet einerseits dem Regisseur hundert dramatische Möglichkeiten, verlockt aber andererseits in seinem unerklärlichen Zwitterwesen sehr zur Geschmacklosigkeit, zu gar zu handfestem, gar zu wirkungstüchtigem Vorgehen. Der hohe künstlerische Instinkt des Otto Falckenberg, seine Kultur, seine edle Sensibilität verhütete jede Entgleisung. Ohne daß gemeine Mätzchen uns irgend geärgert hätten, legte sich das sinnreich gefügte Spiel wie ein dichter, unheimlicher, komischer und tief rührender Traum um unsere Sinne.
Daß die Münchener Kammerspiele, deren guter Ruf gemach zu sinken angefangen hatte, über junge zukunftsvolle und sehr begabte Kräfte noch immer verfügen, bewies allen diese schöne Inszenierung. Dem Schauspieler Hans Geibelt sowohl wie dem Schauspieler Kurt Horwitz gebührte fast das leidenschaftliche und hochgespannte Beiwort «genial». (Schade nur, zu schade, daß Geibelt, der die menschlichsten, rührendsten und dabei wunderlichsten Töne findet, von seiner fatalen sächsischen Mundart nicht loskommen kann.) Helene Sauer vibriert und zittert förmlich von jener höchsten und fruchtbarsten Nervosität des echten Komödiantentums. Hans Schweikart hat den scharfen, bis zum Zerreißen gespannten Akzent, die fast grotesk gestraffte Gebärde, das bedingungslose hager-biegsame Pathos wahrer jünglingshafter Intensität.
Der kluge Geschmack Otto Falckenbergs fügte an das schillernde Schein- und Wahrheitsspiel von den sechs Personen, die doch nur Schemen sind und suchen müssen nach einem, der ihnen Gestalt gibt – eine ganz köstlich, ganz abenteuerlich komische kleine Exzentrik-Komödie, ein pudelnärrisches, buntes Puppenspiel, in dem zwei schwarze, stattliche und jähzornige Franzosenherrschaften, nämlich Herr und Frau Boulingtier, so fürchterlich zanken, daß ein kläglicher, armer Gast, der sich bei ihnen gemütlich einzulogieren dachte, als Opfer ihrer prächtigen und radikal sinnlosen Temperamentsausbrüche einfach zu Grunde gehen muß. Das Stück hieß «Ein ruhiges Heim» und war von Courteline. Man mußte entsetzlich über sein Unwesen lachen.
Das war ein Abend, dessen sich keine Weltstadt zu schämen brauchte, ein Abend, mit dem diese unliterarische Stadt par excellence sich ruhig ein wenig brüsten könnte.
Das war ein Abend, für den München Otto Falckenberg von Herzen danken müßte, ein Abend, kurz und gut, dessen München sich freuen sollte.
1925
Mrs. Dot
Im Lessingtheater
Das Beste, wenn nicht das einzig Gute, dieses Abends war, daß Frau Adele Sandrock eine englische Mama spielte und so prächtig war, so über die Maßen stattlich, so wahrhaft majestätisch, daß unser Herz vor Freuden so recht im Leibe hüpfte und tanzte. – Sonst aber?
Vielleicht wäre «Mrs. Dot» von Maugham ein amüsantes Lustspiel, wenn ein elegantes und wirkungssicheres Ensemble sie aufführte. Wir wollen nichts gegen die routinierte Leopoldine Konstantin sagen, sie war resolut und fesch. Wir wenden nicht viel gegen Georg Alexander ein, er hat natürliche Spaßhaftigkeit, wenngleich er oft peinlich übertreibt. Wir werden nicht grob gegen André Matoni, wissen seine törichte Schönheit zu schätzen, fragen uns ganz nebenbei nur, warum er nicht lieber Operettenstar in Österreich wurde. Aber spielt man, in Gottes Namen, so englische Konversationsstücke? So laut, so possenhaft, so plump?!
Das Publikum lachte und klatschte. Schweigen wir vor seiner spottenden Beweisführung. Uns blieb der Eindruck: Eine diskrete und launige Aufführung hätte nicht dieses absolut schlechte Werkchen zum Erträglichen retten können. Eine laute, in manchen Einzelheiten unmögliche, in anderen mäßige Aufführung machten einen Schwank von vorgestern daraus.
Als heitere, positive und frohe Erinnerung blieb uns Frau Sandrocks prächtige Gestalt. Wir wünschten, daß dieser Frau irgendein Begabter ein buntes und starkes Theaterstück schriebe.
Zurück zur Schule
In der Komödie
Am Schlusse zischten Vereinzelte. War denn dies Stück zu dünn? – Geben wir zu. Seine Melodie ist ohne Stärke. Aber es ist Witz in dieser Melodie – Witz und Traurigkeit; das ist viel. Seine Atmosphäre hat Reiz, hat Duft, sie schillert lustig und ist geladen mit Möglichkeiten launiger und dann auch wieder melancholischer Natur.
Ein habgieriger Schuldirektor vermietet für die heißen Ferienwochen sein leerstehendes Internatsgebäude als Hotel, schlau den Vorteil benutzend, daß es in einem überfüllten Badeort gelegen ist. In diesem Pseudohotel, das noch nach Schule riecht und noch ganz voll Schulluft steckt, findet sich, wie sich von selbst versteht, eine hübsche kleine Gesellschaft von etlichen Herren und Damen zusammen, die sämtlich untereinander durch allerlei Liebesspiel oder aber durch mancherlei ernstere Pläne, langweilige Vernunftsverbindungen betreffend, verkettet sind. Nicht aber ohne Einfluß bleibt die Atmosphäre des Ortes auf ihre Gemüter – eine ungemein schillernde Atmosphäre, wie ich schon sagte: schillernd zwischen Erziehungsheim und mondänem Badeort – : Humoristisch-geduckte Ehemänner werden übermütig in seliger Erinnerung an ehemalige Musterschülertriumphe; Ehegattinnen, resolut sonst und praktisch, geraten ins «Poetische» hinein; Autofürsten sind wieder dumm und dick, wie damals, als die Klassenkameraden ihnen noch Dummheiten auf den breiten Rücken schrieben; eigentlich doch schon ganz heiratsfähige junge Mädchen gebaren sich veraltert – katholisch –, und zwischen zwei Menschen erwacht gar etwas, was wir fast – und bei aller Scheu vor diesem Worte – Liebe nennen müssen. «Hier ist eine große Liebe geboren worden!» jubelt ein junger Mensch. Und vielleicht würde dies dumm und flach erscheinen, wenn ein anderer es ausriefe. Da aber die Stimme Hans Brausewetters diesen so sehr gefährlichen Satz laut und lebendig werden läßt, klingt hier plötzlich in die Melodie eines Lustspiels, das wirklich hübsch ist, aber nicht stark, fast etwas anderes hinein – und etwas Größeres. Im zweiten Akte ist eine Liebesszene, eine zunächst ganz verschleierte, ganz schamhaft zugedeckte, die aber dann heftiger und immer inniger wird – da schwillt der Ton an, nimmt leuchtend zu, wächst, berauscht gleichsam über sich selbst hinaus.
Die Partnerin Hans Brausewetters war Erika Meingeist. Neben seiner großen Stärke und anmutsvollen Kraft, die strahlte, obwohl sie sich zuweilen unsicher zu verwirren schien, hatte ihre blasse, wenn auch vielleicht nicht weniger innige und leidenschaftliche Begabung harten Stand. Sie fesselte wohl, aber man wünschte oft vollere Klänge und eine geradere Linie. – Sonst auch gute und erfreuliche Leistungen. Margarete Kupfer kräftig und herzhaft erheiternd als tüchtige und einmal rührend-poetische Gattin und Mutter. Karl Ettlinger ein komischer, ein einfallsreicher, wohl doch ein bißchen konventioneller Pantoffelheld. Auch Walter Brandt, ein Autokönig, ebenso einfältig wie mit Glücksgütern gesegnet, lustig, aber in nichts frappierend. Grete Mosheim, die exaltierte Heiratsfähige, mager, blond, oft nur nett, aber zuweilen sogar ergreifend. Sylvia von Hodenberg endlich war in der Tat bezaubernd hübsch, frisch und natürlich zudem – was vollauf genügte für ihre Partie, die im wesentlichen zu kichern, zu schreien und zu küssen hatte.
Wird in diesem sauber gearbeiteten, originell erdachten Lustspiel «eine große Liebe geboren» – oder ist es nur Hans Brausewetter, der sie vor uns spielt und also miterleben läßt? Aber ein Atom von ihr ging durch den Abend, und darum war sein Inhalt nicht ein seichtes Possenamüsement, sondern mehr und Schöneres als das.
Brahms-Walzer
Man kennt die Melodie. Wenn sie einsetzt, dann ist es, als würde nun etwas laut, das die ganze Zeit schon in uns und um uns gewesen war. Das spinnt sachte ein wie ferne Erinnerungen. Das verblüfft nicht, es ist so altbekannt, ein linder und rührender Zauber. Wenn das Neue schreiend über uns hereinbricht, dann schließt man die Augen, enerviert, mit fliegenden Pulsen, wenn auch zur Aufnahme zitternd bereit. Erklingt aber das, was wir «immer schon kannten», wovon wir träumten, als wir noch Kinder waren, was uns die alten Dienstmädchen erzählten – es war schauerlich und dennoch wundersam anheimelnd –, dann wiegen wir nur lächelnd den Kopf. Fragen wir nicht, welches von beiden das stärkere und größere Erlebnis sein muß. Lauschen wir – –
Oben tanzen zwei Menschen, eine Frau und ein Jüngling. Sie ist weiß gekleidet, lieblich und weiß, wie sich's zum Brahms-Walzer ziemt. Sie wirft die Beine, sie ziert sich in jener Anmut, die es doch eigentlich gar nicht mehr gibt, die auf rührende Art verschollen ist, sich manchmal, ganz selten nur, schelmisch und doch ängstlich, hervorwagt. – Ein Jüngling ist bei ihr. Er trägt schwarzen Samt, vom Kopfe bis zu den Füßen. Aber über dem ernsten Stoff ist sein Gesicht knabenhaft.
Warum lassen diese beiden unseren Blick nicht mehr los? Womit bannen sie uns denn so, daß wir, wie erschrocken, die Augen nicht mehr von ihnen lassen können?! – Was sie äußerlich tun, ist ja fast mehr nicht als das Konventionelle. In jener Angst, die sich aus Keuschheit und aus Koketterie lieblich zusammensetzt, will sie dem Werbenden sich lächelnd entziehen. Weiß gekleidet flieht sie von dannen. Unbeholfen ist er hinter ihr drein. In süßer Schwäche neigt sie sich ihm zu – liegt schon in seinem Arm. Vereinigt vollführen sie etliche unternehmende Tanzschritte. Kurzes Glück. Sogleich entwindet sie sich ihm aufs neue. Er, jedesmal wieder traurig betroffen, müht sich zum zweitenmal, ihrer habhaft zu werden. Altertümlich-verliebtes Hin und Her. Es ist eine alte Geschichte, melancholisch und lustig. Am Ende küßt er ihr Nacken und Haar. – Was bannt unsere Augen? Wer sind diese zwei, die die wehmütige Verzücktheit solcher Spielerei bis zum Gespenstischen mit dem Raffinement und dem leidenschaftlichen Ernst ihrer Modernität verquicken und beides spukhaft ineinander übergehen lassen?! Das Faszinierende ist, daß die rührende Schlichtheit ihres Liebesspieles dadurch, daß sie mit Elementen äußerster und heutigster Künstlichkeit durchsetzt ist, nicht etwa an gerader, an überzeugender Linie verliert – und also pervertiert, falsch, krankhaft erschiene –, sondern daß sie nur, gesteigert, erhöht, verdichtet, in ihrer Art, wenn auch über sich hinaus vielleicht, als das, was sie ist, als Schlichtheit, heftiger, erschütternder, intensiver spricht. – Erschütternde Schlichtheit – –
Diese Frau hat ein Gesicht wie eine Maske. Es steht abenteuerlich bunt, mit irr lächelnden Lippen, unter rotem Haar die schwärzlichen Augenlider. – Wir sahen diese Frau zuvor als Salome. Sie hatte einen blutroten Schal um ihren Leib gewickelt – wie verzweifelt, wie wollüstig sie war.
Auf eine zuckende, klingelnde, kriegerisch-rhythmisch ansetzende, ins süße Nichts zurücktaumelnde Musik tanzte dieser Jüngling zuvor eine Arabeske. Wie gewaltig belebt, wie unmäßig heftig von innen heraus die Sprünge seines Körpers waren, der schwarz als Silhouette vor einem weißen Hintergrund erschien. – Jetzt ist dieser, der das Stärkste und Größte tanzen konnte, demütig hinter der weißlich Entschwebenden drein, hält knabenhaft-überglücklich die flüchtig sich Hingebende in seinem Arm, küßt der, nach neckischem Zwischenspiel endgültig ihm Gehörigen, mit geschlossenen Augen Haar und Nacken. Sie aber, die Salome war, bunt und verzweifelt – sie wirft die Beine im Musselinkleide, sie schmiegte sich an ihn, entwindet sich ihm lächelnd.
Vielleicht ist Schlichtheit groß, die sanft und stetig gegeben wurde, von vornherein. Größer ist Schlichtheit, die sich aus Qual und Verzerrung fand. – Anmut ist süß, die vom Himmel fiel. Süßer ist die Anmut, die aus Wollust und aus Verzweiflung, wie eine reine Blume aus einem Sumpf wächst. Dieses ist die erschütternde Anmut.
«Erschütternde Anmut» – das ist die Faszination, die von dem neuen Tanze ausgeht, den Henri und Anita Berber allabendlich in der «Rampe» zusammen tanzen. Sie war Salomé! Und sein Körper schnellte und bog sich in der Leidenschaft der «Arabeske». – Aber zusammen fanden sie heim zu jener Verspieltheit, zu jener innigsten Zärtlichkeit, die das Letzte ist.
Fragten wir uns nicht, was das Größere sei: das, was gellt und schreit und heftig und neu ist – oder das, was leise daherkommt, was in uns war und was wir immer schon kannten – die Kindheitsgeschichte? – Das Größte ist das, was aus dem Schrei heimfindet zum Lächeln.
Totentanz
Draußen, in der Klosterkirche, wo man so schwer hinfindet – versehentlich betritt man zunächst die Räumlichkeiten der Goethebühne, und Wiener Theaterlachen gellt einem entgegen, denn dort gibt es ja Gott sei Dank «Comtesse Guckerl», – in der Klosterkirche draußen spielt uns die Holtorftruppe ihren Lübecker Totentanz vor. Diesem Spiele, das von einer radikalen, krassen, ja grotesken Primitivität und wilden Frommheit ist, zuzuschauen, ist in einer Stadt, die alles ist, nur nicht fromm, ein Erlebnis sicherlich seltener und vielleicht sogar ergreifender Art. Denn in der Mitte des Spiels steht der Tod, ein schwarzer und schlanker Geselle – Holtorf selbst stellt ihn dar –, er ist nicht starr und nicht böse, sondern er ist wohl eher leidenschaftlich und fast mitfühlend, höhnisch zum einen und zartgesinnt zum anderen (der Tod, von dem ich träume, ist freilich größer und stiller, viel ruhiger träume ich ihn und nicht so heftig in schwarzer Anmut) – und um den Tod herum tanzen, schreien, weinen allerlei Menschen in expressionistisch-gotischem Reigen, Kaiser und Bäuerlein, Hausknecht und Nonne, verzweifelt oder demütig, kämpfend oder ergeben – schwatzen ein wenig, tanzen ein wenig, um am Ende dennoch der unheimlich-höflich einladenden Geste des schwarzen Meisters ins Dunkle hinein gebückt, Folge zu leisten. Eine leidenschaftlich grelle, eine aus rauher Finsternis zu unnatürlich buntem Lichte spukhaft erstandene Vision ist dieser Reigen der Menschen um ihr finster bewegliches Schicksal. Diese Vision erschüttert nicht ganz, weil sie nicht Schicksal ist und also nicht groß, sondern lautes, mittelalterlich übertriebenes Spiel vom Schicksal. Aber sie packt, sie greift gewaltig an Nerven und Herz – was das Bildhafte angeht zum mindesten, denn im Sprachlichen vermißt man oft gar zu sehr Können und Zucht, und das kommt, weil es ein Spiel von Inbrunst, Heftigkeit und Bemühung ist, ein Spiel nur, kein Schicksalslied, das von tiefster Seele kommt, eben ein frommes Spiel. Und ist das nicht etwas Seltenes?
Romeo und Julia
Ernst Deutsch ist kein Romeo. Sein Blick ist zu schief und zu starr. Seine Miene ist zu verzerrt. Seine Stimme entbehrt zu sehr der Weichheit und der Melodie. Den von der Leidenschaft grimmig Besessenen, den von Liebe Verstärkten, Verzweifelten kann er gestalten. Aber er ist nie der biegsame, schwärmerische, tänzerische, sangesvolle Jüngling. – Grete Jakobsen, eine zauberisch liebreizende, eine ganz wundersam und auf so rührende Art charmante Schauspielerin: ist sie wohl eine Julia? – Ihre Mittel reichen nicht aus zu den großen Affekten, ihre Anmut hilft über manches hinweg – aber, was in anderen Rollen vielleicht ein Reiz mehr nur war: eine gewisse Koketterie, die ihr eigen, kommt hier peinlich zum Vorschein, besonders da sie sich auch in tragischen Szenen hinter den Gebärden des letzten Schmerzes zu verbergen scheint. Wie rein war die Freude, als wir Grete Jakobsen in München einstmals als Wendta sahn. Oder in Shawschen Lustspielen. Dort war sie in ihrem Gebiet, reizend an ihrem Platz. Aber sie ist keine Julia.
Um dieses problematische Liebespaar gruppierte sich langweilig und auf die herkömmlichste Art ein ziemlich provinzielles Ensemble. Keiner war so, daß er bei einer Aufführung des altbewährten Stückes in Augsburg allzu sehr aufgefallen wäre. Heinrich Morlow, der den jähzornigen alten Capulet mimte, fiel allenfalls durch seine größere Kraft und sein stärkeres Temperament vorteilhaft aus dem Rahmen. Emil Lind, der für die Regie zeichnete, war ein etwas sehr undeutlicher und farbloser Bruder Lorenzo.
Wenn das Stück nicht so wundersam schön und ganz voll Musik wäre, brauchte man kein Wort verlieren über die Angelegenheit. Wäre die Aufführung schandbar gewesen und eindeutig skandalös, könnte man schimpfen. Was soll man tun, da sie mittel war, Augsburg am Lech, anständiges Stadttheater?
Denken wir an ein paar Töne der lieben Grete Jakobsen zurück. Wer im übrigen das Stück nicht kennt, sei herzlich aufgefordert, diese Lücke seiner Bildung durch einen Besuch im Wallner-Theater auszufüllen.
Kaspar Hauser
Jakob Wassermann, dessen Werk mir ferne liegt und den ich wenig kenne, hat ein Buch geschrieben, nicht ein Buch eigentlich, eine Chronik, die mir, vielleicht mehr noch ihres Gegenstandes als ihres eigentlich künstlerischen Wertes halber, sehr am Herzen liegt. Es ist dies die Geschichte des Fremdlings Kaspar Hauser.
In würdiger Sachlichkeit und stets mit jener großen Sorgfalt, die Liebe zum Gegenstande verrät, berichtet der Dichter, immer sich eng ans Historische haltend, das im letzten und tiefsten Sinne romantische, ja für alle Romantik sinnbildliche und gleichnishafte Schicksal des fremden und heimatlosen Kindes. Wenig Pathos ist in dem Buch, wenig Affekt, wenig Lärm. Es wirkt, es erschüttert, indem es, Seite für Seite, Kapitel für Kapitel ganz genau, ohne eigentlich viel Aufhebens zu machen, vom Lose seines knabenhaften Helden berichtet.
Aber ohne viel Aufhebens zu machen, eben ganz ohne Lärm nötig zu haben, legt sich der alte, innige Zauber solch ernsten Märchenerzählens nach und nach immer dichter um uns. Das Schreien und die zuckenden Gesten der Nervosität hatten uns oft erschreckt, peinlich berührt oder unmäßig vergnügt. Nie konnten sie so traumtief uns umspinnen wie der Tausend-und-eine-Nacht-Ton des ruhigen Fabulierens.
Wie nahe und lieb mir Kaspar Hauser war, als ich das Buch beiseite legte! Wie traurig ich war, daß die Welt ihn so grausam behandelte, den heimatlosen Prinzen, daß sie brutal nicht achthatte auf seine erlauchte Anmut, deren tiefstes Wesen ja Weltfremdheit wiederum ist! Sie glaubten, er lüge, wenn der hierzuland Vaterlandslose von einer dunklen und prunkvollen Heimat sprach. Sie sagten, er sei eitel, weil er so gerne seidene Strümpfe trug und sich so zu zieren wußte. Und sie waren zu plump, um zu wissen, wie nahe solche Eitelkeit dem Wesen der Trauer verbunden ist.
Als ich das Buch das erste Mal zu Ende gelesen hatte und also freigegeben war von dem hypnotisierenden Zauber der episch berichtenden Fabel – begann ich nachzudenken, versuchte ich, sinnend über dem zugeschlagenen Buche sitzend, mir selbst zu erklären, warum dieses rätselhaften Knaben Schicksal und Geschichte so sehr, so fast persönlich mich berührte. Und bald erkannte ich das Gleichnishafte seines Lebens, und daß hier durch äußere Umstände nur betont, durch mancherlei Zufall mir deutlich gemacht war ein im Grunde inneres Los, das mir sehr nahe, das mir wohl allzu nahe bekannt und lange vertraut war. Mit vielem andern, das ich liebte und mit dem ich verbunden war, brachte ich damals die für mich lebendig gewordene Gestalt des Knaben in Verbindung. Und am Ende fehlte nicht viel, daß ich zwischen dem gepeinigten und fremden Menschensohn und einem andern eine Verbindung ahnte. In solch grüblerischer Stunde vereinigte sich mir das Bild des als Lügner verlachten Prinzen mit dem Bilde dessen, der auch viel von einer «andern Heimat» hatte zu erzählen gewußt – mit dem Bilde also des Nazareners. Und ich erinnere mich, daß ein großer Dichter einst den Christus als das Symbol und Gleichnis aller Romantik erkannt hatte. Da erschrak ich fast über die Tiefe und Bedeutung, die das Wort in dieser Auslegung empfing. Und sinnend noch schüttelte ich, das Buch vor mir auf dem Tische, den Kopf über solch weihevolle Zusammenhänge.
Als ich dann wiederum in den Seiten der Erzählung blätterte, fiel mir mit Freuden etwas auf, das ich bis dahin übersehen hatte, ein Motto, das der Chronist dem Buche hatte vorangesetzt. Es lautete: «Zum Symbole ward die Gestalt …»
Là-bas
Der Mystiker, der Gott-Sucher sucht Gott auch noch im Kote. Im Kote Gott suchen: das ist Satanismus.
Jeder Sünde, jedem Rausche ganz sich hingeben, weil man in der Sünde noch und im Rausche «Gott» empfängt: das ist Satanismus.
Hingabe an das Schädliche, Dunkle, Abkehr von des Lichts friedfertiger Klarheit, Hinuntersteigen zum Inferno, zum «Làbas», das ist es.
Satanismus hat mit sexueller Leichtlebigkeit nichts zu tun. Satanismus ist nicht heiteres, phallisches Heidentum – er ist intensivstes, verbissenstes Christentum. Seine Ausschweifungen, die tiefen Krämpfe seiner perversen Unzucht sind letzte Frömmigkeit.
Huysmans, der uns in seinem «Là-bas» eine wahrhaft meisterliche Chronik des Satanismus schenkte, ist, wie ich fürchte, kein homo mysticus. Sein katholisches Ende im Kloster widerlegt nichts. Man kann das Raffinement auch so weit treiben, Mönch zu werden. Eher will es mir scheinen, als habe er seine erschlafften Sinne aufpeitschen wollen, indem er das Buch von Gilles de Rais schrieb. Dieser abgefeimte, kleine décadent hat ein ruchlossachliches Vergnügen an den Unterleibsekstasen seiner Gottsucher und Teufelsdiener. Mit leidenschaftlich-verbissener Präzision schildert er uns des Gilles de Rais' höllenheiße Orgien, bis zu dem Augenblick hin, da der heilige Aufrührer wie ein geduckter Wolf zum Kruzifix kriecht, sich freiwillig dem Gerichte stellt. Mit einer wahrhaft grauenerregenden Kälte, hinter der ein leises, schlimmes Feuer glüht und schwelt, stattet er Bericht ab von den inbrünstigen Schmutzereien der schwarzen Messe, wo unter unzüchtigen Zeremonien der Ex-Priester die Hostie besudelt, während Hysterische in absurden Ausschweifungen zu seinen Füßen ihr dunkles Gebet verrichten.
Das Problem des Satanismus ist ein tiefes, ein grundlegendes. Es ist das Problem Luzifers und des Antichrists. Es heißt: Aufruhr als Opferdienst. «Nein» schreien und in tiefster Seele «Ja» meinen. Wer es fassen kann, der fasse es.
«Là-bas» kommt als Roman nicht in Frage. Es handelt sich um keinen Roman, sondern um eine Chronik. Doch ist es vielleicht großartiger, an dieses Höllenproblem mit gewaltig einseitiger Wissenschaftlichkeit heranzutreten, als sich plump-ekstatisch hineinzuwerfen. Diese Eiseskälte ist heiß – so grimmig und lodernd heiß etwa wie die schaurige Objektivität des Matthias Grünewald, die Huysmans selbst als «mystischen Naturalismus» definiert, eine Formel, auch auf ihn selbst anzuwenden.
Wer dem Problem des Satanismus kühl gegenübersteht, wird diese eiseskalte Chronik vom großen Höllen-Aufstand des gottsuchenden Menschen gar «langweilig» finden. Wer es fassen kann, der fasse es.
Pädagogium
Ich glaube, daß England, von höherem Gesichtspunkte aus betrachtet, abseits liegt, außerhalb und beinahe rührend unbedrängt von den großen Strömungen der Zeit. In einer kleinen und ernsten Stadt, wie Oxford, kann es gewiß am reinsten sich offenbaren, das Beste und Vornehmste dieses Landes kann hier, gleichsam am geläutertsten und am festlichsten, anschaulich werden. Der gewaltige Lärm Londons ist nicht etwa tot, es ist sogar Lustigkeit in seinem großen Geräusch, er ist gravitätisch und leichtherzig. Das Gute, das Imponierende Englands vermögen aufmerksame Ohren meist aus seinem Stimmengewirr herauszulauschen, aber am Ende vernehmen sie auch Unreines darin und etwas wie eine ins Riesenhafte, ja ins Phantastische gesteigerte Ahnungslosigkeit, alle Dinge betreffend, die von heute sind, eine ganz selbstsichere, ganz vergnügte Ahnungslosigkeit zudem, die vielleicht geeignet ist zu amüsieren, vielleicht sogar Achtung einzugeben, auf irgendeine Weise aber eine erstaunte, belustigte Achtung, die sich mit Verachtung wunderlich paart.
Doch über Oxford liegt es wie eine Verklärung. Sportliche Naturnähe und köstlich-friedsamer Fleiß paaren sich reizend und fast überraschend in der Atmosphäre des Ortes. Mag es immerhin sein, daß das Körperideal, dem hier wohl so tüchtig nachgeeifert wird, von dem, das unsere Besten erträumen, sehr grundsätzlich sich unterscheidet. Das Ideal des englischen Internats scheint mir elegant und konservativ zu sein, herrenhaft und auf sachliche Ertüchtigung bedacht, ein rechtes Lordideal und ungemein englisch auf jeden Fall, das aber, über das wir denken und von dem wir sprechen in so vielfachen Variationen, ja, das vielleicht den innigsten, durchgehendsten, zentralsten Gedanken unserer Zeit überhaupt ausmacht, ist Verschmelzung einer hellenisch-schlanken Vollkommenheit mit etwas anderem, Neueren, Gewagteren, Süßeren – dem ich mit Worten nicht zu nahe kommen mag.
Mir ist es aber, als könne sich dieses Ideal, das sehr deutsch ist, sehnsüchtig, gespalten, unsicher seiner selbst und irgendwie ohne Rückhalt, aus einem so guten und stolzen Kraftbehälter, wie dieses alte Oxford es ist, gleichsam Nahrung holen, Sicherheit gewinnen, Festigung. Wir haben das so hoffnungsfroh hochgemute Experiment der «Jugendbewegung» gehabt, und wir mußten mit ansehen, wie es zerfiel und sich fruchtlos verlor. An hochmütig vereinzelten Stellen mühen sich deutsche Pädagogen immer noch, ihre Sehnsucht Wirklichkeit werden zu lassen, und, wie Schönes sie auch schon erreichten mit ihren «Freien Schulgemeinden» und ihrem «Arbeitsschulsystem», alles bleibt unfertig, ergreifend mangelhaft, ein deutsches Fragment.