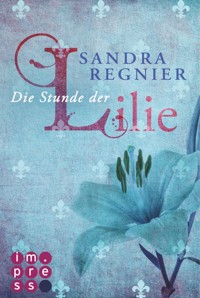5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Es geht weiter mit den Elfen aus Sandra Regniers Bestseller-Trilogie »Pan«!** Mit der Existenz von Elfen kann Allison sich gerade so abfinden. Dass sie nun das Sterben eines ganzen magischen Reichs verhindern soll, ist da schon schwerer zu verkraften. Doch sie ist der Schlüssel und damit die Einzige, die es vermag, die Regenpforte zu schließen, sobald das Herz der Anderwelt wieder an seinem Platz ist. Dabei muss Allison erst einmal herausfinden, wie es um ihr eigenes Herz bestellt ist. Denn das wird nicht nur von dem gut aussehenden Wächter Finn erschüttert, sondern auch von einem dunklen Prinzen, mit dem sie mehr verbindet, als sie je geahnt hätte... //Alle Bände der erfolgreichen Elfen-Reihe: -- Die Pan-Trilogie 1: Das geheime Vermächtnis des Pan -- Die Pan-Trilogie 2: Die dunkle Prophezeiung des Pan -- Die Pan-Trilogie 3: Die verborgenen Insignien des Pan -- Die Pan-Trilogie: Band 1-3 -- Die Pan-Trilogie: Die Pan-Trilogie. Band 1-3 im Schuber -- Die Pan-Trilogie: Die magische Pforte der Anderwelt (Pan-Spin-off 1) -- Die Pan-Trilogie: Das gestohlene Herz der Anderwelt (Pan-Spin-off 2) -- Die Pan-Trilogie: Der Sammelband der Anderwelt-Dilogie (E-Box des Pan-Spin-offs)//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Sandra Regnier: Das gestohlene Herz der Anderwelt
Mit der Existenz von Elfen kann Allison sich gerade so abfinden. Dass sie nun das Sterben eines ganzen magischen Reichs verhindern soll, ist da schon schwerer zu verkraften. Doch sie ist der Schlüssel und damit die Einzige, die es vermag, die Regenpforte zu schließen, sobald das Herz der Anderwelt wieder an seinem Platz ist. Dabei muss Allison erst einmal herausfinden, wie es um ihr eigenes Herz bestellt ist. Denn das wird nicht nur von dem gut aussehenden Wächter Finn erschüttert, sondern auch von einem dunklen Prinzen, mit dem sie mehr verbindet, als sie je geahnt hätte ...
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Das könnte dir auch gefallen
Leseprobe
Für Dechant Walter Fuß und Martin.
In tiefer Dankbarkeit und Freundschaft.
Und für Marc, der mir das Vertrauen zurückgab.
FINN
Allison war der Schlüssel. Nicht nur, weil sie an der magischen Pforte den Dauerregen abgestellt und damit den Zugang zu einer uralten Welt freigegeben hatte. Nein, dank ihr hatte ich auch weiter in die Zeit zurückspringen können als bis zum Tag meiner Geburt, wie es für uns Elfen normalerweise möglich ist. Während sie neben dem Symbol in der Ruine des Urquhart Castle am Loch Ness wartete, landete ich in einem Hain, unmittelbar vor einer Siedlung. Die Dämmerung hatte eingesetzt und der Himmel trug nur noch einen zarten Streifen Rotorange am Horizont. In der Ferne war ein Gebirge zu erkennen. Mir war sofort klar, dass es sich nicht um die Insel des kleinen Volkes handelte. Das hier war eindeutig das Snowdon-Gebirge in Wales, das ich von früheren Reisen kannte.
Hinter mir raschelte es. Mein Agenteninstinkt war augenblicklich wieder geweckt und ich duckte mich.
»Du kannst dich nicht vor mir verstecken«, sagte eine melodische Stimme mit unbekanntem Akzent. Sie gehörte einer Frau mit dunklen Haaren und einem ebenfalls dunklen Teint. Sie sah aus, wie ich mir eine griechische Göttin vorstellte.
»Ich weiß, was du bist«, sagte sie zu meiner Überraschung. »Was willst du, Elf?«
Die Frau musste eine Priesterin sein. Ihr langes, schwarzes Gewand war nur mit einer Gürtelschnalle verziert. Darauf war dasselbe Symbol zu sehen, das im Urquhart Castle das Tor zu einer anderen Zeit markierte.
Doch ehe ich antworten konnte, drang plötzlich Lärm zu uns. Die Menschen in der Siedlung schrien und dann war das Schlagen von Flügeln zu vernehmen. Es klang nach massigen Schwingen, als ob man einen riesigen Lederlappen in der Luft ausschüttelte. Schwefelgeruch verpestete mit einem Mal die Luft und ein gigantischer düsterer Schatten erschien am rotblauen Firmament.
»Du bist hier nicht sicher, Elf«, sagte die Frau. Sie war ganz bleich geworden. »Genauso wenig wie wir. Die Drachen haben uns alle verraten. Sag mir schnell, was du brauchst, damit ich meine Familie in Sicherheit bringen kann.«
»In welchem Jahr befinden wir uns?«, fragte ich verblüfft.
»Das ist nicht die Antwort, nach der du suchst«, entgegnete sie ungehalten.
Sie hatte recht. Ich sollte mich auf das Wesentliche konzentrieren. Ein Feuerstrahl erhellte für einige Sekunden die Dunkelheit. Die Frau zuckte zusammen.
»Hast du von der magischen Pforte gehört?«, fragte ich sie.
»Die Regenpforte?«
»Genau die«, bestätigte ich. »Sie wurde geöffnet und seither welkt die Anderwelt. Wie kann ich die Pforte schließen, damit die Anderwelt gerettet wird?«
»Die Anderwelt welkt nicht, weil die Pforte geöffnet wurde«, sagte die Priesterin. »Sondern weil das Herz der Anderwelt von seinem Platz entfernt wurde.«
Das Geschrei hinter der Palisade wurde lauter und panischer. Es brachte mich durcheinander, ich wusste nicht mehr, was ich zuerst fragen wollte. »Aber wie …«, begann ich ratlos.
Die Priesterin unterbrach mich mit einer ungeduldigen Geste.
»Die Frage ist nicht, wie das Herz gestohlen wurde«, sagte sie. »Deine Frage müsste lauten: Warum wurde es gestohlen? Das würde dich auf den Täter bringen.«
»Was hat der Täter von einem Kelch, der für die Existenz der Anderwelt notwendig ist?«, fragte ich überrascht. »Will er uns vernichten?«
Die Priesterin war nun ebenso unruhig wie ich. Sie schüttelte den Kopf und antwortete gereizt: »Nicht unbedingt. Der Kelch verwandelt jede Flüssigkeit in einen Heiltrank. Jede Krankheit, jeder gebrochene Knochen kann geheilt werden. Er fängt Quellwasser an einer bestimmten Stelle auf und nur dank dieser Position unter ebenjener Quelle gibt es keine Dürre und keine Seuchen in der Anderwelt.«
»Wie kann ich mich vor der tödlichen Luft hinter der Pforte schützen?«
»Gar nicht«, erwiderte sie. »Die Stadt ist nur für Drachenkinder zugänglich oder jene, die ihr Gift in sich tragen. Sie sind die Hüter. Die Hüter des Herzens.«
In diesem Augenblick zuckte ein weiterer Feuerstrahl am Himmel. Die Baumwipfel über uns gingen in Flammen auf. Schützend warf ich mich über die Frau.
Sie war zierlich und roch nach frischer Luft und Kräutern. Allison riecht besser, schoss es mir durch den Kopf.
Wir konnten nicht hierbleiben. Glühende und glimmende Blätter rieselten auf uns hernieder. Mir machten sie wegen meines natürlichen Schutzmantels nichts aus, doch die Frau würde bald keine Luft mehr bekommen. Ich hob die Priesterin hoch und rannte mit ihr davon – immerhin war ich dank meiner Elfenmagie schneller als jeder Drache. Ich spurtete auf einen Steinhaufen zu, der direkt hinter dem Hain lag, in der Hoffnung, dort Schutz unter den riesigen, rechteckigen Felsblöcken zu finden.
»Der Drache ist spurlos verschwunden!«, keuchte die Priesterin und wurde noch blasser, sofern das überhaupt möglich war.
»Was heißt, er ist spurlos verschwunden?« Ich suchte den Himmel nach dem fliegenden Ungetüm ab. Doch sie hatte recht. Er war weg.
»Vielleicht ist er in das Zeitloch gefallen, aus dem du gekommen bist«, mutmaßte sie.
»Das bezweifle ich«, sagte ich. »Drachen können nicht durch die Zeit reisen.«
Hinter dem Hain sahen wir das Feuer. Die Siedlung brannte lichterloh. Die Priesterin verkrampfte sich.
»Pass auf, Elf«, sagte sie völlig außer Atem. »Um die Pforte zu öffnen, bedarf es dreier Elemente. Elfenblut, Drachengift und ein Attribut des kleinen Volkes, von dem meine Vorfahren abstammen. Das kann ein vererbtes Muttermal oder ein geweihtes Medaillon oder auch eine von einem Hohepriester angefertigte Tätowierung sein. Die Gründer der drei Völker, Pan, Fafnir und die dunkle Königin, haben die Pforte einst versiegelt. Die Drachen sollten das Herz dort verwahren und bewachen. Doch Fafnirs Kinder waren zu gierig. Sie töteten ihren Obersten und beanspruchten alle Königreiche für sich. Die dunkle Königin floh auf eine Insel, die sie mit ähnlichen Zaubern schützte wie Pan seine Anderwelt.«
Sie holte tief Luft. »Und jetzt lass mich los. Ich will nach meinen Kindern sehen.«
Sie befreite sich aus meinem Griff und rannte zurück in Richtung der Siedlung.
Ich wollte ihr hinterher – es waren noch so viele Fragen offen! Ich musste wissen, wo ich das kleine Volk und dessen Königin finden konnte. Ich musste wissen, wie die Pforte wieder geschlossen werden konnte. Doch dann raschelte es zwischen den Hecken und ich konnte im Dunkel eine Silhouette erkennen. Was für ein Glück! Sie kam zurück.
Zu spät erkannte ich meinen Irrtum.
»Fionngall Lhaoghaire? Was tust du hier?« Es war Dougal. Ich kannte den Elfen noch aus meiner Zeit als Agent und ich wusste, er war dem Oberon treu ergeben. Und er wusste, dass ich nicht hier sein durfte!
»Im Namen des Oberon: Du bist verhaftet!«, rief er mit lauter Stimme.
Ich zögerte nicht eine Sekunde. Ich mobilisierte alle Magie, die ich in mir trug, und rannte an ihm vorbei zu dem Zeitfenster. Zu Allison.
Ich erreichte das Zeitloch und war sofort wieder im Urquhart Castle, wo ich Allison zurückgelassen hatte. Sie sah furchtbar verängstigt aus und ich hörte sofort, weshalb: Ein Drache! Da war ein Drache unter den Ruinen! Allison war schon einmal einem Drachen begegnet und diese Begegnung hatte sie fast das Leben gekostet. Das brachte mich auf eine Idee.
Ich schnappte mir Allison noch im Sprung und rannte mit ihr hinaus in die Nacht. Ich hörte die Elfen hinter mir und ich rannte schneller. Ich überlegte nicht lange, ich wusste nur einen Ort, wo Allison sicher sein konnte. Als ich das Mary King’s Close mit ihr erreichte, hatte ich unsere Verfolger für ein paar Minuten abhängen können. Doch sie würden gleich hier sein. Ich musste mich beeilen.
»Keine Angst, Allison«, sagte ich zu ihr. Dann brachte ich sie zur magischen Pforte. Ich hätte sie gern zum Abschied umarmt, doch dafür blieb keine Zeit. Sie schrie entsetzt auf, dann stieß ich sie durch den Torbogen, mitten auf den Innenhof in die tödliche Luft – außer Reichweite der Elfen.
ALLISON
Hinter der magischen Pforte
Das hatte er nicht getan!
Das durfte er nicht tun!
Ich hatte meine Augen fest zusammengekniffen und spürte den stechenden Schmerz vom Aufprall und den Nachhall seines harten Griffs, mit dem er mich am Oberarm gepackt und durch die Pforte geworfen hatte. Und ich spürte die Sonne, die heiß auf meinen Rücken schien.
ER HATTE ES GETAN!
Ich befand mich hinter der magischen Pforte. Da, wo noch jede Ratte, jeder Waschbär, Hund, Mensch und Elf einen grauenvollen Tod gefunden hatte.
Ich wagte kaum zu atmen. Ich hielt die Augen fest geschlossen und wartete.
Ich wartete auf den quälenden Schmerz, den Todesschmerz, der jeden Moment einsetzen und mich von innen her verbrennen musste. Ich wartete auf den Tod.
Ich wartete darauf, dass alles zu Ende ging. Jeden Moment musste es losgehen. Das hatte nie mehr als ein paar Sekunden gedauert.
Ich hielt die Luft an, kniff die Augen noch fester zusammen und wartete. Und wartete.
Und dann musste ich wieder atmen, weil mir schwindelig wurde. Ich nahm einen tiefen Atemzug und bekam prompt etwas in die Nase, was mich heftig husten ließ.
Erst nach dem Hustenanfall registrierte ich, dass nichts geschah.
Ich verbrannte nicht.
Vorsichtig hob ich den Kopf und blinzelte.
Das Erste, was ich sah, war Asche. Direkt vor meiner Nase. Die hatte ich eingeatmet und sofort wurde mir übel. Ich wusste, was diese Asche bedeutete. Sie war das letzte Überbleibsel von allen Lebewesen, die diesen Innenhof betreten hatten – und direkt gestorben waren.
Ich hatte vom Kellergewölbe aus gesehen, wie hier eine Ratte verendet war. Sie hatte dabei so qualvoll gequiekt, dass sich mir allein bei der Erinnerung die Nackenhaare aufstellten.
Und ich hatte die Asche eingeatmet! Schnell wischte ich mir über die Nase und sah die schwarze Schmiere auf meinem Handrücken. Igittigittigitt!
Ich rieb hektisch alles an meiner Hose ab. Erst dann wagte ich es, mich umzusehen. Ich befand mich in dem hübschen Innenhof mit den Düften nach mediterranen Gewürzen und den zerfallenen Häusern ringsum. Vor den Häusern befanden sich unkrautübersäte Gärten, und der ein oder andere Strauch trug verlockend aussehende Früchte.
Dort, wo eigentlich das Kellergewölbe von Edinburghs Unterwelt, das Mary King’s Close, sein sollte, war eine kleine Mauer mit einem höher angelegten Garten. Eine Treppe führte hinauf zu einem Haus ohne Dach.
Ich spürte zwar nicht den Todesschmerz, aber ich fühlte die Prellungen an meinem Bein und Ellbogen immer deutlicher. Verflixt und zugenäht!
Was war schiefgelaufen? Finn hatte mich abgeholt zu einem, wie er behauptete, sicheren Zeitsprung, was ich Idiotin für ein Synonym für Romantischer Abend gehalten hatte.
Eben noch waren Finn und ich am Loch Ness gewesen, dann faselte er etwas von Drachen, rannte mit mir zurück nach Edinburgh und schubste mich durch die magische Pforte. Dorthin, wo bislang noch jeder – wirklich jeder! – durch die giftige Luft getötet wurde. Was all die Aschehäufchen auf dem Boden um mich herum bewiesen.
Nur starb ich nicht.
Wie konnte Finn sich so sicher sein, dass ich hier nicht verbrannte? Er spielte mit meinem Leben! Um seine sterbende Anderwelt zu retten? War er fähig mich dafür zu opfern?
Der Gedanke war schrecklich.
Und dann kam ein anderer Gedanke. Der hatte die Stimme von Finn.
»Duck dich!«
Ohne nachzudenken, warf ich mich flach auf den Boden und rollte zur Seite. Neben mir schepperte es und als ich in Richtung des Geräuschs blickte, lag dort ein Dolch.
Ich wollte ihn gerade aufheben, weil ich mir nicht erklären konnte, woher er kam, als mich etwas an der Schulter streifte. Ich sah mich um.
Ein Pfeil lag auf dem Boden und hätte mich getroffen, wenn ich mich nicht zu dem Dolch gebeugt hätte.
»Verschwinde!« Dieses Mal war es nicht Finns Stimme, die mich warnte. Es war meine eigene. Ich wurde beschossen!
Ich sprang auf und wollte zu den Häusern laufen, deren Mauern Schutz versprachen. Doch sobald ich stand, knickte unvermittelt mein linkes Bein ein.
Ich knallte erneut in die Asche auf dem Boden. Flöckchen stoben auf, ich atmete sie ein, aber es blieb keine Zeit zum Spucken.
Ich rappelte mich auf, konzentrierte mich auf mein linkes Bein und humpelte seitwärts auf das nächste Haus zu. Das lag etwas erhöht, ich musste ein paar Stufen zu dem zugewucherten Garten steigen und stolperte erneut. Ich hörte ein Zischen in der Luft, fühlte einen scharfen Luftzug an meinem Ohr und etwas streifte mein Haar.
Flach robbte ich durch das Gestrüpp auf die Haustür zu. Dornenranken, Distelstacheln und Brennnesseln ritzten meine Hände auf, während über mir nun ein wahrer Tornado von Wurfgeschossen losbrach, aber ich erreichte das Haus, ohne – nun ja, ohne Kratzer wäre übertrieben, denn die Dornen hatten meine Hände und Knie ganz schön malträtiert – aber ohne von einem Pfeil oder Dolch getroffen zu werden. Völlig außer Atem rollte ich mich durch die Türöffnung hinter die schützende Mauer und blieb schwer atmend liegen.
Weitere Pfeile blieben zitternd in der morschen Holztür an der Wand gegenüber stecken. Mit einem klopfenden Herzen, das jeden Moment aus meiner Kehle zu springen drohte, lehnte ich an der Wand. Ein weiterer Pfeil krachte gegen das Holz. So hart, dass es endgültig auseinanderbarst. Mein Blick fiel auf die Waffe, die gar kein Pfeil war: Ich hatte so was schon im schottischen Landesmuseum gesehen. Und in Finns Waffenkammer. Es war ein Bolzen, wie man ihn bei Armbrüsten nutzte: ein kurzer, kräftiger Schaft, drei Klingen an der Spitze und damit absolut tödlich. Wenn der mich getroffen hätte, wären Wirbelsäule, Brustbein oder mein Schädel durchlöchert.
Ich spürte, wie mein Herz einen Moment lang aussetzte.
Es knallte neben mir und Putz bröckelte von der Wand herunter und hinterließ eine kleine Staubwolke.
Ich musste hier weg. Nicht mal die Mauer bot Sicherheit gegen solche Geschütze!
»Aber … ich dachte, ich sei der Schlüssel!«, rief ich verzweifelt. Das hatte Finn doch die ganze Zeit über behauptet. Wofür dann der Spießrutenlauf vom Loch Ness hierher, wo ich erschossen werden sollte? Ich wollte nicht sterben. »Ich dachte, ihr braucht mich, um die Pforte zu schließen und die Anderwelt zu retten!«
Statt einer Antwort rumste es erneut. Ich fühlte die Wand hinter mir beben.
Hektisch überlegte ich, ob es irgendeinen Weg, irgendeinen Ausweg gab – zurück nach Edinburgh, ins Internat – nach Hause.
Wenn, dann würde ich ihn auf keinen Fall hier in diesem zerfallenen Haus finden.
Wieder rumste es und dieses Mal spürte ich, dass die bröckelige Wand hinter mir im Begriff war, einzustürzen.
Ich musste weg. Dringend! Und so weit wie möglich.
Am liebsten hätte ich den Kopf um die Ecke gestreckt, um einen anderen Fluchtweg zum Kellergewölbe zu finden, aber ich war ja nicht blöd.
Ich sah mich um. Auf dem Boden in der Ecke lagen Tonscherben und ein kaputter Topf. Der Deckel war noch ganz. Ich hob ihn auf und wollte ihn in den Hof werfen. Doch kaum hielt ich den Deckel in die Türöffnung, schmetterte ein weiterer Bolzen voller Wucht dagegen. Er prallte ab in die Innenfläche meiner Hand.
»Aua!«, schrie ich und ließ den Deckel fallen. Meine Hand blutete.
Ich hielt meine Hand. Die Wunde brannte jetzt. Und dann gab mein Bein wieder nach und ich knickte zur Seite. Für den Bruchteil einer Sekunde war ich mit meinem Arm im Türrahmen, ehe ich mich zur anderen Seite hinter die sichere Mauer rollte. Doch das reichte bereits aus, damit die Elfen einen weiteren Bolzen auf mich abfeuerten.
Die Mauer mir gegenüber war durch die Geschosse zur Hälfte eingefallen und jetzt konnte ich einen Lichtschein im Raum dahinter erkennen. Dort gab es eine weitere Tür, durch die das Sonnenlicht fiel.
Ich würde keinesfalls einen Fuß zum Innenhof in Richtung Regenpforte setzen. Ich musste wohl oder übel einen anderen Weg aus dieser Ruinenstadt finden. Und dann würde ich nie wieder was von Elfen wissen wollen. Sollten sie ihre dämliche Tür alleine schließen. Ich kletterte über die eingestürzte Wand in den Vorraum und trat durch die Tür auf die sonnenbeschienene Straße.
In der Ruinenstadt
Ich stand in einer Straße voller zerfallener Häuser. Und ich konnte nicht zurück. Ich hatte alles hinter mir gelassen, was mein Leben bisher ausmachte: Edinburgh, meine Schule, meine Freunde.
Ich hatte die Wahl, dort im Innenhof zu sterben oder hier zwischen diesen Ruinen eine Gefangene zu sein. Womöglich auf ewig?!
Der Gedanke war einen Augenblick lang übermächtig. Mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen, als wäre ein Zauberkünstler dabei, meinen Darm zu verdrehen und aus ihm einen Pudel zu knoten.
Mir wurde speiübel und ein heftiges Zittern ließ mich genau da, wo ich war, zu Boden sinken.
Was zum Teufel hatte ich getan, um hier zu landen?
Ich hatte eine dämliche Tür geöffnet, na und? Ohne Absicht, ohne Wissen, dass es überhaupt diese magische Pforte gab. Und weil ich mich – freiwillig! – bemühte, diese Pforte wieder zu schließen, wurde ich auf einmal verfolgt und beschossen?
Ich wusste gerade selber nicht, was ich tun sollte: schreien, weinen, wimmern, rennen, Schutz suchen, liegen bleiben? Am liebsten hätte ich alles auf einmal gemacht.
Ein Instinkt, den ich durch die jahrelangen Reisen mit meinen Eltern, beide Tierforscher, unternommen hatte, hielt mich zurück. War ich hier wirklich allein? Was, wenn ich mit meinem Geheule Raubtiere anlockte? Oder Ureinwohner, die Fremde in riesigen Kesseln kochten? Die Stadt sah zwar wie von einer antiken Zivilisation erbaut aus, aber auch die alten Inkas hatten Menschen ihren Göttern geopfert. Es war garantiert besser, vorerst nicht zu schreien oder zu weinen. Das konnte ich immer noch, wenn ich mir sicher war, dass ich hier allein war. Aber meine Brust war so eng! Ich bekam kaum Luft. Jeder Atemzug fiel mir schwer.
Ich erinnerte mich daran, was die Ärzte mir damals nach meinem Unfall rieten, als ich Panikattacken hatte. Ich sollte sie wegatmen. Also holte ich tief Luft. Ein, aus. Ein, aus.
Nach ein paar weiteren tiefen Atemzügen nahm ich meine Umgebung wieder wahr.
Das Erste, das mir auffiel, war, dass in dieser Straße alle Häuser gleich aussahen. Mal mehr, mal weniger zerfallen. Sie waren aus dem gleichen hellen Bruchstein erbaut. Dächer, Türen oder Fenster, ehemals aus Holz, waren zwischenzeitlich verrottet oder fehlten ganz. Die Straße war breit und schlängelte sich einen Hügel hinauf. Weiter oben konnte ich eine Kreuzung erkennen.
Ich horchte angestrengt, ob ich vielleicht doch Stimmen hörte. Aber nein. Da waren keine Stimmen, kein Bellen, kein Miauen. Keine Schritte, kein Türenknallen, überhaupt nichts, was auf irgendein Lebenszeichen für eine bewohnte Stadt hindeutete. Nur ein leises Rauschen und Summen von Insekten.
Ich überlegte, ob ich das Haus hinter mir je wiederfinden würde. Doch wozu? Ich würde den Innenhof sowieso nicht noch mal betreten können, es sei denn, ich wollte mich umbringen lassen. Doch Sterben war keine Option.
Aber hier sitzen zu bleiben war ebenfalls keine Lösung.
Ich sollte versuchen einen anderen Rückweg nach Edinburgh zu finden. Und ich würde künftig alle Elfen so meiden, wie die Queen den Knoblauch mied. Eine piepsleise Stimme in meinem Kopf fügte hinzu: Schließ diese Pforte, dann wäre endgültig Ruhe und sie würden sich in ihre wieder geheilte Anderwelt zurückziehen.
Doch die verdrängte ich lieber. Meine bisherigen Bemühungen, die Tür zuzumachen, hatten mich hierhergeführt. Ich würde zuerst einmal einen Weg zurück suchen, nach Hause.
Es dauerte eine Weile, bis ich in der Lage war aufzustehen. Ich hatte das Gefühl, meine Schienbeine hätten sich in Gummi verwandelt. Vor allem das linke mit den Narben tat weh. Drachennarben hatte Finn sie genannt. Ich konnte nicht glauben, dass er das wirklich ernst meinte.
Ich wankte die Straße aufwärts und nach ein paar Schritten ließ das Zittern glücklicherweise nach.
Es war unerträglich heiß für Dezember. Ich schälte mich aus meiner dicken Daunenjacke, die ich noch trug, weil es in Schottland in den letzten Tagen ständig regnete – vereinzelt hatte es sogar gefroren oder Schneematsch gegeben.
Hier herrschte das komplette Gegenteil. Die Sonne sengte so heiß, wie ich den Sommer einmal am Mittelmeer erlebt hatte. Und es roch intensiv nach Thymian, Majoran und Salbei.
Finn hatte mich abends im Dunkeln zu der magischen Pforte gebracht, doch hier stand die Sonne so hoch wie zur Mittagszeit. Es gab kaum Schatten. Wie viel Zeit mochte inzwischen vergangen sein?
Ich musste auch meine dicke Strumpfhose loswerden. Dafür setzte ich mich und entdeckte ein fettes Loch am Oberschenkel. Kein Wunder bei der Wucht, mit der mich Finn in den Hof geschleudert hatte. Ich sollte ihn dafür bei der nächsten Begegnung vors Schienbein treten. Nein, ich würde ihn ebenfalls meiden wie ein Vampir das Sonnenlicht.
Die Narben an meinem linken Bein, die ich mir bei einem Unfall vor vier Jahren zugezogen hatte, juckten. Sie waren mit den Jahren etwas verblasst, doch als ich die Strumpfhose ausgezogen hatte, erkannte ich, dass sie wieder dunkelrot und geschwollen waren. Und es kribbelte, als wäre ich in einen Haufen Brennnesseln gefallen. Verflucht. Die Strumpfhose auszuziehen war gar nicht so einfach, denn die Schürfwunden an meinen Händen und Beinen brannten. Vor allem die Stelle, wo mich der Bolzen gestreift hatte. Meine ehemals weiße Bluse war total verdreckt von Asche, Staub und Blut. Hoffentlich gab es hier keine fleischfressenden Tiere, die Blut riechen konnten. Mal davon abgesehen, dass es eklig aussah. Am liebsten hätte ich alles ausgezogen.
Ich knüllte die kaputte Strumpfhose in der verletzten Hand und hoffte, dass die Wunde durch den Druck bald aufhören würde zu bluten. Dabei fiel mir auf, dass ein Haus weiter oben stabiler aussah als die meisten. Vielleicht fand ich dort einen weiteren Innenhof – und eine andere magische Pforte.
Das Haus hatte auch tatsächlich eine Hintertür. Sie führte zu einem kleinen Garten, und direkt hinter der Mauer des Gartens sah ich das Meer. Das erklärte das Rauschen, das zu hören gewesen war. Das Wasser war azurblau. Ich konnte nicht anders. Ich staunte. Ich hatte schon einmal ein so wunderschönes blaues Meer gesehen. Auf der Insel Avalon. Finn hatte mich dorthin gebracht. Der Moment mit ihm am Strand von Avalon war so schön gewesen. Der Gedanke daran zog den Knoten in meinem Magen noch enger. Erst machte er einen auf guten Freund und dann pfefferte er mich hierher – und hielt nicht mal seine Kumpane davon ab, auf mich zu schießen! Warum hatte er mir das angetan? Ich fühlte den Kloß in meinem Hals. Ich hatte ihm vertraut. Und dann machte er so was!
Ich zwang mich weiterzugehen und betrat noch fünf weitere Häuser, aber ich fand weder eine Pforte noch Asche noch einen sonstigen Hinweis, der auf einen magischen Zugang hindeutete. In einigen Häusern sah ich zerbrochene Tonscherben und verfaulte Möbel von den ehemaligen Bewohnern, aber ich konnte nicht ausmachen, ob sie die Stadt fluchtartig oder geplant verlassen hatten.
Es wäre nicht schlecht, so langsam mal irgendwo auf Trinkwasser zu stoßen. Es war wirklich warm und ich schwitzte. Vor allem mit der dicken Jacke unterm Arm.
Mit dem Durst kam die Angst, hier womöglich die Nacht verbringen zu müssen. Sofort wurde meine Brust wieder enger.
Ich musste den Ausweg finden! Und das schaffte ich nur, wenn ich ruhig blieb, mich aufmerksam umsah und nach Hinweisen suchte.
Und dann sah ich es. Es war das gleiche Zeichen wie am Loch Ness.
Dieses unterbrochene W, dem die unteren Ecken fehlten.
Es befand sich eingeritzt in die hellen Steine eines Hauses an einer Kreuzung. Am Loch Ness hatte dieses W Finn den Zugang zu irgendetwas Wichtigem gewährt. Da ich fünf Minuten am Urquhart Castle Zeit gehabt hatte, darauf zu starren, fiel mir auf, dass dieses hier im Gegensatz zu dem am Loch Ness spiegelverkehrt dargestellt war. Die längere Senkrechtlinie deutete in die andere Richtung. Ob das ein Wegweiser war? Es war alles, was ich hatte, also schlug ich die angedeutete Richtung ein. Es ging leicht hügelan.
Die Stadt war riesig und die Stille wurde mir immer unheimlicher. Die Sonne brannte unablässig und mein Verlangen nach etwas zu trinken wurde stärker. Ich hörte das Rauschen der Wellen vom Meer immer lauter. Ob das auch mit dem Durst zusammenhing? Meine Freundin Emma hatte mal erzählt, dass man immer das deutlich wahrnahm, wonach man sich am meisten sehnte. Ihr sei mal bei einer Diät aufgefallen, wie viel Werbung es für Essen, Süßigkeiten und Fast Food gab. Camilla und ich hatten uns damals über sie lustig gemacht.
Als ob Emma eine Diät nötig hätte bei ihrer Modelfigur. Aber nun fielen mir ihre Worte wieder ein, denn das Wasserrauschen schien überdeutlich zu werden.
Das W entdeckte ich nun häufiger. An Kreuzungen war es ins Pflaster und an Häusern eingelassen. Der längere Strich war unterschiedlich angebracht. Ich folgte ihm, bis ich staunend stehen blieb. Dieses W hatte mich zu einem Hafen geführt. Ein richtiger Hafen mit gemauerten Anlegestellen. Nur, dass keine Schiffe auf dem Wasser schwammen. Die lagen alle auf Grund.
Im glasklaren Wasser des Hafenbeckens konnte man Fische und Muscheln auf dem Boden erkennen, außerdem verrottete Holzschiffe. Es waren meist kleine Fischkutter aber auch zwei Galeeren, modrig und verfault. Das war so trostlos. Ich hatte nicht mal an die Möglichkeit gedacht, übers Meer einen Ausweg zu finden. Aber hier, mit all den gesunkenen Schiffen, wurde mir deutlich, dass es vermutlich einen triftigen Grund gab, weshalb die Stadt verlassen war – der womöglich nichts mit einem Krieg oder Kampf zu tun hatte.
Der Hafen war groß und von einer Mauer eingefasst. Sogar ein Leuchtturm war zu sehen und … ein Palast.
Auf einer Anhöhe, der Straße – entlang des Hafens –, stand ein Palast!
Er war riesig. Die äußerste Wand war mit roten Säulen bestückt, wie bei einem griechischen Tempel. Und auf jeder Säule glänzte in leuchtendem Gold das W.
Ich wollte darauf zugehen, es mir näher anschauen – und fiel zu Boden. Mein Bein! Ich konnte den Sturz mit meinen Händen abfangen. Für einen Moment lang hatte ich die Schmerzen vergessen, doch jetzt waren sie schlagartig zurück. Die Narben pulsierten, die Schürfwunden brannten und mit einem Mal überkam mich der ganze Frust und die Angst. Ich konnte nicht anders. Ich weinte. Ich blieb einfach zusammengekauert liegen und heulte Rotz und Wasser. Ich war mutterseelenallein in einer toten Stadt und der einzige Rückweg wurde von mörderischen Elfen bewacht. Sollte mein Vater je erfahren, was Finn mir angetan hatte, würde er ihn bestimmt verprügeln. Elfenkräfte hin oder her.
Ich verfluchte Finn, verfluchte meine Eltern, die mich ins Internat abgeschoben hatten, verfluchte die Elfen, verfluchte diese Stadt, verfluchte das Mary King’s Close, verfluchte meinen Unfall von damals mitsamt den Narben, verfluchte unsere Schulleiterin Mrs Bell, die mich Finn anvertraut hatte, ohne zu wissen oder zu hinterfragen, wer er war. Ich verfluchte sogar den Wasserspender unserer Schule, weil der dort stand und nicht hier. Ich weiß nicht, wie lange ich da lag und heulte, aber irgendwann ließ der Schmerz nach. Das Licht um mich herum hatte sich verändert.
Das war einen weiteren Fluch wert, denn es erinnerte mich daran, dass ich um die Nacht hier nicht herumkam. Allein. Im Dunkeln.
Verdammt, verdammt, VERDAMMT!
Ich wischte mir übers Gesicht und versuchte erneut auf die Beine zu kommen. Es war nicht einfach, aber es ging. Langsamer als zuvor, weil ich mich auf jeden Schritt konzentrierte, humpelte ich den Hügel hinauf auf den Palast zu.
Der Palast
Im Gegensatz zu den Häusern der Stadt war der Palast nicht eingestürzt. Ich brauchte einen Moment, ehe sich meine Augen an das Dunkel im Innern gewöhnt hatten. Ich stand am Eingang zu einer großen Halle. Das unterbrochene W war überall zu sehen. Ansonsten wirkte hier alles ebenso verlassen wie in der Stadt. Welkes Laub lag auf dem Boden, hereingeweht durch eine Tür an der Rückwand.
Die führte in einen Innenhof, in dem es intensiv nach Thymian und Salbei duftete. Aber alle Sträucher waren vertrocknet, und die Sonne war noch weiter gesunken.
Der Palast wirkte wie viele aufeinandergestapelte und aneinandergereihte Schachteln. Er kam mir sogar größer vor als das Schloss Versailles. Einige Räume waren verziert mit Säulen oder Mosaiken und die Wände waren mit leuchtenden Farben bunt bemalt. Wenn es einen anderen Ausweg gab, dann doch wohl hier, oder? Für Könige oder Fürsten wurden doch immer Geheimgänge gebaut, damit sie im Notfall flüchten konnten.
Ich ging durch mindestens zehn Räume und weitere drei Innenhöfe. Alle waren unmöbliert, alle waren leer bis auf Spinnen, Insekten, Staub und vom Wind hereingewehten Schmutz. Glücklicherweise hatte ich – dank meinen Eltern – keine Angst vor Spinnen. Hier gab es ein paar sehr große, vor denen sogar mein Freund George geflüchtet wäre. Obwohl George erst knapp zwölf Jahre alt war und dank seiner Vorliebe für unterirdische Gänge schon so einige Riesenexemplare gesehen hatte.
Eine Spinne krabbelte gemächlich in den nächsten Raum und ich folgte ihr. Das Licht wurde mittlerweile immer spärlicher, ich würde mir sehr bald überlegen müssen, was ich tat, wenn es ganz dunkel wurde, Betten schienen hier nicht …
»Aaah!«
Ich stolperte rückwärts und fiel auf meinen Hintern. Da war jemand!
Ich war doch nicht allein in dieser Stadt!
Mein Herz hämmerte gegen meinen Brustkorb. Damit hätte ich ohne Probleme einen Nagel in die Wand hauen können.
Noch während ich das dachte (und mich selber fragte, was das für ein dämlicher Gedanke war), begriff ich, dass sich der Mensch nicht bewegte. Ich starrte genauer auf die Wand. Es handelte sich nur um ein Bild. Allerdings wirkte es so echt, weil es nicht nur gemalt, sondern teilweise in die Wand gemeißelt war. Die Augen bestanden aus eingelassenen Edelsteinen und die Sonnenstrahlen fielen durch die vielen kleinen Fenster an der gegenüberliegenden Seite gebündelt darauf, was sie so lebendig aussehen ließ. Auf einmal fühlte ich mich überhaupt nicht mehr wohl. Die abgebildete Person sah aus, als könnte sie jeden Moment aus der Wand heraustreten.
Ich stand wieder auf und sah mich um. Dieser Saal war mit Abstand der prachtvollste, den ich je gesehen hatte. Die Wände waren voll von lebensgroßen und erschreckend realistisch dargestellten Menschen, im Hintergrund waren eine blühende Landschaft und eine Stadt gemalt. Die Ruinenstadt hatte offensichtlich schon bessere Tage erlebt.
Während ich daraufstarrte, ging mir auf, dass die Sonne weitergewandert war und nun das nächste Bild anstrahlte. So wurde Szene für Szene nacheinander ins rechte Licht gerückt. Ich betrachtete die Bilder mit noch immer heftig klopfendem Herzen.
Es war immer ein und derselbe Mensch zu sehen, dieselbe Haarfarbe, dieselben hübschen Gesichtszüge, dieselbe Kleidung. Aber was sich auf jedem Gemälde änderte, war der Gesichtsausdruck, der sich mehr und mehr schmerzvoll verzog.
Auf dem dritten Bild brachen Flügel aus dem nackten Rücken des Mannes, der den Kopf zu einem stummen Schrei in den Nacken gelegt hatte. Im nächsten Bild verwandelten sich Füße und Hände zu Klauen. Jedes Bild zeigte einen weiteren Verwandlungsgrad und sein Gesicht wurde ständig spitzer, länger. Selbst in diesem Dämmerlicht waren Schuppen gut zu erkennen, die sich allmählich über die nackte Haut zogen, als würden sie darauf wachsen.
Hier verwandelte sich ein Mensch in einen Drachen.
Unwillkürlich dachte ich an den finsteren Raum im Urquhart Castle, wo ich mit Finn gewesen war. Der Raum am Loch Ness hatte ein bodenloses Loch gehabt und während ich darauf wartete, dass Finn von seinem Zeitsprung zurückkehrte, war jemand oder etwas dabei, aus diesem Loch zu mir in den Raum zu klettern.
Finn hatte gesagt, es sei ein Drache gewesen. Er hatte gesagt, die Narben an meinem Bein seien Drachennarben.
Aber es gab keine Drachen. Meine Eltern reisten seit zwanzig Jahren um die Welt, um seltene Tiere zu erforschen. Wie konnte es sein, dass sie in all den Jahren nie einen auch nur erahnt hatten? Finn würde mich doch nicht anlügen, oder?
Doch Finn hatte mich auch durch die Pforte geschmissen.
Finn war ein Verräter.
Ich fühlte, wie ich wieder zu zittern begann und die Schmerzen in meinem Bein stärker wurden. Damit ich nicht wieder zu Boden fiel, lehnte ich mich an die Wand.
Das Licht war nun bei dem endgültig verwandelten Drachen angelangt.
Er hatte Flügel, ledrige Hautlappen, die sich zwischen den Schulterblättern befanden und ausgebreitet waren, und einen Reptilienkopf und gespaltenen Schlangenschwanz.
Ganz langsam wanderte die Sonne noch etwas weiter, bis um die Ecke an die nächste Wand. Die hatte bislang so im Dunkeln gelegen, dass ich dort nichts erkennen konnte, aber nun wurde es deutlich.
An der Wand befand sich ein Podest, gemauerte Stufen führten auf eine Art Bühne und direkt darüber war in Blau- und Goldtönen ein Bildnis, das eine gekrönte Seeschlange zeigte. Die Schuppen wirkten so echt und das Bild war noch viel lebendiger als der gemalte Drachenmensch daneben. Ich ging ein paar Schritte näher und erkannte, dass es kein gemaltes Bild war. Es war ein Mosaik, jede Schuppe war aus blauen Glassteinen gefertigt, die Augen und Zähne traten hervor und dadurch wirkte es so lebensecht.
Es zeigte eine Schlange, deren Kopf aus dem Wasser ragte sowie Buckel und Schwanz. Dank der wandernden Sonne sah es aus, als gleite sie auf dem Wasser dahin.
Das kam mir extrem bekannt vor.
Das abgebrochene W!
Es handelte sich um ein Piktogramm! Das unterbrochene W war ein vereinfachtes Symbol für einen Wasserdrachen oder eine Seeschlange aus der Mythologie dieser Stadt.
Mit einem Mal war mir noch unheimlicher zumute. Es würde mich nicht wundern, wenn die Schlange auf dem Bild um Mitternacht aus der Wand sprang.
Tropf. Tropf. Tropf.
Sogar das Wasser plätscherte. Ich sollte verschwinden. Ich humpelte zu einem der Fensterchen, um zu sehen, wie viel Zeit beziehungsweise Sonnenlicht mir noch blieb. Nach meiner Handyuhr hatte ich eine Stunde das Schauspiel des wandernden Lichtstrahls beobachtet.
Tropf. Tropf.
Allison, werde nicht verrückt. Du hast Durst. Du bildest dir das alles ein.
Tropf. Tropf.
Nein, das bildete ich mir nicht ein. Da tropfte etwas!
Ich hielt einen Moment lang die Luft an, um mich auf andere Geräusche zu konzentrieren. Schlurfen, Kratzen, Schmatzen zum Beispiel. Ich wollte keinesfalls einen Drachen bei seiner Mahlzeit stören.
Nein, nichts. Das Tropfen klang dumpf, es kam also nicht aus diesem Saal, oder … war dort auf dem Podium vor dem Nessie-Bild eine Bodenöffnung? Ja, da war eine Öffnung und eine Treppe führte hinunter. Ganz vorsichtig, weil ich noch immer fürchtete ein Untier könne jederzeit auftauchen, näherte ich mich dem quadratischen Loch.
Dort unten war es stockdunkel. Doch das Tropfen war nun ganz deutlich zu vernehmen. Dort unten war Wasser. Augenblicklich wurde mein Mund noch trockener.
Also nahm ich mein Handy aus der Tasche und leuchtete hinein. Ganz vorsichtig ging ich Stufe für Stufe nach unten. Ich zählte fünfzehn Stufen, bis ich den Boden erreichte. Der Lichtschein meines Handys erfasste die Wände ringsum, was mich schon mal aufatmen ließ. Es gab keine dunklen Gänge, aus denen plötzlich jemand rausspringen könnte. Hier war nur das Symbol in einer meterhohen Bordüre angebracht. Hier war nur ein weiterer Raum, allerdings stand in der Mitte eine halbe Säule mit einer Kuhle, in die es tropfte.
In dieser Kuhle hatte sich Wasser angesammelt. Ich probierte vorsichtig mit einem Finger und jubelte: Süßwasser!
Gierig beugte ich mich über die Säule und trank. Das Wasser war kühl, es schmeckte etwas metallisch, aber es war eindeutig Trinkwasser. Ich spürte, wie es mir auf den Hinterkopf tropfte, doch das störte mich nicht, im Gegenteil. Es hätte ein ganzer Schwall herunterkommen können und ich wäre dankbar stehen geblieben. Das Wasser in der Kuhle war viel zu schnell ausgetrunken. Ich wischte mir den Mund und seufzte.
Das hatte so gutgetan! Allmählich beruhigte sich auch mein Puls wieder.
Ich leuchtete mit der Taschenlampe durch den Raum. Das Wasser tropfte aus einem winzigen Loch in der Decke. Seltsam. Direkt darüber befand sich doch nur der Drachensaal. Alle drei Sekunden drang ein Tropfen heraus. Schade, es würde eine Weile dauern, bis sich die Kuhle wieder füllte. Doch das Mosaik an der Wand war interessant. Es zeigte eine Säule wie diese, aus der ich soeben getrunken hatte, allerdings stand darauf ein Gefäß. Ein Kelch mit aufwendigem Muster.
Und er wurde von einem Drachen, einem Elfen – deutlich an den spitzen Ohren zu erkennen – und einer Frau mit dunklerem Teint auf den Sockel gestellt. Schlagartig wurde mir klar: Der Kelch musste das Herz der Anderwelt sein!
Es war also kein Mythos. Es existierte wirklich. Beziehungsweise hatte existiert, denn der Sockel, auf dem der Kelch normalerweise stand, war leer. Bis auf ein paar Tropfen Wasser.
Das hier war der Platz, an den das Herz zurückgebracht werden musste. Das war der Ort, nach dem die Elfen gesucht hatten. Dann würde das Welken in der Anderwelt aufhören. Die Pforte würde sich schließen. Alles wäre wieder gut! Blöd nur, dass der Kelch gestohlen worden war. Wohin, weshalb, von wem – alles offene Fragen, wobei Finn eine vage Vermutung in Bezug auf den Täter hatte. Er vermutete, dass das kleine Volk mit der dunklen Königin dahintersteckte. Die Frau, die da neben dem Drachen und dem Elfen abgebildet war, schien den Verdacht zu bestätigen. Ich betrachtete erneut das Mosaik genauer, aber natürlich standen hier keine Antworten.
Mein Handy flackerte. Der Akku schaltete auf Sparmodus. Ich musste hier schnell raus. Ich würde zurück zum Innenhof gehen und den Elfen sagen, dass ich den Türöffner gefunden hatte.
Als ich in den Saal zurückkehrte, war es da beinahe so finster wie im Keller darunter.
Ich humpelte so schnell ich konnte durch die nächstbeste Tür – und befand mich auf einem Balkon, hoch über dem Meer.
Mir wurde elend zumute, als ich die letzten Sonnenstrahlen im Meer versinken sah.
Ich starrte verzweifelt in den Himmel. Die Sterne leuchteten auf und eine dünne Mondsichel war zu sehen. Aber der Mond war so dünn, so neu, er spendete kaum Licht.
Kein Ausweg. Kein Bett. Auch die Insekten waren verstummt und nur das Rauschen der Wellen, die unten gegen den Felsen klatschten, war noch zu hören.
Ich wollte heim. Ich wollte Licht. Die Panik schlug schneller über mir zusammen als die Wellen unter mir gegen den Fels.
Ich kauerte mich auf den Boden, schlang meine Arme um meinen Oberkörper und wiegte mich schluchzend hin und her. Was sollte ich nur tun?
Irgendwann musste ich eingeschlafen sein, denn als ich die Augen wieder aufschlug, ging die Sonne gerade auf. Mein Mund fühlte sich pelzig an. Die Zunge war geschwollen und ich konnte meinen eigenen Atem riechen. Ich humpelte zurück in den Kellerraum mit dem Wasser und leckte gierig das bisschen Wasser aus der Kuhle, das sich über Nacht darin gesammelt hatte. Es nutzte nicht viel. Mir war heiß! So heiß. Alle Knochen taten mir weh. Meine Kopfhaut schmerzte. Ich hatte mir gestern in der prallen Sonne garantiert einen Sonnenbrand geholt. Wenn nicht sogar einen Sonnenstich. Rote Haare und helle Haut vertrugen sich einfach nicht mit zu viel Sonne. Ich glühte und hatte Gliederschmerzen. Ganz klar, ich hatte Fieber. Ob vor Wassermangel, Hunger oder dem abrupten Wetterwechsel vom winterlichen Edinburgh in diese hochsommerliche Stadt, war letztendlich egal. Ich würde sterben, wenn ich es nicht bald gesenkt bekam. Aber wie – ohne Aspirin, Antibiotikum oder auch nur Tee?
Wasser. Kühles Wasser konnte es senken. Nicht nur zum Trinken, sondern einfach, um den Körper zu kühlen.
Ich musste zurück zum Hafenbecken!
Es war wohl das Anstrengendste, was ich je hatte tun müssen. Ungefähr fünfhundert Meter trennten den Palast vom Hafen. Doch dieser Weg war der längste und beschwerlichste, den ich je gegangen war. Zweimal fiel ich hin, weil mein Bein einfach wegknickte. Der Thymian-Salbei-Geruch machte mich wahnsinnig. Davon wurde ich hungrig. Und es gab nicht mal ein Blatt, auf dem ich hätte herumkauen können. Jede Bewegung war übermenschlich anstrengend. Alles tat mir weh. Meine Haut glühte, die Narben an meinem Bein brannten, als stünden sie in Flammen. Als ich dann endlich – ENDLICH – die Kaimauer erreicht hatte, ließ ich mich völlig erschöpft vornüberfallen mit Blick aufs Meer. Ich hielt eine Hand ins Wasser. Es war kühl. So angenehm kühl. Ich machte mir nicht mal die Mühe, meine Klamotten auszuziehen, und ließ mich geradewegs ins Wasser gleiten.
Das Wasser war so klar und schimmerte blaugrün. Mit giftgrünen Fischen darin. Sie schwammen unter mir hindurch, flüchteten vor meinem Schatten.
Das lenkte mich etwas ab. Es hatte etwas Beruhigendes, Meditatives. Das belebte mich und ich rollte mich schwimmend vom Bauch auf den Rücken, ließ meine Haare nass werden und mich treiben. Herrlich! Ich drehte mich wieder auf den Bauch und erschrak. Der Fischschwanz war groß. Riesig! Wie von einem Hai. Und er war giftgrün. Doch statt spitzer Zähne waren vorn rote Locken.
Chloe!
»Hey!«, stieß ich erschrocken aus, als ich unter Wasser gezogen wurde.
Das Salzwasser brannte in meinen Augen und als ich endlich wieder sehen konnte, war Chloe unmittelbar vor mir – unter Wasser.
Ich hatte nicht geträumt! Ich war nicht mehr allein! Ich hätte sie am liebsten umarmt, aber ich brauchte Luft. Also tauchte ich kurz auf und dann wieder unter.
Sie schwamm direkt vor mir, blieb zwar mit dem Kopf unter Wasser, aber sie war da. Chloe war da! Ich konnte es nicht fassen. Ich tauchte auf und atmete.
»Wie hast du mich gefunden? Woher wusstest du, dass ich hier bin?«
Sie machte mit der Hand eine wegwerfende Bewegung. Im Grunde spielte es auch keine Rolle. Ich fühlte mich zwar nicht mehr so elend wie vorhin, aber auch nicht gesund. Egal, wie sie mich gefunden hatte, ich war unsagbar froh, dass sie hier war.
Ob sie schon mal hier gewesen war? Damals, ehe die Stadt unterging?
Sie nickte. Chloe nickte. Hatte sie gerade meine Gedanken gelesen? Wie ein Elf?
»Du kannst Gedanken lesen?«, fragte ich jetzt laut. Sie nickte erneut.
»Wenn du schon mal hier warst, kannst du mir sagen, ob es noch einen anderen Zugang nach Edinburgh gibt? Und wenn ja, wo?«, fragte ich hoffnungsvoll.
Sie zupfte an meiner Bluse und bedeutete mir ihr zu folgen.
Folgen? Wohin?
Chloe wies hinaus aufs freie Meer.
»Da hinaus? Und dann?«
Sie hob einen Daumen und ich nahm an, dass sie mir Mut machen wollte. Sie nickte bestätigend.
Ich sah zweifelnd an den Horizont. Da flog nicht mal eine Möwe. Meine Hoffnung sank. Da war nichts. Außer Wasser und Himmel. »Äh … werde ich das überleben?«, fragte ich skeptisch.
Sie rollte die Augen und deutete auf die Stadt, um dann einen Finger an ihrem Hals entlangzuziehen.
»Stimmt. Hier sterbe ich auf jeden Fall«, übersetzte ich niedergeschmettert ihre Geste.
Doch dann fielen mir die mörderischen Elfen ein und dass Finn einmal behauptet hatte, Nymphen würden Elfen bei ihrer Ermittlungstätigkeit helfen.
»Wirst du mich in Edinburgh ausliefern?«, fragte ich.
Sie schüttelte den Kopf. Erneut wurde ich an der Bluse gezupft. Chloe wiegte ihre Arme, als hielte sie ein Baby.
»Ich bin bei dir so sicher wie in Abrahams Schoß?«
Sie grinste breit und rollte die Augen.
Hatte ich eine Wahl? Ich starb entweder hier oder auf dem Meer, wobei mir Letzteres wenigstens eine Chance auf Überleben bot.
Sie hatte ihre Fäuste in die Hüften gestemmt. Ihr Fischschwanz wippte ungeduldig.
Ich fackelte nicht länger, holte tief Luft und tauchte unter.
Chloe nahm meine Hände, ich zuckte kurz zusammen, denn sie waren eiskalt, und zog mich dicht an sich. Ich schloss die Augen, das Salzwasser brannte auch so schon. Dann fühlte ich, wie ich vorwärtsgezogen wurde. Schon nach ein paar Sekunden brannte meine Lunge, und das Bedürfnis, den Mund zu öffnen und zu atmen, wurde stärker und stärker. Ich zählte bis drei. Ich zählte noch einmal bis drei. Länger würde ich es nicht aushalten. Ich musste atmen. Gerade als ich den Mund öffnen wollte, wurde ich durch die Wasseroberfläche gestoßen und mit Schwung an Land geworfen.
Am Leith
Ich lag am Ufer des Leith und spürte das nasse, feuchte Gras und den Winterfrost. Nach all der Hitze und dem Durst genoss ich die Kälte unter meinem Körper. Mir war es auch egal, ob ich auf dem schmutzigen Boden lag, ob meine nackten Beine schlamm- und dreckbeschmiert waren: Es tat so gut!
Ich atmete tief ein, roch das Gras, das welke Laub, und mein Verlangen nach Wasser ließ mich zurück zum Leith kriechen.
»Kommst du jetzt alleine zurecht?«, hörte ich Chloe rufen und hob den Kopf in ihre Richtung. Ihr Oberkörper ragte aus dem tieferen Teil des Baches empor. Ein amüsiertes Grinsen lag auf ihren Lippen. Vermutlich wegen meiner heruntergekommenen Aufmachung, denn sie selber sah so trocken und elegant aus, als wäre sie gleich im Balmoral Hotel zum Tee eingeladen. Doch das war mir alles so was von egal. Ich lebte! Sie hatte mich gerettet! Ich hob einen Daumen und beugte mich, ohne sie weiter zu beachten, übers Wasser.
»Alles klar. Ich muss weiter! Wir sehen uns bestimmt wieder, Allison Murray.« Es platschte und sie war weg.
Das Wasser war genauso klar wie das Salzwasser im Hafenbecken der Ruinenstadt. Mit dem Unterschied, dass der Boden mit grünen Algen, schwarzen Steinen und braunem Schlamm zu sehen war. Und das Wasser war eiskalt. Ich steckte den Kopf hinein und trank in großen Schlucken. Es schmeckte! Einen winzigen Moment lang dachte ich daran, dass manche Gassigänger ihre Hunde hier drin schwimmen ließen. Es war mir egal.
Total egal! Es war Wasser. Es löschte den Durst. Es kühlte mein überhitztes Gesicht. Hätte ich mich nicht höflicher bei Chloe bedanken müssen? Sollten wir uns irgendwann wiedersehen, würde ich es nachholen. Doch dann dachte ich, dass ich sie, die Elfen und alles, was mit ihnen zusammenhing, nach besten Möglichkeiten meiden würde.
Ich hob den Kopf, um Luft zu holen, und ließ ihn wieder hineinsinken. Den ganzen Kopf mitsamt der glühenden Kopfhaut. Sicherlich hatte ich unter meinem Haar einen Sonnenbrand, aber das Wasser kühlte so herrlich.
Ich nahm wieder einen Mundvoll und weil mein Magen übervoll war, spuckte ich es aus, ich nahm einen weiteren Schluck, gurgelte, ließ mir den Geschmack intensiv auf der Zunge zergehen, nahm eine weitere Handvoll in den Mund, schob das Wasser von links nach rechts, fühlte es mit der Zunge und genoss einfach, dass ich so viel nun zur Verfügung hatte, und immer und immer den Kopf hineinstecken und …
Sie hat sie gefunden! Heiliger Pan, ich bin Chloe was schuldig. Sie hat sie tatsächlich gefunden und zurückgebracht, hörte ich eine Stimme in meinen Gedanken.
O Gott, sie ist tot!
Ehe ich ihn korrigieren konnte, wurde ich an den Haaren gepackt und abrupt herausgezerrt. Erschrocken schnappte ich nach Luft und roch den Flieder.
Es gab nur einen, der mitten im Winter nach Flieder roch.
Ich drehte meinen Kopf und tatsächlich! Finn hielt mich fest. So viel zum Thema, ich würde Elfen in Zukunft meiden.
»Ich dachte gerade, du hängst tot im Wasser«, sagte er, ließ meinen Kopf los und umarmte mich heftig.
SIE LEBT!, konnte ich jetzt wieder vernehmen, aber ohne dass sich seine Brust dabei bewegte. Ich konnte mich in seiner Schraubstockumarmung nicht rühren.
Als er mich wieder losließ, fiel mir auf, dass er anders aussah, als ich ihn in Erinnerung hatte.
Seine sonst so ordentlich gekämmten Haare waren ein einziges Durcheinander und sein Oberteil war fleckig.
»Du!«, krächzte ich. Ich stemmte meine Arme gegen seine Brust und schob mich weg. So weit weg, wie es möglich war. Ich hatte keine Kraft in den Armen, aber er ließ mich los, als er meinen Widerstand merkte.
Ich schubste erneut gegen seine Brust. »Hau ab! Verschwinde! Zieh Leine. Lass mich endlich in Frieden!«
»Allie …«
»Nichts Allie!«, rief ich. Zufrieden stellte ich fest, dass ich wieder lauter und deutlicher sprechen konnte. »Es hat sich Aus-ge-Alliet für dich. Für dich bin ich, wenn überhaupt Allison. Verschwinde, hörst du? Und lass dich nie wieder blicken.«