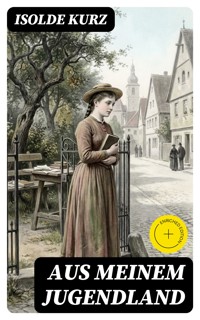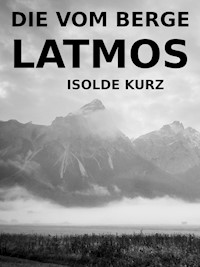Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Isolde Kurz ist auch heute noch eine ambivalente Schriftstellerin. Schon in jungen Jahren selbstständig als Autorin und Übersetzerin, war sie eine Seltenheit im wilhelminischen Deutschland. Später jedoch geriet sie wegen ihres Schweigens im Dritten Reich und ihrer altmodischen Sprache in Kritik. Hervorzuheben sind ihre Werke "Vanadis" und "Florentiner Novellen". Isolde Kurz wuchs in einem liberalen und an Kunst und Literatur interessierten Haushalt auf. Anfang der 1890er Jahre errang sie erste literarische Erfolge mit Gedicht- und Erzählbänden. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 841
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isolde Kurz
Die Pilgerfahrt nach dem Unerreichlichen
Lebensrückschau
Isolde Kurz
Die Pilgerfahrt nach dem Unerreichlichen
Lebensrückschau
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962812-12-6
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel – Sternenstunde
Zweites Kapitel – Mutterrecht
Drittes Kapitel – Kindesseele und Überwelt
Viertes Kapitel – Das Gestirn des Vaters
Fünftes Kapitel – Noch einmal die Jugendstadt
Sechstes Kapitel – Florenz
Siebtes Kapitel – Der Weg
Achtes Kapitel – Unser Thole
Neuntes Kapitel – Die Villa mit dem Granatbaum
Zehntes Kapitel – Durchbruch
Elftes Kapitel – Wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen
Zwölftes Kapitel – Lebensmitte
Dreizehntes Kapitel – Wir begründen ein Weltbad
Vierzehntes Kapitel – Sonnenwende
Fünfzehntes Kapitel – Das Verglimmen
Sechzehntes Kapitel – Vorboten
Siebzehntes Kapitel – Im Weltbrand
Achtzehntes Kapitel – Den Du nicht verlässest
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Erstes Kapitel – Sternenstunde
Aus freundlichen Leserkreisen bin ich wieder und wieder gefragt worden, warum ich meine Jugenderinnerungen, die mit der Übersiedlung unserer Familie nach Italien abschließen, nicht später wieder aufgenommen und fortgeführt habe. Man wollte die zahlreichen Sonderdarstellungen, die den einzelnen Gliedern meines Hauses sowie den Menschen meiner späteren Umwelt gewidmet sind, nicht für einen vollwertigen Ersatz nehmen, weil man in dem absichtlichen Zurückstellen der eigenen Person eine Art Ausweichen zu sehen meinte, was es ja in gewissem Sinne auch war. Im Augenblick, wo ein geliebter Mensch die Augen schließt, erlischt ganz plötzlich die Tagesbeleuchtung mit den durch sie hervorgebrachten Schatten und Verzeichnungen, die großen Grundlinien ordnen sich in ihrem eigenen Lichte zu dem gottgewollten Urbild der unvollkommenen und sich widersprechenden irdischen Erscheinung. Mit diesem hat der Biograf als monumentaler Künstler, der er sein muss, zu tun, und er besorgt sein zartes und verantwortungsvolles Amt am besten, wenn er nicht sich selber als Gegenspieler zu den Dargestellten auf die Bühne begibt. Ich trat zurück, um ihnen an keiner Stelle durch meinen hereinfallenden Schatten das Licht zu beeinträchtigen. Weil ich aber einem eng verbundenen Familienkreis angehört habe, dessen einzelne Glieder alle schicksalhaft aufeinander bezogen waren – ein jedes von den andern grundverschieden, aber jedes für sich eine einheitliche Persönlichkeit –, so kann ich kein Kapitel meines Lebens aufrollen, ohne dass das ganze Sternbild sich mitbewegt. Ich kann dem Leser jedoch nicht zumuten, sich die Untergründe und Zusammenhänge aus den verschiedenen Erinnerungsbüchern zusammenzusuchen. Da bleibt nichts übrig, als gelegentlich in den alten Farbentopf zu greifen und den zuvor in ihrer Lebensfülle geschilderten Gestalten ihr Erdenkleid wenigstens leichthin wieder umzuhängen. Dabei ist es unvermeidlich, dass aus meinem Leben heraus gesehen die zuvor nur in ihren eigenen Werten und Rechten Geschilderten nunmehr anders erscheinen und das ganze Blickfeld sich verändert. Auch von den ausgeprägten Gestalten, die von außen her meinen Weg gekreuzt haben, sind die meisten entweder schon in Sonderabhandlungen dargestellt, oder sie stehen irgendwo verkleidet in meinen Büchern, dann freilich so verwandelt und ineinander umgegossen, dass sie sich selber nicht mehr erkennen würden noch ihre Glieder an sich zu nehmen vermöchten, da das eine vom einen, das andere vom andern stammt, und diese gemischten Bestandteile nunmehr natürlich wie bei Lebenden ineinandergreifen und neue Individualitäten bilden. Ich glaube, der große Schöpfer hält es auch nicht anders, als dass er seine Gebilde immer wieder mischt und anders zusammensetzt. Wie sollte ich solche vertauschten Glieder wieder voneinander lösen und jedem das seine zurückgeben? Die selbstgeschaffenen Bilder sind dem Urheber, der sie mit Teilen seines eigenen Wesens verkittet, glaubhafter und wesentlicher als die leibhaften Vorlagen, die, nachdem sie einmal diesen Dienst geleistet, in der Erinnerung zurücktreten und verblassen. Was die Dichtung sich einmal zueigen genommen hat, das gehört ihr für immer und kommt für die Rückversetzung in die Wirklichkeit nicht mehr in Betracht. Ja, selbst mein eigenes Leben ist zum großen Teile nicht mehr mein, da es schon durch hundert Kanäle, in Spiegelungen und Parallelen und in wirklichen Episoden, die einmal mein waren und jetzt den erfundenen Personen gehören, von mir abgeflossen ist und damit ebenfalls auf weite Strecken für die Selbstbiografie unbrauchbar geworden. Bleibe es, wohin ich es gegeben habe, sonst müsste manches, was hier nur noch flüchtig gestreift werden kann, einen viel weiteren Raum auf diesen Blättern einnehmen.
Wenn ich mich nun trotz der beschränkenden Umstände doch zuletzt noch von meinem Vorsatz, die Feder nicht mehr zur Selbstdarstellung einzutauchen, abwendig machen lasse, so bewegen mich dazu vor allem die mannigfachen irrigen Vermutungen über mein Werk und Leben, denen ich besonders bei Gelegenheit meines achtzigsten Geburtstags in der Presse begegnet bin. Diese zu berichtigen liegt mir nicht nur als Einzelpersönlichkeit, sondern auch als Trägerin wertvoller Familien- und Kulturüberlieferungen ob. Man kann aber gegen solche Missverständnisse nicht im einzelnen angehen, man kann nur an Stelle der Verzeichnungen das richtige Bild setzen, wozu außer mir selbst niemand in der Lage ist, weil sich mein Leben zum größten Teile außerhalb Deutschlands abgespielt hat und von seinen früheren Zeugen nur noch wenige am Leben sind. Dass ich nicht mehr mit der Fülle bunter Einzelheiten und in der klaren zeitlichen Abfolge berichten kann wie in den Schilderungen »Aus meinem Jugendland«, versteht sich von selbst. Vom andern Zeitufer her verwandeln sich die Gestalten, die die Räume unserer Erinnerung bevölkern, aus selbstständig handelnden Personen mehr und mehr in symbolische, sie werden die unbewussten Träger schicksalformender Zeit und Lebensgewalten, treibender und hemmender, mit denen man sich am Ende auseinanderzusetzen hat.
Es kann sich also nur um das Wagnis einer Sinndeutung des eigenen Daseins handeln, und dies ist es ja auch ganz eigentlich, wozu ich aufgerufen bin.
Freilich, hier stutze ich aufs neue. Kann aus einem stillen Einzelgeschick, das abseits von dem großen Strom der Zeitgeschicke verlaufen ist, überhaupt so etwas wie ein versteckter Sinn, wie eine absichtliche Führung herausgelesen werden? Ist es nicht ausschließlich eine Sache der Träger des Weltgeschehens, uns zu sagen wie sie wurden, was sie sind, und wohin sie zielen? Das Amt des Dichters ist ein leiseres und so schwer mit Worten zu umzirken. Denn die künstlerischen Befruchtungen gehen im Dunkel vor sich, und das menschliche Leben in seinem Ablauf weiß wenig von sich. Ich habe das Menschenwesen, das ich mit dem Wörtlein »Ich« bezeichnen muss, nie so lange und tief ins Auge gefasst wie die äußeren Erscheinungen, und die Feder, die sich mit ihm beschäftigen soll, ist bei der ungewohnten Aufgabe immer in Versuchung, auf ein Außerpersönliches abzugleiten. Seine Bedeutung für mich bestand vor allem darin, dass es geistiges Auge war, mein Auge, Organ, die Gegenstände wahrzunehmen, und Mittelpunkt, in dem die Ströme des Lebens sich kreuzten, nicht selber Gegenstand der Betrachtung. Wo ich den Blick auf mich selber richten will, sehe ich mich wie dunkel geführt nach dem Unerreichlichen wandern. Indessen habe ich doch stets in meinem Dasein etwas Gleichnisartiges gespürt und sehe die überdauerten Zeiten und Zustände sich in seinem langen Laufe spiegeln. So sei denn der Versuch gemacht, von dem was mitteilbar ist, eine Anschauung zu geben.
Hier muss ich nun zunächst einer persönlichen Eigenheit gedenken, die mir erst ganz spät durch den mir fremden Zwang, mich mit mir selbst wie von außen her zu befassen, ganz deutlich bewusst wurde: dass mir nämlich die Zeit niemals ein linearer Begriff gewesen ist. Die Dinge erschienen mir nicht im Verfolg, eines aus dem anderen abgeleitet und eines das andere ablösend; sie umstanden mich im Ring als zeitlos gleichzeitige Gegenwart. Es gab da nichts eigentlich Vergangenes, nicht Anfang und Ende, Jugend und Alter, sondern der Kreis hielt alles beisammen, im Kreis war das Leben ewig. Keine Entwicklung vollzog sich bei mir linear, sondern immer nur durch Erweiterung des Kreises, der sich durcheinanderschob, mit mir langsam in der Spirale aufstieg und mit zunehmenden Jahren die Dinge nur aus immer zunehmender Höhe zeigte. Meine Lieblingsfächer, denen ich von klein auf leidenschaftlich nachging – auf eigene Hand wie gezwungenermaßen alles was ich trieb –, waren die Mythen, Sagen, Mären der Völker, nicht Geschichte, nicht fertige Literatur; diese stand mir erst an zweiter Stelle – sondern ihr Rohstoff: Volkskunde, Volksgesang, Sprache, Sprachen mit ihrem unterirdisch verschlungenen Wurzelwerk: alles Geistige, was zeitlos und gleichsam vegetativ lebt, war mir natürliche Heimat. Wollte ich mit der Geschichte denken, so bedurfte es einer inneren logischen Umstellung, ich musste aus dem Kreis in die Linie treten. Ebenso geht auch mein eigenes Schaffen nicht linear, sondern im Kreise vor sich, als läge die ganze Arbeit wartend in einer unsichtbaren Tiefe und brauchte nur gehoben zu werden. Wo beginnen? In den seltensten Fällen vom Anfang her, sondern es blitzt vom Boden auf – irgendein Glied der Kette – schnell muss es festgehalten werden, denn schon blitzt es an einer anderen Stelle, an einer dritten und vierten, der Stift darf sich eilen um nachzukommen. So geht es weiter, bald da, bald dort, ohne Zusammenhang. Es sind lauter Stücke des Ganzen, bestimmt die Entwicklung nach einem vorschwebenden aber noch nicht streng festgesetzten Plan zu schieben und dadurch erst volle Klarheit auch in diesen selbst zu bringen, fertige Bausteine, die wenig oder gar nicht mehr zubehauen werden müssen und ihre Stelle im Bauwerk haben, die auf sie wartet. Geht eines dieser Stücke zu Verlust, sodass es willensmäßig ersetzt werden muss, und es findet sich später das Verlorene wieder, dann zeigt sich erst, wie viel frischer, treffender, ursprünglicher die erste Eingebung gewesen. Nun umringen sie mich im Kreis, die von selbst Gekommenen, aber damit erst beginnt, und nicht selten unter großen Wehen, die eigentliche Arbeit: nun sollen sie zu ineinandergreifender Ordnung gefügt und gegliedert, aus dem üppiggesproßten Nebeneinander ein logisches Nacheinander gemacht werden. Und hier fühle ich deutlich, wie sich das elterliche Blut in mir gemischt hat. An Stelle des Chaotischen, das ich als Erbteil meiner höchst genialen, aber allem Planmäßigen abholden, im Urstoff wesenden Mutter in mir kenne, tritt nun das Blut des Vaters mit dem strengen Zwang zur Gesetzlichkeit und lässt mich nicht ruhen, bis ich diese ganze lose Gesellschaft wie eine Koppel wildweidender Fohlen zusammengespannt und zu richtiger Gangart fest in die Zügel genommen habe. Dieser Zwang von der anderen Seite her, ohne den ein bewusstgewolltes, rhythmisch-abgewogenes Kunstgebilde unmöglich wäre, duldet kein romantisches Durcheinander, kein unorganisches Gefüge, und er waltet um so strenger, je größer die Anarchie, durch die er sich durchzuringen hat. Dass eine solche Arbeitsweise nicht erleichternd ist, liegt auf der Hand, aber sie hat den Vorteil, dass sie jedes künstliche, erzwungene Füllsel ausschließt, weil sie immer mehr Stoff zur Verwendung hat als sie aufbrauchen kann, und darum nur Entstandenes, nichts Gemachtes verwendet. Wie der Maler, der sich nie genug tut, unter sein Werk ein pingebat, kein pinxit schreibt, so gibt es auch für meine Arbeit kein Fertigwerden, weil sie mit mir geht, sich dreht, von allen Seiten zugleich wächst, wie das wallende Leben, aus dem sie geholt ist.
Ganz verwickelt wird der Hergang, wenn durch die heftige Aufwühlung tiefere, unterhalb des zu bearbeitenden Stoffes liegende Schichten der Einbildungskraft in Bewegung gesetzt werden und ihre Gebilde zwischen die oberen drängen. Sie können so gewalttätig werden, dass sie das Strömen der ersten hindern, indem sie sich vor diese schieben. Es bleibt nichts übrig, als schnell auf andere Zettel ihr Ungestüm abladen und zusehen, wie man sich wieder auf den ersten Weg zurückfindet. Auf diese Weise kann aber auch das Chaos Herr werden und alle Gestaltung verschlingen, wodurch mir unzählige Entwürfe in der Hand zerbrochen sind: die andrängenden Rivalen hatten sie nicht geduldet. Durch diese Vorgänge ist die Überzeugung von der Präexistenz der Kunstwerke in mir geweckt worden, die ich in jüngeren Jahren verschiedentlich ausgesprochen habe: dass sie in irgendeinem undenkbaren Raum fertig weilen und dass, wer sie ans Licht bringt, nur ihr Finder, nicht ihr Schöpfer ist, wenn sie auch während der Hebung die Züge von ihm annehmen.
Mit ähnlichen Schwierigkeiten hat sogar die Darstellung des eigenen Lebens bei mir zu kämpfen: indem Erlebtes, Gedachtes, Gewolltes, Erreichtes und Unerreichtes mich in bewegtem, mit mir wandelndem Kreise umstehen, kommt bei der leisesten Berührung alles ins Wallen, sodass sich keine magere Gerade ergeben kann. – Ein Tagebuch habe ich nie geführt: Tagebücher, diese Tummelplätze des Selbstkults, erschienen mir stets, soweit sie sich nicht auf das Verzeichnen von Geschehnissen beschränken, durch die Belichtung von Keimvorgängen, die kein Licht wollen, und durch vorzeitiges Kristallisieren des Werdenden als schädlich, wenn nicht gar als schamlos. Die Hand sträubte sich sogar, Namen niederzuschreiben, die im Begriffe standen im Leben eine noch nicht ausgesprochene Bedeutung zu gewinnen. Alles Namennennen ist Magie: die Recken des Nordlands hielten es sogar für todbringend, während des Kampfes mit Namen gerufen zu werden. Durch Bereden wird jedes stille innere Weben gestört; ihm darf sich nur in geweihten Stunden das Wort der Dichtung nähern, die es gleich nach ihren eigenen Gesetzen leise umgestaltet. Also muss bei den Aufzeichnungen über mein Leben die innere Folge und Wahrheit an Stelle der genaueren Chronologie stehen; ich werde erzählen, wie der wallende Kreis es mit sich bringt, bald vor-, bald zurückgreifend, ohne die Erinnerung in eine künstliche Linie zu zwängen.
So günstig nach der Meinung der Astrologen die himmlischen Gestirne auf meine Geburt schienen, so ungünstig, ja unfreundlich war die äußere, die bürgerliche Konstellation, die mich empfing, und der Widerstreit der beiden Einflüsse begleitete mich durchs Leben. Der günstige trat in allem Naturgegebenen zutage: zunächst in der Abstammung, in dem Hineingeborensein in ein durch die höchsten Belange veredeltes, ganz von den großen Zielen der Menschheit erfülltes Elternhaus, weshalb ich mir ein höheres Leben nicht zu erkämpfen brauchte, sondern es durch die Geburt besaß. Ferner in der glücklichen Saugekraft, die mich fast ohne Leitung das mir Zukommende, mir Verwandte schnell erfassen, das Nichtverwandte, Nichtgemäße ablehnen ließ, wodurch sich frühe in mir ein unzerstörbares Weltbild gestalten konnte. Hinzuzählen darf ich noch einen wahrhaft brüderlichen Frater Corpus, der mich in nichts belästigte oder hemmte, und eine Innenwelt, in der kein brütendes Ich als »dunkeler Despot« sich selber Unheil spinnend und wehbereitend saß – ein Vorteil, der mir erst im Lauf des Lebens an den vielen gegenteiligen Beispielen die ich sah bewusst geworden ist. Aber mehr als für alles andere danke ich der Gottheit für das schönste ihrer Geschenke die Fähigkeit zur Freude die mir auch in tiefdunklen Tagen niemals ganz abhanden kam und die mich aus den trübsten Erfahrungen stets aufs neue meine Fahne retten ließ mit dem Wahlspruch: Mensch, sei immerzu dein eigener lachender Erbe – und wenn es unter Tränen wäre.
Der Einfluss der bösen Gestirne äußerte sich vor allem in dem herben Dichterlos meines Vaters, das auch das Schicksal seiner Kinder und vorwiegend das der Tochter überschattete. Ich habe ihn in meiner Hermann-Kurz-Biografie geschildert, wie er in unserer Mitte stand in seiner gebietenden und doch so milden Größe wie ein König ohne Land; wir Kinder fühlten die Bedeutung seiner Werke, bevor wir sie selber lesen konnten, aus der Begeisterung unserer Mutter und der wenigen ihm gebliebenen Freunde, und fanden doch seinen Namen nicht vom Ruhm umstrahlt, sein Verdienst weit unter dem Werte eingeschätzt, von viel Geringeren verdunkelt, den Ertrag seiner Arbeit in umgekehrtem Verhältnis zu ihrer inneren Größe. Die Mutter hatte uns gelehrt, dass es eine Ehre für uns war, weniger zu haben als die Kinder der befreundeten Häuser, die keinen deutschen Dichter zum Vater hatten, aber dieses Los war nichtsdestoweniger eine der frühen Belastungen, mit denen ich ins Leben trat. Noch in die Fremde folgte mir die Pein, dass ich denen, die mich nach meinem Vater fragten, nicht sagen konnte, wer dieser Dichter gewesen, dessen Namen niemand nannte: der Tochter allein hätte man ja nicht geglaubt. Aber lieber wollte ich ihn ganz im Dunkel wissen als nur halb gewürdigt und bei den Geistern zweiten Ranges unter seinen Zeitgenossen eingereiht. Meine Brüder haben gewiss die Sachlage nicht minder herb empfunden als ich, allein sie konnten nichts dazu, darum schwiegen sie: ihnen lag nur ob, auf ihren eigenen vorgezeichneten Wegen ihrer Herkunft Ehre zu machen, und das haben sie getan. Mir aber war von der Vorsehung mit dem Erbe des väterlichen Berufs auch der Auftrag mitgegeben, der langen Ungerechtigkeit entgegenzutreten, für den Verkannten, Halbvergessenen den Platz im Nationalheiligtum seines Volkes, der ihm zukam, einzufordern. Jede Literaturgeschichte, die schweigend über ihn wegging oder ihn nebensächlich abtat, jede misskennende oder unzulängliche Kritik trieb mir mit schmerzhaftem Stachel die Mahnung von neuem ins Herz. Aber durfte ein junges, noch ganz ungeschultes Mädchen, das nichts war noch hatte, nicht einmal einen schirmenden, fördernden Lebenskreis, hoffen, ihrer Stimme dereinst soviel Gehör zu verschaffen, da sie doch erst die eigenen Fähigkeiten reifen lassen musste, den Kampf, der seine Kraft zu früh gebrochen hatte, gegen eine ideallose Zeit für sich selber aufnehmen und aus noch erschwerterer Stellung, der weiblichen heraus, durchführen, bevor sie mit ihrer Sache auch der seinigen dienen konnte? Das zu hoffen war Vermessenheit, ich hoffte es doch, wenn auch nur in einer vorschwebenden Ahnung, in einem Lichtstrahl, der aus verhüllter Zukunft herüber fiel: dass es dennoch so kommen werde. Ich habe oftmals in Zeiten, wo ich nicht wusste, wo aus noch ein, dergleichen unausschaltbare innere Gewissheit gehabt, dass mein Ziel irgendwie mich finden werde, dass ohne gewaltsames Drängen die Zeit selber mir die Frucht reifen werde. In jener Nacht des 10. Oktober 1873 zu Tübingen, als mein Bruder Edgar, damals ein blutjunger Arzt, bei dem jählings geschiedenen Vater allein die Totenwache hielt, gelobte er ihm, dem ererbten Namen durch die eigene Laufbahn Auszeichnung zu erwerben: er hat dieses Versprechen in seinem pfeilgeraden sicheren Lauf glänzend gelöst. Ich blieb in meinen magischen Kreis gebannt, wo die Enden beisammen sind, und musste auf Ort und Stunde warten, um das meine, noch kühnere, zu lösen.
Der zweite hemmende Einfluss, der über meinem Leben stand, war mein Geschlecht. Kaum dürfte je die Frau in Deutschland niedriger gestanden haben als im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts, in das meine Jugend fiel. Dass es eine Bettina, eine Karoline Schlegel, eine Günderode, gegeben hat, Frauen, von denen ihre Zeit, die ja auch die Zeit Goethes war, die Färbung mit empfing, das wirkte nicht mehr nach, es lag als bloßer Wissensstoff eingesargt in der Literaturgeschichte. Eine Pflicht zur Ausbildung der Töchter kannte weder der Staat noch die Familie, es stand ganz bei den Eltern, ob und was sie diese lernen lassen wollten. In den bürgerlichen Kreisen, auch in den gebildeten, soweit sie nicht wohlhabend waren, begnügte man sich oft genug damit, ihnen die häuslichen Arbeiten beizubringen und sie zu unbezahlten Dienstboten heranzuziehen, besonders wenn das Studium der Söhne die elterlichen Mittel erschöpfte. Und wenn auch bessergestellte Häuser die ihrigen zur Schnellbleiche in irgendein französisch sprechendes Institut schickten, der Geist, der die Erziehung durchwaltete, blieb der gleiche. Erwachsen, hatte ein solches Mädchen keine dringendere Aufgabe, als sich nach dem künftigen Ernährer umzusehen, der die Sorge für sie übernahm und dem sie nun mit ihrem ganzen Sein zu dienen, nach dem sie sich bis zur völligen Aufgabe ihres eigenen gottgeschaffenen Selbst zu modeln hatte. Der scharfe Wettbewerb auf dem Heiratsmarkt lähmte jedes höhere Streben und verdarb auch den weiblichen Charakter. Selbst das hohe Amt der Mutterschaft vermochte ihn nicht mehr zu heben, denn wenn der Wettlauf unter Zurückdrängung der Mitbewerberinnen gewonnen war, so begann er bald aufs neue und fast noch schärfer um die Zukunft der heranwachsenden Töchter. Es fragt sich, ob nicht die physische Mutterschaft, die ihr Hegen und Sorgen auf den Kreis der eigenen Geburten beschränkt, unter Umständen dem höheren Muttertum im Wege ist: ausschließlich auf einen Punkt gerichtete Liebe macht liebeleer gegen die anderen. Darum gehörte wirkliche Frauenfreundschaft, ja, nur ein echtes Wohlwollen von Frau zu Frau zu den seltensten Ausnahmen. So blieb nicht nur der Geist der Frau völlig unentwickelt und in einen umlaufenden Kreis von Kleinigkeiten gebannt, ohne Aussicht auf das Große und Ganze, auch ihr Seelenleben war entwürdigt und entadelt. Schlimmer noch als der tatsächliche Zustand war es, dass dieses öde, verkümmerte Gebilde als Idealbild der deutschen Frau die bürgerliche Gesellschaft beherrschte. Gehe ich fehl, wenn ich die Gestalt des Gretchen dafür mitverantwortlich mache? Es ist ein seltsames Verhängnis, dass gerade der Dichter, der dem Wesen der Frau am nächsten kam und es in vielfachen Spiegelungen am echtesten dargestellt hat, die Gestalt erschuf und mit dem Schmelz der höchsten Poesie umkleidete, die die deutsche Frau um Jahrhunderte zurückwerfen half. Der Gretchenkult war ein allzu bequemer, man konnte ihr in Hemdärmeln dienen, sie stellte keine kulturelle Forderung an den männlichen Partner und erhöhte sein Selbstgefühl durch ihre tiefe Unterworfenheit. Noch tönt mir aus Jugendtagen das vielgesungene Brautlied in die Ohren: »Mein hoher Herr, du willst herab dich lassen / beseligend zu deiner armen Magd.« Heine dagegen sang frivol: »Den Leib möcht ich noch haben, / den Leib so zart und jung, / die Seele könnt ihr begraben, / hab selber Seele genung.« Demütige Magd oder Weibchen – Leib ohne Seele – das machte der männliche Formungswille aus dem handlichen Plastilin. Und das Plastilin kam ihm willig entgegen, es war stolz auf seine Hörigkeit die keine Mühe kostete, es trug seine geistige Armut wie einen Schmuck, worin der Liebeszauber steckt. Manche gab sich sogar aus Gefallsucht ärmer und schwächer als sie war. Sie durfte ja gar keinen geistigen Besitz mit in die Ehe bringen, sie hatte das weiße Blatt zu sein, auf das der Mann seine Schrift eintrug. Eine Schrift, die auch wieder zu löschen war im Fall einer zweiten Ehe, denn sie pflegte nicht allzutief einzudringen. Ihrer Wißbegier, wenn sie solche hatte, wurden alle Gegenstände zerkleinert wie einem Vögelchen in den Schnabel gesteckt. Ich kenne eine Damenbücherei aus dem vorigen Jahrhundert, wo sich noch ein Kuriosum befindet, eine »Sternkunde für Damen«! Alle Gebreiten des Lebens gehörten ausschließlich und unweigerlich dem Manne, die Frau galt in der Gesellschaft nur als sein Anhängsel, auch wenn sie zufällig die Bedeutendere war; verwitwet fiel sie in ihr Nichts zurück. Als Unvermählte blieb sie lebenslänglich missachtet und auf die Seite geschoben. Nur selten gelang es einer, durch große künstlerische Leistung auf irgendeinem Gebiete diesen Bann zu brechen. Sonst war es ein Kleben im Pech, mit leerem Kopf und unterdrückten Lebensinstinkten, im Herzen nur die Angst, den rechten Zeitpunkt zu verpassen. Wie viel einfacher und natürlicher lebte sichs doch im Volke; bei Töchtern aus guten Häusern waren Schwermut und Wahnsinn keine seltene Erscheinung. Da kam dann freilich der Mann als Erlöser und konnte nicht lange daraufhin angesehen werden, ob er der Rechte sei: die Sache war eilig, nach zwanzig hörte schon meist die Jugend auf, denn der Durchschnittskäufer verlangte die frischeste Ware. So blieb die Frau ein unerlöster Mensch und ein durch und durch gefälschtes Erzeugnis einer falschen Zivilisation; ihr wahres Wesen kannte niemand, auch sie selber nicht. – Von Schiller stammt der Ausspruch, dass die Frau nicht nur kein geistiges Eigenleben besitze, sondern dass der Mann auch in ihrem Geist keine dauernde Pflanzung anlegen könne. Goethe hat ihr wenigstens das Recht zugebilligt, dabei zu sein, »wenn kluge Männer reden«. Vergaßen die Dichter, dass am Aufgang der Dichtung ein Frauenname steht, vor dem das klassische Altertum sich neigte, der ewige Name Sappho? Wo von der Einzigen eine Strophe laut wird, da versinken die Jahrtausende zwischen ihr und uns. Sie nennt ihren Quittenbaum, und wir hören den lauen Regen Ioniens durch seine Zweige rauschen; steht er nicht unten in unserem Garten? Die Griechen stritten nicht, ob solche Höhe der Frau erreichbar sei, sie ließen die Wahrheit der Erscheinung gelten. – In Athen war die Frau durch Gesetz und Sitte unterdrückt, aber die Dichtung des Sophokles hob sie auf die höchste, menschlicher Natur erreichbare Stufe. Auch hinderte die öffentliche Meinung Aspasia nicht, über Perikles und durch Perikles über Athen zu herrschen. Ebensowenig konnte die Stimme der Allgemeinheit jene Priesterin der eleusinischen Demeter schrecken, die sich allein dem von der ganzen Priesterschaft gegen den Alkibiades geschleuderten Bannfluch zu widersetzen wagte. –
Mit welcher Herrlichkeit treten auch die Shakespeareschen Frauen, die Töchter des Geistes der Renaissance einher! Wie gebietend die königliche Hetäre Kleopatra und das »Überweib« Lady Macbeth. Wie viel Geist, Entschlossenheit und Tatkraft in dem holden Mutwillen einer Porzia, einer Beatrice, in der hingebenden Liebes- und Treuepflicht einer Imogen. Nirgends eine in Demut ausgelöschte Persönlichkeit. Solche Wesenszüge strömen aus der Dichtung ins Leben über und bauen das Wunschbild, dieses hilft die Wirklichkeit bauen. Auch Gottfried Kellers Schweizerinnen stehen kraftvoll und hochwüchsig auf der mütterlichen Erde. Wie aber stand es in der Literatur des vorigen Jahrhunderts um das Bild der deutschen Frau? Man blättere in den Werken des feinen Paul Heyse, des damaligen Lieblings der Leserwelt, den man den Frauenlob jener Tage nennen könnte; wie zerblasen sein Frauenideal und wie spielerisch fast durchweg in seiner Dichtung das tragische Ringen der Geschlechter. Da gibt es meist nur einen holden mädchenhaften Eigensinn zu überwinden, der sich gegen den überlegenen Willen des Mannes aufbäumt, um schnell zerknirscht mit süßen Reuetränen zu seinen Füßen zu sinken, womit das Problem Mann und Weib gelöst ist. Kein heutiger Mann, und wäre er der rückständigste, würde an der Frau, wie jene Tage sie forderten, sein Genüge finden. Die Langeweile, die von der ungeistigen Frau ausging, trieb den geistigen Mann vom Familientisch fort ins Wirtshaus zu Seinesgleichen. Der Grund, warum der Trunk in deutschen Landen zurückgegangen ist, liegt nicht allein in der schlechteren Wirtschaftslage, sondern auch darin, dass der gebildete Mann jetzt bei der gebildeten Frau zu Hause geistige Nahrung findet. Denn auch dem Manne war mit der Entwertung der Frau persönlich nicht gedient. Der Fehler, der in der Rechnung lag, verdarb vielfach auch ihm das Dasein. Im Zusammenleben mit einer kleinlichen, hintergründigen, über Umwegen und Hintertreppen herrschenden Hälfte sanken auch ihm die Flügel, wenn er solche hatte, nieder.
Was große Gelehrte wie Jakob Grimm und J. J. Bachofen über den chthonischen Urgrund des Weibes und ihr aus der Erdverbundenheit hervorgegangenes Übergewicht über das männliche Prinzip in der Vorzeit sagen, das findet man auch heute noch in den meisten alten Ehen. Der Mann ist der Eroberer der Natur, ihre Füllen und Gnaden aber hat die Frau zu verspenden. Hat er in seiner Vollkraft sich die Natur dienstbar gemacht, so beginnt er im Altern sein allmähliches Erliegen vor ihr zu ahnen, und nun klammert er sich an die Frau als an die der Natur immer vertraut Gebliebene, jetzt auch biologisch Stärkere – was keineswegs immer mit ihren meist jüngeren Jahren zusammenhängt – und sucht ihren Schutz. Die Frau wird zur Mutter des Mannes, und der Mutter hängt er wieder wie in der Kinderzeit am Kleid. Man sieht auf der Straße mehr alte Ehepaare wo die Frau den Mann stützt als umgekehrt. Wenn ein alterndes Paar sich untereinander Vater und Mutter nennt, so meint sie den Vater ihrer Kinder, er meint seine eigene Mutter. Eine Reihe der trefflichsten, männlichsten Männer sah ich im Alter die haltbedürftigen Söhne ihrer Frauen werden. Wenn es die Männer voraussähen, so würden sie begreifen, dass es nicht in ihrem Vorteil liegt, die Frau klein und schwach zu wollen, ganz abgesehen von dem Einfluss auf den Nachwuchs: denn wie ihre Frauen sind, so werden sie selbst am Ende ihrer Tage sein.
Die Frage hatte aber auch noch eine andere Seite, die über das Einzelschicksal hinaus ins Allgemeine wirkte. Da die Menschheit ein Ganzes ist und nur durch den Kunstgriff der Natur in zwei Hälften geteilt, um sie besser zu verbinden, so musste durch die Verkümmerung des einen Geschlechts das andere mitgeschädigt werden, und mittelbar die ganze Nation. Denn die Frau schafft das äußere Gepräge einer Kultur; sie ist die Erzieherin des Mannes zu Form und Schönheit, und ihr feinerer Tastsinn ist berufen, seine starre, abstrakte Sachlichkeit zu mildern. Es braucht nun einmal den Sporn des Eros um die Sitten zu verfeinern und das Leben zu veredeln. Der Mangel an Takt und äußerem Anstand, die Schroffheit, hinter der sich oft nur gesellschaftliche Unsicherheit verbarg, und was sonst noch das Ausland dem Deutschen vorwarf und zum guten Teil heute noch vorwirft, nachdem es mit diesen Dingen besser geworden – denn wie lange dauert es, bis eine geprägte Meinung sich berichtigt –, war in dem mangelnden gesellschaftlichen Einfluss der Frau begründet. Weshalb auch die deutsche Kultur nie imstande war, eine Gesellschaft mit bestimmtem äußerem Formcharakter zu bilden wie die romanische oder die angelsächsische und damit für den deutschen Menschen die kennzeichnende Silhouette zu prägen, die ihn einheitlich und gefällig von den Nachbarn abgehoben hätte. Dass er daheim die Form verschmähte, trieb ihn dazu, sie auswärts um so rückhaltloser zu bewundern und nachzuahmen. Weil er sich für sein Deutschtum kein gesellschaftsfähiges Kleid geschaffen hatte, legte er im Ausland das seine ab, und nahm – wie oft hat es mich gewurmt! – die äußere Form des Wirtsvolkes an.
In seinem Werk über das Mutterrecht sagt der große Bachofen über die gynäkokratische Weltperiode als die »Poesie der Geschichte«: »Sie wird dies durch die Erhabenheit, die heroische Größe, selbst durch die Schönheit, zu der sie das Weib erhebt, durch die Beförderung der Tapferkeit und ritterlichen Gesinnung unter den Männern, durch die Bedeutung, welche sie der weiblichen Liebe leiht, durch die Zucht und Keuschheit, welche sie von dem Jüngling fordert: ein Verein von Eigenschaften, die dem Altertum in demselben Lichte erschienen, in dem unsere Zeit die ritterliche Erhabenheit der germanischen Welt sich vorstellt. Wie wir so fragen jene Alten: Wo sind jene Frauen, deren untadlige Schönheit, deren Keuschheit und hohe Gesinnung selbst die Liebe der Unsterblichen weckten, hingekommen? – Wo aber auch jene Helden ohne Furcht und ohne Tadel, die ritterliche Größe mit tadellosem Leben, Tapferkeit mit freiwilliger Anerkennung der weiblichen Macht verbanden? Alle kriegerischen Völker gehorchen dem Weibe, sagt Aristoteles, und die Betrachtung späterer Weltalter lehrt das gleiche: Gefahren trotzen, jegliches Abenteuer suchen und der Schönheit dienen, ist ungebrochener Jugendfülle stets vereinte Tugend.« (Vorrede zum Mutterrecht S. 18).1
Und an anderer Stelle:
»Dass in der Herrschaft des Weibes und seiner religiösen Weihe ein Element der Zucht und Stetigkeit von großer Stärke enthalten war, muss besonders für jene Urzeiten angenommen werden, in denen die rohe Kraft noch wilder tobte, die Leidenschaft noch kein Gegengewicht hatte in den Sitten und Einrichtungen des Lebens und der Mann sich vor nichts beugte als vor der ihm selbst unerklärlichen zauberhaften Gewalt der Frau über ihn. Der wilden ungebändigten Kraftäußerung der Männer traten die Frauen als Vertreterinnen der Zucht und Ordnung, als verkörpertes Gesetz, als Orakel angeborener ahnungsreicher Weisheit wohltätig entgegen. Gern erträgt der Krieger diese Fessel, deren Notwendigkeit er fühlt. – – In dem Bewusstsein der in seine Hand gegebenen Herrschaft muss das Weib jener alten Zeit mit einer, späteren Weltaltern rätselhaften Größe und Erhabenheit erschienen sein. Der spätere Verfall seines Charakters hängt wesentlich mit der Beschränkung seiner Wirksamkeit auf die Kleinlichkeiten des Daseins, mit seiner Knechtstellung, mit dem Ausschluss von aller größeren Tätigkeit und dem dadurch herbeigeführten Hang zu verstecktem Einfluss durch List und Intriguen zusammen. Solche Weiber an der Spitze eines Staates und diesen als wohlgeordnet gepriesen zu sehen, das lässt sich allerdings mit unserer heutigen Erfahrung nicht vereinigen. – – Wie lassen sich die heutigen mit der Urzeit, zumal der germanischen, messen? Das Bewusstsein der Herrschaft und Machtbefähigung veredelt Leib und Seele, verdrängt die niederen Wünsche und Empfindungen, verbannt die geschlechtlichen Ausschweifungen und sichert den Geburten Kraft und Heldengesinnung. Für die Erziehung eines Volkes zur Tugend in dem alten derben, nicht in dem schwindsüchtigen Sinne heutiger Zeit, gibt es keinen mächtigeren Faktor als die Hoheit und das Machtbewusstsein der Frau. Es ist jedenfalls tiefe Bedeutung in der Erzählung, wonach der Römer Heldenvolk von Sabinerinnen ganz amazonischer Erscheinung abstammt. Solchen Frauen können keine Weichlinge und keine gleißenden Wollüstlinge gefallen.« (Mutterrecht, Kreta S. 125) Mögen auch manche Schlüsse des großen Forschers und Pfadfinders wissenschaftlich umstritten sein, der sittlichende Einfluss der Frau, wie ihn Bachofen in Mythe und Frühgeschichte der Menschheit erkennt, wird sich niemals wegleugnen lassen. Man hat so oft Goethe seinen Zug zum Adel, zur Hofgesellschaft vorgeworfen, als ob der Frankfurter Bürgersohn sich damit eines Mangels an Mannes- und Bürgerstolz schuldig gemacht hätte. Und doch wissen wir es aus seinem eigenen Munde, dass eine allseitige Ausbildung der Persönlichkeit im bürgerlichen Stande gar nicht zu erlangen war. »Er hat Person«, sagten unsere Klassiker von einem, der mit dem Anstand des Weltmanns auftrat, und das gab es nur in den höheren Kreisen; der bürgerlich Geborene hatte bloß ein Amt aber keine Person. Er war Schullehrer, Amtmann, Notar, aber als Persönlichkeit hatte er sich auszulöschen, wollte er nicht wegen fratzenhafter Anmaßung verlacht sein. Höhere Umgangsformen waren sonst nur noch auf der Bühne zu gewinnen, wo Wilhelm Meister seinen Kursus durchmacht, der ihn erst befähigen muss, unter den Vornehmen als Gleicher zu stehen. Sollte nun derjenige Deutsche, dem es bestimmt war, seinem Volk auf einem Kulturweg voranzugehen, wo es ihn bis heute nicht eingeholt hat, auf die Entwicklung seiner beispielhaften Persönlichkeit von vornherein verzichten? Gewiss lag der Reiz, den Frau von Stein auf ihn ausgeübt hat, wesentlich in der Selbstverständlichkeit vollendeter Weltformen und dem genauen Wissen, »was sich ziemt«, worin sie ihm Lehrmeisterin war. Aus Kindheitstagen erinnere ich mich noch gewisser unwahrscheinlich grotesker Gestalten der älteren Generation, die aus Unschick und Blödigkeit über ihre eigenen Beine stolperten. Nicht einmal im Besitze seiner Gliedmaßen war vielfach der deutsche Mann, bevor er durch die allgemeine Dienstpflicht gedrillt, durch den Sport geschmeidigt, durch gesellschaftlichen Umgang, den Umgang mit gebildeten Frauen, verfeinert wurde. Es ist klar, dass wo die Frau eine kulturelle Bedeutung hat, der Mann niemals in solchem Grade äußerlich ausarten kann, weil sie sich nicht mit dem ersten besten begnügen und weil sie auch auf das Werden des Sohnes ein Auge haben wird.
Als ich in Florenz lebend zum ersten Mal von der in Deutschland eingeleiteten Bewegung zugunsten des Frauenstudiums und der höheren Frauenberufe las, schüttelte ich den Kopf; ich hielt davon so wenig wie der verbissenste Frauenverächter. Zu gut war mir der weibliche Ungeist bekannt, wenn ich auch unterdessen weibliche Gemütseigenschaften hatte schätzen lernen. In Frauengesellschaften ging ich nie, und wenn ich vor der Türe umkehren musste bei der Entdeckung, dass nur weibliche Gäste am Teetisch saßen. Die Armut der Belange und die Unfähigkeit zur Begriffsbildung, die jedes ernstere Gespräch verhinderten, wirkten auf mich wie lähmendes Gift. Wie gründlich sollte ich späterhin umlernen, als mir in Deutschland ein neues, in geistigem Lichte herangewachsenes Frauengeschlecht entgegentrat. Es hatte genügt, den Blickpunkt auf den Mann zu ändern und den Sinn für das Überpersönliche zu wecken, so stand die Frau – nicht wesensgleich, aber ebenbürtig neben ihm. Ich darf die tapferen Wegbereiterinnen rühmen, denn ich habe nicht zu ihnen gehört. Sie haben den Nachkommenden einen Boden geschaffen, auf dem sich wohnen und werken lässt. So glücklich war die Welt noch nicht, in die ich Ende des Jahres 1853, am Tag der Wintersonnenwende, trat.
*
Da meine Geburt mit der Neugeburt des Lichtes unter dem Zeichen des Steinbocks, dem Juelfest unserer germanischen Vorfahren, zusammenfiel, so wurde die nahe Weihnacht auf diesen Tag vorverlegt. Es gab für mich somit nur ein Fest im Jahre, aber dieses war ein kosmisches, woran die ganze Erde teil hatte. Nach meinen kindlichen Begriffen verlor ich zwar den zweiten Gabentisch des Jahres, doch auf dem Tag, der mich gebracht hatte, lag eine höhere Weihe, ein feierlicherer Nachdruck. Die damit gegebene Vorausbedeutung erfüllte sich bei meinem Heranwachsen in dem Sinn, dass in dem großen Geschwisterkreis das meiste Licht auf die einzige Tochter fiel, dass ich aber gemäß den Anschauungen der Zeit mit allen irdischen Ansprüchen hinter den Brüdern verschwinden musste. In meinem späteren Leben, als ich den lichtsuchenden Charakter des Steinbocks erkannt hatte, fühlte ich mich ihm dienst- und lehenspflichtig und stellte mir ihn oder sein astronomisches Zeichen zum Sinnbild und Wappen auf.
In »Dichtung und Wahrheit« bemerkt Goethe, das ganze Leben eines Menschen hänge von dem Jahrzehnt seiner Geburt ab: zehn Jahre später zur Welt gekommen und sein Lebensgang wäre ein völlig anderer geworden. Wie viel mehr gilt das von einem Frauenleben! Zehn Jahre später, und ich hätte meinen Weg schon nicht mehr so ungangbar gefunden, mein Erscheinen wäre nicht so unbegreiflich fremdartig gewesen und so erbittert bekämpft worden, wie es auf dem Riss zwischen zwei Zeitaltern, einem das langsam sich zum Ausklingen anschickte und dem von mir unbewusst vorausgenommenen neuen, der Fall war.
Auf diesen Riss war ich zunächst ganz ohne mein Zutun schon im unmündigen Alter gestellt worden. Ich hatte ja zur Mutter eine Frau, deren Haltung zu dem damaligen Frauentum im stärksten Gegensatz stand. Da sie aus altem Adel stammte, dazu äußerst fortschrittlich war, konnte sie auf die bürgerlichen Vorurteile heruntersehen; ihr waren bessere Bildungsmöglichkeiten zu Gebote gestanden, sie hatte sich auch auf eigene Hand weitergeholfen und brachte zwar kein systematisches Wissen aber ein weites Gesichtsfeld und eine unendliche Begeisterung für alles Große und Schöne, für Dichtung, Sprachen, Philosophie und Geschichte, besonders die des Altertums, mit in die Ehe. Was sie nur teilweise erreichte, wollte sie in der Tochter vollendet sehen. Aber die Mittel fehlten, denn es war einer der Fälle, wo die Knabenerziehung die elterliche Kasse erschöpfte. Ihr Heim war jetzt kein freiherrliches mehr, sondern das höchst bescheidene eines deutschen Dichters, dem die Stumpfheit seiner Zeitgenossen den Erfolg vorenthielt. Für mich gab es keine französischen und englischen Bonnen, keine im Latein unterrichtenden Hauslehrer wie einst für sie. Von den Mädchenschulen fanden die Eltern, keine Schule wäre besser. So unterrichtete sie mich selber, aber freilich ohne Ordnung und Methode und selbst ohne festen Stundenplan, je nachdem die häuslichen Geschäfte ihr gerade Zeit ließen. Ich habe ihr das Lehren leicht gemacht, obwohl ich keinen richtigen Lernkopf hatte und Wissen als Häufung von Tatsachen mich nicht im geringsten reizte; die Dinge liefen mir von selbst entgegen und ich ihnen, weil ihre feurige Fantasie schnell die meinige entzündete und alles lebendig machte. Von den Schulaufgaben der Brüder, die sie abhörte, fielen auch nahrhafte Bröcklein ab und wurden mir zugetragen. Im übrigen musste ich mir helfen, wie ich konnte; ich las unglaublich viel, auch in fremden Sprachen, die von selbst an mir hängen blieben. Freilich musste ich später die schnelle Entwicklung büßen, da ich immer wieder an den Grundmauern nachzubessern hatte. Zum Griechentum, das lebenslang unser beider Heimat blieb, lieferte sie mir zuerst den Schlüssel, indem sie mir in ganz früher Kindheit die beiden großen homerischen Gesänge in die Hand gab. Ihre Gestalten wurden mir das Vertrauteste was ich hatte; ich kannte sie alle persönlich, sie wuchsen mit mir, und ich sah sie auch gar nicht als Vorzeitriesen, außermenschlich und fremdartig, wie sie dem Grünen Heinrich erschienen, der sie als Jüngling zuerst kennenlernte. Ihre Maße waren vielmehr der Maßstab, den ich an alle meine Wunschbilder legte, und sie wurden der Anlass, dass ich mich lebenslang bei den wechselnden Literaturmoden so jämmerlich übel befand, ja viele der berühmtesten Tageserzeugnisse, die der Kritik und dem Publikum wie Kaviar auf der Zunge zergingen, schlechterdings nicht hinunterbrachte. – Erwachsen ließ ich mich dann durch meinen Jugendkameraden Ernst Mohl in die griechische Sprache einführen und gelangte damit aus der Vorhalle in die Cella des Tempels.
Was die Griechen mir gaben, hat auf allen Altersstufen ein neues Gesicht getragen und mich immer zu neuem Dank verpflichtet. Denn dieses Volk hat sich ja immer wieder mit neuen Zügen vor der alternden Welt verjüngt, und ihre Bedeutung wird niemals auszuschöpfen sein. Für mich ging sie über den poetischen Genuss weit hinaus ins Ethische, in die eigentliche Lebensanschauung über. Der tragische Untergrund, auf dem sie stehen, gab schon dem Kinde die Ahnung von der Unsicherheit alles menschlichen Geschicks und dass das Leid mitübernommen werden muss, wenn unserem höheren Ich sein Wille geschehen soll. Diese Erkenntnis, im Gefühl entsprungen, wenn auch noch nicht im Begriff erfasst, stärkte mich für die Widerwärtigkeiten, denen ich an der Schwelle der Jugend entgegenging.
Jene Art Unterdrückung, die an der gleichen Fähigkeit des weiblichen Geistes zweifelt, habe ich an mir selber nicht erfahren. Geisteswege lagen vor mir, sie gingen strahlig nach vielen Seiten: der Humanismus war mit der Muttermilch überkommen, später brachten die Brüder die Naturwissenschaften ins Haus, freilich nur in den fertigen Schlüssen, nicht mit dem Weg, auf dem sie erarbeitet waren.
Auch das Vatererbe des Humanismus war zunächst nur in seinen Auswirkungen vorhanden, als Lebensstil wie als innere Stellungnahme. Im einzelnen hieß es, das Erbe erwerben, um es zu besitzen; hiefür gab es Wink und Fingerzeig, es gab unermüdliche Anregung von seiten einer Mutter von unerschöpflicher Geistigkeit, aber sprunghaftem, allem System widerstrebendem Naturell. Unser abendliches Lesen der griechischen Geschichte aus dem Herodot war mehr ein Spielen mit Bausteinen als ein wirkliches ernstes Bauen, dennoch hat es uns alle in der Welt der Griechen für immer heimisch gemacht. Nur Erwin, der Zweitjüngste, der als Augenmensch und künftiger Künstler mehr im Sichtbaren zu Hause war, entzog sich diesen Anregungen, hat aber das damals Übersehene in reifen Jahren glühend nachgeholt.
Ich wusste nichts von der Umwelt, in der ich lebte, denn ich kannte nur mein Elternhaus. Aber diese Umwelt wusste leider von mir und nahm an dem bloßen Dasein des fremdartigen Kindes, das mit den Heroen und Göttern Griechenlands aufwuchs, Anstoß, denn sie selber war das Rückständigste, was es gab, wennschon die hochgelehrte Universitätsstadt des hochgelehrten Schwabenlandes. Aber diese Gelehrsamkeit glänzte nur auf dem Katheder; in den Familien, die trotz der ausgeprägtesten Männerherrschaft, vielleicht gerade deshalb, ganz das Gepräge der Frau, nämlich der unwissenden, trugen, herrschte die dunkelste Unbildung. Mit meinem Heranwachsen wuchs der Gegensatz. Alles Schöne, wofür ich erglüht war: Poesie und Kunst, Pflege und Stählung des Körpers durch das was man heute Sport nennt und was nur gegen den Widerspruch der öffentlichen Meinung durchzusetzen war, galt für nahezu diabolischen Ursprungs. Am meisten wehrten sich die Mütter und Töchter der kleinen Stadt gegen solch ein junges Menschenwesen, in dessen offenbar verfrühtem Erscheinen sie das Heraufdämmern einer neuen, ihr ganzes Herkommen in Frage stellenden Zeit ahnen mochten. Die Tragik dieser Verfrühtheit, in die mich die Natur gerufen hatte, war die widrigste von den widrigen Schicksalsmächten, die mich an der Schwelle des Lebens empfingen. Dass es mir ohne äußere Hilfe gelang, sie wenigstens teilweise zu überwinden, schreibe ich der Gnade des freundlichen Gestirnes zu, das mich bei der Geburt angeblickt hatte. »Das meiste nämlich vermag die Geburt«, singt Hölderlin, »und der Lichtstrahl, der dem Neugebornen begegnet.« Eine seltsame Naturanlage half dabei nach, die mich die feindselige Außenwelt in Augenblicken, wo ich nicht unmittelbar unter ihr litt, mehr wie einen bösen Traum als wie eine lebendige Wirklichkeit ansehen ließ oder höchstens wie eine wilde Insel, auf die mich ein Schiffbruch verschlagen hätte.
Aus: Der Mythus von Orient und Okzident <<<
Zweites Kapitel – Mutterrecht
Die im Vorstehenden geschilderten Zustände schufen nur den äußeren Ring der Schwierigkeiten, die meinen Weg ins Leben umlagerten. Es gab noch einen engeren, der aus der nächsten Umwelt, aus dem Angehörigenkreise selber kam. Ich habe mich später in der Welt oftmals gewundert, wie locker in den meisten Familien der Zusammenhang ist, wie schnell das Band zwischen den Geschwistern versagt, wenn sie einmal das gemeinsame Nest verlassen haben, und wie wenig auch Kinder bedeutender Menschen von der Jugend und sogar von dem miterlebten Leben ihrer Eltern wissen; von den Großeltern ganz zu schweigen, die im Zwielicht zu verdämmern pflegen. Bei uns war es anders. Wir bildeten nicht nur eine Familie, sondern eine enggeschlossene Geistesgemeinschaft, die auch in das dritte Folgegeschlecht nachwirken sollte. Aus dieser nahen Verbundenheit heraus konnte ich nicht nur die Geschichte meiner Eltern, sondern auch die der Voreltern erzählen, weil mir das lange Gedächtnis meiner Mutter und das noch längere ihrer Josephine, genannt Fina, die sie in Windeln betreut hatte, zur Verfügung stand. In unserem Hause konnte es auch keinen Kampf der Generationen geben, denn meine Eltern hatten selber schon so weit vorne begonnen, dass die Zeit ihnen noch lange nicht nachkam. Dieser gemeinsame Gegensatz gegen eine noch lange nicht nachkommende Zeit war es dann auch, was uns Geschwister so enge zusammenband, dass wir eine eigene, ganz auf sich gestellte Welt bildeten, in der wir uns gegenseitig Wohl und Wehe bedeuteten und aus der wir uns die Maßstäbe für das Leben holten, wo aber auch die inneren Erschütterungen nie zur Ruhe kamen. Es sei jedoch betont, was heute nicht mehr so selbstverständlich ist wie damals: dass den vielen Reibungen niemals ein materieller Anlass zugrunde lag und dass die Frage von Mein und Dein, Missgönnen und Selberhabenwollen im Familienkreis nie eine Rolle gespielt hat.
Als der Dichter Hermann Kurz aus dem uralten, schon um 1400 genannten Reutlinger Bürgerhause der Glockengießer und Ratsherrn Kurz (richtiger Kurtz) die hochgemute, von Vaterseite aus kurländischem Adel stammende Freiin von Brunnow heiratete, erwuchs aus diesem Bunde zweier kristallklarer, von den gleichen Idealen erfüllter und geistig ebenbürtiger, aber im Naturell grundverschiedener Menschen eine Nachkommenschaft, in der die elterlichen Züge sich so mischten und vermengten, dass jedes eine geschlossene Einheit darstellte, dem anderen nur in der Gesinnung und in den Idealen ähnlich, in der Individualität unähnlich. Edgar, der Älteste, dessen Charakterbild ich in meinen »Florentinischen Erinnerungen« eingehend gezeichnet habe, war der heldische Mensch, eine Pioniersnatur, geboren um voranzugehen, an Unbedingtheit und Wagelust der Mutter gleich, aber vom Vater her verwickelter und verletzlicher geartet. Er war mehr für die großen Schicksalsstunden als für das tägliche Leben gemacht, denn immer großgesinnt und opferbereit für die Sache, die er vertrat, im Familienkreise sah er nur sich selber. Das war nicht der Egoismus des Gewöhnlichen, der das Seine sucht: sein geniales Ich wirkte in ihm mit solcher Stoßkraft, dass ihm die Belange der anderen gar nicht zum Bewusstsein kamen; Unrast und Reizbarkeit machten ihn verzehrend. Nur der Adel seines ganzen Wesens half mit den Schärfen dieses schwierigen Temperaments zurechtzukommen. Wir zwei standen uns nicht nur nach den Jahren, sondern auch in den innersten Bedürfnissen und den heimlichsten Seelenschwingungen am nächsten und konnten uns ohne Worte verstehen; der gleiche Himmel der Poesie wölbte sich über unseren Stirnen. Ich wusste als Kind und junges Mädchen, dass er mich glühend liebte, mit einer scheuen verschwiegenen Zärtlichkeit, die sich hinter spröder Schale barg. Aber sein Beherrschenwollen, sein Alleinbesitzenwollen machte es schwer, in dauerndem Frieden mit ihm zu leben; nicht nur der Schwester, auch den Jugendfreunden ging es so. Zwar mein Tun bekrittelte er niemals, er verstand es zu gut von seinem eigenen innersten Wesen aus, aber mein Denken und Meinen suchte er sich immerdar zu unterwerfen und mir die geistige Freiheit zu beschränken, ohne die ich nicht leben konnte. Dabei waren wir in allen tieferen Fragen so selbstverständlich einig, dass es nur immer ein Stürmen, aber ein schmerzliches, auf der Oberfläche gab. Jahre hindurch übten wir uns in einem poetischen Wettstreit, dessen Proben in die Hände der Mutter gelegt wurden. Bei diesen unterschieden sich frühe sein Hang, sich im Subjektiven, Gegenwärtigen einzuschließen, und der meinige, aus dem Persönlichen ins Allgemeine hinauszudrängen. Es mochte für den Ehrgeizigen, der sonst mit seinen großen Fähigkeiten allenthalben mühelos voranstand, nicht ganz leicht sein, allmählich auf diesem Punkt vor der jüngeren Schwester zurückzutreten. Als Erwachsener verstummte er, und während ich vor die Öffentlichkeit trat, pflegte er nur heimlich sein Talent weiter. Um so höher ehrt es ihn, dass er niemals auch nur einen Hauch von Missmut fühlen ließ, sondern mir willig das Meine ließ. Er, der persönlich so stolz war, wusste nichts vom Geschlechtshochmut der Dummen. Nach seinem Tode im Jahre 1904 konnte ich eine Auswahl seiner Gedichte, die sich überraschend in seinem Nachlass fanden, herausgeben, wie später die der Mutter, der sein Talent artverwandter ist als dem Vater. Zwar mit der Feile, der zehnten Muse, wie Leopardi sie nennt, wusste der Sohn als feiner Humanist wohl umzugehen, während die eilige Mutter nicht darnach fragte. Aber bei beiden gleich subjektiven Naturen war das Dichten eine rein autobiografische Angelegenheit, eine Selbstbefreiung im persönlichen Lebensraum ohne den Trieb der Verwandlung ins Überpersönliche und ohne Richtung auf Weiterentwicklung im künstlerisch Gegenständlichen, wozu ihm auch die Zeit fehlte.
Alfred, der Drittgeborene, ein kleiner Berserker an Kraft und Gewalttätigkeit, war mein geschworener Feind und konnte mir während der Flegeljahre, die bei ihm über die normale Zeit hinaus dauerten, nie genug Schabernack antun. Sein höchster Trumpf war, mich irgendwie vor Fremden in Verlegenheit zu bringen und bloßzustellen. Ich hielt ihn darum für einen wahren kleinen Teufel, während er das treueste liebevollste Herz hatte und nur der dunkle Knabentrotz gegen das von ihm verachtete andere Geschlecht so wild in ihm rumorte. Auch sein Charakterbild ist von mir nach seinem Hingang in meinen »Florentinischen Erinnerungen« gezeichnet worden. Züge aus seiner unbändigen Knabenzeit habe ich zuletzt noch dem wilden Roderich in »Vanadis« mitgegeben. Zwischen diese zwei Brüder als einzige Schwester durch die Geburt hineingeworfen, fiel es mir zu, die beiden Gewaltsnaturen, die ihre jahrelange Fehde täglich in Abwesenheit des Vaters am Mittagstisch auskämpften, auseinanderzuhalten, wobei leicht Püffe, die sie sich gegenseitig zudachten, ohne ihr Wollen die Friedensstifterin trafen. Die Sabinerinnen, die sich zwischen die zwei kämpfenden Heere warfen, waren mir daher schon in früher Tugend eine sehr geläufige Vorstellung.
Der dritte Bruder Erwin, bildhübsch und liebenswürdig, war ein lustiger Junge, der allem Unangenehmen aus dem Wege und dem Angenehmen nachging; er stritt niemals mit den Geschwistern, kam aber als Helfer auch nicht in Betracht. Sein heiteres Künstlerblut suchte die Sonnenseite des Lebens und entzog sich den häuslichen Stürmen, die leicht ins Gefährliche ausarteten und mir die Jugend tief verdüsterten. Eigen hat es das Schicksal gefügt, dass gerade dieser kleine Genüßling, von dem alle glaubten, dass er auf leichten Füßen durch ein sonnenfrohes Dasein gehen würde, in schweren Lebenskämpfen zu einem Charakter von eherner Willensstärke und Selbstverleugnung geschmiedet werden sollte.
Der jüngste war unser vielgeliebter Balde, 1860 im Monat der Einnahme von Palermo geboren und deshalb von der Mutter, die eine feurige Garibaldischwärmerin war, mit dem Namen ihres Lieblingshelden benannt, was Vater zugab, weil Garibald (Speerkühn) ein langobardischer Name sei. Im Gebrauch aber wurde Garibaldi in Balde verkürzt, und ich brachte seiner langen Kindlichkeit wegen noch den zärtlichen Necknamen »Bemper« für ihn auf, den er sich halb lachend, halb schmollend eine Zeit lang gefallen ließ und mit dem er häufig im Briefwechsel der Familie erscheint.
Er war eine rührend holde Menschenblüte von edelster Mischung, aber durch einen Herzfehler, dessen Ursprung auf eine akute Erkrankung im fünften Jahre zurückging, zu kurzem und verkümmertem Leben bestimmt. Für ihn gab es weder regelrechten Schulbesuch noch irgendeine Jugendfreude. Er hatte nichts als seinen inneren Reichtum und die unermüdliche Hingabe seiner Mutter, die alle seine Leidensnächte mit ihm verbrachte, am Tage mit ihm las und ihm half sich durch Selbststudium zu bilden. Dieses langsame aber unausweichliche Hinsterben, das die Mutter nach sich reißen zu müssen schien, nahm auch meiner Jugend das Sicherheitsgefühl und ließ mich immer auf den schweren Schlag gefasst sein. Das Siechtum des allgeliebten Jüngsten wurde der Hauptanstoß zu der Übersiedlung der ganzen Familie nach Italien, weil man von dem südlichen Klima zwar keine Heilung, aber einen Stillstand des Leidens erhoffte.
Inmitten dieser Familie stand als das A und O, worin alles beginnt und endet, das unbegreiflichste aller Frauenwesen, von dem man nie aufhören könnte zu erzählen, ohne je damit fertig zu werden, meine Mutter. Auf allen meinen Erinnerungsblättern ist von ihr die Rede, abgesehen von dem ihr eigens gewidmeten kleinen Büchlein mit den Proben ihrer Gedichte. Dennoch lässt sich kein Stück Vergangenheit zurückrufen, ohne dass sie wiederum dabei zugegen wäre, mit solcher Schicksalsmacht hat sie das Leben aller von ihr Geborenen durchwaltet. Sie hätte können – nicht nach dem äußeren Auftreten, das so anspruchslos wie möglich war, aber nach der von ihr ausgehenden Wirkung und nach der grandiosen Einfachheit, womit ihr inneres Saitenspiel gebaut war – zu jenen urzeitlichen Frauen gehören, von denen Bachofen spricht. Auch gegenüber dieser einzigen Gestalt bin ich jetzt, wo ich den Spuren meines eigenen Schicksals nachgehen soll, in der Lage, sie auf der Bühne meines Lebens als Gegenspielerin, die bedeutsamste, geliebteste, edelste, aber auch in manchem Sinn die verhängnisvollste aufführen zu müssen. Aber um das zu dürfen, muss ich noch einmal ihr Gesamtbild erscheinen lassen auf die Gefahr hin, dass man mir Wiederholung vorwerfe, denn nur von diesem her empfangen ihre einzelnen Wesenszüge die richtige Beleuchtung.
Ich habe sie geschildert, wie sie schon als kleines Kind sich gegen die Ungleichheit der Stände und des Besitzes auflehnte und ihre eigene bevorrechtete Stellung als ein Unrecht ansah, das sie gutzumachen suchte, indem sie die Köstlichkeiten des väterlichen Kellers und der mütterlichen Speisekammer ausräumte, um sie den Bettlern zu schenken. Ich habe sie weiterhin geschildert, wie sie als junges Mädchen im Jahre 1848 der Sache des Volks ihr Vermögen opferte und wie sie später mit derselben flammenden Begeisterung ihrem Dichter die Hand reichte, um mit ihm durch ein Leben härtester Entbehrungen zu gehen, ohne jemals den Mut zu verlieren oder an ihren Idealen irre zu werden. Ihr Persönlichstes lässt sich nicht fasslicher umreißen, als ich es in meinem »Jugendland« und in dem Büchlein »Meine Mutter« getan habe. Es sei mir also gestattet, einiges wenige davon hier im Auszug anzuführen.
»Sie wiederzugeben ganz so wie sie war ist ein Wagnis. Kein Bild ist leichter zu verzeichnen als das ihrige. So ausgeprägt sind ihre Züge, so urpersönlich – ein einziger zu stark gezogener Strich, eine vergröberte Linie, und das Edelste und Seltenste was es gab kann zum Zerrbild werden. Und nicht nur die Hand, die das Bild zeichnet, muss ganz leicht und sicher sein, es kommt auch auf das Auge an, das es auffassen soll. Wer gewohnt ist, in Schablonen zu denken, findet für das nur einmal Vorhandene keinen Platz in seiner Vorstellung.« … »Die unbegreiflichsten Gegensätze waren in diesem Menschenbild zu einem einfachen und bruchlosen Ganzen zusammengeschweißt, dass man sich in aller Welt vergeblich nach einer ähnlichen Erscheinung umsehen würde. Von beiden Seiten blaublütig, mit allen Vorteilen einer verfeinerten Erziehung ausgestattet und doch so ursprünglich in dunkler Triebhaftigkeit. Diese Triebhaftigkeit aber gänzlich abgewandt vom Ich, was doch der Natur des Trieblebens zu widersprechen scheint! Was andere sich als sittlichen Sieg abringen müssen, der selbstlose Entschluss, das war bei ihr das Angeborene und kam jederzeit als Naturgewalt aus ihrem Inneren. Wenn ich mich umsehe, wem ich sie vergleichen könnte, so finde ich nur eine Gestalt, die ihr ähnelt, den Poverello von Assisi, der wie sie im Element des Liebesfeuers lebte und die freiwillige Armut zu seiner Braut gewählt hatte. Sein Sonnenhymnus hätte ganz ebenso jauchzend aus ihrer Seele brechen können. Auch in dem starken tierischen Magnetismus, der von ihr ausströmte, muss ihr der heilige Franziskus geglichen haben, denn um beide drängte sich die Kreatur liebe- und hilfesuchend. Kinder und Tiere waren nicht aus meines Mütterleins Nähe zu bringen. Auch das Irrationale und Plötzliche, was zum Wesen der Heiligen gehört, war ihr in oft erschreckendem Maße eigen.«
Dennoch, wie auch Feder oder Pinsel sich mühen, sie können von einer verschwundenen Gestalt nur die typischen Merkmale zurückrufen: das letzte, ganz einmalige Geheimnis der Individualität ist an das Leben geknüpft, an den Kreuzungspunkt des Geistigen mit dem Körperlichen, es west in allem Unwiederbringlichen, das der Gegenwart gehört, in Blick und Lachen, in Miene, Geste und Bewegung – Schriftzüge, die keine irdische Chronik festhält. Wie nach dem Zeugnis der Zeitgenossen der heilige Franziskus vor dem Papste Innozenz stehend aus Entzücken keinen Augenblick stillhalten konnte, sondern immer tanzend hin und her fuhr, dieses Bild bringt mir die quecksilberne Überbeweglichkeit meines Mütterleins aus ihren jungen Jahren ins Gedächtnis. Hätte dieses liebeglühende Herz nur einigen Sinn für den Wert einer fraulichen Heimstätte besessen, für die Wohltat der Ordnung und Harmonie, für ein wenig Maß und Takthalten, es wäre nirgends so wohnlich gewesen wie in ihrer Nähe. Dem aber widersprach das Sprunghafte ihres Wesens und ihre Franziskusnatur, die keinerlei Besitz wollte und kaum das Notdürftigste anders denn als lästiges Anhängsel empfand. Während alles Lebewesen sich unwiderstehlich zu ihr gezogen fühlte, Tiere, Kinder, junge Leute, ergriff das Unbeseelte bei ihrem Erscheinen alsbald die Flucht; das Wort von der»Tücke des Objekts« schien eigens für sie erfunden. Das Schreibzeug wanderte aus, Kaffeelöffel rotteten sich irgendwo zusammen, um nicht zum Frühstückstisch zu kommen, das ganze zum Dasein unentbehrliche Kleinvolk des Hausrats war um sie her in beständigem Aufruhr. Wenn ich mich mühte, Ordnung zu stiften, so wurde sie ärgerlich oder lachte mich aus: Wozu den Umstand um ein Nichts! Bequemlichkeiten verachtete sie, nicht aus asketischem Hochmut, sondern weil sie nichts damit anzufangen wusste. Ihr Anzug durfte weder Geld noch Zeit kosten und hatte nur den urtümlichsten Zweck, die Blöße zu decken. Sie sah durchaus nicht, was sie anzog, und versicherte aufs bestimmteste, dass die anderen es auch nicht sähen! Nur eines war ihr in späteren Jahren unleidlich: dass ihr Haar ergreiste, denn ihr starkes Lebensgefühl vertrug sich nicht mit der Vorstellung von Alter und Verfall, wie sie sich auch am liebsten mit jungen Menschen umgab. Sie schlang also ein schwarzes Schleiertuch ganz enge um die Stirn, was ihren von der Zeit und dem Geist immer mehr durchgemodelten Zügen zuletzt etwas ganz Übersinnliches gab. Damit man nicht glaube, dass die Mutter kahl sei, schob ihr gelegentlich einer der Söhne schnell einmal in Anwesenheit Fremder den Schleier weg, dass der Silberglanz aufschimmerte, wodurch sie sich jedoch geschädigt fühlte, denn sie wollte sich nicht alt wissen.
Wenn mein Vater gelegentlich halb scherzend äußerte, er halte es mit dem Mutterrecht der Urvölker, weil der Frau, die allen Schmerz und alle Last der Mutterschaft trage, auch das erste Recht an die Kinder zustehe, da war er sich schwerlich bewusst, dass es in der Tat ein Wiederaufleben jener urzeitlichen Zustände war, das in seinem Hause herrschte und auch über das künftige Geschick seiner Kinder entschied. Seine Gattin diente ihm mit Begeisterung und verehrte jedes seiner Worte als Orakel, aber ihre Kinder waren ihr Eigentum, das sie allein verwaltete, ihm nur so viel Mitverwaltung lassend, als es ihn bei seiner Arbeit nicht beschwerte. Er konnte auch nichts tun als abdanken, weil seine von den langen politischen, literarischen und wirtschaftlichen Kämpfen zerriebenen Nerven der Doppelaufgabe nicht mehr gewachsen waren. Auch war er ja sicher, dass ihr Einfluss der edelste war und aus den höchsten Gesichtspunkten geübt. Nicht, wie es sonst Frauenart ist, mit der Richtung auf den äußeren Erfolg, sondern einzig auf die höheren Werte. Sie erschwerte sogar ihren Kindern unbedenklich das ohnehin so schwierige bürgerliche Fortkommen, indem sie sie zur äußersten Unbeugsamkeit in allen grundsätzlichen Fragen erzog und sie damit von Anfang an mit der Welt, wie sie war, in Gegensatz brachte. Auf drei höchst eigenartig abgeprägte Söhne (ich spreche nicht von dem Jüngsten, Leidenden und von ihr Betreuten, bei dem es sich von selbst verstand) übertrug sie ihr Weltbild, auch wo es sich anders als beim Vater schattierte, durch eine zum Teil vorgeburtliche Beeinflussung. Noch bis ins dritte Glied dauerte unter gänzlich veränderten Lebensbedingungen in gewissem Sinne ihr Walten: sie gab oder ergänzte den Enkeln die Namen und wirkte auf ihre Erziehung soweit ein, dass sie auf ihren späteren, ganz anders verlaufenden Bahnen immer noch das Vorbild der Nonna (Großmutter), wenn auch nicht mehr wegweisend, so doch als stille Mahnung über sich fühlten. Dass die kleinbäuerlich so anspruchslose Frau nach dem Tode des Vaters und unserem Auszug aus dem Vaterland den ganzen Clan wieder so fest zusammenfasste, dass keines sich weiter als auf die Entfernung einer Tagereise von ihr niederließ, erschien allen als das von selbst Gegebene. Wie es auch gar nicht anders denkbar war, als dass ihr Ältester, der daheim die seinen Gaben angemessene Stellung nicht finden konnte, Florenz als ärztlichen Wirkungskreis wählte, damit seine Mutter mit dem leidenden Jüngsten ihm in das milde Klima folgen konnte.