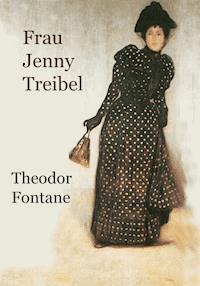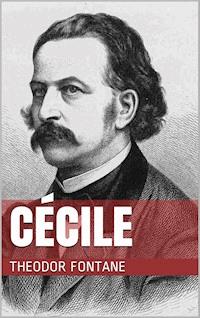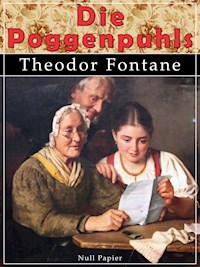
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Fontanes Novelle "Die Poggenpuhls" spielt im Dreikaiserjahr 1888, als in einem Jahr drei Kaiser regieren. Eine verarmte Offiziersfamilie, deren Familienoberhaupt lang schon gefallen ist, muss nun in einer Mietskaserne hausen. Die Familie, immer darauf bedacht, auch mit den kärgsten Mitteln den Stand zu wahren, schlittert von einer hochnotpeinlichen Situation in die nächste. Hoffnung keimt noch einmal auf, als der reiche Erb-Onkel zu Besuch erscheint. Kann er die prekäre Lage der Poggenpuhls lindern? Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Theodor Fontane
Die Poggenpuhls
Theodor Fontane
Die Poggenpuhls
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954188-62-8
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Erstes Kapitel
Die Poggenpuhls – eine Frau Majorin von Poggenpuhl mit ihren drei Töchtern Therese, Sophie und Manon – wohnten seit ihrer vor sieben Jahren erfolgten Übersiedelung von Pommersch-Stargard nach Berlin in einem gerade um jene Zeit fertig gewordenen, also noch ziemlich mauerfeuchten Neubau der Großgörschenstraße, einem Eckhause, das einem braven und behäbigen Manne, dem ehemaligen Maurerpolier, jetzigen Rentier August Nottebohm gehörte. Diese Großgörschenstraßen-Wohnung war seitens der Poggenpuhlschen Familie nicht zum wenigsten um des kriegsgeschichtlichen Namens der Straße, zugleich aber auch um der sogenannten »wundervollen Aussicht« willen gewählt worden, die von den Vorderfenstern aus auf die Grabdenkmäler und Erdbegräbnisse des Matthäikirchhofs, von den Hinterfenstern aus auf einige zur Kulmstraße gehörige Rückfronten ging, an deren einer man, in abwechselnd roten und blauen Riesenbuchstaben, die Worte »Schulzes Bonbonfabrik« lesen konnte. Möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß nicht jedem mit dieser eigentümlichen Doppelaussicht gedient gewesen wäre; der Frau von Poggenpuhl aber, einer geborenen Pütter – aus einer angesehenen, aber armen Predigerfamilie stammend -, paßte jede der beiden Aussichten gleich gut, die Frontaussicht, weil die etwas sentimental angelegte Dame gern vom Sterben sprach, die Rückfrontaussicht auf die Kulmstraße aber, weil sie beständig an Husten litt und aller Sparsamkeit ungeachtet zu gutem Teile von Gerstenbonbons und Brustkaramellen lebte. Jedesmal, wenn Besuch kam, wurde denn auch von den großen Vorzügen dieser Wohnung gesprochen, deren einziger wirklicher Vorzug in ihrer großen Billigkeit und in der vor mehreren Jahren schon durch Rentier Nottebohm gemachten Zusicherung bestand, daß die Frau Majorin nie gesteigert werden würde. »Nein, Frau Majorin«, so etwa hatte sich Nottebohm damals geäußert, »was dieses angeht, so können Frau Majorin ganz ruhig sein und die Fräuleins auch. Gott, wenn ich so alles bedenke … verzeihen Frau Majorin, das Manonchen war ja noch ein Quack, als Sie damals, zu Michaeli, hier einzogen …, un als Sie dann Neujahr runterkamen und die erste Miete brachten und alles noch leer stand von wegen der nassen Wände, was aber ein Unsinn is, da sagte ich zu meiner Frau, denn wir hatten es damals noch nich: ›Line‹, sagte ich, ›das is Handgeld und bringt uns Glück.‹ Und hat auch wirklich. Denn von dasselbe Vierteljahr an war nie was leer, un immer reputierliche Leute – das muß ich sagen … Und dann, Frau Majorin, wie werd ich denn grade bei Ihnen mit so was anfangen … ich meine mit das Steigern. Ich war ja doch auch mit dabei; Donnerwetter, es war eine ganz verfluchte Geschichte. Hier sitzt mir noch die Kugel; aber der Doktor sagt: sie würde schon mal rausfallen und dann hätt ich ein Andenken.« Und damit schloß Nottebohm eine Rede, wie er sie länger nie gehalten und wie sie die gute Frau Majorin nie freundlicheren Ohres gehört hatte. Das mit dem »Dabeigewesensein« aber bezog sich auf Gravelotte, wo Major von Poggenpuhl, spät gegen Abend, als die pommersche Division herankam, an der Spitze seines Bataillons, in dem auch Nottebohm stand, ehrenvoll gefallen war. Er, der Major, hinterließ nichts als einen guten alten Namen und drei blanke Krönungstaler, die man in seinem Portemonnaie fand und später seiner Witwe behändigte. Diese drei Krönungstaler waren, wie das Erbe der Familie, so selbstverständlich auch der Stolz derselben, und als sechzehn Jahre später die erst etliche Monate nach dem Tode des Vaters geborene jüngste Tochter Manon konfirmiert werden sollte, waren aus den drei Krönungstalern – die bis dahin zu konservieren keine Kleinigkeit gewesen war – drei Broschen angefertigt und an die drei Töchter zur Erinnerung an diesen Einsegnungstag überreicht worden. Alles unter geistlicher Mitwirkung und Beihilfe. Denn Generalsuperintendent Schwarz, der die Familie liebte, war am Abend des Konfirmationstages in die Poggenpuhlsche Wohnung gekommen und hatte hier die in Gegenwart einiger alter Kameraden und Freunde stattfindende Broschenüberreichung fast zu einer kirchlichen Zeremonie, jedenfalls aber zu einer Feier erhoben, die sogar dem etwas groben und gegen die »Adelspackage« stark eingenommenen Portier Nebelung imponiert und ihn, wenn auch nicht geradezu bekehrt, so doch den wohlwollenden Gesinnungen seines Haus- und Brotherrn Nottebohm um etwas näher geführt hatte.
Wie sich von selbst versteht, war auch die Poggenpuhlsche Wohnungseinrichtung ein Ausdruck der Verhältnisse, darin die Familie nun mal lebte; von Plüschmöbeln existierte nichts und von Teppichen nur ein kleiner Schmiedeberger, der mit schwarzen, etwas ausgefusselten Wollfransen vor dem Sofa der zunächst am Korridor gelegenen und schon deshalb als Empfangssalon dienenden »guten Stube« lag. Entsprechend diesem Teppiche waren auch die schmalen, hier und dort gestopften Gardinen; alles aber war sehr sauber und ordentlich gehalten, und ein mutmaßlich aus einem alten märkischen Herrenhause herstammender, ganz vor kurzem erst auf einer Auktion erstandener, weißlackierter Pfeilerspiegel mit eingelegter Goldleiste lieh der ärmlichen Einrichtung trotz ihres Zusammengesuchtseins oder vielleicht auch um dessen willen etwas von einer erlöschenden, aber doch immerhin mal dagewesenen Feudalität.
Über dem Sofa derselben »guten Stube« hing ein großes Ölbildnis (Kniestück) des Rittmeisters von Poggenpuhl vom Sohrschen Husarenregiment, der 1813 bei Großgörschen ein Carré gesprengt und dafür den Pour le mérite erhalten hatte – der einzige Poggenpuhl, der je in der Kavallerie gestanden. Das halb wohlwollende, halb martialische Gesicht des Rittmeisters sah auf eine flache Glasschale hernieder, drin im Sommer Aurikeln und ein Vergißmeinnichtkranz, im Winter Visitenkarten zu liegen pflegten. An der andern Wand aber, genau dem Rittmeister gegenüber, stand ein Schreibtisch mit einem kleinen erhöhten Mittelbau, drauf, um bei Besuchen eine Art Gastlichkeit üben zu können, eine halbe Flasche Kapwein mit Liqueurgläschen thronte, beides, Flasche wie Gläschen, auf einem goldgeränderten Teller, der beständig klapperte.
Neben dieser »guten Stube« lag die einfensterige Wohnstube, daran sich nach hinten zu das sogenannte »Berliner Zimmer« anschloß, ein bloßer Durchgang, wenn auch im übrigen geräumig, an dessen Längswand drei Betten standen, nur drei, trotzdem es eine viergliedrige Familie war. Die vierte Lagerstätte, von mehr ambulantem Charakter, war ein mit Rohr überflochtenes Sofagestell, drauf sich, wochenweis wechselnd, eine der zwei jüngeren Schwestern einzurichten hatte.
Hinter diesem »Berliner Saal« (Nottebohm selbst hatte den Grundriß dazu entworfen) lag die Küche mitsamt dem Hängeboden. Hier hauste das alte Dienstmädchen Friederike, eine treue Seele, die noch den gnädigen Herrn gekannt und als Vertraute der Frau Majorin alles Glück und Unglück des Hauses und zuletzt auch die Übersiedelung von Stargard nach Berlin mit durchgemacht hatte.
So wohnten die Poggenpuhls und gaben der Welt den Beweis, daß man auch in ganz kleinen Verhältnissen, wenn man nur die rechte Gesinnung und dann freilich auch die nötige Geschicklichkeit mitbringe, zufrieden und beinahe standesgemäß leben könne, was selbst von Portier Nebelung, allerdings unter Kopfschütteln und mit einigem Widerstreben, zugegeben wurde. Sämtliche Poggenpuhls – die Mutter freilich weniger – besaßen die schöne Gabe, nie zu klagen, waren lebensklug und rechneten gut, ohne daß sich bei diesem Rechnen etwas störend Berechnendes gezeigt hätte.
Darin waren sich die drei Schwestern gleich, trotzdem ihre sonstigen Charaktere sehr verschieden waren.
Therese, schon dreißig, konnte (was denn auch redlich geschah) auf den ersten Blick für unpraktisch gelten und schien von allerhand kleinen Künsten eigentlich nur die eine, sich in einem Schaukelstuhle gefällig zu wiegen, gelernt zu haben; in Wirklichkeit aber war sie geradeso lebensklug wie die beiden jüngeren Schwestern und bebaute nur ein sehr andres Feld. Es war ihr, das stand ihr fest, ihrer ganzen Natur nach die Aufgabe zugefallen, die Poggenpuhlsche Fahne hochzuhalten und sich mehr, als es durch die Schwestern geschah, in die Welt, in die die Poggenpuhls nun mal gehörten, einzureihen. In den Generals- und Ministerfamilien der Behren- und Wilhelmstraße war sie denn auch heimisch und erzielte hier allemal große Zustimmung und Erfolge, wenn sie beim Tee von ihren jüngeren Schwestern und deren Erlebnissen in der »seinwollenden Aristokratie« spöttisch lächelnd berichtete. Selbst der alte Kommandierende, der, im ganzen genommen, längst aufgehört hatte, sich durch irgend etwas Irdisches noch besonders imponieren zu lassen, kam dann in eine vergnüglich liebenswürdige Heiterkeit, und der der Generalsfamilie befreundete, schräg gegenüber wohnende Unterstaatssekretär, trotzdem er selber von allerneustem Adel war (oder vielleicht auch eben deshalb), zeigte sich dann jedesmal hingerissen von der feinen Malice1 des armen, aber standesbewußten Fräuleins. Eine weitere Folge dieser gesellschaftlichen Triumphe war es, daß Therese, wenn es irgend etwas zu bitten gab, auch tatsächlich bitten durfte, wobei sie, wie bemerkt werden muß, nie für sich selbst oder aber, klug abwägend, immer nur um solche Dinge petitionierte, die man mühelos gewähren konnte, was dann dem Gewährenden eine ganz spezielle Befriedigung gewährte.
So war Therese von Poggenpuhl.
Sehr anders erwiesen sich die beiden jüngeren Schwestern, die, den Verhältnissen und der modernen Welt sich anbequemend, bei ihrem Tun sozusagen in Compagnie gingen.
Sophie, die zweite, war die Hauptstütze der Familie, weil sie das besaß, was die Poggenpuhls bis dahin nicht ausgezeichnet hatte: Talente. Möglich, daß diese Talente bei günstigeren Lebensverhältnissen einigermaßen zweifelvoll angesehen und mehr oder weniger als »unstandesgemäß« empfunden worden wären, bei der bedrückten Lage jedoch, in der sich die Poggenpuhls befanden, waren diese natürlichen Gaben Tag für Tag ein Glück und Segen für die Familie. Selbst Therese gab dies in ihren ruhigeren Momenten zu. Sophie – auch äußerlich von den Schwestern verschieden, sie hatte ein freundliches Pudelgesicht mit Löckchen – konnte eigentlich alles; sie war musikalisch, zeichnete, malte, dichtete zu Geburtstagen und Polterabenden und konnte einen Hasen spicken; aber alles dies, soviel es war, hätte für die Familie doch nur die halbe Bedeutung gehabt, wenn nicht neben ihr her noch die jüngste Schwester gewesen wäre, Manon, das Nesthäkchen.
Manon, jetzt siebzehn, war, im Gegensatze zu Sophie, ganz ohne Begabung, besaß aber dafür die Gabe, sich überall beliebt zu machen, vor allem in Bankierhäusern, unter denen sie die nichtchristlichen bevorzugte, so namentlich das hochangesehene Haus Bartenstein. Bei dem Kindersegen der Mehrzahl dieser Häuser war nie Mangel an angehenden Backfischen, die mit den Anfängen irgendeiner Kunst oder Wissenschaft bekannt gemacht werden sollten, und ein über die verschiedensten Disziplinen angestrengtes längeres oder kürzeres Gespräch endete regelmäßig mit der leicht hingeworfenen Bemerkung Manons: »Ich halte es für möglich, daß meine Schwester Sophie da aushelfen kann«, eine Bemerkung, die sie gern machen durfte, weil Sophie tatsächlich vor nichts erschrak, nicht einmal vor Physik und Spektralanalyse.
So war die Rollenverteilung im Hause Poggenpuhl, aus der sich, wie schon angedeutet, allerlei finanzielle Vorteile herausstellten, Vorteile, die zuzeiten nicht unbeträchtlich über die kleine Pension hinauswuchsen, die den eisernen Einnahmebestand der Familie bildete. Sämtliche drei junge Damen vergaben sich dabei nicht das geringste, waren vielmehr (besonders die zwei jüngeren) ebenso leichtlebig wie dankbar, vermieden es taktvoll, in geschmacklose Huldigungen oder gar in Schmeichelei zu verfallen, und standen überall in Achtung und Ansehen, weil ihr Tun, und das war die Hauptsache, von einer großen persönlichen Selbstlosigkeit begleitet war. Sie brauchten wenig, wußten sich, zumal auf dem Gebiete der Toilette - was aber ein gefälliges Erscheinen nicht hinderte -, mit einem Minimum zu behelfen und lebten in ihren Gedanken und Hoffnungen eigentlich nur für die »zwei Jungens«, ihre Brüder, Wendelin und Leo, von denen jener schon ein älterer Premier über dreißig, dieser ein junger Dachs von kaum zweiundzwanzig war. Beide, wie sich das von selbst verstand, waren in das hinterpommersche, neuerdings übrigens nach Westpreußen verlegte Regiment eingetreten, drin schon ihr Vater seine Laufbahn begonnen und am denkwürdigen 18. August in Ruhm und Ehre beschlossen hatte.
Diesen Ruhm der Familie womöglich noch zu steigern war das, was die schwesterliche Trias mit allen Mitteln anstrebte.
Hinsichtlich Wendelins, der ihrem eigenen Bemühen in allen Stücken entgegenkam, besonders auch darin, daß er zu sparen verstand, hinsichtlich dieses älteren Bruders unterlag das Erreichen höchster Ziele kaum einem Zweifel. Er war klug, nüchtern, ehrgeizig, und soviel durch Aufhorchen in dem militär-exzellenzlichen Hause zur Kenntnis Theresens gekommen war, konnte sich’s bei Wendelin eigentlich nur noch darum handeln, ob er demnächst in das Kriegsministerium oder in den Generalstab abkommandiert werden würde. Nicht so glücklich stand es mit Leo, der, weniger beanlagt als der ältere Bruder, nur der »Schneidigkeit« zustrebte. Zwei Duelle, von denen das eine einem Gerichtsreferendarius einen Schuß durch beide Backen und den Verlust etlicher Oberzähne eingetragen hatte, schienen ein rasches Sichnähern an sein Schneidigkeitsideal zu verbergen und hätten ebensogut wie Wendelins Talente zu großen Hoffnungen berechtigen dürfen, wenn nicht das Gespenst der Entlassung wegen beständig anwachsender Schulden immer nebenher geschritten wäre. Leo, der Liebling aller, war zugleich das Angstkind, und immer wieder zu helfen und ihn vor einer Katastrophe zu bewahren, darauf war alles Dichten und Trachten gerichtet. Kein Opfer erschien zu groß, und wenn die Mutter auch gelegentlich den Kopf schüttelte, für die Töchter unterlag es keinem Zweifel, daß Leo, »wenn es nur möglich war, ihn bis zu dem entsprechenden Zeitpunkt zu halten«, die nächste große Russenschlacht, das Zorndorf der Zukunft, durch entscheidendes Eingreifen gewinnen würde.
»Aber er ist ja nicht Garde du Corps«, sagte die Mama.
»Nein. Aber das ist auch gleichgültig. Die nächste Schlacht bei Zorndorf wird durch Infanterie gewonnen werden.«
boshafte Äußerung <<<
Zweites Kapitel
Es war ein Wintertag, der dritte Januar.
Eben kam Friederike von ihrem regelmäßigen Morgeneinkauf zurück, einen Korb mit Frühstückssemmeln in der einen, einen Topf mit Milch in der andern Hand, beides, Semmeln und Milch, aus dem Keller gegenüber. Die Finger, trotz wollener Handschuhe, waren ihr bei der Kälte klamm geworden, und so nahm sie denn beim Eintreten in ihre Küche den Teekessel aus dem Kochloch und wärmte sich an der Glut. Aber nicht lange, denn sie hatte sich, weil sie gegen Morgen noch einmal eingeschlafen war, um eine halbe Stunde verspätet, was natürlich wieder eingebracht werden mußte.
So machte sie sich denn eifrig an ihre vom Brett genommene Kaffeemühle, schüttete, so daß sie nachher nur noch aufzugießen brauchte, das braune Pulver in den Beutel und ging nun, nachdem sie schließlich noch den Teekessel wieder in die Glut gestellt hatte, mit ihrem Holzkorb (dessen Boden übrigens jeden Augenblick herauszufallen drohte) nach vorn, um da das einfensterige Wohnzimmer zu heizen. Hier kniete sie vor dem Ofen nieder und baute Holz und Preßkohlen so kunstgerecht auf, daß es nur eines einzigen Schwefelholzes, allerdings unter Zutat eines aus Zeitungspapier zusammengedrehten Zopfes, bedurfte, den künstlichen Bau in Brand zu setzen.
Keine halbe Minute verging, so begann es im Ofen auch wirklich zu knacken und zu knistern, und als Friederike nun wußte, daß es brennen würde, stand sie von ihrem Ofenplatz wieder auf, um sich ihrer zweiten Morgenaufgabe, dem Staubabwischen, zu unterziehen. Hierbei, weil das, was sie leistete, die drei Fräuleins doch nie zufriedenstellte, verfuhr sie, so gewissenhaft sie sonst war, ziemlich obenhin und beschränkte sich darauf, eine über dem Sofa hängende Bilderreihe, die Leo, trotzdem es Zeitgenossen waren, die »Ahnengalerie des Hauses Poggenpuhl« zu nennen pflegte, leidlich blank zu putzen. Drei oder vier dieser Bilder waren Photographien in Kabinettformat; die älteren aber gehörten noch der Daguerreotypzeit an und waren so verblichen, daß sie nur bei besonders günstiger Beleuchtung noch auf ihren Kunstwert hin geprüft werden konnten.
Aber diese »Ahnengalerie« war doch nicht alles, was hier hing. Unmittelbar über ihr präsentierte sich noch ein Ölbild von einigem Umfang, eine Kunstschöpfung dritten oder vierten Ranges, die den historisch bedeutendsten Moment aus dem Leben der Familie darstellte. Das meiste, was man darauf sehen konnte, war freilich nur Pulverqualm, aber inmitten desselben erkannte man doch ziemlich deutlich noch eine Kirche samt Kirchhof, auf welch letzterem ein verzweifelter Nachtkampf zu toben schien.
Es war der Überfall von Hochkirch, die Österreicher bestens »ajustiert«, die armen Preußen in einem pitoyablen Bekleidungszustande. Ganz in Front aber stand ein älterer Offizier in Unterkleid und Weste, von Stiefeln keine Rede, dafür ein Gewehr in der Hand. Dieser Alte war Major Balthasar von Poggenpuhl, der den Kirchhof eine halbe Stunde hielt, bis er mit unter den Toten lag. Eben dieses Bild, wohl in Würdigung seines Familienaffektionswertes, war denn auch in einen breiten und stattlichen Barockrahmen gefaßt, während die bloß unter Glas gebrachten Lichtbilder nichts als eine Goldborte zeigten.
Alle Mitglieder der Familie, selbst der in Kunstsachen etwas skeptische Leo mit einbegriffen, übertrugen ihre Pietät gegen den »Hochkircher« – wie der Hochkirch-Major zur Unterscheidung von vielen andern Majors der Familie genannt wurde – auch auf die bildliche Darstellung seiner ruhmreichen Aktion, und nur Friederike, sosehr sie den Familienkultus mitmachte, stand mit dem alten, halb angekleideten Helden auf einer Art Kriegsfuß. Es hatte dies einfach darin seinen Grund, daß ihr oblag, mit ihrem alten, wie Spinnweb aussehenden Staublappen doch mindestens jeden dritten Tag einmal über den überall Berg und Tal zeigenden Barockrahmen hinzufahren, bei welcher Gelegenheit dann das Bild, wenn auch nicht geradezu regelmäßig, so doch sehr, sehr oft von der Wand herabglitt und über die Lehne weg auf das Sofa fiel. Es wurde dann jedesmal beiseite gestellt und nach dem Frühstück wieder eingegipst, was alles indessen nicht recht half und auch nicht helfen konnte, Denn die ganze Wandstelle war schon zu schadhaft, und über ein kleines, so brach der eingegipste Nagel wieder aus, und das Bild glitt herab.
»Gott«, sagte Friederike, »daß er da so gestanden hat, nu ja, das war ja vielleicht ganz gut. Aber nu so gemalen … es sitzt nich und sitzt nich.«
Und nachdem sie dies Selbstgespräch geführt und die Ofentür, was immer das letzte war, wieder fest zugeschraubt hatte, tat sie Handfeger und Wischtuch wieder in den Holzkorb und trat leise durch die lange Schlafstube hin ihren Rückzug in die Küche an. Es war aber nicht mehr nötig, dabei so vorsichtig zu sein, denn alle vier Damen waren bereits wach, und Manon hatte sogar den einen nach dem Hof hinausführenden Fensterflügel halb aufgemacht, davon ausgehend, daß vier Grad unter Null immer noch besser seien als eine vierschläfrige Nacht- und Stubenluft.
Keine Viertelstunde mehr, so kam der Kaffee. Die Damen saßen schon vorn in der warmen Stube, die Majorin auf dem Sofa, Therese in ihrem Schaukelstuhl, während Manon, einen Handwerkszeugkasten vor sich, eben diesen Kasten nach einem etwas längeren Nagel, und zwar für den alten, wieder herabgefallenen »Hochkircher«, durchsuchte.
»Friederike«, sagte die Majorin, »du solltest dich mit dem Bilde doch etwas mehr in acht nehmen.«
»Ach, Frau Majorin, ich tu es ja, ich rühr ihn ja beinah nich an; aber er sitzt immer so wacklig … Gott, Manonchen, wenn Sie doch bloß mal einen recht langen fänden oder, noch besser, wenn Sie mal so ’nen richtigen Haken einschlagen könnten. In acht nehmen! Gott, ich denke ja immer dran, aber wenn er denn so mit einmal rutscht, krieg ich doch immer wieder ’nen Schreck. Un is mir immer, als ob er vielleicht seine Ruhe nich hätte.«
»Ach, Friederike, rede doch nicht solch dummes Zeug«, sagte Therese halb ärgerlich. »Der, gerade der. Als ob der seine Ruhe nicht hätte! Was das nur heißen soll! Ich sage dir, der