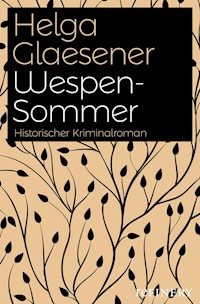8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die junge Adlige Aliz lebt als Kammerfrau bei der Herzogin von Jülich. Als diese brutal ermordet wird, flieht sie mit Moritz, dem illegitimen Sohn ihrer Herrin, nach Wöllenstein, ein Dorf in der Nähe von Mainz. Liebevoll kümmert sie sich um den Jungen. Um zu überleben, baut sie einen illegalen Postdienst auf. Das ist riskant, denn die Familie von Taxis besitzt das kaiserliche Monopol auf die Postbeförderung. Und tatsächlich wird Moritz, mittlerweile zum jungen Mann herangewachsen, von den Häschern der Taxis verhaftet. Doch auch die Vergangenheit verfolgt Aliz. Als die Mörder der Herzogin von einem rechtmäßigen Erben erfahren, werden Aliz und Moritz zu Schachfiguren in einem perfiden Spiel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Rheinhessen, Anfang des 17. Jahrhunderts: Aliz, eine Witwe mit dunkler Vergangenheit, betreibt im kleinen Wöllstein eine Herberge. Um sich und ihren drei Kindern das Überleben zu sichern, baut sie zudem einen illegalen Postdienst auf. Das ist profitabel, aber riskant, denn die einflussreiche Familie von Taxis besitzt das kaiserliche Monopol auf die Postbeförderung. Doch nicht nur von dieser Seite droht Gefahr. Ihr Sohn ist ein möglicher Erbe des Herzogtums Jülich, und als seine Identität durch ein Unglück offenbar wird, wird er zum Spielball im intriganten Geschäft der mächtigen Landesherren …
Die Autorin
Helga Glaesener wurde in Niedersachsen geboren und studierte in Hannover Mathematik. Im Trubel ihrer fünfköpfigen Kinderschar begann sie 1990 mit dem Schreiben historischer Romane, von denen gleich das Debüt, Die Safranhändlerin, zum Bestseller avancierte. Neben ihrer Tätigkeit als Autorin arbeitet sie als Tutorin bei der Studiengemeinschaft Darmstadt, wo sie angehenden Autoren die Kniffe des Handwerks verrät. Seit 2010 lebt sie in Oldenburg.
Weitere Informationen unter www.helga-glaesener.de
Helga Glaesener
Historischer Roman
List
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1377-1
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Zero Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Umschlaggestaltung nach Motiven von © Bridgeman Images (Nachtszene), akg-images (Frau und Stadtansicht) und FinePic®, München
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Düsseldorf, 23. September 1597
as Kind schrie. Es lag in einem Weidenkorb wie einst der kleine Moses und brüllte sich die Seele aus dem Leib, und das bereits seit zehn Minuten. Aliz d’Antigny presste die Hände gegen die Schläfen. Wie sollte man so etwas aushalten? Am liebsten hätte sie das Bündel gegriffen und … ja, und was? Sie hatte keine Ahnung von Kindern, und Marthe, die Mutter des Kleinen, eine dralle Amme mit einem angedeuteten Bart über der Oberlippe, schien von dem Lärm nicht im Geringsten beeindruckt. Sie plauderte, als wäre sie taub. Das Wetter … die Reise auf den schlammigen Landstraßen, die sie fast umgebracht hatte …
»Vielleicht ist der Kleine hungrig?«, versuchte Aliz sie zu unterbrechen.
Marthe schüttelte den Kopf und stupste den Weidenkorb mit dem Fuß an. Sie musste noch die Sache mit dem Calvinisten loswerden, den sie vor dem Düsseldorfer Schloss hatte predigen hören und den man besser einsperren sollte, bevor er den Leuten mit seinem ketzerischen Geschwätz das Herz verdarb und …
»Oder seine Windel ist nass?«
Marthe lachte und schüttelte den Kopf. »Alle Kinder schreien. Es kräftigt die Lungen. Wenn sie nicht schreien, sterben sie.«
Sie musste es wissen. Wäre sie keine erfahrene Amme, hätte man ihr wohl kaum das zweite Kind anvertraut, das sich mit ihnen in dem kleinen Kellerraum des Düsseldorfer Schlosses aufhielt – den kostbaren Knaben, der in einer Ecke neben einem Eimer voller Holzscheite mit einem bunt bemalten Blechpferdchen spielte. Er war ein hübsches Kind, drei Jahre alt, mit blonden, zarten Locken, flinken Fingern und einem aufgeweckten Gesicht.
Die Nadel in Marthes Finger glitt über ein Wollhemd, das geflickt werden musste. Sie begann ein Rezept ihrer Mutter zu preisen – Suppe aus Brot und schwarzem Bier, aber süßem, unbedingt! –, als plötzlich die Tür aufflog. Susanne kam herein, die erste Kammerfrau der Herzogin Jakobe, der auch Aliz diente. Das hagere Gesicht des Weibes war gerötet. Ihr Blick flog durchs Zimmer, und sie atmete auf, als sie sah, dass sich nur die beiden Frauen und die Kinder in dem kargen Dienstbotenzimmer aufhielten. Rasch schloss sie die Tür hinter sich. »Du kannst noch nicht zur Herrin, Aliz. Der Herzog läuft durch die Gänge. Er hatte wieder einen Anfall und … Es ist grauenhaft.«
Aliz nickte.
»Dieses Mal hat er einen gläsernen Pokal zerschlagen, den benutzt er als Waffe. Angeblich hat er Josef, der ihn bewachte, den Hals so furchtbar zerschnitten, dass man um sein Leben fürchten muss.« Susanne brach in Tränen aus. Sie setzte sich zu ihnen an den Tisch und knetete das Ende ihres Gürtels. »Ich musste durch den Flur, in dem es passiert ist, und habe das Blut gesehen. Die ganzen Wände waren vollgespritzt. So ein Anblick … so ein Grauen … O gütige Jungfrau, warum musste der Herrgott uns so schlagen? Warum musste unsere arme Herzogin …«
»Er ist doch nicht auf dem Weg zu ihr?«, unterbrach Aliz sie beunruhigt.
»Sie hat sich eingeschlossen. Und es sind bereits Wachen unterwegs. Sicher ist es bald vorbei.«
Aliz war erleichtert. Sie mochte Jakobe. Die Herzogin hatte sie als Kammerfrau in ihren Dienst genommen, als es ihr schlecht ging, und so etwas vergaß sie nicht. »Gibst du mir Bescheid, wenn sich alles wieder beruhigt hat?«
Susanne nickte und blickte von der Amme, die schockiert das Hemd hatte sinken lassen, zu dem Knaben mit dem Blechpferdchen. Dann sprang sie auf, als hätte sie sich schon viel zu lange in dem düsteren Gelass aufgehalten, und ging. Ihre Schritte verhallten.
»Die arme Herzogin«, murmelte Marthe. Aliz schlang ihren Mantel enger um sich. Draußen regnete es, und obwohl es bereits Juni war, wurde es nachts noch sehr kalt. Kurz überlegte sie, die Scheite aus dem Eimer zu nehmen und in dem kleinen Kamin ein Feuer anzuzünden, entschied sich dann aber dagegen. Ihr war übel. Wahrscheinlich wurde sie krank. Oder der Fisch vom Mittagessen war nicht gut gewesen. Träge lauschte sie Marthes Geplapper, das wieder eingesetzt hatte. »Die arme Herzogin … wenn man dagegen das eigene Glück betrachtet … mir ist wahrlich kein Reichtum beschert, doch mein Ehemann …« Der Knabe ließ sein Blechpferdchen über ihre Schenkel reiten.
Aliz schluckte, als der Brechreiz stärker wurde. Sich übergeben zu müssen wäre die Krönung dieser scheußlichen Nacht. Draußen vor dem Fenster platschten die Tropfen auf das Pflaster, jeder einzelne schien in ihrem Kopf eine Explosion zu verursachen. Die Turmuhr im Innenhof des Düsseldorfer Schlosses begann zu schlagen. Sie zählte bis elf. Wann die Herzogin wohl nach ihr rufen lassen würde?
Endlich kehrte Susanne zurück. »Du kannst jetzt hinauf, Aliz. Der Herzog hat Wein und ein starkes Mittel zur Beruhigung bekommen, keine Sorge. Er liegt in seinem Bett und schläft.« Sie setzte sich zu Marthe.
»Kommst du nicht mit?«
»Sie will nur dich und den Knaben sehen.«
Aliz atmete weiter gegen die Übelkeit in ihrem Magen an, das verfluchte Rumoren, das einfach keine Ruhe geben wollte. Der Knabe tappte um den Tisch herum. »Hotthü!« Sie nahm ihn auf die Arme. Er war so niedlich mit den runden, arglosen Augen, dem Pusteblumenhaar und dem Grübchen neben dem linken Mundwinkel, das ihm eines Tages die Herzen zufliegen lassen würde. Aber außerdem und vor allem war er ein Unglück.
»Nun geh schon«, drängte Marthe. »Wir warten hier.«
Der Junge war quirlig wie ein Welpe. Er wollte auf den Boden zurück, aber Aliz hielt ihn fest. »Leise sein, Moritz«, flüsterte sie, als sie die Tür öffnete. Er lachte sie mit müden Äuglein an und zappelte weiter.
Die Flure, die sie entlangschritten, waren lang, dunkel und von niedrigen unverputzten Decken überwölbt, so dass man ständig meinte, den Kopf einziehen zu müssen. Als sie den Keller über eine schmale Holzstiege verließen, waren die Flure immer noch lang, aber hier, wo die Herrschaft schritt, besaßen sie doppelte Höhe. Das Mondlicht, das durch die Sprossenfenster fiel, ließ Gemälde, kostbare Ledertapeten und gelegentlich einen Kronleuchter erkennen. Aliz’ Schritte hallten auf dem Parkett, obwohl sie sich bemühte, leise zu sein. »Hühott …«, plapperte der Junge, der sein Pferd nun auf ihrer Schulter reiten ließ.
»Psst.«
Was sollte sie nur sagen, wenn ihr jemand begegnete? Sie müsste schnell und glaubwürdig antworten. »Behaupte, dass es das Kind deiner Schwester sei«, hatte Jakobe befohlen. Nur besaß Aliz gar keinen Neffen, weil ihre Familie einem Blatternausbruch zum Opfer gefallen war, dem nur sie selbst und ihr klappriger Onkel Jean entkommen waren, und das wussten die Leute hier. Es ist alles ein Wahnsinn, dachte sie und wünschte von Herzen, sie läge bereits in ihrem Bett.
Sie wollte gerade eine weitere Tür öffnen, als sie ein Geräusch zu hören meinte. Sofort dachte sie an den Herzog. Aber der schlief doch längst und wurde bewacht. Aliz schaute sich um, doch der Flur lag völlig still, und auch hinter der Tür, vor der sie stand, rührte sich nichts. Plötzlich bäumte sich ihr Magen auf, und das kaum verdaute Essen schoss in ihren Mund. Hektisch ließ sie das Kind zu Boden gleiten und erbrach sich neben einem Fenster – erst das Essen, danach bittere Galle. Der Knabe hielt sich an ihrem Rock fest und schaute fasziniert zu. »Hast du ein Weh?«, wollte er wissen.
Aliz wischte sich den Mund ab, hob den Saum an, den sie hoffentlich nicht bekleckert hatte, und nahm den Kleinen wieder hoch. Ihr ekelte vor sich selbst.
»Du stinkst«, krähte der Knabe.
»Und wie nett von dir, dass du’s mir sagst.«
»Ich kann zählen. Bis hundert, weißt du das?«
Sie musste trotz des sauren Geschmacks im Mund lächeln. »Glaube ich nicht.«
Das war eine dumme Bemerkung, denn er begann sofort, ihr seine Kunst zu beweisen. »Eins, zwei …«, hallte es durch den Gang.
»Kannst du auch leise zählen, Moritz? Nur im Kopf?«
»Dann hörst du mich doch nicht.«
»Laut zählen kann jeder, kluge Menschen wissen, wie man stumm zählt.«
Er senkte die Stimme. Sie hörte ihn flüstern, und so durchschritten sie die letzten Türen, bis sie den Turm erreichten, in dem die Herzogin ihre Gemächer hatte. Schwer atmend erklomm Aliz die Wendeltreppe, bis sie das oberste Geschoss erreichte. Ein kleines Fenster, das eher an eine Schießscharte erinnerte, gab den Blick auf den Schlosshof frei. Draußen regnete es immer noch. Dazu pfiff der Wind durch die Ritzen. Weiter entfernt konnte sie die Umrisse der Düsseldorfer Häuser erahnen, die sich im Unwetter duckten. Plötzlich kämpfte sie mit den Tränen. Was für ein furchtbares Land, welch ein verfluchtes Haus! Es war ja nicht nur der Wahnsinn des Herzogs – seine Schwäche hatte dazu geführt, dass hinter jeder Tür im Haus Ränke gesponnen wurden. Man kam sich in diesem Schloss vor wie in einem Pfuhl voller Schlangen, ständig in Gefahr, gebissen zu werden.
Doch es half nichts. Vor vier Tagen hatte sie ein Brief aus Frankreich erreicht, mit der Nachricht, dass ihr Onkel Jean verstorben sei und dass man viele Rechnungen, aber kein Vermögen habe finden können. Sie musste also in Düsseldorf bleiben. Entschlossen klopfte sie an die Tür ihrer Herrin. Sie wusste nicht, wer den Wachdienst versah, aber sicher war es eine Person, der sie nichts zu erklären brauchte.
»Elfundzwanzig«, flüsterte der Knabe.
Aliz drückte ihn an sich. »Du kannst wirklich zählen, Kompliment. Aber kannst du auch so leise sein, dass niemand dich atmen hört? Nicht einmal ich?«
Der Junge hielt die Luft an, und Aliz klopfte erneut. Nichts. War der Diener eingeschlafen? Oder hatte Jakobe ihn fortgeschickt wie Susanne? Vielleicht verrichtete er gerade seine Notdurft. Nach einem weiterem Klopfen öffnete Aliz die Tür. Der Geruch von brennendem Tran stieg ihr in die Nase. Eine Lampe flackerte auf einem Tisch, beleuchtete aber nur einen winzigen Teil des Raums. Kein Mensch war zu sehen.
Zögernd trat sie ein – und da entdeckte sie den Diener. Der Mann lag neben einem alten Bett, sein Kopf schwamm in einer Blutlache, sein Gesicht war eine blutige Masse, das einzig Heile darin ein offenes Auge, das sie anstierte, als machte er ihr einen Vorwurf. Identifizieren konnte sie ihn nur an den abgewetzten braunen Stiefeln mit dem Pelzbesatz, die der Diener sommers wie winters trug. Karl Krämer, der persönliche Diener der Herzogin.
Ihr zog sich vor Angst der Magen zusammen. Was sollte sie tun? Das Schloss zusammenschreien? Sie dachte an den Herzog und blieb stumm. Ihr Blick schweifte zur zweiten Tür im Raum, die in das Schlafgemach der Herzogin führte. Sie war angelehnt, und jetzt, als Aliz sich darauf konzentrierte, meinte sie ein ersticktes Stöhnen und das Rascheln von Seidendecken zu hören.
»Psst«, raunte sie in das Kinderohr. Ein Wunder, dass man ihr Klopfen überhört hatte. Rasch hinaus, solange es noch möglich ist! Doch gleichzeitig verspürte sie ein Gefühl von Treue gegenüber der Frau im Nebenraum. Schau nach, forderte diese Treue, das bist du ihr schuldig.
Mit rasendem Herzen lugte Aliz durch den Türspalt. Sie konnte nicht viel erkennen, dass dort aber nicht der wahnsinnige Herzog wütete, wurde auf den ersten Blick deutlich. Vor dem Bett der Herzogin erhob sich ein schwarzer Frauenrücken mit einer weißen, gestärkten Mühlsteinkrause, auf der wiederum eine kompliziert gesteckte Damenfrisur thronte. Neben der Frau beugte sich ein ebenfalls schwarz gewandeter Mann über das Bett. Zwei kleine, weiße, mit bestickten Strümpfen bekleidete Füße lugten unter der Bettdecke hervor und zappelten.
Aliz erstarrte, unfähig, etwas zu unternehmen. Die Zeit stand still, während das Zappeln allmählich schwächer und das unheimliche Stöhnen leiser wurde. Schließlich drang ein Murmeln an ihr Ohr: »Es ist vollgebracht.«
Die blasphemischen Christusworte waren es, die sie wieder zum Leben erweckten. Sie fuhr herum. Bestimmt würden die Mörder das Zimmer eilig verlassen. Könnte sie vor ihnen die Wendeltreppe erreichen? Vielleicht, aber sicher war das nicht. Also huschte sie zu einem freien Plätzchen zwischen dem Bett und der Wand, dem einzigen Ort, an dem man sich in diesem Raum verbergen konnte. Ihre Füße traten dabei in das Blut, und ihr Saum streifte das Gesicht des Toten.
»Psst«, wisperte sie in das Ohr das Knaben, während sie sich mit ihm zusammenkauerte. Sie spürte ihn zittern. Er verstand die Gefahr. Die Mörder kamen in das Vorzimmer, hielten inne und sprachen kurz miteinander, aber Aliz verstand vor Aufregung kein Wort. Der Knabe verbarg sein Köpfchen an ihrer Brust, und sie versenkte das Gesicht in seinem Haar.
Plötzlich brach das Gespräch ab. Hatten die beiden sie entdeckt? Aliz verkrampfte sich …
Und in diesem Moment kam ihr der böse Gedanke, der sie für den Rest ihres Lebens verfolgen sollte: Vielleicht lassen sie mich laufen, wenn ich ihnen den Knaben und seine Geschichte gebe.
Sie sollte in den folgenden Jahren den süßlichen Geruch des Blutes, den schweißbehafteten von Karls Stiefeln und auch den Hall der Schritte vergessen, als die Mörder die Treppe hinabstiegen. Aber nie vergaß sie den säuerlichen Geschmack der Feigheit, als sie erwog, das Leben des Knaben gegen ihr eigenes zu tauschen.
ie waren flink, aber er war schneller. Sie kannten den Wald wie ihr eigenes Dorf, er wie das eigene Hemd. Der nächtliche Reiter lachte still in sich hinein. Wind zauste in seinen Haaren, sein Blut pulsierte, er fühlte sich lebendig und übermütig.
Der Wald lag im Zauber der Nacht. Das Laub am Boden glitzerte schwarz und silbern, die Bäume waren wie krumme Säulen, die ein dunkles Gewölbe trugen. Hinter ihm dröhnte der Hufschlag seiner Verfolger. Die Männer saßen ihm seit Alzey im Nacken, vielleicht schon seit Hangen-Weisheim, wo er sich in der Schenke von Wolf Glaser den Fellsack mit den Briefen hatte zustecken lassen, dessentwegen sie ihm jetzt nachjagten. War Wolf aufgeflogen? Hatte jemand verraten, dass der Wirt sein kärgliches Einkommen mit dem Transport von Päckchen und Briefen aufbesserte? Wohl kaum, dann hätten die Büttel schon in der Gaststube zugegriffen.
Moritz vermutete, dass rund um Alzey Posten aufgestellt worden waren, die der illegalen Konkurrenz der kaiserlichen Post auflauern sollten. Der Kaiser hatte das Recht, Briefe zu befördern, der mächtigen Familie Taxis übertragen. Lamoral von Taxis war zum Generalpostmeister des Reiches bestellt worden. Und sein Kölner Postmeister Johann von Coesfeld, der in die Taxis-Familie eingeheiratet hatte und nun die Strecke zwischen Köln und Wöllstein betrieb, versuchte seit über einem Jahr, die Lumpen zu erwischen, die ihm die Aufträge wegschnappten. Aber er kriegte sie einfach nicht zu fassen. Der finanzielle Schaden war die eine Sache – dass man über Coesfeld lachte, ging ihm sicher direkt ins eitle Herz.
Moritz griff nach dem Fellsack, der hinter ihm auf dem Pferderücken lag. Er löste im Reiten die Schnalle und zog das verräterische Stück zu sich nach vorn. Sein Rappe Buckler war ein hässliches, aber schlaues Tier. Er merkte auf, weil er ahnte, was kommen würde. Sie hatten es wochenlang in einem wilden Spiel trainiert. Als Moritz ihm ein Zeichen mit den Schenkeln gab, wurde er langsamer und ließ ihm Zeit, in die Büsche zu gleiten. Dann galoppierte er umso rascher davon, wieherte triumphierend und zog die Verfolger auf sich.
Moritz, der lediglich mit ein paar Kratzern zwischen den Brombeerbüschen gelandet war, wartete, bis die Reiter an ihm vorbeigezogen waren. Dann sprang er auf die Füße. Sie würden bald genug merken, dass er sie getäuscht hatte. Er schlug sich durch die Büsche, den Postsack in den Armen, verfolgt von den misstrauischen Augen der Marder, Käuze und Fledermäuse. In der Nähe befand sich eine Grube, in der Quecksilber abgebaut wurde. Der Eingang zum Stollen war gut verborgen. Ein mögliches Versteck? Aber wenn Coesfelds Männer denselben Einfall hatten, konnten sie ihn in dem schmalen Schacht ohne zweiten Ausgang ausräuchern wie einen Fuchs. Nein, lieber eine andere Richtung.
Moritz erreichte einen Hang und schlitterte mehrere Meter bis zu einem Trampelpfad hinab. Hier wurde der Wald lichter, die Sterne zogen sich bis zum Horizont. Er horchte. Die Rufe seiner Verfolger drangen durch die Nacht. Einer beschwerte sich, dass sie keine Hunde mitgenommen hatten. »Hab ich’s nicht gesagt? Dass der Dreckskerl uns wegschlüpft?« Eine hitzige Stimme antwortete: »Der Mann ist mit dem Teufel im Bund.«
Warum sie nur immer den Leibhaftigen bemühten, wenn ihnen die Arbeit ins Auge ging? Moritz verkniff sich ein Lachen und kroch ins hohe Gras, das zwischen dem Weg und einem Abgrund wuchs. Die Männer würden ihn nicht mehr erwischen, nachdem sie ihn einmal aus den Augen verloren hatten. Hier im Farn war er praktisch unsichtbar. Und auch den Buckler würden sie nicht mit sich nehmen können. Der wurde wild, wenn ihn ein Fremder anpackte. Moritz bog das Gras beiseite und schaute in die Tiefe. Eine falsche Bewegung, und er würde Dutzende Fuß tief auf harten Boden fallen. Sollte er keine Angst haben? Ach was. Das Leben war ein Tanz, der das Herz zum Schlagen brachte. Er mochte es genau so, wie es jetzt war.
Während die Stimmen seiner Verfolger verklangen, begannen seine Gedanken abzuschweifen, und Moritz wurde ungewohnt nachdenklich. Er legte sich auf die weichen Halme und starrte zu den Sternen hinauf. Eine Gestalt kristallisierte sich aus den Lichtern, die sein Herz zum Klopfen brachte: Eva.
Er formte ihren Namen mit den Lippen. Evas Vater war Lebkuchenbäcker und Herbergswirt in Frankfurt, ein einflussreicher, wohlhabender Mann und zudem Moritz’ Lehrherr. Aber damit – also mit der Aussicht auf ein Erbe und ein gesichertes Leben – hatte Moritz’ Leidenschaft nichts zu tun, auch wenn es jeder vermuten würde, der davon erführe. Nein, es war ihr Wesen, das ihn so tief berührte. Sie hatte eine ganz besondere Art zu sprechen und sich zu bewegen. Moritz hatte viele Mädchen geliebt. Die Annas und Maries und wie immer sie geheißen hatten, waren lebhaft gewesen, lustig, zu Wagnissen aufgelegt, hübsch, mit funkelnden Augen und zupackenden Händen, kurz, sie glichen ihm, sie waren das weibliche Pendant seines eigenen Charakters. Aber nie konnte eine von ihnen seine Aufmerksamkeit über längere Zeit fesseln.
Dann war er Eva begegnet. Und das Erste, was ihm an ihr auffiel, war ihre Ruhe gewesen. Eine stille junge Frau, die ihrer Arbeit nachging und selten scherzte. Aber wenn sie lächelte, dann wärmte sie die Stube wie ein Kaminfeuer. An ihren Wangen wuchs ein winzig zarter Haarflaum, den man mehr spürte als sah. Ihn zu berühren ließ seine Lenden brennen.
Und wie zärtlich sie mit ihren kleinen Geschwistern umging. Sie musste ihre Mutter ersetzen, die im vergangenen Sommer gestorben war, und sie tat es mit so viel Liebe und Geschick, dass man kaum jemals Tränen sah. Hübsch war sie auch, schön sogar, mit ihren blonden Zöpfen und der zierlichen Nase, auf der sich einige Sommersprossen tummelten, aber darauf kam es ihm gar nicht an. Sie ist so urtümlich wie dieser Wald, dachte Moritz, der sich von klein auf gern in der Natur herumgetrieben hatte. Sie ist beschützend und umsorgend. Sie ist das, wonach ich mich immer gesehnt habe. Er lächelte und war plötzlich verlegen, weil er sich alt vorkam, als hätte er einen Grad an Weisheit erlangt, der ihm mit seinen achtzehn Jahren noch gar nicht zustand.
Etwas raschelte, und das Geräusch riss ihn aus den Träumen. Er spannte die Glieder an. Waren seine Häscher ihm doch auf die Spur gekommen? Hastig hantierte er mit dem verräterischen Fellsack. Dann starrte er zum Wald hinauf. Alles war wieder ruhig.
Und plötzlich packte ihn die Ungeduld. Er wollte rüber nach Wöllstein, nach Hause zu seiner Mutter. Dort wartete ein Bett auf ihn und sicher auch eine gute Mahlzeit. Die Männer des Postmeisters würden ihn schon nicht erwischen. Vielleicht hatte er sich sogar geirrt, und nicht die Büttel, sondern einfaches Straßengesindel hatte ihm nachgesetzt, das längst verschwunden war. Lautlos erhob er sich und lief den Weg hinab. Buckler würde allein zum Stall heimfinden. Der Rappe war nicht nur klug, sondern auch gefräßig, und er wusste, wo er Futter bekam.
Moritz brauchte eine halbe Stunde, um den Boden der Schlucht zu erreichen. Die Sommerwiese, die von Schwarzdornsträuchern und hohen Bäumen bewachsen war, wurde von einem kleinen Gewässer, dem Finkenbach, durchschnitten. Diesem Bach wollte er aus dem Wald hinaus folgen und dann den Weg durch die Felder nehmen. Die drei Dörfer, die auf seinem Weg lagen, würde er umgehen, und trotzdem wäre er noch vor Mitternacht daheim.
Leise näherte er sich dem sprudelnden Gewässer. Er hatte es fast erreicht, da hörte er ein Wiehern. Sein Herz begann zu hämmern, und er ließ sich zu Boden fallen. Mistdreck, kriegten sie ihn jetzt doch? Aber warum sollten sie gerade hier unten nach ihm suchen? Es gab doch unzählige Möglichkeiten, den Wald zu verlassen. Sein Blick irrte über die Schlucht. Es war ein Anblick wie aus einer der unheimlichen Geschichten, die erzählt wurden, wenn die Nächte am schwärzesten waren: die Blumen, die sich unter dem leichten Wind wiegten, dahinter der schroffe Fels, aber alles ohne Farben. Und am Himmel zogen schwarze Wolken, als hätte sich das Wilde Heer auf die Jagd gemacht …
Da entdeckte er den Buckler. Das Teufelsvieh schien geahnt zu haben, was sein Herr plante. Oder hatte er schlicht die bekannte Wasserstelle aufgesucht, um zu saufen? Moritz richtete sich auf. Als der Buckler ihn erblickte, zog er die Oberlippe hoch, als würde er lachen. Braver Bursche, großartiger Sinn für Humor. Moritz bückte sich, um seinen Fellsack abzusetzen.
In diesem Moment raschelte es in seinem Rücken. Moritz fuhr herum, doch es war zu spät. Er sah einen Knüppel auf sich zukommen, konnte ihm aber nicht mehr ausweichen.
er kleine Dicke gehörte zu den Uhus. Aliz schloss es aus der Verdrossenheit, mit der er den Hirsebrei und die Pfirsichstücke verschlang und das frische Brot in die Soße tunkte und in sich hineinstopfte. Wenn es ans Zahlen der Rechnung ging, würde er das typisch klagende Geräusch der Nachtvögel von sich geben: »Es soll kein Vorwuuuurf sein, gute Frau. Ihr gebt Euch Müüühe, ich sehe es wohl. Und doch muss ich anmeeerken, dass das Stroh im Schlafraum lange nicht mehr frisch aufgeschüüüüütet worden ist. Auch sollte der Magen zu Beginn einer Mahlzeit durch Heißes und Troooockenes geöffnet werden …«
Neben dem Uhu saß ein Zaunkönig. So nannte Aliz die Gäste, die, blind für die schäumenden Töpfe und die abgehetzten Mägde, ständig nach Aufmerksamkeit verlangten.
Gäste wie die Uhus und Zaunkönige konnte sie meist mit einem Scherz beruhigen, und alles war gut. Aber der in der Ecke mit dem dreieckigen Hut, den er auch beim Essen nicht ablegte, könnte eine Elster sein, einer von den Kerlen, die gern ein Stück unbezahltes Brot unter den Kleidern verschwinden ließen. Diese Leute versuchten sich unsichtbar zu machen, sobald sie sich in das Büchlein eingetragen hatten, das Aliz auf Geheiß des Schultheißen führen musste. Wenn man sie in einer Ecke aufscheuchte, flossen sie über vor Liebedienerei, aber im Morgengrauen machten sie sich heimlich davon, ohne die Übernachtung zu zahlen.
Aliz beschloss, ihn im Auge zu behalten. Doch die Laune ließ sie sich von diesem Burschen nicht verderben. Es war ein schöner, lauschiger Frühsommermorgen. Die Sonne schien durch die Fenster und warf Flecken auf die dunklen Tische, Bänke und Schemel im Wirtsraum der Grünen Laterne. Die Gäste genossen das Essen, das sie vor der Abreise aufgetischt bekamen. Sie scherzten miteinander, einer hob den Zinnbecher und beglückwünschte Aliz zu dem Beerenwein, der dieses Jahr wirklich ausgezeichnet schmeckte, und zu dem würzigen Käse, den sie nach einem Rezept ihres verstorbenen Mannes herstellte.
»Ganz ausgezeichnet, wirklich wunderbar«, bemerkte ein anderer in praktischer Reitkleidung, den sie für einen Kaufmann hielt. Sie dachte, er meinte ebenfalls den Käse, aber ein Blick zeigte ihr, dass er von den Malereien sprach, die die geweißten Wände schmückten. Sie gaben ausnahmslos friedliche Naturszenen wieder, meist Waldtiere: Rehe auf einer Lichtung, einen jungen Fuchs, dessen Schnauze sich dem Betrachter in argloser Neugierde entgegenreckte, ein Nest mit frisch geschlüpften Vögelchen …
»Als wäre man wirklich in Gottes schöner Natur. Als würden sie davonhuschen, sobald man sich bewegt«, lächelte er. Der Mann war schon ein wenig älter, mit Flecken auf der Glatze, Triefaugen und einem weißen Kragen, auf den ein wenig Wein gekleckert war.
»Sie bleiben, so lange wir sie füttern. Die Treue ist eine Tugend, die ihren Sitz im Magen hat«, scherzte Aliz.
Der Mann lachte und schnitt sich ein Stück Käse ab. »Denkt Ihr wirklich so?«
»Wie ich denke, weiß der Herrgott nach meinem Nachtgebet«, lächelte sie und folgte dem Wink eines anderen Gastes, der seine Zeche und die Übernachtung zahlen wollte. Während er penibel die Münzen im Geldbeutel zusammenklaubte, warf sie einen Blick durchs Fenster in den Hof, wo ihr Sohn Tile gerade die Pferde sattelte. Der Junge war ein feingliedriges Kind, vierzehn Jahre alt, mit dunklem, lockigem Haar, vollen, ein wenig vorgestülpten Lippen und tiefbraunen, fast schwarzen Augen, die immer ein wenig aufgeregt und unglücklich blickten, als würde ihn etwas beunruhigen. Und vielleicht war es auch so. Sie sah ihn kaum einmal unbeschwert fröhlich.
Nur bei den Tieren entspannte er. Mit ihnen ging er so geschickt um wie mit dem Pinsel und der Farbe, mit denen er die Bilder im Speisesaal gemalt hatte. Alles, was mit Tieren zu tun hatte, war ihm eine Herzensangelegenheit.
Aliz wünschte sich manchmal, ihn würden noch andere Dinge interessieren, wie beispielsweise die Steuern, die sie für ihren Gasthof zu zahlen hatten, oder zumindest die tägliche Arbeit, denn irgendwann würde er diesen Hof bewirtschaften müssen. Aber wenn man ihn bat, in der Küche auszuhelfen oder die Schlafräume zu fegen, wurde er stur und langsam. Er sah ihr ähnlich, besaß aber ein völlig anderes Temperament. Sie unterdrückte einen Seufzer.
»Sollte sie nicht im Herzen wohnen?«
»Bitte?«
»Die Treue«, meinte der Triefäugige. »Ich finde, sie sollte ihren Platz direkt neben der Liebe haben.«
»Ihr seid mir ja ein rechter Wolkengänger«, lächelte Aliz. Der umständliche Gast hatte endlich seine Münzen zusammen, und nachdem sie sie im Beutel unter der Schürze verstaut hatte, machte sie sich daran, den Tisch abzuwischen, der von Honigklecksen und verschüttetem Wein beschmiert war.
Die meisten Gäste waren jetzt mit dem Frühstück fertig. Sie zahlten und gingen, ihre Reisesäcke zu holen. Aus den Augenwinkeln sah Aliz ihre Tochter Anni mit einer Schüssel in den Innenhof huschen. Gleich darauf hörte sie die helle Kinderstimme Mandelgebäck und Mönchsküchlein anpreisen. Anni glich in vielem ihrem verstorbenen Vater, der ein Gespür dafür gehabt hatte, wie sich Geschäfte machen ließen. Und ob die Gäste nun auf eine leckere Reisemahlzeit hofften oder dem niedlichen Mädchen nichts abschlagen mochten – sie kauften ihr immer ruckzuck die Schüssel leer. Was für ein Jammer, dass Tile dieses Talent, oder vielmehr das Interesse an der Herberge, so völlig abging. Nun, zumindest hatte er sämtliche Pferde gesattelt.
Aliz machte sich ans Fegen. Ihr war die Arbeit keine Last, die Handgriffe taten sich wie von allein. Sie liebte die Grüne Laterne, die zwar keinen Reichtum brachte, aber ihr und den Kindern und dem wenigen Gesinde ein Auskommen gab und sie unabhängig machte.
Vielleicht war der Wolkengänger gar kein Träumer, sondern ein Mensch, der wusste, worauf es im Leben ankam. Peter Granius, Aliz’ verstorbener Mann, hatte sie geliebt, es aber nicht dabei belassen, sondern ihr, trotz des Widerstands seiner Verwandtschaft, vor dem Pfarrer immerwährende Treue geschworen, so als gingen Liebe und Treue wirklich Hand in Hand. Er hätte jede wohlhabende Frau aus Wöllstein oder den Nachbarorten bekommen und damit seinen Besitz erheblich vergrößern können. Aber er war mit ihr, Aliz, vor den Altar getreten. Und den Schwur, den er dort abgelegt hatte, hatte er all die Jahre gehalten, obwohl ihm seine Familie wegen der hergelaufenen Ehefrau ordentlich das Leben schwermachte.
Aliz lächelte wehmütig, als sie die Schürze abband und hinausging, um die Gäste zu verabschieden. Der Mann mit den Triefaugen – er hatte sich als Johannes Apocalypsis in ihr Büchlein eingetragen – kletterte, von Tile gestützt, auf sein Pferd. »Eine gute Weiterreise und Gottes Glück«, wünschte ihm Aliz, die ihn plötzlich liebenswert fand.
Anni, die auf einem Stein saß und das Geld zählte, das sie in einem Schüsselchen gesammelt hatte, zeigte ihr mit den Fingern verstohlen ihren Verdienst: zwölf Kreuzer. Sie war ein ernstes Kind, aber in diesem Moment lachte sie über das ganze herzförmige Gesicht.
»Erlaubt Ihr mir noch eine Frage?«
»Bitte?« Aliz schreckte auf.
»Ich hätte mehrere Briefe zu befördern«, erklärte Apocalypsis. »Sie sind wichtig, und es müsste schnell gehen.«
Aliz nahm sich einen Moment Zeit, bevor sie antwortete. »Dann reitet zu dem Haus gleich neben der Kirche. Ihr könnt es gar nicht verfehlen. Es hat ein hübsch blau bemaltes Fachwerk, und über der Tür hängt ein Schild mit einem Posthorn.«
»O ja, das ist mir aufgefallen. Aber ich hörte, es gäbe in Wöllstein noch andere Möglichkeiten, Nachrichten zu transportieren, die vielleicht günstiger wären, was das Porto angeht.«
Günstiger? Aliz wurde vorsichtig. Sie hatte sich vor einigen Jahren, kurz nach dem Tod ihres Mannes, als die Gäste ausblieben und das Geld knapp wurde, einen heimlichen Nebenerwerb eingerichtet, eine Poststrecke, auf der sie nicht ganz legal – aber sei’s drum – die Briefe einer ausgewählten diskreten Kundschaft beförderte. Die Kinder waren damals noch klein gewesen, und Aliz hatte keinerlei Scham empfunden, als sie einem Übernachtungsgast nicht den Weg zur Poststation wies, sondern seine gesiegelten Briefe selbst ins nächste Dorf brachte.
In den folgenden Jahren hatte sie auf ihren Reisen, bei denen sie Weine und Delikatessen einkaufte, fünf Leute in fünf verschiedenen Dörfern entlang des Rheins gewinnen können, die ihrerseits gern mitverdienten und die Briefe weitertransportierten, so dass sie nach und nach einen Kurierdienst von Köln bis hinab nach Rheinhausen aufbauen konnte. Ihre heimlichen Postreiter waren langsamer als die kaiserliche Post, denn um den Kreis der Mitwisser klein zu halten, ritten die Kuriere nicht drei Meilen, nach denen sie die Fellsäcke in einer Stafette weitergaben, so wie die Männer der Taxis es machten, sondern acht oder zehn, und sie waren natürlich auch nicht so oft unterwegs. Trotzdem hatte sich im Lauf der Zeit ein Kundenstamm herausgeschält, der den größeren Zeitaufwand gern in Kauf nahm, wenn er dabei sparen konnte. Es handelte sich vor allem um Kaufleute, die Warenproben oder Geschäftsbriefe verschicken wollten und mit dem Kreuzer rechneten – auf ihre Verschwiegenheit war Verlass.
Hatte sie jetzt einen neuen Kunden an der Angel? Jemanden, der von jemand anderem gehört hatte, dass wiederum jemand anderes erwähnt habe, dass man in der Grünen Laterne Porto sparen könne? Sie wollte sich schon vortasten, aber als sie in das betont harmlose Gesicht mit den freundlichen Lachfältchen schaute, packte sie plötzlich ein Misstrauen. »Günstigeres Porto? Wie meint Ihr das?«
»Es werden doch sicher Menschen bei Euch übernachten, die in die nächsten Städte reisen müssen und noch Platz im Säckel haben. Meine Briefe sollen nach Remagen und zwei noch ein Stück weiter nach Köln. Ob sich da nicht jemand fände, der sie für, sagen wir einmal vier Kreuzer das Stück, mit sich nähme?«
Wieder lockte ihr Geschäftssinn. Zupacken. Nun mach ihm schon ein Angebot. Das Lächeln des Mannes wurde breiter, als könnte er ihre Gedanken lesen.
»Das weiß ich wirklich nicht. Ist so etwas nicht verboten, werter Herr?« Sie tätschelte den Hals des Pferdes.
»Ach, wer nimmt’s schon so genau? Wir müssen doch alle überleben.«
Finger weg, dachte sie – in ihrem Kopf schrillten sämtliche Alarmglocken.
Als sie nicht antwortete, meinte er: »Euer Käse ist tatsächlich köstlich, Frau Granius, und er wird über die Maßen charmant serviert. Ich werde ihn bei meinen Freunden weiterempfehlen.«
Ihr Arm war schwer wie Blei, als sie ihm nachwinkte. Was hatte er mit seinen Fragen bezweckt? War er ein Büttel? Nein, nicht in diesen teuren Kleidern. Aber vielleicht etwas noch Schlimmeres. Ein Spion derer von Taxis? Er warf ihr noch ein Lächeln zu, bevor er endgültig hinter dem gemauerten Torbogen verschwand.
Aliz zwang sich, die düsteren Gedanken beiseitezuschieben. Sie hatte sein Angebot ja ausgeschlagen. In sich versunken übertrug sie Tile seine Arbeiten für den Morgen, dann sah sie nach, ob die Mägde die Strohsäcke ordentlich aufschüttelten, und bat Asmus, ihren einzigen Knecht, den Pferdestall auszumisten. Nachdem sie all das erledigt hatte, wandte sie sich noch einmal dem Büchlein des Schultheißen zu.
Johannes Apocalypsis. Sie strich mit dem Finger über die steile, herrische Schrift. Plötzlich kam ihr der Name nicht mehr harmlos vor. Wollte ihr Gast mit den herzerwärmenden Ansichten über die Treue ein Reiter der Apokalypse sein? Ein Bote des Jüngsten Gerichts? Er nannte sich mit Vornamen Johannes, was doch fast wie Johann klang. Der Name des Kölner Postmeisters, Johann von Coesfeld, drängte sich förmlich auf. Aliz beschloss, in nächster Zukunft äußerst vorsichtig zu sein.
Am Nachmittag erntete sie mit Anni die ersten Möhren aus dem Garten hinter dem Haus, die immer besonders saftig schmeckten. Sie trugen den schweren Korb gemeinsam in den Keller, wo sie sie einlagern wollten.
»Um Möhren frisch zu halten, bedeckt man sie am besten mit Sand, Schicht für Schicht, in Kisten aus Holz«, erklärte Aliz ihrer Tochter, und Anni nickte, und man konnte sich darauf verlassen, dass sie es sich merken würde. Der Keller besaß keine Fenster, Licht fiel nur über die steile Holztreppe, die aus der Küche in die Vorratsräume führte, aber es reichte für ihre Arbeit aus.
Anni schüttete Sand auf die Kistenböden, und Aliz breitete das Gemüse darauf aus. »Nimm ein bisschen mehr – sie dürfen nicht aneinanderstoßen.« Ein weiteres Schippchen flog auf die Möhren. Aliz’ Blick fiel auf die Beine ihrer Tochter, die braun und dünn waren und bis zu den Knien unbedeckt unter dem Kleid hervorlugten. »Du musst aufhören, deinen Rock hochzubinden.«
»Warum? Das machen doch alle.«
»Ja, bei der Arbeit auf dem Feld oder beim Keltern der Trauben. Danach lässt man ihn wieder hinab. Du bist eine junge Dame, fast zehn Jahre alt.«
Anni zog eine Schnute, und Aliz beugte sich vor, nahm ihren Kopf zwischen die Hände und gab ihr einen Kuss direkt auf den Mund. »Du bringst die Jungs auf dumme Gedanken.«
»Auf was für Gedanken denn?«
»Das erkläre ich dir später.«
Wieder eine Schnute.
»Hier fehlt Sand, siehst du? Wenn die Möhren …«
»Bertram war gemein zu mir.«
»Wieso? Was hat er gemacht?«
»Er hat gesagt …« Anni brach ab. Überlegte sie, wie viel Kritik erlaubt war? Bertram war ihr Vetter, der Sohn von Peters Schwester Josefa. Aliz unterdrückte einen Seufzer. Ihr Verhältnis zur Schwägerin war angespannt, sie hatte keine Lust auf Ärger. Aber Anni sah bedrückt aus. Also forschte sie nach. »Was hat er gesagt?«
»Dass Tile ein Bastard ist.« Anni beobachtete ihre Mutter genau.
»Tatsächlich?«
»Und Moritz auch – und das find ich gemein«, schob Anni nach, aber es war klar, dass sie trotz ihrer zehn Jahre nicht begriff, worin genau die Kränkung bestand.
»Bertram plappert nach, was seine Mutter sagt, hör drüber weg«, sagte Aliz rau.
»Was ist denn ein Bastard?«
»Ich sagte: Hör einfach drüber …«
»Aber …«
»Bastard ist ein Schimpfwort, und Schimpfwörter beschmutzen die Menschen, die sie benutzen, und nicht die, auf die sie gemünzt sind. Und jetzt genug damit!« Energisch wandte Aliz sich wieder den Möhren zu. Nein, ganz fertig war sie doch noch nicht. »Worte sind wie Rauch, ma chérie – sie werden vom Wind davongetragen. Und Bertram ist ein armseliger kleiner Lümmel, mit einer Mutter, die niemals fröhlich ist. Er tut uns leid, und wir lassen uns von ihm nicht weh tun.«
Anni nickte, aber nur halb zufrieden. Irgendwann würde sie eine richtige Antwort verlangen. Und die bestünde dann in der Lüge, die Aliz jedermann, auch Peter, erzählt hatte, dass nämlich Tile und Moritz ihre Söhne aus einer Ehe mit einem französischen Fernhändler waren, den sie auf einer Reise begleitet und den die Cholera dahingerafft hatte. Aber sie hasste diese Lüge, und gerade in diesem Moment kam sie ihr nicht über die Lippen. Josefa – dieses verfluchte, intrigante Weib!
Hör einfach drüber weg, befahl sie auch sich selbst. Draußen zwitscherten die Vögel, und sie würde für die Gäste frisches Brot backen, mit Thymian und Basilikum, und sich daran freuen, welch guten Ruf die Grüne Laterne genoss und dass ihre Gästekammern, auch die beiden großen, ausreichend belegt waren, so dass sie und ihre Familie zurechtkamen. Josefa sollte sich zur Hölle scheren!
Das tat sie aber nicht. Im Gegenteil, es war kaum eine Stunde vergangen, Aliz stand an dem großen Eichentisch in ihrer Küche und steckte gerade bis zu den Ellbogen in der Teigschüssel, da stolzierte sie hinein. Eine Frau um die vierzig mit einem so engen Korsett, dass ihr Oberkörper wie ein Dreieck auf den ausladenden Rock zulief. Ihr Haar war hochgesteckt und mit Perlen geschmückt, der Spitzkragen mit Draht abgestützt, und aus den geschlitzten Ärmeln quoll rote Seide, die zweifellos ein Vermögen gekostet hatte. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters besaß Josefa eine glatte Haut und einen Kirschmund, den sie so wenig wie möglich bewegte, damit sich keine verräterischen Falten zeigten.
»Immer fleißig, meine Liebe?«, fragte sie und schaffte es, das Lob wie einen Makel klingen zu lassen. Aliz verkniff sich die schlechte Laune und deutete auf einen Stuhl. Es war allerdings schwierig, sich in dem steifen Kleid zu setzen, ohne es zu zerknittern, und so zog ihre Schwägerin es vor, stehen zu bleiben. Umso besser, dann würde sie vielleicht bald wieder abziehen.
Josefa griff nach einem Büschel Thymian, das auf dem Tisch lag, und roch daran, wobei sie murmelte: »Ich wundere mich, mit welcher Großzügigkeit du die vielen Kräuter in das Brot gibst – wo deine Gäste doch sicher auch mit einem wohlschmeckenden Fladen zufrieden wären. Du weißt ja, ich habe selbst über viele Jahre die kaiserlichen Postreiter bekocht, du kannst mir also eine gewisse Erfahrung zubilligen. Und mit dieser Erfahrung sage ich dir: Die Vorlieben von Reisenden sind schlicht. Ihre Bäuche müssen gefüllt werden … Wein braucht es ebenfalls, aber alles nicht vom Besten. Das wissen sie gar nicht zu schätzen. Ach, früher musste man kühler rechnen.«
»Ich will, dass meine Gäste wiederkommen.«
»Nun, ich kann glücklicherweise sagen, dass ich mich in dieser Hinsicht niemals sorgen musste. Denn auch wenn meine Küche einfach war, so galten die Speisen doch bis Augsburg hinunter als schmackhaft, und sie wurden – so hat man mir gelegentlich zugetragen, auch wenn ich nicht darauf achtete – hochgepriesen. Es braucht natürlich eine gewisse Erfahrung, um mit wenig Zutaten ein Gericht herzustellen, das mundet und Kraft spendet.«
Aliz schlug die Faust in den Teig und versuchte, ihren eigenen Rat zu befolgen: Hör einfach drüber weg. Wie hatte eine Mutter nur derart verschiedene Kinder hervorbringen können – auf der einen Seite den bodenständigen, gelassenen Peter, auf der anderen Seite dieses lächerliche Weib mit der Giftzunge. Na ja, besonders gut waren die beiden auch nicht miteinander ausgekommen. Peter hatte die Herberge seiner Eltern geerbt, und Josefa den Postmeister von Wöllstein geheiratet. Dadurch waren die beiden zu Konkurrenten geworden, denn das Weib hatte natürlich nicht nur die Postreiter beherbergt, wie es zu ihrer Profession gehörte, sondern ihrem Bruder auch andere durchreisende Gäste abspenstig gemacht. Und so viele Leute passierten das kleine Wöllstein eben doch nicht.
»… ich ein wenig befremdlich, denn es ist natürlich ein sonderbarer Anblick, wenn ein so großer Knabe, der ja schon kurz vor dem Eintritt ins Mannesalter steht, die Hühner scheucht.«
»Wer scheucht Hühner?«, fragte Aliz zerstreut.
Für einen winzigen Moment kränzten hässliche Falten den hübschen Kirschmund. »Wie es scheint, fällt es dir schwer, zu kneten und gleichzeitig deinen Besuchern zuzuhören. Nun, jeder hat wohl sein eigenes Geschick.«
Mit Erleichterung sah Aliz, dass Asmus über den Hof kam, um ihr beim Kochen zu helfen. Ihr Knecht konnte nur ein einziges Gericht zubereiten: Fischbrei mit Mandelmilch. Aber der fand bei den Übernachtungsgästen reißenden Absatz. Doch Asmus war nicht nur deshalb ein Schatz in ihrem Haus. Seine Ruhe war wie ein Steg durch den Sumpf, dem ihr Leben manchmal glich. Und nun würde er sie vor dem giftigen Geschwätz ihrer Schwägerin retten. Sie lächelte ihn an, als er die Tür öffnete, und wandte sich zugleich an Josefa. »Es tut mir leid. Hier wird’s jetzt unruhig. Vielleicht willst du lieber am Sonntag wieder …«
»Schon gut!« Ihre Besucherin wedelte mit der Hand. »Ich hatte gehofft, willkommen zu sein, aber ich spüre, dass ich störe. Nein, nein, ich werde dich nicht weiter ablenken, dir scheint das alles hier ja schwer genug zu fallen. Ich hatte es nur für meine Pflicht gehalten, dich als deine nächste Verwandte von dem seltsamen Treiben deines Sohns in Kenntnis zu setzen.«
Wie war das gewesen? Tile hatte die Hühner gescheucht? Wessen Hühner denn? Die von Josefa? Aliz verbiss sich den Ärger. »Ich werde mit ihm reden«, versprach sie – und konnte sich dann doch nicht die Bemerkung verkneifen: »Ich wäre froh, wenn du auch ein Wort mit Bertram sprechen könntest. Er beschimpft Tile.«
»Das halte ich für ausgeschlossen. Mein Sohn weiß glücklicherweise, was sich Verwandten gegenüber gehört. Aber ich sehe, dass meine Hilfe hier nicht willkommen ist, obwohl viele Menschen behaupten, dass es ihnen nicht zum Schaden war, wenn sie Rat bei mir einholten.«
Sie ging zur Tür. Aliz ahnte allerdings, dass sie das Haus nicht verlassen würde, ohne noch einen letzten Giftpfeil abzuschießen. Und sie hatte recht. Als Josefa in den Hof getreten war, drehte sie sich noch einmal um und meinte, als wäre es ihr gerade eingefallen: »Ach, da ist noch etwas. Es könnte sein, dass dein Ältester ebenfalls durch ungebührliches Betragen aufgefallen ist. Vermutlich ist alles nur ein Irrtum. Andererseits wird es nicht viele junge Männer geben, die Moritz heißen und aus Wöllstein kommen und auf einer hässlichen Schindmähre reiten.«
Aliz ließ entgeistert die Hände in den Teig sacken. »Was ist passiert?«
Josefa verzog die Lippen zu einem zufriedenen Lächeln, und die Falten, die sie so unbedingt vermeiden wollte, kräuselten sich um ihren Kirschmund wie in die Haut gemeißelte Bosheit, als sie zu berichten begann.
Alzey lag drei Meilen von Wöllstein entfernt: Es war ein aufstrebendes Städtchen mit einer Stadtmauer aus graubraunem Bruchstein zwischen wuchtigen Wehrtürmen, einem fast neuen Rathaus, einem Schloss, in dem vor Jahren einmal der Kurfürst residierte, als in Heidelberg seine Kapelle renoviert wurde – und mit dem berüchtigten Metzgerturm, in dessen Kerker, Gott steh uns bei, die Stadt die Lumpen befragte, die ihr ins Netz gingen.
Meinen Lumpensohn, dachte Aliz und ritt auf dem schnellsten ihrer drei Pferde, als würde sie vom Teufel gejagt. Sie hätte gern jemanden an ihrer Seite gehabt – Asmus, um genau zu sein, denn er war nicht nur der treuste, sondern auch der klügste Kopf in ihrem Haus –, aber das war unmöglich. Während sie über die Feldwege stürmte, mit Bildern von Daumenschrauben und Streckbänken im Kopf, die bei den besagten Lumpen die Wahrheitsliebe fördern sollten, musste jemand dafür sorgen, dass daheim das Geschäft weiterlief, und zwar möglichst so, dass niemand den Verdacht schöpfte, es könne etwas Ungewöhnliches in Gang sein. Etwas, das womöglich mit illegalen Poststrecken zusammenhing.
Sie dachte an den Mann, der sich Apocalypsis genannt hatte. Hingen sein Besuch in der Grünen Laterne und Moritz’ Verhaftung zusammen? Zog sich gerade ein Netz um sie zusammen, in dem ihr Ältester bereits um sein Leben zappelte?
Sie hatte lange gezögert, ob sie ihre Kinder in ihr geheimes Zusatzgeschäft einweihen solle. Dann hatte, an einem kalten Frühlingsabend, als die Armut nach einem Hungerwinter mit besonders ängstigender Fratze durch die Fenster schaute, ein Reitertrupp an die Tür der Herberge geklopft, zwanzig Mann, die sie mit ihrer Zeche über die nächsten drei Wochen bringen könnten. Die Männer hatten gegessen und gesoffen und keinerlei Neigung gezeigt, zu Bett zu gehen. Aber der Fellsack mit den Briefen musste nach Hangen-Weisheim.
Also hatte sie Moritz geweckt. Er war damals vierzehn Jahre alt gewesen – fast erwachsen. Sie hatte ihm erklärt, womit sie heimlich Geld verdiente und wie ihre Notlage aussah, und er hatte sich auf den Weg gemacht und war vier Stunden später mit glänzenden Augen zurückgekehrt. Aus der Ausnahme wurde rasch eine Gewohnheit. Moritz war flink und hatte Vergnügen an den nächtlichen Ritten. Ihr eigenes schlechtes Gewissen hatte sie mit dem Gedanken beruhigt, dass es ihm nur guttun könne zu lernen, dass die Not kein Gebot kennt.
Und nun? Schickte der Herrgott die Rechnung für ihr sündiges Verhalten? Wollte er sie in der Währung zahlen lassen, die sie am meisten schmerzte – dem Unglück ihrer Kinder?
Die Sonne schien immer noch. Auf den Feldern, an denen sie entlangpreschte, wuchs eine überreiche Ernte heran, ein Körnermeer, das den Dörfern durch den Winter helfen würde. Ein Bauer mit Kittel und Leinenmütze stapfte zwischen dem Getreide und prüfte zufrieden die Ähren, während sein Söhnchen ihn auf einem Steckenpferd umsauste. Rehe trauten sich zum Äsen an den Rand eines Wäldchens. Alles wirkte so friedlich, aber im Metzgerturm hatten sie einen Halunken sitzen, der sicher zu störrisch war, um seine Sünden zu gestehen. Und wenn sie ihm deshalb die Finger brachen? Wenn sie ihm die Hände auf den Rücken banden und ihn mit einer Winde an die Decke zogen und dabei seine Sehnen zerrissen, so dass er zeit seines Lebens ein Krüppel bleiben würde? Es war ja kein Geheimnis, was sich bei den peinlichen Befragungen abspielte.
Aliz trieb ihr Pferd an, eine etwas blöde, aber flinke Stute, die galoppierte, als wäre Moritz’ Unglück ein Futtersack, der ihr vor der Nase baumelte. Glücklicherweise war das Alzeyer Tor noch nicht verschlossen. Aliz steckte dem Wächter, der auf den Stufen liebevoll den Dreck zwischen seinen Zehen herauspulte, einige Kreuzer zu, damit er sie nicht mit Fragen aufhielt.
Der Metzgerturm befand sich in die Nähe des Tores. Sie musste nur noch ein Gässchen hinauf. Das Pferd trabte an Handwerksläden vorbei, zwischen Schweinen, Mägden und müden, weinenden Kindern hindurch. Ein frommer Psalm, mit zittriger Bettlerstimme vorgetragen, zog an ihrem Ohr vorbei. »Preiset den Herrn …« Ja, das würde sie tun, wenn er nur ihrem Jungen half.
Und dann stand sie vor dem Gemäuer mit dem eisenbeschlagenen Tor und den vergitterten Fenstern, die sich bis unter den Zinnenkranz zogen. Sie hörte nichts, keine grässlichen Schreie, kein Stöhnen, aber das musste nichts heißen. Der Folterraum lag bestimmt so, dass keine Geräusche die Passanten auf der Straße belästigen konnten.
Aliz zwang sich zur Ruhe. Sie band ihr schweißnasses Pferd an einem Eisenring fest, beauftragte einen Knaben mit seiner Bewachung, richtete das Kleid und zwängte die Haare, die sich gelöst hatten, unter die Haube. Sie war Aliz Granius, eine ehrbare Witwe, die regelmäßig die Gottesdienste besuchte, die wegen ihres Fleißes in ihrem Heimatstädtchen geachtet wurde und zuverlässig zum Steueraufkommen beitrug. Außerdem gab sie jeden Feiertag Almosen, fünfzig Kreuzer in schlechten Wochen, in guten das Doppelte …
Aufhören, Schluss damit! Das alles würde die Männer, die ihren Sohn malträtierten, nicht interessieren. Wenn überhaupt, würden sie die Münzen überzeugen, die sie in einem Beutel am Gürtel trug. Aliz hämmerte mit dem angerosteten Klöppel gegen die Tür. Befand Moritz sich tatsächlich hier? Sie malträtieren ihn im Metzgerturm, hatte Josefa behauptet. Aber wenn sie gelogen hatte? Oder Moritz bereits mit gebrochenen Gliedern im Stroh lag? Aliz atmete auf, als endlich ein Riegel zurückgeschoben wurde.
Der Mann, der ihr öffnete, trug einen unvorteilhaften Kinnbart, der ihn wie einen Affen aussehen ließ, und eine von dunklen Flecken übersäte Schürze. Seine Hände waren feingliedrig, doch das durfte nicht täuschen. Er war der Henker, und die Flecken stammten sicher vom Blut seiner Opfer. Sie erspähte hinter seinem Rücken einen runden Raum mit einem Tisch, Schemeln und einem gepolsterten Sessel, wie ihn eigentlich nur reiche Leute besaßen. Eine Treppe führte in die oberen Stockwerke, die zweite in den Keller, sicher an den Ort, in dem die Foltergeräte standen. Die irdische Hölle wurde ja gern in der Nähe der unterirdischen angelegt.
Aliz zwängte sich an dem Mann vorbei.
»Ihr könnt da nicht runter«, protestierte er, traute sich aber nicht, sie aufzuhalten, wahrscheinlich wegen ihrer sittsamen und keinesfalls ärmlichen Kleidung.
»Ich verstehe, ich verstehe«, plapperte sie und eilte auch schon die Stufen der Wendeltreppe hinab. Der Mann folgte ihr. Foltern erforderte Kraft, auch dieser Henkersknecht barst vor Muskeln. Sein Schweiß stieg ihr in die Nase. »Wo steckt er denn, der Unglücksrabe?«, erkundigte sie sich mit zitternder Stimme, während sie Stufe um Stufe nahm.
»Also hört mal …«
»Maman …«, tönte es in diesem Moment kläglich aus den Tiefen des Kellers.
Ihr Herz stand still. »O Heilige Jungfrau, ich höre ihn rufen!« Sie sprang über die letzte Stufe und hatte den Schreckensraum erreicht. Und das war es wirklich – ein Raum des Schreckens. Entsetzt starrte Aliz auf Finger- und Beinschrauben, auf Halsgeigen, ein Streckbrett und einen mit Nägeln gespickten Stuhl. Auf eiserne Ketten, die von der Decke hingen, auf ein böse loderndes Feuer in einem Eisenbecken, auf dunkle Flecken, die sich in die Ritzen der grauen Fußbodensteine gefressen hatten … Das Bild stimmte so exakt mit dem überein, was sie erwartet hatte, dass sie sich einen Moment wie in einem Alptraum fühlte.
An einem Tisch saßen zwei Männer. Beide vornehm gekleidet mit schwarzen Wämsern und eleganten, steifen Spitzenkragen, die ihre Wangen vom Kinn bis zu den Ohren rahmten und sie dazu zwangen, die Körper zu drehen, wenn sie zur Seite blicken wollten. Sicher die Richter, die den Delinquenten befragten.
Aliz wandte sich ihnen zu. »Meine guten Herren«, begann sie und suchte die Verzweiflung in ihrer Stimme zu unterdrücken. »Ihr seid aufgebracht. Und das zu Recht. Ich bin informiert. Wie konnte es nur, dieses unglückselige Kind! Wie konnte es nur.« Sie trat zum Tisch und beugte sich wie zufällig vor, in der Hoffnung, dass den Herren dabei ihr immer noch hübscher Busen vor die Augen und der Veilchenduft, den sie daheim großzügig aufgetragen hatte, in die Nase kam. »Aber ich weiß nur Allgemeines. Wie genau hat der Unfug sich denn zugetragen?«
»Verstehe ich das richtig? Ihr seid die Mutter dieses Verbrechers«, brummte der Dicke, dessen fette Wangen sich in den Kragen drückten.
»Maman …«, hörte Aliz erneut die jammernde Stimme ihres Sohnes.
»Schont mich nicht, Monsieur«, bat sie mit tragischer Stimme. »Ich bin gewappnet. Er hat gespielt, nicht wahr? Wie oft habe ich zu ihm gesagt: Die Würfel werden dein Unglück sein. Du wirst dich an den Strick würfeln, habe ich ihm gepredigt, bis mir die Stimme versagte. Wenn nur sein Vater noch lebte. Auf den hat er gehört. Aber seit mein armer Gatte verstorben ist …«
»Ich hab doch gar nicht gespielt«, tönte es protestierend in ihrem Rücken.
Aliz drehte sich um und zwang sich zu dem klaren Blick, den sie bisher vermieden hatte. Moritz – Maurice, wie sie ihn früher gelegentlich genannt hatte, wenn die Sehnsucht nach den leichtfüßigen Franzosen ihr das Herz zusammenschnürte – saß an einem Tisch, in dessen Platte eiserne Fingerschrauben eingelassen waren. Man brauchte keinen Sachverstand, um ihre Funktion zu begreifen. Eiserne Querstreben wurden von Stangen gehalten, und in der Mitte stak ein Schraubengewinde, durch das man diese Streben gegeneinanderpressen konnte. Moritz’ Finger steckten zwischen den Eisen, sie waren blau angelaufen. Aliz blickte in die Augen ihres Sohnes, und obwohl ihm ein Grinsen im Gesicht saß, für das sie ihn hätte prügeln mögen, sah sie doch auch die Angst in ihnen. Der Schein des lodernden Feuers irrlichterte über seine Wange. Er schwitzte, er schluckte.
»Was hast du angestellt, du furchtbares Kind?«, brachte sie hervor.
»Dies ist meine Mutter, Madame Marot«, erklärte ihr Sohn den beiden Richtern überflüssigerweise. Nein, es war keineswegs überflüssig, denn sie hatte diesen Namen noch nie zuvor gehört. Marot also. »Es ist alles ein Irrtum, Maman. Ich habe es selbst nur halb verstanden. Es geht um einen dummen Fellsack.« Moritz verzog das Gesicht. Die Blässe seiner Wangen, die blutunterlaufenen Augen – o ja, er litt.
»Jetzt ist dir also doch wieder dein Name eingefallen, du Teufelsbrut, ja?«, raunzte einer der Richter, nicht der dicke, sondern ein hagerer mit schön geschwungenen Augenbrauen und vollen, sinnlichen Lippen. Trotz seines angenehmen Äußeren war er härter als der andere, das spürte Aliz. Aber der Dicke blickte bekümmert. Vielleicht besaß er selbst Kinder, die ihm Sorgen bereiteten. Vor seiner Brust baumelte eine Silberkette mit dicken Gliedern. Er sah reicher als der andere aus und war zudem älter und deshalb hoffentlich derjenige, der den Ton angab.
»Maurice wird doch nicht betrogen haben, Monsieur?«, wandte Aliz sich mit bebender Stimme an ihn. »Bitte, ich flehe Euch an. Er ist unbesonnen, aber … Nein, Monsieur, so schwarz kann sein Herz nicht sein. Er hat fleißig zu seinem Herrn gebetet, seit er sprechen kann. Als Kind hat er Bilder des Heilands gemalt, sehr hübsch sogar, mit Kreide auf sein Schiefertäfelchen. Doch leider ist er verführbar, wenn er in schlechte Gesellschaft …«
»Ihr seid also Frau Marot? Eine Französin?«, unterbrach der Mann mit der Silberkette ihren Redefluss.
Sie nickte, lächelte verzagt und hoffte, dass sie den beiden Männern niemals zuvor begegnet war, was keineswegs als sicher gelten konnte, denn ihr Dorf lag nur wenige Meilen von Alzey entfernt. Andererseits hatten sie auch gerade deshalb keinen Grund, eine Herberge aufzusuchen, in der sich nur Reisende und abends einige Dörfler tummelten. Dass sie eine gebürtige Französin war, hatte man in dieser Gegend glücklicherweise längst vergessen. Ihr Familienname, Granius, war deutsch, ihr Akzent völlig verschwunden, wenn sie ihn nicht, wie gerade jetzt, kultivierte. Warum also sollte man sie mit der Grünen Laterne in Verbindung bringen?
»Ich habe den Sack gefunden«, meinte Moritz kläglich.
Sie fuhr erneut herum. »Wie gefunden? Was redest du denn?«
»Er lag hinter Wörrstadt am Wegrand. Ich hab ihn unter einem Busch liegen gesehen und gedacht, es wäre doch schade, ihn da im Dreck zu lassen.«
Der Silberkettenmann nickte, aber sein Begleiter blickte spöttisch. Man konnte ihm die Gedanken ansehen: Diese Strolche sind alle gleich: Sie lügen den Mörtel aus den Fugen.
»Was hat er enthalten?«, fragte Aliz ihren Sohn streng.
»Ich weiß nicht, irgendwelche Papiere.«
»Mein Kind besitzt leider kaum Verstand«, erklärte sie den Richtern. »Hat er Euch die Papiere übergeben? Sind sie wichtig, diese Papiere? Allgütiger, es handelt sich doch hoffentlich nicht um die Geheimnisse irgendwelcher hoher Herren? Mein Sohn ist faul und dumm, und das sage ich als die Mutter, die ihn liebt. Ihm Geheimnisse anzuvertrauen – so töricht würde niemand sein. Oder waren es gar Wechsel? Geht es um Geldpapiere?«
»Nichts davon«, beruhigte sie der Mann mit der Kette.
Der andere blickte zu einem Schemel in der Ecke, auf dem der Fellsack lag, mit dem Moritz normalerweise unterwegs war. Es war kein gewöhnlicher Sack, sondern ein Postfelleisen, wie die Reiter der Taxis sie benutzten, um ihre Briefe zu befördern. Aliz hatte ihn vor Jahren ihrem Schwager abgekauft, bei dem einer der Postreiter den Beutel hatte liegen lassen. Er war so praktisch gewesen: wasserdicht, robust, mit Unterteilungen, so dass die Briefe nach ihren Bestimmungsorten getrennt untergebracht werden konnten. Leider besaß er aber auch verräterische gelb gefärbte Streifen an den Nähten. Gelbe Streifen! Wie hatten sie nur so leichtsinnig sein können.
Die Männer hatten den Sack geöffnet. Ein schmutziges Hemd und ein Lederschlauch lugten heraus, am Rand des Schlauchs klebte Bier, durch das betrunkene Fliegen krabbelten. Außerdem erspähte Aliz einen Lederbecher und einen vertrockneten Kanten Brot. Aber – danke, o Herr im Himmel – keine Briefe oder Pakete. Moritz musste sie entsorgt haben, bevor er in die Fänge der Häscher geriet. Das war wohl auch der Grund, warum es ihrem Jungen noch einigermaßen gut ging.
»Ich hab die Papiere weggeworfen und meine eigenen Sachen in den Sack getan, weil er besser als mein eigener war.«
»Du hättest forschen sollen, wer der Besitzer ist«, klärte Aliz ihren Jungen auf. »Nicht wahr, das hätte er tun müssen, meine guten Herren? Aber er denkt nicht weiter als zum nächsten Augenblick.« Der Silberkettenmann seufzte, und Aliz schenkte ihm ein Lächeln. Wenn du lächelst, geht die Sonne auf, hatte Peter immer gemeint, und etwas Sonne konnten sie wahrlich brauchen. »Was machen wir denn nun, meine Herren?«
Der Dicke stand auf. Er trat zu ihr und blickte prüfend in ihr Gesicht, und sie pries innerlich die Vorsehung, die es mit einem Ausdruck der Unschuld versehen hatte. »Es ist so, gute Frau, dass wir einem Verbrechen auf der Spur sind, von so ungeheuerlichem Ausmaß, dass Ihr es nicht werdet erfassen können.«
Aliz brach in Tränen aus – nicht aus Vorsatz, das hätte sie wohl kaum geschafft, sondern aus purer Nervenanspannung. »Na, na, na …« Der Richter tätschelte ihre Schulter. »Es geht um das Postregal des Kaisers. Wie gesagt: Dieses Metier ist zu kompliziert für Euren hübschen Kopf. Nur so viel: Wir jagen seit Wochen eine Bande durchtriebener Verbrecher, die heimlich und gegen das Gesetz Briefe befördern. Der Schaden, den sie damit verursachen, ist immens, ebenso wie der Grimm des Kölner Postmeisters, der hier bei uns die Postlinien beaufsichtigt, und der Herren von Taxis, die ihm das Amt übertragen haben.«
Aliz tupfte vorsichtig mit dem Finger unter die Nase, wo sich ein Tröpfchen gebildet hatte.
»Wenn wir das Gesindel erwischen, ist ihnen der Galgen sicher.«
»Ach, dass es Euch nur gelänge«, flüsterte sie.
»Nun ja, Euer Sohn wurde gesehen, wie er mit einem Postfelleisen auf dem Rücken seines Pferdes eine Furt in der Nähe von Alzey passierte, und da wir in der Nähe waren, jagten wir ihn. Er machte sich zusätzlich verdächtig, weil er auf unsere Rufe nicht reagierte, sondern im Gegenteil floh.«
»Ich hatte Angst, ich wusste ja nicht, wer hinter mir her ist«, keuchte Moritz. Ihm liefen inzwischen ebenfalls die Tränen herab. Die Fingerpresse musste teuflisch schmerzen.
»Wenn man bedenkt, was für ein Tölpel Euer Sohn angeblich ist, dann könnte man sich wundern, wie geschickt er nach Aussage der Büttel von seinem Pferd gefallen ist, wie mühelos er sein Reittier zurückbekam und wie entschlossen er auch nach seiner Festnahme die nächste Gelegenheit zur Flucht ergreifen wollte«, meinte der dürre Richter, den Aliz im Geiste auf den Namen Luzifer taufte.
Sie ging zu ihrem Sohn und sank vor dem Foltertisch auf die Knie. »Du bist geflohen? Warum, um aller Barmherzigkeit willen, machst du etwas so Törichtes? Warum gehorchst du nicht, wenn die Männer der Justiz es dir befehlen?«
Moritz blickte sie an, er hatte rote Flecken im Gesicht. »Ich liebe Eva«, stieß er hervor.
»Bitte?«
»Und sie wird mein Weib. Das ist der Grund, Maman. Es eilt, sie wartet auf mich und ist voller Angst. Wir werden fliehen, das habe ich ihr versprochen. Ihr Vater hat sie eingesperrt und will sie noch in diesem Monat verheiraten. Aber unsere Liebe ist heilig. Wenn es sein muss, werden wir nach Frankreich fliehen, habe ich zu ihr gesagt. Oder in die Kolonien. Ich werde sie und unser Kind ernähren. Ich werde …«
»Heilige Jungfrau Maria – was für ein Kind?«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.