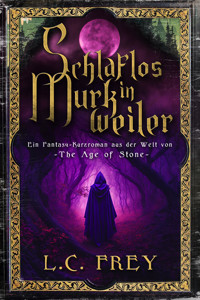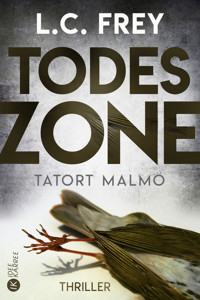10,99 €
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DarkWing Publishing
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Komplettausgabe mit über 1.600 Seiten - In den Ruinen Chicagos hausen seltsame Wesen - und die meisten davon sind absolut tödlich. Als das Mädchen Morrow ohne jede Erinnerung in einer fremden, bösartigen Welt erwacht, ahnt sie nicht, welche Veränderungen sie in dieser Realität verursachen wird - und aus welchem Grund sie wirklich hier ist. Begleitet von einer halbmenschlichen Kreatur, die sie "den Jungen" nennt, bricht sie auf, um den Weg zurück in ihre eigene Welt zu finden. Auf ihrer abenteuerlichen Reise durch eine Welt voller vergessener Relikte aus den letzten beiden Jahrhunderten unserer Zeit müssen sich die beiden Freunde tödlichen Gefahren stellen, bevor sie ihr Ziel erreichen können: Die sagenhafte rote Stadt der vergessenen Götter. Doch die Schrecken, die in den Weiten des ewigen Sandes und jenseits davon lauern, stammen nicht allein von dieser Welt. Und etwas weitaus Gefährlicheres ist ihnen bereits dicht auf den Fersen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
DIE RIFTWELT-SAGA
Gesamtausgabe im Sammelband
L.C. FREY
DarkWing Publishing
IMPRESSUM
Copyright © 2021 by L.C. Frey. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung von L.C. Frey. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Lektorat: Anne Bräuer, Textbüro Bräuer, Frankfurt am Main, Layout und Satz: Ideekarree Leipzig. Umschlaggestaltung: L.C. Frey, unter Verwendung von ©Grand Failure, https://stock.adobe.com
2301.14.0806
www.Alex-Pohl.de
Die in diesem Roman beschriebenen Personen und Geschehnisse sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen, Orten, Unternehmen und Produktmarken sind rein zufällig und keinesfalls beabsichtigt. Gleichwohl kommen in der Handlung dieses Buches Personen und Zusammenhänge von historischer Bedeutung vor. Der Autor bemüht sich, diese Fakten nach bestem Wissen respektvoll zu behandeln, sie werden jedoch im Kontext dieses Buches frei ausgelegt. Der Autor distanziert sich von einer historischen oder sonstigen Deutung von geschichtlichen und anderweitigen Ereignissen und Zusammenhängen.
Dieses Werk ist reine Fiktion.
Noch.
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank für dein Interesse an meinem Buch! Als kleines Dankeschön möchten ich dir gern einen Thriller von
mir schenken, den du auf meiner Website OliverMoros.de kostenlos erhältst.
Gratis: TODESZONE - Tatort Malmö: Thriller
Ein Serienmörder auf freiem Fuß
Eine Stadt in Angst.
Nur eine Frau kann ihn stoppen - vielleicht.
Erleben Sie dramatischen Nervenkitzel auf schwedische Art - in diesem rasanten Thriller von Bestsellerautor L.C. Frey!
Um das Buch zu erhalten, folge einfach diesem Link:
www.OliverMoros.de
BAND 1 - KINDER DES FEUERS
Karte der Riftwelt © Franz Alken
TEIL I
IÄ! DER JUNGE MIT DEN TAUSEND ZIEGEN
ALPHA
Vierzehn Milliarden Jahre vor unserer Zeit, getrennt durch die Unendlichkeit des Raumes, findet der gewalttätigste und kreativste Moment in der Geschichte unseres Universums statt. Alles, das jemals passiert ist, geht auf diesen einen Moment zurück.
Jede Religion, jede Kultur hat sich mit diesem Moment beschäftigt, aber wir wissen immer noch nicht, was diesen Schöpfungsakt ausgelöst hat oder warum.
Ein unendlich kleiner, dichter Punkt explodiert und erschafft Raum, Zeit, Materie – und unser Universum.
Es beginnt als ein subatomares Teilchen, Momente später erreicht der Punkt die Größe unserer Erde. Noch heute breitet sich das Licht des Urknalls aus. Man kann es hören, wie das statische Rauschen eines Radios. Man kann es sehen, wie die Bildstörung eines Fernsehers, der keinen Sender mehr empfängt.
Und so beginnt das Universum.
– nach Journey to the Edge of the Universe, eine National Geographic Dokumentation (2008)
* * *
S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S
* * *
1
Als sie bemerkt, dass ihr Sohn sie ansieht, lächelt sie.
Der Junge kann nicht zurücklächeln, aber das macht nichts. In ihren Augen lächelt er trotzdem. Seine Mutter beendet ihre Arbeit an dem Leder, zieht den groben Faden ein letztes Mal durch und beißt das lose Ende ab. Der Junge krabbelt an ihrem Bein hoch und sie nimmt ihn auf ihren Schoß.
Seine Klauen spielen mit dem goldglänzenden Ring, den sie an einer schmalen Kette um den Hals trägt.
An dem runden Stück Metall zwischen ihren warmen Brüsten glitzert ein Brillant. Der Junge mag es, mit dem interessanten Ding zu spielen. Der Stein an dem Anhänger ändert ständig seine Farbe, von bläulich schimmernd zu orange leuchtend und dann zu grün lodernd – je nachdem, in welchem Winkel das Licht darauf fällt – und manchmal scheint es, als ändere sich auch seine Form dabei.
Seine Mutter streicht eine Strähne des Haarflaums aus der Stirn des Jungen. Das wenige Haar, das er jetzt noch hat, steht in hauchfeinen Büscheln von seinem viel zu großen Schädel ab. Ihre schlanken Finger liebkosen sanft die knorpeligen Auswüchse auf der Stirn, über den Ohren und auf dem Rücken des Jungen.
Seine Mutter flüstert ihm Worte zu, deren genaue Bedeutung er noch nicht versteht, aber er spürt, dass sie voller Liebe sind. Sie beruhigen den Jungen und machen ihn schläfrig.
Der Junge muss viel schlafen, denn noch ist er viel zu schwach für die Welt, in die er hineingeboren wurde.
Wenn er schläft, dann öffnen sich die fleischigen Blätter der Pflanzen über seinem Kopf, um ihn vor dem Regen zu schützen, und die Zweige der Bäume scheinen den Wind zu besänftigten.
Manchmal kommen kleine Tiere zu dem Jungen, und dann hält er sie in seinen unförmigen Klauen, und freut sich über ihre kleinen Gedanken. Und manchmal, wenn ein Tier verletzt ist, oder wenn es Angst hat, dann beruhigt er es und macht es wieder gesund. Das macht seine Mutter gleichermaßen stolz wie traurig. Er begreift nicht, warum das so ist, denn auch sie liebt die Tiere, und alles, das lebt.
Aber heilen kann sie sie nicht.
»Du musst mich beschützen«, sagt sie, ohne dass sich ihre Lippen bewegen, und dann beugt sie sich hinab und küsst seine wuchtige Stirn, zwischen den kleinen Hörnern, wo der Junge es am liebsten hat. Ihr Haar kitzelt ihn und er stößt ein vergnügtes, kleines Schnaufen aus.
Sie lächelt, während sie weint.
Doch statt Tränen laufen jetzt schmale rote Rinnsale aus ihren Augenwinkeln, und das Herz des Jungen zieht sich furchtsam zusammen. Ihre Augen sind nun keine Augen mehr, sondern leere Höhlen.
Blutige Krater in ihrem makellosen Gesicht.
Hässliche Wunden, in denen kleine, fleischige Dinge emsig herumwimmeln. Ihr augenloses Gesicht ist eine Wachsmaske, und die Haut, die sich darüber spannt, beginnt zu zerfließen, vermischt sich mit dem Blutstrom, der an ihrem knochigen Kinn herabläuft und zischend auf den Waldboden tropft.
Er streckt eine seiner verkrümmten Klauen nach ihr aus, in dem vergeblichen Bemühen, diesem rasenden Verfall Einhalt zu gebieten.
Doch die Hand des Jungen verfängt sich nur in einer blutverklebten Strähne und er reißt, ohne es zu wollen, ein handtellergroßes Stück Kopfhaut von ihrem Schädel.
Ihr Kopf sackt auf ihre Brust, die nun nichts ist als ein Sack voller Knochen, über dem sich eine Pergamenthaut spannt.
Sie ist tot, seit Jahren schon.
Es ist ein Leichnam, der den Jungen hält.
Und jetzt sieht der Junge, dass der Wald, in dem sie gerade noch waren, kein Wald mehr ist, sondern eine tote, morastige Fläche, aus der sich schwarze Ranken in den Himmel recken wie die verwachsenen Arme von getöteten Riesen. Diese Ranken sind so tot wie alles hier, vergangen und zu Stein geworden, denn hier, wo einst das Grün war und die Liebe und das Leben – hier gibt es jetzt kein Leben mehr.
Keine Liebe.
Kein Grün.
Nur noch den Tod.
»Du musst mich beschützen«, sagt sie noch einmal, obwohl sie keine Zunge mehr hat, mit der sie sprechen könnte.
Körperlos, fern, vergangen ist diese Stimme jetzt.
Eins geworden mit dem grünen Leuchten und dem Leben, das einst in den Bäumen wohnte, vor so langer Zeit.
Du musst mich beschützen.
»Weil es wichtig ist.«
Und so beginnt es.
2
HEUTE // DORT
DIE STADT
Als er erwachte, bemerkte der Junge, dass sich seine rechte Hand um den Ring geschlossen hatte, der an einer groben Lederschnur um seinen Hals hing. Beinahe verschämt ließ er ihn unter die Tierhaut gleiten, die er sich um die Schultern geschlungen hatte.
Der Junge richtete sich langsam auf und spähte durch das Loch in der Ziegelmauer nach draußen.
Das zerfledderte Bündel, welches er seit Tagesanbruch beobachtete, lag immer noch auf dem großen Platz vor der Kreuzhalle.
Inzwischen war er zu der Ansicht gekommen, dass es sich bei dem Bündel um den Leichnam eines Mädchens handeln musste.
Der Wind, kaum mehr als eine sanfte Brise, spielte mit den glitzernden Fetzen, die den leblosen Körper umflatterten. Die Silberstreifen aus der zerfetzen Kleidung der Leiche wogten in der flirrenden Hitze über dem Platz wie träge Gräser auf dem Grund eines brackigen Tümpels. Dabei funkelten sie geheimnisvoll, beinahe wie Metall – und doch mussten sie so leicht sein wie verdorrtes Laub, überlegte der Junge, während er einen sehnsüchtigen Blick auf die Stiefel an den Füßen des Körpers warf.
Gute Stiefel waren das, viel besser als die Lumpen, die er um seine Füße und Waden gewickelt hatte. Schuhe, in denen man vermutlich meilenweit laufen konnte, ohne Pause machen zu müssen. Ein paar der Mickies trugen so ähnliche, aber ihre waren grob und schwer, und einige hatten Nägel durch die stählernen Kappen getrieben. Gut, um auf Dinge oder Körper einzutreten – schlecht dagegen, wenn man schnell und weit laufen wollte.
Die glitzernden Stiefel waren praktisch in Reichweite des Jungen, keine zwanzig Schritte von seinem Versteck entfernt, vermutlich weniger. Dennoch zähmte der Junge seine Ungeduld. Er verharrte weiter reglos in den Schatten und starrte durch den Riss im Gemäuer.
Eine Tasche oder etwas Ähnliches lag bei der Leiche, halb verdeckt von ihrem Oberkörper, wo reglose Gliedmaßen in grotesken Winkeln aus dem flatternden Silber ihres Anzugs ragten. Möglicherweise würde die Tasche ebenfalls etwas Nützliches enthalten, dachte der Junge, möglicherweise aber auch nicht.
Dünne, zerfetzte Schläuche ragten daraus hervor und erinnerten den Jungen an die langstieligen Leuchtpflanzen, die weiter unten in den Tunneln wuchsen. Das musste sie auf dem Rücken getragen haben, die Schläuche mit ihrem Körper verbunden – bis etwas sie gewaltsam davon getrennt hatte.
Aus einem der Schläuche tröpfelte ein dünnes Rinnsal. Die klare Flüssigkeit hatte eine kleine Lache auf dem rissigen Steinboden vor der Kreuzhalle gebildet, welche gierig von der Hitze aufgesogen wurde.
Sie glänzten, diese Stiefel, und das war natürlich schlecht. Keiner, der bei Verstand war, würde so etwas anziehen – am Tag würden sie meilenweit zu sehen sein – kein Wunder, dass ihre bisherige Trägerin jetzt tot mitten auf dem Platz herumlag. Aber das Glänzen würde der Junge später mit etwas Dreck und Aschepampe in den Griff bekommen. Wenn er sie nur erst einmal in seinen Händen hielt, diese verlockenden, bequemen Silberstiefel.
Aber da gab es ein Problem.
Das Problem bestand vor allem darin, dass es ihm bis jetzt noch nicht gelungen war, eine befriedigende Antwort auf die Frage zu finden, wieso ihm niemand zuvorgekommen, und der Leiche ihre Stiefel abgenommen hatte. Wieso jemand derart wertvolles Zeugs hier mitten auf dem Platz vor der Kreuzhalle herumliegen ließ. Das heißt, eine mögliche Antwort gab es schon.
Eine Falle.
Der Junge wusste, was ein Köder war, wenn er auch vielleicht das Wort nicht kannte. Manchmal banden die Farmer oder die Mickies ein kleines Tier an einem Stock fest und schnitten rein, damit das große Tier das Blut roch und aus dem Wald rauskam. Kaum hatte es sich in den Köder verbissen, hackten sie mit ihren Spießen auf dem großen Tier herum, bis es totgeblutet war.
Dann fraßen sie das große und das kleine Tier.
Der Junge ließ seinen Blick ein weiteres Mal schweifen. Auch wenn die Fassade der Kreuzhalle auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes meterhoch in den Himmel aufragte und den Platz zumindest auf dieser Seite vor all zu neugierigen Blicken bewahrte – es gab immer noch zwei Seiten, wo sie in Verstecken sitzen und auf den Platz starren konnten, mit Netzen und Knüppeln und langen Spießen bewaffnet.
Wartend, auf das große Tier.
Auf das Monster.
Auf ihn.
Verborgen in den Schatten der Häuserruinen, genau wie er, würden sie jetzt sitzen. Wenn sie erfahrene Jäger waren, würden sie warten, bis er nahe genug bei der Leiche und den Stiefeln war. Bis es zu spät war, um noch umkehren und fliehen zu können.
Bis dahin würden sie kein Geräusch machen.
Sobald er nahe genug dran war an dem Köder, würde ein Pfiff aus einem der höheren Gebäude erschallen, und dann kämen sie von allen Seiten auf den Platz gestürmt und würden auf ihn einprügeln, bis er so tot war wie die Leiche dort draußen auf dem Platz vor der Kreuzhalle.
Besser, noch zu warten.
Einmal, vor vielen Nächten, war er hineingegangen in die Kreuzhalle. Ein blasser Mond hatte durch die Löcher in den hohen, spitz zulaufenden Fenstern geschienen und zaghafte Strahlen weißlichen Lichts in das Innere des gigantischen Gebäudes geschickt.
Der Junge war in der Kreuzhalle herumgewandert, war durch zentimeterhohe Staubschichten gewatet, in denen die Spuren seiner Krallen die ersten Abdrücke seit Jahren hinterlassen hatten. Ehrfürchtig hatte er die Wände berührt, und die Bilder betrachtet, die sie schmückten.
Darstellungen von rundlichen Frauen und bärtigen Männern in wallenden Gewändern, die durch Wolken schwebten und auf dem Rücken Flügel trugen und goldene Ringe über ihren Köpfen. Vielleicht sollten sie Ringe darstellen wie der, den seine Mutter einst getragen hatte?
Die Malereien blätterten von den Wänden, die sie einst lückenlos bedeckt hatten, bis hinauf zur Spitze der gigantischen Kuppeldecke. Der Blick des Jungen war emporgewandert bis dorthin, wo sich die steinernen Pfeiler hoch über seinem Kopf vereinten, in einem Himmel aus Stein; zu ewiger Reglosigkeit gefroren, einst bemalt mit Wolken und Sternen, nun zur Bedeutungslosigkeit verblasst wie alles hier. Und dann, als der Junge seinen Blick wieder nach vorn wandte, hatte er es gesehen.
Der Anblick hatte ihn erstarren lassen.
Am Stirnende der steinernen Halle hatte eine große, weiße Gestalt gestanden und ihren Blick unverwandt auf den Jungen gerichtet. Als er den Schock überwunden hatte, begriff der Junge, dass es kein Mensch war, der dort mit ausgebreiteten Armen stand, kein Mickie oder Farmer und auch keiner der Aussätzigen. Es war überhaupt nichts Lebendes, sondern nur eine gigantische Figur aus weißem Stein. Sie war an ein gigantisches, schwarzes Kreuz geheftet, mit großen Nägeln, die jemand ihr durch die Hand- und Fußgelenke getrieben hatte.
Doch wozu würde jemand eine Steinfigur foltern?
Die Gestalt war dünn, richtiggehend ausgemergelt, im krassen Gegensatz zu den Männern und Frauen in ihren wehenden, sich bauschenden Gewändern auf den Bildern an den Wänden ringsum. Es lag etwas Fesselndes in den Augen, die dem Jungen aus dem schmerzverzerrten Gesicht der Gestalt am Kreuz entgegenstarrten. Ein Feuer schien darin zu brennen, der Wahnsinn vielleicht – wie er in vielen der Mickies brannte.
Der flammende Blick der Steingestalt schien ihm zu folgen, wohin er auch ging. Unverwandt, starr – aufmerksam.
Lauernd.
Da hatte sich der Junge umgedreht und war aus der Kreuzhalle hinaus zurück in die Nacht gerannt und hatte sie seitdem nicht wieder betreten.
Doch das steinerne Gesicht hatte er danach noch oft gesehen, in seinen Träumen, und stets musterte es ihn aus diesen seltsamen Augen, halb leidend, halb wissend – und ganz bestimmt ein bisschen wahnsinnig. Doch auch voller gütiger Verzweiflung. Wie ein Vater, wenn der Junge seinen Vater auch nie kennengelernt hatte.
Nein, beschloss er, heute war nicht der Tag, an dem sie ihn fangen würden, mochten die Stiefel auch noch so verlockend sein. Er warf einen letzten, beinahe sehnsüchtigen Blick auf den silberumflatterten Körper auf dem Vorplatz, dann drehte er sich um, um genauso geräuschlos zu verschwinden, wie er gekommen war.
Er erstarrte mitten in seiner Bewegung.
Das Bündel hatte sich bewegt.
3
Ein kaum merkliches Zucken der Finger ihrer rechten Hand, aber dennoch nichts, das der Wind allein hätte bewerkstelligen können, und sie lag noch nicht lang genug, als dass die kleinen Fresser ihren Körper in Besitz genommen haben konnten.
Reglos starrte der Junge auf den Platz, ganz und gar auf den Körper fokussiert, den er gerade noch für leblos gehalten hatte.
Die Bewegung erfasste langsam ihre gesamte Hand. Ein kleines, bleiches Stück Fleisch am Ende ihres aufgeschürften Arms, das jetzt zum Leben erwachte. Milchig weiße Haut, bedeckt mit einer dicken Schmutzkruste und von rotem Gewebe, auf dem sich erste Blasen von der Hitze gebildet hatten.
So gut wie tot.
Aber eben noch nicht ganz.
Das verkomplizierte die Situation des Jungen beträchtlich, und für einen Moment überlegte er, ob es nicht trotzdem besser wäre, seinen Posten auf der Stelle aufzugeben und die ganze Sache einfach zu vergessen. Er könnte sich geräuschlos zurückziehen, und im Schatten der verfallenen Ziegelmauer zurück zur Kanalisation schleichen. Von dort hinab in den Tunnel, lautlos, unsichtbar. Noch vor Einbruch der Dunkelheit würde er in seinem Versteck sein – ohne Stiefel freilich, aber dafür ungesehen und in Sicherheit.
In Sicherheit.
Doch er blieb und starrte, unfähig, den Blick abzuwenden, wie es ihm unmöglich gewesen war, dem Blick der Statue auszuweichen, die von ihrem Kreuz unter dem Himmel aus Stein auf ihn hinabgestarrt hatte.
Die Hitze flimmerte über der festgestampften Erde, die den Platz vor der Halle bedeckte. Er erkannte jetzt, dass die zögerlichen Bewegungen des Mädchens ein Ziel hatten.
Sie versuchte, in den Schatten zu kriechen, den die Kreuzhalle warf, und sie zeigte erstaunliche Beharrlichkeit dabei. Ihre Bewegungen waren für einen flüchtigen Beobachter kaum als solche auszumachen, so langsam waren sie.
Dennoch kroch sie weiter.
Unendlich langsam, aber sie bewegte sich.
Doch die Sonne war schneller als das Mädchen. Die Hitze würde das letzte bisschen Wasser aus ihrem Körper saugen, lange bevor die Nacht hereinbrach. Falls sie dennoch bis dahin überlebte, würde dann die Kälte kommen und mit ihr jene, die sich an sterbenden und toten Körpern labten. Dinge, die sich tagsüber in die lichtlosen Schatten der Ruinen verkrochen, wohin die Menschen niemals gingen und auch der Junge nicht.
Dinge, die nur im Schutz der Dunkelheit herauskamen, wenn sie leichte Beute witterten. Kriechend, tastend, hoppelnd und schleichend – und immer hungrig.
Nachdem diese Kreaturen ihren Teil gehabt hatten, würden die kleinen Fresser sich um die Reste kümmern.
Als das Mädchen sich erneut bewegte, rutschte ein Stück des silbrigen Stoffs von ihrem Kopf. Was darunter zum Vorschein kam, entlockte dem Jungen ein überraschtes Glucksen. Ihr Haar, fein und strahlend hell, fiel ihr ins Gesicht und lang über ihre Schultern. Selbst von da, wo er saß, konnte der Junge sehen, wie wunderbar weich und fein dieses Haar war.
Solche Haare hatte er noch nie gesehen.
Er verspürte den beinahe übermächtigen Impuls, es zu berühren. Es in seine Hände zu nehmen und sich davon zu überzeugen, wie zart es tatsächlich war. Daran zu schnuppern, möglicherweise. Wie er den Duft im Haar seiner Mutter geschnuppert hatte, vor langer Zeit.
Er sah wieder zu dem Mädchen hinüber.
Sie hatte ihren Körper ein paar weitere Zentimeter bewegt, auf den Schatten der Kreuzhalle zu, und war dann wieder zusammengebrochen. Sie würde sehr bald sterben, wenn er nichts dagegen unternahm.
Sterben, wie sie alle gestorben waren.
Seine Mutter, die Tiere des Waldes und kurz darauf der Wald selbst. Sterben, wie das Mädchen im Tigerkäfig gestorben war, seinetwegen.
Und die anderen Kinder.
Hin und wieder fuhr der Wind zärtlich in das feine Gespinst der Haare und entblößte eine bleiche Stirn. Haut, wie sie der Junge seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatte. Denn diese Haut deutete auf Schwäche hin, und Schwäche passte nicht in die Welt, in der der Junge lebte.
Schwäche verging hier all zu rasch.
»Du musst mich beschützen«, hörte er die Stimme seiner Mutter. »Weil es wichtig ist.«
Also blieb er, und starrte auf den Platz hinaus.
Und dachte nach.
4
Das Mädchen hatte ihren Oberkörper inzwischen größtenteils aus der unmittelbaren Sonneneinstrahlung gehievt. Nun lag sie reglos im Schatten der Kreuzhalle. Wenn sie großes Glück hatte, konnte sie vielleicht doch noch bis zum Einbruch der Dunkelheit überleben.
Dann würde der Junge sie holen und sich um ihren ausgebrannten Körper kümmern können. Vielleicht. Aber sehr wahrscheinlich war das nicht.
Zu gefährlich.
Als er die Bewegung wahrnahm, drückte sich der Junge in die Schatten hinter der zerborstenen Ziegelwand. Sein Körper spannte sich, seine Füße krallten sich sprungbereit in die verfaulten Bretter, auf denen er hockte. Er hielt den Atem an, während er dem Geräusch seines wild pochenden Herzens lauschte.
Etwas war hier.
Vorsichtig drehte er den Kopf in die Richtung, aus der er die Bewegung wahrgenommen hatte. Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes lugte der zottige Kopf eines Hundes aus einer schmalen Gasse zwischen zwei windschiefen Gebäuden hervor.
Den Körper gänzlich in den Schatten verborgen, witterte das Tier, während es mit unverhohlener Gier zum Körper des sterbenden Mädchens herüberstarrte.
Der Junge konnte den Hunger der Kreatur förmlich spüren.
Das Hundegesicht mit der langen Schnauze war von zahlreichen Kampfspuren gezeichnet. Der Hund besaß nur noch ein Auge. Eine breite Narbe begann mitten auf seiner Stirn und endete bei seinen Lefzen, sodass es aussah, als habe das Tier ein schiefes, anzügliches Grinsen aufgesetzt.
Na, wie wär's mit uns beiden?, schien dieses Lächeln zu sagen. Die gewaltigen gelben Zähne, die darunter zum Vorschein kamen, versprachen eine ebenso kurze wie leidenschaftliche Begegnung.
Seine Zähne, wenn auch furchteinflößend, waren nicht mehr vollzählig. Es war ein alter Hund – älter und größer als alle, die der Junge bisher gesehen hatte. Ein erfahrener Kämpfer, der schon jenseits seiner besten Tage war.
Ein alter, aber dennoch gefährlicher Gegner.
Schließlich wagte sich das zerzauste Tier aus seinem Versteck hervor und trottete gemächlich auf den Platz vor der Kreuzhalle zu.
Immer wieder blieb es stehen, witterte, lauschte.
Das linke Hinterbein zog er etwas nach, was seinem Gang etwas Unsicheres verlieh, als habe er von dem Gebrannten gekostet, den die Mickies bei den Spielen am Rad an die Farmer verkauften.
Zottige Fetzen seines Fells hingen in großen Büscheln von seinem Körper, dazwischen zeigte die ledrige Haut unzählige schlecht verheilte Narben. Hauptsächlich Bissspuren und tiefe Kratzer, die von der Begegnung mit seinen Artgenossen stammen mussten. Doch es gab auch andere. Brandwunden, längliche, glatte Schneisen in seinem borstigen Fell, von Fackeln oder glühenden Stäben, die man ihm in den Leib gedrückt hatte, um seine Kampfeslust zu steigern. Und diese Narben stammten nicht von anderen Tieren.
Ein Leittier, das erkannte der Junge an der Art seines Gangs und an dem Mut, den der Hund an den Tag legte.
Für ihn war es ebenso gefährlich wie für den Jungen, mitten am Tag auf den großen, ebenen Platz zu laufen – seine Narben ließen darauf schließen, dass der Hund über die Bedeutung eines Köders ebenso gut Bescheid wusste wie der Junge.
Nur war der Hund viel hungriger als der Junge.
Ein ausgestoßener Rudelführer vielleicht, der zu alt für seinen Posten geworden war, aber dennoch zu gefährlich für den Nachfolger, als dass dieser ihn zu einem offenen Kampf herausforderte.
Heutzutage hält er sich raus aus dem Kampf, dachte der Junge, wenn er es vermeiden kann. Sucht sich leichte Beute, weil er weiß, dass einer seiner nächsten Kämpfe sein letzter sein wird. Versteckt sich tagsüber, genau wie ich, und wartet darauf, dass es mit ihm zu Ende geht. Ein Rudelführer ohne Rudel.
Seine Krallen machten leise Klickgeräusche, als der Hund in vorsichtigen Schritten auf die Mitte des Platzes zulief. Dort hin, wo der Körper des Mädchens lag. Der inzwischen wieder aufgehört hatte, sich zu bewegen.
Der Hund erreichte den ersten der silbrigen Fetzen der verstreuten Kleidung des Mädchens und begann, daran zu schnuppern.
Blut, dachte der Junge, er riecht ihr Blut.
Wenn er es kostet, wird er nicht mehr zu bremsen sein. Nicht so einer wie er. Ohne hinzusehen, griff der Junge in die Tasche, die an einem breiten geflochtenen Band um seine Schultern baumelte und holte einen flachen Stein heraus.
Vorsichtig wog er ihn ein paar Mal abschätzend in der Hand, während er den Hund keinen Moment aus den Augen ließ. Er spürte das Gewicht des Steins, seine Rundungen und Kanten. Dann krümmte er den Zeigefinger um eine der Kanten und hob langsam seinen Arm.
Tut mir leid, alter Rudelführer, aber dieses Fleisch kannst du nicht haben.
Der Junge hob den Stein und holte aus, genau in dem Moment, als der Hund einen weiteren Schritt auf das Mädchen zumachte. Für einen Augenblick spürte der Junge die Gier des Hundes fast körperlich, und er bewunderte die erstaunliche Disziplin und Vorsicht des Hundes angesichts des gewaltigen Hungers, der an seinen Eingeweiden reißen musste.
Ein Gefühl, das dem Jungen gut vertraut war.
Der Hund musste seit Tagen nichts zu Fressen bekommen haben.
Tut mir leid, alter Rudelführer.
Die lange Zunge hing seitlich aus dem Maul des Tieres und wippte bei jedem seiner Schritte hin und her, ein langer Speichelfaden löste sich von seinen Lefzen und tropfte zu Boden. Die borstigen Fellbüschel auf seinem Rücken hatten sich zitternd aufgestellt.
Der Hund blieb wieder stehen.
Er hatte die Pfütze erreicht, die sich dort gebildet hatte. Wasser, das aus einem der zerfetzten Schläuche aus dem Anzug des Mädchens gelaufen war. Der Hund schnüffelte an dem zerfetzten Ende des Schlauchs. Hob den Kopf. Sah sich um. Er schleckte das wenige Wasser vom Boden auf, den Blick seines wachsamen Auges auf den reglosen Körper des Mädchens gerichtet.
Dann ging er weiter.
Der Junge hob die Hand mit dem Stein, sah sich um. Nur er, der Hund, und der zerschrammte Körper des beinahe toten Mädchens. Kein Rudel in Sicht. Bis jetzt.
Das da muss ich beschützen, Rudelführer, dachte der Junge, weil es wichtig ist.
Als der Hund einen weiteren vorsichtigen Schritt auf das Mädchen zumachte, warf der Junge den Stein.
Er prallte mit einem trockenen Geräusch gegen die Schnauze des Hundes.
Der Rudelführer jaulte erschrocken auf und sprang zur Seite.
Dort stand er, zitternd vor Anspannung, und lauschte mit erhobenem Kopf und aufgestellten Ohren, während der Junge die Hand mit dem nächsten Stein bereits zum Wurf erhoben hielt. Am Hals, wo er kaum noch Fell besaß, traten die kräftigen Sehnen wie gespannte Seile hervor. Reglos starrte das Tier in die Richtung, in der es den Ursprung des Wurfgeschosses vermutete.
Das anzügliche, halbseitige Grinsen des gewaltigen Hundes wandte sich dem Jungen zu und erstarrte. Die Schnauze zitterte aufgeregt, und der Junge konnte sehen, dass ein wenig Blut aus der Wunde troff, die sein Steinwurf verursacht hatte. Der Hund zog die Lefzen zurück und gewährte dem Jungen einen langen Blick auf sein beeindruckendes, wenn auch unvollständiges Gebiss.
Dann senkte er den Kopf und begann, leise zu knurren, ohne den Blick seines einzelnen, gelblich schimmernden Auges von der Ziegelmauer zu wenden, hinter der der Junge saß.
Der Junge hob den Stein in seiner angespannten Rechten ein Stück höher. Seine Finger krallten sich um den Gesteinsbrocken, bereit für einen zweiten, härteren Wurf. Der Hund stieß ein röchelndes Keuchen in Richtung des Gebüschs aus, eine Art halbherziges Bellen.
Dann entschied er sich zur Flucht.
Ohne das Mädchen oder den Platz eines weiteren Blickes zu würdigen, lief er davon und verschwand in dem Spalt zwischen Mauer und Wurzel, aus dem er gekommen war.
Als er fort war, verstaute der Junge den Stein wieder in der Tasche. Der Hund würde wiederkommen, keine Frage, vielleicht mit seinem ganzen Rudel. Was, wenn fünf von seiner Sorte hier auftauchten, oder zehn, oder vielleicht noch mehr? Dann würden alle Steine, die der Junge finden konnte, nicht ausreichen, um mit ihnen fertig zu werden.
Der Junge richtete seinen Blick ein letztes Mal hinauf zum fernen Dach der Kreuzhalle. Dort, wo die verwitterten Reste eines weiteren Kreuzes in den wolkenlosen Himmel ragten.
Dann huschte er aus seiner Deckung und rannte auf den Platz, die Tasche eng an den Körper gepresst, den Stein wurfbereit in seiner Rechten.
Er rannte dorthin, wo das Mädchen lag.
5
Sie schlägt die Augen auf.Sie muss wohl eingeschlafen sein.
Über ihr der Himmel, strahlend blau, ein paar Schäfchenwolken. Milder Sonnenschein, der ihre Haut wärmt und die Welt mit Licht erfüllt.
Ein Vogel singt, eine Spottdrossel vielleicht.
Es duftet leicht nach gebratenem Fleisch.
Ihre Finger streichen durch das kühle Gras, auf dem sie liegt. Aber das stimmt nicht, sie liegt auf einer Decke.
Die Wolldecke aus Davids Wagen.
Wer auch immer David ist.
»Hast du von mir geträumt?«, sagt eine Stimme.
Jetzt stützt sie sich auf ihre Ellenbogen, hebt den Oberkörper an und dreht sich um, um zu sehen, von wem die Stimme stammt. Ein Mann, etwa dreißig, gutaussehend, braungebrannt mit lächelnden braunen Augen, die mehr versprechen als nur ein Lächeln. Interessante Augen sind das, und deren gesamte Aufmerksamkeit gilt ihr, scheint ihren Anblick aufzusaugen wie eine seltene Kostbarkeit. Es ist schön, so angeschaut zu werden.
Das ist David.
Natürlich.
Sie nickt, um seine Frage zu beantworten, auch wenn sie sich in Wahrheit nicht erinnern kann, wovon sie geträumt hat.
Oder … an irgendetwas.
Merkwürdig.
Das ist seltsam, denn woher weiß sie dann, dass der Mann David heißt und ihr Verlobter ist und …
Sie schaut an sich herab.
Ihr Bauch wölbt sich unter einem lockeren Sommerkleid, Blumen in Pastellfarben sind darauf gedruckt, und einen Moment später begreift sie, dass sie schwanger ist.
Dass sie ein Leben in sich trägt, das noch nicht einmal richtig begonnen hat.
Ihr Herz wird von einer Wärme erfüllt, der von dem kleinen Leib zu strahlen scheint, der jetzt in ihr heranwächst.
Ein Wunder.
Ein Etwas, das sie beide aus Nichts geschaffen haben.
Nein – nicht aus Nichts, sondern aus Liebe.
Tränen steigen in ihre Augen und sie tut so, als hätte sie etwas unheimlich Interessantes im Gras entdeckt, während ihre Linke sich sanft auf ihren Bauch legt.
Leben.
Ein winziges, neues Leben.
So viele Möglichkeiten.
»Mir ist ein Name eingefallen«, sagt David. »Falls es ein Mädchen wird. Und das wird es selbstverständlich.«
Sie nickt, unfähig zu sprechen.
»Wir könnten sie … nennen.«
»Was?«, fragt sie, denn sie hat den Namen nicht verstanden.
»Wir … sie … en.«
Jetzt wird seine Stimme in Fetzen gerissen wie ein Funkspruch während eines Unwetters. Düstere Wolken, wo eben noch ein strahlend blauer Himmel war. Ein Sturm ist aufgekommen. Er reißt an ihrem Kleid, an den Zweigen des Apfelbaumes, unter dem sie liegt, an der Landschaft selbst.
»Was, David?«, ruft sie, denn jetzt ist alles erfüllt vom Rauschen und Tosen des wütenden Sturms und sie versteht ihre eigene Stimme kaum noch, während David sich immer weiter zu entfernen scheint.
Dann ist er verschwunden.
Plötzlich ist es dunkel, und als sie diesmal in den Himmel blickt, sind schwere, graue Gewitterwolken aufgezogen, die ein Sturm über den Himmel peitscht.
Es ist pechschwarze Nacht.
Da ist keine Sonne mehr.
Tote Blätter wirbeln um sie herum, und auch die Spottdrossel singt nicht mehr.
Dann setzt auf einen Schlag der Regen ein.
Aus dem Sturm ist inzwischen ein Orkan geworden, der an dem kahlen, schwarzen Baumriesen zerrt, der gerade noch ein Apfelbaum voller praller, roter Früchte war. Jetzt ragt er in den Himmel wie ein anklagender Skelettfinger, kahlweiß vor der Schwärze.
Tot.
Sie schaut zu Boden, doch ihre Finger krallen sich nicht länger in das Gras, denn die Wiese ist verschwunden. Jetzt ist hier nur noch schwarzer, stinkender Morast, der sie gierig in sich hineinsaugt.
Sie versucht aufzustehen, zu dem toten Apfelbaum zu laufen, irgendwo hin, wo sie sich festhalten kann, wo noch fester Boden ist, doch sie kann sich nicht mehr bewegen.
Sie hört auf, hier zu sein, sie …
Sie beginnt, sich zu verlieren.
Und dann stürzt die Schwärze über ihr zusammen, während sie panisch nach David ruft, und ihn doch nicht entdecken kann und seine Stimme nicht mehr hört, und der Himmel fällt ihr auf den Kopf.
6
Die Jacke, die das Mädchen trug, schien im Gegensatz zu ihrer übrigen Kleidung noch funktionstüchtig zu sein, auch wenn es der Junge für keine gute Idee hielt, solch ein glänzendes Ding zu tragen. Viel zu auffällig, wie auch die Stiefel. Der Stoff, aus dem die Jacke bestand, war dünn und leicht, und dabei erstaunlich robust. Ein Material wie dieses hatte der Junge noch nie gesehen und er konnte sich auch nicht erklären, welch ein Tier oder welche Pflanze die Grundlage für etwas Derartiges produzieren mochte.
Vermutlich stammte sie nicht aus dem Viertel, was neben der seltsamen Kleidung auch ihre offensichtliche Unachtsamkeit erklären würde. Blieb die Frage, wie sie dann hier hergekommen war.
Und warum.
Der Junge warf die Jacke in eine Ecke seines Verstecks, zu den Stiefeln, die er dem Mädchen zuvor von den Füßen gezogen hatte. Sicher würde das Mädchen später beides wiederhaben wollen.
Falls es für sie ein Später gab.
Nachdem er sie vom Platz auf seine Schultern gewuchtet hatte, war er mit seiner Beute davongerannt, immer mit der nagenden Furcht im Hinterkopf, dass es doch eine Falle war, und sich Farmer oder Mickies mit Dornenkeulen und Feuerstäben auf ihn werfen würden. Doch nichts war passiert. Er hatte es völlig unbeschadet bis zu seinem Versteck geschafft. War jetzt in Sicherheit, und sie auch.
Falls sie überlebte.
Er wickelte ihren zitternden Körper erneut in die schmutzige Decke, aus der sie sich immer wieder zu befreien versuchte. Sie strampelte, kämpfte. Doch er wusste, dass ihr Körper die Wärme brauchte. Um die Hitze zu bekämpfen, die in ihr tobte.
Feuer, das gegen das Feuer kämpft.
Als er ihr die Decke wieder über ihre Schultern zog, spürte er die Hitze, die von ihr ausging wie von einem Lagerfeuer. Ihr Brustkorb hob und senkte sich in hektischen Stößen, ihr Atem ging röchelnd und ungleichmäßig.
Ihr Atem roch nach Krankheit, und nach Tod.
Die Haut des Mädchens war spröde und rissig, und an vielen Stellen hatten sich Blasen von der Hitze gebildet. Er hatte die tieferen Wunden ausgewaschen und die Abschürfungen mit breiten Streifen der grünen Pampe bedeckt, die er über dem Feuer zubereitet hatte.
Ihr zerbrechlicher Körper sackte kraftlos zusammen, so als sei jeder Lebenswille aus ihr gewichen.
Aber ihr Geist war in einem weit schlimmeren Zustand.
Als er sie auf die zerschlissene Matratze gelegt hatte, war sie für einen Moment erwacht, hatte ihn aus weit aufgerissenen, verwirrten Augen angestarrt.
Dann hatte sie geschrien.
Sie hatte ihm unverständliche Wortfetzen entgegengespien, vermischt mit langen Fäden ihres Speichels. Fiebriges Zeug war von ihren Lippen getropft, bis ihre Stimme ganz rau und heiser geworden und schließlich zu einem undeutlichen Schluchzen herabgesunken war.
Dann war sie wieder eingeschlafen.
Der Junge spürte das Fieber, das ihren Körper verbrannte und ihren Geist durcheinanderwirbelte wie ein Sturm, der in die Glut eines Lagerfeuers fährt. Er konnte es riechen, dieses Fieber. Es drang aus jeder Pore ihrer glühenden Haut, während sie dalag und zusehends schwächer wurde.
Es war zu spät.
Der Junge legte seine Hand auf ihre Stirn und versuchte erneut, in ihren Kopf zu blicken, wie er es vor langer Zeit bei den kleinen Tieren getan hatte, die seine Freunde gewesen waren. Doch dann hatte er sich schnell wieder daraus zurückgezogen. Der rasende Malstrom der Empfindungen und zerfetzten Eindrücke hatte gedroht, seinen simplen Geist mit sich in die Tiefe zu reißen.
Gedanken, Bruchstücke, zusammenhanglose Erinnerungen mit Löchern darin, so groß wie die in den Wänden der Ruinen um die Kreuzhalle. Das alles raste wild im Kopf des Mädchens durcheinander, so schnell und chaotisch, dass einem übel davon wurde.
Das, überlegte der Junge, musste ihre ganz eigene Version von dem Übel sein, das auch in Onkel Ruggs’ Kopf getobt hatte. Die Würmer, die Ruggs’ Geist zum Schluss ganz beherrscht hatten.
Schwarz und grün.
Der Wahnsinn.
Das Mädchen öffnete den Mund und gab ein ersticktes Stöhnen von sich. Der Junge beugte sich über sie, obwohl der bittere Gestank aus ihrem Mund noch schlimmer geworden war. Sie hauchte etwas, das beinahe wie ein richtiges Wort klang. Der Junge beugte sich noch tiefer zu ihr hinab, bis sein schwarzer, schuppiger Schädel ihre spröden, aufgeplatzten Lippen beinahe berührte.
Da verstand er etwas, dass wie »Bet … better … Morr … o-moh-rr … oh … morrow«, klang.
»Mor-Row«, murmelte das Mädchen.
Morrow.
Das musste ihr Name sein.
Dann klappte sie den Mund wieder zu und fiel zurück in das Dunkel.
Morrow.
Ein schöner Name, für ein schönes und fast totes Mädchen.
Der Junge ging wieder nach draußen und sammelte etwas Asche von der Feuerstelle, um sie mit dem Rest der grünen Pampe in dem kleinen Topf über der Feuerstelle zu vermengen. Es waren seine letzten Kräuter, er würde bald neue beschaffen müssen. Wenn er irgendwo noch welche finden konnte. Aber vermutlich würde er das nicht, selbst in den Tunneln war die Ausbeute in letzter Zeit sehr karg gewesen. Blieben nur die Farmer, und dort hinzugehen, würde der Junge nicht wagen.
Beschütze sie, weil es wichtig ist.
Aber wie?
Der Junge blickte noch einmal auf das Mädchen, das vielleicht Morrow hieß und vielleicht auch schon ein Leichnam war. Sorgsam trug er den Rest der Pampe auf ihre Wunden auf und dann, einem Impuls folgend, malte er das Blitzzeichen des Zeuss auf ihre Stirn. Er glaubte nicht an den Zeuss der Farmer, jedenfalls nicht richtig, aber was konnte es schon schaden?
Diesmal strampelte sie die Decke nicht von ihrem Körper, mittlerweile war sie zu schwach dazu.
Ihr Atem ging in kleinen, unregelmäßigen Stößen und auf ihren Wangen und ihrem Hals hatten sich hektische, rote Flecken gebildet. Als der Junge mit dem Malen des heiligen Zeichens fertig war, verstummte ihr Stöhnen.
Sie schlief jetzt.
Das war gut, vielleicht.
Der Junge angelte nach der flachen Tasche, die er neben ihrem Körper auf dem Platz gefunden hatte. Vorn war eine Art Verschluss dran. Kühl und seltsam glatt unter seinen Fingerspitzen. Er strich darüber, zog daran und nach einer Weile kapierte er, dass er draufdrücken musste, und öffnete die Tasche. Er drehte sie um und schüttete den Inhalt vor sich auf den Boden.
Drei Behälter, jeweils etwa so groß wie ein Ziegelstein, aber viel leichter, und ein schwarzer, etwas größerer. Die kleineren Boxen waren aus einem halbdurchsichtigen Material, wie Glas, nur dass es sich überhaupt nicht wie Glas anfühlte. Es war rauer, und nicht so kalt wie Glas, außerdem konnte man es verbiegen, oder es zumindest ein wenig eindellen, wenn man fest genug gegen die Oberfläche drückte. Der Junge ritzte es mit einer seiner Krallen, und auch das ließ sich leicht bewerkstelligen.
Er hob den Deckel von der ersten der ziegelsteingroßen Boxen, die daraufhin ein leises Zischen von sich gab. Sie war leer.
Mit den anderen beiden verfuhr er auf dieselbe Weise, und diese verströmten einen penetrant süßlichen Duft, und als er sie umdrehte, lief eine graubraune Masse heraus und klatschte auf den Boden. Nahrung, begriff der Junge, aber diese war komplett verdorben, offenbar schon vor langer Zeit.
Der Junge warf die unansehnlichen Reste des stinkenden, grünlichen Breis ins Feuer, dann öffnete er den größeren schwarzen Kasten. Auch dieser Verschluss bereitete ihm einige Mühe, und als er endlich an der richtigen Stelle drückte, war er so überrascht, dass ihm die Schachtel aus den Händen glitt.
Etwas fiel heraus und zersprang mit einem hohen Klirren auf dem Steinboden, begleitet von einem leisen Stöhnen des Mädchens. Ein kleines durchsichtiges Röhrchen, das eine Flüssigkeit enthalten hatte, die nun rasch in den Ritzen zwischen den Ziegelsteinen versickerte, die der Junge um die Feuerstelle gelegt hatte.
Bevor sie ganz verschwunden war, leuchtete die Flüssigkeit in einem sanften blauen Schimmer auf, der den Jungen an die Augen der langstieligen Leuchtpflanzen in den Kanälen erinnerte.
Vorsichtig hob er den Deckel des Behälters an und sah hinein. Die Innenseite der Schachtel enthielt ein weiches Polster mit drei Vertiefungen, um die Röhrchen sicher darin zu lagern. Zwei Vertiefungen waren leer, in der mittleren lag noch ein Röhrchen, angefüllt mit der blau leuchtenden Flüssigkeit. Behutsam zog der Junge es heraus und betrachtete es, fasziniert von dem blauen Schimmer, den die Flüssigkeit ausstrahlte.
Das Mädchen Morrow stöhnte fiebrig, und als er hinsah, bemerkte er, dass ihre Augen sich eine Winzigkeit geöffnet hatten und jetzt das leuchtende Röhrchen in seiner Hand fixierten.
Da wusste der Junge, was zu tun war.
7
Der Junge ist krank. Das ist er noch nie zuvor gewesen und vielleicht ist es deshalb so schlimm.
Der Junge trägt die Hitze in sich.
Sein Körper ist kraftlos und voller Schmerzen. Sein Geist ein einziges, wirbelndes Wirrwarr von Farben und verzerrten Eindrücken. Seine Mutter und den Wald nimmt er wie durch einen roten Schleier wahr, der die Umgebung verschwimmen lässt, sie aufweicht an den Übergängen.
Grelle Schlieren tanzen vor seinen Augen, wenn er den Kopf dreht. Sein Schädel dröhnt vor Schmerzen und pocht und wummert, und jeder Laut rast vielfach verstärkt seine Schläfen hinauf, explodiert mit einem lauten Knall vor seinen Augen.
Selbst die Berührungen seiner Mutter oder der kleinen Tiere, die gekommen sind, um ihm beizustehen, verursachen ihm jetzt heftige Schmerzen. Er kann nicht mehr in ihre Köpfe sehen, und als sie das begreifen, verlassen sie ihn, damit er in Ruhe sterben kann.
Wie es jedes lebende Wesen tut.
Allein.
Der Junge hat jegliches Gefühl für die Zeit verloren, erwacht nur noch hin und wieder für wenige Augenblicke. Dann lauscht er dem rasselnden Atem in seinen verschleimten Lungen und sucht in dem roten Gewitter, das vor seinen Augen tobt, nach dem Gesicht seiner Mutter, bevor er zurück in die tosende Schwärze seiner Fieberträume gleitet.
Dort, wo er mit seiner Mutter lebt, ist der Wald noch grün und gesund, aber auch dieses Fleckchen schrumpft zusehends, und es kommen immer weniger Tiere zu ihnen, während die Pflanzen lichter und die Bäume kahler werden.
Der Junge spürt, dass seine Krankheit irgendwie mit diesem Schrumpfen zusammenhängt, mit dem Sterben des letzten Stückchens, das von diesem einstmals riesigen, grünen Lebewesen übrig ist. Ein Wesen, das er als den Wald kennt und das ihm Vater und Heimat zugleich ist. Ihm und den Pflanzen und den Bäumen und den kleinen Tieren.
Und der Mutter.
Jenseits dieses letzten, grünen Fleckchens ist der Wald längst tot. Nichts als schwarze, knotige Ranken, in ihrer Bewegung erstarrt. Und Morast, der allgegenwärtige Sumpf, aus dem diese versteinerten Arme in den glühenden Himmel emporragen.
Seine Mutter hat aus dem Moos, das vor ihrer Höhle wächst, einen Sud gebraut, aber auch das Moos ist gelb und kraftlos. Der Junge erbricht die Pampe immer wieder, und auch der Schlamm vom Kanal vermag seine Stirn nicht mehr zu kühlen. Während der Junge sich in unruhigen Träumen wälzt, hält ihn seine Mutter in ihren Armen, summt leise vor sich hin und wiegt ihn sanft. Manchmal weint sie dabei, und ihre Tränen fallen auf die erhitzten Wangen des Jungen, wo sie sofort eintrocknen.
Es hilft nichts, der Junge stirbt und nichts kann ihn retten. Nicht der Wald, nicht die letzten Tiere und Pflanzen. Nicht einmal die Liebe seiner Mutter, so scheint es.
Eines Tages geht sie fort, und lässt den Jungen allein zurück in der Höhle, nahe der Lichtung. Er bemerkt es nicht einmal. Wenn er für kurze Zeit erwacht, versucht er, nach seiner Mutter zu rufen, doch aus seinem Mund kommt nur ein trockenes Krächzen.
Seine Kehle ist ausgedörrt und schmerzt.
Er schläft wieder ein.
Als sie zu dem Jungen zurückkehrt, ist es schon fast zu spät. Seine Haut, die sich straff über die spitzen Knochen spannt, hat einen hellgrauen Farbton angenommen wie die Asche eines heruntergebrannten Feuers. Seine Augen sind von einem klebrigen, gelben Film überzogen, und als sie seine Hand in die ihre nimmt, hat er kaum die Kraft, sich an ihrem Finger festzuhalten.
Aber er kämpft.
Und sie hat etwas mitgebracht. Es stammt von dem Mann, der beim Kanal lebt. Dem gefährlichen Mann, den sie Ruggs nennen.
Sie zerschneidet die dunkelrote Frucht in kleine Stücke und breitet sie auf einem trockenen Stück Baumrinde aus. Dann zerstampft sie sie mit dem stumpfen Ende eines Stocks, bis es ein Brei wird, den sie zwischen zwei Blättern weiter zerreibt.
Die Medizin verströmt einen betörenden, klebrig-süßen Duft, doch sie selbst probiert kein einziges Stück davon.
Es ist alles für den Jungen, ihren Jungen.
Damit ihr Junge nicht sterben muss.
Sie tunkt einen Finger in die Pampe und verteilt sie auf den rissigen Lippen des Jungen, bis dieser schließlich den Mund öffnet, und die Zunge etwas herausstreckt, um sich die Lippen zu lecken.
Seine Zunge ist rau und geschwollen, und beinahe weiß, aber schließlich schafft er es, und sie gibt ihm die nächste, winzige Ration.
Das tut sie zwei Tage und zwei Nächte lang, ohne auszuruhen.
Am dritten Tag schläft sie, denn sie hat alle Medizin verbraucht, und alle Hoffnung.
Am vierten Tag, als sie erwacht, ist der Atem des Jungen ruhig, und seine Haut deutlich dunkler. Sie schließt ihn in ihre Arme und flüstert: »Ich liebe dich.«
Der Junge drückt sie fest an sich.
Die Kraft ist in seine Glieder zurückgekehrt.
Seine kleine Hand mit den zu Klauen verkrümmten Fingern tastet nach dem Ring zwischen ihren Brüsten, doch der ist fort. Der Mann unten beim Kanal hat ihn jetzt. Onkel Ruggs hat ihn ihr fortgenommen, im Austausch für die Medizin.
Doch das ist nur ein Teil ihres Handels.
Sie drückt den Körper ihres Sohnes ein letztes Mal an ihre Brust, und dann beginnt sie leise zu weinen. Sie weint nicht um sich, oder wegen dem, das ihr nun bevorsteht. Sie weint nicht, weil sie den Jungen vielleicht nie wiedersehen wird.
Sie weint vor Glück, weil ihr Kind leben wird.
Nur das zählt.
Später, als der Junge wieder schläft – doch diesmal ist sein Atem ruhig, denn sein Körper erholt sich bereits – geht sie los, um den Rest des Handels mit Onkel Ruggs, dem Mann vom Kanal einzulösen.
Ihren Jungen wird sie nie wiedersehen.
8
Als er die Wange des Mädchens berührte, öffnete sie ihre Augenlider einen winzigen Spalt. Sofort wurde der Junge von dem rasenden Chaos ihrer Gedanken in Beschlag genommen.
Sie versuchte, die Augen vollständig zu öffnen, während ihr Blick dem fluoreszierenden Röhrchen in seiner Hand folgte – doch es gelang ihr nicht. Ihre Gedanken, das spürte der Junge deutlich, waren jetzt bei dem blauen Zeug in seiner Hand, und ganz allein darauf fokussiert. Mit fahrigen Bewegungen wühlte sie ihre Arme unter der Decke hervor, um mit zitternden Fingern nach dem Röhrchen zu greifen, doch sie war zu schwach, um es zu halten.
Ihr Mund öffnete sich zu einer stummen Bitte.
Medizin, dachte der Junge.
Das blaue Zeug ist ihre Medizin.
Als er das Röhrchen an ihre halb geöffneten Lippen führte, berührten ihre Fingerspitzen die Haut seines Arms.
Da bemerkte der Junge noch etwas. Unter der bleichen Haut ihres Handgelenks schimmerte etwas, ein blasses Leuchten, das von innen durch ihre Haut drang, sanft aufleuchtete, verlosch, aufleuchtete, beinahe im Einklang mit der schimmernden Flüssigkeit in seiner Hand.
Vorsichtig setzte der Junge das offene Ende des Glasröhrchens auf der Unterlippe des Mädchens an.
Tropfen um Tropfen entleerte er die Flüssigkeit, die sie gierig hinunterschluckte. Als das Röhrchen schließlich leer war, fielen ihre Arme zurück und das Leuchten an ihrem Handgelenk verblasste. Ihre Lider schlossen sich und das Kreiseln ihrer Gedanken wurde allmählich langsamer.
Kurze Zeit später begann die Hitze bereits aus ihrem Körper zu weichen.
Während der Junge sie mit aufmerksamen Augen betrachtete, wurde ihr Atem gleichmäßiger, tiefer. Dann legte sich ein sanftes Grau über ihr bewusstes Denken und sie schlief, von einem Augenblick auf den nächsten.
Traumlos und erschöpft, aber ruhig.
Der Junge betrachtete ihr Gesicht, das sich nun entspannte und für einen Moment schien es das Gesicht seiner Mutter zu sein, und er tastete nach dem Ring an seiner Brust und spürte ihre Stimme in seinem Herzen.
Und für diesen einen Augenblick war der Junge beinahe glücklich.
Er kroch von dem Mädchen fort, legte sich am anderen Ende der Hütte nieder und war innerhalb von Sekunden ebenfalls in einen tiefen Schlaf gesunken.
9
Der Junge erwachte vom Stöhnen des Mädchens, das er Morrow nannte, als es noch stockdunkel war. Selbstverständlich war es im Versteck des Jungen immer dunkel, aber er spürte, dass auch die Nacht draußen noch ein paar Stunden andauern würde.
Dem Mädchen ging es wieder schlechter, das sah er auf den ersten Blick. Flehend streckten sich ihre Hände in seine Richtung – nein, in Richtung des Röhrchens und des nun leeren Kästchens, das es enthalten hatte.
Das Mädchen brauchte mehr von der Medizin, und zwar schnell.
Also erhob sich der Junge von der verschlissenen Decke, auf der er geschlafen hatte und verließ sein Versteck, um mehr von der Medizin zu holen, denn ihm war inzwischen klargeworden, wo er welche bekommen würde.
Er zweifelte keinen Moment daran, das Richtige zu tun.
TEIL II
KINDER DES FEUERS
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf – Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille –
und hört im Herzen auf zu sein.
– Rainer Maria Rilke, Der Panther
* * *
»Allzeit bereit, ihr Lumpenhunde!«
– Napoleon
10
Das Gesicht seines Vaters glotzt aus dem Morast zu ihm hoch, während die Welt brennt.
Überall ist Feuer.
Kreischende, peitschende Vegetation, die zu Kohle und Staub verbrennt und den Himmel in beißende Schwärze taucht. Irgendwo in der Ferne hört er das Zischen der Flammenwerfer, mit denen sie den Wald bekämpfen. Um ihn auszurotten, jetzt und für alle Zeit. Letztlich werden sie siegreich sein, und einen furchtbaren Preis für diesen Sieg bezahlen – das weiß er, denn er hat das alles schon unzählige Male erlebt.
Er erlebt es jede Nacht aufs neue.
Früher haben ihm seine Träume Angst gemacht, besonders die Stelle, an der sein Vater ihm die Hand entgegenstreckt, während sein Körper schmatzend im Morast versinkt. Der Mund seines versinkenden Vaters, schlammgefüllt, der ihn ruft. »Komm schon, Junge, greif’ nach der verdammten Ranke dort, und wirf sie mir rüber. Na los! Komm schon, Napoleon, hilf mir!«
Aber er rührt keinen Finger. Er steht nur da und sieht zu, wie sein Vater immer tiefer versinkt, eins wird mit dem Schlamm.
Jetzt schleicht sich Panik in die Augen des alten Kämpfers. Des einst furchtlosen Anführers. Er, Napoleon, sein eigen Fleisch und Blut, lehrt ihn jetzt das Fürchten. Zu guter Letzt beweist er seinem Vater, dass es etwas gibt, von dem er mehr versteht als jeder andere Mickie, obwohl er beinahe noch ein Kind ist.
»Du verdammter Feigling!«, ruft sein Vater, und jetzt ist seine Stimme eher bettelnd als fordernd. Weil er allmählich die Lektion begreift, die sein Sohn ihm gleich erteilen wird. Er winselt und Napoleon entfährt ein nervöses Kichern.
»Oh, du … Jetzt reich’ mir schon diesen Ast, Junge! Verdammt, du … du verdammter Feigling!«
Napoleon kann nur starren, kann sich nicht bewegen, nicht nach der Ranke greifen oder sonst irgendetwas tun. Er steht nur da und sieht zu.
Ein letztes Mal ruft sein Vater seinen Namen, dann schließt sich die stinkende, schwarze Brühe schmatzend über dem weißen Haarschopf des Alten. Einen Augenblick später ist es, als habe es seinen Vater nie gegeben.
Einfach so.
Napoleon richtet sich auf.
Der Lärm und die Flammen um ihn herum sind jetzt verschwunden. Jetzt gibt es nur noch die schwarze Fläche des Morastes, der sich in alle Richtungen erstreckt, und dazwischen die versteinerten Arme der gigantischen Ranken.
Der Krieg ist aus und er, Napoleon, hat ihn gewonnen.
Später wird er den Männern sagen, dass das Monster seinen Vater geholt hat, auch wenn er selbst nie daran geglaubt hat, dass das Monster wirklich existiert. Entscheidend ist, dass die meisten der Mickies daran glauben. Dass sie es nie zu Gesicht bekommen haben, lässt es nur umso furchteinflößender erscheinen.
Und selbst wenn es tatsächlich einmal existiert hat – jetzt ist es tot und vergangen, ein Fraß der Flammen, wie der restliche Wald. Und die Mickies – die Männer, die einst geschworen haben, seinem Vater bis in den Tod zu folgen, werden fortan seine Männer sein.
Er wird sie führen – in die Flammen. In den Sumpf.
In den Tod, sollte es nötig sein.
Oder falls er Lust dazu verspürt. Denn ein guter Führer muss schrecklich sein, und unberechenbar. Auch diese Lektion hat ihm sein Vater beigebracht.
11
HEUTE // DORT
HAUS DER MICKIES
Napoleon warf einen nachdenklichen Blick auf den silbernen Fetzen, der vor ihm auf dem Tisch lag. Der musste der Leiche als Kleidung gedient haben. Bevor sie eine Leiche gewesen war, freilich.
Höchst seltsame Kleidung, das.
Metallisch glänzend und doch zu dünn und zu leicht, um wirklich aus Metall zu sein. Offenbar robust genug, um einigen Schutz gegen Wind und Sonne zu bieten. Völlig nutzlos hingegen bei jeglicher Art von Gewalteinwirkung.
Als er den verschrumpelten Körper herumdrehte, knallte dessen Arm – ein mit schwarzer, halb verwester Haut bespannter Knochen – auf die Oberfläche des Tisches. Der Arm gab ein hilfloses Fiepen von sich wie ein sterbender kleiner Vogel, und etwas an seinem Handgelenk leuchtete schwach auf.
Zunächst hielt Napoleon das Leuchten nur für einen Lichtreflex, aber dann fiel ihm auf, dass etwas auf der vertrockneten, schwarzen Haut schimmerte. Zögernd tastete Napoleon danach. Der kleine Lichtpunkt erlosch. Dann flammte er träge auf, schwächer diesmal, und erlosch wieder.
Napoleon berührte das Handgelenk der Leiche.
Es war kalt.
Nichts, das Napoleon kannte, war in der Lage, einen solch kleinen Lichtpunkt zu produzieren, und schon gar nicht ohne die Hitze des Feuers. Also sah er nochmal hin und stellte fest, dass das Licht von innen durch die Haut des Leichnams schimmerte. Dann wechselte es die Farbe, wurde blau, dann zu einem leuchtenden Grün, und schließlich orangerot, wie die Seele des Feuers.
Ein letztes Aufblitzen und dann war auch das vorbei.
Napoleon betastete erneut das Handgelenk der Leiche und spürte dort, wo gerade noch das Licht gewesen war, eine Verhärtung unter dem verwesten Fleisch. Etwas Kastenförmiges ragte aus dem Knochen heraus. Das war es vermutlich, was geleuchtet hatte. Napoleon zog das große Messer aus der Scheide an seinem Gürtel und setzte die Klinge an der Haut des Handgelenks an. Als er hineinschnitt, quoll eine zähflüssige, dunkelbraune Masse daraus hervor.
Das Zeug stank fürchterlich.
Angewidert verzog Napoleon das Gesicht.
Er machte weiter, bis er die Reste des verrotteten Fleisches um den Knochen herum weggeschabt hatte. Tatsächlich war etwas darin eingelassen, eine Scheibe, etwa von der Größe seines Daumennagels, fest mit dem Knochen verbunden, so als sei sie in das Gewebe hineingewachsen.
Napoleon setzte das Messer an, und hebelte die Kapsel mit einigen Mühen heraus.
Dann hielt er sie zwischen Daumen und Zeigefinger gegen das wenige Licht, das durch das winzige Fenster in den Kellerraum drang. Das Ding sah aus wie eine Münze, nur ohne Prägung, und auf der Oberseite war sie von einer gewölbten, gläsernen Fläche überzogen. Napoleon ließ die Spitze des Messers über beide Seiten gleiten, aber nichts passierte.
Kein Blinken, kein Leuchten.
Nur dieses seltsame, kleine Stück Metall – jetzt offenbar so tot wie die vertrocknete Leiche, aus deren Knochen er es geschnitten hatte.
Napoleon steckte das Ding ein und ließ seinen Blick nachdenklich über den Leichnam gleiten. Der entstellte Körper war mal eine erwachsene Frau gewesen, man konnte sogar noch die eingefallenen Hautlappen erkennen, die einmal ihre Brüste gewesen waren. Unmöglich zu sagen, wie alt sie gewesen war, als ihr – was auch immer – zugestoßen war.
Ziemlich alt, vermutlich.
Dann wandte er sich dem anderen Bündel zu. Die zweite, ebenfalls in Silberstoff gehüllte Leiche war in weit besserem Zustand. Ein kleines Kind, ein Baby von vielleicht 6 Monaten. Auch ein Mädchen, Napoleon hatte extra nachgesehen.
Ein winziges Babymädchen, das in einem viel zu großen, silbernen Anzug steckte, der eher einer erwachsenen Frau gepasst hätte. Ihrer war im Gegensatz zu dem der weit älteren Leiche überhaupt nicht zerrissen, sondern in erstklassiger Verfassung, er glänzte und funkelte, was das Zeug hielt.
Mutter und Tochter möglicherweise, dachte Napoleon, aber wer konnte das jetzt noch mit Bestimmtheit sagen?
Auf der Rückseite eines jeden der Anzüge hatte Napoleon einen Behälter gefunden, von dem mehrere Schläuche in die silberne Außenhaut des Anzugs führten. Vermutlich war das irgend eine Art von Wasserversorgung. Ziemlich gerissen, das. So konnte man vielleicht sogar für eine Weile in der Wüste außerhalb des Viertels überleben. Sollte man dämlich genug sein, dort hinaus zu gehen.
Blieb allerdings die Frage, wozu ein solcher Anzug überhaupt nütze sein sollte, außer dass man ihn über eine Entfernung von mehreren Meilen in der Sonne glänzen sah, womit sein Träger vor allem eine erstklassige Zielscheibe abgab – und Schläuche in ihn hineinführten, damit man aus dem Wasservorrat auf dem Rücken trinken konnte, ohne das Ding absetzen zu müssen. Den beiden hier auf dem Tisch hatte jedenfalls weder das eine noch das andere etwas genützt.
Aus der Tasche auf dem Rücken stammten auch die Kästchen mit den Glasröhrchen. Mit Hilfe seines Messers hatte Napoleon den komplizierten Verschluss schließlich aufbekommen und insgesamt zwölf der Röhrchen mit der bläulich schimmernden Flüssigkeit gefunden. Ein jedes von ihnen hatte in einer weichen Vertiefung im Inneren des Kästchens gelegen. Vier pro Kästchen, drei Kästchen insgesamt. Die Flüssigkeit war geruchlos, wie Napoleon festgestellt hatte, als er eins der Röhrchen aufgemacht hatte.
Das Zeug zu trinken wagte er dann aber doch nicht.
Gut möglich, dass der Zustand der Leichen auf den Genuss dieser Flüssigkeit zurückzuführen war – wer konnte das wissen?
Dennoch, mit dem Zeug musste es etwas auf sich haben, es hatte ganz bestimmt einen Wert! Es war simple Logik: Warum sollte sich jemand die Mühe machen, etwas in diese schwer zu öffnenden, robusten Kästchen zu verpacken, wenn deren Inhalt nicht auf irgendeine Weise wertvoll war?
Und außerdem sah es irgendwie … interessant aus.
Napoleon schloss beide Hände um eins der Röhrchen und lugte in die kleine, künstliche Höhle zwischen seinen Fingern. Tatsächlich, das Zeug leuchtet schwach in der Dunkelheit zwischen seinen gewölbten Handflächen, ganz von allein, genau wie es das kleine Plättchen im Handgelenk der großen Leiche getan hatte. Schließlich legte Napoleon das Röhrchen mit dem blauen Zeug zurück und verschloss die Kästchen wieder. Dann steckte er sie ein.
Er verließ den Raum mit den beiden Leichen und rief in den Flur hinein nach dem Doc, der im benachbarten Labor damit beschäftigt war, die Produktion des Gebrannten zu beaufsichtigen.
Der Doc steckte seinen Kopf aus der Tür der Brennstube und Napoleon stellte wieder einmal fest, dass er nicht sagen konnte, warum genau er den Doc eigentlich so hasste. Etwas am Blick dieser wasserblauen Augen hinter den verschmierten Brillengläsern verärgerte ihn enorm, jedes Mal, wenn er hinein sah.
Vielleicht, auch wenn er das niemals zugeben würde, verunsicherte ihn dieser Blick sogar ein wenig.
Hin und wieder ertappte sich Napoleon bei dem Versuch, den Blick des Doc zu deuten. Waren da Anzeichen von Widerspruch in diesem fahlen Blau, ein unausgesprochenes Aufbegehren gegen seine, Napoleons rechtmäßige Herrschaft? Noch war es kaum ein Ansatz – ein schwacher Vorbote einer Meuterei, die vermutlich nie stattfinden würde, aber Napoleon nahm sich vor, trotzdem auf die Augen des Doc zu achten.
Möglicherweise würde er die bösen Gedanken aus dem Kopf des Doc entfernen müssen, und die bösen, alten Augen am besten gleich mit. Der Kerl war nicht gut für die Moral der Truppe, würde er dann sagen und die anderen Mickies würden sich kaputtlachen, wenn der Doc auf den Knien über den Hof rutschte und seine Augen im Staub suchte, während das Blut aus seinem Schädel quoll und ihm über die fahlen, alten Bäckchen lief. Napoleon musste grinsen, als er sich das vorstellte.
»Ja, Napoleon?«, fragte der Doc, »Was ist denn?«
»Du kannst sie dir jetzt anschauen.«
»Oh, in Ordnung.« Es klang nicht gerade enthusiastisch. »Mach’ ich gleich.«
Dann blies er die Backen auf und schob die Brauen in die Höhe. Ungeduld. Noch so etwas, das Napoleon an ihm hasste. Er wirkte stets, als habe er eigentlich etwas Besseres zu tun, als sich mit ihm zu unterhalten, und das störte Napoleon enorm.
»Ist sonst noch was, Napoleon?«
Napoleons Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen.
»Boss, meine ich«, grummelte der Doc.
Napoleon fixierte den Doc für einen Augenblick, dann schüttelte er langsam den Kopf und wandte sich zur Treppe um, die in den Innenhof führte. Für einen Moment war der Wunsch, dem Doc die verfluchten wasserblauen Sehapparate auf der Stelle aus dem Kopf zu reißen, fast übermächtig.
12
Napoleon schlenderte auf den Hof hinaus, wo ein paar der Mickies damit beschäftigt waren, in einem losen Halbkreis um etwas herumzustehen, das jaulte und wimmerte, während sie danach traten und es mit Stöcken piesackten. Offenbar hatten die Jungs einen Heidenspaß dabei.
Napoleon erkannte den fetten Käfermann und Marion, den Ausbilder und einen pickeligen Jüngling namens Will, wenn er sich des Namens recht entsann. Auch ein paar von den Neuen waren hier. Frischfleisch, das Marion gelegentlich mit auf Kontrollgang nahm. Standen da bei den Veteranen herum, beinahe wie Gleichgestellte. Nun, da war es kaum verwunderlich, dass es mit der Moral der Mickies stetig abwärts ging.
Napoleon trat dazu.
Zunächst bemerkte ihn keiner der anderen Mickies. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, mit ihren Stöcken auf das Tier in ihrer Mitte einzustechen.