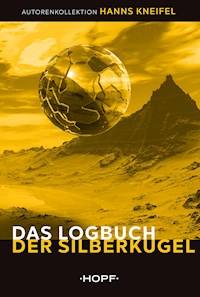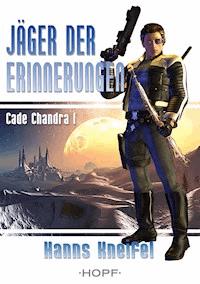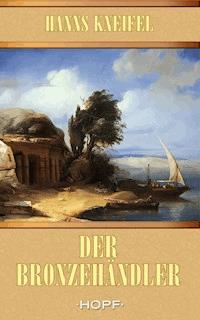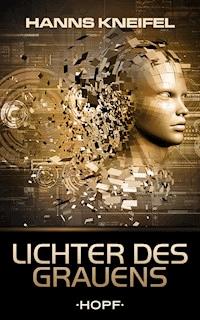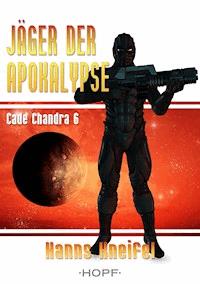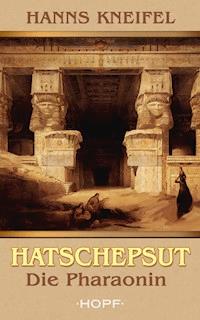Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Peter Hopf
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anno Domini 1190: Im Lager des Sultans Saladin berichtet der gefangen genommene Kreuzritter Troncas von Artus, dem sagenhaften Britenkönig aus dem 5. Jahrhundert. So erfährt der Geschichtsschreiber des Sultans von Merlin und der schönen Morganna, von Lanzeloth und Guinevere und von den Träumen und Taten eines Herrschers, der seinem Land den Frieden bringen wollte und am Ende doch von denen verraten wurde, denen er am meisten vertraute. Hanns Kneifel verknüpft in diesem Roman auf spannende Weise die Legenden der Artussage mit den Ereignissen des Dritten Kreuzzugs um Richard Löwenherz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 714
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE
RITTER VON
AVALON
© Copyright Erben Hanns Kneifel
© Copyright 2016 der eBook-Ausgabe bei Verlag Peter Hopf, Petershagen
www.verlag-peter-hopf.de
Cover & Grafiken: © Copyright Joonarkan | Erica Guilane-Nachez - Fotolia.com
ISBN ePub 978-3-86305-222-5
Folgen Sie uns für aktuelle News auf Facebook.
Alle Rechte vorbehalten
Die in diesem Roman geschilderten Ereignisse sind rein fiktiv.
Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Begebenheiten, mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig und unbeabsichtigt.
Das Buch
Anno Domini 1190: Im Lager des Sultans Saladin berichtet der gefangen genommene Kreuzritter Troncas von Artus, dem sagenhaften Britenkönig aus dem 5. Jahrhundert.
So erfährt der Geschichtsschreiber des Sultans von Merlin und der schönen Morganna, von Lanzeloth und Guinevere und von den Träumen und Taten eines Herrschers, der seinem Land den Frieden bringen wollte und am Ende doch von denen verraten wurde, denen er am meisten vertraute.
Der Autor
Inhalt
Das Buch
Der Autor
ERSTES BUCH
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
ZWEITES BUCH
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
DRITTES BUCH
1. Kapitel
2. Kapitel
HANNS KNEIFEL
Die Ritter von Avalon
Hinweis des Verlegers:
Erstes Buch
Tintagel und die Mauern von Akkon
Vor Akkon: 25. April A. D. 1190 bis 2. Juli A. D. 1190 (im Jahre 586 nach der Hedschra)
1. Kapitel
Erzählt, wie Ritter Troncas in Sultan Yussuf Salah ad-Dins rosenduftendem Heerlager staunenswerte Fragen beantwortet
Über den Zweigen der Ölbäume schwebte die Morgensonne wie ein schmelzender Eisenschild. Ein schauerlicher Laut aus weiter Ferne zerriss die Stille des späten Morgens; es war, als würde ein Tier lebendig ausgeweidet. Ein Eselsschrei, dachte Troncas, oder der Hilferuf eines Menschen. Einige Atemzüge lang erstarrte die wellige Ebene zu einem Bild aus uralten Sagen. Als Troncas aus dem Schatten hinausritt, in dem sich Staubwirbel hinter den Hufen mit Nebelfetzen mischten, riss sein Rappe den Kopf hoch. Im dumpf pochenden Hufschlag stockte plötzlich der Takt. Unvermittelt fühlte Troncas, dass die frühsommerliche Landschaft eine Gefahr barg; er spannte seine Sinne, zügelte das Pferd, stellte sich in den Steigbügeln auf und vermied es, sich von der Sonne blenden zu lassen.
Er sah sich um. Zitternde Äste kratzten am Lanzenschaft. Das sonnendurchstrahlte Land unterhalb des Hügels, scheinbar reglos, veränderte binnen eines Atemzugs unter Troncas' Blicken seine Bedeutung: Felsen, Baumstämme, Mauerreste und deren Schatten schienen zu schroffen Gesichtern und drohenden Gestalten zu erstarren. Westwind schleppte üble Gerüche vom Hafen, den Mauern Akkons und dem Kriegslager bis hierher, mehr als eine Stunde Ritt vom Meeressaum entfernt.
Sieben Bewaffnete ohne Schilde, Lanzen und Rüstung, vielleicht Kriegsknechte aus dem Christenlager, galoppierten, zwei Pfeilschüsse weit entfernt, auf den baumumstandenen Brunnen zu. Gleichzeitig verließ eine muslimische Karawane das Wäldchen aus Palmen und Tamarisken; Troncas sah blitzende Waffen, würfelförmig zusammengelegte Zelte auf den Kamelrücken und die wehenden, goldgesäumten Umhänge der Reiter.
Er gab die Zügel frei und kitzelte den Rappen mit den Sporen. Das Tier trabte den Hang hinunter, fiel in langsamen Galopp und wich, während Troncas den Lanzenschaft in der Achselhöhle festhielt und den Schild vom Sattelknauf hob, von selbst den Hindernissen aus. Die dahinpreschende Horde hatte die Muslime entdeckt, peitschte die Pferde und teilte sich; einige Reiter zeigten auf die Lastesel und stießen unverständliche Rufe aus. Die Luft war dünn wie eine Messerschneide; alle Laute waren klar zu unterscheiden. Troncas schob den Unterarm durch die Schildgriffe und schalt sich einen Narren, dass er ohne Beinpanzer und Streitkolben losgeritten war, nur in Kettenhemd, Halbrüstung und Kursit; unter dem dunklen Wappenrock war es unerträglich heiß geworden.
»Fränkisches Gesindel«, knurrte er und beugte sich im Sattel vor. Der Rappe fiel gleitend in schnellen Galopp und schien zu ahnen, dass Troncas in einem Halbkreis auf die Stelle zureiten wollte, an der das Räuberpack die sichernden Bogenschützen erreicht haben würde. Die Lederbänder knarzten, die Ränder der Rüstungsteile schabten aneinander wie rostige Feilen. Troncas murmelte: »Es ist Friede zwischen uns Rittern und den Muslimen. Waffenstillstand; Hudna! Ihr werdet ihn nicht brechen – ihr nicht...«
Die Franken hatten ihn noch nicht entdeckt. Er ritt auf einem Ziegenpfad zwischen grünenden Büschen und einem Sandwall zum Rand des Wäldchens. Das ausgefranste Fähnchen unter der dreifach gegabelten Kampfspitze der Lanze knatterte, auf dem harten Sand war der schnelle Hufschlag kaum zu hören. Troncas spannte seine Muskeln und befestigte das schlenkernde Kettenband der Vinteile über der linken Schulter, ehe er die Lanze fester packte und, als der Pfad eine kleine Anhöhe überwand, auf die Ebene hinausritt. Das Frühsommergras stand zwei Handbreit hoch, nur noch an wenigen Halmspitzen glitzerten Tautropfen. Die Karawane versuchte zu flüchten, nach Südosten, auf Tiberia zu. Troncas zählte sechs Muslimreiter, vielleicht sieben Rennkamele und ein Dutzend schwer beladene Esel. Er galoppierte, die Sonne halb im Rücken, auf die Franken zu und brüllte:
»Haltet an! Der König und die Fürsten haben's verboten! Niemand raubt, keiner plündert!« Er wechselte vom Britannischen ins Romanische. »Das sind einfache Leute. Nicht Saladins Krieger!«
»Kümmre dich um deinen eigenen Arsch, Ritter!«, schrie der Anführer der Plünderer. Im Rücken und zwischen den Schenkeln spürte Troncas die Muskeln des starken Pferdekörpers. »Wir wollen nicht am Hunger verrecken. Wir nehmen ihren Proviant und den Wein. Aus dem Weg, Britannier!«
Troncas verzichtete darauf, das Visier zu senken. Er hatte den Anführer erkannt, einen flämischen Soldaten unter Ritter Jacob von Avesnes. Er zog das Ende der Lanze aus dem Steigbügelschuh und hielt die Waffe schräg. Dann brüllte er:
»Auch ihr Flamen müsst euch an den Waffenstillstand halten. Du hast es nicht anders gewollt. Zum letzten Mal: Haltet an!«
Ein einzelner arabischer Reiter war in rasendem Galopp davongestoben. Ein zweiter zerrte die Kamele, die mit blitzenden Ketten zu einer Reihe verbunden waren, mit sich; die Lasten und Zelte schwankten erbarmungswürdig. Wahrscheinlich klammerten sich hinter den ledernen und leinenen Wänden Frauen und ihre Sklavinnen an alles, wovon sie sich Halt versprachen. Drei muslimische Reiter mit Pfeilen auf den halb gespannten Bögen galoppierten hinter den Kamelen her, deren Hufe lange Sandfahnen aufwirbelten; die Esel drängten sich abseits des Pfades zusammen. Troncas sah versilberte Kettenhemden, Gold an den Helmen und Handgelenken; die Karawane war zweifellos der Besitz eines bedeutenden Muslimfürsten. Die Reiter hatten zwei oder drei Pfeile aus den Köchern gezogen und drehten sich immer wieder nach den Verfolgern um.
»An mir müsst ihr zuerst vorbei, Flame!« Troncas fällte die Lanze. Er galoppierte, die Franken links vor sich, auf die Reiter zu. Es ist immer das gleiche, dachte er halb traurig, halb in kaltem Zorn. Seit zwanzig Jahren, seit ich meinen ersten Mann aus dem Sattel gerammt habe: Wer das Schwert schwingt, schindet die Schwächeren. Und auf die gleiche Weise werde ich's ihnen heimzahlen. Seine Gegner waren mit Streitäxten, Armbrüsten, Schwertern und kurzen Lanzen oder Wurfspeeren bewaffnet. Er holte tief Luft und verstärkte den Griff um die Lanze, schwang den linken Arm mit dem Rundschild vor die Brust, schrie dem Wallach einen Befehl zu und setzte die Sporen ein. Nach fünf Galoppsprüngen stob der Rappe, ohne den Rücken zu heben und zu senken, auf den schwitzenden Apfelschimmel des Flamen zu. Ein Armbrustbolzen summte an Troncas' Helm vorbei. Die Spitze seiner Lanze malte Schlängelfiguren in der Luft, zerteilte sie in irreführenden Kreisen; Troncas schien an dem gegnerischen Anführer vorbeizugaloppieren. Einen kurzen Atemzug, drei Lidschläge vor dem Zusammenprall stemmte sich Troncas in die Waffe, zielte und traf den Reiter zwischen Halsgrube und Brust.
Die fingerlange, geschliffene Spitze zerfetzte Kettenhemd und Rüstung, zerriss Hals, Kehlkopf, Knochen und Adern, brach dem Flamen das Genick, warf ihn aus dem Sattel und schleuderte ihn rückwärts über die Pferdekruppe. Das Tier prustete gurgelnd und brach aus. Der tote Flame schien, als Troncas die Lanze nach links hob und, so schnell und kraftvoll er es vermochte, nach rechts und wieder zurück schwenkte, noch immer zu fallen oder zu schweben, als der Schaft der Lanze mit voller Wucht, wie ein Keulenhieb, den zweiten Reiter an der Brust traf. Er kippte nach hinten, riss mit dem Zügel den Kopf seines Pferdes hoch, die Streitaxt wirbelte aus seiner Hand blitzend in die Luft, aber er ließ die gestrafften Zügel nicht los. Klirrend, mit endgültigem Krachen, schlug der erste Tote zu Boden.
Der Schmerz im Maul des Pferdes ließ das Tier grell wiehernd durchgehen. Es schleifte den Reiter, dessen eisenbeschlagener Stiefel sich nicht aus dem Steigbügel löste, durch aufwirbelnden Sand und auseinanderspritzendes Geröll zwischen peitschende Dornenbüsche. Troncas war mitten durch die Gruppe hindurchgaloppiert und lenkte den Rappen im Halbkreis zurück, schloss geblendet die Augen und sah zwei Atemzüge später, als eine Abfolge undeutlicher Schattenrisse vor dem lodernden Gestirn, wie ein Schwert oder eine Streitaxt herunterfuhr und seine Lanze traf. Die Spitze senkte sich nach dem prellenden Hieb und fuhr ins Erdreich; Troncas löste den Griff seiner Finger, ließ die Lanze los. Das Metall des Steigbügels traf den Schaft, das Ende schlug hart gegen den Schulterschutz. Troncas fluchte leise, lenkte das Tier weiter nach links und entging der Sonnenblendung; dann erst schloss er das Visier.
Um ihn waren Geschrei, Wiehern, das pfeifende Heulen von Pfeilen, der scharfe Schlag einer Armbrustsehne und der Einschlag eines Bolzens in seinen Schild, das Brennen in seinem linken Unterarm, das ölige Schleifen, mit dem sein Schwert aus der Scheide glitt, ein dünner Chor langgezogener Triller, Flüche und Hufgetrappel: Er drehte den Kopf und sah drei Reiter auf ihn eindringen. Seine Knie gaben dem Rappen Hilfen, die Sporen kratzten, und als Troncas am Zügel zog, stemmte der Wallach die Vorderhufe ein, senkte den Kopf zwischen die Beine und keilte zugleich mit beiden Hinterläufen aus. Die eisenbeschlagenen Hufe trafen Nüstern, Nase und das weiße Auge eines Pferdes, das vor Schmerz rasend wieherte, buckelnd und auskeilend umhersprang, einen zweiten Reiter zur Seite drängte und weder Zügeln noch Sporen gehorchte. Als sein Reiter, der mit dem Tier kämpfte, nahe genug herangekommen war, führte Troncas einen waagrecht ziehenden Hieb von weit links nach rechts.
Erz dröhnte auf Erz. Er traf den Reiter an der Schulter. Die Schwertschneide rutschte feilend über die Ringe des Kettenhemdes, zersägte einen Teil des fränkischen Kollers und drang mit leisem Kreischen durch das Hersenier. Mit einem Ruck riss Troncas das Schwert aus dem rotsprudelnden Gemenge von Knochen, Leder, Stoff, Metall, Haut und Knorpeln heraus und renkte sich beinahe den Arm aus; sein Rappe sprang mit aller Kraft vorwärts. Troncas spürte salzigen Schweiß, Sand und Blut auf der Zunge. Das nächste Bild, das Troncas durch die ovale Öffnung des Visiers erkannte, war ein anderer Teil dieses Kampfes: Umgeben von den schweißgeschwärzten Säumen des Kopfschutzes aus Kettengewebe, stierte ihn ein fahlweißes Gesicht aus aufgerissenen Augen an, die nur noch wenig Menschliches hatten. Über der Nasenwurzel wippte ein Pfeil, helles Blut lief aus Nasenlöchern und Mund. Die drei Abschnitte der Befiederung und die knöcherne Nock zeigten Troncas – er wusste es, ohne nachzudenken –, dass es der Pfeil eines muslimischen Reiters war. Der tote Reiter rutschte seitwärts aus dem Sattel.
Troncas warf sein Pferd herum, ließ den Rappen drehen und sah, dass die Araber in langsamem Galopp ihn und die Plünderer umkreisten und in lautlos blitzender Eleganz Pfeil um Pfeil abschössen. Dann erkannte er zwischen den Muslimen einen Reiter, der eine fast armlange, zweischneidige Streitaxt über dem Kopf schwenkte und auf ihn zugaloppierte. Troncas brachte den Schild hoch, sah das Blut aus seinem Unterarm auf Schenkel und Sattel tropfen, packte das Schwert und zwang den Rappen aus dem holprigen Kanter in trommelnden Kampfgalopp. Er packte den Schild fester und starrte seinen Gegner über den narbig gewellten Schildrand hinweg an; sie näherten sich einander in gerader Linie auf einer Fläche aus frühlingsgrünen Grasbüscheln, grobem, honigfarbigem Sand, kantigen Gesteinsbrocken mit rußigen Schatten und phantastischen Schlierenmustern aus Laub und Splittern von Palmwedelrispen. Sie prallten, scheinbar allein auf dem Kampfplatz, mit voller Wucht zusammen. Die Pferde schoben sich halb aneinander vorbei. Troncas' klirrender Schwerthieb kappte den Helm dicht über der Schädeldecke des Gegners. Metallfetzen wirbelten umher. Die Schneide der Kampfaxt hackte ein halb handgroßes Dreieck aus dem Schildrand. Einen Lidschlag lang dachte Troncas an den schwarzsilbernen Fisch, die Sterne und den Untergrund in loderndem Rot auf der ihm abgewandten Seite des Schildes, dann waren sie aneinander vorbeigeprescht.
Das zweite Treffen in gestrecktem Galopp hatte ihn und den Unbekannten in die Nähe der Esel gebracht, die mit gesenkten Köpfen an Disteln knabberten und die Welt um sich herum vergessen hatten. Troncas schlug zu, traf seinen Gegner hart an der Vorderseite des Helms; dessen Waffe schrammte schnarrend über den Schild und zerhackte in der geflochtenen Mähne des Rappen dessen Hals, zwei Handbreit tief.
Blutstrahlen pumpten aus der Wunde. Das Tier starb mitten im Sprung.
Der Helm zerbrach in drei Teile. Troncas schlug keuchend von rechts nach links und spaltete den Schädel des Angreifers von der Schläfe bis zum Oberkiefer. Ein Schlag traf Troncas an der Schulter. Sein Rappe torkelte geradeaus weiter. Dann verschwanden Mähne und Ohren und der tief klaffende, dreieckige Einschnitt aus Troncas' Blickfeld; er wurde aus dem Sattel geschleudert und aus den Steigbügeln gerissen. Er ließ die Zügel los, kippte nach vorn, fühlte, wie er sich zu überschlagen begann, starrte mit schmerzenden Augäpfeln in die schmelzende Sonnenscheibe und erlebte, wie Umgebung, Zeit, Bewusstsein und die savannenhafte Ebene, die Wirklichkeit und alles, was er kannte und wusste, auseinanderschwirrten wie ein Schwarm Sperlinge.
Der Ablauf der Zeit änderte sich. Jahre wurden unbedeutend, Lidschläge dehnten sich in ungewohnter Kälte zu Fetzen der Ewigkeit, ein Jahrhundert erstarrte binnen eines Atemzugs. Er schwebte, sich überschlagend, in der kühlen Luft, sich windend-wendend, über sich oder neben sich; in einem fernen, spinnwebstaubigen Winkel seines Verstandes wusste er, dass dies das Sterben war, das endgültige Ende, das verweilende Sein jenseits aller Hoffnungen, vielleicht das Eins-Werden mit dem Heiligen Gral oder an der Schulter seines Vaters; in lichterfülltem Flug wob eine milde Fee Bilder aus fünfunddreißig Jahren. Er lallte oder schrie, lernte, ritt und kämpfte, las Schriften und sah Bilder aus Vaters Erzählungen von Freund Geoffrey und vom ersten ›Weg nach Jerusalem‹, von der mühseligen Reise seines Vaters zurück nach Caer Laverock und seiner Liebe zur dunkelhäutigen Kriegsbeute, von deren Krankheit und Tod, der verzweifelten Leidenschaft zwischen dem Greis und der jungen Sklavin, Troncas' Mutter, der gazellengleichen az-Zharâ.
Dann das Ende: Irgendetwas in ihm fühlte, dass er mit todbringender Wucht auf dem Boden aufschlug, dass sich scharfe Steine in seinen Körper bohrten. Knochen brachen, Muskeln und Sehnen rissen. Ein breiter Lichtspalt blendete jäh auf, als das Visier abbrach: er sah zwei Dutzend arabische Reiter in rasendem Galopp auf ihn, auf die Toten, die Esel, die schaukelnden Rennkamele und die Brunnenoase zustieben. Er sah den Panzerhandschuh König Richards, erlebte dessen Krönung, streichelte die Brüste seiner Geliebten, ritt nördlich des Hadrianswalls, inmitten des verfallenen Besitzes derer von Caer Laverock, fühlte das Leder des Helmbandes reißen, den Helm davonwirbeln wie vom wütenden Fußtritt eines Titanen getroffen, spürte Lederbänder reißen und die Teile der Rüstung in alle Richtungen fliegen, spürte, wie im Aufprall das Leben aus ihm hinausgeprellt wurde, wie seine silbernen Sporen lange Spuren in den Sand zeichneten und der Schild davonflog wie ein Teller, im trunkenen Gelage nach einem Hund geschleudert. Sein Leben endete in einer Reihe klirrender, schmetternder Donnerschläge: Es gab, als er starb, keinen Schmerz, nur überwältigende Verwunderung.
Das Schicksal, wenige Atemzüge vor dem Jüngsten Gericht, ließ Ritter Troncas noch in einer hellen, stillen Umgebung verweilen. Die kühle Luft roch nach Rosen. Das Paradies, dachte er ungläubig. Seine Gedanken krochen unendlich langsam dahin, als bahnten sie sich ihren Weg durch Treibsand. Er war tot; er spürte keinen Schmerz. Er versuchte sich zu erinnern, was er erlebt und gesehen hatte, bevor der Aufprall und der Felsen sein Genick gebrochen hatten. War es immer so, dass die Seele in ihren Körper blieb, während sie auf das Urteil wartete, in großer, unirdischer Stille? Er war halb gelähmt, aber plötzlich bewegte sich die linke Hand, seine Finger berührten sein Knie, seinen Oberschenkel, tasteten über sein Gemächt; unter den Fingerkuppen spürte er öligen Stoff. Tücher? Binden? Er versuchte die Augen zu öffnen, aber die goldene Helligkeit veränderte sich nicht; ihm war, als schwebe er ausgestreckt in einem Nebel, der dichter war als jeder andere, den er jemals gekannt hatte. Von fern ertönte undeutlicher Lärm. Seine Seele hatte den Körper noch nicht verlassen, dachte er schläfrig. Er hungerte, sein Magen rumorte, Nase, Lippen und Gaumen waren trocken. Er konnte den rechten Arm nicht bewegen. Die Finger der Linken ertasteten straffen Stoff, klebrige Nässe an den Schenkeln, harte und ölige Säume über der Brust, Holz zwischen Binden am rechten Arm, ein Tuch über seinem Gesicht und Bartstoppeln an Hals und Kinn, die schon weich geworden waren. Seine Gedanken schlichen ziellos umher, und mit jedem Fingerbreit, den sie zurückkrochen, wuchsen Troncas' Verwunderung, Erschrecken und Enttäuschung: Er fasste den Rand eines Tuches, zupfte kraftlos daran und zog es von seinem Kopf. Es wurde heller. Ein klebriges kleines Kissen war über der einen Hälfte seines Gesichts festgebunden; mühsam erkannte er mit dem rechten Auge einzelne Zeltbahnen mit Mustern getrockneten Schmutzes, schwarze Spannseile und, jenseits einer Öffnung, ein Viereck aus Blau. Er lag in einem Zelt; dachte, atmete, fühlte Schmerzen.
Troncas begriff: Er lebte. Bevor er mit dieser Erkenntnis zu ringen begann, lenkte ihn außerhalb des Blickfeldes seines gesunden Auges ein Hüsteln ab, Rascheln, Schritte, seltsames Klappern. Eine große, weiß gekleidete Gestalt näherte sich seinem ausgestreckten Körper, ein Dunkelhäutiger, der Troncas riesenhaft erschien; eine heisere Stimme sagte:
»Salaam. Der Hakim schickt mich, Ritter; ich bin Achmad, der Hammâmi. Es ist nötig, dass du dich erleichterst, und dein Trunk ist fertig.«
»Inshallah.« Troncas formte mühsam jedes Wort in der Sprache der Araber. »Salaam. Ich heiße Troncas von Caer Laverock. Wo bin ich?«
Der Dunkelhäutige lächelte überrascht, mit schneeweißen Zähnen; er verbeugte sich und hob einen Ledereimer. »Durch die unbegreifliche Gnade Allahs und des Waffengefährten unseres Herrn, des trefflichen Beha ed-Din, im Kriegslager des großen Sultans al-Malik al-Nasir Salah ad-Din Abu'l-Muzaffer Yussuf abu Ayyub ibn Shadi; so lautet sein voller Name, Ungläubiger.«
»Ah! Salah ad-Din! Hilf mir. Ich spüre meinen Körper kaum.«
Der Meister der Bäder zog eine dünne Decke von Troncas' ausgestrecktem Körper, hob und drehte ihn auf dem stinkenden Lager in sitzende Stellung und schob den Eimer vor das Lager. Erst jetzt spürte Troncas seine feuchten, entzündeten Schenkel und die pralle Blase; er suchte die Wörter der fremden Sprache zusammen und fragte stöhnend:
»Wie lange habe ich eure Gastfreundschaft schon ausgenutzt, Achmad?«
»Fünf Tage und Nächte, Effendi. Musa ibn Maimûn, der Leibarzt des Großen, versucht dich zu heilen. Er hat dir einen sehr starken Betäubungstrunk gegeben. Wie kommt's, dass du unsere Sprache sprichst?«
Troncas reinigte sich mit einem feuchten, weichen Tuch, mit der linken Hand, und sagte: »Meine Mutter war eine eurer Sklavinnen. Fünf volle Tage! Ich lebe also und – hab' kaum Schmerzen.«
Achmad half ihm, sich auf dem Lager auszustrecken. Mit dem guten Auge sah Troncas, dass das Laken in mehreren Farben von Blut, Eiter, Urin und dem Öl der Salben getränkt und verschmutzt war; trotzdem roch das geräumige Zelt noch immer nach Rosen und anderen Wohlgerüchen. Achmad bedeckte den Kübel mit dem Tuch, das er mit spitzen Fingern der linken Hand ausbreitete, dann nahm er einen kleinen Krug und eine halbvolle Schale von einem Tischchen und hob sie an Troncas' Mund.
»Trink, Effendi. Es besiegt die Schmerzen und löscht deinen Durst. Morgen oder übermorgen, Inshallah, werden dich der Hakim und Beha ed-Din besuchen.« Er wartete, bis Troncas die Schale zum zweiten Mal geleert hatte. »Dein Pferd fressen die Geier. Den Sattel und alles andere haben die Reiter eingesammelt; bald wirst du erfahren, warum sie dir nicht die Kehle durchgeschnitten haben. Wie den anderen Ifrandsch, den Franken, den du am Leben gelassen hast.«
»Inshallah«, murmelte Troncas. »So Gott will.« Von seinem Magen aus kroch einschläfernde Wärme langsam in seine Glieder, lahmte auch sein Auge, löschte sein Bewusstsein aus; wieder versank er in schweren Schlaf und vergaß sein abgrundtiefes Erstaunen darüber, dass er Kampf und Sturz überlebt hatte.
Beha ed-Din, schwarzbärtig und weiß gekleidet, vielleicht fünfzig Jahre alt, älter als Troncas also, hob die Hand und wedelte unsichtbare Fliegen von seinem Gesicht weg. Seine Augen blitzten; er versenkte seinen Blick in Troncas' Gesicht und schüttelte langsam den Kopf. Sein sorgfältig gestutzter Bart und die Locken an seinen Schläfen waren ergraut; an seinen Fingern und Handgelenken schimmerte schwerer Goldschmuck.
»Salaam, christlicher Frankenritter. Man hat mir gesagt, Ungläubiger, dass du unsere Sprache fast so gut sprichst wie einer von uns; es würde die Rinnsale unserer Worte wohltuend dahinplätschern lassen. Denn eure seltsamen Sprachen ... ich kenne nur wenige Worte davon.«
»Salaam, mächtiger Beha ed-Din. Ich habe Arabisch lange nicht gesprochen, o Amir«, sagte Troncas mühsam. »Ich brauchte auch lange nicht in deiner Sprache zu denken.« Als er sprach, schmerzte seine Kehle nicht mehr. Aus seinem Mund kam ein schauerlicher Geruch, auch sein Körper stank unter den Decken hervor; Laken, Brust und Kissen waren voller trockener Reste des Breis, mit dem man ihn gefuttert hatte. »Mein Vater brachte aus dem Heiligen Land eine Sklavin mit. Deren Dienerin az-Zharâ, noch blutjung, wurde meine Mutter. Ihre kranke Herrin und sie lehrten mich die Sprache und, sehr viel schlechter, sie auch zu schreiben. Ich bin der Sohn des William of Caer Laverock. Britannischer Fürst, bettelarmer Herr über einen unbedeutenden Landstrich. Sonst hätte mich niemand zum Ritter schlagen dürfen.«
Beha ed-Din nickte. »Daher also dein helles Haar, die blauen Augen und die bräunliche Haut. Warum hast du gegen deine eigenen Leute gekämpft? Etwa um ›Sarazenen‹ oder ›Ungläubige‹ zu retten?«
»Weil ich mein Leben lang gelernt hab, dass Absprachen und Verträge zu halten sind. Meine Eide und die Ritterehre, sage ich. Weil ich so oft gesehen hab, wie Stärkere sich an Schwachen und Wehrlosen vergriffen haben.« Er holte tief Luft und spürte plötzlich viele Schmerzherde in seinem Körper stechen. »Weil ehrlicher Kampf eine Sache ist und ein feiger Überfall eine andere.«
Beha ed-Din sah zur Deckenöffnung des runden Zelts, schien lange nachzudenken und sagte:
»Die Karawane war auf dem Weg hierher. Zwei Lieblingsfrauen aus dem Harim Salah ad-Dins, sein dreijähriger Sohn und zwei Töchter Malik ad-Dils, unter den Heubündeln der Esel viel Gold und Waffen. Drei der tapfersten Anführer seiner Soldaten. Du hast, ohne es zu wissen, beiden Amirs ein unübertreffbares Geschenk gemacht. Deshalb befahl der Sultan, für dich alles zu tun, was in Allahs Macht steht. Lob sei ihm, dem All-Erbarmer.«
»Ich hab's wirklich nicht gewusst, o Qa'id.« Troncas' rechter Arm war bis zum Handgelenk gesalbt, geschient, umwickelt und nicht zu bewegen, ebenso wie der linke Oberschenkel und der Fußknöchel. »Die Freude und die Verwunderung, mich unter den Lebenden wiederzufinden, mindern meine Bereitwilligkeit, meine... Fähigkeit, mich überströmend zu bedanken.«
Beha ed-Din zupfte lächelnd an seinem Bart. Mit einiger Mühe stopfte Troncas einige Kissen in seinen Rücken und hinter den Nacken. Er richtete sich ächzend auf; neuer Schmerz stach bis in seine Zehenspitzen.
»Deine Genesung liegt in Allahs Hand, wie so vieles andere. Die Stunde indes, in der du wieder springen kannst wie ein Füllen oder eine Gazelle, ist unnennbar weit entfernt, trotz der Künste des Hakims.« Er füllte grinsend zwei Pokale mit starkem Wein, wie der Duft bewies. »Ich habe viele Fragen, die, denke ich, nur wenig mit der Belagerung Akkons durch euch Ifrandsch zu tun haben.«
»Du scheinst genügend Macht zu haben, o Amir«, sagte Troncas und schloss unsicher die Finger um den Rand des Pokals. »Bist du ein Anführer im Heer des Großen?«
»Ich bin Salah ad-Dins Gefährte, der Qâdi seines Heers: Beha ed-Din ibn Shaddad.« Er hielt den Becher an Troncas' Lippen und verzog das Gesicht, als Troncas schluckte und Wein aus den Mundwinkeln auf den eingetrockneten Schmutz tropfte. »Ich versuche, eine Geschichte der Kämpfe und Schlachten um dieses Land, um unsere Städte, zu schreiben. Als ich, jünger und viel kräftiger, Schwert und Bogen führte, war ich Waffengefährte an der Seite des Sultans.« Er setzte den Pokal ab und starrte in Troncas' verwüstetes, bartstoppeliges Gesicht zwischen den Binden. »Ist der König, der vor wenigen Tagen landete, jener Wiedergeborene, Mächtige, Gerechte, der uns Muslime vernichten und das endgültige Christenreich errichten wird?«
»Ich weiß es nicht.« Troncas ließ sich erschöpft zurücksinken. »König Richard Löwenherz? Lionheart? Coeur de Lion? Das kann ich nicht glauben.«
»Nicht Löwenherz. Sein Name ist anders. Der Gefangene nannte ihn König Artus. Mit zwölf mal zwölftausend Rittern seiner Tafelrunde.«
An zwei Dutzend Stellen seines Körpers folterten Troncas stechende und dumpfe Schmerzen. Er versuchte ein Lächeln, schloss sein heiles Auge und sagte leise:
»König Artus! King Arthur! Er ist seit mehr als sechs Jahrhunderten tot; eine Legende, wie seine Ritter. Aber viele Barden, Sänger und Dichter sagen, dass er lebt. Unsterblich, auf der Insel Avalon. Er käme, singen sie, um Britannien zu retten, wenn die Not am größten ist. Welcher Gefangene, Qa'id?«
»Man fand vor einer Handvoll Jahren einen kranken, verwundeten Ritter aus deinem Land. Er redete viel, im Fieber, und bevor er starb, drohte er uns Muslimen mit diesem König und seiner göttlichen Macht.« Beha ed-Din nippte an seinem Wein und hob einen Krug, dessen Außenseite mit winzigen Tröpfchen beschlagen war. »Weißt du etwas über diesen mächtigen König, den wir fürchten müssen?«
Auch nachdem Troncas den Weinpokal geleert und viel kaltes Wasser getrunken hatte, waren die Schmerzen nicht geringer geworden. Der Schädel unter dem Schorf der Kopfwunden dröhnte. Troncas war jetzt sicher, dass Beha ed-Din wirklich ein Qa'id war, ein hoher muslimischer Würdenträger. Er sagte mühsam:
»Ich weiß vieles über König Artus, denn ich bin dort aufgewachsen, wo er lebte und seine Schlachten schlug. Mein Vater war mit einem Chronisten befreundet, der Artus' Leben beschrieb.«
Beha ed-Din legte die Hand auf Troncas' schweißbedeckte, schmutzige Stirn und nickte bedächtig.
»Ich sehe, dass du leidest; deine Wunden und Verletzungen, sagt der Hakim, sind bedrohlich. Ich lasse ihn wieder holen, und man wird dich behandeln und heilen, wie es einem geehrten Gast zukommt.« Er betrachtete seine Handfläche, als wäre sie voller Blut und Eiter. »Sammle deine Gedanken, Ritter Troncas, die noch wie staksende Lämmer über die Weiden vieler Hügel verstreut sind. Wenn sich die buntscheckige Herde deiner Erinnerung am Brunnen versammelt hat, werde ich dir wieder Fragen stellen – Allah hat uns, so scheint's, zur rechten Zeit zusammentreffen lassen.«
Troncas atmete keuchend. »Er hätte es auf weniger schmerzhafte Art tun können, o Amir.«
Er schloss das Auge und hörte undeutlich die Pokale und Krüge klirren und dann Beha ed-Dins leichte Schritte. Raschelnd schloss sich der Ledervorhang des Zelts.
Troncas konnte nicht sicher sein, dass er richtig gezählt hatte: Mindestens siebenmal wechselten Tag und Nacht. Nur an wenigen Stunden der Tage und Nächte konnte er die Geräusche des Heerlagers deutlich unterscheiden; meist schlief er oder lag durch den Schlaftrunk halb betäubt da. Schmerzen kamen und gingen. Zweimal wachte er auf und merkte: Vier Männer trugen ihn aus dem Zelt und durch verwinkelte Lagergassen in ein Bad aus Holzplanken, das in den Boden eingelassen war und in dem einige Dunkelhäutige seinen Körper reinigten, Binden und verkrustete Salben von seiner Haut entfernten und so behutsam, dass er es kaum spürte, den Bart im Gesicht und am Hals schoren und das Haar rund um die Kopfwunden. Der Arm, das Bein und die Brust wurden frisch geschient und verbunden, salbentropfende Pflaster hefteten sich auf andere Stellen der Haut; Binden wickelten sich um seinen Kopf. Ein weißhaariger, weißbärtiger Mann – wirklich der Leibarzt Salah ad-Dins? – betastete und untersuchte murmelnd jede Fingerbreit seines Körpers, ließ verschiedene Muskeln mit einem Öl kneten und walken, das schmerzend heiß zu sein schien. Ein Teil der bohrenden, pochenden Schmerzen wich, ein anderer Teil nahm zu; aber das Gefühl, schmutzbedeckt, schwärend und stinkend dazuliegen, war vergangen. Die Luft trug wieder einen leichten Rosenduft. Troncas hatte versucht, Beha ed-Dins Rat zu folgen und die weit verstreuten Schäfchen seiner Gedanken zusammenzutreiben, um sich zu erinnern, wie viel er wirklich über König Artus oder King Arthur wusste; so nannten ihn die Britannier, und nicht anders hatte ihn der zweite Henry genannt, der König von Britannien und Aquitaine. Aber es gelang Troncas nicht, seine Gedanken und Erinnerungen zu sammeln.
Wieder verdämmerte er in einem Schlaf, der seine Muskeln schlaff werden ließ und von dem er hoffte, dass er ihn, vielleicht, heilen konnte; mit Hilfe von Musa ibn Maimûn, dem weißhaarigen Hakim des großen und überaus mächtigen Sultans.
In einer hellen Stunde an einem der ereignislos dahintreibenden Tage, irgendwann ... nein, es war Nacht, denn einige Ölflämmchen erhellten das Zelt, saß Salah ad-Dins Waffengefährte wieder an Troncas' Lager. Troncas spürte eine seltsame Klarheit der Gedanken. Es war kalt geworden, die Luft schien reiner und ließ sich leichter atmen. Eine Gelöstheit, von der er wusste, dass sie nicht lange andauern würde, erfüllte ihn und verhinderte, dass er Schmerzen fühlte. Wie von selbst fanden sich Worte und Bedeutungen, fügten sich zu Sätzen, und ohne dass er sich dazu gezwungen sah, begann er mit trockenen Lippen zu erzählen.
Höre, o Amir: Denn eigentlich beginnt meine Geschichte mit einem offensichtlichen und wahren Wunder, nämlich mit der Rettung eines geschlagenen Heeres verzweifelter Christenritter. Von Anfang an: Mein Vater William war dem Ruf gefolgt, das Heilige Land zu befreien.« Troncas entsann sich der mühseligen Umrechnung. »Er ritt im Jahr des Herrn 1147, nach eurer Rechnung 542 nach der Hedschra, im Frankenheer, als euer Feldherr Nur ed-Din die Stadt Bosra nahm oder sie ihm übergeben wurde. Als ein geheimnisvoller fremder Schimmelreiter mit dem scharlachroten Banner den traurigen Rest des Frankenheeres nach Gadara führte, hat auch mein Vater einsehen müssen, dass sie gegen euch nicht gewinnen konnten. Mit einem Freund aus dem Heer König Balduins machte er sich auf den Rückweg. Dieser Freund, Falco, hatte eine junge Frau, Alifa, und ihre Sklavin gekauft oder geschenkt bekommen. Er wurde im Kampf gegen Piraten getötet, jenseits von Cypern. Vater William of Caer Laverock schickte sich darein. Er reiste mit den Frauen zurück nach Britannien, zu unserem Besitz.«
Je länger Troncas redete, desto leichter fiel ihm der Gebrauch jener Sprache, die er gleichzeitig mit dem Britannischen gelernt hatte.
»Er fand Helen, seine Frau, auf dem Krankenlager. Sie litt an Auszehrung. Sie ist langsam und unter Qualen gestorben, obwohl sich die schöne Alifa ihrer annahm.«
»Unser aller Leben ist in Allahs Hand«, sagte Beha ed-Din und senkte den Kopf. »Ich kenne die Geschichte Bosras. Nur ed-Din, der zum ersten Mal Nachrichten mit Tauben hierhin und dorthin sandte, Sohn des glanzvollen, grausamen Feldherrn Zengi, hat damals zugesehen, wie euch der Fremdling über den Jordan und nach Gadara führte. Ist es jener König Artus gewesen?«
Troncas zuckte mit den Schultern und stöhnte leise. Beha ed-Din redete weiter.
»Also – die mächtige Burg deines Vaters steht auf dem Land, über das jener König Artus herrschte?«
»Nicht mächtig, o Amir. Nicht einmal eine Burg. Zwei große, drei kleine Häuser. Ein Stall und zwei Scheunen, mit Reisig und Stroh gedeckt und ohne jeden prunkvollen Inhalt. Genug zum Überleben, aber verschuldet. Vater begrub seine Frau Helen. Er versuchte eine Weile lang, Trost im Glauben zu finden. Er muss damals lange durch das Land geritten sein. Dabei lernte er einen alten Chronisten kennen, Geoffrey von Monmouth, einen gelehrten Mönch, der vieles Wichtige niederschrieb. Die alten Sagen und Legenden unseres Landes kannte Vater indes wie jeder andere Einheimische.«
Teile seiner Erinnerung tauchten aus dem nebligen Dunkel auf, in dem ihn die arabische Medizin festhielt. Es war, als trüge ein Unsichtbarer herrlich gemalte Bilder an ihm vorbei, auf denen nicht nur alle Menschen zu sehen waren, sondern auch all die Jahre, die er mit ihnen verbracht hatte und die längst samt ihrer Bedeutung vergangen waren. »Bevor ich dir die Wahrheiten und Legenden berichte, das Gesagte, Gesungene und später Hinzugefügte erzähle, das die Welt von König Artus weiß, sollst du wissen, wer ich bin.«
»Ein wenig kenne ich dich schon.« Beha ed-Dins Lächeln schien ehrlich zu sein. »Du kämpfst wie eine rasende Löwin und erträgst Schmerz mit der trunkenen Langmut eines Weisen.«
»Ich hab' in meinem Leben noch nie so viel geschlafen wie in deinem Zelt, Qa'id. Az-Zharâ, meine junge Mutter, und mein Vater mussten zusehen, wie auch die schöne Alifa nach langer Krankheit starb. An der gelben Seuche, die unser Land heimsuchte. Az-Zharâ wurde mit mir schwanger. Nach ein paar Jahren, Anno Domini 1155 oder 1156, nahm William of Caer Laverock az-Zharâ zur Frau. Elf Bauern sorgten für uns, unsere Untertanen also. Wir waren arm, aber az-Zharâ brachte es fertig, dass mein Vater wieder lachte, wenn auch nicht allzu häufig.«
Beha ed-Din mischte Wein und half Troncas beim Trinken. Später brachte ein Sklave weiches, frisches Brot, in Würfel geschnittene Früchte, eine Schale voll Brei mit geschabtem Fleisch; Troncas aß mit schmerzenden Zähnen und geschwollenen Muskeln. Er erzählte vom Steinwall des römischen Kaisers Hadrian, fünfhundert Jahre vor der Hedschra errichtet, vom Bach, vom Fluss und vom Solvay-Fjord, von den kleinen Pferden der Britannier und den kargen Feldern und Weiden, von großen Quadern, die im Boden versanken, und dicken, bis zur Unkenntlichkeit überwucherten Mauerresten aus der Zeit, als Britannien eine Insel am Außenrand des Römischen Reiches gewesen war. Beha ed-Din hörte schweigend zu, nur hin und wieder schrieb er mit Fettkohle Zeichen auf Pergamentfetzen und zerknittertes Papier. Troncas spülte den letzten Bissen mit einem Schluck Wein hinunter und stellte den Pokal auf das Tischchen links von seinem Lager.
»Als ich zehn war, begann ich mehr von den Erzählungen zu verstehen. Vater berichtete von seinem langen Ritt ins Heilige Land, az-Zharâ von ihrem Leben als Sklavin einer Sklavin, im Haus eines reichen Kaufmanns. Vater züchtete mit den großen, starken Pferden, die er mitgebracht hatte, und so kam etwas Silber und Gold ins Haus. Ich durfte manchmal in seinem Sattel reiten und fragte ihn nach dem Wall, den Hügelgräbern, den Quaderfundamenten und den Mauern, über das Kleine Volk, die Druiden, Alben und Barden. Er erzählte, dass er und ich die Letzten eines Geschlechts von Lanzenreitern waren, deren erste noch im Heer von König Artus gekämpft hatten. Es mag zutreffen oder nicht. Aber er lehrte mich auch, mit dem Holzschwert zu fechten.« Troncas gähnte, nahm einen Schluck Wein und sah in Beha ed-Dins schwarze Augen. Die Ölflämmchen flackerten, die Rußfäden über ihren Spitzen schienen sich zu verknoten. »Die blökenden Lämmlein meiner Gedanken zerstreuen sich wieder, o Qa'id. Nun, ich sollte die Schriften des Magister Geoffrey of Monmouth lesen, wenn ich etwas über jene versunkene Zeit erfahren wollte, sagte Vater. Geoffrey, einer seiner Freunde, war aber vor meiner Geburt gestorben, als Bischof von Sankt Asaph – ihr würdet ihn Imam, Chalifa oder Chatib nennen –, einem Ort einige Tagesritte südlich von Caer Laverock. Davon aber berichte ich dir später.«
Beha ed-Din rollte vorsichtig das Pergament zusammen, stand auf und verbeugte sich. »Allah bewache deinen Schlaf, Ritter. Das nächste Mal werde ich nur fragen und zuhören; ich habe vorzügliche Schreibsklaven.«
»Hoffentlich enttäusche ich dich nicht mit der Geringfügigkeit meines Wissens und meiner Erinnerungen.« Troncas gähnte krampfhaft und schloss die Augen. »Der König, den ihr so fürchtet, hat hundert Jahre vor der Hedschra gelebt.«
Beha ed-Din blieb stehen, den Zeltvorhang in der Hand. Leise sagte er: »Wahre, tiefe Furcht vermag viele Jahrhunderte zu überdauern, o Ritter.«
Mitten in der Nacht wurde Troncas von undeutlichem Lärm aus der Mitte des Lagers geweckt; es hörte sich an, als kämen verwundete Krieger zurück. Mühsam fügten sich Erinnerungssplitter zusammen; er versuchte, seine Lage zu überdenken: Anno Domini 1190, also 586 Jahre nach der Hedschra, der Übersiedlung des Propheten Mohammed nach Medina, am 22. des zweiten Rabi, einige Tage vor Beginn des Mondes Mai, war Troncas of Caer Laverock zu Schiff am Dünenstrand vor Akkon eingetroffen und hatte erfahren, dass die uneinsichtigen Herren Guido von Lusignan, König von Jerusalem, und Markgraf Konrad von Montferrat in der Stunde der größten Not des Belagerungsheeres eine Übereinkunft zustande gebracht hatten, wer von ihnen zukünftiger Herrscher sein würde. Dem einzelnen Schiff aus Cypern, das Troncas zusammen mit einigen Männern aus der Ritterschaft von Richard Löwenherz, ihren Pferden und dem wenigen Gepäck verließ, südlich der hohen Stadtmauern auf dem Dünensand des Ufers, folgten die Schiffe Konrads aus Tyros und entluden, nachdem sie eine Flotte der Muslime besiegt hatten, viele Lebensmittel, Holz und Teile von Belagerungsgeräten. Wenige Tage später versuchten einige Abteilungen des christlichen Heeres, mit Hilfe der rasch gezimmerten Belagerungstürme die Stadt zu stürmen.
Aber die muslimischen Verteidiger, angeführt von Amir Behaed-Din Qara-Qûsh, schleuderten Krüge mit griechischem Feuer und brannten die Türme nieder. In der Stadt und im Lager der Franken herrschten Verwahrlosung, Hunger und Krankheit; mitunter gelang es wenigen Schiffen des Sultans Salah ad-Din, den geschützten Hafen von Akka zu erreichen, das die Franken Akkon nannten, und Nahrungsmittel in die Stadt zu bringen. Späher berichteten im christlichen Heer, dass der Sultan seine Krieger sammelte und durch Nachschub aus allen Teilen des Umlandes verstärkte. Am Pfingstsonnabend, dem 19. Mai, begann der Sultan das christliche Belagerungsheer anzugreifen; acht Tage lang tobten erbarmungslose Kämpfe, bis alle kämpfenden Gruppen erschöpft waren: die muslimische Besatzung der Stadt, das christliche Belagerungsheer und Sultan Salah ad-Dins Truppen.
Troncas und drei andere Ritter waren von Richard Löwenherz dazu bestimmt worden, das Land östlich von Akkon und die Straße nach Jerusalem zu erkunden und den besten Platz für das Heer zu finden, das noch auf der Insel Cypern wartete. Troncas hatte die Stille der Erschöpfung im Schatten der Mauern genutzt, die ausgerufene Waffenruhe der Tage, in denen die Gefallenen begraben und die Verwundeten versorgt wurden, doch schon der erste Ritt ließ ihn mit den halbverhungerten Flamen zusammentreffen.
Dass sich die siegreichen Muslime vor dem legendenhaften König und seinem Ritterheer fürchteten wie vor einer Legion Dschinnis, verwunderte Troncas zutiefst; seine Gespräche mit Beha ed-Din würden dieses Rätsel vielleicht aufzuklären vermögen. Troncas lauschte den langsamen Schritten der Wachtposten, bis die Müdigkeit und der einschläfernde Trank des Hakims die Schmerzen überdeckten und Troncas in einen schweren, schweißtreibenden Alptraum zwang.
Es mag hundertfünfzig Jahre vor der Hedschra gewesen sein, als jener Artus geboren wurde. Du musst wissen, o Beha ed-Din, dass unsere Inseln weit im Norden der Meerenge von Dschebel al-Tariq liegen, vom Festland durch einen breiten Meeresarm getrennt.«
Troncas sprach leise und sah zu, wie Sklaven oder Handwerker neben dem Zelteingang eine Puppe aus Rohrgeflecht aufstellten und mit einigen seiner Kleidungsstücke, dem Kettenhemd und der Rüstung behängten. Er glaubte deutlich zu sehen, dass alle Teile gewaschen, ausgebessert und geputzt worden waren; Auge und Schuppen des Fisches blitzten. Beha ed-Dins nächste Worte beseitigten seine Zweifel.
»Der Sultan hat befohlen, deine Waffen und den Sattel mit gebührender Sorgfalt instand zu setzen. Wenn du wieder gehen kannst, wirst du vor dem Sultan, meinem Freund, erscheinen müssen.«
»Er kann meines tiefen Dankes gewiss sein, o Amir. In den wenigen Tagen, die ich vor Akkon kämpfte, hab ich viel Verwunderliches gehört und erlebt: Fränkische Ritter und muslimische Krieger sind zu Freunden geworden, obwohl sich vorher Ungläubige und Sarazenen wie die Rasenden bekämpft haben.«
»Viele Namen für wenige Unterschiede. Alle eure Ritter und Kriegsknechte, aus vielen Ländern und Königreichen, heißen bei uns ›Ifrandsch‹, also ›Franken‹«, sagte Beha ed-Din leise. »Was du Ritterehre und Ritterschwur nennst, kennen wir ebenso, auf unsere Weise. Viele Suren des Qur'an – des Koran – handeln davon.« Er wartete, bis der Diener den umgefallenen Schild an die Puppe gelehnt und das Zelt verlassen hatte. »Beide Heere rüsten für den nächsten Kampf. Taki, der Sultan, sein Bruder Malik ad-Dil und ich. Vielleicht wird Salah ad-Din das Lager abbrechen und weiter entfernt von Akka aufschlagen müssen.«
»Akkon-Akka ist wie das einzige Tor auf der Straße nach Jerusalem«, sagte Troncas. »Die Verteidiger sind mutig und tapfer, trotz Hunger, Entbehrungen und der langen Belagerung.«
»So ist es.« Beha ed-Din zupfte an seinem Bart. »Wir sind sicher, dass ihr die Stadt nicht einnehmen werdet. Die Mauern sind hoch und unzerstörbar.«
»Man sagt, dass auf der Mauerkrone zwei Gespanne aneinander vorbeifahren können«, sagte Troncas. »Seit ich Britannien verließ, hab' ich viele herrliche Bauwerke bestaunt. Stadtmauern, Türme, Burgen und Kathedralen – ihr nennt sie Moscheen. Und mächtige Brücken über reißende Ströme. Ich glaube, Akkons Mauern sind stärker und höher.«
Beha ed-Din lehnte sich zurück.
»Einige Amire haben dem Großen Sultan geraten, Akka dem Erdboden gleichzumachen. Solange Akka steht, sagten sie, werden die Ungläubigen versuchen, die Stadt wieder einzunehmen. Andere bestärkten seinen Entschluss, das schöne Akkon und den sichersten Hafen dieser Küste wiederaufzubauen. Er ließ aus Ägypten den Amir Qara-Qûsh mit schwerem Werkzeug kommen. Viele christliche Kriegsgefangene haben schwitzend und betend Akkas Türme, Mauern und Molen wiederaufgebaut. Qara-Qûsh wartet in der Stadt und bessert aus, was ihr zerstört – ihr Franken rennt, in gewisser Weise, gegen eure eigenen Mauern an.«
»Die Gesetzmäßigkeiten – wenn sie denn diesen Namen verdienen – des Krieges sind undurchschaubar, o Amir. Vernunft solltest du von den meisten Herrschern nicht erwarten; ich hab' längst aufgegeben, sie zu finden.«
»Zwei, drei Monde wird es dauern, sagt der Hakim, bis du wieder – mit kunstvoll geschnitzter Gehhilfe – humpeln kannst. Deinen Mut im Sattel, in voller Bewaffnung, wirst du lange nicht zeigen können.« Der Chronist des Großen Sultans lächelte zögernd. »Mir scheint, du weißt viel von jenem König Artus?«
»Die weit verstreuten Schäflein meiner Gedanken und das eine oder andere Falkenpärchen meiner Erinnerungen werden sich in einer gewissen guten Stunde am Burgturm meiner Vergangenheit versammeln – ich liebe es, die gaukelnden Schmetterlingsworte eurer Rede zu gebrauchen.« Troncas nickte langsam und bohrte seinen Blick in Beha ed-Dins Augen. »Du findest wahrscheinlich rund um Akkon niemanden, der mehr über diesen fernen König weiß als ich.«
»Jener britannische Chronist ...«
»... Geoffrey von Monmouth?«
»Er und ich, also ein anderer, der eine wahre Chronik schreiben will ... wir wissen gewisslich und unveränderbar, dass jegliche Geschichte viel früher anhebt als ihr scheinbarer Anfang.«
Wieder nickte Troncas. »Das Leben eines Helden beginnt manchmal lange vor seiner Geburt. Ich weiß, was du meinst, Amir. Ich werde dir und euch allen, die ihr jenen König Artus wirklich zu fürchten scheint, die Wahrheit berichten – so wie ich sie kenne.«
»Auf dass wir unsere Furcht besiegen? Oder anders: dass wir durch Wissen und Einsicht erfahren, wie es wirklich war – ein Jahrhundert, ehe Mohammad unzählbar viele Stämme von Kamelnomaden und Beduinen einigte und uns mächtig werden ließ?«
»Ich schildere, was ich weiß.« Troncas streckte ächzend den linken Arm nach dem Becher aus und nahm einen Schluck warmen, süßen Kräutersud. »Was ihr, du und der Große Sultan, aus dieser fragwürdigen Wahrheit herauslest, liegt bei euch.«
Ein Diener trat ein und verbeugte sich vor Beha ed-Din. Er legte die Lanze auf den Boden und krönte die Puppe mit dem entrosteten, halbwegs schimmernden Helm des Ritters. Beha ed-Din stand auf und bedeutete dem Dunkelhäutigen, das Tischchen auf die linke Seite von Troncas' Lager zu stellen.
»Morgen zur Mittagsstunde will ich mit den Schreibern kommen und fragen, Ritter Troncas.« Durch den Zelteingang drang kühle Luft ins Innere. »Vielleicht hindert mich ein überraschender Waffengang, dann wartest du vergebens. Wenn du den Lärm hörst, wirst du's wissen.«
Er senkte den Kopf, duckte sich und ging mit leisen Schritten durch den Zelteingang. Troncas leerte den Becher und ließ sich zurücksinken. Er wartete auf den Augenblick, an dem er wieder einschlafen würde; die Zeiten des Wachseins, in denen seine Gedanken sich klärten, zwischen den langen Stunden heilenden Schlafs, schienen von Tag zu Tag zahlreicher zu werden.
Ferne und nähere Vergangenheit mischten sich, einzelne Menschen und deren Bedeutung wirbelten durch Troncas' Gedanken. Magister und Bischof Geoffrey of Monmouth, einst Kanoniker im Stift der Augustiner Saint George zu Oxford on Thames, oder Wace, oder Chrestien de Troyes, die Schriften Historia Regum Britanniae und Vita Malini in der alten Kirchensprache, die ihm übersetzt wurde, die Gesänge von Perceval an den Höfen der Alienor von Aquitanien, der Barde Caradoc von Llancarvan und dessen Geschichte von Wales und die Krönung von Richard Löwenherz in London. Hinter Troncas' Stirn wütete ein Stechen wie von glühenden Nadeln. Geschichte fügte sich aus wahren Erinnerungen und unwahren Erzählungen zusammen, wie es an Alienors Hof geheißen hatte, aus Geschwätz und Legenden, aus Vorstellungen, Vorlieben, Ausschmückungen und dem geringen oder machtvollen Wissen des Sängers oder Erzählers.
In jenen nebligen Schatten der fernen Zeit, die Geoffrey von Monmouth »die langen, dunklen Jahrhunderte« genannt hatte, waren Gedanken gedacht, Leidenschaften gelebt und in wütenden Kämpfen blutige Wunden geschlagen worden, ohne dass die Britannier jemals aufgehört hätten, einen großen König für ihre geschundene Insel herbeizubeten.
Die römische Besatzung hatte die Druiden und Druidinnen längst gezähmt; die Furien besänftigten ihre Götter nur noch mit symbolischen Opfern, nicht mehr mit Neugeborenen und Jungfrauen. Die Kämpfe, einst trunkene Schauspiele nach Bardengesang und Met-Trinken, waren zu tödlichen Auseinandersetzungen zwischen Britanniern, die sich oft noch cives, Bürger, nannten, und Eindringlingen geworden. Vom ordnenden Einfluss der römischen Legionen hatten sich nur Straßen, Brücken, halb verschwundene Fundamente erhalten – und der Begriff der Romanitas.
In dieser Zeit waren ein Mann und eine Frau einander in rasender Leidenschaft verfallen und hatten ein Kind gezeugt; niemand konnte ahnen, ob der Säugling verhungern, in frühen Jahren sterben oder gesund heranwachsen würde.
Plötzlich wusste Troncas trotz der Schmerzen und des betäubenden Trunks, wie er seinen Bericht beginnen würde.
2. Kapitel
Schildert, wie Troncas of Caer Laverock sich erinnert und dem muslimischen Chronisten Beha ed-Din ihn Shaddad die wahrhaftige Historie vom Geschehen auf Burg Tintagel erzählt
»O Ygraine mit den schlehenfarbenen Spitzen deiner prallen weißen Brüste!« Uther Pendragon, die Finger der Rechten im Bart verkrallt, starrte die brennenden Kloben der Feuerstelle an.
»O Feuerblume Ygraine mit dem Haar in der Farbe der Flammen!« Die Halle voller wuchtiger Tische und schwerer Schemel war schon vor Mittnacht fast menschenleer geworden. Nur das Bodenmosaik, die Säulen, das Portal und die Mauer aus hellen Quadern erinnerten noch an die Kunst der römischen Baumeister und an die Zeit, in der die Anführer der Legionen und Ambrosius, der Kriegsführer oder Dux bellomm, in dem prächtigen Bau gelebt hatten. Kalter Regen peitschte gegen die Mauern und aufs Strohdach und wütete in den lehmigen Gassen.
Uther Pendragon riss die Hand aus dem Bart; ein paar Haare blieben in den Fassungen der Ringsteine hängen. Er spürte den jähen Schmerz und fluchte unhörbar. Der Schmerz brachte ihn zurück in die rohe Wirklichkeit. Er hob den Kopf und sah die leeren Sitze an den Tischen, von denen Dienerinnen leise die Reste des Mahles wegräumten. In seiner Brust schien ein wütender Drache seine Krallen zu spreizen.
»Ostern in Caerleon. Nass, dreckig, kalt, ärmlich und ohne Freude. Die Stadt angefüllt mit mürrischen Fürsten«, murmelte Pendragon. Etwas lauter sagte er: »Gib mir viel kaltes Bier, Seonaid. Keltisches Bier.«
Die Magd füllte einen dünnwandigen Becher aus einem Krug und beugte das Knie, als sie Pendragon das Gefäß reichte. Er dankte zerstreut mit einem Nicken und blickte sie länger als gewohnt an; ihre Haut war sahneweiß wie Ygraines Körper, ihre vollen Brüste bebten unter dem Stoff, und ihr Haar war feuerfarben, wenn auch strähnig.
Der Schaum und der erste Schluck des Schwarzbieres schmeckten bitter; bitter wie die Zeit seit dem Rückzug der Legionen, die Jahre verwaister Siedlungen, Häfen und Bäder, das Jahrhundert, an dem nur wenige Jahre fehlten und das ein Jahrhundert des grässlichen Umbruchs, der Unruhe und des Vergessens war. Und der Kämpfe.
Der riesige weiße Hund Cabal, der sich neben dem Feuer ausstreckte, knurrte in einem Beißtraum und fletschte die gelben Zähne.
»Ambrosius Aurelianus in seinem Grab!« Pendragon hob den Kopf und sah dem Rauch nach, der zwischen mächtigen Dachbohlen verschwand, deren Schnitzwerk von einer Rußschicht bedeckt war. »Ich wünschte, er wäre jetzt hier und nicht vor so langer Zeit gestorben. Im gleichen Jahr, als ich geboren wurde.«
Sein Murmeln ging im Heulen des Mittnachtwindes unter. Mägde und Diener verließen den Saal und schleppten Geschirr, Tücher und Essensreste in Körben zur Küche. Einige Kienspäne und Öllampen erloschen zuckend und rauchend; ein Windstoß fauchte, mit Regen gemischt, durch das Gefüge der Deckenbohlen zischend in die Glut. Pendragons Wut wuchs und drängte ihn, sich ihrer zu entledigen.
Als er den Becher hob, glitt eine Hälfte des Vorhangs zur Seite. Ein schlanker, hoch aufgeschossener Mann in Lederkleidung, ein wenig älter als fünfundzwanzig Jahre, trat in den Saal und blieb drei Schritte vor dem steinernen Podest stehen. Er verbeugte sich und sagte:
»Du solltest schlafen, Kriegsführer. Tiefer, satter Schlaf in Regennächten ist gesund und vertreibt mürrische Gedanken.«
»Hörst du den Lärm, den die Fürsten und ihre ungewaschenen Krieger machen? Da soll ich schlafen, Merlinus? Diese nassen Nächte – wieder ist ein Jahr angebrochen, in dem wir im Norden und Osten werden kämpfen müssen. Brände und Kämpfe und Überfälle! Vor fünfzig Jahren haben sie Ambrosius begraben! Keine fünf Jahre lang war Friede im Land!«
Pendragon deutete auf einen hochlehnigen Stuhl und winkte Seonaid. Merlinus setzte sich und streckte die Beine zum Feuer aus. Die knielangen Stiefel waren bis zu den Waden durchnässt und lehmbeschmutzt.
»Die Fürsten und ihre besten Krieger haben sich versammelt. Sie wissen, was uns der Sommer bringen wird, o König Pendragon.« Merlinus streckte seine Hände aus und wärmte die Finger in der Nähe der Glut. Seine Handgelenke und Hände waren schmal, schienen aber ungewöhnlich kräftig. »Danke, Feuerhaar. Auch das Bier verhilft zu tiefem Nachtschlaf. Oder ist dein Ärger größer als die Müdigkeit, Pendragon?«
Uther Pendragon, den viele seiner Vertrauten und die mutigsten Krieger schmallippig »furchtbares Drachenhaupt« nannten, hatte die Fürsten der Britannier und Kelten zum Osterfest geladen. Jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt, am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling, hielt er Heerschau in der befestigten Stadt, die Fürsten tauschten Geschenke aus und redeten über Grenzen, Wälle, Palisaden und Burgen; seit Hochkönig Vortigern den Kampf der Römertruppen gegen die Eindringlinge und Räuber mit ebenso wenig Erfolg wie jene Legionen fortgesetzt hatte, fanden diese Treffen statt. Merlinus trank, wischte sich etwas Schaum von der Nase und blickte in Pendragons dunkle, große Augen.
»Es ist kein Ärger, Freund.« Pendragon drehte sich halb herum und deutete mit der Hand, die den Becher hielt, auf den Wandteppich. Der rote Drache, der eine Feuerzunge ausspie, schien den Männern mit der rechten Pranke und dem hochgekrümmten Schweif zu drohen. »Es ist kalte Wut. Das Volk, gleich welcher Sprache, lebt in einem regnerischen Jammertal. Es sehnt sich danach, in Ruhe und Frieden seine Ernte einzubringen, ohne Überfälle vom Meer oder Mord aus dem Piktenland. Ich fange an zu verstehen, dass wir nicht stark genug sind. Wie damals die Legionen, die Vortigern und Ambrosius Aurelianus befehligten. Die anderen Fürsten sind kampfesmüde geworden, unlustig; sie wollen Ruhe, keinen Ruhm.«
Merlinus hatte seine grünen Augen auf die Finger des Königs gerichtet. Sie schienen das dünnwandige Holzgefäß zerdrücken zu wollen. Pendragon begegnete dem prüfenden Blick, zuckte mit den Schultern und beugte sich vor. Der Ausdruck in Merlinus' falkennasigem Gesicht beunruhigte ihn; seine hilflose Wut drohte sein Inneres zu verbrennen.
»Besonders Herzog Gorlois scheint weder Ruhm an deiner Seite noch die hitzige, blutige Schlacht gegen Juten und Angeln zu suchen.«
Pendragon hob die Stimme. »Was soll das heißen?«
»Mit seinen zwei Dutzend Lanzenreitern hat er Caerleon nach dem Königsmahl verlassen, bevor die Tore geschlossen wurden. Es war ein Anblick wie aus der Dämmerung unserer Geschichte: Regen, Flammen und Funken der Fackeln, spritzender Schlamm, Dampf aus den Nüstern der schweren Pferde und molkige Mondstrahlen auf Helmen, auf der südlichen Römerstraße.«
Pendragon sprang auf, schleuderte mit einem unbeherrschten Ruck des Handgelenks den Becher weg; dann holte er pfeifend Luft und bezwang sich. Er ließ sich schwer in das schwarzbraune Bärenfell fallen, das sich über Sitz und Lehne spannte, und sagte mit einer Stimme, die Merlinus zu fürchten gelernt hatte:
»Herzog Gorlois von Terrabil und Tintagel. Gorlois aus Dumnonia. Gorlois der Eifersüchtige von den Klippentürmen.« Er schloss die Augen. »Es wäre sinnlos, zu spät und lächerlich, ihn jetzt zurückholen zu wollen. Morgen, Merlin. Oder übermorgen.«
Merlin sagte leise: »Er weiß längst von dir und Ygraine, mein Freund.«
»Trotzdem: übermorgen.« Pendragon packte die Armlehnen, als wolle er sie aus dem Sessel reißen. Ungläubig sagte er: »Er weiß es? Alles?«
»Vieles. Ygraine ist immerhin seine Gattin, König, nicht deine.«
»Woher weiß er ...?«
»Das Gesinde. Hundert Augenpaare in Caerleon und andernorts. Sie wussten's auch damals bei Ambrosius, sie wissen's mitunter auch von mir. Du und Ygraine, im Zelt, im Sommer zwischen den Felsen, in den Nischen Caerleons, in den Brombeeren am Wall des Hadrian und im Schiff. Wenn die Diener betrunken sind, ahmen sie Ygraines Lustschreie nach.«
»Die Gorlois nie gehört hat.« Pendragon lachte kurz und grinste verächtlich. Seine Schläfenadern pochten. Der Regensturm riss und rüttelte an den hölzernen Schlagläden. An der Wand hinter dem Thronsitz lief ein schmales Rinnsal bräunliches Wasser herunter. Uther Pendragon hing im Sessel, als lauere er auf einen Angriff. Er schien sich an jedes Mal zu erinnern, an jeden Ort, an dem er Ygraine genommen hatte, seit drei Jahren. »Nun: Man weiß es. Nicht zu ändern, nichts mehr zu verbergen. Was sagst du, was rätst du, Merlin-Myrddin?«
»Die Befehle, die Sitte und der Brauch – und die Notwendigkeit, sich zu versammeln, wenn der König ruft – sind unabhängig vom Ziel deiner Leidenschaft, sind geradezu heiliges Gesetz. Dass sich Gorlois deinem Befehl widersetzt und das Gesetz bricht, wird jedermann in deinem Königreich verstehen.« Merlins Stiefel dampften, aus der bronzeumkleideten Esse rauschte ein Wasserguss senkrecht ins Feuer und verschwand in einer Dampfwolke. »Zwing ihn, zurückzukehren. Die Burg Terrabil, in der er sich verschanzen wird, ist schwer einzunehmen. Ich habe von einem seiner betrunkenen Axtkämpfer gehört, dass er seine begehrenswerte Gemahlin in Tintagel zurückgelassen hat.«
»Tintagel. Die gischtumtosten Klippen in Dumnonia. Hätte er ihr beizeiten ein paar Kinder gemacht, hätt' sie mich nur über die Schulter angesehen.«
»Das mag so sein oder nicht«, sagte Merlin leise. »Mein Vater hat Ambrosius geraten, ich rate dir: Befiehl Gorlois, deinem Befehl zu gehorchen. Gehorcht er nicht, zwing ihn dazu. Dies bedeutet wüsten Kampf; die Überzahl deiner Krieger wird ihn besiegen, wird ihn töten. Überlass die Belagerung mir und deinen Besten. Für die wenigen Wachen auf Tintagel sollst du aussehen und dich kleiden wie Gorlois.« Er kicherte und strich mit dem Zeigefinger über seine Raubvogelnase. »Mach deiner sahnehäutigen und feuerhaarigen Geliebten ein Kind und nimm sie zur Frau – für alles andere sorge ich.«
»Wie schon so oft. Wie zumeist, Freund.« Seonaid näherte sich zögernd dem Feuer und schob langsam, nacheinander, vier schenkeldicke Kloben zersägtes Treibholz in die bröckelnde Glut. Pendragon knurrte: »Bei Sonnenschein und trockener Straße brauchen wir vier Tage zu Pferd nach Terrabil oderTintagel.«
»Nach Tintagel, dessen Rundturm Ambrosius hat errichten lassen. Bei diesem Regen, König, wird es länger dauern. Der Sturm wird stärker, sagt mein alter Diener; er spürt es im rechten Arm, obwohl er ihn vor einem Jahrzehnt im Kampf verlor.«
Pendragon löste seinen Blick von Merlins Gesicht. Die Schatten eines Viertagebartes verliehen Merlin das Aussehen eines Halbverhungerten, der aus dem Moor kam. Ein paar Dutzend Atemzüge lang schwiegen die Männer. Pendragon blickte unruhig im Saal umher und entdeckte im Spalt der Vorhanghälften die junge Dienerin. Er holte scharf Luft und sagte leise:
»Ruf alle Unterführer im Morgengrauen hier zusammen. Frische Pferde! Lass mich wecken, ehe die verfluchten Hähne krähen.« Der Hund am Feuer rührte sich, wedelte mit dem Schwanz und grollte, die Augen weit geöffnet, ins Leere. Sein Gebiss klackte aufeinander. Unvermittelt rief Pendragon Seonaid zu: »Bring Wein in mein Schlafgemach! Lampen anzünden! Schnell! Geh ins Bad und lass dich waschen, Frau! Zieh ein Kleid an, in dem ich dich nicht gleich erkenne!«
Er machte einige befehlende Gesten und war mit wenigen Schritten zwischen Merlinus und der gemauerten, von bronzenen und eisernen Gittern umgebenen Feuerstelle in der Mitte der Halle. Die Dienerin verbeugte sich schweigend und ließ die Vorhangsäume los. Der Hund wich aufjaulend einem Tritt Pendragons aus, der nur seinen Schenkel traf. Merlin stand auf und legte die Rechte auf Pendragons Schulter; der König spürte die beruhigende Kraft der Finger, an denen rote, blaue und grüne Steine in silbernen Fassungen glommen.
»Macht«, sagte Merlinus wie leichthin. »Sie zu haben bedeutet, deinen Willen und deine Ziele gegen Widerstand durchzusetzen. Die kleinen Fürsten und Herzöge müssen erkennen, dass du die Macht nicht verloren hast und dass du sie nicht aufgibst. Tu, was du tun willst, was der König tun muss.«
Pendragon packte Merlins rechtes Handgelenk und sagte rau:
»Noch bin ich mächtig, aber ich werde alt. Wenn ich einmal die Macht in die Hände eines Sohnes legen kann, der Vortigern, Ambrosius oder mir gleicht, lehne ich mich gern dösend gegen einen der vielen Druidensteine im Land. Noch sehe ich keinen solchen Erben, Freund.«
»Wenn Ygraine ihn dir gebiert und wenn ich ihn erziehe, o Hochkönig eines armen Landes voller halsstarriger, stolzer Fürstlein, wird ihn Britannien voll ehrfürchtigem Staunen bewundern.« Merlin legte die ringstarrenden Finger aufs Herz. »Trink Bier, aber nicht zu viel, Uther, wasch dein Gemächt und bereite dich auf den Ritt nach Tintagel vor: übermorgen.«
Uther Pendragon stieß ein dröhnendes Gelächter aus. Sein schwarzer Bart, in dem er in jedem Mond mehr graue Haare fand, fühlte sich fremd an. Er hob den Arm, als wolle er etwas beschwören, und rief unterdrückt: »Ich gebe mein Bestes, kluger Emrys-Merlin. Wie immer. Danach zeigen wir's Gorlois und seinen dumpfen Axtschwingern. Morgen, übermorgen!«
Er nickte Merlin zu, schob sich an ihm vorbei und verließ den Saal. Die Schritte waren schnell, weit und sicher, wie die eines gut abgerichteten Kampfrosses. Hinter sich hörte er das Rauschen des Vorhanges; ein Scheit knackte laut und schleuderte Funken in den Raum, die er nicht mehr sah.
Seonaid presste sich mit dem Rücken gegen die Tür und drückte sie mit zitternden Händen zu. Uther Pendragon stand zwischen dem Tisch, auf dem Wolldochte in Fettschalen brannten, und dem Bett. Die Laken waren frisch, die Decken und Felle zurückgeschlagen. Pendragon trug einen bodenlangen Leinenmantel; sein Haar, noch vom Bade feucht, lag ebenso wie ihres straff am Kopf und war im Nacken mit einem Lederband zusammengefasst.
»Komm her«, sagte Pendragon leise. Seine Finger zitterten. »Bis zum Morgengrauen. Du bist nicht Ygraine, von der ihr alle sprecht. Aber ich bin der König.«
»Du bist der König.« Sie ging mit zögerndem Lächeln auf ihn zu. »Aber ich fürchte dich nicht. Ich will gern bei dir liegen.«
Ihre Blicke flirrten; Pendragon wusste, was sie sah: Es schien Seonaid, als würde er sich verändernde näher sie ihm kam. Trotz der breiten grauen Strähnen im Bart und im Haar schien er jünger geworden, die Haut war straff; aus den Augen leuchteten Begehren und das Versprechen einer Nacht voller Leidenschaft. Er starrte sie an, sie fühlte seltsame Schwäche in den Knien, sein hungriger Blick glitt an ihr hinunter und wieder hinauf und blieb auf ihren halb verhüllten Brüsten haften. Dann streckte er die Hand aus, legte sie um ihren Nacken und zog Seonaid an sich. Sein Atem roch nach Minze.
Er küsste sie, sie spürte seine warmen Hände, als er den Umhang von ihren Schultern zerrte und sie um die Hüften packte. Er hob sie von den dicken Strohmatten und Fellen hoch, riss in ihrem Rücken den Saum des Kleides auseinander und beugte sich über sie, als er sie auf das Bett fallenließ. Seine innere Glut wandelte sich in scharfes Begehren, sein hartes Glied berührte ihren Bauch.