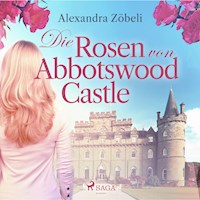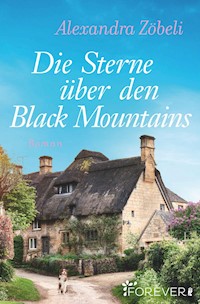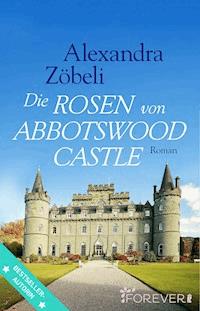
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hetty ist frustriert. Ihre Familie scheint in ihr nur die Putzfrau und Köchin zu sehen. Nicht mal an ihrem Geburtstag nimmt man sich Zeit für sie. Da muss sich was ändern. Sie folgt dem Rat ihrer Freundin Pippa, lässt ihren Mann und die achtzehnjährige Tochter in London zurück und fährt nach Schottland, zu ihrem kranken Großonkel in Abbotswood Castle. Auf der Reise zu sich selbst, jagt sie mit dem attraktiven Schreiner aus der Nachbarschaft einem Tagebuch hinterher, um dem schusseligen Schlossgespenst Rose zu helfen, endlich zu ihrem Liebsten zu kommen. Ihr eigenes Herz geht auf dieser Suche hoffnungslos verloren ... "Die Zutaten für diesen tollen Roman: Viel Liebe, ein wenig Grusel gemischt mit etwas Thriller und natürlich eine große Portion Spannung!" (Christine Jaeggi, Autorin) "Familiengeheimnis, Mystery, Romantik - alles dabei was Frau sich wünscht!" (Asbeah, LovelyBooks) Von Alexandra Zöbeli sind bei Forever erschienen: Ein Bett in Cornwall Ein Ticket nach Schottland Die Rosen von Abbotswood Castle Der Himmel über den Black Mountains Der Pub der guten Hoffnung Die Sterne über den Black Mountains
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Die AutorinAlexandra Zöbeli wurde 1970 in der Schweiz geboren und ist im Berner Oberland aufgewachsen. Ein Sprachaufenthalt in London infizierte sie mit dem Großbritannien-Virus, der mit Übernahme des eigenen Gartens vollständig ausbrach. Zusammen mit ihrem Mann lebt sie im Zürcher Oberland und arbeitet als Sachbearbeiterin einer Schulverwaltung. Ihre kreative Seite lebt sie auch beim Seifensieden, Gärtnern, Nähen und Basteln aus. Aber ihr liebstes Hobby ist das Schreiben, weil man dabei die erstaunlichsten Abenteuer und Geschichten erleben kann, ohne dass einem Grenzen aufgesetzt sind.
Das BuchHetty ist frustriert. Ihre Familie scheint in ihr nur die Putzfrau und Köchin zu sehen. Nicht mal an ihrem Geburtstag nimmt man sich Zeit für sie. Da muss sich was ändern. Sie folgt dem Rat ihrer Freundin Pippa, lässt ihren Mann und die achtzehnjährige Tochter in London zurück und fährt nach Schottland, zu ihrem kranken Großonkel in Abbotswood Castle. Auf der Reise zu sich selbst, jagt sie mit dem attraktiven Schreiner aus der Nachbarschaft einem Tagebuch hinterher, um dem schusseligen Schlossgespenst Rose zu helfen, endlich zu ihrem Liebsten zu kommen. Ihr eigenes Herz geht auf dieser Suche hoffnungslos verloren... Außerdem von Alexandra Zöbeli bei Forever: Ein Bett in Cornwall Ein Ticket nach Schottland Forever. Lesen. Lieben. Träumen.
Alexandra Zöbeli
Die Rosen von Abbotswood Castle
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt. Originalausgabe bei Forever. Forever ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Februar 2016 (1) © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016 Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München Titelabbildung: © FinePic® Autorenfoto: © privat ISBN 978-3-95818-079-6 Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
1. Kapitel
Hetty blätterte lustlos in einem Klatschheftchen, das ihre Tochter Becky beim letzten Besuch mitgebracht hatte. Doch in Wirklichkeit interessierte es sie überhaupt nicht, was die Stars und Sternchen dieser Welt von sich gaben, was für Kleider sie trugen oder welche Partner sie gerade wieder mal eingetauscht hatten. Ihr war langweilig – stinklangweilig, und das an ihrem Geburtstag! Oliver hatte ihr nach dem Frühstück einen flüchtigen Kuss aufgedrückt und gemeint, dass sie dann am Abend feiern gehen würden. Er hätte noch ein wichtiges Golfspiel mit irgendwelchen Kunden, die kurz davor wären, in ein großes Geschäft einzusteigen. Sie sollte sich doch einen schönen Tag machen, mal wieder zum Frisör gehen und sich ein hübsches Kleid kaufen. Hetty schnaubte verärgert auf, sie hatte sich schon so darauf gefreut, mal wieder etwas gemeinsam mit ihrem Mann zu unternehmen. Doch der Golfplatz ging mal wieder vor. Wie hatte sie nur glauben können, dass er sie überraschen und irgendwohin ausführen würde?! Im Flur gackerte ein Huhn und Hetty musste augenblicklich schmunzeln. Becky hatte ihr geholfen, diesen Klingelton auszusuchen und auf ihr Handy zu laden, mit dem sich Hetty immer noch nicht angefreundet hatte. Wozu brauchte sie ein Telefon, das fotografieren, Musik abspielen und all den anderen Schischi machen konnte, wenn sie doch nur telefonieren wollte? Sie legte die Zeitschrift zur Seite und ging hinüber in den Flur, wo ihre Handtasche auf einem kleinen antiken Schrank stand. Natürlich war das Handy mal wieder zuunterst in der Tasche, und beinahe hätte das Huhn zu gackern aufgehört, bevor sie den Anruf entgegennehmen konnte. Auf dem Display lächelte ihr Becky entgegen.
»Hallo, Liebes«, begrüßte sie ihre Tochter und ließ sich dabei nicht anmerken, wie frustrierend der heutige Tag für sie war.
»Happy birthday to youuuuu, happy birthday to youu«, sang Becky lauthals und zum Gotterbarmen falsch in ihr Ohr. »Ich wünsche dir alles Liebe! Du bist die beste Mutti der Welt!«
Hettys Laune verbesserte sich schlagartig. »Danke, Becky. Wie geht es dir?«
»Ich lerne, bis mir der Kopf raucht, so wie es Dad mir eingebläut hat. Die Anforderungen hier in Oxford sind schon um einiges höher als zu Hause auf dem College.«
»Macht es dir auch Spaß?«
»Machst du Witze, Mum?! Ich bin hier, um zu studieren, nicht um Spaß zu haben!«
Hetty lächelte. Ihre Tochter kam ganz nach Oliver, nur die blauen Augen und die Sommersprossen, die hat Becky von ihr geerbt.
»Und was machst du heute an deinem Geburtstag? Plant ihr einen Ausflug?«, fragte Becky neugierig.
»Schön wär’s. Aber dein Dad hat keine Zeit.« Weil er lieber mit seinen Geschäftskollegen auf dem Golfplatz ist, fügte sie im Stillen hinzu und spürte, wie der Ärger wieder in ihr hochkroch.
»Hmm, das ist blöd. Aber ihr könnt ja danach noch was unternehmen. Du, sag mal, kannst du mir am Wochenende meine Kleider waschen? Es ist hier so mühsam mit den Waschautomaten.«
»Natürlich, Liebes. Heißt das, du kommst nach Hause? Ich freue mich so! Wir könnten zusammen ins Kino gehen, so wie früher.«
»Nicht böse sein, Mum, aber ich habe mich bereits mit ein paar Freunden aus der Zeit vom College verabredet. Oh, ich muss los, die Pause ist vorbei. Tschüss, Mum.«
Hetty wollte ihr Handy gerade zurück in die Handtasche stecken, als es erneut gackerte. Dieses Mal erschien ihre Mutter auf dem Display. »Hallo, Mum«, meldete sie sich, und klang dabei selbst in ihren eigenen Ohren wie Becky.
»Guten Morgen, Henrietta. Gut, dass ich dich erwische. Wir haben heute kurzfristig über Mittag ein Familienessen geplant. Schau doch bitte, dass du kommen kannst.«
Einen Augenblick war Hetty sprachlos. Dann besann sie sich eines Besseren und dachte, vielleicht hätte die Familie ja ein Überraschungsessen für sie auf die Beine gestellt.
»Bist du noch dran, Henrietta?«
»Ja, klar, Mum. Es ist zwar wirklich etwas kurzfristig, aber ich werde da sein. Oliver wird allerdings nicht kommen können, er ist auf dem Golfplatz.«
»Das macht nichts, es geht sowieso um die Familie.«
»Mum, er ist mein Mann, er ist Familie!«, erinnerte sie ihre Mutter leicht genervt.
»Ja, ja, nun reg dich nicht gleich auf. Wir sehen uns also zum Mittagessen. Ach, und könntest du bitte noch ein Dessert mitbringen? Ich komme leider nicht mehr dazu, selbst etwas zu machen und du kannst das doch so gut.«
Hetty seufzte: »Ja, natürlich.«
Super, nun durfte sie an ihrem Geburtstag auch noch ihren eigenen Kuchen backen.
Zwei Stunden später fuhr Hetty mit ihrem teuren Jaguar vor ihrem Elternhaus vor. Oliver hatte darauf bestanden, dass sie als Frau eines Bankmanagers in einem entsprechenden Statussymbol herumfuhr, obwohl sie ihren ersten Wagen, einen alten Vauxhall, viel lieber mochte. Aber sie wollte mit Oliver wegen so etwas nicht streiten und hatte sich daher nicht gewehrt, als er den Vauxhall nach seiner Beförderung in der Bank vor fünf Jahren einfach verkauft hatte. Der Jaguar, den er ihr dann geschenkt hatte, war zwar schön und bequem, aber sie kam sich darin völlig dekadent vor. Zudem befürchtete sie immer, sich irgendwo einen Kratzer in den teuren Lack einzufangen. Sie wusste, wie ihr Mann sich über solche Kleinigkeiten aufregen konnte und versuchte daher gar nicht erst in diese Situation zu geraten. Das eine Mal hatte ihr völlig gereicht.
Hetty griff nach dem herrlich duftenden Schokoladengugelhupf auf dem Rücksitz und ging entlang dem Wagen ihrer Schwester zur Haustür. Noch immer dachte sie, dass alle nur auf sie warteten, um dann laut »Überraschung!« zu rufen. Sie drückte auf die Klingel und musste sich einen Moment gedulden, bis ihre Mutter die Tür öffnete. »Ah, da bist du ja endlich. Komm rein, Henrietta! Lucy ist auch schon da und wir haben mit dem Essen nur noch auf dich gewartet.«
Hetty zog den Mantel aus und ging dann ins Esszimmer, wo sie ihren Dad und ihre Schwester Lucy begrüßte, die bereits am Tisch saßen. Niemand gratulierte ihr zum Geburtstag und ihr wurde schnell klar, dass es hier um etwas anderes ging. Sie setzte sich und wartete, bis ihre Mutter allen das Essen auf den Tellern serviert hatte. Es gab Kartoffelbrei, einen trockenen Schweinebraten mit einer pampigen Sauce und dazu Möhrchen in einer zu sauren Balsamico-Sauce. Ihre Mutter war keine große Köchin, aber niemand wagte es, das Mahl zu kritisieren. Im Gegenteil, ihr Vater lächelte seine Frau an und nickte anerkennend: »Köstlich, meine Liebe, sehr köstlich.«
Hetty verkniff sich ein Lächeln, ihr Vater war wirklich ein herzensguter Charmeur.
»Ihr wisst ja«, griff ihre Mutter schließlich das Thema auf, weswegen sie die ganze Familie zusammengetrommelt hatte, »dass ich euren Vater damals gegen den Widerstand meiner Familie geheiratet und daher kaum noch Kontakt zu ihr habe.«
Ja, das hatte sich Hetty in ihrer Jugend bis zum Abwinken anhören müssen. Ihre Mutter stammte aus einem schottischen Adelsgeschlecht und dass sie da ausgerechnet einen einfachen englischen Büroangestellten geheiratet hatte, ging der Familie total gegen den Strich. Janes Familie war der Trauung ferngeblieben und hat seither keinen Kontakt zu den beiden aufgenommen. Hettys Vater hatte sich beruflich hochgearbeitet und mittlerweile gehört ihm das Hotel, in dem er als kleiner Lehrling begonnen hatte. Ihre Mutter hat ihn stets unterstützt, half im Hotel bei der Organisation von größeren Anlässen mit und war ansonsten in verschiedenen Wohltätigkeitsprojekten engagiert. Auch die Erstgeborene des Paares, Lucy, hat Karriere gemacht. Sie ist Kinderärztin geworden und arbeitet nun als Kinderchirurgin im Saint Mary’s Hospital in London.
Nur Hetty passte irgendwie nicht so richtig in die beruflich ehrgeizige Familie. Kurz nach ihrem neunzehnten Geburtstag hatte sie den Banker Oliver auf einer Party einer Freundin kennengelernt. Nach nur sechs Monaten wurde Becky aufgrund eines geplatzten Kondoms gezeugt. Oliver stand zu seiner Verantwortung und heiratete Hetty, denn eine Abtreibung kam für sie nicht in Frage. Manchmal fragte eine kleine leise Stimme in ihr, ob Oliver und sie aus den richtigen Gründen geheiratet hatten und ob er sie auch wirklich liebte. Wenn sie ehrlich war, war sie sich hin und wieder selbst nicht sicher, ihren Mann aufrichtig und aus vollstem Herzen zu lieben. Doch war das nicht normal? Gewöhnte man sich nicht mit der Zeit so sehr aneinander, dass der Partner einfach Familie, nicht aber mehr Liebhaber ist? Dass das Herzklopfen ausbleibt, wenn er nach Hause kommt und man einfach nur auf einen friedlichen Abend nebeneinander hofft?
»Henrietta! Hörst du überhaupt zu?«, fragte ihre Mutter spitz und holte sie aus ihren Gedanken zurück.
»Ja … natürlich, Mum . Es geht um deine Familie.«
»Es wäre schön, wenn du möglichst bald nach Schottland fahren könntest, um dich um Maxwell zu kümmern.«
»Was? Wie?! Das geht nicht! Und überhaupt, wer ist Maxwell?«
»Das habe ich doch gerade eben erklärt!«, schimpfte ihre Mutter.
»Maxwell ist ein Onkel von Mum. Er ist über achtzig, zuckerkrank und braucht nun jemanden, der sich um ihn kümmert«, erklärte Lucy dem lieben Frieden willen. »Wenn er stirbt, erbt ansonsten Mums Schwester Liz das Schloss, und wir gehen leer aus. Das wollen wir doch alle nicht, nicht wahr?«
»Lucy!«, wies ihr Vater seine Älteste zurecht.
»Na, wenn wir ehrlich sind, ist das doch genau der Punkt, oder, Mum?«, seufzte Lucy.
»Ähm … natürlich nicht, Lucy! Als ich noch ein Kind war, habe ich Maxwell immer gemocht.«
»Und warum fährst du dann nicht selbst nach Schottland?«, fragte Hetty.
»Du weißt doch, Henrietta, ich habe immer so viel um die Ohren. Und du hast von uns allen am ehesten Zeit. Deine Schwester ist in ihrem Job zu sehr eingespannt und ich muss mich um die Wohltätigkeitsorganisationen und um deinen Dad kümmern.«
»Ich habe auch Familie«, wandte Hetty etwas beleidigt ein.
»Ja, aber deine Tochter ist mittlerweile an der Universität und dein Mann wird wohl mal eine Weile ohne dich auskommen.«
Ihre Mutter sah sie fordernd an und schien keinen Widerspruch zu dulden.
»Aber ich kenne diesen Maxwell doch noch nicht einmal!« Hetty wollte nicht so einfach klein beigeben.
»Dann ist es doch eine gute Gelegenheit, ein Mitglied meiner Familie kennenzulernen. Nun gib dir schon einen Ruck, Henrietta.«
»Wie kommt es überhaupt, dass wir um Hilfe gebeten werden, wo du doch gar keinen Kontakt mehr zu deiner Familie hast, Mum?« Hetty wollte Zeit schinden, um einen Ausweg aus der Misere zu finden.
»Maxwell und Liz sind anscheinend auch verkracht. Ich denke, er hat uns genannt, in der Hoffnung, wir würden sowieso nichts unternehmen, weil wir zu weit weg wohnen. Die Krankenschwester meinte, er wolle daheim einfach so weitermachen wie vor dem Zusammenbruch, aber das wäre sehr riskant. Anscheinend gibt es einen Nachbarn, der hin und wieder nach ihm schaut. Dieser Nachbar war es auch, der ihn gefunden und den Notruf alarmiert hat. Maxwell hatte mehr Glück als Verstand.«
»Was soll ich denn da, wenn er niemanden von uns bei sich haben will?«
»Hilfe organisieren. Ich erwarte von dir, dass du hinfährst, schaust, was er braucht und eine entsprechende Person engagierst, die es mit ihm aushält und für ihn sorgt. Ich habe der Schwester auch bereits zugesichert, du würdest kommen und ihn vom Krankenhaus abholen.«
Hetty stöhnte auf.
Lucy lachte etwas schadenfroh: »Was hast du hier schon Wichtiges zu tun, Schwesterchen? Es schadet dir bestimmt nicht, dich mal um jemand anderen zu kümmern als um dich selbst.«
Hetty erhob sich von ihrem Stuhl und schaute in die Runde. »Na, dann weiß ich jetzt ja, was ihr von mir haltet. Auch wenn ich mich nur um mich selbst kümmere, wünsche ich euch einen guten Appetit bei meinem selbstgebackenen Geburtstagskuchen. Ich kehre jetzt in mein langweiliges und egoistisches Leben zurück.«
Damit drehte sie sich um und verließ mit einem lauten Türknaller ihr früheres Zuhause. Sie hatte so eine Wut im Bauch! Nicht auf diesen Maxwell, den kannte sie ja noch nicht einmal, sondern auf ihre Familie, die einfach über ihr Leben bestimmte. Wie kamen sie dazu?! In ihrer Handtasche gackerte erneut ihr Handy. Bestimmt war es ihre Familie, die sich dafür entschuldigen wollte, dass sie ihren Geburtstag vergessen hatte. Doch die konnten ihr jetzt alle den Buckel runterrutschen. Sie stellte den Jaguar vor ihrem Haus ab, ging hinein und ließ auch da die Tür geräuschvoll ins Schloss fallen.
Und nun? Wohin mit all der aufgestauten Wut? Es war niemand da, der ihr hätte zuhören können oder den sie hätte anschreien und an dem sie sich hätte abreagieren können. Hetty schälte sich aus ihren Kleidern, ging zum Putzschrank und griff zum Backofenreinigungsmittel. Sie würde ihren Ärger am Ofen auslassen, dann hätte sie wenigstens am Ende ein blitzblankes Gerät. Sie schrubbte und schimpfte dabei laut vor sich hin. Ihr Huhn in ihrer Handtasche hatte zwischendurch immer mal wieder aufbegehrt, aber Hetty hatte es ignoriert. Erst als der gröbste Ärger im Reinigungsschaum ertränkt war und sie ihr Spiegelbild im Backofen wieder erkennen konnte, zog sie sich die Putzhandschuhe aus und sank auf den Küchenboden. Sie wischte sich eine ihrer rotgoldenen Haarlocken aus dem Gesicht. Sollte sie nun wirklich nach Schottland fahren? Dieser Maxwell konnte ja schließlich nichts dafür, dass ihre Familie war, wie sie war. Vor ihrem inneren Auge entstand ein Bild von einem alten gebrechlichen Mann, der am Boden lag und auf Hilfe wartete. Konnte sie das wirklich mit ihrem Gewissen vereinbaren, ihn dort liegen zu lassen? Ihr Festnetztelefon riss sie aus ihren Gedanken. Sollte sie rangehen? Bestimmt wäre es bloß wieder ihre Mutter, die nun eine Antwort von ihr wollte. Ach was soll’s, irgendwann musste sie ja sowieso wieder mit ihr reden. »Was denn noch?!«, knurrte sie in den Hörer, als sie das Gespräch entgegennahm.
»Hallo, Schatz. Was ist denn los?«
Es war Oliver. Hetty massierte ihre Stirn mit dem Daumen und Zeigfinger. Sollte sie ihm jetzt schon erzählen, dass sie nach Schottland würde fahren müssen? Sie entschloss sich dagegen. Das wollte sie ihm lieber in Ruhe mitteilen.
»Hallo, Oliver. Tut mir leid, ich hatte gerade einen kleine Meinungsverschiedenheit mit meiner Familie.«
»Oh … ah, okay. Du, Henrietta, ich rufe nur kurz an, um dir zu sagen, dass es heute doch später wird. Ich muss mit dem Direktor einer großen Informatikfirma essen gehen. Es geht um einen für die Bank sehr wichtigen Auftrag. Können wir dein Geburtstagsessen nicht morgen nachholen?«
Na, super! Das passte perfekt zum heutigen Tag. Sie seufzte laut in den Hörer, was Oliver gleich als Zustimmung betrachtete.
»Danke, Henrietta. Wusste ich doch, du hast Verständnis dafür. Ich muss dann auch schon los. Wir sehen uns später. Tschüss!«
Als sie den Hörer aufgelegt hatte, war sie den Tränen nahe. Was für ein bescheuerter Geburtstag! Wenn sie ihn jetzt nicht heulend auf dem Sofa verbringen wollte, musste sie unbedingt was tun. Erneut griff sie zum Telefon und wählte die Nummer ihrer Freundin Pippa. Kaum meldete die sich am anderen Ende, schoss Hetty auch schon los: »Hallo, Pippa. Hast du Zeit? Können wir uns im Pub treffen?«
Pippa lachte vergnügt: »Erst mal alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag! Ich wollte gleich noch bei dir reinschauen, um dir dein Geschenk vorbeizubringen.«
Hetty lächelte. »Ich brauche kein Geschenk, aber dich, dich könnte ich grad ganz gut gebrauchen.«
»Sag mir, welches Pub, und ich werde da sein«, versprach Pippa, die der Stimme ihrer Freundin anhörte, dass da was im Busch war.
Am frühen Abend trafen sich die beiden Freundinnen im Red Inn, einem kleinen Pub in der Nähe von Pippas Wohnung.
»Ich hole die Getränke, bleib du sitzen, immerhin hast du heute Geburtstag«, orderte Pippa an.
Hetty lächelte dankbar. Nach diesem Tag tat es einfach nur gut, sich von jemandem etwas verwöhnen zu lassen. Sie stießen mit Prosecco an, bevor Pippa sie aufmerksam musterte.
»Und nun erzähl mir, warum du mit deiner Freundin im Pub sitzt, anstatt mit deinem Ehemann deinen Geburtstag zu feiern.«
Hetty seufzte und schüttete Pippa ihr Herz aus. Sie endete damit, dass ihre Familie sie nach Schottland zu diesem Großonkel Maxwell beordert hatte.
Empört schnaubte Pippa auf: »Haben die noch alle Tassen im Schrank?«
»Nun ja«, meinte Hetty schon wieder etwas versöhnlicher, denn jetzt, wo sie das Ganze Pippa erzählt hatte, fand sie alles gar nicht mehr so dramatisch. »Irgendwie haben sie ja schon Recht. Ich meine, ich habe zu Hause wirklich nicht mehr so viel zu tun und könnte es mir schon einrichten …«
»Hetty! Hör auf damit! Du bist nicht Mutter Teresa! Ich verstehe sowieso nicht, wie du dich für deine Familie so aufopfern kannst. Es kommt ja noch nicht mal ein Dankeschön über ihre Lippen. Deine Tochter kommt nur nach Hause, um sich die Wäsche machen zu lassen und dein Mann lässt dich sogar an deinem Geburtstag allein rumhocken.«
»Das hat er doch nicht mit Absicht gemacht«, nahm ihn Hetty gleich in Schutz.
»Hetty, weißt du, an was mich das Ganze erinnert?«
Hetty war sich nicht sicher, ob sie das hören wollte. Denn innerlich wusste sie ja selbst, dass in ihrer Familie etwas gründlich schieflief.
»Erinnerst du dich, als wir uns zusammen den Film Die Brücken am Fluss angesehen haben? Es ist schon ein Weilchen her, aber Hetty … du bist zu Meryl Streep geworden! Deine Familie behandelt dich wie Luft, genau wie im Film. Du bist für sie selbstverständlich geworden – so wie ein Küchenstuhl. Du stehst einfach immer da, man muss dich nicht pflegen, kann dich hin- und herschieben und sich auf dir ausruhen.«
Hetty, die sich schon den ganzen Tag zusammengerissen hatte, liefen mittlerweile die Tränen übers Gesicht. Sie wühlte in ihrer großen Handtasche verzweifelt nach Taschentüchern, doch Pippa war schneller und reichte ihr eines über den Tisch. Während Hetty sich die Nase putzte, setzte Pippa sich zu ihr auf die Bank und nahm sie einfach in die Arme.
»Es tut mir leid, Liebes, dir das ausgerechnet an deinem Geburtstag sagen zu müssen, aber es ist höchste Zeit, etwas an der Situation zu verändern. Mir ist das schon seit längerem aufgefallen und wenn du ehrlich bist, siehst du doch selbst, wie unglücklich du bist. Du hast mir damals nach dem Film gesagt, dass du, wärst du Meryl gewesen, mit Clint abgehauen wärst.«
Hetty lächelte unter Tränen. »Aber Clint Eastwood ist nicht aufgetaucht.«
Pippa tätschelte ihre Hand. »Auf die Clints dieser Zeit ist eben auch kein Verlass mehr. Du kannst nicht warten, bis er zufällig an deine Türe klopft. Du musst selbst was tun!«
»Und was? Ich mag Oliver, ich will keinen anderen. Und Becky ist einfach alles für mich.«
»Vielleicht musst du ihnen nur vor Augen halten, dass sie dich nicht als gegeben hinnehmen können. Dass sie sich auch etwas um dich bemühen müssen.«
»Und wie stelle ich das an?«
Pippa nippte an ihrem Prosecco und überlegte. Dann schaute sie Hetty wieder an. »Fahr nach Schottland!«
»Aber das ist doch genau das, was meine Familie will.« Auch Hetty griff zu ihrem Glas und nahm einen kräftigen Schluck.
»Schon möglich, aber man weiß oftmals erst, was einem fehlt, wenn es nicht mehr da ist. Deine Eltern und deine Schwester sind jetzt erst mal egal, wir kümmern uns zuerst um deinen Mann und deine Tochter. Wenn du ihnen mal nicht ständig den Hintern abwischst, nicht ständig zur Verfügung stehst und sie sich selbst mal etwas anstrengen müssen, merken sie vielleicht, was du alles für sie getan hast.«
Hetty seufzte tief: »Dann werden sie ihr Dienstmädchen vermissen, nicht mich.«
»Doch, Hetty, denn du bist viel mehr als das. Du hast ihnen zugehört, wenn sie dir von ihren Sorgen berichtet haben, du hast getröstet, sie zum Lachen gebracht, du warst immer da für sie. Ich bin sicher, es tut ihnen mal ganz gut, dich zu vermissen. Und wer weiß, womöglich wartet im hohen Norden ja doch Clint auf dich.« Pippa lächelte verschmitzt.
»Du spinnst! Ich weiß nicht, der Gedanke gefällt mir irgendwie nicht recht. Ich meine, ich kenne diesen Maxwell doch überhaupt nicht. Meine Mutter hat mir immer erzählt, wie schlecht ihre Familie sie behandelt hätte und nun soll ich dahin fahren und mich um einen von ihnen kümmern?«
»Wie alt ist Maxwell nochmal? Achtzig oder neunzig? Ich glaube nicht, dass du einen alten und kranken Mann fürchten musst. Hetty, gönn dir eine Familienpause im Norden, und werde dir darüber im Klaren, was du in deinem Leben verändern willst. Vielleicht wird es auch Zeit, dass du dir wieder eine Beschäftigung suchst.«
Hetty schaute ihre Freundin zweifelnd an. »Ich weiß ja, du hast Recht, Pippa. Doch irgendwie macht es mir eine Heidenangst, so alleine nach Schottland zu fahren.«
»Warum denn? Du warst früher immer so abenteuerlustig. Denk nur mal an all den Mist, den wir zusammen angestellt haben.«
»Ja, aber da warst du dabei.«
Pippa kicherte: »Die Ideen stammten meistens von dir, wenn ich mich richtig erinnere. Hetty, du schaffst das auch ohne mich und wenn was schiefläuft und dieser Maxwell einfach nur furchtbar ist, dann setzt du dich wieder in deine Nobelkarre und fährst zurück. Was ist schon dabei?«
Hetty schaute in ihr Glas. »Vielleicht sollte ich das wirklich tun. Ich meine, wenn es diesem Maxwell wirklich so schlecht geht, dann wäre er bestimmt froh, wenn ich komme.«
Pippa grinste. »Du hast eindeutig ein Helfersyndrom, meine Liebe. Aber wenn es hilft, dich von deiner Familie loszureißen, damit denen endlich mal klar wird, was sie an dir haben, dann habe ich nichts dagegen einzuwenden.« Sie hob ihr Glas und stieß es klirrend an das von Hetty. »Auf Schottland!«
»Na, mal sehen, ich lasse es mir noch mal durch den Kopf gehen.«
Später lag Hetty allein in ihrem Bett. Oliver war noch immer nicht nach Hause gekommen und es war schon beinahe Mitternacht. Sie konnte nicht schlafen, weil ihr die Worte von Pippa durch den Kopf gingen. Sollte sie wirklich nach Schottland fahren? Immerhin gehörte dieser Maxwell auch zur Familie. Wenn er am Ende völlig verwahrlost starb, nur weil sie sich von ihrer eigenen Familie ungerecht behandelt fühlte und ihren Stolz nicht überwinden konnte, würde sie sich wohl ewig ein schlechtes Gewissen machen. In dem Moment hörte sie unten die Tür ins Schloss fallen. Oliver gab sich nicht gerade Mühe leise zu sein. Es dauerte kaum eine Minute, da kam er ins Schlafzimmer gewankt und ließ sich neben ihr aufs Bett fallen. Hetty machte das Licht an.
»Oh, verdammt, mach das Licht aus, Henrietta! Mir dreht sich alles.«
Na super, Oliver war komplett blau. Sauer warf Hetty ihre Bettdecke zurück, stand auf und begann, ihm die Schuhe auszuziehen.
Plötzlich setzte sich Oliver auf. »Scheiße, ist mir schlecht.«
Geistesgegenwärtig griff Hetty zum Papierkorb und schaffte es gerade noch, den ihrem Mann unter die Nase zu halten, bevor der sich tatsächlich übergeben musste. Das brachte das Fass nun endgültig zum Überlaufen! Wütend griff sie nach ihrer Bettdecke und ihrem Kissen und stapfte aus dem Schlafzimmer. Sie hörte noch, wie Oliver hinter ihr her jammerte: »Schatz, Schatz …«
Sie stellte sich taub und versuchte ihr schlechtes Gewissen zu ignorieren. Irgendwann war es auch einfach mal genug! In Beckys Zimmer hätte es noch ein Bett frei gehabt, aber das war zu nahe an ihrem eigenen Schlafzimmer. Sie wollte weder sehen, wie sich Oliver erneut übergab, noch wollte sie ihn schnarchen hören. Langsam aber sicher konnte sie Frauen verstehen, die ihre Ehemänner im Schlaf um die Ecke brachten. Als sie sich auf dem Sofa im Wohnzimmer einrichtete, war ihr aber schon klar, dass sie für den Rest der Nacht auch keine Ruhe finden würde.
Morgens um fünf Uhr beschloss sie, Schottland eine Chance zu geben. Pippa hatte Recht: Sollte ihre Familie doch ruhig mal eine Weile ohne sie auskommen. Vielleicht würde sie sie danach wieder mit etwas mehr Respekt behandeln. Da sie sowieso nicht mehr schlafen konnte, stand Hetty auf, holte zwei Koffer vom Dachboden und begann im Ankleidezimmer ein paar Kleider zusammenzupacken. Anschließend duschte sie, kochte sich einen Kaffee und wartete, bis der Zeiger auf der Küchenuhr auf halb acht sprang. Um diese Zeit waren ihre Eltern für gewöhnlich wach, und sie konnte sie anrufen. Eigentlich wäre sie am liebsten einfach so losgefahren, ohne jemandem Bescheid zu geben, aber sie musste ja noch wissen, wo Maxwell überhaupt im Krankenhaus lag.
Ihre Mutter klang sehr zufrieden mit sich, als Hetty ihr sagte, sie würde nach Schottland fahren, um nach Maxwell zu sehen. »Ich wusste doch, dass du zur Vernunft kommen würdest, Henrietta.«
Hetty schluckte ihre Antwort hinunter und wartete darauf, dass ihre Mutter ihr die Adresse des Krankenhauses durchgab. Dann rief sie dort an und verlangte nach der Schwester, die mit ihrer Mutter gesprochen hatte.
»Ich bin sehr froh zu hören, dass Sie sich um Mr Gordon kümmern werden. Er hat sich gestern leider selbst entlassen und ich mache mir Sorgen um ihn. Er meinte zwar, er hätte einen Nachbarn, der nach ihm sehen würde, aber ich bin mir nicht sicher, dass das reicht.«
»Steht es denn so schlimm um ihn?«, fragte Hetty besorgt.
»Na ja, er muss sich halt regelmäßig Insulin spritzen. Und Mr Gordon ist etwas vergesslich geworden. Auch bin ich mir nicht sicher, ob er sich an die Diät hält, die wir ihm auferlegt haben. Sollte er das alles nicht machen, dann könnte er in einen Zuckerschock fallen und wenn ihn dann niemand findet …«
Den Rest ließ die Schwester ungesagt.
Hetty schluckte schwer. »Hören Sie, ich weiß nicht, ob ich die Richtige für diese Aufgabe bin. Ich habe keine Erfahrung in Krankenpflege.«
Die Frau am anderen Ende lachte. »Oh, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Ihnen jetzt Angst gemacht habe, das war nicht meine Absicht. Eigentlich ist das alles nicht besonders schwierig und Mr Gordon kann sich die Spritze auch selbst setzen. Man muss ihn halt nur dazu anhalten. Wenn Sie wollen, können Sie gerne bei uns auf der Station vorbeischauen, dann kann ich Ihnen alles in Ruhe erklären und zeigen.«
»Ich glaub, ich fahre zuerst mal zu meinem Großonkel und dann sehen wir weiter. Danke für das Angebot.«
»Gern geschehen. Ich mag Mr Gordon, man muss ihn einfach zu nehmen wissen. Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie mich an, ja?«
»Danke, das mache ich.«
Hetty verstaute nach dem Gespräch ihre Koffer im Jaguar, dann zog sie ihren Mantel an und ging nach oben in das Schlafzimmer, das sie mit Oliver teilte. Er lag noch immer angekleidet auf dem Bett. Daneben stand der Eimer und verbreitete einen fürchterlichen Gestank im Zimmer. Hetty ging zum Fenster, zog die Vorhänge beiseite und öffnete es weit, um frische Luft in den Raum zu lassen. Unwillig stöhnte Oliver vom Bett aus auf und legte sich den Arm über die Augen, um sie vor dem grellen Licht zu schützen.
»Schließ die verdammten Vorhänge wieder!«, schimpfte er.
»Hör zu«, sagte Hetty unbeeindruckt. »Ich werde für eine Weile nach Schottland fahren, um mich um meinen Großonkel zu kümmern.«
Oliver zog den Arm etwas zur Seite und blinzelte sie aus einem fahlen Gesicht an. »Was?!«
»Ich werde eine Weile weg sein.«
»Wir diskutieren das später, Henrietta. Ich fühle mich grad ziemlich beschissen.«
»Daran bist du selbst schuld, und nein, wir diskutieren das nicht später. Maxwell braucht mich jetzt. Becky wird am Wochenende nach Hause kommen. Sie braucht saubere Wäsche, aber sie weiß, wo unsere Waschmaschine steht und kann das auch mal selbst erledigen.«
Mit einem Mal war Oliver wach. »Du kannst uns hier nicht einfach zurücklassen! Und wer ist dieser Maxwell überhaupt?«
»Das sagte ich bereits, mein Großonkel. Und doch, es wird höchste Zeit, dass ich das mal tu.«
Oliver sah sie misstrauisch an. »Was soll das jetzt heißen?«
»Dass du und der Rest meiner Familie mich wie den letzten Dreck behandelt. Mir ist gerade gestern sehr deutlich vor Augen gehalten worden, was ich wirklich für euch bin: Putzfrau und Köchin. Mehr nicht.«
»Ach, komm jetzt. Nur weil wir deinen Geburtstag mal nicht zusammen gefeiert haben?! Diesen Floh hat dir bestimmt wieder deine unmögliche Freundin Pippa ins Ohr gesetzt.«
»Meine unmögliche Freundin hat sich wenigstens nicht mit ihren Golfkumpanen bis fast zur Besinnungslosigkeit besoffen, während ich zu Hause saß. Und es ist ja nicht nur das. Ich spüre einfach nicht, dass du mich noch liebst.« Hettys Augen schimmerten verdächtig feucht, aber sie riss sich zusammen. Sie wollte jetzt nicht heulen, nein, das ließ ihr Kopf nicht zu. »Ich bin für dich so selbstverständlich geworden! Hauptsache, am Abend steht ein Essen auf dem Tisch, die Wäsche ist gemacht und das Haus glänzt …«
»Das darf ich doch wohl auch erwarten, schließlich musst du nicht zur Arbeit gehen, wie es der Rest deiner Familie tut!«
»Siehst du …«, Hettys Stimme drohte ihr nun doch den Dienst zu versagen. »Das ist genau das, was ich meine. Wenn ich dir wirklich noch etwas bedeuten würde, hättest du jetzt gesagt, wie sehr du mich liebst und mir nicht vorgehalten, dass du für mich das Geld verdienst. Ich glaube, es tut uns ganz gut, wenn wir eine Weile etwas Abstand haben.«
»Du hast eindeutig zu viel Zeit, um Kitschfilme zu schauen und Liebesromane zu lesen, Henrietta. Werde endlich erwachsen, diese Welt gibt es nicht! Wenn du das Gefühl hast, ungerecht behandelt zu werden, dann geh doch! Geh und schau, wie du in der Welt da draußen zurechtkommst, ohne dass jemand für dich sorgt! Vielleicht bringt dich das zur Vernunft und du schätzt wieder, was du hier zu Hause hast. Erwarte bloß nicht, dass ich dir wie ein hirnamputierter verliebter Trottel hinterherlaufe.«
Mit Tränen in den Augen drehte sich Hetty um und verließ den Raum. Sie stieg in ihren Wagen, ließ den Motor an und fuhr einfach los, ohne darauf zu achten, welche Richtung sie einschlug. Erst als sie die Stadt hinter sich gelassen hatte, hielt sie am Straßenrand an und heulte sich die Seele aus dem Leib.
Als ihre Schluchzer etwas verebbt waren, griff Hetty zum Handy und rief Pippa an. »Ich glaube, ich hab‹ grad Mist gebaut«, schniefte sie in ihr Handy.
»Hetty? Was ist denn los? Wo steckst du?«
»Ich habe keine Ahnung. Nach dem Streit mit Oliver bin ich einfach losgefahren. Ich bin auf dem Weg nach Schottland. Pippa, ich weiß grad nicht, ob ich meine Ehe in den Sand gesetzt habe.«
»Nur weil du nach Schottland fährst?«
»Nein, nicht nur deswegen. Ich habe Oliver einige unschöne Dinge an den Kopf geworfen.« Hetty erzählte kurz und knapp, was zuvor geschehen war.
Pippa hörte zu und meinte am Ende: »Ich denke, das war mal höchste Zeit. Deine Familie brauchte einen Denkanstoß. Dass du nach Schottland fährst, ist das Beste, was du machen kannst. Du bist mehr als nur ihr Putzlappen und ihre Köchin, Herrgott nochmal!«
»Oliver hat aber gemeint, er werde nicht hinter mir herlaufen …«
Pippa lachte höhnisch. »Ich gebe ihm maximal eine Woche und er wird angekrochen kommen, Hetty.«
»Er muss doch gar nicht angekrochen kommen. Und vielleicht habe ich ja auch völlig überreagiert?! Und was, wenn er mich nicht mehr zurückhaben will? Oh, Pippa, ich glaube, ich habe ihn gerade verloren.«
»Unsinn, Mädel! Und wenn du jetzt umkehrst und zu ihm zurückkriechst, dann kriegst du Ärger mit mir, verstanden?«
Hetty gab ein kleinlautes Geräusch von sich, das man als Ja interpretieren konnte.
»Du fährst jetzt nach Schottland, kümmerst dich um diesen Maxwell, genießt den Abstand zu deiner Familie, und danach sieht die Welt bestimmt wieder für alle ganz anders aus.«
»Mag sein.«
»Nein, nicht ›mag sein‹, das ist so! Und jetzt benutze dein Navi, damit du auch wirklich in Schottland ankommst und nicht etwa in Südfrankreich. Und ruf mich an, wenn du da bist.«
»Ja, Mutti«, lächelte Hetty. »Danke, Pippa. Danke, dass du so geduldig mit mir bist.«
»Nun mach dich schon auf den Weg«, knurrte Pippa leicht verlegen.
2. Kapitel
»Sie haben Ihr Ziel erreicht!«, klang es aus dem Navi. Aber wenn Hetty sich umsah, sah sie weit und breit kein Schloss. Sie war vor wenigen Augenblicken an dem Ortsschild von Percie vorbeigefahren. Es war nur ein kleiner Weiler mit einem Pub und einem Gemischtwarenladen. Oftmals waren Schlösser und Burgen etwas außerhalb von Ortschaften zu finden und die Wege dahin gut ausgeschildert, damit die Touristen sie auch fanden. Das war hier nicht der Fall. Nicht ein Schild mit dem Hinweis Abbotswood Castle war zu sehen. Sie folgte der kleinen Straße entlang des Flusses und gelangte schließlich in einen Wald. Seufzend gestand sie sich ein, dass dieser Weg wohl auch nicht zum Ziel führen würde. Sie beschloss, an der nächsten möglichen Stelle zu wenden und nach Percie zurückzufahren, um dort jemanden nach dem Weg zu fragen. Da tauchten vor ihr zwei Gebäude auf, die sie an kanadische Blockhäuser erinnerten. Auf dem Parkplatz wurden Baumstämme und Äste gelagert. Es musste wohl eine Schreinerwerkstatt sein. Sie parkte ihren Wagen neben einem Holzstapel und stieg aus. Der Duft von Waldboden und Holz war herrlich und eine angenehme Abwechslung zu der Stadtluft, die Hetty sonst gewohnt war.
»Hallo?«, rief sie etwas zögerlich, erhielt aber keine Antwort.
Aus dem einen Blockhaus hörte sie Maschinengeräusche, da war wohl jemand bei der Arbeit. Vorbei an dem Stapel mit Baumstämmen, ging Hetty zu der Tür, die einen Spaltbreit geöffnet war. Da sie sowieso niemand hören würde, wenn sie anklopfte, trat sie einfach hindurch. Es schien ein Einmannbetrieb zu sein, denn es stand nur ein Arbeiter, mit dem Rücken gegen sie zugewandt, an einer Maschine, die ein lautes ratterndes Geräusch von sich gab.
»Hallo!«, rief sie erneut mit kräftiger Stimme, um gegen den Lärm anzukommen. Doch der Mann trug Ohrenschützer und konnte sie nicht hören. Da ihr seine Statur die Sicht versperrte, sah sie nicht, was er gerade tat. Neben ihm auf einem Tisch stand ein halbfertiges Möbelstück, das vermutlich mal einen Gartenstuhl abgeben würde. Hetty überlegte kurz, was sie machen sollte, um auf sich aufmerksam zu machen. Sie könnte warten, bis er die lärmende Maschine ausschaltete, aber das könnte noch ewig dauern. Also tippte sie ihm kurz auf die kräftige Schulter. Der Typ erschrak so heftig, dass er mit dem Stück Holz, das er an dem Schleifband bearbeitete, abrutschte, und mit dem Handballen auf das Band geriet. Er gab einen kurzen Schmerzenslaut von sich, fluchte und stellte das Gerät aus, bevor er sich zu ihr umdrehte. Mit seiner gesunden Hand drückte er auf den verletzten Handballen.
»Verdammt noch mal, wollen Sie mich umbringen?! Wenn ich an der Kreissäge gearbeitet hätte, wäre die Hand jetzt weg!«
»Tut mir leid«, sagte Hetty kleinlaut.
»Was?«
Erst jetzt bemerkte er, dass er noch den Hörschutz trug. Er streifte ihn ab und blickte auf den leicht blutenden Handballen. Dann griff er zu einem Lappen und wollte ihn sich auf die Wunde drücken.
»Das sollten Sie besser nicht tun. Der ist ja voller Holzstaub. Haben Sie ein Badezimmer hier?«
Weil er dachte, die Frau müsste mal auf die Toilette, deutete er nur mit dem Kopf in die Richtung des Klos. Hetty ging zur Tür und als sie bemerkte, dass er ihr nicht folgte, drehte sie sich zu ihm um. »Na, nun kommen Sie schon.«
Begriffsstutzig sah er sie an.
»Von allein wird die Wunde nicht sauber. Die muss ausgewaschen und versorgt werden.«
»Was verstehen Sie schon davon?«, knurrte er, folgte ihr aber dennoch.
Hetty lachte gutmütig. »Als Mutter einer Tochter, die dachte, sie sei Lara Croft, eine ganze Menge.«
Er trat an ihr vorbei und zog aus dem kleinen Schrank im Badezimmer eine Erste-Hilfe-Box hervor. Während er seine Hand unter den Wasserstrahl beim Waschbecken hielt und das Blut abwusch, suchte Hetty aus der Box die benötigten Materialien hervor.
»Das sollte reichen«, sagte sie und stellte das Wasser ab. Vorsichtig tupfte sie die Hand trocken, dann griff sie zum Desinfektionsmittel. Er sog die Luft scharf ein, als die Flüssigkeit brennend auf die Wunde traf, und zog ruckartig seine Hand weg.
»Nun stellen Sie sich nicht so an! Meine Tochter war da weitaus weniger wehleidig.«
»Nun ja, sie ist ja auch Lara Croft …«, sagte er.
Um seine Augen bildeten sich kleine Lachfältchen, die ihm gut standen. Hetty schmunzelte und schnitt ein großes Pflaster zurecht.
»Es tut mir leid, ich wollte Sie nicht erschrecken«, versuchte sie sich zu entschuldigen.
Er hielt ihr die Hand wieder hin, damit sie das Pflaster befestigen konnte. »Dafür haben Sie sich aber geschickt angestellt. Haben Sie denn die Klingel beim Eingang nicht gesehen? Wenn man die drückt, geht nicht nur ein akustisches Signal durch die Werkstatt, sondern es blinkt zusätzlich ein Licht, damit ich sehe, dass Besuch da ist.«
»Entschuldigung«, sagte Hetty kleinlaut. »Die habe ich wirklich nicht gesehen. Die Tür stand offen und da bin ich einfach eingetreten.«
Sie blickte in seine warmen olivgrünen Augen, die belustigt funkelten.
»Na ja, als Mutter von Lara Croft … die hätte bestimmt auch nicht geklingelt, sondern die Hütte gleich gestürmt. Ich schätze, ich kann von Glück reden, dass Sie mich am Leben gelassen haben.«
Sein Lächeln war umwerfend, und überhaupt sah er ziemlich gut aus mit seinen breiten Schultern, die von körperlicher Arbeit zeugten, seinen hellbraunen Haaren, die an den Schläfen bereits leicht ergraut waren, und diesem spitzbübischen Lächeln, das wohl so manches Frauenherz in Schwierigkeiten brachte. Auf einmal schien das Badezimmer zu schrumpfen und es schien ihr ziemlich eng da drin.
»Das hätten wir«, sagte sie daher und verließ eiligst den Raum.
»Danke.« Er räumte die Erste-Hilfe-Box wieder an ihren Platz zurück und folgte dann Hetty zurück in die Werkstatt. »Und was kann ich für Sie tun?«, fragte er.
Hetty hätte beinahe vergessen, warum sie in die Werkstatt gekommen war. »Ich suche Abbotswood Castle und muss mich wohl ziemlich verfahren haben. Das Navi scheint die Adresse nicht zu kennen und eine Ausschilderung habe ich auch nicht gesehen.«
»Ja, das liegt daran, dass das Schloss in Privatbesitz ist und der Besitzer keine Besucher möchte, die das Schloss besichtigen wollen. Es ist nämlich nicht für Touristen geöffnet.«
»Ich bin keine Touristin.«
»Nein? Was wollen Sie dann in Abbotswood Castle?« Der Typ schaute sie prüfend an.
»Ich wüsste nicht, was Sie das angeht, Mr …«
»Webster … Jules Webster. So wie es draußen an der Klingel steht, die sie nicht gefunden haben.« Das Lächeln war noch nicht aus seinem Gesicht verschwunden, war jetzt aber einen Hauch spöttischer.
»Es tut mir leid … Mr Webster. Ich weiß nicht, wie oft ich mich noch entschuldigen soll.«
»Och, Sie machen das doch ganz gut.«
Hetty merkte, dass er sie aufzog, was sie irgendwie ärgerte. »Können Sie mir jetzt sagen, wie ich zum Schloss komme?«
»Könnte ich … wenn Sie mir sagen, was Sie von dem alten Maxwell wollen.« Sein Blick war auf einmal nicht mehr freundlich lächelnd, sondern schien sie festnageln zu wollen.
»Er ist mein Großonkel, und ich bin hier, um mich um ihn zu kümmern. Aber wie gesagt, das geht Sie eigentlich nichts an!«
»Dann gehören Sie also auch zu dieser geldgierigen Sippe, die Maxwell aus seinem Zuhause vertreiben will, um sich das Schloss selbst unter den Nagel zu reißen.«
In Hettys meerblauen Augen brodelte sich ein Sturm zusammen. Wie konnte dieser ungehobelte Kerl es wagen!? »Mr Webster, ich weiß nicht, wie Sie auf diese absurde Idee kommen. Meine Familie wurde vom Krankenhaus verständigt, weil Maxwell uns als nächste Angehörige angegeben hat. Und weil meine Familie so überaus beschäftigt ist und denkt, ich wäre die Einzige, die zu Hause nur Däumchen dreht, wurde ich hierher in die Pampa geschickt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir jetzt einfach den Weg zum Schloss zeigen könnten, damit ich nach dem Rechten sehen und möglichst schnell zurück nach London fahren kann, wo ich meinen Mann ziemlich wütend zurückgelassen habe.«
Jules blickte kurz auf seine Schuhspitze und dann wieder zurück zu ihr. »Es tut mir leid. Ich dachte, Liz hätte Sie geschickt.«
»Liz ist meine Tante, aber ich kenne sie nicht, weil … ach, Herrgott nochmal, das geht Sie nun wirklich nichts an!«
»Schön«, gab Jules schließlich nach. »Wenn Sie die Straße einfach weiterfahren, kommen Sie bald an eine Abzweigung. Nehmen Sie die linke Straße, die über den Fluss führt und fahren Sie die Allee entlang. Nicht erschrecken, die ist ziemlich lang und es geht steil bergauf. Am Ende dieser Straße liegt das Schloss.«
»Danke«, sagte Hetty mit Stolz erhobenen Kopf und geröteten Wangen. »Und es tut mir leid, es war nicht meine Absicht, Sie zu erschrecken.«
Jules nickte und blickte ihr hinterher, als sie die Werkstatt verließ. Er wusste nicht, ob er mit seinem Freund Max Mitleid haben oder sich für ihn freuen sollte.
3. Kapitel
Hätte dieser Webster sie nicht gewarnt, dass die Allee lang wäre, hätte sie tatsächlich bereits kehrtgemacht. Es war ein furchteinflößender Weg, der hoch zum Schloss führte. Die Allee bestand aus riesigen, dunklen Blutbuchen, die kaum einen Sonnenstrahl auf die Straße ließen. Und das mitten in einem Wald. So etwas hatte Hetty wirklich noch nie gesehen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit war die Straße plötzlich zu Ende. Rechts führte der Weg auf einen großen Parkplatz und links erhob sich dunkel und bedrohlich die Schlossmauer. Sie lenkte den Jaguar auf den Parkplatz und ließ ihr Gepäck erst mal im Wagen, als sie ausstieg. Was ihr als erstes auffiel, war diese unglaubliche Stille. Sie hörte nichts außer leisen Vogelgesang. Es war fast so, als trauten sich selbst die Vögel nicht, munter und unbekümmert drauflos zu zwitschern. Unweigerlich streckte Hetty ihren Rücken durch und kniff ihren Hintern zusammen. Sei kein Angsthase, sagte sie zu sich selbst. Schließlich hatte die Krankenschwester ja gesagt, dass er eigentlich ein netter Kerl war, wenn man ihn denn zu nehmen wüsste.
Ein Torbogen unterbrach die Schlossmauer und gab den Blick auf einen Innenhof frei. Entschlossen ging Hetty durch den Bogen hindurch, und was sie dann sah, war einfach atemberaubend und wunderschön. Das alte Schlossgemäuer war mit Kletterrosen bewachsen, die gerade in voller Blüte standen. Rechts vom Schloss war ein formaler Garten angelegt, der zwar mal wieder eine pflegende Hand gebrauchen könnte, aber zu seiner besten Zeit sehr edel ausgeschaut haben muss. Hinter dem Garten fiel das Gelände ab und man hatte das Gefühl, über die steinerne Brüstung springen, die Flügel spreizen und wie ein Vogel einfach durch die Luft fliegen zu können. Sie sah nichts als Himmel und noch mal Himmel.
Begeistert ging sie zur Brüstung. Das Schloss war auf einer Hügelebene angelegt. Von dieser Terrasse fiel eine steile Mauer ab, und etwa fünf Meter unter ihr wurde das Gelände ebener. Auch da war ein riesiger Garten angelegt mit Buchs, Thuja und Eiben, die leider etwas aus ihrer Schnittform gewachsen waren, aber dem Besucher dennoch zeigten, wie prächtig dieser Garten einst gewesen sein musste. Die Schlossmauer kroch wie eine dicke steinerne Schlange um das weitläufige Gelände. Dahinter waren Felder und eine Hügelkette zu sehen. Rechts in der Ferne konnte sie ein Dorf ausmachen.
»Sie befinden sich auf Privatbesitz! Ich muss Sie auffordern, das Schlossgelände sofort zu verlassen!«, riss eine herrische Stimme sie aus ihrer Schwärmerei.
Hetty drehte sich um und sah zunächst niemanden.
»Sind Sie taub oder was?! Verlassen Sie sofort mein Grundstück!«
Erst jetzt sah Hetty den alten Mann am Fenster im ersten Stock des Schlossgebäudes.
»Sind Sie Maxwell Gordon?«, fragte Hetty unsicher und kam wieder näher an das Schloss heran, um den Mann besser sehen zu können.
»Wer will das wissen?«
»Ich bin Hetty, Ihre Großnichte.«
Der Alte schaute sie skeptisch an: »Sie irren sich. Ich habe keine Großnichte und nun verschwinden Sie endlich!«
»Ich bin die Tochter von Jane und James. Jane Brandon? Ihre Nichte?«
Maxwell rieb sich am unrasierten Kinn: »Ah, ich erinnere mich. Das ist die, die diesen Engländer geheiratet hat, nicht wahr? Und was willst du nun plötzlich hier? Zu erben gibt es hier noch nichts!«
Hetty sog scharf die Luft ein. Die Verwandtschaft ihrer Mutter schien wirklich etwas speziell zu sein, um es gelinde auszudrücken. »Das Krankenhaus hat uns verständigt und ich bin hier, um mich um dich zu kümmern.«
»Sehe ich etwa pflegebedürftig aus?! Herrgott noch mal, ich habe der Krankenschwester doch nur den Namen deiner Mutter genannt, weil ihr am weitesten weg wohnt und ich nicht damit gerechnet hätte, dass sie euch überhaupt findet.«
»Das hat sie aber, und nun bin ich hier. Hör mal, Max, könntest du mich nicht rein lassen und wir besprechen das in Ruhe?«
»Ich heiße Maxwell und nein, du kommst mir hier nicht rein. Du kannst gleich wieder nach Hause fahren und deiner Mutter sagen, dass ihr verdammten Engländer dort bleiben könnt, wo ihr seid. Sie wird das Schloss nie erben, auch dann nicht, wenn sie mir ihre Tochter als Pflegerin herschickt!«
Hetty hatte etwas Mühe, den starken schottischen Akzent zu verstehen, zumal Maxwell sich keine Mühe gab, langsamer zu sprechen. Das war bestimmt auch Absicht, dachte Hetty aufgebracht.
»Du bist genauso unmöglich, wie meine Mutter mir ihre Familie beschrieben hat. Ich dachte immer, sie übertreibe, doch wie ich gerade sehe, hat sie das nicht. Weder meine Mutter noch ich haben Interesse an diesem … diesem … alten Kasten. Wir haben ein glückliches Leben in London, wo wir alles haben, was wir brauchen. Ich bin auf Wunsch meiner Mutter hergekommen, weil sie sich Sorgen um dich gemacht hat. Deinetwegen habe ich mich mit meinem Mann verkracht und bin den ganzen Weg von London hier heraufgefahren.«
»Ich habe dich nicht darum gebeten!«, stellte Maxwell klar.
Hetty stemmte die Hände in ihre Hüfte und schaute ihn auffordernd an. »Aber du solltest zumindest so viel Anstand haben, mir wenigstens eine Tasse Tee anzubieten. Diese Sitte sollte auch den Schotten bekannt sein.«
»Und danach fährst du wieder zurück?«, fragte er misstrauisch.
Hetty nickte. Sie wollte sich nur ein Bild davon machen, ob es dem alten Kauz wirklich gut ging, dann könnte sie ihrer Mutter berichten, dass sie überflüssig war und er gut allein zurechtkäme.
»Na schön.«
Er verschwand vom Fenster. Hetty ging zur Tür, die aus massivem Nussbaumholz war und größer schien als jede andere Tür, die Hetty je zuvor gesehen hatte. Sie wartete. Nichts geschah. Bestimmt dauerte es eine Weile, bis ein alter Mann den Weg nach unten zurückgelegt hatte, dachte sie bei sich. Dann hörte sie plötzlich ein Rumpeln aus dem Inneren des Schlosses und daraufhin Hundegebell.
»Maxwell, ist alles okay?«
Sie erhielt keine Antwort. Verunsichert trat sie ein paar Schritte von der Tür zurück, in der Hoffnung, dass sich an einem der Fenster etwas tun würde. Doch es regte sich nichts. Nur der Hund bellte immer noch wie verrückt. Was sollte sie bloß tun? Sie drückte die Klingel, vielleicht war ja sonst noch jemand im Haus, der ihr öffnen könnte. Doch es kam niemand, um sie einzulassen. Vorsichtig drückte sie die Türklinke nach unten, aber die Tür war verschlossen. Hoffentlich war dem alten Mann nichts passiert. Womöglich war er über den Hund gestolpert und lag nun hilflos in einer Blutlache auf dem Boden. Umsonst bellte der Hund ja schließlich nicht. Ich muss Hilfe organisieren, sagte sie sich. Aber was, wenn er nur vergessen hat, an die Tür zugehen, weil er nicht mehr weiß, dass ich überhaupt da bin? Er würde noch wütender werden, als er es eh schon war.
Sie beschloss, erst mal um das Haus zu gehen, um zu sehen, ob es nicht noch einen weiteren Eingang gäbe, der eventuell offen stand. Auf der dem Wald zugewandten Seite wurde sie schließlich fündig. Im zweiten Stock stand ein Fenster offen. Es war zwar klein, aber sie würde wohl schon hindurch passen. Sie müsste sich lediglich zuerst auf die kleine Gartenmauer hochziehen, von da konnte sie auf die Balkonbrüstung im ersten Stock klettern, und weiter über das Spalier der Kletterrose, in der Hoffnung, dass die Rose nicht allzu hässliche Dornen hätte, und schon wäre sie oben. Wie schwer konnte das schon sein?
Entschlossen stellte sie ihre Handtasche auf den Boden und hievte sich die kleine Gartenmauer hoch. Auch auf die Balkonbrüstung gelangte sie ohne größere Probleme. Vorsichtig stellte sie dann einen Fuß auf das hölzerne Rosenspaliergitter. Hetty hoffte, es war stabil genug, damit es ihr Gewicht trug. Bevor sie den anderen Fuß auch daraufstellte, rüttelte sie an dem Gitter, um zu prüfen, ob es auch fest in der Mauer verankert war. Es hielt. Tief Luft holend kletterte sie nun vom Balkon ganz auf das Spalier hinüber. Autsch! Diese Rose hatte doch ziemlich stachelige Dornen, wie Hetty schmerzhaft feststellen musste. Zum Glück wuchsen die Triebe hier nicht allzu dicht, so fand Hetty immer wieder eine Lücke, wo sie ihre Hände sicher platzieren konnte. Nur nicht nach unten sehen, sagte sie sich und kletterte immer weiter nach oben. Gleich wäre es geschafft. Erleichtert fühlte sie unter ihren Händen endlich den rettenden Fenstersims. Sie stieß sich gerade noch mal ab, um sich mit dem Oberkörper über den Sims zu ziehen, als der Spross unter ihrem Fuß krachend zersplitterte. Zitternd atmete sie aus. Wie gut, dass das nicht weiter unten geschehen war.
Ihre Füße baumelten im Leeren, während sie mit dem Kopf bereits ins offene Badezimmerfenster hineinschaute. Leider war an dieser gekachelten Wand nichts, woran sie sich hätte festhalten und in den Raum ziehen können. So stemmte sie ihre Hände gegen die Wand und versuchte, weiter in den Raum hinein zu robben. Verflixt noch eins, die Öffnung war enger als sie gedacht hatte. Die Haut an ihrer Seite brannte bereits, da sie sie am Fensterrahmen aufgescheuert hatte. Aber sie musste jetzt einfach da hindurch passen! Ein Zurück gab es nicht mehr. Sie ächzte und stöhnte, drückte und zerrte, doch es half alles nichts. Es ging plötzlich einfach keinen Millimeter mehr weiter. Sie schien sich irgendwo verhakt zu haben. Da die Öffnung so eng war, konnte sie nicht mit den Händen nachsehen. So hing sie völlig ausgeliefert mit dem Kopf nach unten an der Badezimmerwand. Suuuuper gemacht, Hetty! Echt prima!
Jules fuhr seinen Wagen die Allee hinauf. Es hatte ihm einfach keine Ruhe gelassen und er wollte nachsehen, ob Max mit der Fremden zurechtkam. Er ärgerte sich, sie nicht mal nach ihrem Namen gefragt zu haben. Als er auf den Parkplatz fuhr, sah er, dass ihr Nobelschlitten noch da stand. Dann hatte Max sie also nicht gleich wieder fortgeschickt. Vielleicht kannte er sie ja doch und hatte ihm gegenüber bisher nur nie erwähnt, eine Großnichte zu haben. Wie auch immer, er schaute lieber rasch nach, ob alles in Ordnung war. Er betätigte die Glocke, doch der einzige, der ihm antwortete, war Max‘ Basset George. Da stimmte irgendwas nicht. Er zückte den Schlüssel, den Max ihm einmal gegeben hatte, und steckte ihn in das große Schloss. Er öffnete die Tür und rief hinein: »Max?«
Doch er bekam keine Antwort. George kam die Eingangshalle entlang gewatschelt und begrüßte ihn freudig mit dem Schwanz wedelnd.
»Hallo, Kleiner. Wo ist dein Herrchen?«
Doch George schaute ihn nur verständnislos aus seinen traurigen Augen an. Jules ging weiter durch die Halle, er kannte das Schloss so gut wie sein eigenes Haus.
»Max, wo steckst du?« Da hörte er auf einmal ein Stöhnen. »Max!« Jules rannte um die Ecke und fand seinen Freund am Ende der Treppe am Boden liegen. »Um Himmels willen, was ist denn passiert!?«
Max öffnete flatternd die Augen und erkannte Jules. »Ich wollte zur Tür … dann ist mir schwarz vor Augen geworden.«
Er wollte sich aufrappeln, doch Jules hielt ihn zurück.
»Langsam, Max. Tut dir irgendwas weh?«
»Frag lieber, was nicht weh tut. Ahh … verdammter Mist!«, wetterte der alte Mann.
»Ich rufe einen Krankenwagen.«
»Nein, Jules. Es geht mir schon wieder gut.«
Jules sah seinen Freund zweifelnd an. »Die Wunde an deiner Schläfe muss genäht werden und wir müssen sicher gehen, dass du keine Gehirnerschütterung davongetragen hast. Außerdem wird man nicht einfach so ohnmächtig, das muss abgeklärt werden. Vermutlich haben die dich einfach zu früh aus dem Krankenhaus entlassen.«
»Ich will nicht zurück in diesen Laden! Mich hat nur dieses Weibsbild aufgeregt, das sich partout nicht vertreiben ließ. Sie wollte eine Tasse Tee, dann würde sie gehen, hat sie gemeint. Da wollte ich sie reinlassen. Wo steckt sie überhaupt?«
Verwirrt blickte Max um sich.
»Ihr Wagen steht auf dem Parkplatz, sie muss noch irgendwo auf dem Gelände sein.«
»Such sie bitte. Ich will nicht, dass sich hier jemand rumtreibt, der nicht hierher gehört.« Stöhnend hielt sich Max den brummenden Schädel.
»Das mache ich gleich, Max, doch zuerst kümmere ich mich um dich.« Er ging in die Küche im ersten Stock, holte ein Glas Wasser und ein Küchentuch. Das Tuch hielt er an Max‘ Schläfe, um die Blutung zu stoppen. Danach half er Max, sich aufzusetzen und drückte ihm das Glas Wasser in die Hand. »Trink das und ich schaue währenddessen nach, wo deine Großnichte steckt.«
»Du weißt, wer sie ist?«, fragte Max erstaunt.
»Sie hat sich bei mir nach dem Weg erkundigt, weil sie dir helfen wollte«, gestand Jules seinem Freund.
»Du hättest sie besser gleich wieder weggeschickt, Jules«, beklagte sich Max.
»Sie hat mir versichert, nicht von Liz zu kommen und ich dachte mir, ein bisschen Hilfe könnte dir zurzeit nicht schaden. Lass uns später darüber reden, ich schaue jetzt erst mal, wo sie steckt und dann fahre ich dich zum Arzt.«
Mit George im Schlepptau ging Jules wieder nach draußen und lief um das Schloss herum. Er hätte sie nicht bemerkt, wenn George nicht neugierig an der Handtasche am Boden geschnüffelt hätte. Erst dann wanderte sein Blick nach oben, wo er zwei zappelnde Beine und ein wohlgeformtes Hinterteil aus dem Badezimmerfenster ragen sah. Das Bild war einfach zu köstlich und er musste laut losprusten.
»Hallo? Ist da wer?«, hörte er sie verzweifelnd rufen.
»Ja, ich komme gleich hoch und helfe Ihnen.«
Er nahm ihre Handtasche an sich und ging zurück ins Haus.
»Hast du sie?«, fragte Max, der schon wieder etwas kräftiger klang.
Jules schaute ihn belustigt an: »Ich denke, es könnte sie sein. Ihr Hintern hängt gerade aus deinem Badezimmerfenster.«
»Was?«
Jules stellte die Handtasche neben Max ab. »Den Rest bringe ich dir gleich.«
Mit großen Schritten ging er die Treppe hoch in den zweiten Stock. Als er die Badezimmertür öffnete, war das Bild, das sie bot, noch besser. Mit hochrotem Kopf hing sie über dem Fenster. Vermutlich hatte sie schon länger versucht, sich selbst aus der Situation zu befreien, denn sie sah ziemlich abgekämpft aus. Sie tat ihm schon fast etwas leid. Als sie hörte, wie die Badezimmertür geöffnet wurde, versuchte sie, ihren Oberkörper soweit hochzustemmen, dass sie ihn ansehen konnte, aber dazu fehlte ihr die Kraft.
So krächzte sie lediglich: »Gott sei Dank! Ich dachte schon, ich würde mein Leben über einer Badezimmerbrüstung aushauchen.«
Jules lachte und ging zu ihr hin. »Ich fasse Sie unter den Armen und zieh Sie raus. Okay?«
Hetty erkannte seine Stimme. »Oh, Sie sind’s, Mr Webster.«
»Ja, Lady Croft, und ich hätte gedacht, Sie würden sich etwas geschickter anstellen beim Einbrechen.«
»Ich wollte nicht … ich hab’s rumpeln gehört und mir Sorgen um Max … Maxwell gemacht … ähm, könnten wir das später klären?«
»Sicher doch.« Er griff sie unter den Schultern und wollte sie aus der Fensteröffnung ziehen. Ihre Gesichter waren sich dabei so nahe, dass sie sein Rasierwasser riechen konnte. Herrlich!
»Autsch, autsch, autsch!«, rief sie und er hielt sofort inne beim Ziehen. »Das geht nicht. Irgendwas hat sich an meiner Hose verhakt«, jammerte sie.
»Okay, dann öffne ich jetzt zuerst Ihre Hose und dann versuchen wir’s nochmal.«
»Geht nicht. Der Gürtel und der Knopf liegen genau auf Höhe des Fensterrandes. Ich komm‹ da ja selbst nicht hin.« Sie hätte vor Scham und Verzweiflung heulen können.
»Nicht aufgeben, Lady Croft«, tröstete er sie. »Sie halten sich jetzt an meinen Schultern fest, dann versuchen Sie, etwas zurückzurobben, bis Sie an den Verschluss kommen. Ich halte Sie und lasse Sie nicht fallen. Versprochen.«
Und tatsächlich schaffte sie es auf diese Weise, die Verschlüsse zu öffnen. Mit einem kräftigen Zug nach vorne, hielt Jules sie schließlich im Inneren des Badezimmers in seinen Armen. Erschöpft lehnte sie sich einen Moment an seine Brust, bis ihr bewusst wurde, dass sie im Unterhöschen vor ihm stand.
»Umdrehen!«, befahl sie ihm entsetzt und blickte verzweifelt im Badezimmer um sich. Da, da hing ein Badetuch über der Heizung. Es hatte zwar schon bessere Tage gesehen, aber zur Not würde es gehen. Sie zog es sich um die Hüfte und hielt es mit einer Hand fest.
»Danke für Ihre Hilfe, Mr Webster«, sagte sie schließlich so würdevoll, wie es noch ging.
Belustigt drehte Jules sich wieder zu ihr um. »Ich denke, unter diesen Umständen reicht Jules völlig aus.«
»Hetty.« Sie streckte ihm die Hand hin, um sich per Handschlag zu bedanken. Doch stattdessen führte er sie an seine Lippen und platzierte einen hauchzarten Handkuss darauf. »Es ist mir eine Ehre.«
»Du brauchst dich nicht über mich lustig zu machen, Jules!« In dem Moment kam ihr der Grund wieder in den Sinn, weshalb sie diese Kletteraktion auf sich genommen hatte. »Maxwell?! Ich muss nach Maxwell sehen.«
Sie schaute aus dem Fenster, wo ihre Hose noch immer an dem Haken hing, schnappte sie sich und bedeutete Jules mit einer Handbewegung, sich erneut umzudrehen, damit sie wieder in die Hose schlüpfen konnte. Sie wunderte sich kurz, weshalb man einen Haken außerhalb des Badezimmerfensters anbrachte. Es gab Dinge, die musste man wohl einfach nicht verstehen.
»Er sitzt unten an der Treppe, die er runtergefallen ist. Ich habe nach ihm gesehen, bevor ich dich aus deiner prekären Lage befreit habe. Ich denke, ich sollte ihn jetzt besser zum Arzt fahren.«
»Hat er sich schwer verletzt?« Sie stand bereits wieder neben ihm und deutete ihm an, vorzugehen, da sie sich ja im Schloss nicht auskannte.
»Er hat sich den Kopf angeschlagen. Die Wunde sollte versorgt werden und ich hoffe, er hat keine Gehirnerschütterung davongetragen. Ich mache mir allerdings Sorgen darüber, weshalb er ohnmächtig geworden war.«
»Er hat Zucker, und die Schwester aus dem Krankenhaus hat mir erzählt, dass er nicht immer daran denkt, sich die Insulinspritzen zu setzen. Deshalb bin ich ja hier.«
»Davon hat er mir nichts gesagt. Er meinte, er müsse lediglich ein paar Tabletten schlucken und etwas weniger Whisky trinken.«
Max lehnte noch immer an dem Pfosten, an dem Jules ihn zurückgelassen hatte.
»Was hast du in meinem Haus zu suchen?«, schimpfte er gleich los, als er Hetty erkannte.
»Wie schön, es scheint dir ja bereits wieder besser zu gehen, Onkel Maxwell. Ich habe es draußen rumpeln gehört und dein Hund hat wie verrückt gebellt. Da habe ich mir eben Sorgen gemacht und wollte nachsehen. Kannst du aufstehen?«
Sie wollte ihm stützend unter die Arme greifen, doch Maxwell wehrte ihre helfenden Hände ab. »Ich kann das selbst!«, blaffte er sie an.
»Max, benimm dich, sie will doch nur helfen!«, versuchte Jules ihn zu beschwichtigen und griff seinerseits nach Max‘ Schultern, um seinem Freund aufzuhelfen.
»Sie ist doch schuld an dem allem!«, wetterte Maxwell weiter.
»Ach ja? Habe ich dich etwa die Treppe hinuntergestoßen? Da riskiere ich Kopf und Kragen, um dir zu helfen …«, sie unterbrach sich, als der alte Mann aufstöhnte. Er hatte versucht aufzutreten, aber der Schmerz in seinem Knöchel ließ das nicht zu. »Wir müssen einen Krankenwagen rufen«, meinte Hetty besorgt.