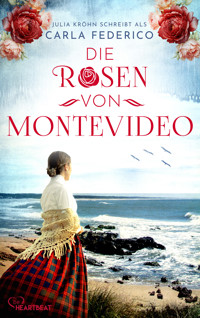
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Starke Frauen, zwei Kontinente, ein halbes Jahrhundert.
Uruguay, 1843: Die lebenslustige Rosa, Tochter der angesehenen Familie de la Vega, soll mit einem älteren Geschäftspartner ihres Vaters verheiratet werden. Um dem zu entgehen, flieht sie und trifft dabei auf den Frankfurter Bankierssohn Albert. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Für ihre Liebe folgt Rosa Albert nach Deutschland, wo sie jedoch immer eine Fremde sein wird ... Zwanzig Jahre später kehrt Rosas Tochter Valeria zurück nach Uruguay und verfällt dem wilden, urwüchsigen Land ebenso wie einem Mann, den sie nicht lieben darf.
Voller Leidenschaft folgen die Frauen der de-la-Vega-Familie ihrem Herzen und kämpfen mit Stärke und Entschlossenheit in einer bewegten Zeit für ihr Glück.
Eine spannende Familiensaga vor exotischer Kulisse! Julia Kröhn schreibt als Carla Federico und entführt ihre Leserinnen und Leser in eine andere Zeit in ferne Länder.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
»Die farbenprächtigen Schilderungen faszinieren den Leser von der ersten Seite an.« Kurier
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 998
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Zitat
Prolog Montevideo 1829
ERSTES BUCH Rosa ~ die Exotin 1847~1851
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
ZWEITES BUCH Valeria und Claire ~ die Liebenden 1866~1870
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
28. KAPITEL
29. KAPITEL
DRITTES BUCH Carlota und Tabitha ~ die ungleichen Schwestern 1888~1889
30. KAPITEL
31. KAPITEL
32. KAPITEL
33. KAPITEL
34. KAPITEL
35. KAPITEL
36. KAPITEL
37. KAPITEL
38. KAPITEL
39. KAPITEL
40. KAPITEL
41. KAPITEL
42. KAPITEL
ANHANG
PERSONENVERZEICHNIS
HISTORISCHE ANMERKUNG
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Uruguay, 1843: Die lebenslustige Rosa, Tochter der angesehenen Familie de la Vega, soll mit einem älteren Geschäftspartner ihres Vaters verheiratet werden. Um dem zu entgehen, flieht sie und trifft dabei auf den Frankfurter Bankierssohn Albert. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Für ihre Liebe folgt Rosa Albert nach Deutschland, wo sie jedoch immer eine Fremde sein wird ... Zwanzig Jahre später kehrt Rosas Tochter Valeria zurück nach Uruguay und verfällt dem wilden, urwüchsigen Land ebenso wie einem Mann, den sie nicht lieben darf.
Carla Federico
Die Rosen von Montevideo
Du musst dich überzeugen, mein Liebster,
dass ich dich mehr als die Dinge liebe,
die mein Leben ausmachen.
Mehr als meine Rosen
mit dem tiefen Duft und den brennenden Gesichtern.
JUANA DE IBARBOUROU
(Dichterin aus Uruguay)
PrologMontevideo 1829
Wenn Valeria Olivares die Augen schloss und Erinnerungen an ihre Kindheit beschwor, fühlte sie sich manchmal in ihre katalanische Heimat zurückversetzt. Sie genoss die neckenden Sonnenstrahlen, lauschte dem von den Mauern des Hauses gedämpften Schnauben der Maultiere und Knirschen der Fuhrwerke und sog den eigentümlichen Geruch ein, der in der Luft lag und Valencias Brise glich: Der salzige des Meeres vermischte sich mit dem süßen von Obst und dem erdigen nach Pferdemist. Doch sobald sie die Augen aufschlug, musste sie sich enttäuscht darauf besinnen, dass sie fern der Heimat lebte und ihr die Stadt, in die es sie verschlagen hatte, fremd geblieben war.
Sie stand im Innenhof des Hauses, wo sie – bereits wenige Wochen nach ihrer Ankunft – Blumen gepflanzt hatte. Sie wuchsen mittlerweile üppig, rochen süßer als Obst und schenkten jenem dunklen Haus, dessen Böden grau und Wände eintönig weiß waren, eine Fülle an Farben. Aber selbst die Blumen konnten sie nicht mit Montevideo versöhnen, und die Nelken, Kamelien und Hortensien täuschten nicht darüber hinweg, dass der einzige Rosenstock verdorrt war.
Valeria blickte auf das armselige Gewächs und sagte zu ihrer treuen Dienerin Esperanza: »Ich werde nicht aufhören, mich nach meiner Heimat zu sehnen.«
In Esperanzas Adern floss das Blut der Indianer Uruguays. Ihre Haut war dunkler als die der Spanier, ihr Blick unergründlicher und ihre Weisheit unerschöpflich. »Ihr müsst Euch Zeit lassen. Es sind erst wenige Jahre ...«
Valeria Olivares hob abrupt die Hand, um sie zum Schweigen zu bringen, und schüttelte energisch den Kopf. »Nein«, erklärte sie. »Die Zeit facht meine Sehnsucht an, anstatt sie zum Erlöschen zu bringen.«
Sie deutete auf den kleinen Jungen, der nicht weit von ihnen im Patio spielte. Er hatte ihre Locken, wenngleich sein Haar um einige Nuancen heller war, und ihre feinen Züge, obwohl er, anders als sie, glücklich und befreit lächelte. »Ich dachte, es würde alles anders werden, wenn ich hier ein Kind geboren hätte. Aber auch wenn Montevideo Julios Geburtsstadt ist – meine Heimat ist es dennoch nicht.« Sie senkte ihren Blick und strich sich über den deutlich gewölbten Bauch. »Und daran wird sich auch nichts ändern, wenn ich mein zweites Kind geboren habe«, fügte sie leise hinzu.
Esperanza widersprach nicht länger, sondern zuckte die Schultern, indes sich Valeria seufzend zu dem verkrüppelten Rosenstock beugte. Die Erde war feucht, sie hatte die Blumen ausreichend gegossen, die Mauern spendeten Schatten, und die Mittagssonne spendete genügend Licht. Warum gingen ausgerechnet ihre Lieblingsblumen ein? War es ein schlechtes Omen, weil auch sie wähnte, hier langsam zu verblühen?
»Vielleicht ... vielleicht solltet Ihr häufiger das Haus verlassen und in die Stadt gehen«, schlug Esperanza vor.
Valeria erschauderte beim Gedanken an die vielen fremden Menschen. »In meinem Zustand ist das unmöglich!«, rief sie. Auch als sie noch nicht schwanger gewesen war, hatte sie sich gescheut, Montevideo zu erforschen. Für ihren Mann Alejandro war es damals ein großes Abenteuer gewesen, hierher aufzubrechen, und er war mühelos heimisch geworden. Voller Eifer hatte er sich auf die Aufgabe gestürzt, sich eine neue Existenz aufzubauen und endlich ein erfolgreicher Kaufmann zu sein, der nicht von seinem Vater gegängelt wurde und im Schatten seiner Brüder stand, der vielmehr seinen Geschäftssinn, seine Skrupellosigkeit und seinen Ehrgeiz ungehindert ausleben konnte. Für ihn war Montevideo eine brodelnde Stadt, eine Stadt mit Zukunft, eine Stadt, in der alle Zeichen auf Neubeginn standen: Überall wurde gebaut, und jeden Tag legten neue Schiffe an, die Auswanderer aus Europa brachten. Für Valeria war Montevideo hingegen eine Stadt ohne Geschichte. Es gab zu viel, was an ihre militärische Vergangenheit erinnerte, zu wenig, was von Schönheit kündete.
Einzig ihr Blumengarten war schön, von dem Rosenstock abgesehen, der keine Blüte getrieben hatte – zumindest fast keine. Plötzlich fiel Valeria auf die Knie, griff in den verdorrten Strauch und deutete auf eine winzige Knospe, die sich hinter den Zweigen versteckt hatte. Sie war noch gänzlich verschlossen und verströmte keinerlei Duft, aber ihre Blütenblätter hatten sich leicht rosig verfärbt.
»Wie es aussieht, waren Eure Bemühungen nicht ganz umsonst.«
Trotz ihres Kummers musste Valeria lächeln. Schwerfällig beugte sie sich nach vorne und strich zärtlich über die winzige Rose. Die Blütenblätter fühlten sich so weich an wie die Haut von Kindern – von ihren Kindern, dem geborenen und dem noch ungeborenen. Sie selbst würde hier nicht glücklich werden, aber die beiden vielleicht schon.
»Aua!«, entfuhr es ihr. Sie hatte nicht nur die Blütenblätter berührt, sondern auch die Stachel, die die Zweige übersäten. Ein winziger Blutstropfen perlte über ihre Hand, tropfte auf die Erde und versickerte dort.
Valeria erschrak. Als sie auf die dunkle Erde starrte, kamen ihr die Worte des Priesters in den Sinn, dass der Mensch aus Staub hervorgegangen sei und irgendwann wieder zu Staub werde. Dereinst würde sie unter solcher Erde begraben liegen und keine Rosen mehr riechen ...
Kälte stieg vom Boden auf und erfasste ihre Glieder. Doch ehe sie zu zittern begann, spürte sie, wie das Kind in ihrem Leib strampelte. Dies war nicht der rechte Moment, an die Vergangenheit zu denken, die Heimat – und den Tod.
Kurzentschlossen pflückte sie die einzige Rose und streckte die Hand nach Esperanza aus, damit diese ihr aufhelfen und sie ins Haus begleiten konnte.
ERSTES BUCHRosa ~ die Exotin1847~1851
1. KAPITEL
Rosa blickte sich verzweifelt um, las in den Gesichtern, die auf sie gerichtet waren, jedoch nur Tadel. Kein einziges Mitglied ihrer Familie stand auf ihrer Seite oder zeigte Verständnis für ihr Anliegen.
Letzteres hatte sie zumindest von Tante Orfelia erwartet, die sich ansonsten immer als gutmütig erwies und ihr vieles durchgehen ließ: Sie hatte verschwiegen, dass Rosa einmal eine teure Vase kaputt gemacht hatte, und überdies immer die kleinen Diebstähle aus der Speisekammer gedeckt. Schließlich hatte sie selbst eine Schwäche für Süßes, obwohl sie zerbrechlich dünn war. Doch nun hielt sie ihren Blick beharrlich auf den Boden gesenkt.
»Tante Orfelia!«, rief Rosa hilfesuchend. »Nun sag doch auch etwas!«
Aber Orfelia schwieg und überließ wie so oft ihrer älteren Schwester Eugenia das Wort. Die war genauso dünn, die Furchen im Gesicht waren jedoch tiefer, und die Stimme war nicht hell und hoch, sondern dunkel und heiser. Auch sie war zu Rosa zwar nie wirklich streng gewesen, aber ihrem Bruder Alejandro, Rosas Vater, bedingungslos ergeben.
»Du solltest deinem Vater wirklich dankbar sein.«
Rosa schüttelte den Kopf. Sie hatte mehrfach all ihre Argumente vorgebracht, aber es war, als würde sie gegen eine Wand reden – weder die Tanten noch Alejandro de la Vegas selbst gingen darauf ein. Ihr Vater erklärte stattdessen zum nun schon wiederholten Male: »Ricardo del Monte stammt aus einer alten Familie Valencias, die genauso wie unsere in der Neuen Welt ihr Glück gemacht hat. Ricardo selbst hat beim Unabhängigkeitskrieg Uruguays tatkräftig mitgekämpft.«
Rosa unterdrückte ein Seufzen. Das, was Alejandro für Ricardo del Monte einnahm, sprach in ihren Augen genau gegen ihn.
Die »33 Unsterblichen« hieß jene Gruppe Uruguayer, die sich einst gegen die Spanier erhoben hatten, um Uruguay von der Fremdherrschaft zu befreien. Das war nun zwanzig Jahre her – was wiederum bedeutete, dass Ricardo del Monte, wenn er damals tatsächlich mitgekämpft hatte, uralt war.
Wieder richtete Rosa sich flehentlich an Orfelia. »Willst du zusehen, wie ich gezwungen werde, einen Mann zu heiraten, den ich nicht will? Du bist doch auch unverheiratet geblieben!«
Orfelia stand in der Tat schon immer im Schatten der älteren Schwester, und als Eugenia geheiratet hatte, war sie ihr gefolgt und hatte ihr den Haushalt geführt. Nach dem frühen Tod von Eugenias Gatten waren beide Schwestern wieder ins Elternhaus zurückgekehrt. Obwohl Eugenia immerhin ein paar Jahre ihres Lebens an der Seite eines Mannes verbracht hatte, wirkte sie nicht minder altjüngferlich wie Orfelia. Beide machten nicht den Eindruck, als hätten sie je geliebt.
»Du musst gehorsam sein«, sagte Orfelia. »Und bedenke – viele Mädchen deines Alters sind längst verheiratet.«
Ohne Zweifel hatte sie recht. Die meisten Bräute, die Rosa kannte, waren um die sechzehn Jahre alt, manche sogar erheblich jünger. Sie hingegen war letztes Frühjahr bereits achtzehn geworden. Allerdings sprach dieser Umstand allein noch nicht für Ricardo. Dass sie älter war als eine normale Braut, machte ihn zu keinem jugendlichen Mann.
In jedem Fall sah sie ein, dass sie von den Tanten keine Hilfe zu erwarten hatte, und wandte sich erneut an ihren Vater. In seiner Nähe empfand sie immer ein wenig Scheu, aber sie hoffte, dass er sein Herz gegenüber der einzigen Tochter nicht verschließen würde. Als Kind hatte sie oft auf seinem Schoß gesessen, wenn er eine Zigarre rauchte, hatte den Geruch eingesogen und mit seinen Barthaaren gespielt. Jetzt war es undenkbar, auf seinen Schoß zu klettern, dennoch ergriff sie zumindest seine Hand. Seit langem hatte sie ihn nicht mehr so eindringlich gemustert: Sein Bart war grau geworden, sein Gesicht faltig, und die Hand war von Flecken übersät.
»Papá ...«, flehte sie. »Du gehörst doch zu den Porteños, den Hafenbewohnern der Banda Oriental, und es heißt, dass diese aufgeschlossen seien und sehr modern. Ein typischer Porteño besitzt kein Land, sondern verdient sein Geld mit dem Handel. Ricardo dagegen zählt zu den Hacienderos, und über die hast du dich doch immer beschwert.«
Für gewöhnlich interessierte sie sich mitnichten für den tiefen Konflikt, der die Banda Oriental zerriss. Nun jedoch nutzte sie die unüberwindbar tiefe Kluft zwischen den Kaufleuten an der Küste und den despotischen Landbesitzern. Leider hatte ihr Appell keinen Erfolg.
»Nun, in diesem Fall tut das nichts zur Sache«, erklärte Alejandro streng. »Ricardo besitzt eine eigene Manufaktur, und das bedeutet, dass ihm viel am Handel gelegen ist. Auch wenn seine Herkunft eigentlich dagegenspricht – er ist einer von uns Colorados.«
Rosa unterdrückte einmal mehr ein Seufzen. Was sollte sie dagegen noch anführen?
Ihr Vater unterteilte die Welt stets in Schwarz und Weiß. Oder eben in Colorados und Blancos, wie die zwei verfeindeten Parteien genannt wurden. Nichts hasste er so sehr wie die Blancos.
Sie selbst war zu unbedeutend, um sie zu hassen – nur ein Mädchen, dessen Wille sich in seinen Augen leicht brechen ließ. »Du wirst mir gehorchen«, erwiderte er streng.
»Aber ich will Ricardo nicht heiraten!«, schrie sie trotzig. »Ricardo riecht nach Kuhmist, spuckt ständig Tabak aus und ist auf einem Auge blind. Und ich will auch nicht aus Montevideo fortziehen.«
Alejandro sagte nichts mehr, sondern nickte Tante Eugenia nur zu.
»Wie mir scheint, brauchst du etwas Zeit, um darüber nachzudenken«, schaltete sich diese ein. »Und das tust du am besten in deinem Zimmer. Du wirst so lange dort bleiben, bis du Ricardos Vorzüge zu schätzen weißt.«
Tante Eugenias Augen blitzten bösartig, Orfelia hielt ihren Blick dagegen immer noch auf den Boden gerichtet. Zuletzt starrte Rosa ihren Bruder Julio an, der bis jetzt am Fenster gestanden und geschwiegen hatte und auch jetzt kein Wort über die Lippen brachte.
Feigling!, schimpfte sie ihn innerlich.
Julio war oft anderer Meinung als Alejandro und lästerte heimlich über den halsstarrigen Alten, aber sie hatte noch nie erlebt, wie er ihm offen trotzte.
»Ihr könnt mich einsperren, bis ich verrotte!«, rief sie verzweifelt. »Trotzdem werde ich Ricardo del Monte nicht heiraten!«
Als niemand etwas sagte, straffte sie die Schultern und lief freiwillig in ihr Zimmer. Dort bemühte sie sich mit aller Macht um eine gleichgültige Miene. Erst als sie hörte, wie Eugenia von außen zusperrte, traten ihr Tränen der Ohnmacht und Verzweiflung in die Augen.
Rosa ging unruhig in ihrem Zimmer auf und ab. Sie war seit nunmehr einem Tag eingesperrt – und allein mit ihren Gedanken. Zuerst hatte sie Trübsinn geblasen, doch nach einer unruhigen Nacht hatte sie Unrast gepackt, und mittlerweile kreisten alle Gedanken um eine mögliche Flucht.
Die meisten Häuser in ihrer Straße waren einstöckig, und auch in ihrem spielte sich das gesellschaftliche Leben vor allem im Erdgeschoss ab, doch ausgerechnet ihr Schlafzimmer befand sich direkt unter dem Dach.
Sie trat auf den Balkon aus Zedernholz und blickte hinab auf die Straße. Wie sie schon gedacht hatte: Für einen Sprung war es viel zu hoch.
Zähneknirschend betrachtete sie die Hauswände aus ungebranntem Backstein. Der Balkon wurde von einem Gerüst gestützt ... Vielleicht könnte sie sich daran herunterlassen. Allerdings müsste sie es erst erreichen – und dabei könnte sie sich alle Knochen brechen.
Als sie hörte, wie sich der Schlüssel umdrehte, stürzte sie hoffnungsvoll zurück in ihr Zimmer, doch es kam weder eine der Tanten noch der Vater, um sie wieder freizulassen.
»Ach, du bist es nur, Espe ...«
Esperanza war die treue Dienerin ihrer verstorbenen Mutter gewesen. Sie war zwar jünger als die Tanten – mittlerweile zählte sie über dreißig Jahre –, doch sie hatte aufgrund des dunklen, wissenden Blicks immer schon uralt gewirkt. So treu sie einst zu Rosas Mutter stand – ob ihr Loyalität im Blut lag oder sie diese als rechtlose Indianerin einfach als nützlich erkannt hatte, war nie recht offensichtlich –, erwies sie sich auch gegenüber der Tochter. Viele Worte machte sie jedoch nicht, und sie sparte auch an liebevollen Gesten. Eine Weile blickte sie Rosa nur ruhig an, dann stellte sie schweigend ein Tablett mit Essen ab. Brot und etwas Ziegenkäse lagen auf dem Teller, eine frische Orange und ein Saft, den Esperanza jeden Morgen selbst braute und dessen Zutaten Rosa nicht kannte. Obwohl ihr Magen knurrte, musterte Rosa das Essen nur flüchtig.
»Ich kann ihn nicht heiraten«, sagte sie verzweifelt.
»Ja«, meinte Espe, wie Rosa sie nannte, seit sie sprechen konnte.
»Und ich ertrag’s auch nicht, länger hier eingesperrt zu sein.«
»Ja«, murmelte Espe wieder.
Ihr Gesicht war ausdruckslos. Nur selten verriet sie mit Worten oder ihrer Miene, was sie dachte.
»Ich ... ich muss fliehen«, stammelte Rosa.
Endlich sagte Espe mehr als nur ein Wort. »Und wohin willst du gehen?«
Rosa zuckte die Schultern. Die Wahrheit war – sie hatte keine Ahnung. Sie hatte in ihrem Leben das Haus der de la Vegas’ stets nur in Begleitung ihrer Familie verlassen. Die Welt da draußen war ihr großteils fremd. Sie mochte voller Verheißungen sein, aber eben auch voller Gefahren.
»Egal«, sagte sie hastig. »Ich will einfach nur weg von hier. Danach kann ich mir immer noch überlegen, wie es weitergehen sollte. Vielleicht ... vielleicht hilft mir auch Julio, wenn ich erst einmal in Ruhe mit ihm allein reden kann.«
Sonderlich groß war die Hoffnung nicht, ausgerechnet von ihrem Bruder Hilfe zu erfahren. Allerdings liebte Julio es, Geschäfte zu machen, und das lieber mit Engländern, die viel von Wirtschaft verstanden, als mit Spaniern. Julio wäre wohl selbst am liebsten ein Engländer gewesen – und vielleicht war es bei diesen nicht üblich, junge Mädchen gegen ihren Willen zu verheiraten. Sie könnte an ihn appellieren, dass eine erzwungene Ehe keinen guten Eindruck machte, ihn möglicherweise sogar auf die Idee bringen, dass es mehr Vorteile brachte, wenn sie einen Engländer heiratete. All seine Geschäftspartner, die sie kennengelernt hatte, sprachen zwar ein unverständliches Spanisch, waren bleich und rotgesichtig und schwitzten stark, aber im Augenblick war ihr jeder Mann lieber als der uralte Ricardo.
Rosa blickte wieder nach draußen. »Ich müsste unter vier Augen mit Julio sprechen. Am besten außerhalb des Hauses. Ich könnte ihn bei den Lagerhallen am Hafen suchen – dort verbringt er die meiste Zeit. Ich frage mich nur, wie ich dorthin kommen soll. Es ist zu hoch, um hinunterzuklettern.«
Espe schwieg wieder lange. »Du könntest über den Corral fliehen.«
Der Corral war der letzte von insgesamt drei Innenhöfen. Der erste Hof befand sich zwischen dem Hauseingang und dem Salon, der zweite zwischen Speisesaal und dem Flügel mit den Privatgemächern. Und wenn man diesen verließ, kam man in besagten Corral, der zu den Stallungen führte, dem Holz- und Kohlenschuppen und den Käfigen für das Federvieh. Außerdem befand sich dort – neben dem Haupteingang – eine zweite kleine Tür, durch die die Dienstboten das Haus betraten und verließen.
»Es könnte funktionieren ...«, setzte Rosa zögerlich an.
»Ich würde an deiner Stelle die Siesta abwarten, wenn alle schlafen.«
Rosa bekam es trotz ihrer Unrast nun doch mit der Angst zu tun. Sie hatte gehofft, dass Espe nicht nur ihre Flucht unterstützen, sondern sie sogar begleiten würde. Doch auch wenn sie nie bekundet hatte, ihn sonderlich zu mögen, erlaubte es wohl die Treue zu Alejandro de la Vegas nicht, dass sie so weit ging.
»Soll ich es wirklich tun?«, fragte sie zaudernd.
Espe zuckte die Schultern. »Es ist deine Wahl. Auf jeden Fall solltest du vorher etwas essen.«
Erst als Rosa sich über das Brot mit Ziegenkäse hermachte, fügte sie hinzu: »Ricardo ist älter als dein Vater.« Mehr brauchte sie nicht zu sagen, um Rosas Bedenken zu zerstreuen.
Einige Stunden später kam Esperanza wieder in ihr Zimmer und bedeutete ihr schweigend, ihr zu folgen. Rosa schlich ihr auf Zehenspitzen nach, eine Mühe, die sie sich eigentlich sparen konnte, denn die Tanten schliefen stets so tief, dass man ihr lautes Schnarchen bis ins Freie hörte. Alejandro wiederum saß meist im Salon und rauchte eine Zigarre.
»Ich hoffe, du bekommst meinetwegen keine Schwierigkeiten«, flüsterte Rosa.
»Lass das mal meine Sorge sein.«
Rosa war einmal mehr über Espes Gelassenheit erstaunt. Obwohl sie nur eine Dienstbotin war, legte sie dennoch die aufrechte Haltung einer Königin an den Tag. Gewiss, dass sie die Vertraute ihrer verstorbenen Mutter gewesen war, unterschied sie rangmäßig von den anderen Frauen, die im Haushalt arbeiteten. Doch es war nicht nur das, sondern ihre Würde, die dazu führte, dass Alejandro ihr nie einen seiner knappen Befehle erteilte und die Tanten lieber die jungen Mädchen herumscheuchten.
Über die marmorne Treppe gelangten sie ins Freie. Ehe sie die Stallungen erreichten, passierten sie den Garten, wie er in vielen der Patio-Häuser angelegt war und wo Blumen, Sträucher und Schlingpflanzen wuchsen. Die Gewächse wurzelten nicht in der Erde, sondern standen in irdenen Gefäßen, hölzernen Kübeln oder durchgesägten Fässern.
Als Rosa den durchdringenden Geruch der Blumen einsog, musste sie an ihre Mutter Valeria Olivares denken. Sie hatte sie nie kennengelernt, weil sie bei ihrer Geburt gestorben war, aber Espe hatte ihr viel von ihr erzählt, so auch, dass sie es geliebt hatte, Blumen zu züchten. Üppig und farbenprächtig seien sie alle gewachsen – nur die Rosen nicht. Die waren bis auf eine einzige allesamt eingegangen, so dass Valeria, die sich so oft nach ihrer Heimat Valencia sehnte, schließlich beschlossen hatte, es nicht länger zu versuchen und stattdessen ihr Kind, so es denn eine Tochter wurde, Rosa zu nennen. Rosa wurde die Kehle eng. Ob Valeria Olivares diesen Namen noch hatte aussprechen können, ehe sie starb? Ob sie ihr Kind noch in den Händen gehalten, es liebkost hatte? Sie hatte Espe nie danach gefragt, aber sie war sich plötzlich sicher: Valeria Olivares würde nicht gutheißen, dass ihre Tochter den alten Ricardo del Monte heiraten sollte. Stark genug, sich gegen Alejandro durchzusetzen, wäre sie wohl dennoch nicht. Schließlich hatte sie ihn auch gegen ihren Willen nach Montevideo begleiten müssen.
Seit Generationen trieb Alejandros Familie Handel mit der Neuen Welt – schon sein Urgroßvater war oft die Handelsroute entlanggesegelt, die von Sevilla aus über die Kanaren oder die Antillen nach Cartagena in Kolumbien und Portobello in Panama führte. Später hatten die de la Vegas enge Geschäftsbeziehungen mit den drei Vizekönigreichen in Südamerika gehalten: Neugranada im Norden, Peru im Westen und die Region um den Río de la Plata im Süden.
Als daraus drei Staaten hervorgingen – Argentinien, Uruguay und Paraguay –, die allesamt auf Unabhängigkeit pochten, ihrem einstigen Mutterland Spanien den Krieg erklärten und auf diese Weise den Handel zum Erliegen brachten, entschied Alejandro de la Vegas, sich von seinem Heimatland loszusagen und in der Neuen Welt sein Glück zu versuchen. In Valencia galt er seitdem als Verräter – in Montevideo, wo er sich niedergelassen hatte, als reicher, angesehener Geschäftsmann. Nur die Mutter war hier so verblüht wie die Rosen ...
Der Gedanke an jene Frau, an die nur ein Ölgemälde erinnerte, lenkte Rosa ab. Schon hatten sie die Stallungen erreicht, ohne entdeckt zu werden, und kamen wenige Augenblicke später an die Hintertür.
»Du kennst den Weg zum Hafen?«, fragte Espe knapp.
Rosa nickte, obwohl sie ihn noch nie allein gegangen war. Hätte Espe sie umarmt, hätte sie sich nie überwinden können zu gehen, doch wie so oft blieb diese mit verschränkten Armen vor ihr stehen, und Rosa nahm allen Mut zusammen und trat auf die Straße.
Jetzt – zur Siesta – war sie fast menschenleer. Fliegen umsurrten ihren Kopf. Hunde schliefen im Schatten. Rosa lief hastig die Straße entlang und verlangsamte ihren Schritt erst, als das Haus der de la Vegas’ außer Sichtweite lag. Hier begegnete sie nun doch einigen Menschen, und sie senkte rasch den Blick, um nicht aufzufallen.
Je weiter sie sich vom Haus entfernte, desto größer wurden ihre Zweifel. Würde Julio wirklich auf ihrer Seite stehen? Und was, wenn sie ihn gar nicht in den Lagerhallen antraf?
Gewiss, sie könnte dort auf ihn warten, aber wenn man zwischenzeitig ihr Verschwinden bemerkte, würde man sie suchen. Auch wenn die Tanten nie sonderlich streng zu ihr gewesen waren, würden sie ihre Flucht streng bestrafen – wobei es jedoch keine schlimmere Strafe gab, als Ricardo zu heiraten.
In ihrer Verzweiflung achtete Rosa nicht länger auf den Weg. Zwar konnte man sich in Montevideo gut zurechtfinden, da sämtliche Straßen in einem rechtwinkligen Netz verliefen, doch als sie stehen blieb und sich umblickte, hatte sie keine Ahnung, in welcher Richtung nun der Hafen lag.
Sie bog in ein enges Gässchen ein – und bereute es bereits, als sie es erst zur Hälfte durchschritten hatte.
Mehrere Männer lungerten hier herum. Sie waren in Lumpen gekleidet, und Rosa hielt sie zunächst für Bettler, die gleich ihre Hände ausstrecken und um Almosen bitten würden. Doch die meisten Bettler waren krank, gelähmt und blind – diese Männer aber stark und bei guter Gesundheit. Wendig sprangen sie auf, kaum dass sie ihrer ansichtig wurden, und maßen sie mit unverhohlen anzüglichen Blicken.
»So alleine unterwegs, Täubchen?«, fragte einer.
Der Mann grinste – aber es wirkte mitnichten freundlich und vertrauenerweckend.
Rosa zuckte zurück, als eine Woge übelriechender Atem sie traf. Entweder hatte der Mann zu viel getrunken oder litt an einem fauligen Zahn.
»Wohin willst du denn?«, fragte er gedehnt.
Sie beschloss, nicht zu antworten, und senkte vermeintlich demutsvoll den Blick. Doch als sie das Gässchen wieder zurückgehen wollte, verstellten ihr zwei der Männer den Weg. Rosa versuchte, die aufsteigende Panik zu unterdrücken, und blickte sich unauffällig um. Weit und breit war niemand zu sehen, von dem sie Hilfe erwarten konnte. Sämtliche Fenster und Türen waren verschlossen, um die Bewohner vor der oft gleißenden Sonne zu schützen oder vor dem Staub, den die häufigen, ganz plötzlich auftretenden Stürme hochwirbelten. Der Mann, der sie angesprochen hatte, hob seine Hand und strich ihr über die Wange. Noch nie hatte ein Fremder sie derart vertraulich angefasst, und obwohl Rosa darum kämpfte, sich ihr Unbehagen nicht anmerken zu lassen, duckte sie sich unwillkürlich. Prompt brachen die Männer in Gelächter aus. Ob sie um Hilfe schreien sollte? Oder ob das diese Halunken noch mehr anstacheln würde?
Ihr kam eine bessere Idee. Sie straffte ihre Schultern, hielt den Blick nicht länger gesenkt, sondern maß den anderen Mann herausfordernd. Hoffentlich merkte er nicht an ihrer zitternden Stimme, wie mulmig ihr zumute war.
»Ich bin Rosa de la Vegas – die Tochter von Alejandro de la Vegas. Lasst mich sofort vorbei!«
Wenn sie mit ihrer Familie unterwegs war, hatte sie oft erlebt, dass allein der Klang ihres Namens Respekt einflößte, war Alejandro doch einer der einflussreichsten Bürger der Hafenstadt.
Bei diesen Männern erzielte sie allerdings nicht die gewünschte Wirkung. In ihrem Blick leuchtete etwas auf, das sie nicht deuten konnte.
»Soso, Alejandro de la Vegas ...«
Der Mann, der ihre Wange gestreichelt hatte, nickte seinen Kumpanen zu, und schon zogen sie einen noch engeren Kreis um sie.
»Hier ist’s, als müsste man nur den Mund aufmachen – und schon kommt ein köstlicher Braten hereingeflogen.«
Rosa hatte keine Ahnung, was er meinte – noch nicht. Schon im nächsten Augenblick fiel ihr jedoch die Armbinde auf, die die Männer trugen, und sie ahnte Schlimmes. Die Binde war das Letzte, was sie sah, denn während sie sich an dem einen Mann vorbeikämpfen wollte, stülpte ein anderer einen Sack über sie. Es war ein rauer Stoff, der kratzte und unter dem sie nur noch Schemen erkennen konnte, und sobald sie von einem Mann gepackt und über die Schultern geworfen wurde, nicht einmal mehr das.
»Hilfe!«, schrie sie laut – und vergebens. Der Griff wurde nur noch fester, und während sie wie ein Mehlsack fortgeschleppt wurde, zischte ihr einer der Männer zu: »Noch ein falsches Wort – und dir wird Hören und Sehen vergehen.«
Rosa presste die Lippen zusammen. Sie war sich sicher, dass er die Warnung wahr machen würde.
Die Armbinde, die sie gesehen hatte, war weiß und bedeutete, dass die Männer zu den Blancos gehörten – den Erzfeinden ihres Vaters, der – als Colorado – seit dem Bürgerkrieg von 1835 oft eine rote Binde trug.
Mein Gott, wie dumm sie war, ausgerechnet den Namen ihres Vaters zu nennen!
Mit jedem Schritt, den ihre Entführer machten, wuchsen ihre Magenschmerzen. Blut schoss ihr in den Kopf, und dieser wurde ganz heiß. Sie konnte nicht deuten, in welche Richtung die Schritte führten, nahm aber schließlich den schwachen Geruch nach fauligem Fisch wahr. Offenbar befanden sie sich in der Nähe des Hafens. Vorsichtig hob sie den Kopf, konnte jedoch nichts erkennen, nur dass es plötzlich dunkler wurde. Es roch nicht länger nur nach Fisch, sondern nach Holzstaub. Vielleicht hatten sie eine jener Lagerhallen betreten, in denen ihr Bruder Julio oft seine Geschäfte abwickelte.
Der Mann hob sie von seinen Schultern und warf sie zu Boden. Unsanft landete sie auf ihrem Hinterteil.
»Und was stellen wir nun mit ihr an?«
»Sie kann uns ein nettes Lösegeld einbringen.«
»Warum sollten wir auf Geld pochen? Mit ihr in unserer Hand können wir Alejandro zwingen, uns die Argentinier auszuliefern.«
Rosa rieb sich ihre schmerzenden Glieder und dachte über die Worte nach. In Montevideo waren viele Argentinier untergeschlüpft, die vor ihrem despotischen Präsidenten de Rosas geflohen waren. Dieser wiederum unterstützte die Blancos. In Alejandros Haus gingen die flüchtigen Argentinier ein und aus, und er schloss mit ihnen Geschäfte ab. Sie waren zwar nicht seine Freunde, aber der gemeinsame Feind einte sie.
Rosa hob die Hand und zerrte den Sack von ihrem Gesicht. Sofort konnte sie befreiter atmen, und ihr Kopf glühte nicht mehr ganz so heiß. Die Männer achteten nicht auf sie, sondern diskutierten laut, was zu tun war. Sie zögerte nicht, diese Chance zu nutzen – vielleicht die einzige, die ihr blieb. Sie rollte blitzschnell zur Seite, sprang auf und lief ein paar Schritte. Die Lagerhalle war voller Boote, und sie stieß gegen eines und schrammte sich ihr Knie auf. Sie achtete nicht auf den Schmerz – zu nahe war die Tür, durch die sie sich nach draußen retten konnte. Schon hörte sie Stimmen und Schritte dahinter – von Menschen, die sie beschützen würden.
Doch ehe sie um Hilfe rufen konnte, packte eine Hand ihr Haar und riss sie daran zurück. Ihr Schrei erstarb zu einem erbärmlichen Quieken.
2. KAPITEL
Albert Gothmann fluchte, als er einmal mehr in einen Haufen Kuhscheiße trat. Zu Beginn seines Spaziergangs hatte er noch sorgsam darauf geachtet, genau das zu vermeiden, doch er hatte es satt, den Blick ständig gesenkt zu halten. Schließlich wollte er etwas von der Stadt sehen – und prompt war’s passiert.
Mit angewiderter Miene rieb er seine Schuhe am Pflaster ab. Seit seiner Ankunft hatte er viele Briten klagen gehört, dass die Gebäude schrecklich vernachlässigt seien und die Straßen voller Pferdemist und Kuhscheiße. Bis jetzt hatte er sie für verwöhnt und kleinlich gehalten, aber mittlerweile hatte auch seine Begeisterung für die fremde Stadt gelitten. Jene Abenteuerlust, die ihn getrieben hatte, diese weite Reise anzutreten und zum ersten Mal in seinem Leben Europa zu verlassen, war schnell der Ernüchterung gewichen. Montevideo war alles andere als das exotische Paradies, das er sich zu Hause vorgestellt hatte. Es war gar nicht so fremdartig, nur ärmlicher, nicht zuletzt, weil es seit Jahren belagert wurde.
Prüfend blickte er auf seine Schuhe: Trotz seiner Bemühungen war natürlich Dreck an den Sohlen haften geblieben. Hoffentlich stank er nicht danach. Als er weiterging, unterdrückte er ein Seufzen und bemühte sich, wieder das Positive zu sehen. Gewiss, Montevideo war ärmlich und heruntergekommen, aber auch sehr lebendig. Eben ging er durch eine Straße, in der Tabakläden sich mit Essständen und den Buden der öffentlichen Schreiber oder Notare und Geldwechselkontore abwechselten. Menschen strömten in Seidenwarenläden und Lebensmittelgeschäfte, Pulperías genannt und hauptsächlich von Italienern betrieben, deren Singsang man bis hinaus auf die Straße hörte. Übertönt wurden sie nur von den Händlern, die in kleinen Buden hockten und den Passanten ihre Ware anpriesen: Schuhe aus Córdoba, Zigarren aus Salta oder Kunstgewerbe aus San Juan.
Albert waren diese Orte fremd, aber er blieb interessiert stehen und betrachtete die Waren. Da er allerdings nicht daran dachte, etwas zu kaufen, was nur wenig praktischen Nutzen versprach, wurde er von den enttäuschten Händlern wütend vertrieben. Oh, dieses südländische Temperament!, dachte er etwas überfordert und tupfte sich mit einem Spitzentaschentuch den Schweiß von der Stirn.
Er floh in eine etwas ruhigere Gasse, wurde dort jedoch prompt von einem Barbier angeredet, der ihm nicht nur anbot, den Bart zu stutzen – sah der Banause denn nicht, dass er das bereits selbst getan hatte? –, sondern ihm obendrein alle möglichen Tiegelchen und Döschen vors Gesicht hielt, die Seifen, Duftwässer oder andere Artikel der Hautpflege beinhalteten. Albert schüttelte dankend den Kopf und sah sich sogleich neuen Flüchen ausgesetzt.
Wieder seufzte er. Die Briten hatten ihn ja gewarnt, ihm nicht nur erzählt, wie dreist die Barbiere den eingesessenen Apotheken Konkurrenz machten, sondern dass sie völlig ungenießbare Liköre als vermeintlich magenstärkende Heilmittel verkauften. Nun, wenn er etwas hätte trinken wollen, hätte Albert eher zu so einem Likör gegriffen, als in eine der Chinganas einzukehren – finstere Spelunken, wo Trauben- und Zuckerbranntwein, der jeden wachen Geist benebelte, in Strömen floss und die Stühle und Tische derart verklebt und verdreckt waren, dass Albert lieber in den Kuhmist stieg, als dort Platz zu nehmen.
Er eilte das Gässchen entlang in Richtung Hafen, wo es auch nicht viel ruhiger zuging. Die Mole war erst vor zwei Jahrzehnten neu errichtet worden, erwies sich aber längst als zu klein für die Schiffe, die mit immer größerem Tiefgang ausgestattet wurden. Deshalb wurde sie eben ausgebaut – und das unter lautstarkem Geschrei, von dem Albert nicht recht sagen konnte, ob es von dem Bauherrn stammte oder aufrührerischen Arbeitern. Und dort, wo diese ausnahmsweise schweigend ihren Dienst verrichteten, herrschte Streit um Anlegeplätze.
Das Sprachenwirrwarr, das Albert traf, faszinierte und verunsicherte ihn gleichermaßen. Am häufigsten vernahm er neben der spanischen die französische und englische Sprache. Mit einem britischen Schiff hatte er selbst vor einigen Wochen angelegt – ein mühsames Unterfangen angesichts der argentinischen Belagerung. Der dortige Präsident wollte in seinem Nachbarland eine Regierung der Blancos etablieren, hieß es offiziell. Unter der Hand sprach allerdings jeder offen davon, dass es de Rosas weniger um Politik ging als vielmehr um den Handel: Was diesen anbelangte, stellte sein Nachbarland eine große Konkurrenz dar, die er gerne ausgeschaltet hätte.
Doch auch die Belagerung hatte die rege Ein- und Ausfuhr von Leder und Fleisch nicht zum Erliegen gebracht. Die Franzosen und Engländer hielten mit ihren Kriegsschiffen den Hafen offen und gewährleisteten die Versorgung der Stadt, und falls sie einmal nicht rechtzeitig eingriffen, machten sich Montevideos Seemänner und Abenteurer wie Giuseppe Garibaldi einen Namen, indem sie die Seewege gegen die Argentinier verteidigten.
Albert blickte auf das blau funkelnde Meer. So wie er selbst einst das fremde Land verherrlicht hatte, hier nun aber immer wieder in Kuhscheiße stieg, wurde auch der Freiheitskampf der belagerten Stadt in Europa hochstilisiert und Montevideo als neues Troja bezeichnet.
Von wegen, dachte Albert. Gegen die Engländer haben die Argentinier ohnehin keine Chance, und was den freien Handel mehr bedroht als die Blockade, ist die fehlende ordnende Hand, die das Chaos bannt.
Wieder tupfte er sich den Schweiß von der Stirn, als er in neuerliches Geschiebe und Gedränge rund um den Fischmarkt geriet. Angesichts der vielen und lauten Menschen konnte er sich schwer vorstellen, dass Montevideo vor wenigen Jahrzehnten kaum mehr als ein Dorf gewesen war und Einwanderer von den Kanarischen Inseln und den baskischen Regionen mit dem Versprechen vieler Privilegien angelockt werden mussten, um den Ort ein wenig zu beleben. Mittlerweile war die Einwohnerzahl längst auf hunderttausend angewachsen, und der Stadtkern platzte aus allen Nähten.
Als Albert sein Spitzentaschentuch einsteckte, berührte er das lederne Notizbüchlein, das er in seiner Brusttasche trug. Seit Beginn seiner Reise hatte er alle aufgeschnappten Informationen über Land und Leute aufgeschrieben und sie immer mal wieder durchgelesen. War er bis vor kurzem noch stolz auf die wachsenden Schriften gewesen, so zweifelte er seit einigen Tagen an deren Sinn. Er hatte alles richtig machen und sich bei den Kontakten mit Einheimischen als kundig erweisen wollen, doch bis jetzt hatte er hauptsächlich mit Engländern zu tun, und die interessierten sich mitnichten für die Vergangenheit des Landes, solange sie dessen Zukunft mitgestalten konnten. Er selbst wollte das auch gerne und hatte sich gegenüber seinem Vater, einem Frankfurter Bankier, durchgesetzt, der ihm die Reise hatte verbieten wollen.
»Begreif doch, Vater«, hatte er erklärt. »Wenn man als Bankier heutzutage Erfolg haben will, braucht man Kapital. Und das Kapital kommt aus dem Handel, und wenn man keine entsprechenden Beziehungen in Europa hat wie wir, dann müssen wir den Handel in Übersee nutzen. In Montevideo sind kaum deutsche Kaufleute tätig, von ein paar Hamburgern und Bremern abgesehen. Es ist möglich, eine Nische zu entdecken und zu nutzen.«
Albert Gothmann senior hatte ihn schließlich zähneknirschend ziehen lassen, und Albert junior hatte bis zuletzt verheimlichen können, dass ihn nicht nur das Geschäft antrieb, sondern das Fernweh, vor allem, seit er ein Gemälde von Montevideo gesehen hatte – einer Stadt in der Nähe von Stränden, Palmen und schimmerndem Meer. Wenn sein Vater ihn jetzt gesehen hätte, hätte er wohl gehöhnt, dass die Strände außerhalb der Stadt lagen, die Palmen rar waren und das Meer im Hafen wie eine Kloake stank. Überdies wurde der Blick auf die funkelnde Weite von dem ständigen Gedränge verleidet.
Wieder brach Albert der Schweiß aus, aber anstatt erneut sein Spitzentaschentuch zu zücken, zog er es vor, sich ein ruhigeres Fleckchen zu suchen. Dort hinten bei den Lagerhäusern waren zwar einige Männer zugegen, um Waren ein- und auszuladen, doch die meisten Hallen waren verschlossen und die Wege davor menschenleer.
Albert stellte sich vor eines dieser Lagerhäuser, atmete tief durch und schloss kurz die Augen. Es glich einem Überlebenskampf, durch die Stadt zu gehen, und das jetzige Innehalten fühlte sich wie eine Atempause in einer ewig andauernden Schlacht an.
Ja, hier war er in Sicherheit vor Lärm, Gedränge und Gestank. Zumindest glaubte er das, bis er plötzlich lautes Geschrei vernahm – aus dem Mund einer Frau.
»Hilfe!«, schrie sie ein ums andere Mal. »So helft mir doch!«
Der Schrei kam von drinnen. Albert lugte durch die Ritzen der Lagerhalle und konnte mehrere Männer erkennen, die eine junge Frau festhielten. Als sie erneut um Hilfe schrie, schlug einer ihr ins Gesicht.
»Maul halten!«, knurrte der Mann. »Wenn du dich still verhältst, kommst du heil aus der Sache raus.«
»Alejandro de la Vegas’ Tochter – was für ein Fisch am Haken!«, rief ein anderer.
»Und deswegen müssen wir genau überlegen, wie wir vorgehen.«
»Mein Vater wird euch alles geben, was ihr wollt«, rief das Mädchen dazwischen.
Albert erschauderte. Er hatte den Namen de la Vegas schon einmal gehört – er war ein ziemlich einflussreicher hier in Montevideo. Offenbar hatten die Männer das Mädchen entführt, um ihren Vater zu erpressen.
Am liebsten wäre Albert unauffällig geflohen. Bis jetzt hatte er sich aus jedem Händel herausgehalten, von denen es hierzulande viele gab. Allerdings war er dazu erzogen worden, Frauen zu schützen.
Mit aller Macht unterdrückte er sein Unbehagen, stieß die Tür zur Lagerhalle auf und streckte seinen Rücken durch, um sich so groß wie möglich zu machen. »Was geht hier vor?«, rief er streng.
Die Männer fuhren herum und blickten ihn wütend an.
Erst jetzt sah er die Armbinden, die sie als Blancos, vielleicht sogar als Argentinier auswiesen. Ihre Stiefel und Ponchos ließen darauf schließen, dass sie Viehzüchter waren – und falls sie tatsächlich aus dem Nachbarland kamen, hatten sie als solche nichts zu verlieren. Während die Engländer dafür sorgten, dass Montevideo für die Kaufleute aller Welt zugänglich war, blockierten sie die argentinischen Häfen: Die dortige Wirtschaft hatte schlimm darunter zu leiden – und betroffen waren vor allem die Viehhändler.
In ihren Mienen stand keinerlei schlechtes Gewissen, weil er sie bei dieser Untat ertappt hatte, sondern die Gier eines Raubtiers, das seine Beute mit allen Mitteln verteidigen würde.
Gott, warum habe ich mich nur eingemischt?
Übermächtig wurde der Drang, wieder rückwärts ins Freie zu treten und davonzurennen. Aber dann fiel sein Blick abermals auf das Mädchen, und er musterte es genauer. Die Engländer hatten ihn vor den Frauen Uruguays gewarnt: Jene würden nur nach äußerer Eleganz streben, wären ansonsten aber unzivilisiert, derb und dreckig wie Bäuerinnen. Dieses Mädchen musste jedoch auch auf jeden Europäer ungemein anziehend wirken. Wer konnte es betrachten und nicht seine Anmut rühmen, die dunklen Augen, die lebendig funkelten, die scharf geschnittene Nase, den zierlichen Mund, das üppige, glänzende Haar?
»Also, was geht hier vor?«, brüllte Albert energischer, als ihm zumute war.
Einer der Männer trat auf ihn zu, hob die Hand und schlug ihm auf die Brust. Es war nur ein nachlässiger Stoß, mehr Warnung als ernsthafter Angriff, doch Albert geriet ins Stolpern.
»Misch dich nicht ein, ja?«
»Ein Mann mit Ehre kann sich unmöglich heraushalten, wenn ein Mädchen so schändlich behandelt wird.« Er war stolz, dass er die spanische Sprache fast fließend beherrschte, wenngleich sie ihn natürlich nicht vor den Männern retten würde. »Soso«, spottete der eine, »wenn du so viel Ehre im Blut hast, besitzt du dann auch eine Waffe, um sie notfalls zu verteidigen?«
Das nun leider nicht. Albert zauderte, ehe sein Blick erneut auf das Mädchen fiel, das ihn so verzweifelt anblickte und sogleich so hoffnungsvoll. Für gewöhnlich wurde er von Frauen nicht betrachtet, als taugte er zum Helden. Als Bankierssohn galt er als gute Partie, und die Blicke, die auf ihn fielen, waren meist berechnend.
Erneut bezähmte er den Drang, zu fliehen. »Ich habe keine Waffe, sondern Geld. Ihr wollt offenbar ihren Vater erpressen, lasst mich das Lösegeld zahlen.«
Jener, der das Mädchen geschlagen und danach festgehalten hatte, stieß sie zurück und trat auf ihn zu. Zwar hatte er genau das gehofft, aber als er in das gefurchte Gesicht starrte, packte ihn die Angst.
»Wir wollen kein Geld, sondern die Herausgabe der argentinischen Verräter.«
»Das heißt, ihr würdet das Geld lieber liegen lassen?«
Verwirrung breitete sich in den Gesichtern aus. »Was heißt liegen lassen?«
Während er gesprochen hatte, hatte Albert in seinen Hosentaschen gewühlt. Sie waren voller Münzen, und zum ersten Mal war er dem Umstand dankbar, dass hier kaum Papiergeld in Gebrauch war. Nun warf er die Münzen hoch, die prompt zu allen Seiten herabregneten, und auf die niedrigen Instinkte der Männer war Verlass: Wie erhofft, bückten sie sich, um die Münzen einzusammeln.
Er wollte dem Mädchen ein Zeichen geben, zu fliehen, doch das war ohnehin bereits losgestürmt. Eben flitzte es an einem der vielen Boote vorbei, doch bevor es zum Ausgang kam, sprang der, der es vorhin festgehalten hatte, auf. »Halt!«, rief er streng und streckte seine Hand nach dem Mädchen aus.
Albert hatte keine Ahnung, was er nun tun sollte – im Zweikampf würde er ohne Zweifel unterliegen. Doch das Mädchen wusste sich selbst zu helfen, zog etwas aus dem Fischerboot und warf es über den Argentinier. Albert erkannte, dass es ein Netz war, in dem sich der Mann verhedderte. Er stolperte, ging zu Boden.
Im nächsten Augenblick stand das Mädchen vor ihm. Albert war wie erstarrt.
»Nun rennen Sie doch!«
Das ließ er sich kein zweites Mal sagen. Er preschte los, kam aber dem Mädchen kaum nach. Sie lief viel schneller als er, und auch als sie die Lagerhalle längst hinter sich gelassen und eine belebtere Gegend erreicht hatten, hörte sie nicht zu rennen auf. Erst als das Gewühl so dicht wurde, dass sie kaum mehr vorankam, hielt sie schnaufend inne. Ihm selbst pochte das Herz bis zum Hals, seine Brust schien zu zerspringen. Er konnte sich nicht erinnern, jemals so schnell gelaufen zu sein.
Kurz stützte er sich an einem Brunnen ab, und als er wenig später den Kopf wieder hob, war von dem Mädchen weit und breit nichts zu sehen. Er war tief enttäuscht und wollte sich schon seines Weges machen, als er es doch noch im Schatten eines Hauseingangs entdeckte.
Ihre Schultern zuckten, und er dachte, dass sie vor lauter Schreck zu weinen begonnen hätte, doch als er vorsichtig seine Hände auf ihre Schultern legte – selten hatte er eine Frau so vertraulich berührt –, fuhr sie herum und lachte aus voller Kehle.
»Haben Sie ihre Gesichter gesehen? Wie dumm sie dreingeblickt haben!«
Sie hatte eine hohe, melodische Stimme, die ihn verzauberte. »Es war sehr mutig von Ihnen, das Netz über den Mann zu werfen ...«, setzte er an. Sein Spanisch war eben noch flüssig gewesen, doch nun rang er nach jedem Wort. Sein Hals war trocken – nicht nur vor Anstrengung, auch von dem Anblick ihrer sanft geröteten Wangen.
»Sie aber auch! Die Männer waren Blancos, vielleicht sogar Argentinier.«
»Das dachte ich mir schon.«
Die junge Frau musterte ihn neugierig. »Sie sind nicht von hier, oder?«
»Ich komme aus Frankfurt.«
Sie blickte ihn fragend an. »Liegt das in Brasilien oder Argentinien?«
Er musste lachen. »Nein, es ist eine deutsche Stadt«, erklärte er schnell, und als sich immer noch keinerlei Verständnis in ihren Zügen ausbreitete, fügte er rasch hinzu: »Das ist in Europa.«
»Oh!« Sie nickte bewundernd. Offenbar war sie kaum je einem Menschen begegnet, der von so weit angereist war.
»Mein Name ist Albert Gothmann«, fügte er hinzu, und auch sie stellte sich vor.
»Rosa«, murmelte sie, »ich bin Rosa de la Vegas.«
Ein Name wie ein Lied ... Wahrscheinlich waren die de la Vegas eine alte spanische Adelsfamilie. Dementsprechend elegant war sie auch gekleidet. Das hellblaue Musselinkleid hatte zwar ein paar Flecken abbekommen, aber das tat ihrer Anmut keinen Abbruch.
»Soll ich Sie nach Hause bringen?«, fragte er.
Sie dachte eine Weile darüber nach, schüttelte dann jedoch den Kopf. »O nein, besser nicht«, erwiderte sie hastig.
Er wusste nicht, was er davon halten und nun tun sollte. Unmöglich konnte er sie einfach hier stehen lassen, aber er fand keinen Vorwand, um weiterhin ihre Nähe zu suchen.
Ehe er eine Entscheidung traf, kam sie ihm zuvor.
»Sie sind doch noch nicht lange hier, und die Stadt ist Ihnen gewiss fremd, nicht wahr? Ich könnte sie Ihnen zeigen.«
Es war ein verführerisches Angebot, und er brachte es nicht übers Herz, es auszuschlagen.
»Nur zu gerne«, stieß er heiser hervor.
Er ahnte: Wenn er die Stadt durch ihre Augen sah, würde ihm die Kuhscheiße ebenso wenig auffallen wie die heruntergekommenen Häuser. Montevideo würde vielmehr die verheißungsvollste Stadt der Welt sein.
Rosa wusste, dass es klüger gewesen wäre, nach ihrer Befreiung den ursprünglichen Plan umzusetzen, Julio aufzusuchen und mit ihm zu überlegen, wie sie der Heirat mit Ricardo entgehen konnte. Doch ob es nun die Erleichterung nach ausgestandenem Schrecken war, das warme Sonnenlicht, das sie nach der dunklen Schiffshalle als noch belebender empfand, oder die Gesellschaft dieses freundlichen, wenngleich etwas steifen Mannes, der sie nicht wie ein dummes, kleines Mädchen, sondern wie eine Dame behandelte – die Versuchung, das drohende Schicksal für ein paar gestohlene Stunden zu verdrängen und ihre ungewohnte Freiheit auszukosten, war zu groß. Nur allzu bald würde sie wieder die Rosa sein, die von ihrem Vater gegängelt und von den Tanten gemaßregelt wurde – in diesem Augenblick aber wollte sie die erwachsene Rosa sein, die kundige Stadtführerin von Welt, die einem Besucher aus einem fernen Land ihre Stadt zeigte.
Nun ja, genau genommen war es nicht ihre Stadt. Bislang war sie ausschließlich in Begleitung ihrer Familie unterwegs gewesen, und die Straße, die sie nun entlangging, kannte sie nicht einmal. Allerdings ließ sie sich das nicht anmerken, sondern holte tief Luft und begann, alles aufzuzählen, was sie über ihre Heimat wusste.
»Montevideo wurde einst in gleich großen, rechtwinkligen Vierecken angelegt. Die Straßen sind mäßig breit und gepflastert. Na ja«, sie blickte etwas kritisch auf den Boden, »das Pflaster ist denkbar schlecht ...«
Zwischen den ungleichen Steinen wucherte Dreck, und man geriet leicht ins Stolpern. Albert Gothmann achtete jedoch nicht auf das Pflaster, sondern starrte sie hingerissen an.
Rosa errötete und fuhr hastig fort: »Sehen Sie dort – am Rand der Straßen gibt es erhöhte Bürgersteige! Seltsam nur, dass dort kein Mensch geht.«
Möglicherweise lag es daran, dass die Steinplatten, mit denen man diese bedeckt hatte, bei jedem Tritt wankten und zu kippen drohten. Wahrscheinlich war Albert Gothmann viel bessere Wege gewohnt, und sie schämte sich wegen des miserablen Zustands von Montevideos Straßen. Aber dann erreichten sie die Kreuzung von einer der sechs Hauptstraßen und einer der vielen kleinen Gassen, und man sah an beiden Seiten das Meer. Vielleicht lag auch Alberts Heimatstadt Frankfurt am Meer, so genau wusste sie das nicht, doch sie konnte sich nicht vorstellen, dass es einen noch schöneren Anblick als diesen gab, und klatschte in die Hände.
»Sieh nur, wie das Meer funkelt – es ist, als wäre es von Tausenden Diamanten gekrönt!«, rief sie. In ihrer Begeisterung war sie ganz selbstverständlich zum Du übergegangen, und da er keinen Einwand erhob – wahrscheinlich hatte er es wegen seiner mangelhaften Spanischkenntnisse gar nicht bemerkt –, entschied sie, dabei zu bleiben.
Sosehr er von ihr bezaubert war – der Anblick des Meers schien ihn wenig zu interessieren. Stattdessen musterte er die Häuser. »Man sieht der Stadt an, dass sie planmäßig erbaut wurde. Noch vor wenigen Jahrzehnten lebten hier nur einige hundert Soldaten, die sie gegen die Portugiesen aus Brasilien schützten.«
Davon hatte Rosa keine Ahnung, aber das wollte sie nicht zugeben. Hektisch blickte sie sich um und überlegte, womit sie ihn ablenken könnte. »Dort oben ist die Plaza Mayor!«, rief sie. »Wir wollen um die Wette laufen – wer kommt wohl als Erster dort an?«
Anstatt seine Antwort abzuwarten, lief sie los, und so wie vorhin auf der Flucht erwies sie sich erneut als die Schnellere. Es machte ihr so großen Spaß, zu laufen, sie konnte sich nicht erinnern, es je getan zu haben.
Albert hingegen schwitzte, als er endlich ankam. Umständlich kramte er in seiner Tasche nach dem Spitzentaschentuch, um sich die Stirn abzuwischen, und hatte erst dann die Muße, die Kathedrale Matriz zu bewundern. Die Kirche war aus gebrannten Ziegeln errichtet und besaß drei Schiffe: Das mittlere mündete in einer großen Kuppel, über den seitlichen war eine eigene Galerie errichtet worden, vorn an der Fassade zierten zwei schlanke Türme die Ecken – was ohne Zweifel elegant wirkte, aber nicht darüber hinwegsehen ließ, dass die Kirche noch nicht verputzt war. Rosa, die mit ihrer Familie hier sonntäglich den Gottesdienst besuchte, wusste, dass auch im Inneren die Wände heruntergekommen waren und es an jeglichem Prunk fehlte. Da sie das warme Sonnenlicht auf der Haut genoss, scheute sie sich ohnehin, das dunkle Gebäude zu betreten, und sie war froh, dass Albert keine entsprechenden Anstalten machte, sondern sich begnügte, die Kathedrale von außen in Augenschein zu nehmen.
Obwohl er noch nicht hier gewesen zu sein schien, hatte er wohl schon von der Kathedrale Matriz gehört. »Der Bau wurde 1790 begonnen«, dozierte er mit ernster Stimme, »und hat vierzehn Jahre gewährt.«
Gütiger Himmel, wen interessierte das schon? Das war lange, bevor sie geboren worden war! Wahrscheinlich war Ricardo del Monte schon damals auf der Welt gewesen, aber an ihren Bräutigam wollte sie ebenso wenig denken wie an den ursprünglichen Plan, Julio aufzusuchen. Sie drehte sich nach allen Seiten, hielt das Gesicht in die Sonne und jauchzte. Von hier oben konnte man das Meer noch besser sehen. »Wie schön!«, rief sie.
»Eigentlich habe ich auf der langen Reise genug Meerwind abbekommen«, meinte Albert nur.
Rosa hatte keine Ahnung, wie lange die Reise von Europa bis hierher währte. Die Vorstellung, wochenlang auf einem Schiff unterwegs zu sein, machte sie neugierig. »Erzähl mir vom Schiff!«, forderte sie ihn auf. »Hast du Fliegende Fische gesehen? Mein Bruder Julio behauptet, dass es sie gibt.«
Er zuckte die Schultern. »Die meiste Zeit war ich in meiner Kajüte. Ich war etwas seekrank.«
Rosa ließ sich davon nicht abschrecken. »Oh, ich würde so gerne einmal auf einem Schiff reisen! Und ich würde auch einmal so gerne das Landesinnere kennenlernen. Die Menschen behaupten zwar, dass unser Land nicht viel zu bieten hätte, weil es hier weder Berge noch Dschungel gebe. Aber manchmal stelle ich mir vor, wie es ist, einfach loszureiten. Der Wind bläst mir ins Gesicht, meine Zöpfe lösen sich, die Sonne scheint auf mich herab ...« Sie hielt ihr Gesicht kurz mit geschlossenen Augen in die warmen Strahlen. »Nun, den Geruch nach Meer würde ich in der Pampa schon vermissen.« Sie lachte auf. »Komm mit! Sieh nur dort hinten!«
Flugs hatten sie den Platz überquert und die Reste einer alten Mauer erreicht. Sie war nicht sonderlich hoch, und sofort raffte Rosa ihr Kleid, kletterte darauf und balancierte darüber. »Mein Gott, das ist gefährlich!«, rief Albert Gothmann entsetzt.
»Ach was, ich falle schon nicht herunter. Und so hoch ist es auch wieder nicht.« Sie lachte erneut, als sie sein bestürztes Gesicht sah, woraufhin er weiteren Tadel unterließ. Allerdings begann er wieder, mit dieser ernsten Stimme zu dozieren: »Das sind gewiss Ruinen von der ersten Befestigung. Montevideo war immer von einer Mauer umgeben, schon 1726, als die Stadt gegründet wurde – damals noch zum Schutz gegen die Portugiesen. Vor einigen Jahren wurden die übrigen Festungsmauern geschliffen, weil die Stadt für die vielen Bewohner zu klein wurde.«
Rosa achtete nicht auf seine Worte. Warum sprach er ständig über Dinge, die so lange zurücklagen? »Kannst du auch balancieren?«, fragte sie. »Oder hast du Angst, dass du herunterfällst?«
Albert trat näher an die Mauer heran, um sie notfalls aufzufangen, bestieg sie jedoch nicht selbst. »Eigentlich sollten nach der Schleifung der Mauer viele freie Flächen neu bebaut werden. Aber aufgrund der Belagerung durch die Argentinier geht das nur schleppend voran.«
»Aha«, machte Rosa und imitierte seine ernste Miene.
»Nun, scheinbar werden für diese Bauarbeiten die alten Steine wiederverwendet«, fuhr Albert fort. In der Tat arbeiteten nicht weit von ihnen einige Männer, und manche von ihnen kamen näher, um von hier Steine fortzuschleppen, und scheuchten sie fort.
Albert reichte Rosa die Hand, damit sie herunterklettern konnte, doch sie nahm sie nicht, sondern sprang wendig wie eine Katze auf den Boden.
»Vielleicht werden damit nicht nur neue Siedlungen errichtet, sondern auch der Hafen erweitert«, sinnierte er laut. »Meines Wissens gibt es überdies Pläne, das Hauptquartier der Regierung und die Handelssiedlung der Kaufleute auszubauen.«
»Du klingst davon so angetan, als würdest du selbst gleich mitbauen wollen!«
»Das nun doch nicht!«, stritt er ab. »Ich bin hier, um Handelsbeziehungen aufzunehmen und ...«
Er redete eine Weile weiter, aber sie hörte ihm nicht zu. Geld und Waren hatten sie noch nie interessiert.
»Komm doch!«, rief sie und lief wieder die Straße hinunter, die Richtung Meer führte. Er betrachtete voller Interesse die einstöckigen Gebäude, sie betrachtete nicht minder fasziniert die Menschen, die die Stadt bevölkerten.
»Sieh doch nur!«
Sie deutete ungeniert auf eine schwarzfarbige Frau. »Wie lustig sie aussieht! Schau dir nur ihre gekräuselten Haare an!«
»Ich habe gehört, dass es hier – anders als in Brasilien – nicht sehr viele Negersklaven gibt«, erklärte Albert ernsthaft, »und die wenigen arbeiten in den Haushalten in Montevideo, nicht auf den Feldern. Auch die indianische Bevölkerung ist in der Banda Oriental nicht sehr zahlreich. Als die Spanier einst das Land eroberten, trafen sie nur etwa fünftausend an.«
Woher wusste er nur all diese Sachen?
Rosa überlegte, ob sie etwas Geistreiches dazu beitragen konnte. »Espe ist auch die Tochter einer Indianerin«, fiel ihr ein.
»Wer ist Espe?«
»Eigentlich heißt sie Esperanza. Sie ist die einstige Dienerin meiner Mutter, die Frau, die mir geholfen hat, auszureißen.« Albert starrte sie verblüfft an, und Rosa biss sich auf die Lippen. Warum musste sie sich aber auch nur verplappern?
»Du bist ausgerissen? Warum denn?«
Rosa entschied, dass es zu spät war, sich in irgendwelchen Ausflüchten zu ergehen. »Mein Vater will mich dazu zwingen, einen alten Mann zu heiraten ... einen uralten.« Sie verzog angewidert ihr Gesicht. »Es ist einfach so schrecklich! Ich wusste natürlich, dass ich bald heiraten würde, aber ...«
Albert betrachtete sie nachdenklich. »Welchen Mann würdest du denn stattdessen heiraten wollen?«
»Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. In jedem Fall müsste er jünger als Ricardo del Monte sein. Schöner. Und weltmännischer. So wie du. Wenn auch nicht ganz so ernst.« Sie grinste ihn keck an und freute sich, als er errötete und das Lächeln erwiderte. Die Männer, mit denen Julio Geschäfte machte, oder gar Männer wie Ricardo erröteten nie. Sie waren allesamt höflich, aber steif, buckelten vor den Engländern und hassten die Blancos. Rosa fühlte sich von ihnen eingeschüchtert, während sie sich an Alberts Seite ungemein verwegen vorkam.
Während er mit immer röterem Gesicht nach einer Entgegnung suchte, hatte sie schon etwas Neues entdeckt: In der Nähe des Hafens befanden sich mehrere Lokale, wo man rund um kleine Tische auf Korbstühlen im Freien sitzen konnte. Am Abend wurde hier wohl Wein ausgeschenkt – jetzt begnügte man sich mit Matetee.
»Hast du schon einmal Matetee getrunken?«, rief sie eifrig. »Wenn du Land und Leute kennenlernen willst, ist das unverzichtbar. Jeder trinkt hier Matetee in rauen Mengen!«
Wenig später hatten sie Platz genommen und die Bestellung aufgegeben – eine ungemein abenteuerliche Angelegenheit für Rosa, war sie doch mit ihren Tanten nie in einem solchen Etablissement eingekehrt. Dennoch erklärte sie nun besserwisserisch: »Der Matetee wird aus der Gurde getrunken – das ist dieses runde Gefäß –, und zwar mit einem Trinkröhrchen, der Bombilla. Wenn er sich dem Ende zuneigt, musst du den Rest schlürfen, aber insgesamt nur drei Mal, alles andere gilt als unhöflich und wenig vornehm.«
Albert sog an der Bombilla und schrie prompt: »Aua!« Wieder lief sein Gesicht rot an, diesmal nicht aus Verlegenheit. »Das ist doch viel zu heiß!«, fügte er keuchend hinzu.
Rosa lachte: »Dabei verbrennt sich fast jeder Fremde, der die Stadt besucht, den Mund.«
Albert wagte nicht, noch einen Schluck zu nehmen, sondern kramte in seiner Jacke und zog schließlich ein kleines Notizbüchlein hervor. Mit ernster Miene schrieb er etwas hinein.
»Was machst du denn da?«, fragte Rosa neugierig.
»Ich schreibe alles auf, was ich hier erlebe. Und was ich über das Land erfahre.«
Eine Weile sah sie ihm zu, doch je länger er schrieb, desto ungeduldiger wurde sie. Sie neigte sich vor, riss ihm das Buch aus der Hand und fing an, daraus vorzulesen, indem sie seine ernste Stimme imitierte: »Das Gebiet östlich vom Río Uruguay hieß bei den Spaniern Östliche Seite – deswegen nennen sich die Menschen dort ›los Orientales‹. In der Zeit der Kolonialherrschaft nannte man das Gebiet die Vereinigten Provinzen des Río de la Plata – Uruguay war damals noch kein eigener Staat, sondern die Banda Oriental del Uruguay, was so viel heißt wie ›das östliche Ufer des Uruguays‹. Bis heute nennen viele Bewohner ihr Land noch so.«
Rosa blickte auf. »Warum schreibst du denn nicht auf, wie lustig die Negerkrausen aussehen?«
Albert ging nicht darauf ein, sondern streckte die Hand nach seinem Notizbüchlein aus. »Nun gib es mir wieder!«
Rosa lachte, wandte sich zur Seite, so dass er das Büchlein nicht an sich bringen konnte, und las weiter: »Der Name Uruguay kommt aus der Sprache der Guaraní – das ist ein Indianerstamm, der heute noch in Paraguay lebt. ›Guá‹ heißt Ort, ›y‹ heißt Wasser, und ›urú‹ heißt bunter Vogel. Man könnte Uruguay folglich übersetzen mit ›Ort des Wassers des bunten Vogels‹ oder mit ›Fluss der bunten Vögel‹.«
Sie blickte ihn zweifelnd an. »Ich habe hier noch nie viele bunte Vögel gesehen.«
Er zuckte die Schultern. »Ich auch nicht«, gab er zu. Vergebens griff er erneut nach dem Buch. Sie sprang auf, wedelte damit über den Kopf, und einer jähen Eingebung folgend, riss sie eine Seite heraus und zerknüllte sie.
»Was machst du denn da?«, rief er entsetzt.
»Wenn du dieses Land erleben willst, dann musst du die Augen schließen, die Sonne genießen und dir die Geräusche und Gerüche einprägen!«
Er betrachtete sie ebenso verwirrt wie verständnislos.
Sie blickte auf die nächste Seite und las: »Diagonal wird das Land vom Río Negro durchflossen, südlich stößt es aufs Meer und den Río de la Plata, nördlich an den Río Grande Brasiliens und westlich an den Río Uruguay.« Wieder riss sie kurzerhand diese Seite heraus. »Du schreibst über Flüsse, aber siehst nicht, wie das Meer funkelt?«
Er schien protestieren zu wollen, gab es jedoch schließlich seufzend auf, ihr das Büchlein zu entwenden.
»Ich finde es ja durchaus ansprechend, dass die Stadt vom Meer umgeben ist«, murmelte er. »Wobei es, genau betrachtet, nicht das offene Meer, sondern die Mündung des Río de la Plata ist.« Sie vertiefte sich in sein Büchlein, wo die Namen weiterer Flüsse aufgezeichnet waren. »Es heißt, dass es in manchen Flüssen Krokodile gibt«, sagte sie, »aber ich habe noch nie eins gesehen. Du etwa?«
»Gott bewahre! Es sind gefährliche Tiere.«
»Ach, ich würde gerne eines sehen«, lachte sie, ehe sie sich wieder an den Tisch setzte und weiterlas: »Montevideo hieß ursprünglich San Felipe del Puerto de Montevideo. Die Stadt befindet sich auf einer Landzunge, deren Mitte sich buckelartig wölbt. Es gibt zwei Erklärungen, wie die Stadt ihren Namen bekam. Einige behaupteten, dass man sie ursprünglich Monte-vireo nannte, was man im Altspanischen mit ›Grüner Berg‹ übersetzte. Andere behaupten, dass der Name auf Magellan zurückgeht. Der segelte 1520 mit seiner Flotte durch den Río de la Plata und suchte die Durchfahrt zum Pazifik. Stattdessen stieß er auf einen Berg, den er Monte de San Ovidio nannte, woraus später Montevideo wurde. Eigentlich erstaunlich, dass die Stadt nach einem Berg benannt wurde. Im Grunde ist es bestenfalls ein Hügel – ein sehr niedriger ... Gott, davon habe ich ja noch nie gehört! Wer ist denn dieser Magellan?« Sie wartete seine Antwort nicht ab, sondern riss auch dieses Blatt heraus und zerknüllte es.
»Nun lass das doch!«, rief er leicht gequält.





























