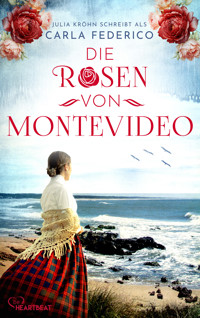4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Chile-Saga
- Sprache: Deutsch
Santiago de Chile 1909: Die beiden jungen Frauen Victoria und Aurelia kämpfen um die Erfüllung ihrer Träume. Aurelia ist eine begabte Malerin und wird bereits als Jahrhunderttalent gefeiert. Doch als der reiche Bankierssohn Tiago sich für sie interessiert, stellt sie ihr Talent hinter ihr Liebesglück. Während Victoria für die Rechte der Frauen und Arbeiter streitet, gerät Aurelias Ehe in Gefahr, denn der beste Freund ihres Mannes setzt alles daran, sie zu verführen. In der Glut der Atacama-Wüste kommt es zum spannenden Finale.
Leidenschaftlich, spannend und gefühlvoll: »Im Schatten des Feuerbaums« bildet den großen Abschluss der Chile-Saga von Bestsellerautorin Julia Kröhn.
Alle drei Bände der Chile-Saga von Carla Federico (Julia Kröhn):
Im Land der Feuerblume
Jenseits von Feuerland
Im Schatten des Feuerbaums
eBooks bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 909
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Prolog
Patagonien 1920
ERSTES BUCH
Die Farben der Freiheit 1909
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
ZWEITES BUCH
Die Farben von Arm und Reich 1909 – 1912
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
DRITTES BUCH
Die Farben der Einsamkeit 1912
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
VIERTES BUCH
Die Farben der Liebe 1920
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Epilog
Patagonien 1920
Personenverzeichnis
Historische Anmerkung
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Santiago de Chile 1909: Die beiden jungen Frauen Victoria und Aurelia kämpfen um die Erfüllung ihrer Träume. Aurelia ist eine begabte Malerin und wird bereits als Jahrhunderttalent gefeiert. Doch als der reiche Bankierssohn Tiago sich für sie interessiert, stellt sie ihr Talent hinter ihr Liebesglück. Während Victoria für die Rechte der Frauen und Arbeiter streitet, gerät Aurelias Ehe in Gefahr, denn der beste Freund ihres Mannes setzt alles daran, sie zu verführen. In der Glut der Atacama-Wüste kommt es zum spannenden Finale.
Leidenschaftlich, spannend und exotisch: Der Abschluss der Chile-Saga von Bestsellerautorin Julia Kröhn.
Julia Kröhn schreibt als
Carla Federico
Prolog
Patagonien 1920
Heulend machte der Wind Jagd auf die Wolken. Dick und weiß hatten sie sich am Himmel zusammengeballt und am Ende des Horizonts leicht bläulich verfärbt. Nun fuhr der Wind durch sie hindurch wie die Hütehunde durch die Schafherde und zerrte so lange an ihnen, bis strahlend blauer Himmel dahinter hervortrat, der nur dann und wann von der Ahnung eines Rostbrauns unterbrochen wurde. Auch als der Tag sich schließlich dem Ende zuneigte, war der Wind nicht bereit, der Nacht zu weichen.
Das Licht wurde trüber, aber Aurelia hörte nicht auf, zu malen. Sie achtete nicht auf ihre flatternde Kleidung, nicht auf Sand und Staub, die ihr ins Gesicht prasselten, nicht darauf, dass die Leinwand – aus gebleichter Guanakohaut gefertigt – vom Rahmen gezerrt zu werden drohte.
Ruhig trug sie Farbe um Farbe auf und malte, was sie sah: die braune Erde, den leuchtenden Feuerbaum, das rote Abendglühen, den sich verdunkelnden Himmel. Die Farbe für Letzteren war aus dem Saft der Calafaten gemacht, blauen Beeren, die süß schmeckten und all jene, die magere Kost gewohnt waren, zu einem Sprichwort verleitet hatten: Wer je diese Beeren gegessen hätte, sei Patagonien verfallen und käme immer wieder zurück. Nicht nur die Farben der Beeren hatte sie der Natur entliehen, die hier karg, wild und widerstandsfähig war, auf einem Fleckchen Erde, das die einen verwunschen und einsam nannten, das für andere aber – so wie sie – ein Sehnsuchtsland war. Auch die Erde schenkte viele Farben, denn nur für den ungeübten Betrachter verhieß sie eintöniges Braun. Für den Maler jedoch gab es in den Schichten des Bodens viele geheime Schätze zu entdecken, sämtliche Nuancen von Ocker, Grün, Grau, Braun und Rot.
Aurelia liebte die Farben und den Geruch, den sie verströmten, und sie liebte die Erde, auf der sie stand, ohne zu wanken. Nicht länger fürchtete sie, diese Erde würde an ihr kleben, würde die Fingernägel verdunkeln und würde für andere nicht Zeichen ihrer Heimatverbundenheit sein, sondern schlichtweg von Dreck und Armut künden. Diese Angst war von den letzten Jahren in Patagonien ebenso verscheucht worden wie die Wolken am Himmel vom Wind.
Nach diesem Himmel, nach dem struppigen Steppengras, nach den violett schimmernden Spitzen der Kordilleren, nach den rötlichen Hügeln und dem sumpfigen Teich in der Ferne malte sie zwei Menschen. Sie standen im Schatten eines Feuerbaums mit leuchtenden Blüten, unter deren Fülle sich die Äste bogen, und ledrig wirkenden, dunkelgrünen Blättern, die im Wind wogten. Da sie nur von hinten zu sehen waren, war nicht zu erahnen, ob sie alt oder jung waren, lächelten oder weinten, zu den Reichen oder zu den Armen gehörten. Einzig die Kleidung verriet, dass sie Mann und Frau waren.
Aurelia hatte viele ähnliche Bilder gefertigt, jüngstens erst hochgelobte Bilder, die manche in die Nähe der naiven Malerei rückten, andere als faszinierendes Beispiel für den Kolonialismus bezeichneten, wieder andere dem Naturalismus zuordneten. Nicht zuletzt wegen der Farben und der Guanakohaut der Leinwand galten sie als einzigartig: Material und Motiv schienen eins zu sein. Fast immer wählte sie das gleiche Motiv – die Weite Patagoniens und zwei Menschen, die inmitten der Landschaft standen, winzig anmutend, weil in diesen Breitengraden die Natur um so viel mächtiger scheint als der Mensch. Die beiden waren ganz allein, aber nicht einsam, denn sie hatten einander, hielten sich an den Händen und liebten sich so sehr, dass sie – für die Dauer, da sie im Wind standen und der sinkenden Sonne zusahen – einander genug waren.
Aurelia trat zurück, nachdem sie das Bild vollendet hatte, und es traten Tränen in ihre Augen – Ausdruck von Schmerz, den diese Liebe in ihr Leben gebracht hatte, und Ausdruck von Dankbarkeit, weil sie diese Liebe erfahren hatte dürfen.
Das Bild verschwamm vor ihren Augen, sie hörte den Wind nicht länger stöhnen.
»Tiago«, murmelte sie. »Tiago ...«
Erst nach einer Weile klärte sich ihr Blick wieder, und sie konnte das Bild etwas nüchterner betrachten. Vielleicht war es das schönste, das sie je gemalt hatte. Ja, die Farben waren so kräftig, verhießen Weite und Wildheit, Liebe und Fruchtbarkeit, Einsamkeit und Freiheit, Luxus und Armut, Glück und Trauer, Gewinn und Verlust. All das hatte sie erfahren, vieles davon überreich, und so wurden aus den Farben des Bildes gleichsam die Farben ihres Lebens.
ERSTES BUCH
Die Farben der Freiheit1909
1. Kapitel
Aurelia hatte keine Hand frei, um sich an der Reling festzuhalten. Mit der einen hielt sie ihre Reisetasche, in der sich neben frischer Kleidung ein wenig Geld und die Fahrkarte für die Rückfahrt befanden, mit der anderen die Mappe, die ihren kostbarsten Schatz barg. Der Wind zerrte daran, blähte obendrein ihr Kleid und drohte den Hut fortzuwehen, dessen Bänder sie am Kinn nur locker zusammengebunden hatte. Noch schlimmer als der Wind war das Gedränge. Sie fürchtete jeden Augenblick zu stolpern und zu fallen. Die Reise von Patagonien nach Valparaíso hatte zwar nur drei Wochen gedauert, doch die meisten Passagiere hatten es so eilig, an Land zu kommen, als wären es Monate gewesen. Aurelia konnte ihre Schritte nicht mehr selbst bestimmen, sondern nur ihren Besitz umklammern, sich irgendwie aufrecht halten und sich treiben lassen.
Zunächst war ihr Blick auf Valparaíso von den vielen Köpfen verstellt, doch nachdem immer mehr Menschen vom Schiff stürmten, wurde es etwas lichter, und sie sah die Stadt, die aus der Ferne betrachtet einem riesigen Amphitheater glich. Häuser schmiegten sich eng an die Bucht, schmale Straßen führten steile Berghänge hinauf, der Ascenso Peral, der Schrägaufzug, ratterte hinauf und hinunter. Aurelia war neugierig, wie es sich anfühlen würde, damit zu fahren. Die Kabine, die herabfuhr, so hieß es, zog mit ihrem Gewicht die andere hinauf, und falls einmal zu wenige Passagiere darin saßen, wurde sie einfach mit Wassertanks beladen.
Die Begeisterung für dieses Wunderwerk der Technik, das es im heimatlichen Patagonien natürlich nicht gab, schwand, als Aurelia die Spuren der Zerstörung sah, die das große Erdbeben von 1906 hinterlassen hatte. Obwohl das drei Jahre her war, lagen noch immer viele Häuser in Trümmern.
Dann hatte sie keine Zeit mehr, die Stadt zu betrachten, sondern musste sich – je näher sie der Rampe kam, die zum Hafen führte – ganz auf ihre nächsten Schritte konzentrieren. Ein Ellbogen rammte sich in ihren Leib, jemand trat ihr auf die Zehen.
»He!«, rief sie empört. Beinahe hätte sie vor Schreck ihre Mappe fallen gelassen und umklammerte sie darum umso heftiger. In der Mappe befanden sich ihre Zeichnungen – einige hatte sie aus Patagonien mitgebracht, andere während der Schiffsfahrt angefertigt, wo sie täglich neue Motive entdeckt hatte. Und wie viel es wohl erst hier in Valparaíso zu zeichnen gäbe!
Trotz des Gedränges überkam sie hitzige Vorfreude, bis sie sich wieder in Gedanken rief, dass eine traurige Pflicht sie hierherführte. Sie seufzte. Natürlich hatte sie großes Mitleid mit Victoria, und es würde nicht leicht sein, ihr Trost zu spenden, dennoch blieb die weite Reise das größte Abenteuer ihres Lebens. Vierundzwanzig Jahre währte dieses, und all die Zeit hatte sie in Patagonien gelebt, wo es nie so viele Menschen wie hier zu sehen gab, nicht dieses weiche, warme Licht, nicht diesen Reichtum an Farben. Der Wind war hier genauso lästig wie dort, und doch, als sie nun die Rampe betrat und auf den schmalen Holzbrettern das Schiff verließ, überkam sie ein Gefühl von Freiheit. Kurz verhießen die vielen drängenden Leiber nicht nur Lärm und Geschäftigkeit, sondern Lebendigkeit und einen neuen Anfang.
Als sie endlich auf festem Boden stand, bebten ihr die Knie. Sie sollte abgeholt werden, aber es war kein Treffpunkt vereinbart worden, und während sie stehen blieb und suchend um sich sah, fiel ihr Blick auf eine Familie. Drei Söhne scharten sich um ihre Eltern, wirkten nicht minder aufgeregt als sie selbst, starrten in sämtliche Richtungen und stellten wissbegierig Fragen zu der Stadt, die man die Perle des Pazifiks nannte. Obwohl sie noch viel kleiner waren, erinnerten die Buben Aurelia an ihre drei Brüder. Wie oft hatte sie sie gezeichnet, und wie gerne würde sie nun auch diese Familie festhalten!
Derart im Anblick der Fremden versunken, merkte sie nicht, dass sie einem Mann im Weg stand. Er versetzte ihr einen schmerzhaften Stoß, als er an ihr vorbeihastete, und anders als bisher konnte sie ihr Gleichgewicht nicht wahren. Sie stolperte, fiel auf die Knie und ließ für einen Augenblick die Tasche fallen. Als sie sich danach bückte, um sie wieder zu ergreifen, rutschte ihr der Hut vom Kopf, und es fielen ihr die langen Haare ins Gesicht – die glatten, schwarzen, glänzenden Haare, die sie von ihrer Mutter Rita, einer halben Mapuche, geerbt hatte. Obwohl sie nichts mehr erkennen konnte, bekam sie die Tasche dennoch zu fassen, aber in diesem Augenblick erfasste sie ein neuerlicher Windstoß und fegte ihr die Mappe mit den Zeichnungen aus der Hand.
»Verflucht!«, schrie sie.
Zart und klein wie ein Mädchen sei sie, spottete ihr Stiefvater Balthasar oft gutmütig, und so hübsch, dass man von ihrem Anblick blind zu werden drohte, aber fluchen könne sie so herzhaft wie ein Mann.
Aurelia schüttelte sich das Haar aus dem Gesicht und sah, dass die Mappe aufgerissen war und die Zeichnungen immer weiter von ihr fortgeweht wurden. Die drei Knaben, die sie beobachtet hatten, deuteten darauf und lachten. Geschwind flitzte sie den Bildern nach, bekam Papier um Papier zu fassen – ein Porträt ihrer Mutter, ein Landschaftsbild von Patagonien, eine Skizze vom Deck des Schiffs. Der Wind schien sie zu necken, ließ sie ganz nahe an weitere Blätter herankommen und wirbelte sie im letzten Augenblick davon. Erst nach einiger Zeit schien ihm das Spiel zu langweilig zu werden, und er ließ von ihnen ab. Als Aurelia endlich alle Zeichnungen eingesammelt hatte, war sie schweißüberströmt. Sie setzte ihren Hut auf, blickte sich um – und erschrak.
Die Angst um ihre Bilder hatte sie so sehr vereinnahmt, dass sie nicht weiter auf ihre Tasche geachtet hatte, und diese lag nun nicht mehr auf dem staubigen Boden des Hafens. Ein Fremder hielt sie an sich gerafft und lief durch die Menge davon.
Wut gleißte wie eine Flamme in ihr auf. Sie achtete weder auf ihre offenen Haare noch den erneut verrutschten Hut, sondern hastete dem Mann hinterher, der sich offenbar sicher genug fühlte, um kurz stehen zu bleiben und die Tasche zu durchwühlen. Eines jener russischen Schimpfworte, die sie von Ana, einer Freundin ihrer Mutter, gelernt hatte, kam Aurelia über die Lippen, und obwohl es im Trubel des Hafens laut war, fühlte der Dieb sich angesprochen. Er hob den Kopf, blickte kurz entgeistert in ihr zornverzerrtes Gesicht und floh dann hastig, indem er sich grob an den Menschen vorbeidrängte, die ihm den Weg verstellten. Aurelia war nicht ganz so grob, aber dennoch so schnell wie er.
Sie wurde blind für die fremde Stadt, sah nur den Mann, ihre Tasche und den Boden unter ihren Füßen. Schon hatten sie den Hafen verlassen und die Planchada erreicht, die schlecht gepflasterte Hauptstraße, die von einer Staubschicht bedeckt war. Etwas weniger Menschen verstellten ihr hier den Weg, stattdessen hielten sie mehrere Fuhrwerke auf, die sie unter den Flüchen der Kutscher umrundete.
Endlich holte sie den Mann ein, umkrallte die Tasche und zog mit aller Macht an ihr. Leider war der Dieb dreister als erwartet. Anstatt sie prompt loszulassen, hielt er die Beute fest und versetzte ihr mit der freien Hand einen Stoß. Als seine Faust sie auf der Brust traf, stockte ihr der Atem. Eben noch war die Wut ihr stärkstes Gefühl gewesen, nun wich sie erst dem Schmerz, dann der Ohnmacht und schließlich einer unliebsamen Erinnerung – der Erinnerung daran, was ihr einst als kleines Mädchen zugestoßen war. Stark, unbesiegbar, selbstsicher hatte sie sich zuvor gefühlt – nach all den Ängsten, die sie dann aber hatte ausstehen müssen, war sie lange Zeit nur ein Schatten ihrer selbst geblieben. Wie gelähmt hatte sie sich damals gefühlt – wie auch in diesem Moment.
Ihr Griff lockerte sich, der Dieb entriss ihr mit einem Ruck die Tasche und rannte davon. Als er sich ein letztes Mal umdrehte, glaubte sie ihn grinsen zu sehen, doch obwohl die Wut nun zurückkehrte und sie drohend die Faust erhob, war sie unfähig, auch nur einen Schritt zu machen.
Der Triumph des Mannes währte allerdings nicht lange. Nach kaum fünf Schritten ragte wie aus dem Nichts eine Hand auf und packte ihn. Sie sah einen Mann, nicht sonderlich groß, aber breit, dann ein Gerangel, bei dem die beiden Körper zu verschmelzen schienen, schließlich eine Faust auf den Dieb eindreschen. Die Tasche entglitt ihm, ehe er zu Boden ging und sich stöhnend wälzte. Es gelang ihm zwar, sich aufzurappeln, aber er versuchte gar nicht erst, die Tasche noch einmal an sich zu bringen, sondern hastete stolpernd davon.
Erst als der fremde Retter in der Not auf sie zutrat, konnte sich Aurelia aus der Starre lösen. Sie war viel zu aufgeregt, um den Mann zu mustern, sondern griff nur hastig nach der Tasche, die er ihr reichte. Die Erinnerungen an das, was ihr als Kind widerfahren war, verblassten.
»Gott sei Dank ...«, stammelte sie.
»Sie sollten besser auf sich achtgeben, Niña. Hier im Hafen gibt es viel übles Gesindel – nach dem großen Erdbeben noch mehr als früher. Ein hübsches Mädchen, ganz allein, gerät schnell in Gefahr ...«
Er redete noch weiter, aber sie hörte ihm nicht mehr zu. Kaum hatte sie die Tasche an sich gepresst, ging ihr auf, dass sie erneut ihre Zeichnungen verloren hatte. Als sie dem Dieb nachgelaufen war, hatte sie die Mappe irgendwo fallen gelassen, und wahrscheinlich hatte der Wind sie abermals in sämtliche Himmelsrichtungen verstreut.
»O nein!«, rief sie entsetzt. Sofort lief sie, ohne sich zu bedanken, in Richtung Hafen los. Sie war noch nicht weit gekommen, als sie inmitten der Menschenmassen einen Mann über ihren Zeichnungen hocken sah. Er hatte sie nicht nur eingesammelt, sondern musterte sie konzentriert und sah auch dann nicht auf, als sie ihn keuchend erreichte.
»Gut ... richtig gut ...«, hörte sie ihn murmeln.
Erst jetzt hob er den Kopf, und ihre Blicke trafen sich. Wieder schien die Welt stillzustehen, diesmal nicht, weil böse Erinnerungen sie quälten und erstarren ließen, sondern weil ein schlichter Gedanke sie überwältigte:
Das ist der schönste Mann, den ich je gesehen habe.
Nicht nur sie stand reglos, auch der Fremde hatte sich erhoben und starrte sie an. Er hielt die Zeichnungen zwar fest umklammert, aber achtete nicht länger auf sie. Vorsichtig machte er einen Schritt auf sie zu und blieb stehen, als würde eine zu abrupte Bewegung die Magie dieses Augenblicks zerstören. Sie wusste, nein, fühlte plötzlich, dass er dasselbe dachte wie sie: Das ist das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe. Wobei es nicht nur ihr beider Aussehen war, was sie für schön befanden, ihre zarte Gestalt und seine schlanke, ihre runden Wangen und seine hohe Stirn, ihr glänzendes, glattes Haar und sein braun gewelltes, ihre kohlschwarzen Augen und seine strahlend blauen. Nein, Schönheit meinte, dass sie noch nie so vollkommen im Anblick eines anderen versunken waren, dass sie das Gefühl hatten, sie wären ganz allein auf der Welt und wären sich selbst genug, um sich für immer geborgen und zu Hause zu fühlen.
Aurelia schluckte rau, kehrte aber für ihr Gefühl viel zu rasch in die Wirklichkeit zurück, als sich ihr Retter neben ihr räusperte. »Geht es Ihnen gut, Niña? Sind Sie verletzt?«
Wie traumwandlerisch drehte sie sich um, um erstmals auch den anderen zu mustern, wenn auch ungleich oberflächlicher. Ob der schön war oder nicht, vermochte sie nicht zu sagen, nur dass er elegant gekleidet war. »Es ist ...«, setzte sie bebend an. Der andere war näher gekommen, und erst jetzt ging ihr auf, dass die beiden sich kannten und gemeinsam unterwegs gewesen waren. »Stell dir vor, Tiago«, rief ihr Retter, »dieser sittenlose Mann wollte doch einfach die Niña bestehlen und ...« Die restlichen Worte versanken in einem Rauschen.
Tiago.
Er hieß Tiago.
Ihre Lippen formten den Namen nach. Während ihr Retter prahlte, wie er den Dieb in die Flucht geschlagen hatte, überreichte Tiago ihr die Zeichnungen. Aurelia nahm sie mit schweißnassen, zitternden Händen entgegen.
»Hast du das gezeichnet?«
Er hatte sie unwillkürlich geduzt – keine Kränkung oder Anmaßung, wie ihr schien, eher eine tiefe Selbstverständlichkeit. Erneut wurde sie blind für die restliche Welt, versank in den Anblick seiner hellen Augen, des Lächelns um den fein geschwungenen Mund, der aristokratischen Nase. Sie musste ihren Kopf in den Nacken legen, um ihm ins Gesicht zu sehen, denn er war um vieles größer als sie.
»Ja, das habe ich ...«, stammelte sie.
Sie brach ab, nicht sicher, ob jemals wieder etwas Vernünftiges aus ihrem Mund kommen würde. »Aber das sind nur ...«, versuchte sie es wieder und konnte den Satz abermals nicht zu Ende bringen.
»Das ist das Beste, was ich seit Langem gesehen habe«, erklärte er, und seine Stimme klang – anders als ihre – fest. »Du hast eine genaue Beobachtungsgabe, aber verlierst dich nicht in unnütze Details. Und die Ölmalereien ... die Art, den Pinsel zu führen, erinnert mich an die großen Impressionisten. Woher hast du nur diese Farben? Selten habe ich so viele Nuancen an Braun- und Gelbtönen wahrgenommen.«
Sie konnte nur lächeln und wäre wohl noch ewig stumm vor ihm stehen geblieben, wenn sich ihr Retter nicht erneut eingemischt hätte. »Tiago, wir müssen nun los. Unser Zug fährt schon in einer Stunde ab ...«
Der Mann hatte ihn am Arm gepackt, um ihn sanft mit sich zu ziehen. Tiago merkte es gar nicht, sondern blieb stehen.
»Du solltest diese Bilder auf der Escuela de Bellas Artes zeigen«, sagte er.
Eben noch war ihr Geist wie ausgehöhlt gewesen. Der Klang dieses Wortes rührte jedoch an einen Traum, den Aurelia seit Jahren hegte. Die Escuela de Bellas Artes war die Kunsthochschule in Chiles Hauptstadt Santiago, dem dortigen Museum angeschlossen und aus der Academia de Pintura hervorgegangen. Ihr Stiefvater hatte ihr davon erzählt, und seit sie das erste Mal gehört hatte, dass es einen Ort gab, wo Menschen nichts anderes taten, als den lieben langen Tag die Malerei oder die Bildhauerei zu erlernen und zu verfeinern, war dies ihr heimlicher, wenn auch unerreichbar scheinender Sehnsuchtsort gewesen.
»Pedro Lira ist im Moment der Leiter«, fuhr Tiago fort, »ich kenne ihn gut, ich kann dafür sorgen, dass du ihm vorgestellt wirst.«
»Tiago ... unser Zug!«
Immer noch ließ er sich von seinem Gefährten nicht zur Eile drängen, sondern blickte sie erwartungsvoll an.
Aurelia rang nach Worten, doch ehe sie etwas sagen konnte – dass sein Angebot sie ungemein freute, aber dass sie doch gewiss nicht gut genug malte, um einen Pedro Lira zu beeindrucken –, hörte sie, wie jemand laut ihren Namen rief. Die Welt – eben noch geschrumpft auf das Plätzchen, auf dem sie mit Tiago stand – wurde wieder groß und laut. Die Stimme klang kreischend.
»Aurelia? Aurelia Hoffmann?«
Ein Mann und eine Frau kamen auf sie zugelaufen – es war die Frau, die kreischte, während der Mann in ihrem Schlepptau ziemlich mürrisch dreinblickte. Das mussten Elvira und Ludwig Kreutz sein, ging Aurelia durch den Kopf. Die beiden führten nach den tragischen Todesfällen die Apotheke von Arthur Hoffmann in Valparaíso und kümmerten sich um Victoria. Aurelia blickte sich um, denn sie hatte erwartet, dass auch diese zum Hafen kommen würde, um sie abzuholen, doch weit und breit war nichts von einem sechzehnjährigen Mädchen zu sehen. »Gott sei Dank!«, stieß Elvira mit ihrer kreischenden Stimme aus. »Endlich haben wir dich gefunden! Diese Menschenmassen sind ja nicht auszuhalten! Und wie siehst du nur aus, Kind?«
Aurelia begriff kurz nicht, was sie meinte, dann fuhren ihre Hände instinktiv zu dem Hut, der nach wie vor verrutscht war, und den offenen Haaren, die wild im Wind wehten.
Elvira packte sie an der Hand. »Komm schnell mit zur Kutsche.«
Drei Schritte folgte sie ihr willig, dann drehte sie sich um und suchte Tiagos Blick. Auch der wurde von seinem ungeduldigen Freund mit sich gezogen. »Der Zug, Tiago, der Zug wartet nicht auf uns!«
Diesmal folgte er ihm, wenn auch widerstrebend, rief ihr jedoch aus der wachsenden Entfernung noch etwas zu: »Deine Bilder! Du solltest sie wirklich jemandem zeigen, der etwas davon versteht ... die Escuela de Bellas Artes ... ich bin selbst dort ...«
Seine Worte wurden vom Lärm übertönt, den Rufen von Lastenträgern, den quietschenden Rädern der Fuhrwerke, dem Rauschen des nahen Ozeans und wieder Elviras kreischender Stimme, als die beklagte, wie lange sie sie hätten suchen müssen. Die vielen Menschen verstellten ihr schließlich den Blick auf Tiagos hochgewachsene Gestalt.
»Warte!«, hätte Aurelia am liebsten gerufen, tat es jedoch nicht. Wie hätte sie dem Ehepaar Kreutz auch ihr Interesse an dem Fremden erklären können, wie den Wunsch, ihn noch so vieles zu fragen, wer er war, wie sein Nachname lautete, warum er etwas von ihren Zeichnungen verstand?
»Gottlob haben wir dich sofort erkannt«, kreischte ihr Elvira ins Ohr. »Nur wenige junge Frauen reisten auf dem Schiff. Ich hielt es ja für keine gute Idee, dass deine Eltern dich ganz allein herschicken, auf einer solch gefahrvollen Reise kann viel Unbill geschehen. Aber nun gut, jetzt bist du hier, und das ist nicht das Schlechteste. Wir machen uns große Sorgen um Victoria. Vielleicht kannst du sie ja endlich zur Vernunft bringen.«
Aurelia stolperte über die unebenen Pflastersteine. Ludwig Kreutz hatte ihr wortlos die Tasche abgenommen, die Mappe mit den Zeichnungen aber umklammerte sie selbst. Sie wurde taub für Elviras anstrengende Stimme, während sie wieder und wieder seinen Namen murmelte.
Tiago ...
Die Fahrt mit der Cerro-Kutsche, die sie zum Haus der Hoffmanns bringen sollte, geriet immer wieder ins Stocken. Im Stadtkern herrschte ähnliches Gewühl wie am Hafen, und während Ludwig Kreutz weiterhin missmutig schwieg, erklärte Elvira nunmehr nicht mit schrillem, sondern beleidigtem Tonfall, dass all jene Horden keine Einheimischen wären, sondern Besucher aus Santiago, die den Sommer am Strand verbracht hatten und nun in die Hauptstadt zurückkehrten. In Viña del Mar würde es dieser Tage hingegen wieder etwas ruhiger werden, die Hoffmanns hätten dort auch ein Chalet besessen, doch weder Emilia oder Arthur noch jetzt Victoria wollten dort leben.
Sie schüttelte den Kopf: Offenbar war alles, was Victoria tat oder eben nicht, ein steter Quell von Ärgernis.
Aurelia musterte das Ehepaar Kreutz eingehender. Ludwig wirkte nicht nur missmutig, sondern mit dem pomadisierten Haar und der eng gebundenen Schleife um den Hals sehr penibel. Wahrscheinlich war er einst darum Apotheker geworden, weil man als solcher jedes noch so kleine Tröpfchen und Körnchen abzuwiegen hatte. Vage erinnerte sie sich daran, wie Victoria bei einem Besuch in Patagonien, der gewiss schon über sechs Jahre zurücklag, über das Ehepaar Kreutz gelästert hatte. »Er ist so steif, als habe er einen Stock geschluckt – und ihre Stimme klingt wie das Quietschen von Rädern, die man zu lange nicht geölt hat.«
Es muss schrecklich für Victoria sein, ihnen jetzt, nach dem Unglück, mit Haut und Haaren ausgeliefert zu sein, ging es Aurelia durch den Kopf.
»Du bist gewiss erschöpft von der langen Reise«, erklärte Elvira eben, doch bevor Aurelia etwas erwidern konnte, wiederholte sie schon die vorherige Beschwerde: dass es eigentlich einer Frau nicht anstünde, ohne Begleitung zu reisen.
»Ich weiß nicht, wie es sich in Patagonien verhält«, erklärte sie schnippisch, »aber hier gilt eine Frau, die allein ausgeht, vor allem bei Nacht, als sehr unehrenhaft.«
Aurelia hielt ihrem vorwurfsvollen Blick ungerührt stand: »Meine Eltern konnten nicht mitkommen. Sie sind schließlich mit der Schafschur beschäftigt.«
Elvira kniff die Lippen zusammen, und in ihren Augen glomm Verachtung auf. Als Apotheker gehörten sie zu Chiles Mittelklasse – Schafzüchter in Patagonien waren in ihren Augen wohl nur einfache Bauern, auf die sie herabsehen konnte. Immerhin überwand sie sich dazu, einzugestehen: »Ich bin froh, dass du hier bist. Ich werde mit Victoria einfach nicht mehr fertig.«
Zum ersten Mal schwieg sie für längere Zeit, und Aurelia beschwor weitere Erinnerungen herauf. Ihre Mutter Rita und Victorias Mutter Emilia hatten sich einst so nahegestanden wie Schwestern. Jahrelang hatten sie die Estancia in Patagonien gemeinsam bewirtschaftet, ehe Emilia den deutschen Apotheker Arthur Hoffmann geheiratet – im Übrigen ein Vetter von Ritas Mann Balthasar – und immer mehr Zeit in Valparaíso verbracht hatte. Der Kontakt der beiden Frauen blieb eng – sie schrieben sich so oft wie möglich, aber zwischen ihren Töchtern hatte kein ähnlich festes Band entstehen können. Von dem letzten Besuch der Hoffmanns war Victoria Aurelia eher unangenehm in Erinnerung geblieben. Sie hatte ständig Fragen gestellt und alles aufmerksam beobachtet, aber über sich selbst so gut wie nichts preisgegeben. Aurelias drei jüngere Brüder Emilio, Arturo und Cornelio schienen ihr irgendwie lästig zu sein, und obwohl Aurelia sie selbst oft Quälgeister nannte, hatte sie Victorias schroffe Art ihnen gegenüber nicht gutgeheißen. Nun, vielleicht lag es daran, dass Victoria selbst keine Geschwister hatte und darum nicht wusste, wie man mit ihnen umgehen sollte. Und ganz gleich, ob sie sie damals gemocht hatte oder nicht – heute tat sie Aurelia vor allem leid. Sie war sofort bereit gewesen, auf Wunsch ihrer Eltern nach Valparaíso zu reisen und sich um Victoria zu kümmern, nachdem sie die traurige Nachricht erreicht hatte.
»Meine Mutter meint, dass Victoria fürs Erste mit mir kommen soll«, erklärte sie, »ich meine, nach Patagonien. Es wäre gewiss eine willkommene Abwechslung.«
Elvira schüttelte entrüstet den Kopf, und Aurelia glaubte schon, dass sie erneut ihre Verachtung für patagonische Schafzüchter bekunden würde. Aber ihr Ärger galt einem anderen Umstand: »Als ob Victoria jemals täte, was man ihr vorschlägt!«
»Es ist doch kein Wunder, wenn Victoria in dieser Zeit etwas ... durcheinander ist«, hielt Aurelia dagegen.
»Wenn es nur die Trauer wäre!«
»Was ist es denn noch?«
Elvira gab keine Antwort, sondern sah hinaus, und Aurelia folgte ihrem Blick.
Wie die meisten deutschen Familien wohnten auch die Hoffmanns in einem großen Haus am Paseo Atkinson, der auf dem Cerro Alegre lag – einem Berghang knapp einhundertfünfzig Meter über Valparaíso, wo die Luft deutlich besser war als in der Tiefebene. Der gegenüberliegende Cerro Concepción dagegen war vorwiegend von den Engländern besiedelt.
Aurelia überlegte schon, ob sie ihre Frage wiederholen sollte, als Elvira plötzlich auf ein Gebäude deutete und wütend ausstieß: »Erst letzten Monat ist sie dort rausgeflogen!«
Das Gebäude war offenbar eine Schule. Noch mehr als über den Rauswurf war Aurelia darüber überrascht, dass Victoria überhaupt eine besuchte. Immerhin war sie schon sechzehn, und Mädchen besuchten ihres Wissens niemals die Oberstufe. »Warum ist sie rausgeflogen?«
»Sie hat es noch nie lange auf einer Schule ausgehalten, weder in der des Ursulinenklosters noch in der Privatschule von Doña Julia Cabezón. Nun bleibt nur noch die staatliche Mädchenschule in Viña del Mar. Aber da leben wir nun mal leider nicht. Ludwig, wir sollten uns wirklich überlegen ...«
Aurelia hörte Elvira nicht länger zu, als diese aufs Neue sämtliche Gründe aufzählte, warum es besser war, in Viña del Mar zu leben und nicht in Valparaíso. Sie selbst hatte nie eine Schule besucht, jedoch von ihrem Stiefvater Balthasar zeichnen und malen gelernt sowie zu schreiben, zu rechnen und wie man Schafe züchtete. In Punta Arenas gab es zwar eine Schule für die Kinder englischer Schafzüchter, aber die Strecke dorthin wäre zu weit gewesen, um sie täglich zurückzulegen. Manchmal hatte sie es bedauert, diese Schule nicht zu besuchen, denn es hieß, man würde dort auch singen und Klavier spielen lernen, und beides hätte sie zu gerne gekonnt. Allerdings war ihr nichts jemals annähernd so wichtig gewesen wie die Malerei, und der hatte sie sich immer hingeben können. Unwillkürlich drückte sie die Mappe mit ihren Bildern an die Brust.
Deine Bilder ...du solltest sie wirklich jemandem zeigen, der etwas davon versteht ... die Escuela de Bellas Artes ...
Sie hörte Tiagos Stimme ganz deutlich in ihrem Ohr, vor allem aber sah sie sein Lächeln vor sich, seine blauen Augen, seine ...
Der Wagen machte einen so abrupten Ruck, dass Aurelia fast nach vorne geschleudert wurde.
»So, wir sind da!«, verkündete Elvira. Noch ehe Aurelia das Haus der Hoffmanns mustern konnte, ja, noch ehe sie überhaupt aus dem Gefährt stieg, kam ihnen eine Frau entgegengestürzt, der weißen Schürze und der adretten Haube nach zu urteilen ein Dienstmädchen oder gar die Haushälterin. Sie hatte ihre Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
»Sie ist schon wieder fort!«, schrie sie aufgeregt.
Elvira und Ludwig seufzten wie aus einem Mund.
Aurelia war sofort klar, dass von Victoria die Rede sein musste.
»Dieses Mädchen treibt mich in den Wahnsinn!«, rief Elvira, und zum ersten Mal sekundierte ihr Ludwig Kreutz: »Wir müssen jetzt andere Saiten aufziehen. Dieses Verhalten können wir uns nicht länger bieten lassen!«
Aurelia gab vor, dass sie müde war und keinen Hunger hatte, und entging so einem Abendessen, in dem Elvira weitere Klagereden führen würde. Stattdessen brachte das Dienstmädchen sie in das Zimmer, das für sie vorbereitet worden war. Sie sah nicht viel vom Haus, weder die Geschäftsräume, in denen sich die Apotheke befand, noch die Küche, das Speisezimmer und Wohnzimmer im Erdgeschoss, sondern nur ihr Schlafzimmer und den Salon im ersten Stock. Sie waren viel größer als die Räume der Estancia in Patagonien, viel eleganter eingerichtet – mit schweren Teppichen, Lüstern und Seidentapeten –, und wirkten dennoch kalt und verwaist.
Aurelia vernahm von unten ein Gemurmel; offenbar diskutierten Elvira und Ludwig darüber, wie sie mit Victorias neuerlichem Verschwinden umgehen sollten. Sie konnte sich aus den Wortfetzen keinen Reim machen, wo Victoria sich wohl gerade aufhielt, und schloss schließlich die Tür, um sich aufs Bett zu legen.
Die Stille, die sie umgab, setzte ihr bald zu. Sie hatte sich selten so einsam gefühlt wie in diesem Augenblick – nicht einmal auf dem Schiff, wo sie zwar nur von Fremden umgeben, wo aber immer etwas los gewesen war. Wie musste sich Victoria in diesem Haus fühlen? So ganz ohne Geschwister! Und nachdem sie ihre Eltern fast gleichzeitig verloren hatte!
Ihr Vater, Arthur Hoffmann, war beim Erdbeben 1906 schwer verletzt worden und hatte sich seitdem nicht mehr erholt. Er konnte kaum laufen, hatte stets unter Schmerzen im Rücken zu leiden, die ihn über Wochen ins Bett zwangen, und erlag schließlich unerwartet einer Lungenentzündung. Nur wenige Wochen nach seinem Tod war Victorias Mutter Emilia an Typhus gestorben. Als der Brief aus Valparaíso eintraf, der die traurigen Nachrichten überbrachte, hatte Aurelia ihre Mutter Rita zum ersten Mal weinen gesehen – und das über Tage. Gleiche Trauer hatte sie eigentlich in diesem Haus erwartet, doch Elvira und Ludwig waren nur voller Ärger über Victoria, und Victoria selbst ... wo war Victoria?
Jemand klopfte, und Aurelia fuhr auf. Doch es war nur das Hausmädchen, das etwas zu essen gebracht hatte, ein Stück Kuchen und ein Glas Portwein.
»Wohin genau ist Victoria eigentlich gegangen?«, fragte Aurelia.
Das Mädchen wich der Frage aus. »Wenn sie diesmal heimkommt, wird es gewiss eine ordentliche Strafe setzen«, erklärte sie nicht ohne Befriedigung.
Aurelia war noch verwirrter, aber geistesgegenwärtig genug, um das Mädchen zu fragen, welches der Zimmer das von Victoria sei. Die gab ihr freimütig Auskunft, wobei Aurelia nicht sicher war, warum. Weil sie sie für vertrauenswürdig hielt? Oder weil sie sich Victoria gegenüber nicht zu Verschwiegenheit verpflichtet fühlte?
Hastig aß Aurelia ihren Kuchen und nahm einen Schluck von dem Wein, der ihr heiß ins Gesicht stieg. Dann trat sie auf den Gang, vernahm von unten immer noch Gemurmel und öffnete schließlich die Tür zu Victorias Zimmer. Auch dieser Raum war sehr elegant eingerichtet. Vor den großen, hohen Fenstern hingen schwere, purpurfarbene Vorhänge. Kunstvolle Schnitzereien schmückten das breite Himmelbett und ein Schränkchen daneben, auf dem Fotografien standen. Aurelia musterte sie neugierig, erkannte Arthur und Emilia, aber auch ihre Mutter Rita und ihren Stiefvater Balthasar.
Was ihre Aufmerksamkeit jedoch ungleich mehr anzog, waren die vielen Bücher im Zimmer. Sie standen nicht nur in Regalen, sondern lagen übereinandergestapelt auf dem Schreibtisch – und es waren mehr, als Aurelia je auf einem Fleck gesehen hatte. Auf der Estancia gab es Geschäftsbücher, einige englische Romane und die Missionarszeitschriften, mehr aber nicht.
Nicht nur wegen der vielen Bücher herrschte auf dem Schreibtisch Unordnung. Auch viele Briefe lagen durcheinander. Aurelia wollte nicht neugierig sein, aber las dennoch die Zeile von einem. »Sehr aufschlussreich, was man darin zum Krankheitsbild erfährt.«
Aurelia runzelte die Stirn, umso mehr, als sie den Namen der Absenderin sah: eine Nora van Sweeten aus Hamburg. Wer das wohl war? Und vor allem: Von welcher Krankheit war da die Rede?
Gleich neben dem Brief lag ein Buch mit schwerem, jedoch abgegriffenem Ledereinband. Es musste oft gelesen worden sein. Aurelia schlug es auf und las einen Absatz, den sie kaum verstand: »An die zuerst abgelagerte tuberculöse Materie schließt allmählich von außen mehr und mehr Tuberkelstoff an; der Tuberkel wächst durch Apposition von außen, und auf diese Weise entstehen aus Tuberkelmolekülen nach und nach größere, aus concentrisch aneinander gelegten Schichten bestehende Tuberkelmassen.«
Offenbar war es ein medizinisches Fachbuch, und in dieser Abhandlung ging es um eine gefürchtete Krankheit, die Lungenkrankheit oder Schwindsucht, an der so viele Menschen starben. Aber warum las Victoria so ein Buch? Ihre Mutter war doch an Typhus gestorben, nicht an Schwindsucht! War sie womöglich selber krank? Aber dann wären Elvira und Ludwig Kreutz doch nicht so böse auf sie!
Aurelia sah sich weitere Bücher an. Eines davon schien nicht das Geringste mit Krankheiten zu tun zu haben. Der Autor hieß John Stuart Mill, das Buch selbst trug den merkwürdigen Titel Die Hörigkeit der Frau, und übersetzt worden war es von einer gewissen Martina Barros. Ein weiterer Brief lag daneben – offenbar einer, den Victoria geschrieben, aber bis jetzt noch nicht fertiggestellt und abgesendet hatte: Ich habe Mill nun endlich gelesen, und ich verstehe, warum sein Buch als die Bibel der Frauenbewegung gilt, denn ...
Aurelia zuckte zusammen und blickte hoch. Ein Luftzug hatte sie erfasst und wirbelte ihre Haare durcheinander. Sie hörte ein Knacksen der schweren Eichendielen, rechnete damit, von Elvira ertappt worden zu sein, und überlegte, wie sie sich dafür rechtfertigen sollte, dass sie heimlich in Victorias Sachen stöberte. Aber als sie zur Tür sah, stellte sie fest, dass diese verschlossen war und folglich niemand die Treppe hochgekommen war. Wer immer das Zimmer betreten hatte, hatte es durchs Fenster getan und stand nun hinter ihr. Ehe sie sich umdrehen konnte, legte sich eine Hand auf Aurelias Mund. »Psst!«, ertönte es mahnend. »Keinen Mucks!«
2. Kapitel
Aurelia erstarrte. Der Schrecken überlief sie eisig kalt. Unwillkürlich fühlte sie sich an den Dieb erinnert, der heute ihre Tasche gestohlen und sie dabei unsanft zurückgestoßen hatte. Allerdings fiel dieser Griff nicht so brutal aus. Schon löste sich die fremde Hand von ihrem Mund.
Aurelia fuhr herum. »Bist du verrückt, mich so zu erschrecken?«, brach es aus ihr heraus.
»Pst«, machte Victoria wieder. »Ich bin eigens die Efeuleiter hochgeklettert, damit Elvira und Ludwig mich nicht sehen. Soll diese Mühe umsonst gewesen sein?«
Ein Efeublatt hatte sich in ihrem Haar verfangen, ansonsten aber saß die Frisur perfekt. Diese hatte nichts Kindliches, Jugendliches an sich: Die Haare waren in der Mitte gescheitelt und im Nacken zu einem festen Knoten geflochten worden. Sehr streng mutete das an – ein Eindruck, der vom schwarzen, etwas unförmigen Kleid, das Victoria trug, noch unterstrichen wurde. Aurelia trug selbst meist schlichte Kleidung – auf der Estancia war es vor allem wichtig, sich praktisch zu kleiden. Aber sie hatte erwartet, dass die Tochter eines wohlhabenden Apothekers ein elegantes Kleid tragen würde, aus Seide, Musselin oder gar Samt. Insgeheim hatte sie sich sogar erhofft, hier in Valparaíso vielleicht einmal selbst in das Kleid einer feinen Frau schlüpfen zu können, aber von Victoria war eine solche Leihgabe wohl nicht zu erhoffen.
Aurelia musterte ihr Gesicht, stellte fest, dass sie sich seit ihrer letzten Begegnung sehr verändert hatte, und fand nicht viele Ähnlichkeiten mit ihren Eltern. Beide hatten sie blondes Haar und helle Augen gehabt – Victorias Haar dagegen war von einem matten Braunton, und die Augen hatten die Farbe der Haselnuss. Ihre Haut war blass, nur auf der Nase saßen ein paar kecke Sommersprossen.
Victoria, die ihren wachen Blick erst erwidert hatte, drehte sich nun um und deutete auf die Bücher und Briefe auf ihrem Schreibtisch: »Hast du darin gelesen?«
Aurelia errötete. »Es tut mir leid, ich wollte nicht indiskret sein, aber da du nicht da warst und ich nicht wusste, ob ...«
»Oh, ich bin froh, dass du lesen kannst!«, unterbrach Victoria sie erfreut. »So viele Chilenen können es nicht, höchstens ein Drittel der Bevölkerung, denk dir das. Dabei ist das Vermögen, zu lesen und zu schreiben, der erste Schritt der Frau in die Freiheit.«
Aurelia begriff nicht recht, was sie meinte. »Wo bist du gewesen?«, fragte sie schließlich.
»Ich komme gerade aus der Armensiedlung und habe Brot verteilt«, antwortete Victoria bereitwillig. »Der Bäckerjunge, ein Deutscher wie mein Vater, ist manchmal sehr großzügig. Er hat heute gleich drei Laibe Schwarzbrot gespendet.« Victoria verdrehte die Augen – ein Zeichen, dass ihre Worte nicht ernst, sondern ironisch gemeint waren und sie drei Laibe für eine lächerlich geringe Gabe hielt. »Nun, man muss nehmen, was man kriegt. Die Empanadera in der Quebrada de Elias gibt auch manchmal was ab – alle Empanadas nämlich, die verbrannt sind und die man der feinen Kundschaft nicht vorsetzen kann.« Als sie das Wort »fein« aussprach, zog sie ihre rechte Augenbraue spöttisch nach oben. »Aber seit meine Eltern tot sind, ist es schwieriger geworden – Essen zu bekommen, meine ich. Die meisten rücken nichts raus. Und schon gar nicht Elvira und Ludwig! Ich meine, unsere Speisekammern sind prall gefüllt, und trotzdem können sie nicht auf den kleinsten Brotkrumen verzichten.«
Sie sprach in gleichem Tonfall vom Tod ihrer Eltern wie von den gespendeten Nahrungsmitteln – sehr nüchtern, fast gleichgültig. Ihre Stimme war nicht laut, aber eindringlich.
Nachdem sie geendet hatte, senkte sich kurz Schweigen über die beiden. Aurelia ging auf, dass sie sich nicht einmal ordentlich begrüßt hatten, doch Victoria schien nicht sonderlich daran interessiert zu sein und fragte auch nicht, wie ihre weite Reise verlaufen war. Sie wandte sich ab und blickte nachdenklich aus dem Fenster.
»Meine Eltern«, setzte Aurelia an, »meine Eltern schicken dir ihre besten Grüße. Und sie möchten dich gerne einladen, nach Patagonien zu kommen, um dort ...«
Abrupt drehte sich Victoria um. »Ich muss noch einmal weg«, erklärte sie schroff.
Aurelia trat neben ihr ans Fenster. Sie befanden sich zwar nur im ersten Stock, aber wenn die Efeuleiter, die Victoria hochgeklettert war, brach und man in die Tiefe stürzte, konnte man sich sicher schlimme Verletzungen zufügen.
»Noch einmal weg?«, wiederholte sie fassungslos.
Victoria stützte sich aufs Fensterbrett. »Ich bringe nicht nur Essen in die Armensiedlung, sondern auch Medikamente. Auch das ist viel schwieriger geworden, seit Elvira und Ludwig meine Vormünder sind. Meine Eltern haben immer bereitwillig ihre Arzneien verteilt.«
»Elvira war sehr wütend, dass du das Haus verlassen hast!«, gab Aurelia zu bedenken.
Wieder zog Victoria ihre rechte Augenbraue hoch. »Gewiss doch!«, stieß sie voller Spott aus. »Sie hatte eine klare Vorstellung, wie Wohltätigkeit auszusehen hat. Nie würde sie den Armen und Kranken zu nahe kommen. Das Äußerste, zu dem sie sich aufraffen kann, ist, an den Basaren der deutschen Kolonie teilzunehmen. Der Erlös wird gespendet, und ich sage ja nicht, dass wir ihn nicht brauchen können. Aber dieser Basar findet nur viermal im Jahr statt, und die Armen brauchen viel öfter Zuwendungen! Sie leben in Zeltstädten, weißt du – all die Menschen, die beim großen Erdbeben ihre Häuser verloren und die nicht genügend Geld haben, sie wieder aufzubauen.«
Sie lehnte sich aus dem Fenster, blickte nach rechts und links, um zu sehen, ob sie beobachtet wurde.
»Du willst tatsächlich wieder da runterklettern?«
»Ich bin verabredet – am Denkmal des Arturo Prat. Dort treffe ich einen Mittelsmann, der die Medikamente in die Siedlung bringen wird.«
»Und woher bekommst du die Medikamente?«
»Genau das ist das Problem. Elvira und Ludwig lassen mich nicht mehr in die Apotheke meiner Eltern, weil sie behaupten, dass ich stehlen würde. Stehlen, du lieber Himmel! Sie ist doch mein künftiges Erbe. Wie dumm, dass ich zu jung bin, es anzutreten. Aber da gibt es einen Arzt im deutschen Hospital. Es liegt gleich am Ende der Straße, und manchmal überlässt er mir etwas Medizin.«
Aurelia trat unruhig von einem Fuß auf den anderen und wusste nicht, was sie tun sollte. Victoria davon abhalten, aus dem Fenster zu klettern? Oder wieder den Wunsch ihrer Eltern aussprechen, sie nach Patagonien zu bringen?
Sie ahnte, dass ihr eine schwere Aufgabe bevorstand, und entschied, vorerst lieber auf Victoria einzugehen, anstatt das eigene Anliegen vorzubringen. »Um welche Medikamente handelt es sich denn?«
»Vor allem Tuberkulin. Robert Koch hat es erfunden. Es heißt, es sei das einzige Medikament, das Tuberkelbazillen aufzuhalten imstande ist, man nennt es auch das Koch’sche Präparat. Ich bin mir ja nicht so sicher, ob es wirkt. Andere Ärzte übrigens auch nicht. Hier an der Deutschen Klinik forscht Eduard Theodor von Schröder nach einer neuen Behandlungsmethode, aber noch hat er keine gefunden, und bis dahin müssen wir eben das Koch’sche Präparat verteilen. Immerhin ist die Krankheit nun frühzeitig erkennbar, seit letztes Jahr die intrakutane Tuberkulinprobe erfunden wurde.«
Sie sprach die vielen Fremdwörter ganz selbstverständlich aus, als hätte sie sich ihr Leben lang mit nichts anderem als Krankheiten und Behandlungsmethoden beschäftigt. Aurelia war mit ihren vierundzwanzig Jahren acht Jahre älter als Victoria – aber als diese so ernsthaft sprach, hatte sie den Eindruck, es wäre umgekehrt. Dass sie immer wieder von den Schulen geflogen war, lag ganz offensichtlich nicht an fehlendem Intellekt oder mangelnder Lernbereitschaft, sondern an ihrem Charakter.
»Du weißt sehr viel«, stellte sie fest. »Aber woher hast du denn all diese Bücher?«
»Der Deutsche Verein hat einst in der Calle Blanco einen großen Lesesaal mit in- und ausländischen Journalen, deutschen, spanischen und französischen Klassikern eröffnet. Dort habe ich viel Zeit verbracht. Leider gibt es dort kaum medizinische oder politische Schriften. Die schickt mir Nora van Sweeten aus Hamburg, sie gehört irgendwie zur Familie meines Vaters, ich weiß auch nicht, auf welche Weise. Sie arbeitet in einem Krankenhaus, und das würde ich auch so gerne tun.«
Sie seufzte sehnsüchtig, und der Glanz, der in ihren Augen erschien, nahm ihr kurz alle Strenge.
»Aber du sollst doch mit mir nach Patagonien kommen ...«, warf Aurelia unsicher ein.
Victoria überhörte es geflissentlich. »Elvira und Ludwig ist es eigentlich egal, was ich tue. Sie haben nur Angst, dass ich das Erbe meiner Eltern verschwende – das wollen sie bis zu meiner Volljährigkeit lieber selbst tun. Widerwärtige Menschen! Pah!« Ihr Körper schüttelte sich vor Verachtung. Abermals beugte sie sich weit aus dem Fenster. »Das Problem ist nur, dass sie mich im Moment suchen. Hörst du? Ludwig fragt gerade den Nachtwächter, der die öffentlichen Lichter anzündet, ob er mich gesehen hat.«
Aurelia beugte sich ebenfalls aus dem Fenster. Sie sah in der Ferne schemenhafte Gestalten, konnte aber nichts von dem verstehen, was dort unten gesprochen wurde. Der Abend war schnell gekommen. Das Meer, das man vorhin noch in der Ferne hatte glitzern sehen, war nur mehr ein schwarzer Streifen, der sich kaum vom grauen Himmel abhob.
»Verdammt!«, fluchte Victoria. »Ich kann heute nicht mehr raus!«
Aurelia seufzte erleichtert. Sie hätte sich äußerst unwohl gefühlt, Victoria dabei zuzusehen, wie sie auf halsbrecherische Weise die Hausmauer hinunterkletterte.
»In meinem Zimmer habe ich noch etwas Kuchen und Portwein«, sagte sie, »ich meine – falls du noch Hunger hast.«
Einmal mehr ging Victoria gar nicht erst auf ihre Worte ein. »Kannst du es nicht für mich machen?«, fragte sie.
»Was?«
»Nun, was schon? Die Medikamente abholen und zum Treffpunkt bringen. Ich beschreibe dir auch ganz genau, wie du dorthin findest.«
Aurelia riss die Augen auf. »Bist du verrückt?«, entfuhr es ihr heftig.
Victoria musterte sie abfällig. »Du bist doch in Patagonien aufgewachsen, oder nicht? Meine Mutter sagte immer, dass nur starke Frauen den starken Wind dort überleben. Alle anderen würden umgeweht werden. Also wirst du wohl hier runterklettern und einen Botengang erledigen können. Oder bist du etwa feige?«
Die spöttische Frage packte Aurelia an ihrem Ehrgeiz. Dass sie feige wäre, hatte ihr noch nie jemand vorgeworfen. Gewiss, seit dem schrecklichen Erlebnis als Kind, als ihr leiblicher Vater sie entführt und mehrere Wochen gefangen gehalten hatte, um ihre Mutter zu erpressen, hatte sie sich nicht mehr so stark und unbesiegbar wie einst gefühlt. Aber sie hatte doch immer mit den jüngeren Brüdern mithalten können, wenn es darum ging, widerborstige Schafe festzuhalten, um sie zu scheren, oder schnell wie der Wind durch die Steppe zu reiten. Arturo, Emilio und Cornelio würden ohne Zögern nach unten klettern – warum sollte sie es nicht können?
»Ich mache es«, willigte sie ein, um streng hinzuzufügen: »Aber hinterher unterhalten wir uns darüber, wie es nun weitergeht und ob du mit mir nach Patagonien kommst.«
Victoria sagte nichts dazu, sondern erklärte ihr nur, wie sie erst zum Krankenhaus und dann zum Denkmal des Arturo Prat kommen würde.
Als Aurelia sich aufs Fensterbrett schwang, wurde sie blass. Eine falsche Bewegung – und sie würde sich den Hals brechen. Allerdings spürte sie, wie Victoria nur darauf wartete, dass sie zögerte – und auch wenn ihre Knie zitterten: Niemals würde sie sich vor der so viel Jüngeren die Blöße geben, zu kneifen.
Victoria blickte Aurelia nach. Ihr erster Eindruck, den sie von ihr gehabt hatte – dass sie etwas zu ängstlich, vorsichtig, gehorsam war –, wich einer gewissen Anerkennung. Sie kletterte geschickter nach unten, als sich vermuten ließ, obwohl sie so klein und zart war. Damals, bei ihrem Besuch in Patagonien vor sechs Jahren, hatte Victoria noch zu ihr aufgesehen – nicht nur, weil Aurelia körperlich größer, sondern weil sie die Ältere war, die mehr vom Leben, insbesondere in dieser windigen Einöde, verstand –, aber das hatte sich inzwischen geändert.
Victoria schüttelte den Kopf. Mit den Erinnerungen an die Aurelia von einst erwachte auch jene an ihre Eltern, die damals in Patagonien so glücklich gewesen waren, Rita und Balthasar wiederzusehen. Rasch vertrieb Victoria das aufsteigende Bild von den beiden, wie sie lachten und redeten, indem sie zu ihrem Schreibtisch trat und ihre Bücher und Briefe ordnete. Alsbald fand sie nichts mehr zu tun – und das war ein höchst ungewohnter Zustand für sie: Sie tat eigentlich immer irgendetwas. Nur zu warten, lag ihr nicht. Sie blickte nach draußen auf den nachtschwarzen Himmel, hörte jedoch nichts – weder die Stimmen von Elvira oder Ludwig noch Schritte, die von Aurelias Wiederkehr kündeten.
Hoffentlich ging alles gut.
Sie zögerte kurz, schlich dann erst in den Gang und schließlich in Aurelias Zimmer. Wie es aussah, war sie mit einfachem Gepäck gereist: Auf einem Stuhl lag eine Tasche, auf dem kleinen Tischchen eine Mappe. Wieder zögerte sie – denn eigentlich hasste sie nichts mehr, als wenn Elvira in ihr Zimmer kam und ihre Sachen durchwühlte. Allerdings hatte Aurelia auch die Briefe von Nora van Sweeten gelesen, und Victoria hatte zudem schon eine Ahnung, was sich in der Mappe befand.
Sie wurde nicht enttäuscht. Noch zu gut konnte sie sich daran erinnern, dass Aurelia damals in Patagonien bei jeder Gelegenheit gezeichnet hatte. Ihr selbst lag es nicht, für irgendetwas lange stillzusitzen, höchstens zum Lesen, aber Aurelia war glücklich, wenn sie ihren Kohlestift in der Hand hielt. Einige der Bilder, die Victoria durchblätterte, waren mit einem solchen gezeichnet und zeigten, wie sich ihre Technik und Beobachtungsgabe verfeinert hatten. Andere waren mit ganz besonderen Farben gemalt worden – keine Wasser- oder Ölfarben, wie Victoria vermutete, sondern jene Erdfarben, mit denen Aurelias Mutter Rita die Schafwolle färbte oder die Stoffe, die sie daraus webte, bedruckte. Es waren kräftige Brauntöne darunter, aber auch zarte Pastellfarben, Kohlschwarz und lichtes Blau. Da Erde unmöglich blau sein konnte, musste sie diesen Farbton auf andere Weise gewonnen haben, vielleicht aus Beeren oder Blumen. So oder so waren die Bilder faszinierend anzuschauen, fingen sie doch einerseits das sturmumtoste Patagonien vortrefflich ein und verfremdeten die Landschaft aufgrund des originellen Pinselstrichs zugleich ein wenig, so als wäre sie ein Traumgebilde, das sich jederzeit auflösen konnte. Victoria hatte sich in Patagonien nicht sonderlich wohlgefühlt, doch diese Bilder weckten ihre Sehnsucht nach einem Ort der Stille und Einsamkeit und Weite. Ein Ort, wo sie sich der Trauer um die Eltern hingeben, aber auch neue Kraft schöpfen konnte ...
»Ach, hier bist du!«
Sie fuhr herum und sah, dass Aurelia zurückgekommen war – ihre offenen Haare fielen noch wirrer über den Rücken als vorhin, das Gesicht war gerötet, ihre Augen blitzten stolz. »Ich habe getan, was du gesagt hast«, erklärte sie mit hörbarem Triumph, »als ich das Paket mit den Medikamenten abgeholt habe, war der Arzt zwar misstrauisch, aber als ich ihn angelächelt habe, hat er mir geglaubt, dass du mich geschickt hast.«
Victoria runzelte ihre Stirn – für gewöhnlich verabscheute sie Frauen, die allein auf die Macht ihres Lächelns und ihrer Schönheit setzten. Allerdings konnte sie Aurelia kaum vorwerfen, alles getan zu haben, um ihren Auftrag zu erfüllen.
»Und zum Treffpunkt beim Denkmal von Arturo Prat habe ich auch gefunden. Der Mann war schon dort, ich habe ihm die Medikamente übergeben, und ...«, sie atmete tief durch, »... und jetzt müssen wir endlich darüber reden, ob du mit nach Patagonien kommst!«
Victoria unterdrückte ein Seufzen. Anstatt etwas zu erwidern, vertiefte sie sich wieder in Aurelias Zeichnungen. »Die sind wirklich gut«, stellte sie fest.
Aurelia trat zu ihr und nahm ihr sanft die Mappe aus den Händen. »Das hat heute schon jemand gesagt«, sagte sie leise.
»Dann hatte er recht. Du solltest Malerei studieren.«
»Studieren? Ich?«
Aurelia blickte sie zweifelnd an – und für gewöhnlich verachtete Victoria auch diesen Ausdruck bei Frauen. »Als ob du nicht weißt, dass du gut bist!«, zischte sie.
Aurelia schwieg betroffen und zuckte hilflos die Schultern.
»Kennst du Pablo Burchard?«, fragte Victoria unvermittelt. »Das ist ein bekannter Maler in Valparaíso, und er war ein guter Bekannter unserer Familie. Er hat ein Ferienhaus in Quintero am Meer und hat sich häufig dorthin zurückgezogen, um zu malen. Wobei er eigentlich immer und überall gemalt hat. Mein Vater hat sich oft darüber lustig gemacht, dass er mitten auf einer Bahnstrecke ausstieg, weil ihn ein bestimmtes Motiv fesselte, und dass er bei der Rückfahrt dann mehrmals den falschen Zug nahm.«
Wehmut stieg in ihr auf, als sie an ihren Vater dachte, der sie stets zum Lachen gebracht hatte – nicht nur, indem er Anekdoten wie diese erzählte, sondern verschiedene Späße mit ihr trieb. »Nun, wie auch immer«, fuhr sie rasch und nüchtern fort, »Pablo Burchard gehört zu den Gründern der Kunstakademie in Santiago. Dort unterrichtet er auch.«
»Die Escuela de Bellas Artes«, sagte Aurelia, und ihre Stimme klang ehrfürchtig. »Die von Pedro Lira geleitet wird. Aber ich bin doch nur ...«
Victoria verdrehte die Augen, weil sie ahnte, was kommen würde. »Du bist doch nur eine Frau, willst du sagen?«, unterbrach sie sie scharf. »Na und? Maria Rotzoll war auch eine Frau, und als sie sich an Pablo Burchard wandte, weil sie Kunst studieren wollte, hat er sofort ihr Talent erkannt und sie aufgenommen. Im Übrigen ...« Victoria zögerte kurz, weil sie nicht sicher war, ob sie ihre Pläne verraten sollte, fuhr dann jedoch entschlossen fort: »Im Übrigen kannst du mich gerne nach Santiago begleiten.«
Aurelia blickte sie entsetzt an. »Dich begleiten? Nach Santiago? Ach, ich ... wir ... wir sollten doch nach Patagonien gehen. Meine Eltern wünschen sich das so.«
Victoria machte eine unwirsche Handbewegung. »Jemand wie ich passt dort gewiss nicht hin.«
»Jemand wie du?«
Wieder zögerte Victoria, sich ihr anzuvertrauen, aber dann überwog nach all den Wochen, da sie Ludwigs und Elviras langweiliger Gesellschaft ausgeliefert war, das Bedürfnis, mit jemandem über ihre Pläne zu reden. »Ich bin Feministin«, erklärte sie stolz.
Aurelias eben noch erschrockener Blick wurde verwirrt. »Was ist denn das?«, fragte sie.
Victoria verdrehte abermals die Augen. Sie wandte sich leicht von ihr ab, ehe sie zu dozieren begann: »Das ist ein Begriff, der aus Frankreich kommt. Alle Frauen bezeichnen sich so, die überzeugt sind, dass unser Geschlecht die gleichen intellektuellen Fähigkeiten wie die Männer hat, überdies das Recht und die Fähigkeit, am öffentlichen Leben und in der Politik teilzunehmen, und nicht zuletzt das Recht und die Fähigkeit, einen Beruf auszuüben und damit Geld zu verdienen.«
Sie wandte sich Aurelia wieder zu. In deren Gesicht zeichnete sich nicht sonderlich viel Verständnis ab. »Und was hat das damit zu tun, dass du mich nicht nach Patagonien begleiten willst?«, fragte sie skeptisch.
Victoria ballte ungeduldig ihre Hände zu Fäusten. »Nun, ich will einen Beruf erlernen und eigenes Geld verdienen. Hier in Valparaíso bin ich von Elvira und Ludwig abhängig, in Patagonien wäre ich es wiederum von deinen Eltern. Aber ich will auf eigenen Füßen stehen – und das werde ich. Nämlich in Santiago. Also – kommst du mit?«
Speicheltröpfchen sprühten von ihrem Mund, so eindringlich und hitzig redete sie auf Aurelia ein. Diese war zwar unwillkürlich zurückgewichen, aber Victoria entging das Funkeln in ihren Augen nicht. Der Gedanke an Santiago schien sie ein wenig zu beängstigen ... aber noch mehr zu faszinieren.
Vielleicht kann man doch etwas aus ihr machen, dachte sie.
»Das klingt ziemlich verrückt!«, stieß Aurelia schließlich aus.
»Wenn du meinst«, sagte Victoria gedehnt.
»Welchen Beruf willst du denn überhaupt erlernen?«
»Irgendeinen, bei dem ich mich für arme Menschen einsetzen und gegen die vielen Missstände unserer Gesellschaft kämpfen kann. Ich bin nämlich Sozialistin.«
»Ich dachte, du wärst Feministin?«
Victoria seufzte. »Das eine schließt das andere doch nicht aus! In einer gerechten Gesellschaft wird das Vermögen zwischen Arm und Reich besser verteilt, aber auch die Rechte und Pflichten zwischen den Geschlechtern, und ...«
Victoria spürte, wie Aurelias Gedanken abschweiften. »Ich sehe schon«, stellte sie grimmig fest, »davon hast du keine Ahnung. Aber immerhin bist du gut im Malen. Und könntest besser werden, wenn du dein Leben nicht bei den Schafen in der Pampa verbringst.«
Aurelia senkte ihren Blick, weswegen Victoria sich diesmal nicht sicher war, ob er begeistert funkelte oder gekränkt war.
Ehe sie noch etwas hinzufügen konnte, hörte man das Knarren der Eichendielen.
»Victoria?«, ertönte Elviras kreischende Stimme. »Bist du da?« Victoria trat hastig von der Tür weg und sah sich nach einem geeigneten Versteck um. »Kannst du sie irgendwie anlügen?«, zischte sie panisch. »Ich ertrage diese Frau heute nicht mehr.« Aurelia hob ihren Blick. Nicht länger standen Skepsis oder Begeisterung darin, nur gleicher Triumph wie vorhin, als Victoria schon einmal ihrer Dienste bedurft hatte. »Aber natürlich helfe ich dir!«, erklärte sie und setzte dann jenes Lächeln auf, mit dem sie wohl vorhin im Krankenhaus den Arzt für sich gewonnen hatte.
Aurelia war todmüde, aber sie konnte trotzdem nicht schlafen. Zu viel war heute geschehen, was ihr nun durch den Kopf ging, die Begegnung mit Tiago, das Wiedersehen mit Victoria ... Ob diese wohl auch noch wach im Bett lag?
Aurelia hatte keine Ahnung, wie es in ihr aussah. Sie hatte erwartet, sie in tiefer Trauer vorzufinden, doch sie sprach von ihren Eltern genauso nüchtern wie von allem anderen. Als Aurelia sie vorhin gefragt hatte, ob sie beim Tod ihrer Mutter dabei gewesen wäre, hatte sie ein ausdrucksloses Gesicht aufgesetzt und sachlich erklärt, dass es in der Deutschen Klinik in Valparaíso zwar eine Spezialabteilung für Typhusinfektionen gab, die erste und einzige des Landes, aber dass für ihre Mutter trotzdem jede Hilfe zu spät gekommen wäre. Sie hatte die Schulter gezuckt und dann hinzugefügt: »Es gibt hier auch die erste Frauenabteilung. Und hier ist auch erstmals in Chile eine Operation der akuten Appendizitis vorgenommen worden.«
Aurelia wälzte sich im Bett. Sie wusste nicht, was eine Appendizitis war, und noch weniger wusste sie, was Victoria hinter der kühlen Fassade verbarg. Sie ahnte, dass es mehr war als bloß feministische und politische Fakten, aber dass es schwer sein würde, zu ihr durchzudringen. Noch schwerer war zu entscheiden, was sie tun sollte – darauf zu bestehen, dass sie mit ihr nach Patagonien kam, oder ihr nach Santiago zu folgen ...
Sie hatte keine Entscheidung getroffen, als sie doch noch der Schlaf überwältigte, begleitet von wirren Träumen und häufigem Aufschrecken. Als sie wieder einmal erwachte, schmerzte der Kopf, es schmeckte säuerlich in ihrem Mund – und Victoria hockte an ihrer Bettkante.
Mit einem Schrei fuhr Aurelia hoch. Ihr Blick ging zum Fenster, noch floss kein Morgengrauen durch die Ritzen.
Im ersten Moment dachte sie, Victoria fühlte sich einsam und suchte nach Gesellschaft. Doch dann erkannte sie, dass diese sich nicht zu ihr ins Bett legen, sondern sie vielmehr selbst daraus ziehen wollte. Ihre Haare waren wieder streng frisiert – und sie trug das gleiche schwarze Kleid wie gestern.
»Los!«, befahl sie. »Wenn du nicht erneut die Efeuleiter nach unten klettern willst, ist jetzt die beste Gelegenheit, das Haus unbemerkt zu verlassen.«
Aurelia rieb sich schlaftrunken die Augen. »Was hast du denn vor?«
»Ich habe dir doch gestern von meinen Plänen erzählt.«
»Du willst heute schon aufbrechen? Nach Santiago?«
»Wohin denn sonst? Worauf sollte ich denn noch warten?«
»Aber ...«
»Im Übrigen lebt eine Freundin meiner Mutter in Santiago ... Wir können bei ihr wohnen – und von dort kannst du deinen Eltern einen Brief schreiben und ihnen alles erklären. Und fürs Erste habe ich ein wenig Geld aus der Kasse der Apotheke genommen.«
Aurelia war sich sicher, dass Elvira und Ludwig nichts davon wussten. Gott, was sollte sie tun?
Sie zog die Decke vor ihr Gesicht, als müsse sie sich schützen – vor einer fremden Welt, in der es zwar viel zu entdecken, aber ebenso viele Bedrohungen gab, vor allem jedoch auch vor Menschen wie Victoria, die ihr Leben planten, als gelte es, eine Rechenaufgabe zu lösen, und keinerlei Gefühle wie Angst oder Vorsicht erkennen ließen. Sie konnte sie doch nicht begleiten? Oder konnte sie doch?
»Santiago ...«, murmelte sie, und plötzlich dachte sie nicht an eine große, fremde, gefährliche Stadt, sondern an Tiago, der wie diese Stadt hieß, und an die Escuela de Bellas Artes, wo man den ganzen Tag malte. Sie dachte auch an Patagonien, die Schafe, den Wind – und anders als während der Reise überkam sie kein Heimweh, sondern ein Gefühl von Langeweile. Welche Motive gab es dort auch schon, die sie noch nicht gemalt hatte!
Zögerlich schob sie die Decke zurück und erhob sich.
»Nun beeil dich!«, drängte Victoria.
Aurelia fuhr sich durch die Haare und flocht sie dann schnell zu Zöpfen – ungleichmäßig und schief. Sie schlüpfte in ihre Kleidung und nahm ihre Mappe. Ihre Hände zitterten.
Ein Fehler ... vielleicht machte sie einen schrecklichen Fehler.
»Wie weit ist es überhaupt bis Santiago?«
Den Namen der Stadt auszusprechen, fühlte sich trotz aller Bedenken gut an.