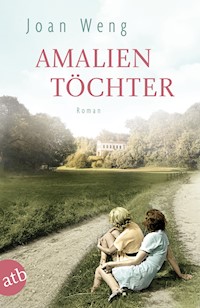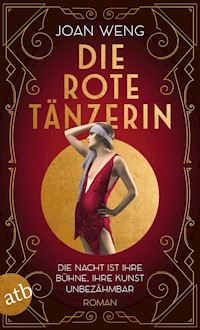
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die wildeste Frau der Goldenen Zwanziger.
Sommer 1925: Anita Berber ist das Phänomen ihrer Zeit. Sie tanzt nackt auf den Bühnen der Weimarer Republik, betört die Massen mit ihrer Schönheit und Extravaganz. Doch dann ist sie nach einer Reihe Eskapaden und Skandalen in den Varietés, in denen sie einst Erfolge feierte, nicht mehr willkommen. Von nun an tanzt sie nur noch vor leeren Rängen und droht, sich in Erinnerungen an ein vergangenes Leben zu verlieren. In der Gefahr, bereits in Vergessenheit zu geraten, begegnet sie einem noch recht unbekannten Maler: Otto Dix.
„Joan Weng erweckt die Goldenen Zwanziger zu neuem Leben.“ Stuttgarter Zeitung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Anita Berber – die wildeste Ikone der Goldenen Zwanziger. Ihre Auftritte auf den Bühnen und Leinwänden der Weimarer Republik ziehen das vergnügungssüchtige Publikum in die Varietés und die Kinosäle, ihre skandalumwitterten Affären mit Männern wie Frauen füllen die Klatschblätter. Doch 1925 hat sie den Zenit ihrer Karriere längst überschritten. In dritter Ehe unglücklich verheiratet, von Geldsorgen und Süchten geplagt, tanzt Anita vor leeren Rängen und droht, sich in Erinnerungen an ein anderes Leben zu verlieren. Doch dann begegnet sie dem aufstrebenden Maler Otto Dix. Ist sein Porträt ihre letzte Chance auf Unsterblichkeit? Oder vielleicht sogar auf Glück?
Über Joan Weng
Joan Weng, geboren 1984, studierte Germanistik und Geschichte und promoviert über die Literatur der Weimarer Republik.
Im Aufbau Taschenbuch sind ihre Romane »Amalientöchter«, »Das Café unter den Linden«, »Die Frauen vom Savignyplatz« und »Die Damen vom Pariser Platz« sowie die Kriminalromane »Feine Leute« und »Noble Gesellschaft« lieferbar.
Mehr zur Autorin unter www.joanweng.de
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Joan Weng
Die rote Tänzerin
Die Nacht ist ihre Bühne, ihre Kunst unbezähmbar
Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
1923
Frühling 1925
1910
Frühling 1925
Februar 1916
1925
1922
Sommer 1925
Kairo, Herbst 1925
November 1928
Nachwort
Danksagung
Erläuterungen
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für meine Männer
1923
Nackte Weiber! Nackt bis auf die Haut!
So hatte es ihm der Schlepper auf der Münsinger Straße zugeraunt, vertraulich, freundschaftlich fast, so als teile man ein Geheimnis oder habe zumindest Seite an Seite mit der Fresse im französischen Matsch gelegen.
Das war Masche und nicht mal originell. Warum war er darauf reingefallen und hierhergekommen?
»Die weiße Maus« bot ihm nichts, was er nicht schon tausendmal erlebt hatte. Stickige, tabakgesättigte Luft, von einem mattglänzenden Deckenventilator gleichermaßen mühsam wie vergeblich verquirlt, auf sündig gedimmtes Licht, Ausländer, zum Überlaufen voll mit Devisen und gepanschtem Sekt. Und dazu Weiber, halb nackt im Publikum und auf der Bühne ganz. Nichts, was er gerade nicht überall zu sehen bekam. Mit dem Laub waren auch die Kleider gefallen.
Das klang nett, aber es stimmte nicht, Schamlosigkeit war nicht erst seit Herbst in Mode. Außerdem war Otto kein Dichter.
Er war Maler.
Und als solchem gingen ihm momentan die Motive flöten. Niemand schockierte sich heute noch an einer Hure bei der Morgentoilette, die Zeiten, dass man ihm dafür den Prozess hatte machen wollen, waren vermutlich bald vorbei.
Wen interessierte das heute noch, wenn man schon für einen lächerlichen Betrag wie 10 Milliarden die Frau eines Oberlehrers haben konnte? Eine anständige, schamhafte Frau, vor Krieg und Inflation als Jungfrau in die Ehe gegangen. Noch mal ein Milliönchen obendrauf, da rezitierte der Gatte einem dabei was aus der Ilias. Die Beamten, die traf es am härtesten, deren Gehälter hinkten dem Dollarkurs immer ein paar Wochen, wenn nicht Monate hinterher.
»Was möchte der Herr trinken?« Der Kellner war noch keine vierzehn. Die rundlichen Bubenwangen waren mit Kohlenstaub auf hager geschminkt, und mit der Pomade im Haar und in dem eleganten Abendanzug sah er aus wie ein verdorbener Konfirmand. Ob seine Eltern davon wussten? Ob es sie interessierte, ob es sie überhaupt gab? Vielleicht waren sie ja froh?
Allemal besser als auf der Lindenpassage, und bestimmt war die Bezahlung auch üppiger. Strichjungen gab es so viele, französische Liebe kriegte man schon für 5 Millionen. Mit Pennälermütze war es aber teurer, was zu einem schwunghaften Handel mit Schuluniformen geführt haben sollte.
»So is dat eben in Berlin!«, schallte es von der Bühne, und die Töne waren so unsauber, wie Otto sich die Füße der Sängerin vorstellte. Von anderen Körperregionen mal ganz abgesehen. Grässlich, am liebsten würde er einfach gehen. Nach Hause, zum Mutzli und der kleinen Nelly. So ein Wunder, alle beide. Seine Frauen. Wie rein der Hals eines Neugeborenen duftete. Es müsste ein Wort dafür geben. Vielleicht gab es das sogar, nur kannte er es nicht. Er war ja kein gebildeter Mensch.
»What would you like for drink?«, erkundigte sich der verdorbene Konfirmand nun mit einem Akzent, der vielleicht amerikanisch klingen sollte.
Ottos ausbleibende Reaktion hatte ihn wohl zu der Hoffnung verführt, hier säßen ausländische Devisen. So ganz abwegig war der Gedanke nicht, denn Ottos Anzug war makellos, der schwarze Lack seiner Schuhe glänzte wie der Potsdamer Platz bei Regen, und die blonden Haare trug er tatsächlich nach amerikanischem Vorbild streng zurückgebürstet.
Mein Jimmy, mein Dandy, so neckte das Mutzli ihn manchmal, aber nur ein bisschen und mit diesem lieben Glitzern in den Augen, sie wusste um seine Schwächen. Und im Übrigen waren es auch die ihren.
»Wu desire?«, fragte der Junge nun schon weniger enthusiastisch, denn Franzosen hatten den Ruf, beim Trinkgeld zu knickern. Und die Huren, die erzählten sich auch so Geschichten, was diese Franzosen von einem Mädchen für Schweinkram wollten – und beim Preis immer ein Geschacher, als käm’s heut noch auf eine Milliarde mehr oder weniger an.
Otto aber zögerte noch immer. Wenn er etwas bestellte, müsste er bleiben. Und er hatte weder Geld noch Zeit zu verschwenden. Da war es wieder, dieses Gefühl. Das hatte er schon gehabt, als ihn der Schlepper auf der Münsinger Straße angesprochen hatte.
So ein Gefühl wie an der Front, wenn alles noch ruhig war und man doch spürte: Das gibt Kattun. Da war etwas, ein elektrisches Knistern der Luft, ein unterschwelliger Misston, wie das Surren einer Mücke. Otto war, als könne er diesen Ton tatsächlich wahrnehmen, heraushören aus dem treibenden Jazz der Kapelle, aus dem dröhnenden Gelächter der besoffenen Spekulanten und dem gezierten Gekicher der Huren.
Er ließ seinen Blick schweifen, suchend. Die Gäste trugen Samtmasken, der neuste Clou und so sinnlos wie ein Markstück, denn jeden Moment lüftete jemand die seine, tupfte sich Schweiß von Wangen und Stirn. Auch waren die Augen frei, und die waren es doch, die die Menschen verrieten.
Der breitgebaute Rotschopf am Nachbartisch, der zum Beispiel war geschäftlich hier. Natürlich verstand Otto nicht, was er auf seine elegante Begleiterin im ausländischen Pelz einredete, aber ein Flirt war das nicht, auch wenn die Schönheit das vermutlich glaubte. Der Rotschopf, der hatte Frau und Kinder daheim, letztes Jahr noch, da war er Herr über ein Sparbuch und in leitender Position gewesen. Alles futsch, alles kaputt, und nicht mal ein originelles Motiv gab er ab.
Auch die beiden Männer im Maßanzug, die schon wieder nach Champagner verlangten, jeder zwei Girls neben sich, auf sich, alle grimmig zum Amüsemang entschlossen und dabei ein Blick, als ging’s in den Graben. Die Jahre im Krieg, all die verlorenen Tage und Stunden, die mussten sie nun wieder reinholen, diese knickerigen Zählmeister ihrer eigenen Lebenszeit.
Trotzdem kein Motiv für Otto, das überließ er Grosz.
Die Luft zum Schneiden, der Saal voll besetzt.
Was sollte Otto hier? Warum ging er nicht nach Hause, zu Frau und Kind? Was suchte er?
Er konnte doch den Krieg malen, seine Alpträume und Schreckensvisionen, die gingen ihm so schnell nicht aus, da hatte er Vorrat. Oder sollte er ein Kinderbuch machen? Da hatte er Ideen, jetzt, seit er dem Würmchen Abend für Abend ins staunende Gesicht erzählte.
Und wenn alle Stricke rissen, dann wurden sie eben doch Profitänzer, das hatten das Mutzli und er sich schon so halb fest vorgenommen gehabt, sogar bereits mit Werbebildern. Warum auch nicht, gut genug waren sie allemal.
Was also suchte er? Hier in dieser Kaschemme?
»Wenn Sie nichts trinken wollen, dann müssen Sie gehen«, versetzte der verdorbene Konfirmand nun überhaupt nicht mehr freundlich und auch nicht weltmännisch. Um seine Worte zu unterstreichen, drehte er sich schon halb weg, wandte sich in Richtung eines Gorillas im zu kleinen Stangenanzug. Der stand bisher an der Tür zur Garderobe, schien ganz versunken in das Kneten seiner einmal zu oft gebrochenen Nase, nun aber kam Leben in die massige Gestalt, genüsslich kugelte er die Schultern nach hinten. Fast war Otto, als könne er die Nähte krachen hören. Diese überwachen Sinne, die waren ein Andenken an den Krieg, die bekam man gratis dazu, genau wie die Alpträume und den Ekel vor Bratenduft.
»Also?«, fragte der Ober, und Otto bestimmte kurz entschlossen: »Einen Sekt«, ergänzte dann ein wenig zu hastig: »Glas, nicht Flasche.«
Aus hübschen, schwarz umkohlten Veilchenaugen sah ihn der Konfirmand einen Moment abschätzig an, die helle Stirn schien sich krausen zu wollen, dann zischte er halblaut: »Wenn Se nach der nächsten Nummer abziehen, bring ich Ihnen für 100 Millionen Soda mit Schnaps. Ist ein Sonderpreis, und dafür machen Se mich den Tisch frei.«
»Wer kommt als Nächstes?«, fragte Otto unsicher. Nachdem der Bengel ihn sowieso für arm hielt, konnte er ihn auch für dumm halten, da kam es nicht mehr drauf an.
»Na, die Berber!«
Wie konnte ein Mensch so unwissend sein? Jetzt lag ein kaum verhohlenes Mitleid in dem auf hart geschminkten Bubengesicht. Vor dem Krieg, vor der Inflation, da hatten nur kleine Brüder solche Blicke abbekommen – halb stolze Überlegenheit, halb Unglaube. Fast schien der Bub ihm ein Lächeln schenken zu wollen, aber so weit ging es nicht. Wer umsonst lächelte, verlor eine Einnahmequelle.
»Die Berber, das ist unser Zugpferd, und es ist ihr erster Auftritt heute Abend. Entre nu, der erste ist immer der beste. Also ick meine, für enen netten Herrn wie Sie. Vor dem Krieg hätten se so eine weggesperrt, das sagt mein Vater immer.« Er hatte also einen, sogar einen mit konservativer Meinung. In vertraulichem Ton fuhr der Konfirmand fort: »Nach Mitternacht gibt’s meistens Bambule. Letzte Woche, da hat sie einem aufs Gedeck gepisst. War kein schöner Anblick. Is einfach ’ne Topsau, die Berber.«
Otto wollte nicken, doch dann ließ er es. Das Gefühl, der Misston, hielt ihn davon ab. Immer wollte Otto alles sehen, alles erleben, notfalls ersterben. Die Berber, dieses Eitergeschwür Berlins, dieser Dämon, dieser Nachtalp jedes sittsamen Bürgers – die, nein das, das musste er sehen. Deshalb also war er hergekommen!
Das war ein Motiv!
»Bringen Sie mir Champagner! Große Flasche, und die anderen Gedecke weg, es kommt niemand mehr«, wies Otto den verblüfften Kellner an und knallte ihm gleich einen ganzen Stapel druckfrischer Millionen auf das Marmortischchen. Eigentlich hätte er damit noch drei Tage auskommen müssen, sein Zugticket nach Hause, nach Düsseldorf, galt erst ab Freitag. Egal, er würde durchkommen, war ja immer durchgekommen.
Wenn er schon fern von Mutzli und Nelly die Nacht verjagte, dann durfte er nicht aus kleinlicher Sparsamkeit das ersehnte Wild vor der Nase wegspringen lassen. Trotzdem, ganz wohl war ihm nicht.
Doch schon hatte der Kellner das Geld geschnappt, das Dämmerlicht noch einmal gedämpft, und die Kapelle holperte unelegant aus dem treibenden Jazz hinein in eine schwüle Tangomelodie. Gespannte, fast andächtige Stille trat ein und dann plötzlich, unmelodisch, schmerzhaft wie ein unerwarteter Schlag in den Magen, eine schrill aufwimmernde Geige.
Da war sie, mit einem Raubkatzensatz mitten auf die Bühne war sie da, übergangslos, unmittelbar.
Und sie tanzte.
Tanzte, als sei sie durch reinen Zufall auf diese Bühne getaumelt, tanzte, als gäbe es keine Scheinwerfer, kein gierig gaffendes Publikum, nur sie und die Musik, eins waren sie und doch nicht, verbunden und doch zwei, wie Mutter und Neugeborenes an der Nabelschnur.
Eine Geburt.
Wie im Wahn wirbelte die Gestalt dort im Licht, drehte sich wie toll im Kreis und immer weiter im Kreis, von bunter Seide umflattert, die Haut weiß gekalkt, das Haar karmesinrot gefärbt. Das Saxophon kam kaum hinterher, und das Publikum? Es gab keine Zuschauer mehr, keine Ausländer, keine Schieber, Spekulanten, Huren, nur noch ein Augenpaar, fest auf die Tänzerin gerichtet, nur einen einzigen stoßweise gehenden Atem, nur noch einen Wunsch: zu besitzen! Dieses in seiner Freiheit, seiner Unabhängigkeit so freche Wesen! Die Zähne hineinzuschlagen, die Nägel und … o ja.
Otto schüttelte den Kopf, griff gierig nach der vollen Champagnerflöte – wann war sie gebracht worden? –, trank hastig, füllte nach, trank noch ein Glas. Schüttelte abermals den Kopf. Heiße Wangen hatte er, nicht wegen der drückend dampfenden Hitze und nicht vom Alkohol. Vor Scham. Solche Gedanken! Noch ein Glas.
Das Zucken, das Drehen, das Wirbeln, das Kreischen der Geigen, es raste dem Höhepunkt entgegen, und dann mitten im Sprung brach die Wilde zusammen, stürzte haltlos zu Boden, auf die dreckige Bühne, blieb leblos liegen, wie tot.
Langsam kam wieder Leben ins Publikum, die andächtige Stille begann zu bröckeln, manche klatschten, unsicher, verschämt. Durfte man das? In der Kirche, im Kreißsaal, auf dem Friedhof, da klatschte man nicht.
Der Zauberbann begann zu verfliegen – zurück blieb kaum zu unterdrückende Wut. Eine kindische Wut darüber, dieses Geschöpf dort nicht haben, nicht besitzen zu können. Die Ersten, die Betrunkeneren, fingen schon an, Schlüpfrigkeiten zu zischen, lauter und lauter wurden sie, schon füllte ein zorniges Grölen den Saal, doch Otto hörte es nicht mehr, sah nicht mehr, wie die Frau auf der Bühne ihr feucht glänzendes Gesicht hob, Schmutz und Zigarettenstummel im zerzausten Haar und im Blick die Angst des tödlich getroffenen Tieres.
Schon war er aufgesprungen, mit polternd umstürzendem Stuhl und unter Zurücklassung einer viertel vollen Flasche Champagner. Nur weg! Nur Flucht.
Nie war er geflohen, der Frontsoldat, nicht in Russland, nicht in Frankreich, nun aber floh er. Das dort, diese Frau, das war kein Motiv!
Das war Gefahr.
Frühling 1925
Na, die Berber natürlich.«
Ihr Name. Ein Granateinschlag direkt neben seinen Füßen, beiläufig in das Frühstücksidyll geschleudert.
Lichtflecken auf der weißen Tischdecke, Narzissen in einer grünen Pressglasvase, Brötchenduft, Kaffeegeschmack und Mutzli, morgenschön zerzaust im blauen Seidenkimono. Und er plötzlich zitternd. Die Berber, natürlich.
»Im ›Ballhaus Jungmühle‹, wie gesagt. Hier steht, es gibt noch Restkarten an der Abendkasse.«
Otto nickte und wollte nach seinen Zigaretten greifen, hielt jedoch inne, nahm stattdessen einen Schluck Kaffee. Echter Bohnenkaffee, schwarz und stark, keine Milch, kein Zucker. Was für ein Genuss nach all den Jahren Bucheckern und Karlsbader Kaffeegewürz. Ziemlich lange hielt er sich die Tasse an die Lippen, so als wollte er gleich noch einmal trinken. Zeit gewinnen. Sich klar werden, warum sein Herz ihm bis zum Hals schlug. Albern war das. Um nicht zu sagen lächerlich. Sich derart anzustellen. Als Nächstes bekam er noch Nervenfieber wie so ein verwöhntes Junkerknäblein.
»Ich würde die Berber einfach schrecklich gerne einmal sehen. Es geht doch nicht an, die Dämonin für eine Vorstellung in Düsseldorf, und wir gehen nicht hin!« Ihre hellen Wangen röteten sich freudig. »Ach, stell dir bloß vor: Mutz und Toy machen die Nacht unsicher. Wie in alten Zeiten. Ich werde gleich das Kindermädchen instruieren. Nelly wird das schon irgendwie aushalten. Da müssen Kinder halt durch.«
Otto nickte und bemühte sich um ein Lächeln, aber eigentlich zog er nur die Mundwinkel in Richtung Ohren.
»Wirklich kaum zu fassen, dass wir die Berber noch nie gesehen haben. Gerade du! Das wäre doch ein wundervolles Motiv? Vielleicht sitzt sie dir Modell für ein Porträt.«
Warum erschreckte ihn der Gedanke derart?
Diese Frau, diese Anita Berber.
Damals, 1923 in Berlin, hatte er irgendwann in seinem schäbigen Hotelzimmer gelegen, kaum wissend, wie er dort nur wieder hingekommen war, am ganzen Körper zitternd und in kaltem Schweiß gebadet, von wirren Träumen, von Fieberphantasien gepeinigt. Und kaum zurück, hatte er gemalt wie besessen, den Krieg und immer wieder den Krieg. Den Krieg und seinen Frieden, seine Mutzli. Seine schöne Frau, sein Liebstes.
Und jetzt wieder diese Frau, diese Anita Berber.
Das war doch lächerlich.
Das in Berlin, das war vermutlich einfach eine körperliche Reaktion auf gepanschten Sekt gewesen. Die verschnitten das Zeug doch mit allem, was sie bekamen. Man konnte froh sein, wenn man hinterher nicht blind war. Das hatte er sich schon oft gesagt, und er sagte es sich nun wieder, aber sehen wollte er dieses grauenvolle Geschöpf trotzdem nicht.
»Weißt du, was mir meine Schwester gestern erzählt hat?«, plapperte das Mutzli indessen munter weiter, ganz vertieft in Vorfreude und Frühstücksgenuss. »Ich habe keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt, aber meine Schwester hat es von ihrem Friseur, und der ist wiederum der Bruder des Mannes, der dem Scheidungsanwalt der Berber die Haare schneidet. Die Faktenlage ist also eindeutig und gesichert.«
Krumen spritzend biss sie in ein Milchbrötchen, sah ihn mit glänzenden Mandelaugen verschmitzt an. Kauend fuhr sie fort: »Also, es muss bei ihrer letzten oder vorletzten Scheidung gewesen sein. Keine Ahnung, wie oft die verheiratet war, aber bei einer ihrer Scheidungen jedenfalls, da hatte sie einen Anwaltstermin. Und weil die Berber nie pünktlich erscheint, sagt ihr das Tippfräulein an der Rezeption immer, sie solle schon zwei Stunden früher kommen.«
»Wenn man sich öfters scheiden lässt, dann kennt einen der Anwalt schon. Vielleicht gibt’s sogar Stammkundinnenrabatt?« Otto grinste ein bisschen stolz auf sich. Und auf seine Frau, wie leger sie über Scheidungen sprechen konnte, dabei war die vom Mutzli kein Zuckerschlecken gewesen, ganz egal, wie freundschaftlich Hans nun immer tat. Und ihre Kinder mit Hans, die sagten jetzt Frau Tante Martha zum Mutzli, wenn sie sie überhaupt mal sehen durfte. Heute Morgen jedoch war Mutz weit entfernt von derartiger Trübsal, in aufgekratzter Frühlingslaune gab sie ihm recht: »Genau, der Anwalt, der weiß schon Bescheid. Sie hat immer den 15-Uhr-Termin, das kann sie sich wohl gut merken, da kommt sie immer gleich nach dem Aufstehen.«
Otto lachte anerkennend und erstaunt, für ihn war das Bohèmeleben weitgehend vorbei. Mit Frau und Kind und halbwegs gesicherten Einkünften, da schlief man an wilden Tagen bis halb neun.
»Aber das ist noch gar nicht die Geschichte!«, strahlte Mutzli und griff über den Tisch nach seinen Händen. Rührend freute sie sich an dem schönen Klatsch. »Also stell dir vor, einmal, da wurde es 15 Uhr, die Berber kam nicht, es wurde 16 Uhr, die Berber kam nicht, dann, um halb fünf, geht plötzlich die Tür auf, und sie steht da. Groß zurechtgemacht, weiß gepudert, mit schwarzem Schleierhut und blutroten Lippen. Vor allem aber in einem Nerz, einem riesigen, bis zum Boden reichenden Mantel. So einem dicken Nerz, wie ihn nur sagenhaft schlanke Frauen tragen können. Ich, ich säh darin aus wie ein Eisbär vorm Winterschlaf.« Darauf biss sie gleich noch mal beherzt ins Brötchen, sprach Krumen verteilend weiter. »Also der Kanzleibursche, der nimmt der Berber den Mantel ab, und stell dir vor, darunter, darunter trägt sie nichts!« Sie kaute vergnügt. »Nichts außer Strumpfgürtel und Strümpfe. Nackt, wie Gott sie schuf! Einen Moment waren alle völlig schockiert, der Friseur meinte, man hätte eine Stecknadel fallen hören können, so still war es. Und dann hat die Berber plötzlich begonnen zu weinen, richtig geschluchzt hat sie, die ganze Schminke ist ihr zerlaufen. Und alle haben versucht, sie zu trösten, und der Anwalt hat beteuert, das könne ja jedem einmal passieren, und weißt du, was sie da gesagt hat? ›Sie verstehen nicht, in meiner Kostümjacke ist doch meine Tabatiere! Ich habe jetzt keine Zigaretten. Wie soll ich den Tag ohne meine Tabatiere überstehen?‹, hat sie gesagt!«
Das Mutzli lachte breit und laut, und Otto tat es ihr gleich, sagte halb tadelnd, halb anerkennend: »Also das ist wirklich eine Topsau.«
»Und wir, wir sehen die heute Abend. Nicht wahr, Toy, du glaubst auch, dass es klappt. Nicht wahr, du glaubst ganz fest daran?«
Und weil Otto zu den Menschen gehörte, die immer das Schlimmste erwarteten, konnte er mit Bestimmtheit sagen: »Ja, das klappt.«
* * *
Frau Leopold gehörte zu den Menschen, die wussten, dass am Ende immer alles gut würde. Und war es noch nicht gut, dann war es nicht das Ende.
Sie selbst war der Beweis, dachte sie, wie sie so im lindgrünen Aprillicht in ihrer Küche stand. Es roch nach warmer Milch, nach Karlsbader Kaffeegewürz, nach Haferflockenbrei mit geriebenem Winterapfel, nach Seife und ein bisschen nach Babyspucke.
Bis zum Ellenbogen steckten ihre sommersprossigen Arme im Spülwasser, eigentlich würde Frau Leopold gerne beim Abwasch singen, laut und falsch und voll Freude am Geschenk dieses Morgens, doch sie traute sich nicht – sie hatte sich ihr Nettchen umgebunden, und nun schlief es endlich. Vier Kinder, alles gute Esser, aber miserable Schläfer.
»Beim Karl dachte ich noch, es läge an den Umständen«, sagte sie, und ihr Mann, der mit aufgeweichtem Graubrot und Zeitung auf der Küchenbank saß, halb versunken zwischen bunten Kissen und zipfeligen Kuscheldecken, entgegnete: »Schmarren, das haben sie von dir.«
So war die Ehe der Leopolds, sie wussten meistens ziemlich genau, wovon der andere sprach. Die Umstände, das war Frau Leopolds Flucht aus Budapest, die Entbindung auf dem Bahngleis in Wien und der Bub, keine 36 Wochen alt, wie tot in der Eiseskälte, und dann der Schrei, sein erster und lautester. Der ganze Bahnhof war zusammengelaufen, und die Offiziersgattin, die sich während der Zugfahrt um Frau Leopold gekümmert hatte, rief: »Worauf warten Sie denn? Bringen Sie Decken, heißes Wasser und der Mutter eine Suppe.« Wie in der Wirtschaft bestellte sie das, und trotz ihrer Schmerzen, trotz Hunger und Erschöpfung hatte Frau Leopold laut lachen müssen.
Auch jetzt zuckte es sie beim Gedanken daran in den Mundwinkeln, was aus der Frau wohl geworden war? Und deren Tochter, damals noch ein Backfisch von vielleicht vierzehn, bestimmt war die inzwischen längst verheiratet.
Frau Leopold trocknete einen Teller und blickte in den Garten. Da war eine wilde Verbrecherjagd im Gange, quer über die frisch umgegrabenen Beete natürlich, was auch sonst. Es war ja im Grunde egal, solange die Bande wenigstens ihre Tulpen leben ließ. An denen hing sie, die hatte noch der Vorbesitzer gepflanzt, und als sie damals im Frühling vor fünf Jahren zum ersten Mal hergekommen waren, da blühten sie so einladend prächtig, Frau Leopold hatte sofort gewusst: Hier war ihre neue Heimat.
Fritz hatte sich das nicht zu wünschen getraut, das Haus zu schön, die Stelle als erster Veterinär der Zeche zu gut – zu gut für einen wie ihn. Als dann die Zusage kam, da sprach er ohne jeden Spott von einem Wunder.
Frau Leopold glaubte an das Gute im Menschen, und sie glaubte an glückliche Enden, aber für Wunder reichte ihre Phantasie nicht. Zumindest nicht für solche, die keine harte Arbeit voraussetzen.
An die Gattin des Zechenbesitzers Siegmar-Wilhelmslob Kasimir hatte Frau Leopold heimlich, ohne Fritz’ Wissen, geschrieben, einen langen, demütigen Brief, unter Verleugnung ihres Stolzes hatte sie gebettelt, man möge ihrem Fritz doch eine Chance geben. Nur ein halbes Jahr, nur drei Monate sollten sie ihm geben, dann würde er sie schon überzeugen, dass er trotz seiner Entstellungen, trotz der Amputationen ein hervorragender Veterinär war. Sogar die christliche Nächstenliebe hatte Frau Leopold bemüht, derart tief war sie gesunken. Und doch, es hatte sich gelohnt: ein Wunder!
Nur wenn Frau Leopold der eleganten Gattin des allgewaltigen Herrn Kasimir beim Kirchgang oder mal beim Stricken für die Kriegskrüppel begegnete, da sah die sie aus grasgrünen, ganz runden Augen manchmal auffordernd an. Oder ging gar so weit, ihre lilienschmale Hand einen Moment auf Frau Leopolds sommersprossige zu legen.
Sie hatte Schulden, und sie wusste es.
Ärgerlich schüttelte Frau Leopold den Kopf, und bei Problemen fiel ihr sofort wieder dieser Brief ein. »Fritz, was meinst du denn jetzt dazu?«
Der Gedankensprung war aber dann doch zu groß, selbst für Fritz Leopold, der seine Frau gut kannte und einige geistige Kapriolen gewohnt war. Er blickte sie verwundert an, aber weil das Glasauge kein Lid besaß, wirkte er sowieso immer etwas überrascht.
»Wegen dieser Anfrage von diesem Herrn Dix. Wegen des Porträts von mir?« Und in einem kindischen Anfall von Eitelkeit nahm sie die Brille von der Nase und fuhr sich mit der flachen Hand durch das rotbraune Haar. Fritz lachte und pfiff anerkennend, entgegnete dann jedoch spöttisch: »Ich glaube, der Herr Dix, der schönt eh in die falsche Richtung.«
»Er hässlicht?« Das Wort gefiel Frau Leopold ausnehmend gut, und weil sie vor Fritz nicht intellektuell tun musste, bekannte sie schlicht: »Ich finde dem sein Zeug eigentlich doof. Warum muss man denn heute alles mit so einem bösen Blick sehen?«
Regelrecht wütend machte sie der Gedanke an seine Skatspieler. Die verquälten Leiber, die gemeinen Gesichter. Wie konnte man so etwas Grauenhaftes malen? Was musste man da für ein unglücklicher Mensch sein. Effekthascherisch und voyeuristisch war das!
»Ich versteh wirklich nicht, was das soll.« Inbrünstig schrubbte sie an einer eingetrockneten Haferflocke herum. »Wenn ihm das Elend des Proletariats so ans Herz geht, dann soll er aufhören, so ein hässliches Ekelzeug zu malen und in die SPD eintreten. Und sich eine anständige Stelle suchen und Steuern zahlen. Und am Sonntag, da kann er dann von mir aus in einer Armenküche Suppe verteilen. Damit wär den Menschen mehr geholfen. Was nützt dem sein Gekleckse denn? Es ist doch sowieso schwer genug. Warum kann er nicht das Schöne, Fröhliche malen? Das wäre eine Aufgabe für einen Künstler, das Hässliche seh ich doch selbst.«
»Da reicht ein Blick auf deinen Ehemann.«
Einen Moment lachten sie beide, dann gab sie ihm einen Kuss auf die Reste seiner Nase und gleich noch einen auf sein Kinngrübchen. Früher, da war dieses Grübchen nur Teil eines Zaubers aus blonden Locken, braunen Augen und Cäsarenprofil, aus geraden Lippen und leicht zurücktretenden Zähnen gewesen, nun war es plötzlich alles. Nur die Ehefrauen und Mütter sollten ein Recht haben, die Kriegskrüppel zu malen, nur sie könnten sie wirklich erkennen. Fritz lächelte, tippte ihr kurz mit dem Zeigefinger auf die Nasenspitze und erklärte entschlossen: »Ich glaube, du solltest trotzdem für den Kerl sitzen. Der wird bestimmt berühmt, kann doch heutzutage gar nicht grässlich genug sein.«
Und mit dieser Erkenntnis stand er auf, die Türglocke hatte zu schellen begonnen, der Vorarbeiter war gekommen, um ihn abzuholen. »Wird vielleicht später. Ich hab so ein Gefühl, das Fohlen von Glöckchen kommt heute.«
Frau Leopold nickte. Dann würde es also so sein, Fritz und die Grubenponys, sie vertrauten einander, die halb blinden, geschundenen Tiere und ihr halb blinder, einarmiger Arzt. Sie wollte ihm noch seine Vesper reichen, doch schon war er fort, knallte die Tür derart, dass Nettchen mit einem empörten Quietschen aufwachte. Umgehend verlangte es nach der mütterlichen Brust, aus dem Garten erschallte jämmerliches Geheule, und ihr Ältester rief schon von draußen: »Ich kann nichts dafür! Mama, der Purzel, der ist ganz und gar selbst schuld.«
Und oben, in der Wohnung des Herrn Doktor Storch, da klingelte schrill das Telefon. Frau Leopolds Mundwinkel zuckten schon wieder. So ein Geschenk, das Leben.
* * *
Das ohrenbetäubende Schellen eines Reiseweckers. Derart in Rage gescheppert hatte er sich, er fiel mit lautem Getöse vom Nachttisch, riss einen vollen Aschenbecher und mehrere leere Flaschen um, die kullerten klirrend unters Bett, während der Wecker weiter tobte.