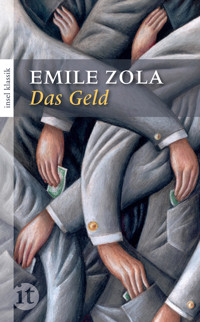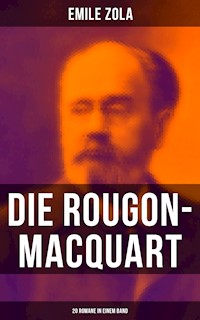
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Emile Zola, einer der bedeutendsten französischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, präsentiert in 'Die Rougon-Macquart: 20 Romane in einem Band' eine epische Familiensaga, die die sozialen und politischen Verhältnisse im Frankreich des 19. Jahrhunderts eindrucksvoll widerspiegelt. Mit einem realistischen Schreibstil und einer kritischen Ader gegenüber der Gesellschaft, stellt Zola in jedem Roman der Serie einen Ableger der Rougon-Macquart-Familie dar, um die erblichen Einflüsse und Konflikte in der Gesellschaft aufzuzeigen. Diese Sammlung von Romanen zählt zu den bedeutendsten literarischen Werken Zolas und ist ein wichtiger Beitrag zur literarischen Naturalismusbewegung. Mit detaillierten Beschreibungen und komplexen Charakteren taucht der Leser tief in die Welt der Rougon-Macquarts ein und erlebt ihre Höhen und Tiefen hautnah mit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die Rougon-Macquart: 20 Romane in einem Band
Inhaltsverzeichnis
Das Glück der Familie Rougon (La fortune des Rougon. Übersetzt von Armin Schwarz)
Vorwort des Übersetzers.
Indem wir daran gehen, dem deutschen Leser eine unverkürzte und getreue Übersetzung von Emile Zolas Roman-Serie »Die Rougon-Macquart« vorzulegen – wie sie noch nicht besteht können wir es nicht als unsere Aufgabe betrachten, auf eine kritische Würdigung Zolas, auf eine Erörterung seiner Stellung und Bedeutung in der modernen Literatur einzugehen. Seit zwei Jahrzehnten währt der Streit der Kritik um Zola; seit zwei Jahrzehnten ist er der Gegenstand maßloser Verketzerung von der einen und ebenso maßloser Verhimmelung von der anderen Seite. Es ergeht ihm wie allen Neuerern. Wer seine Richtung als die einzig wahre anerkennt, folgt ihm mit Begeisterung wie dem Apostel einer neuen Weltanschauung. Die anderen nennen seine Art, die Dinge zu sehen und vor uns hinzustellen, eine Verirrung und wenden sich unwillig von ihm ab. Die Zeit wird lehren, daß Zola alle denkenden Geister beschäftigt, den Büchermarkt beherrscht, der gelesenste Schriftsteller unserer Zeit ist. Seine Bücher haben eine noch nie dagewesene Verbreitung erreicht.
Welcher Zweck dem Dichter bei der Schaffung des großartigen Kunstwerkes »Die Rougon-Macquart« vorschwebte, sagt er selbst ganz klar in seiner Vorrede, die wir diesem Vorworte folgen lassen. Im Jahre 1871 begonnen, ist die Romanfolge heute, da wir diese Zeilen schreiben, abgeschlossen.
Den vorliegenden ersten Teil bezeichnet Zola selbst mit dem wissenschaftlichen Titel der Ursprung. In der Tat sehen wir hier den Ursprung der Familie Rougon-Macquart, die in der südfranzösischen Stadt Plassans seßhaft, ihre Nachkommen allmählich nach der Hauptstadt und nach den übrigen Teilen des Landes entsendet. Die verschiedenen Mitglieder dieser Familie sind es, denen wir in den einzelnen Teilen der Romanfolge begegnen; ihre Schicksale beschäftigen den Dichter; er stellt sie – die Männer und die Frauen – in die mannigfachsten Verhältnisse und Umgebungen hinein, um zu zeigen, wie das Gesetz der Vererbung ein unzerreißbares Band um sie schlingt. Zudem zieht Zola fast in jedem dieser Bände von einem bestimmten Zweige menschlichen Schaffens den Vorhang hinweg und zeigt uns mit unerreichter Meisterschaft der Schilderung den Menschen, wie er den Boden bestellt, wie er die im Schöße der Erde geborgenen Schätze zutage fördert, wie er eine Millionenstadt ernährt, wie er Eisenbahnen lenkt, wie er auf dem Geldmarkte Milliarden anhäuft und wieder in den Abgrund wirft usw.
In dem vorliegenden ersten Bande, » Das Glück der Familie Rougon« betitelt, lernen wir zunächst Adelaide kennen, ein halb wahnsinniges, wilder Sinnenlust ergebenes Weib, das von einem im Wahnsinn verstorbenen Vater, dem Krautgärtner Fouque abstammte. Adelaide war mit einem Gärtner namens Rougon verheiratet, der nach kurzer Ehe starb. Von diesem hatte sie einen Sohn, Pierre Rougon. Später lebte sie mit einem Wilddiebe namens Macquart in wilder Ehe. Von diesem hatte sie einen Sohn, Anton, und eine Tochter, Ursula, die sich mit dem Hutmacher Mouret verheiratete. Von diesen Menschen stammen alle handelnden Personen ab, denen wir in den späteren Teilen der Romanfolge Rougon-Macquart begegnen.
Der vorliegende erste Teil ist eigentlich nur eine Geschichte des Napoleonischen Staatsstreiches und des rasch niedergeworfenen Bauernaufstandes in Südfrankreich. Damit verwebt der Dichter die reizende Liebesidylle zweier Kinder, die in dem Rummel mit untergehen. Wohl sieht der Leser schon hier den Großmeister der Schilderung, doch fehlt es noch an jenen kraßrealistischen Bildern, die später dem Dichter so viele Gegnerschaften zugezogen haben und – gestehen wir es nur – sehr zur großen Verbreitung seiner Bücher beigetragen haben.
In dem zweiten Teile: »La curée« (die Treibjagd) sehen wir Zola schon in voller Tätigkeit bei der Lösung seines Problems. Der große Dezember-Wilddieb hatte das edle Wild – Frankreich – erlegt. Tausende von gierigen Jagdhunden forderten ihren Anteil an der Beute. Die Treibjagd beginnt. Zola wählt drei Gestalten, um die Gesellschaft des zweiten Kaiserreiches nach dem Staatsstreiche zu schildern: den schamlosen Spekulanten (Aristides Rougon-Saccard), den verlebten Junker (des Vorigen Sohn Maxim) und die gefallene Frau aus den besseren Ständen (Renée Béraud du Chatel). Die Sittenlosigkeit dieser Frau spottet jeder Beschreibung. Ihr Stiefsohn Maxim, der entnervte Bummler, wird ihr Liebhaber. Dieser widerliche Ehebruch führt zu keiner düsteren Lösung. Der Vater zwingt den Sohn, eine Ehe mit einer reichen Schwindsüchtigen zu schließen. Renée findet in der Jagd nach Genüssen einen frühen Tod.
Im Gegensatze zu dem ersten Teil, der das Bürgertum schildert, und dem zweiten Teil, in dem die reichere Streberklasse des zweiten Kaiserreiches erscheint, versetzt uns der dritte Teil, » Der Bauch von Paris«, unter die Volksgestalten der Markthallen. Ein vor Hunger sich krümmender Unglücklicher inmitten der ungeheueren Mengen von Nahrungsmitteln: das ist der Ausgangspunkt des Buches, in dem das Drama selbst nur wenig von der Stelle rückt. In seinem Mittelpunkte sehen wir unter anderen Personen auch die »schöne Lisa« sich bewegen, eine Tochter Anton Macquarts, die den dicken Fleischer Quenu geheiratet hat und in angestammter Habgier zusammen mit dem Gatten rastlos nach Reichtum strebt.
» Die Eroberung von Plassans« heißt der vierte Teil der Romanfolge. Der Eroberer ist der Klerikalismus. Der Dichter zeigt uns, wie ein schlauer Geistlicher, der sich in die Familie Franz Mourets (eines Sohnes der Ursula Macquart und des Hutmachers Mouret) einzuschleichen weiß, allmählich die Frau des Hauses vollständig in seine Gewalt bekommt und durch diese Frau seinen verderblichen Einfluß zugunsten des herrschenden Bonapartismus weiter und weiter ausbreitet. Der Familie Mouret selbst wird die Bekanntschaft des Geistlichen (Abbé Faujas) geradezu verhängnisvoll. Die Kinder verlassen das Haus; die Eintracht zwischen Mann und Frau ist geschwunden. Die Frau verfällt der Frömmelei, vernachlässigt ihr Haus, entbrennt in sträflicher Leidenschaft zum Abbé. Der Gatte wird wahnsinnig und zündet sein Haus an, wobei er, der Abbé und dessen Mutter umkommen.
Ein Sohn dieses unglücklichen Ehepaares, der Abbé Serge Mouret, ist der Held des fünften Teiles, der den Titel führt: »Die Sünde des Abbé Mouret«. Diese Sünde des jugendlichen, frommen, keuschen Abbé ist seine Liebe zu Albine, einem unschuldigen jungen Mädchen, das er im Paradou, einem Landgute in der Nähe seiner Pfarre findet. Jeder Leser, der Serge Mouret und Albine auf ihren Streifzügen durch den verwilderten Park des Paradou folgt, wird gestehen, daß die ganze moderne Literatur unseres Jahrhunderts kaum etwas Schöneres aufzuweisen hat. Diese Liebschaft ist ein herrliches Gedicht in Prosa, eine entzückende Schilderung des Daseins des ersten Menschenpaares in einem irdischen Paradiese. Nichts fehlt zur Vervollständigung des Gemäldes, selbst nicht der strafende Engel, Bruder Archangias, der den Abbé aus dem Paradiese vertreibt.
Das Zeitbild wäre unvollständig, wenn wir nicht eine Schilderung des Lebens und Treibens am kaiserlichen Hofe und der politischen Welt jener Zeit bekämen. Diese Schilderung bietet uns Zola im sechsten Bande, der den Titel führt: » Seine Exzellenz Eugen Rougon«. Der Dichter führt uns an den Hof zu Compiègne. Wir sind Zeugen der großartigen Feste, die Ihre Majestäten ihren Gästen geben. Wir sehen die Hofschranzen, Beamten, Diplomaten, Günstlinge und Spione von der Sonne der kaiserlichen Huld bestrahlt. Der Dichter enthüllt vor uns das verwickelte Getriebe der politischen und der Finanzwelt. Im Mittelpunkte von allem steht der allmächtige Minister und Staatsmann Eugen Rougon, der in sehr durchsichtiger Weise die glänzende Laufbahn des bonapartistischen Ministers Rouher darstellt. Eugen Rougon ist einer der Söhne Peter Rougons. Als beschäftigungsloser Advokat ist er nach Paris gezogen; der Staatsstreich hat ihn in die Höhe gebracht. Er ist der Glanz und der Wohltäter seiner Familie geworden.
Mit dem siebenten Teile der Serie Rougon-Macquart, » Der Totschläger« betitelt, beginnt eigentlich erst der Ruhm und der Erfolg Zolas. Kein zweites Buch hat eine so tiefgehende Bewegung im Publikum hervorgerufen, wie dieses. Zola war nahe daran, auf offener Straße gesteinigt zu werden. Kein Wunder. Er hatte den Finger an eine offene, eiternde Wunde des Volkscharakters gelegt und das schmerzte. »Der Totschläger« – das ist der Schnaps. Zola wollte ein Buch über das Volk der Arbeiterviertel schreiben und zeigen, wie der Mißbrauch des Alkohols zum sittlichen und wirtschaftlichen Untergang der Familien führen müsse.
Die Hauptperson des Buches ist Gervaise, eine Tochter Anton Macquarts. Sie bleibt während der ganzen Erzählung im Vordergrunde und erregt zuerst das Interesse, später das tiefe Mitleid des Lesers. Als ein Kind des Volkes erbt sie die üblen Neigungen ihrer Eltern, überwindet sie aber anfangs, als sie zu Paris, von ihrem Liebhaber Lantier (dem sie zwei Kinder gegeben hat) verlassen, durch ihre Arbeit und durch ihren häuslichen Sinn eine Art Wohlstand zu schaffen beginnt. Sie ist eine Ehe mit dem Spengler Coupeau eingegangen. In den ersten Jahren dieser Ehe geht alles gut. Da zieht das Unglück in diese Familie ein. Coupeau fällt während der Arbeit von einem Hausdache. Während der langwierigen Krankheit und notgedrungenen Untätigkeit verliert der charakterschwache Coupeau die Arbeitslust. Er ergibt sich der Trägheit und dem Trunke, und seine Familie verfällt dem Untergange. Gervaise selbst sinkt zur Säuferin und Metze herab ...
In dem achten Bande: » Ein Blättchen Liebe« erhalten wir die Geschichte der Helene Mouret, einer Tochter Ursula Macquarts. Die Ursula war mit dem Hutmacher Mouret verheiratet. Früh verwitwet zieht Helene mit ihrem Töchterchen Jeanne nach Paris. Das Kind ist kränklich und steht in Behandlung des verheirateten Arztes Deberle, der in zärtliche Beziehungen zur Mutter des Kindes tritt. Diese Liebe ist es, die uns der Dichter schildert. Jeanne stirbt an der Schwindsucht, und Helene reicht Herrn Rambaud, einem Manne ihres Bekanntenkreises, die Hand zum zweiten Ehebunde. Der Rahmen dieser Herzensgeschichte ist Paris, und man darf kühn behaupten, daß solch meisterhafte Schilderungen der Seinestadt, wie sie dieses Buch enthält, kaum wieder anzutreffen sind.
Mit » Nana«, dem neunten Bande, ist Zola wieder in seinem Elemente. Nana, die Tochter von Gervaise und Coupeau, konnte nichts anderes als eine Dirne sein. Aber sie ist eine moderne Dirne, eine Theaterpflanze. Dieses Geschöpf unserer fortgeschrittenen Bildung, diese die höheren Gesellschaftsklassen zerstörende Kraft vor uns hinzustellen; ein Blatt der ewig menschlichen Geschichte der Dirne zu schreiben; uns das Geschlecht des Weibes gleichsam im Tempel der Wollust zu zeigen und ringsumher auf den Knien ein Volk von ruinierten, entnervten, verblödeten Männern: dies war der Stoff, den Zola sich erwählt. Er hat seine Aufgabe glänzend, mit beispiellosem Erfolge gelöst. » Nana« erschien in einer Auflage von 55,000 Exemplaren auf dem Büchermarkte. Jetzt ist das Buch in alle Kultursprachen übersetzt worden.
Im zehnten Bande: » Der häusliche Herd« betitelt, schildert Zola das heuchlerische, verlogene, zum Schein sittsam tuende, dabei durch und durch verderbte und lasterhafte Bürgertum. Wir werden in ein großes Pariser Haus eingeführt, wo äußerlich alles so ordentlich, so streng, so fein säuberlich zugeht. Schon die hohen Türen auf den Fluren flößen Achtung ein; hinter diesen Türen aber, fast in jeder Wohnung, hausen Laster und Verworfenheit. Im Mittelpunkte der Geschehnisse steht Octave Mouret, ein Sohn Franz Mourets. Der junge Mann ist aus Plassans nach Paris gekommen, um da sein Glück zu machen, was ihm bei seiner angeborenen Zähigkeit und Geschicklichkeit auch gelingt, wie wir im folgenden elften Bande sehen werden.
» Zum Paradies der Damen« betitelt sich dieser Band. Es ist zugleich der Titel eines großartigen Modewarenhauses, dessen Getriebe der Dichter uns mit bewunderungswürdiger Meisterschaft vor Augen führt. Der Leiter dieses großen Unternehmens ist Octave Mouret, dem seine tausendfachen Geschäfte noch zu allerlei Liebeshändeln Zeit lassen, und der schließlich durch die standhafte Tugend Denisens, eines armen Mädchens, dem er in seinem Geschäftshause eine Anstellung gegeben, besiegt wird, so daß er Denise zu seiner Frau macht.
» Die Lebensfreude« heißt der zwölfte Band. Der Titel ist ein grausamer und doch so treffender Spott auf einen armen Gichtbrüchigen, der seit Jahren an den Rollstuhl gefesselt, von Zeit zu Zeit Anfällen ausgesetzt ist, die ihn vor Schmerz rasend machen, und der dennoch bei der Nachricht, daß die griesgrämige, alte Hausmagd sich erhängt habe, entrüstet ausruft: »Nein! so dumm, sich das Leben zu nehmen!« Im übrigen begegnen wir in diesem Buche Pauline Quenu, der früh verwaisten Tochter des reichen Pariser Fleischers Quenu, dessen Bekanntschaft wir im dritten Teile der Romanfolge gemacht haben, und seiner Ehefrau Lisa Macquart. Das Gesetz der Vererbung, das der Dichter aufgestellt hat, scheint bei Pauline eine Ausnahme gemacht zu haben. (Die Ausnahme bestätigt ja die Regel.) Pauline ist, einen Hang zum Jähzorn abgerechnet, ein gut und edel veranlagtes Geschöpf. Sie kommt zu ihrem Oheim Chanteau, der zu ihrem Vormund eingesetzt war, ins Haus. Chanteau, früher Kaufmann, mußte wegen eines Gichtleidens sich zurückziehen und lebt mit Frau und Sohn in einem kleinen Fischerdorfe am Meere. In dieses Haus tritt Pauline ein und bringt ein ansehnliches Vermögen in Wertpapieren mit. Pauline wächst mit Lazare, dem jungen Chanteau heran, und wir sind Zeugen der reizendsten Liebesidylle. Paul und Virginie im modernsten Gewande. Leider wendet sich die Idylle zum Drama. Es kommt die verhängnisvolle Dritte in Gestalt Louisens, der Tochter eines befreundeten Kaufmanns, die alljährlich die Ferien in diesem Hause zubringt. Zwischen Lazare, der sich inzwischen medizinischen Studien zugewendet hat, und Louisen entwickelt sich die Jugendfreundschaft zur Liebe, und die arme Pauline opfert sich, begräbt ihre Liebe, nachdem sie auch ihr Vermögen Stück für Stück hergegeben, um das sinkende Haus zu stützen ...
In » Germinal«, dem dreizehnten Bande, führt uns der Dichter in die dunklen Schächte eines Bergwerkes und in das Arbeiterleben ein. Es ist die Geschichte eines Ausstandes der Bergarbeiter, geführt von dem unruhigen, in die sozialistische Arbeiterbewegung verschlagenen Etienne Lantier, einem Sohne der Gervaise Macquart. Im ganzen ein großartiges und ergreifendes Bild modernen Arbeiterelends.
» Das Werk« (d. h. das Kunstwerk) hat der Dichter den vierzehnten Teil seiner Romanfolge betitelt. Dieser Band ist der Kunst gewidmet. Der Künstler ist Claude Lantier, Maler, der Sohn der Gervaise Macquart und ihres ersten Gatten Jean Lantier. Die schweren inneren Kämpfe, mit denen der Künstler sich bis zur Erkenntnis der naturalistischen Kunstrichtung durchringt, sie geben gleichsam ein Bild des Entwicklungsprozesses, den Zola selbst durchgemacht hatte. Aber hier endet der Vergleich. Der Maler Claude ist seiner großen Aufgabe nicht gewachsen und endet durch Selbstmord.
Der fünfzehnte Band der Reihe heißt » Mutter Erde«. Der Dichter entrollt darin ein großartiges Bild von dem Leben des französischen Bauers; von seinem nimmer rastenden aussichtslosen Kampfe um Scholle und Geld. Dem Stoffe und den handelnden Personen angemessen führt Zola hier eine Sprache, die an Rauheit und Ungebundenheit nichts zu wünschen übrig läßt. Man wird nicht ohne tiefstes Interesse dieses Buch lesen können. Ist auch der Bauer in den Hauptzügen seines Charakters in allen Ländern gleich, so findet man hier dennoch eine Studie, die völkisch und kulturell von hohem Werte ist. Die Familie Rougon-Macquart ist hier durch Jean, den Sohn Anton Macquarts vertreten, der nach abgeleistetem Heeresdienste nach der Beauce-Gegend ausgewandert ist, wo er sein Schreinerhandwerk beiseite legt und Landmann wird, aber vergebens Fuß zu fassen sucht ...
» Der Traum« betitelt sich der sechzehnte Band. Dieser Teil der Reihe bildet wieder eine Ruhestation. Der Dichter führt uns nach einer kleinen bischöflichen Stadt in die stille, glückliche Häuslichkeit des kinderlosen Ehepaares Hubert. Das Haus der Huberts stößt an den Dom, denn ihr ganzes Dasein ist mit der Kirche verwachsen. Die Huberts sind Kunststicker; sie verfertigen die kostbaren Meßgewänder, und dieses seltene Kunstgewerbe ist eine hundertjährige Überlieferung der Familie. Die Huberts nehmen eines Tages ein armes verlaufenes Kind in ihr Haus. Die kleine, achtjährige Angelika ist ihren Pflegeeltern – einem dem Trunk ergebenen Ehepaar – entlaufen, weil es die jämmerliche Behandlung nicht länger ertragen konnte. Die Huberts beschließen, das Mädchen an Kindesstatt anzunehmen. Die Nachforschungen, die sie aus diesem Anlasse anstellen, ergeben, daß Angelika die uneheliche Tochter Sidonie Rougons, einer Tochter Peter Rougons aus Plassans ist. Sidonie war mit ihrem Gatten aus Plassans nach Paris gekommen; hier hatten die Eheleute einen kleinen Ölhandel betrieben. Der Mann starb bald, und Frau Sidonie gab fünfzehn Monate später einer Tochter das Leben, deren Vater unbekannt war. Dieses Kind war Angelika. Man sagte ihr, ihre Mutter sei tot; sie war es auch in moralischem Sinne, denn sie hatte sich in Paris unnennbaren Gewerben hingegeben.
Angelika wuchs in dem Hause der Huberts zu einer sehr geschickten Kunststickerin und zu einem züchtigen, frommen, nur etwas träumerisch veranlagten Mädchen heran.
In der frommen, kirchlichen Atmosphäre, in der sie lebte, neigte sie zu überirdischen Träumereien. Die schönen, frommen Legenden, die sie zu lesen und zu hören bekam, erzeugten in dem Mädchen allmählich eine Seelenstimmung, in der es erklärte, »nur einen Prinzen heiraten zu wollen, den schönsten, reichsten und edelsten der Welt«. Dies ist der Traum. Der Prinz erscheint in Gestalt eines Kunstdilettanten, der in der benachbarten Domkirche Glasmalerei treibt. Zwischen Felix – so heißt der junge Mann – und Angelika entspinnt sich die reizendste Liebesidylle. Doch endlich kommt das Erwachen. Felix entpuppt sich als der Sohn des mächtigen und strengen Bischofs, der einst Kapitän gewesen und aus Gram über den frühen Tod seiner jungen Frau Geistlicher geworden war. Der hochmütige Bischof ruft den Liebenden sein »Niemals!« zu. Angelika, ohnehin stets von zarter Gesundheit, wird schwer krank. Der Jammer der Kinder erweicht das Herz des Bischofs; die Trauung findet statt. Angelika, nur mehr ein Schatten, schwankt am Arme des Geliebten zum Traualtar und haucht beim Austritt aus der Kirche auf der obersten Stufe angesichts der jubelnden Menge in einem Kusse, den sie dem geliebten Gatten auf die Lippen drückt, ihre keusche Seele aus.
» Die Bestie im Menschen« heißt der siebzehnte Band. Ein schaurig-ergreifendes Bild von menschlicher Krankheit und Verirrung. »Die Bestie im Menschen« ist natürlich der böse, verbrecherische Trieb. Jakob Lantier, Lokomotivführer in den Diensten der Westbahn, ist der entsetzlichen Krankheit, der Lustmordsucht, unterworfen. Ein Sohn der unglücklichen Gervaise Macquart (von ihrem ersten Gatten Lantier), ein Enkel des versoffenen Anton Macquart, ein Urenkel der wahnsinnigen Adelaide, hatte er die ganze Summe von Lastern seines Geschlechtes geerbt. Im Grunde nicht böse geartet, hütet er sich lange vor dem Weibe, denn mit der fleischlichen Lust erwacht zugleich die Mordlust in ihm. Von Zeit zu Zeit ist er furchtbaren Anfällen ausgesetzt. Er hat dann einen Schmerz hinter den Ohren, der ihm das Gehirn zu durchbohren scheint; eine jähe Schwermut kommt über ihn, die ihn zwingt, wie ein Tier in einem einsamen Winkel niederzukauern. Keiner seiner Brüder, weder Claude, noch der nach ihm geborne Etienne, litt unter der Jugend seiner Mutter (Gervaise war kaum fünfzehn Jahre alt, als sie ihn gebar) und seines knabenhaften Vaters, des schönen Lantier, dessen schlechtes Herz Gervaise soviele Tränen kosten sollte. In gewissen Stunden fühlte er den erblichen Riß. Er war dann nicht mehr Herr über sich, sondern gehorchte nur seinen Muskeln wie eine wütende Bestie. Dabei trank er nicht; denn er hatte bemerkt, daß ein Tropfen Alkohol ihn verrückt mache. Er kam schließlich zu der Überzeugung, daß er die Schuld der anderen bezahlen müsse, die Schuld der Väter und Großväter, der Geschlechter von Trunkenbolden, die sein Blut verdorben hatten. Er fühlte in sich eine schrittweise Vergiftung, eine Wildheit, die ihn dem lauernden Wolf, der auch Frauen zerreißt, gleich machte.
Doch sein Kampf gegen das lauernde Ungeheuer nützt ihm nichts. Er liebt Severine, die Gattin eines Eisenbahnbeamten, ein verworfenes, lasterhaftes Weib, das schließlich unter Jakobs Messer verblutet ... Der Rahmen dieses furchtbaren Dramas ist das Leben und Treiben auf einer großen Eisenbahnlinie (Paris–Havre), das der Dichter mit seiner unerreichten Meisterschaft uns schildert...
Der achtzehnte Teil führt den Titel: » Das Geld.« Alles Schöne und Heilsame, was mit Hilfe des Geldes hienieden gestiftet werden kann, alles Unheil und alle Schmach, die das Geld unter den Menschen täglich erzeugt, sind mit unerreichter Meisterschaft in dem großartigen Gemälde dargestellt, in welchem Zola uns die Bedeutung des Geldes im modernen Wirtschaftsleben zeigt. Der traurige Held, der im Mittelpunkte der Begebenheiten steht und eine führende Rolle spielt, ist uns nicht unbekannt: es ist Aristides Saccard, der Bauspekulant, den wir in dem Buche »Die Treibjagd« als den Gatten Renées kennen gelernt haben. Dank seiner Energie, Findigkeit und Zähigkeit, die sich mit einer vollkommenen Gewissenlosigkeit paarten, ist es diesem Manne, nachdem seine waghalsigen Spekulationen ihn ruiniert hatten, noch einmal gelungen, sich zu erheben und für kurze Zeit zu einer gebieterischen Macht in der Finanzwelt emporzuschwingen. In dieser kurzen Glanzperiode führte das Leben ihm eine starke, kluge und edle Frau – Karoline Hamelin – in den Weg, die ihr Los an das seinige knüpfend, in unsägliches Leid geriet, aber schließlich vermöge ihrer Seelenstärke ungebrochen und unbefleckt aus den schweren Prüfungen hervorging.
» Der Zusammenbruch« heißt der neunzehnte Band. Nämlich der Zusammenbruch des zweiten Kaiserreiches im Verlaufe des gewaltigen Ringens zweier großer Kulturvölker, der Deutschen und Franzosen. Den Krieg von 1870–71 schildert Zola in diesem Bande. Seine großartigen Schilderungen gipfeln in den Vorgängen bei Sedan.
Sedan! Ein Name, der für Deutschland einen nationalen Festtag bedeutet und die Erinnerungen an ewig denkwürdige Ruhmestaten wachruft. Und für Frankreich? Ein Ort der Schmach und des Jammers, die Stätte, wo das auf Gewalt und Verderbtheit aufgebaute zweite Kaiserreich zusammenbrach. Rings um Sedan fand jenes beispiellose Kesseltreiben statt, das eine geschlagene, in wilder Flucht aufgelöste Armee in den Straßen einer nicht großen Stadt zusammenpferchte und den Kaiser nötigte, zu kapitulieren und sich gefangen zu geben. Sedan bildet demnach eine entscheidende Etappe im deutschfranzösischen Krieg 1870–71 und ist zugleich der Schauplatz von zarten Begebenheiten, die uns in diesem Bande näher interessieren. Wir machen Bekanntschaft mit Gilberte Delaherche, einer schönen, jungen Frau, die nicht schlecht war, nur leichtfertig und zu jener Gattung von Frauen gehörte, die sich nicht damit abfinden können, mit ihrem Liebreiz nur einen zu beglücken, und wäre dieser eine auch ihr Gatte.
Der zwanzigste, letzte Teil der Reihe führt den Titel: » Doktor Pascal«. Mit Doktor Pascal, dem dritten Sohne des Peter Rougon, hatten wir bisher nur flüchtige Begegnungen. Wir sahen ihn im ersten Bande an der Seite der sterbenden Miette und im fünften Bande als Hausarzt im Paradou, wo er seinen Neffen, den Abbé Mouret einführte. Der Schlußband ist völlig seinem Leben und Wirken gewidmet. Dieses Buch geleitet uns nach Plassans zurück, dem Stammsitze und Ursprungsorte der Rougon-Macquart. Doktor Pascal hat sich dort als Arzt niedergelassen. Er ist ein Gelehrter, Philosoph und Menschenfreund, der sich für seine Krankenbesuche bei den Armen in der Weise bezahlt macht, daß er unbemerkt ein Zwanzigfrankenstück auf dem Tische zurückläßt. Nachdem er soviel Kapital erworben, daß er von den Zinsen leben kann, gibt er die ärztliche Praxis auf, bleibt nur noch der Arzt der Armen und zieht sich in die »Souleiade«, sein vor der Stadt gelegenes Landhaus, zurück. Dort lebt er fortan seinen wissenschaftlichen Forschungen und besonders den Untersuchungen über den Atavismus, die Vererbung. Das Buch ist in dieser Hinsicht gewissermaßen als eine Bilanz der ganzen Romanfolge zu betrachten, als eine Rechtfertigung der physiologischen Lehre, auf der das zwanzigbändige Werk sich aufbaut. Doktor Pascal tritt hier für Emile Zola ein. Er tritt mit einem wissenschaftlichen und statistischen Material auf, das er ein Menschenalter hindurch gesammelt hat, indem er in riesigen Aktenbündeln gleichsam die Lebensgeschichte jedes einzelnen Mitgliedes seiner Familie zusammengetragen hat, der Familie, die er auch in einem sorgfältig angelegten Stammbaum in allen ihren Verastungen und Verzweigungen auslegt.
Doktor Pascal hat Clotilde, die Tochter seines Bruders Aristides aus dessen erster Ehe, in sein Haus genommen. Sie ist an der Seite des Oheims in voller Ungebundenheit herangewachsen, ist eine Gehilfin bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten, durfte lesen und erfahren, was sie wollte, so daß ihr nichts fremd blieb von dem Mann und von dem Weibe. Sie hat einen runden, festen Kopf, wie ihr Oheim oft sagte, einen klaren Geist und ein kindliches, unverdorbenes Herz. Sie ist frei geblieben von dem traurigen Erbteil der Familie.
Obgleich in einer Atmosphäre freier Forschung herangewachsen, war Clotilde keineswegs eine Freidenkerin wie ihr Oheim. Einen festen Halt für ihr inneres Leben suchend, war sie naturgemäß unter den Einfluß ihrer Großmutter Felicitas Rougon und einer alten Magd des Hauses, Martine, geraten, die eine fromme, christliche Gottesgläubigkeit in ihr nährten. Ein großer, künstlerischer Zug liegt in der Art und Weise, wie der Dichter hier den Gegensatz und die Kämpfe zwischen dem freidenkerischen Gelehrten und dem frommen, von den wissenschaftlichen Forschungen unbefriedigten Kinde entwickelt. Der Arzt, der Junggeselle ist und stets ein solides Leben geführt hat, hängt mit Leib und Seele an dem Mädchen; abgesehen von seinem sinnlichen Verlangen, liebt er sie noch mit einer unendlichen Zärtlichkeit, entzückt von ihrer sittlichen und geistigen Persönlichkeit, von der Geradheit ihres Empfindens und von ihrem munteren, tapferen und entschlossenen Geiste. Clotilde wieder blickte mit grenzenloser Bewunderung zu dem »Meister« empor; von der Bewunderung des Weibes zur Liebe ist aber nur ein Schritt. Dieses Verhältnis nimmt eine bestimmte Gestalt in dem Augenblicke an, da die Werbung des Doktor Ramond, eines in Plassans ansässigen jungen Arztes, um die Hand Clotildens zur Entscheidung drängt. Doktor Pascal will schweren Herzens seine Neigung opfern und befürwortet die Werbung; Clotilde jedoch, die in Pascals Seele schaut, weist den Freier ab.
Nimm mich doch, da ich mich dir gebe! ruft sie dem angebeteten Meister zu.
Und so fanden sich Oheim und Nichte wie Mann und Weib ...
Budapest, Ende 1893. Armin Schwarz.
Vorwort des Autors.
Ich will darstellen, wie eine Familie, eine kleine Gruppe von Wesen in einer Gesellschaft sich verhält, indem sie sich entwickelt und zehn, zwanzig Menschen das Leben gibt, die auf den ersten Blick sehr verschieden scheinen, die uns aber eine genaue Prüfung innig miteinander verbunden zeigt. Die Vererbung hat ihre Gesetze wie die Schwere.
Die zwiefache Frage der Naturanlage und der Umgebung lösend, werde ich bemüht sein, jenen Faden zu finden und ihm zu folgen, der folgerichtig von einem Menschen zum anderen führt. Wenn ich einmal alle Fäden festhalte, wenn ich eine ganze Gruppe in Händen habe, werde ich sie am Werke zeigen, mittätig, als handelnde Personen eines geschichtlichen Zeitraumes; ich werde diese Gruppe vorführen, wie sie tätig ist in dem Ganzen ihres Strebens; ich werde zugleich die Summe an Willenskraft in jedem einzelnen Mitgliede der Gruppe und das allgemeine Vorwärtsdringen ihrer Gesamtheit darlegen.
Die Rougon-Macquart, die Gruppe, die Familie, die ich zum Gegenstande meines Studiums machen will, hat als kennzeichnendes Merkmal jenes Überströmen der Begierden, jenes wilde Stürmen in unserer Zeit, das sich auf die Genüsse wirft. In körperlicher Hinsicht verkörpern sie die langsame Erbschaft der Nerven- und Blutkrankheiten, die infolge einer ersten organischen Erkrankung in einem Geschlechte sich offenbaren und je nach der verschiedenen Umgebung bei jedem Einzelwesen dieses Geschlechtes die Gefühle, die Begierden, alle menschlichen Leidenschaften – natürliche, wie triebartige – bestimmen, deren Äußerungen die herkömmlichen Namen der Tugenden und Laster tragen. In geschichtlicher Hinsicht gehen sie aus dem Volke hervor, strahlen in die ganze zeitgenössische Gesellschaft aus, schwingen sich zu allen Stellungen empor, immer vermöge jenes wesentlich modernen Antriebes, den die niederen Klassen auf ihrem Zuge durch den gesellschaftlichen Körper empfangen; so geben sie die Geschichte des zweiten Kaiserreiches auf Grund ihrer besonderen Dramen, angefangen bei der Mausefalle des Staatsstreiches bis zum Verrat bei Sedan.
Seit drei Jahren sammelte ich die Belege zu diesem großen Werke, und der vorliegende Band war schon geschrieben, als der Sturz der Bonaparte, dessen ich aus künstlerischem Gesichtspunkte bedurfte und den ich wie ein Verhängnis immer am Ende des Dramas fand, ohne ihn so nahe zu wähnen, mir den schrecklichen, aber notwendigen Abschluß meines Werkes an die Hand gab. Es ist nunmehr fertig, es bewegt sich in einem geschlossenen Kreise; es wird zum Bilde einer vergangenen Herrschaft, einer seltsamen Zeit der Schmach und des Wahnsinns.
Dieses Werk, das mehrere Abschnitte bilden wird, ist demnach – wie ich mir es denke – die natürliche und soziale Geschichte einer Familie unter dem zweiten Kaiserreich. Und der erste Abschnitt: » Das Glück der Familie Rougon« müßte wissenschaftlich »der Ursprung« heißen.
Paris, 1. Juli 1871. Emile Zola
Erstes Kapitel.
Wenn man Plassans durch das Römertor verläßt, das auf der Südseite der Stadt liegt, findet man rechts von der Straße nach Nizza hinter den ersten Häusern der Vorstadt ein wüstes Stück Land, das in der Gegend unter dem Namen »der Saint-Mittre-Grund« bekannt ist.
Der Saint-Mittre-Grund ist ein längliches Viereck in ziemlicher Ausdehnung, das sich in gleicher Höhe mit dem Fußsteig der Straße hinzieht, von der er nur durch einen Streifen dürren Rasens getrennt ist. Auf einer Seite des Grundstückes, rechts, zieht sich ein Sackgäßchen hin mit einer Reihe von Hütten. Links und im Hintergrunde ist das Gebiet durch zwei von Moos zerfressene Mauern abgeschlossen, über die hinweg man die Maulbeerbäume des Jas-Meiffren erblickt, eines größeren Besitztumes, zu dem der Eingang weiter unten in der Vorstadt zu finden ist. So von drei Seiten eingeschlossen, ist der »Saint-Mittre-Grund« eigentlich ein großer Platz, der nirgends hinführt und daher nur von Spaziergängern aufgesucht wird.
Einst war hier ein Kirchhof, der unter dem Schutze des Saint-Mittre stand, eines provençalischen Heiligen, der in dieser Gegend sehr verehrt wurde. Die älteren Leute erinnerten sich im Jahre 1851 noch, die Mauern dieses Kirchhofes, der Jahre hindurch geschlossen geblieben, gesehen zu haben. Der Boden, den man seit mehr denn einem Jahrhundert mit Leichen vollstopfte, atmete den Tod aus, und man war genötigt, am anderen Ende der Stadt einen neuen Gottesacker zu eröffnen. Nachdem er aufgelassen worden, schwand der ehemalige Friedhof mit jedem jungen Jahre mehr und bedeckte sich mit einem üppigen Pflanzenwuchs. Dieser fette Boden, in den die Totengräber keinen Spatenstich mehr tun konnten, ohne Menschenknochen aufzuwerfen, war von einer ungeheuren Fruchtbarkeit. Nach den Mairegen und den sonnigen Tagen des Juni sah man von der Straße aus die Spitzen der Gräser über die Mauern hinausragen; im Innern war ein Meer von tiefem, sattem Grün, da und dort blühten breite Blumen von seltsamem Farbenglanze. Im Schatten der eng zusammenstehenden Stengel roch man das feuchte Erdreich, das von gärenden Säften strotzte.
Eine Merkwürdigkeit dieses Grundstückes waren zu jener Zeit die Birnbäume mit den verkrümmten Zweigen und unförmigen Knoten, nach deren riesigen Früchten keine Hausfrau von Plassans Verlangen trug. Man sprach in der Stadt von diesen Birnen nur mit Ekel; aber die Vorstadtjungen waren nicht so heikel; sie erklommen des Abends scharenweise die Mauern, um die Birnen zu stehlen, noch ehe sie völlig reif waren.
Das blühende, reich sprießende Leben der Gräser und Bäume hatte bald den Tod des ehemaligen Kirchhofes von Saint-Mittre bewältigt. Der menschliche Moder wurde gierig von den Blumen und Früchten aufgesogen, und kam man an diesem Orte vorbei, so spürte man nur mehr den scharfen Duft der wilden Nelken. Wenige Sommer hatten dies zustandegebracht.
Um jene Zeit kam die Stadt auf den Gedanken, von diesem bisher brach gelegenen Gemeindebesitz Nutzen zu ziehen. Man riß die längs der Straße und des Sackgäßchens stehenden Mauern nieder und beseitigte Gräser und Birnbäume; dann verlegte man den Kirchhof. Der Boden ward bis zu einer Tiefe von mehreren Metern aufgegraben, und man warf in einem Winkel die Gebeine zuhauf, die sich in der Erde vorfanden. Die Jungen, die über den Verlust der Birnbäume untröstlich waren, spielten fast einen Monat Ball mit den Schädeln; es fanden sich Leute, die sich den schlechten Spaß machten, nächtlicherweile Schenkel- und Schienbeine an die Türglocken der Stadt zu hängen. Dieses Ärgernis, das in Plassans heute noch unvergessen ist, hörte nicht eher auf, als bis man sich entschloß, die Gebeine in einer Grube auf dem neuen Kirchhofe zu verscharren. Allein, in der Provinz werden die Arbeiten mit bedächtiger Langsamkeit ausgeführt, und die Bewohner des Ortes sahen eine Woche hindurch von Zeit zu Zeit einen einzigen Leichenkarren mit menschlichen Resten dahinziehen, als ob er Kalk führte. Das Schlimmste dabei war, daß dieser Karren Plassans in seiner ganzen Länge passieren mußte und daß er, auf dem schlechten Pflaster forthumpelnd, bei jedem Stoße Knochenstücke und Häuflein fetter Erde als Spur zurückließ. Keinerlei kirchliche Zeremonie, nur eine langsame, rohe Abfuhr. Niemals fand in einer Stadt ein so widerliches Schauspiel statt.
Mehrere Jahre hindurch blieb der ehemalige Kirchhof von Saint-Mittre ein Gegenstand des Schreckens. Am Rande einer großen Straße für alle Welt offen daliegend, blieb der Ort öde und verlassen, abermals eine Beute wilden Wachstumes. Die Stadt, die ohne Zweifel das Grundstück veräußern wollte, damit es mit Häusern bebaut werde, fand keinen Käufer; vielleicht war es die Erinnerung an den Knochenhaufen und an den vereinzelt durch die Straßen ziehenden, an einen hartnäckigen, bösen Traum gemahnenden Leichenkarren, welche die Leute zurückschreckte; vielleicht auch erklärt sich die Tatsache durch die Lässigkeit der Provinz, durch jenes Widerstreben, das sie gegen alles Niederreißen und Wiederaufbauen hat. Die Stadt behielt das Grundstück, und schließlich geriet der Wunsch, es zu verkaufen, ganz in Vergessenheit. Man unterließ sogar, das Gebiet mit einem Pfahlzaun einzufrieden; jedermann konnte ungehindert ein und aus gehen. Nach und nach gewöhnte man sich im Laufe der Jahre an diesen öden Winkel; man ließ sich auf das Gras am Raine nieder; man ging wohl auch quer über das Stück Feld, kurz: der Ort belebte sich immer mehr. Als die Füße der Spaziergänger den Rasenteppich abgenützt hatten und der festgestampfte Boden grau und hart geworden war, glich der ehemalige Kirchhof einem schlecht geebneten öffentlichen Platze. Um jede peinliche Erinnerung völlig zu tilgen, gewöhnten sich die Bewohner, fast ohne es zu merken, allmählich daran, die Benennung des Gebietes zu ändern; man begnügte sich damit, bloß den Namen des Heiligen zu behalten und legte diesen auch dem Gäßchen bei; man sagte: das »Saint-Mittre-Feld« und das »Saint-Mittre-Gäßchen«.
All dies ist schon lange her. Seit mehr denn dreißig Jahren hat das Saint-Mittre-Feld sein eigenartiges Aussehen. Die Stadt, viel zu lässig und sorglos, um das Grundstück auszunützen, hat es gegen ein geringes Entgelt an die Wagner der Vorstadt verpachtet, die daselbst einen Zimmerplatz eingerichtet haben. Heute noch liegen stellenweise Haufen von riesigen Balken, zehn bis fünfzehn Meter lang, herum, gleich umgestürzten hohen Pfeilern. Diese Balkenhaufen, diese parallel hingelegten Maste, die sich fortsetzen von einem Ende des Feldes bis zum anderen, sind die ewige Freude der Jungen. Einzelne Balken sind herabgeglitten, so daß stellenweise der Boden mit einer Art Parkett, aus runden Stücken bestehend, bedeckt ist, auf dem man nur mit dem Aufgebot halsbrecherischer Balancierkünste dahinschreiten kann. Den ganzen Tag sind Scharen von Kindern da, die sich dieser Leibesübung hingeben. Man sieht sie über die großen Bohlen springen, die schmalen Kanten entlang schreiten, rittlings dahinrutschen, all die verschiedenen Spiele treiben, die gewöhnlich mit einer Keilerei, mit Geheul und Gezeter endigen; oder auch es setzen sich ihrer je ein halbes Dutzend, eng aneinander gedrängt, auf die beiden Enden eines quer über die anderen gelegten Balkens und schaukeln sich stundenlang. Das Saint-Mittre-Feld ist ein Unterhaltungsplatz geworden, auf dem die Vorstadtjungen seit einem Vierteljahrhundert die Hosen zerreißen.
Was diesem verlorenen Winkel vollends einen seltsamen Charakter verliehen hat, ist der alte Brauch der durchziehenden Zigeuner, hier ihre Zelte aufzuschlagen. Sobald eines dieser Häuser auf Rädern, das einen ganzen Stamm enthält, in Plassans eintrifft, läßt es sich im Hintergrunde des Saint-Mittre-Feldes nieder. Der Platz ist denn auch niemals leer; es findet sich stets eine dieser Banden mit ihrem seltsamen Treiben, eine Truppe von braunen Männern und furchtbar dürren Weibern, zwischen denen ganze Scharen schmutziger Rangen sich am Boden wälzen. Dieses Volk lebt ohne Scham im Freien vor aller Welt, kocht seine Suppe, nährt sich von namenlosen Dingen, breitet seine Lumpen aus, schläft, prügelt sich, küßt sich, stinkt von Schmutz und Elend.
Das öde Leichenfeld, wo einst die Drohnen allein die dickblätterigen Blumen in der stillen, schwülen Sonnenglut umsummten, ist ein geräuschvoller Ort geworden, erfüllt von dem Gezanke der Zigeuner und dem Geschrei der jungen Vorstadt-Taugenichtse. Eine Sägerei, die in einem Winkel die Balken des Zimmerplatzes zerlegt, liefert mit ihrem Kreischen eine beständige dumpfe Begleitung zu den hellen menschlichen Stimmen. Die Sägerei ist ganz einfach; das Stück Holz wird quer auf zwei erhöhte Böcke gelegt, und zwei Brettschneider, der eine oben auf dem Balken sitzend, der andere unten, geblendet durch den herabfallenden Sägestaub erhalten eine starke und breite Säge in fortwährender auf- und absteigender Bewegung. Stundenlang neigen sich diese Männer so hin und her gleich Gliederpuppen mit der Regelmäßigkeit und Starrheit von Maschinen. Das von ihnen zu Brettern gesägte Holz ist im Hintergrunde längs der Mauer zwei bis drei Meter hoch aufgeschichtet und gleichmäßig in Kubikform gelegt. Diese Mühlsteinen ähnlichen Vierecke, die manchmal mehrere Jahre lang hier liegen bleiben, bis sie von Moos und Unkraut überwuchert werden, sind mit ein Reiz des Saint-Mittre-Feldes. Es ziehen sich zwischen ihnen verschwiegene, stille Pfade hin, die zu einem etwas breitern Wege führen, der zwischen den Holzstößen und der Mauer freigelassen blieb. Es ist dies ein verlassener Winkel, ein schmaler grüner Fleck, von welchem aus man nur schmale Streifen des Himmels sieht. Auf diesem Wege, dessen Wände mit Moos überzogen sind und dessen Boden mit einem Wollteppich belegt zu sein scheint, herrscht noch der üppige Pflanzenwuchs und die fröstelnde Stille des ehemaligen Kirchhofes. Man verspürt da den lauen, unbestimmten Hauch der Wollust des Todes, wie er aus den im Sonnenbrande glühenden alten Gräbern aufsteigt. Es gibt in der Umgebung von Plassans keinen Ort, wo man so sehr wie hier durch die Einsamkeit und Stille zur Liebe gestimmt würde. Hier ist es köstlich zu lieben. Als der Kirchhof geräumt ward, mußte man in diesem Winkel die Gebeine aufhäufen; heute noch kommt es vor, daß man, den feuchten Boden mit dem Fuße aufwühlend, Schädelstücke zutage fördert.
Übrigens denkt niemand mehr an die Toten, die einst unter diesem Rasen geschlummert. Bei Tage spielen die Kinder Verstecken zwischen diesen Holzstößen. Der grüne Weg bleibt unbekannt und unbenutzt. Man sieht nichts als den staubgrauen Zimmerplatz mit den umherliegenden Pfosten. Des Morgens und Nachmittags, wenn die Sonne ihre Glut herniedersendet, wimmelt das Feld von Menschen; und über all dem regen Treiben, über den Straßenjungen, die zwischen den Hölzern spielen, und den Zigeunern, die das Feuer unter ihren Suppenkesseln anfachen, hebt sich das dürre Schattenbild des Sägearbeiters, der hoch auf seinem Balken sitzt, scharf vom Himmel ab, wie er sich auf- und abwärts bewegt mit der Regelmäßigkeit eines Pendels, wie um das fröhliche, neue Leben zu regeln, das hier auf dem ehemaligen Totenacker erstanden. Nur die Alten, die auf den Balken ausruhen und sich in der Abendsonne wärmen, reden noch manchmal untereinander von den Gebeinen, die sie ehemals auf dem sagenhaften Leichenkarren durch die Straßen von Plassans hatten führen sehen.
Wenn die Nacht hereinbricht, leert sich das Saint-Mittre-Feld und gleicht dann einer tiefen, schwarzen Grube. Im Hintergrunde ist nichts als der matte Schein der Feuerstellen der Zigeuner. Von Zeit zu Zeit sieht man stille Schatten durch die dichte Finsternis huschen. Im Winter hat der Ort ein besonders düsteres Aussehen.
An einem Sonntag abends, gegen sieben Uhr, verließ ein junger Mensch die Saint-Mittre-Gasse und schlich immer die Mauern entlang bis zu den Balken des Zimmerplatzes. Es war in den ersten Dezembertagen des Jahres 1851, und es herrschte eine trockene Kälte. Das Mondlicht hatte die den Wintermonden eigentümliche Klarheit. Der Zimmerplatz glich diese Nacht nicht einer dunklen Höhle wie in den regnerischen Nächten; durch breite Lichtfelder des weißen Mondes erhellt, lag er, den Beschauer zu sanfter Schwermut stimmend, in winterlicher Stille und Unbeweglichkeit da.
Der junge Mensch blieb, vorsichtig sich umschauend, einige Augenblicke am Rande des Feldes stehen. Unter seiner Jacke hielt er den Kolben einer langen Flinte fest, deren zu Boden gesenkter Lauf im Mondlicht glänzte. Er drückte die Waffe fest an sich und warf einen scharf prüfenden Blick auf die Schattenvierecke, die die Bretterstöße im Hintergrunde des Feldes warfen. Es war wie ein Damebrett aus Licht und Schatten mit scharf geschnittenen Feldern. Mitten im Felde standen auf einem kahlen, grauen Fleck die Böcke der Sägearbeiter eng aneinander gereiht, einer ungeheuerlichen geometrischen Figur gleichend, die jemand mit Tinte auf das Papier wirft. Der übrige Teil des Zimmerplatzes, der aus Balken gebildete Estrich, war ein breites Bett, wo das Mondlicht schlief, kaum getrübt durch die schmalen Schattenstreifen, die die aufgehäuften Pfosten hineinwarfen. Diese im Lichte des Wintermondes in eisiger Stille daliegenden Haufen umgestürzter, unbeweglicher Mäste, die gleichsam erstarrt waren in Kälte und Schlaf, erinnerten an die Toten des ehemaligen Kirchhofes. Der junge Mensch warf auf diesen leeren Raum nur einen flüchtigen Blick; kein Wesen, kein Hauch, keine Gefahr, gesehen oder gehört zu werden. Die dunklen Flecke des Hintergrundes beunruhigten ihn mehr. Doch nach kurzer Betrachtung wagte er sich vor und durchschritt rasch den Zimmerplatz.
Sobald er sich in Schatten gehüllt wußte, verlangsamte er seine Schritte. Er befand sich jetzt auf dem grünen Wege längs der Mauer hinter den Bretterstößen. Hier vernahm er nicht mehr das Geräusch seiner Schritte; das gefrorene Gras knisterte kaum unter seinen Füßen. Ein Gefühl der Zufriedenheit schien ihn zu erfüllen. Ihm war, als müsse er diesen Ort lieben, weil er daselbst keine Gefahr zu fürchten, nur Gutes und Liebes zu suchen habe. Er verbarg seine Flinte nicht mehr. Der Weg zog sich gleich einem schattigen Graben dahin. Stellenweise glitt das Mondlicht zwischen zwei Bretterstößen hindurch und warf einen hellen Streifen auf das Gras. Dunkel und Helle lagen gleichmäßig in tiefem, traurigem Schlaf. Nichts war mit der Stille und Ruhe dieses Weges vergleichbar. Der junge Mensch durchschritt ihn in seiner ganzen Länge. An seinem Ende, dort wo die Mauern des Jas-Meiffren einen Winkel bilden, blieb er stehen und horchte, wie um zu hören, ob nicht von dem benachbarten Grundstück her ein Geräusch vernehmbar sei. Als er nichts hörte, bückte er sich, schob ein Brett zur Seite und versteckte seine Flinte unter einem Stoß Holz.
In diesem Winkel fand sich ein alter Grabstein, der bei der Übersiedlung des alten Kirchhofes hier vergessen worden und quer gelegt eine Art hoher Bank bildete. Der Regen hatte die Ränder des Steines zermürbt, und das Moos fraß sich nach und nach in ihn ein. Beim Mondschein konnte man noch einiges von der Grabschrift auf der dem Erdboden zugeneigten Fläche des Grabsteines lesen. »Hier ruht ... Marie ... gestorben ...«, den Rest hatte die Zeit ausgelöscht.
Als der junge Mensch sein Gewehr verborgen hatte, horchte er von neuem, und da er nichts hörte, entschloß er sich, auf den Stein zu steigen. Die Mauer war niedrig; er stemmte die Ellenbogen auf die Mauerkappe. Allein jenseits der Reihe von Maulbeerbäumen, die längs der Mauer stand, sah er nichts als eine mondhelle Ebene; die Felder des Jas-Meiffren dehnten sich im Mondlichte flach und baumlos gleich einem ungeheuren Stück ungebleichter Leinwand aus. In einer Entfernung von etwa hundert Metern bildete das von dem Krautgärtner bewohnte Haus mit den Wirtschaftsgebäuden einen etwas helleren Fleck. Der junge Mensch blickte gespannt nach dieser Seite hin, als eine Turmuhr der Stadt in langsamen, tiefklingenden Schlägen die siebente Abendstunde kündete. Er zählte die Uhrschläge, dann stieg er von dem Steine herab, gleichsam überrascht und ärgerlich.
Er setzte sich auf die Bank wie jemand, der sich gefaßt macht, lange zu warten. Er schien die scharfe Kälte nicht zu spüren. Eine halbe Stunde verharrte er regungslos, die Augen nachdenklich auf eine Schattenmasse geheftet. Er hatte sich in einen dunklen Winkel gesetzt; aber allmählich erreichte ihn der höher steigende Mond, und sein Kopf war hell beleuchtet.
Es war ein Bursche mit aufgewecktem Gesichte, dessen feiner Mund und noch zarte Haut die Jugend verrieten. Er war etwa siebzehn Jahre alt und von einer charakteristischen Schönheit. Sein mageres, langes Gesicht war wie von dem Daumenstrich eines mächtigen Bildhauers geformt; die hügelige Stirne, die vorspringenden Bogen der Augenbrauen, die Adlernase, das breite, flache Kinn, die Wangen mit den vorspringenden Backenknochen verliehen dem Kopfe einen eigenartigen Ausdruck von Kraft und Energie. Mit dem Alter mußte dieser Kopf einen ausgesprochen knochigen Charakter, die Magerkeit eines fahrenden Ritters annehmen. Allein in dieser Zeit erwachender Mannbarkeit, an Kinn und Wangen kaum mit einem schwachen Flaum bedeckt, wurde die Rauheit dieses Kopfes durch gewisse einnehmende Weichheiten gemildert, durch gewisse Winkel des Gesichtes, die noch einen unbestimmten, kindlichen Ausdruck haben. Die Augen von zartschwarzer Färbung, noch in die Unschuld der Jugend getaucht, verliehen diesem energischen Gesicht ebenfalls einen Zug von Sanftmut. Nicht alle Frauen würden diesen Knaben geliebt haben; denn er war weit entfernt von dem, was man einen hübschen Jungen nennt; allein das Ganze seiner Züge zeigte eine so feurige, anziehende Lebendigkeit, eine solche Schönheit der Begeisterung und der Kraft, daß die Dirnen der Gegend, diese heißblütigen Töchter des Südens, wohl von ihm zu träumen begannen, wenn er an schwülen Juliabenden an ihrer Haustüre vorbeikam.
Auf dem Grabstein sitzend, sann er und sann, ohne zu merken, daß er jetzt ganz im Mondlichte saß. Er war von mittlerer, etwas gedrungener Gestalt. Am Ende seiner stark entwickelten Arme saßen Arbeiterhände, die schon durch die Arbeit abgehärtet waren; die kräftigen Füße staken in groben Bundschuhen. Die Gelenke und die Glieder, die schwerfällige Haltung des Körpers kennzeichneten ihn als Sohn des Volkes; allein in der aufrechten Haltung seines Halses und in dem denkenden Ausdruck der Augen lag gleichsam eine stille Auflehnung gegen die Verrohung durch das Tagewerk, das ihn schon zu Boden zu drücken begann. Es mußte eine verständige Natur sein, ertränkt in der Schwerfälligkeit seines Stammes und seines Berufes; einer jener fein gearteten und auserlesenen Geister, die sich im Fleische selbst kundgeben und darunter leiden, daß sie nicht siegreich und strahlend ihre plumpe Hülle verlassen können. Trotz seiner Kraft schien er schüchtern und zaghaft zu sein; er schämte sich gleichsam unbewußt, sich so unvollständig zu fühlen und nicht zu wissen, wie er sich vervollständigen solle. Ein wackeres Kind, dessen Unwissenheit sich in Begeisterung verwandelt hatte; ein Mannesherz, unterstützt durch die Vernunft eines Knaben, der Hingebung fähig wie ein Weib und dabei mutig wie ein Held. An diesem Abend war er mit Beinkleid und Jacke von grünem Wollsammet bekleidet; ein Hut von weichem Filz, der ihm leicht auf dem Hinterkopfe saß, warf einen Schattenstreif auf seine Stirn.
Als die benachbarte Turmuhr die halbe Stunde schlug, fuhr er plötzlich aus seiner Träumerei auf. Er sah sich in voller Beleuchtung und schaute sich besorgt um. Mit einer hastigen Bewegung zog er sich in das Dunkel des Schattens zurück, aber er konnte den Faden seiner Träumerei nicht wiederfinden. Er fühlte jetzt, daß seine Hände und Füße froren, und die Unruhe bemächtigte sich seiner von neuem. Er klomm wieder hinan, um einen Blick nach den Jas-Meiffren zu werfen, der still und öde dalag. Als er dann nicht mehr wußte, wie er die Zeit totschlagen solle, holte er unter dem Bretterhaufen seine Flinte hervor und begann, mit dem Hahn zu spielen. Es war ein langer und schwerer Karabiner, der einst ohne Zweifel irgendeinem Schmuggler gehört hatte; an dem dicken Kolben und der starken Schwanzschraube des Laufes erkannte man die einstige Steinschloßflinte, die ein Büchsenmacher der Gegend zu einer modernen Schießwaffe umgewandelt hatte. Auf den Pachthöfen findet man noch solche Karabiner über den Kaminen hängen. Der junge Mensch tändelte mit seiner Waffe; er ließ wohl zwanzigmal den Hahn spielen, fuhr mit dem kleinen Finger in den Lauf und prüfte aufmerksam den Kolben. Allmählich flammte seine jugendliche Begeisterung auf, in die sich ein Zug von Kinderei mengte. Er legte den Karabiner an die Wange und zielte ins Leere wie ein Rekrut, der sich einübt.
Bald mußte die achte Stunde schlagen. Der junge Mensch hielt seit einer Minute seine Waffe angelegt, als eine Stimme, leise wie ein Hauch, müde und keuchend, aus dem Jas-Meiffren herüber vernehmbar wurde.
Bist du da, Silvère? fragte die Stimme.
Silvère ließ das Gewehr fallen und war mit einem Satze auf dem Grabstein.
Ja, ja, erwiderte er, ebenfalls mit gedämpfter Stimme ... Warte, ich will dir behilflich sein.
Noch hatte er den Arm nicht ausgestreckt, als der Kopf eines jungen Mädchens über der Mauer erschien. Mit seltener Behendigkeit hatte das Kind den Stamm eines Maulbeerbaumes ergriffen und war emporgeklettert wie ein Kätzchen. An der Sicherheit und Leichtigkeit ihrer Bewegungen konnte man sehen, daß sie mit diesem seltsamen Wege wohl vertraut war. In einem Nu saß sie auf der Mauerkappe. Nun nahm Silvère sie in seine Arme und stellte sie auf die Bank. Allein sie wehrte sich.
Laß doch, sagte sie mit munterem Lächeln ... Ich kann allein hinab.
Als sie auf dem Steine stand, fragte sie:
Wartest du schon lange? ... Ich bin gelaufen ... bin ganz atemlos.
Silvère antwortete nichts. Er schien zum Lachen nicht gelaunt und betrachtete das Kind mit bekümmerter Miene. Dann setzte er sich zu ihr und sagte:
Ich wollte dich sehen, Miette, und würde selbst die ganze Nacht auf dich gewartet haben. Morgen mit Tagesanbruch ziehe ich fort.
Miette hatte inzwischen die im Grase liegende Waffe bemerkt. Sie ward sogleich sehr ernst und flüsterte:
Ach, es ist also entschieden! ... da ist deine Flinte.
Sie schwiegen eine Weile.
Ja, ich gehe, sagte Silvère mit schwankender Stimme ... das ist mein Gewehr ... Ich hielt es für besser, es schon heute abend aus dem Hause zu schaffen; morgen würde Tante Dide vielleicht bemerkt haben, daß ich es wegnehme, und es würde sie beunruhigt haben. Ich will es hier verstecken, und ehe wir aufbrechen, will ich mir es holen.
Da es schien, als könne Miette die Augen nicht mehr wegwenden von der Waffe, die er törichterweise im Grase hatte liegen lassen, erhob er sich und schob die Flinte von neuem unter den Holzstoß.
Wir haben heute morgen erfahren, sagte er und nahm neben ihr wieder Platz, daß die Aufständischen von La Palud und von Saint-Martin de Vaulx im Anzuge seien und die letzte Nacht in Alboise zugebracht haben. Es ist beschlossen worden, daß wir uns ihnen anschließen. Heute nachmittag hat ein Teil der Arbeiter von Plassans die Stadt verlassen, die übrigen werden morgen zu ihren Brüdern stoßen.
Das Wort »Brüder« sprach er mit einer wahrhaft knabenhaften Begeisterung aus. Immer lebhafter werdend fuhr er mit scharf vibrierender Stimme fort:
Der Kampf wird unvermeidlich; aber das Recht ist auf unserer Seite; wir werden siegen.
Miette hörte ihm zu und blickte starr vor sich hin. Als er schwieg, sagte sie einfach:
Es ist gut.
Nach einer Weile setzte sie hinzu:
Du hattest mich benachrichtigt ... aber ich hoffte dennoch ... Nun ist's entschieden ...
Sie fanden keine anderen Worte. Der verlassene Winkel des Werkplatzes, der grüne Weg an der Mauer versank wieder in trübes Schweigen; nur der helle Mond warf den Schatten der Holzstöße rund umher auf das Gras. Die Gruppe der beiden jungen Leute auf dem Grabstein war im bleichen Mondlicht unbeweglich und stumm geworden. Silvère hatte den Arm um den Leib Miettes gelegt, und diese lehnte sich an die Schulter des Burschen. Sie tauschten keine Küsse aus, nur eine Umarmung, in der die Liebe die zärtliche Unschuld einer geschwisterlichen Zuneigung annahm.
Miette war in einen großen braunen Mantel mit Kapuze gehüllt, der bis zu ihren Füßen hinunter fiel und sie ganz bedeckte. Man sah bloß ihren Kopf und ihre Hände. Die Frauen aus dem Volke, Bäuerinnen und Arbeiterinnen, tragen in der Provence heute noch diese breiten Mäntel, deren Mode eine recht alte sein muß. Wie sie gekommen war, hatte Miette die Kapuze zurückgeworfen. Als heißes junges Blut, das im Freien lebte, trug sie niemals eine Haube. Ihr unbedeckter Kopf hob sich kräftig von der mondbeleuchteten Mauer ab. Es war ein Kind, im Begriffe zum Weibe zu reifen. Sie befand sich in jenem unbestimmten, liebenswürdigen Alter, wo das Kind zur Jungfrau wird. In diesem Alter hat jedes Mädchen die Zartheit der sprießenden Knospe, eine Unfertigkeit der Formen, die einen köstlichen Reiz hat; in der unschuldigen Schmächtigkeit der Kindheit äußern sich schon die ersten Anzeichen der vollen, wollüstigen Linien der Erwachsenen; das Weib löst sich los mit der ersten züchtigen Verwirrung, noch zur Hälfte das Aussehen des kleinen Mädchens bewahrend und unwillkürlich in jeden seiner Züge das Zeugnis seines Geschlechtes legend. Für manche Mädchen ist dies eine schlimme Stunde; sie schießen plötzlich in die Höhe, werden häßlich, gelb, gebrechlich wie allzu rasch gediehene Pflanzen. Für Miette und für alle, die blutreich sind und in der freien Luft leben, ist's eine Stunde alles durchdringender Anmut, wie sie niemals wiederkehrt. Miette war dreizehn Jahre alt. Obgleich sie schon stark war, würde man sie doch nicht für älter gehalten haben, so sehr erhellte sich ihr Antlitz manchmal in einem frohen, kindlich-unschuldigen Lachen. Sie mußte übrigens schon mannbar sein; das Weib entwickelte sich sehr früh in ihr dank dem Klima und dem arbeitsamen Leben, das sie führte. Sie war fast so groß wie Silvère, stark und strotzend von Leben und Gesundheit. Gleich ihrem Freunde war auch sie von nicht gewöhnlicher Schönheit; man konnte sie nicht häßlich finden, aber sie mußte vielen jungen Leuten mindestens seltsam erscheinen. Sie hatte prachtvolles Haar; dicht und gerade in der Stirne wurzelnd, fiel es machtvoll zurück gleich einer aufspringenden Woge, dann floß es über Scheitel und Nacken herab wie eine tintenschwarze, launische, wellige Flut. Das Haar war so dicht, daß sie es nicht zu bewältigen vermochte und es ihr eine Last war. Sie wickelte es in mehrere Knoten von der Größe einer Faust zusammen, so stark sie nur konnte, damit es so wenig Platz wie möglich einnehme, und steckte es am Hinterkopfe auf. Sie hatte keine Zeit, sich lange mit ihrem Kopfputz zu beschäftigen, aber diese riesige Haarflechte, ohne Spiegel und in aller Hast gewunden, gewann unter ihren Fingern dennoch eine ungewöhnliche Anmut. Wenn man sie mit diesem lebendigen Helm bedeckt sah, mit diesem Haufen krauser Haare, die in reicher Fülle über Schläfen und Nacken hinabflössen gleich einem Tierfell, begriff man, weshalb sie unbedeckten Hauptes ging, unbekümmert um Sturm und Wetter. Unter der dunkeln Linie des Haares hatte die sehr niedrige Stirne die Form und die goldschimmernde Farbe eines Halbmondes; die vorspringenden, großen Augen; die kurze, an den Flügeln breite, am Ende aufgestülpte Nase; die allzu starken und allzu roten Lippen: sie würden häßlich geschienen haben, wenn man sie einzeln betrachtet hätte. Allein wenn man sie in der reizenden Rundung des Antlitzes, in dem regen Spiel des Lebens sah, bildeten diese Einzelheiten des Gesichtes ein Ganzes von seltsamer und ergreifender Schönheit. Wenn Miette lachte, den Kopf rückwärts leicht auf die rechte Schulter neigend, glich sie der antiken Bacchantin mit ihrer von hellem Frohsinn geschwellten Brust, ihren runden, vollen Kinderwangen, ihren breiten, weißen Zähnen, ihren Wülsten krauser Haare, welche die Ausbrüche der Freude auf ihrem Nacken tanzen ließen, gleich einem Kranze von Weinlaub. Um in ihr die Jungfrau, das Mädchen von dreizehn Jahren zu erkennen, mußte man sehen, wie viel Unschuld in diesem hellen, geschmeidigen Lachen des reifen Weibes lag, mußte man insbesondere die noch kindliche Zartheit des Kinns und die weiche Reinheit der Schläfen sehen. Das von der Sonne angehauchte Antlitz Miettens nahm an gewissen Tagen den Schein des Bernsteins an. Ein feiner, schwarzer Flaum warf bereits einen leichten Schatten auf ihre Oberlippe. Die harte, unaufhörliche Arbeit begann bereits ihre kurzen, kleinen Hände zu verunstalten, die bei einem müßigen Leben liebliche, fette Hände einer kleinen Bürgerin geworden wären.
Miette und Silvère blieben lange stumm; sie suchten in ihren unruhigen Gedanken zu lesen und in dem Maße, wie sie sich zusammen in die Angst und in das Unbekannte des kommenden Tages versenkten, ward ihre Umarmung fester und inniger. Das Mädchen konnte indes nicht länger an sich halten; sie drohte zu ersticken und sprach in einem Satze den Gedanken aus, der beide beunruhigte.
Du wirst wiederkehren, nicht wahr? stammelte sie, indem sie sich Silvère an den Hals warf.
Silvère fand keine Antwort; die Kehle war ihm wie zugeschnürt, und er fürchtete in Tränen auszubrechen wie sie. Er küßte sie wie ein Bruder, der keinen anderen Trost findet. Sie lösten sich aus der Umarmung und versanken wieder in das frühere Stillschweigen.
Nach kurzer Zeit fuhr Miette fröstelnd zusammen. Sie lehnte sich nicht mehr an die Schulter Silvère's; sie fühlte ihren Körper zu Eis erstarren. Noch am vorhergehenden Abend würde sie nicht so gefroren haben in dieser verlassenen Allee auf diesem Grabstein, wo sie schon seit einigen Jahren, in der Stille des alten Kirchhofes, so glücklich ihrer Liebe lebten.
Mich friert's! sagte sie, und schlug die Kapuze ihres Mantels herauf.
Wollen wir einen Gang machen? fragte der junge Mensch. Es ist noch nicht neun Uhr; wir können einen Spaziergang auf die Straße machen.
Miette dachte, daß sie vielleicht lange Zeit nicht wieder die Freude eines Stelldicheins haben werde, einer jener Abendplaudereien, die sie tagelang ersehnte.
Ja, gehen wir, sagte sie lebhaft; gehen wir bis zur Mühle. Ich bleibe die ganze Nacht bei dir, wenn du willst.
Sie stiegen von der Bank herab und verbargen sich hinter einem Bretterhaufen. Hier öffnete Miette ihren wattierten, mit rotem Wollstoff gefütterten Mantel und warf einen Flügel dieses breiten und warmen Kleidungsstückes über die Schulter Silvères, ihn so ganz einhüllend und in einem und demselben Kleidungsstücke an sich schließend. Sie legten sich wechselseitig einen Arm um den Leib, um so nur eins auszumachen. Als sie dergestalt zu einem Wesen verschmolzen waren, als sie dermaßen in die Falten des Mantels eingehüllt waren, daß sie jede menschliche Form verloren, setzten sie sich mit kurzen Schritten in Gang, wandten sich nach der Heerstraße und durchschritten furchtlos die mondhellen Räume des Werkplatzes. Miette hatte Silvère eingehüllt und dieser hatte sich dem Beginnen in einer ganz natürlichen Weise gefügt, als ob der Mantel ihnen jeden Abend den nämlichen Dienst geleistet habe.
Auf der Straße nach Nizza, zu deren beiden Seiten die Vorstadt erbaut war, standen noch im Jahre 1851 hundertjährige Ulmen, alte Riesen, großartige, mächtige Ruinen, welche die weise Stadtverwaltung seither durch kleine Platanen ersetzt hat. Als Silvère und Miette unter den alten Bäumen angelangt waren, deren knotige, unförmlich verschränkte Zweige ihre Schatten auf den vom Monde beleuchteten Fußweg warfen, begegneten sie zwei- oder dreimal dunklen Massen, die sich eng an den Häusern vorwärtsbewegten. Es waren Liebespärchen wie sie, dicht eingeschlossen in den Zipfel eines Überwurfes, im Dunkel des Schattens ihre stille Liebe spazieren führend.
Die Liebenden in den Städten des Südens haben diese Art spazieren zu gehen. Die Burschen und Mädchen aus dem Volke, die eines Tages Mann und Frau werden sollten, aber gern geneigt sind, sich auch schon vorher zu umarmen und zu küssen, wissen nicht, wohin sie flüchten sollen, um ungestört ein Küßchen auszutauschen, ohne sich allzusehr dem Klatsch auszusetzen. Obgleich die Eltern ihnen volle Freiheit lassen, würden sie doch, wenn sie in der Stadt ein Zimmer mieten wollten, um da allein zu sein, schon am nächsten Tage der Gegenstand des allgemeinen Ärgernisses sein; anderseits haben sie nicht jeden Abend Zeit, die Einsamkeit im Freien zu suchen. Da nehmen sie denn zu einem Auskunftsmittel ihre Zuflucht; sie gehen in die Vorstädte auf die leeren Flecke, in die Alleen der Heerstraße, kurz an alle Orte, wo es wenig Leute und viele Schlupfwinkel gibt. Und da sich alle Leute gegenseitig kennen, tun sie ein übriges an Vorsicht und machen sich unkenntlich, indem sie sich in ihre weiten Mäntel einhüllen, in denen eine ganze Familie Platz fände. Die Eltern dulden diese Spaziergänge im nächtlichen Dunkel; die Sittenstrenge der Gegend scheint darüber nicht entrüstet zu sein. Man weiß, daß die Verliebten in keinem Winkel stehen bleiben, auf den verlassenen Wiesengründen sich nicht niederlassen, und das genügt, um die Besorgnisse der Züchtigen zu beschwichtigen. Während des Spazierganges können sie sich höchstens küssen. Indessen kommt es doch manchmal vor, daß eine Dirne fällt. Dann weiß man, daß das Liebespärchen sich gesetzt hat.
Es gibt in Wahrheit nicht Reizenderes als diese Liebes-Spaziergänge. Da äußert sich voll und ganz die einschmeichelnde und erfinderische Einbildungskraft des Südens. Es ist ein wirklicher Mummenschanz, ergiebig an kleinen