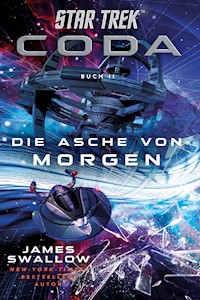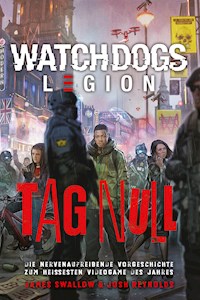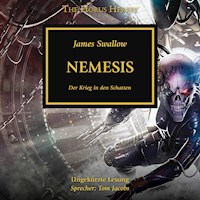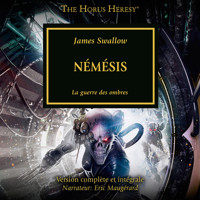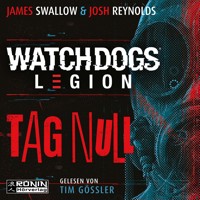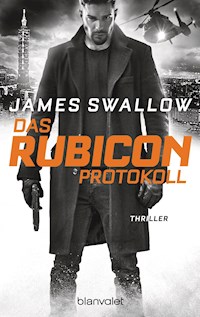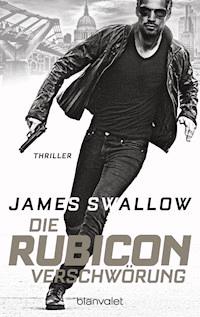
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Marc Dane
- Sprache: Deutsch
Finde den Verräter. Kämpfe ums Überleben. Vertraue niemandem.
Marc Dane ist Agent beim Britischen Geheimdienst. Er ist der Typ am Computer, der Technikexperte jenseits der Action. Als er nach einem brutalen Anschlag auf sein Team als einziger Überlebender zurückbleibt, kämpft er plötzlich an vorderster Front. Nicht nur muss er sein Land vor einer düsteren Bedrohung retten, er muss auch seine eigene Unschuld beweisen. Völlig auf sich allein gestellt, bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Hilfe der toughen Agentin Lucy Keyes anzunehmen. Keyes weiß, was es bedeutet, niemandem vertrauen zu können. Und sie verfügt über all jene Fähigkeiten, ohne die Dane den bevorstehenden Kampf nicht überleben kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 814
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
JAMES SWALLOW
DIE RUBICON-
VERSCHWÖRUNG
THRILLER
Deutsch von Leo Strohm
Buch
Marc Dane ist Mitglied einer Spezialeinheit des britischen Geheimdienstes. Er ist Computer- und Technikspezialist und unterstützt die operativen Kräfte, ohne normalerweise selbst in lebensbedrohliche Situationen zu geraten. Doch nachdem seine Einheit in Frankreich in einen Hinterhalt gelockt wird, bleibt Marc als einziger Überlebender zurück. Es gelingt ihm, sich nach London zur Zentrale des MI6 durchzuschlagen, nur hat er nicht damit gerechnet, dort selbst als Drahtzieher des Anschlags verdächtigt zu werden. Da er nicht weiß, wem er in seiner eigenen Organisation noch vertrauen kann, flieht er, um auf eigene Faust Ermittlungen anzustellen. Zum einen muss er seine Unschuld beweisen, zum anderen muss er sein Land vor einer düsteren Bedrohung retten. Als er auf seiner Mission in eine Falle gerät, kommt ihm unerwartet die Scharfschützin Lucy Keyes zu Hilfe. Völlig auf sich allein gestellt, bleibt Marc nichts anderes übrig, als fortan mit der toughen Agentin zusammenzuarbeiten. Keyes weiß ebenfalls, was es bedeutet, niemandem vertrauen zu können. Und sie verfügt über all jene Fähigkeiten, ohne die Dane den bevorstehenden Kampf nicht überleben kann.
Autor
James Swallow wurde für seine Drehbücher unter anderem für einen BAFTA Award nominiert und hat zahlreiche erfolgreiche Video- und Hörspiele, Kurzgeschichten und Science-Fiction-Romane verfasst. Mit Die Rubicon-Verschwörung legt er seinen ersten Thriller vor. James Swallow lebt und arbeitet in London.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet
und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Für Mum und Dad,
denen ich die Landkarte zu verdanken habe,
und für Mandy,
die den Kompass dazu hatte.
Dieses Buch ist dem Andenken an Darren Mills gewidmet.
1
Der Tag neigte sich seinem Ende entgegen, aber noch immer lag eine drückende Hitze über der Stadt.
Barcelona flimmerte wie eine Fata Morgana, während die aufgeheizte Luft aus den engen Straßen in den wolkenlosen Himmel aufstieg. Pasco klopfte mit der zusammengerollten El Periodico rhythmisch auf seine Schulterklappen mit den Rangabzeichen eines Sergeanten. Das Uniformhemd klebte an seiner breiten Brust, aber das fiel ihm gar nicht auf. Pasco war ein Sohn dieser Stadt, in vierter Generation. Er war unter der Sonne der Balearen groß geworden, was man seinem alten, faltigen Kalbsledergesicht auch deutlich ansah.
Er schob sich zwischen den Touristengrüppchen und den Einheimischen hindurch, ohne sie richtig wahrzunehmen. Die blassblaue Uniform der Mossos d’Esquadra und die Mütze mit dem roten Band erledigten ohnehin den Großteil der Arbeit und bahnten ihm einen Weg durch die Menschenmenge. Jetzt, wo die Sonne hinter den Häuserdächern verschwunden war, beendete die erste Welle der Nachtschwärmer ihre Siesta und strömte ins Freie, um sich zu amüsieren. Blasse Deutsche und noch blassere Briten waren auch darunter. Sie mussten sich erst noch an die Hitze gewöhnen und waren froh über die etwas kühleren Temperaturen und die Straßencafés in diesem Teil der Altstadt. Dazu hatten sich mit Sicherheit auch schon ein paar Kleinkriminelle, Taschendiebe und Trickbetrüger unter die Menge gemischt.
Allerdings waren sie in dieser Ecke der Ciutat Vella vermutlich eher dünn gesät. Der Grund dafür war die imposante, glatte Steinfassade der Hauptpolizeiwache in der Nou de la Rambla. Es war ein nüchternes Gebäude aus weißem Stein und blau getönten Fensterscheiben, ein Paradebeispiel für den modernistischen Geist, der die Stadt im Lauf der vergangenen Jahrzehnte erobert hatte.
Als Pasco den Innenhof der Wache überquerte, kam ihm Enrique entgegen. Die beiden Polizeibeamten begrüßten einander mit einem Nicken. Enrique zeigte auf die Zeitung. »Na, Abello? Bist du schon fertig?« Er lächelte und entblößte dabei eine Reihe nikotingelber Zähne.
Pasco faltete mit großer Geste die Zeitung auseinander. Es war ein kleines Ritual, das sie einmal pro Woche miteinander vollzogen, immer wenn das neue Querdenker-Kreuzworträtsel veröffentlicht wurde. Er zeigte es Enrique. Jedes Kästchen war fein säuberlich mit einer sorgfältigen, klaren Handschrift ausgefüllt.
Der Jüngere verzog das Gesicht. Pasco wusste, dass sein Kollege mit dem Rätsel noch nicht fertig war, und das bedeutete, dass Enrique ihm ein Päckchen von den guten Zigarillos kaufen musste. Das war der wöchentliche Einsatz.
»Komisch, du scheinst ja mit einem Mal viel besser geworden zu sein«, wunderte sich Enrique, und in seiner Stimme lag eine gehörige Portion Misstrauen.
Pasco zuckte nur mit den Schultern. »Muss die Hitze sein. Die macht mich schlauer.«
Enriques Miene wurde noch misstrauischer. »Wenn ich dich beim Betrügen erwische, dann kippe ich dir einen Haufen Katzenscheiße in die Schreibtischschublade.« Er lächelte geschlagen und ging weiter.
Pasco schnaubte. Schon bald, vielleicht in ein, zwei Wochen, wenn er so oft gewonnen hatte, dass er Enriques Vorsprung aufgeholt hatte, würde er sein Geheimnis lüften. Es war ein Geburtstagsgeschenk seines Enkels, ein elektronisches Spielzeug, in dem sein ganzes Adressbuch mit allen Geburtstagen und Telefonnummern gespeichert war. Darüber hinaus enthielt es eine riesige Datenbank mit Wörtern und Redewendungen in verschiedenen Sprachen, die Pasco schon öfter sehr nützlich gewesen war, wenn er mit ausländischen Touristen zu tun gehabt hatte. Und dann gab es da noch die Wörterbuchfunktion, die einem alle möglichen Vorschläge machte, wenn man nur ein paar Buchstaben eines Wortes kannte.
Er musste an seinen Sohn denken und bekam sofort ein schlechtes Gewissen. Er hätte ihn eigentlich gestern anrufen sollen, aber dann war er nach der Arbeit noch mit ein paar Kollegen in eine Bar gegangen und hatte über dem gemeinschaftlichen Vergnügen und allerlei derben Scherzen die Zeit vergessen.
Pasco seufzte. Sein Sohn machte sich Sorgen um ihn, jetzt, wo seine Mutter im Himmel war. Papa, jemand wie du sollte nicht mehr auf der Straße Dienst tun, sagte er immer wieder. Polizist ist ein Job für Männer in meinem Alter, nicht in deinem. Lass dich doch an einen Schreibtisch versetzen.
Einen Schreibtisch …! Die bloße Vorstellung löste bei Pasco Beklemmungen aus. Er liebte diese Stadt wie sein Eigentum, und sie Tag für Tag nur vom Schreibtisch aus der Distanz beobachten zu können … Sein Sohn konnte nicht begreifen, dass das für ihn wie ein schleichender Tod wäre, langwierig und schmerzhaft, genau wie der Krebs, der seine wunderschöne Rosa dahingerafft hatte.
Er trat durch die Glastüren in das Foyer der Wache und wurde von einer Geräuschkulisse aus Gesprächen und Bürolärm empfangen. Dann ging er durch den bogenförmigen Metalldetektor und nickte dem Mann am Bildschirm geistesabwesend zu. Der Scanner piepste. Ein anderer Beamter winkte ihn mit einer nachlässigen Kopfbewegung durch.
Pasco legte seine Mütze ab und versuchte, die Gedanken an seine Familie beiseitezuschieben. Er musste sich jetzt um Wichtigeres kümmern. Manchmal kam es ihm vor, als wäre sein Sohn von einem anderen Stern. Ständig dieses Gerede über die globale Klimaerwärmung, die die Sommer unerträglich machte, die Skandale der Superreichen und die Kriege in anderen Ländern, wo die Menschen sich aus Gründen gegenseitig umbrachten, die Pasco nicht einmal ansatzweise verstehen konnte.
Er seufzte. Genau deswegen las er die Nachrichten in der Zeitung nicht mehr. Alles viel zu deprimierend. Ihn interessierte mittlerweile nur noch das Kreuzworträtsel. Sonst nichts.
Erst jetzt nahm Pasco den Jungen wahr und ärgerte sich ein bisschen über sich selbst, weil er so mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt gewesen war. Das war kein Grund, weniger aufmerksam zu sein.
Der Junge war vielleicht siebzehn, achtzehn Jahre alt. Es war schwer zu sagen. Er hatte ein blasses Gesicht, dichte Augenbrauen und dunkle Augen, in denen Furcht zu erkennen war. Schwarze Locken lugten unter einer braunen Malermütze hervor, und dazu trug er einen schlammfarbenen Jogginganzug. Mit unsicheren Schritten – es sah fast so aus, als wären ihm die Turnschuhe zu klein – ging er auf den mächtigen Empfangstresen zu, wo Tomás, der diensthabende Beamte, gerade einen jüngeren Kollegen anmaulte.
Der Junge merkte, dass Pasco ihn ansah, und zuckte zusammen wie nach einer Ohrfeige. Der Sergeant betrachtete ihn aufmerksam. Er war völlig erschöpft, schweißgebadet, und am Hals waren ein paar rote Striemen zu erkennen.
Aber es waren seine Augen, die Pasco sofort in ihren Bann zogen. Dieser Jugendliche blickte so ernsthaft in die Welt, wie es nur junge Menschen konnten. Er erkannte darin seinen Sohn und seinen Enkel wieder.
Der Junge im Jogginganzug blinzelte, als wolle er gleich etwas sagen, dann gaben seine Beine nach. Er landete unsanft auf dem harten Fliesenboden und blieb liegen. Die Menschen hörten den Aufprall, der durch das ganze Foyer hallte, und starrten den Jungen an.
Pasco war sofort an seiner Seite, kniete sich neben ihn und wollte ihm helfen. Er sah krank aus – nicht wie ein Junkie auf Entzug, sondern eher wie jemand, der schon lange Zeit an einer schweren Krankheit litt, die ihn langsam innerlich auffraß. »Ist dir nicht gut, mein Junge?«, erkundigte sich der Sergeant. »Was ist denn los mit dir? Brauchst du einen Arzt?«
Der Blick, den Pasco dafür erntete, sagte ihm, dass der Junge kein Wort Spanisch sprach. Ein Teil seines Gehirns – der professionelle, hoch konzentrierte Teil, in dem er nur Polizist war – schätzte den Jungen bereits ein und überlegte, wie er ihn am besten in der täglichen Routine der Akten und Berichte unterbringen konnte. »Wo kommst du her?« Er hatte die Frage gestellt, ohne darüber nachzudenken. Der schweigsame Jugendliche sah ihn nur mit ernsthaften Augen an.
Der Sergeant blickte sich um und entdeckte ein vertrautes Gesicht in einer gelb-orangefarbenen Sanitäterjacke. »Noya!« Er rief den Namen der jungen Frau, die ohnehin schon auf ihn zukam. Sie hatte auch ihren Notfallkoffer dabei.
Noya war oft hier auf der Wache. Die zierliche Katalanin war Rettungssanitäterin im nahe gelegenen Krankenhaus, und wenn die Wache einen Notfall meldete, dann war es in der Mehrzahl der Fälle ihr Team, das alarmiert wurde. Pasco mochte sie, obwohl viele seiner Kollegen sie nicht leiden konnten. Sie war schroff und streng, aber außerordentlich tüchtig.
»Hilf mir, ihn auf die Bank da drüben zu legen«, sagte sie. Sie stützten den Jugendlichen und brachten ihn zu einer Holzbank im Wartebereich. Die Leute, die daraufsaßen, machten nach einer lautstarken Anweisung der Sanitäterin Platz und huschten davon, sodass Pasco den Jungen hinlegen konnte.
Seine Atmung ging jetzt in kurzen, schnellen Stößen, wie bei einem verängstigten Tier.
Es wurde zunehmend stiller im Foyer, während den Menschen bewusst wurde, was sich hier gerade abspielte. Für einen Moment unterbrachen sie ihre eigenen, kleinen Dramen, um sich diesem hier zu widmen. Manche kamen näher, um besser sehen zu können.
Noya schnipste mit den Fingern, um die Aufmerksamkeit des Jungen zu bekommen. »Hallo. Kannst du mich hören?«
»Ich glaube, er versteht dich nicht«, meinte Pasco.
Sie legte die Finger an seine Halsschlagader, tastete nach dem Puls. »Ein Hitzschlag ist es nicht«, sagte sie. Sie griff nach dem Reißverschluss seiner Trainingsjacke, doch der Junge legte die Hand darauf und hinderte die Sanitäterin daran, die Jacke zu öffnen. Jetzt war noch etwas anderes in seinem Blick zu sehen: Angst. Er versuchte zu sprechen, brachte aber nur ein trockenes Hecheln hervor.
»Ich muss den Reißverschluss aufmachen«, sagte Noya streng. Sie zeigte ihm ihr Stethoskop. »Zum Abhören.« Sie redete laut und betonte jedes Wort überdeutlich, als hätte sie es mit einem begriffsstutzigen Kind zu tun.
Der Junge blickte an ihr vorbei zu Pasco und versuchte erneut, etwas zu sagen. Er leckte sich die spröden Lippen und presste unter größter Anstrengung ein Wort hervor.
Der Sergeantverstand nur die Hälfte und beugte sich nach vorne. Der Junge versuchte es erneut, und dieses Mal konnte Pasco sein Flüstern deutlich verstehen.
»Shahiden.«
Damit konnte er nichts anfangen. Er runzelte die Stirn.
»Zurück«, schnauzte Noya ihn an. »Lass mich meine Arbeit machen.« Sie griff erneut nach dem Reißverschluss, und wieder wehrte sich der Junge. Missmutig verzog sie das Gesicht. »Ich habe keine Zeit für so was.« Sie holte ein leuchtend orangefarbenes Plastikteil aus der Tasche – ein Rettungsmesser, das sie vor allem bei Verkehrsunfällen brauchte, um Sicherheitsgurte durchzuschneiden. Doch Noya handhabte das Werkzeug mit chirurgischer Präzision. Mit einer einzigen, geschmeidigen Bewegung setzte sie es am Kragen der Trainingsjacke an und schlitzte das ganze Ding auf.
Pasco war, wie verlangt, ein, zwei Schritte zurückgewichen, damit Noya genügend Platz hatte. Ihr Partner, ein hagerer Portugiese, kam mit einer zusammenklappbaren Trage gerade durch das Foyer gelaufen. Der Junge wiederholte das Wort, und Pasco zog, ohne nachzudenken, sein Geburtstagsgeschenk aus der Tasche und drückte auf die ÜBERSETZER-Taste. So gut er konnte, sprach er das Wort, das er gehört hatte, in das winzige Mikrofon des Geräts.
Es war keine Übertreibung zu sagen, dass Jadeed sich noch nie in derart luxuriösen Räumen aufgehalten hatte. Die Suite im obersten Stockwerk des Hilton war ihm so fremd, dass er kaum Worte dafür fand. Aber das würde er den anderen Männern verschweigen. Schließlich wollte er nicht, dass sie sich über ihn lustig machen, ihn für provinziell und weltfremd hielten. Das hätte Jadeed nicht gefallen.
Trotzdem, die Suite war deutlich größer als die Wohnung in jenem Slum von Jeddah, in der er aufgewachsen war. In der ersten Nacht hatte er in dem riesigen, weichen Bett einfach keinen Schlaf gefunden. Ständig war er aufgewacht und hatte geträumt, von einem riesigen, leeren Raum verschluckt zu werden. Er hatte das Bettzeug genommen und sich im Wohnzimmer ein Nachtlager bereitet, hinter einem langen Sofa, sodass er von der Tür aus nicht zu sehen gewesen war. Dann war ihm wohler gewesen.
Jetzt nippte er an einem Wasserglas und ging quer durch das Zimmer zu einem der vom Boden bis zur Decke reichenden Fenster. Es erschien ihm falsch, dass so viel Raum nur für eine einzige Person gedacht sein sollte. Das spürte er tief im Inneren, als wäre es ein Verbrechen. Es war Verschwendung. Aber andererseits … das war westlich.
Am offenen Fenster fühlte er sich schon wohler. Niedrig stand der Mond bereits am Himmel, und in ganz Barcelona gingen jetzt die Lichter an, an der Diagonal Mar ebenso wie im Stadtzentrum. Sechzehn Stockwerke unter ihm, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, lagen die Restaurantterrassen eines Einkaufszentrums, von wo der Lärm der ersten abendlichen Gäste bis zu ihm nach oben drang.
Er nahm an einem niedrigen Tischchen Platz und steckte sich eine der tschechischen Zigaretten an, die sein einziges Laster darstellten. Er nahm einen tiefen Zug, warf das Streichholz in einen gläsernen Aschenbecher und stieß dann eine Wolke blauen Rauchs aus.
Neben dem Aschenbecher lagen ein kompaktes, aber leistungsstarkes Bushnell-Fernglas, ein Funk-Headset und ein flaches, glattes Smartphone. Jadeed stupste es mit dem Finger an, drehte es gedankenverloren im Kreis. Obwohl das Gerät rein äußerlich kaum von anderen modernen Smartphones zu unterscheiden war, war es stark modifiziert worden. Unter der Hülle aus gebürstetem Aluminium war kaum ein Originalbauteil erhalten geblieben. Jadeed hatte sich zwar ein gesundes Misstrauen gegenüber der modernen Technologie erhalten, aber intelligentere Männer als er selbst hatten ihm gesagt, dass das Ding sicher sei, und er war klug genug gewesen, keine weiteren Fragen zu stellen.
Das Smartphone summte, und er blinzelte überrascht. Er drückte seine Zigarette aus, hängte sich die rautenförmige Halterung des Headsets über das rechte Ohr und tippte auf das Display. Jetzt waren zahlreiche bunte Icons und eine fortwährend an- und abschwellende Wellengrafik darauf zu erkennen.
Eine stark hallende Stimme drang an sein Ohr. »Ich sehe alles.« Khadirs Worte waren klar und deutlich zu verstehen, als würde er direkt hinter Jadeed stehen. Nur das geisterhafte Rauschen im Hintergrund verriet, dass der Mann am anderen Ende der Leitung Tausende Kilometer weit entfernt war. Die minimale Verzögerung war ohne Zweifel dem komplizierten Weg geschuldet, den das Signal dieses streng geheimen Anrufs nehmen musste – von verschiedenen Satelliten einmal um den Erdball gejagt und dann noch auf beiden Seiten durch einen Chiffrierfilter gezwängt.
Jadeed nickte. »Es muss bald so weit sein.« Er griff nach dem Fernglas und suchte die Dächer ab. Schnell hatte er gefunden, was er suchte. Einen Augenblick später warf er einen Blick auf das Smartphone und startete mit einer Berührung eine bestimmte App. Ein Fenster mit einer Countdown-Anzeige klappte auf, und Jadeed sah, wie die Zahlen sich beständig der Null näherten. Khadir – das wusste er – hatte dieselbe Anzeige vor sich.
Jetzt war die Zwei-Minuten-Marke erreicht. Die Uhr fing an rot zu blinken. »Hundertundzwanzig Sekunden«, murmelte die Stimme. »Wir haben unser Ziel vor Augen.«
Jadeed lächelte leise. »Hat es je einen Moment gegeben, wo wir es aus dem Auge verloren hätten?«
Khadir kommentierte diese Äußerung nicht. »Hat der Träger vor dem Einsatz irgendwelche Schwierigkeiten gemacht?«
Jadeed warf einen Blick auf die Finger seiner rechten Hand. Sie waren immer noch leicht gerötet, weil er gezwungen gewesen war, eine Disziplinarmaßnahme zu ergreifen, und sich zu diesem Zweck die Stahlkugeln seiner Gebetskette, der Misbaha, wie einen Schlagring fest um die Hand gewickelt hatte. »Nein«, log er. In der sich anschließenden Stille ergänzte er seine Antwort: »Nichts von Bedeutung.«
Falls Khadir das kurze Zögern wahrgenommen hatte, dann ließ er es unkommentiert. »Ich bin froh, dass du diese Sache persönlich in die Hand genommen hast«, sagte er. »Du verstehst doch, dass ich in diesem Fall Augen brauche, denen ich absolut vertrauen kann, nicht wahr?«
»Natürlich.« Tatsache war, dass es viele Männer gab, denen Khadir diesen Auftrag hätte übertragen können, Männer, die nur allzu gerne bereit gewesen wären, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Doch diese Angelegenheit war zu bedeutend, als dass man sie Handlangern überlassen durfte. »Meine Abreise ist bereits arrangiert.« Jadeed hatte die Suite zwar noch einen Tag länger gemietet, aber es würde nur noch wenige …
Er warf einen Blick auf das Smartphone. Nur noch sechzig Sekunden. Er nahm das Fernglas wieder in die Hand und suchte das Ziel. »Das ist der Moment, den die Amerikaner den Augenblick der Wahrheit nennen würden«, sagte Jadeed fast wie zu sich selbst.
»Wie passend«, bemerkte Khadir.
Der Junge versuchte, Noya daran zu hindern, allerdings nur schwach und halbherzig, als hätte er nicht mehr genügend Energie dafür. Er stöhnte laut, als Noya das Stethoskop an seine Brust drückte. Mit der anderen Hand fuhr sie sanft über seinen Oberkörper und drückte mit ihren kurzen, in Latexhandschuhen gefangenen Fingern auf sein Fleisch. Bei jeder Berührung zuckte er zusammen.
Die Sanitäterin stieß einen unterdrückten Fluch aus, packte das T-Shirt des Jungen und entblößte mit einem weiteren Schnitt seine Brust.
Pasco hörte, wie Noyas Kollege scharf einatmete. Er hörte sogar, wie der Portugiese die Luft anhielt. Dabei verzerrte sich sein Gesicht. Er kannte diesen Gesichtsausdruck – Ekel und Abscheu, hastig verborgen hinter einer professionell-distanzierten Fassade. Einer der Touristen, der die Szene ebenfalls beobachtet hatte, fing an zu würgen und wurde aschfahl im Gesicht.
Pasco konnte nicht anders, er musste ebenfalls einen Blick riskieren und bedauerte es sofort. Kaum hatte er gesehen, was dem Jungen angetan worden war, bekreuzigte er sich. »Santa Maria …«
Mit einem Mal spürte er sein Alter, erschien ihm jeder einzelne seiner Knochen schwer wie Blei. Es war erschütternd, dass es Menschen gab, die einem anderen solch schreckliches Leid zufügen konnten.
Ein leises, digitales Pling lenkte seine Aufmerksamkeit zurück zu dem elektronischen Spielzeug, das er in seinen dicken Fingern hielt. Es bot ihm eine Übersetzung an, und das Blut gefror ihm in den Adern.
Shahiden (arabisch, Nomen), stand da. Märtyrer.
Noya sagte: »Ich glaube, da ist etwas …«
Das feuchte Röcheln des Jungen war das Letzte, was Pasco Abello hören sollte.
Im einen Moment war da nichts anderes als ein Meer aus roten Dachziegeln, aber schon einen Augenblick später füllte eine grauschwarze Blüte aus Staub und Trümmern die Optik des Fernglases voll und ganz aus. Jadeed ließ es sinken, als die Schallwellen der Explosion die drei Kilometer bis zu seinem Balkon zurückgelegt hatten, ihn spürbar erschütterten und an den hohen Fenstern rüttelten.
Er machte die Augen zu und führte sich die Wirkung der Waffe bildlich vor Augen, ja, er weidete sich richtiggehend daran. Der erste, gleißend helle Blitz der eigentlichen Detonation und die komprimierte Luft, die sich ringförmig im Inneren der Polizeiwache ausbreitete. Der mörderische Überdruck, der Glas und Plastik brutal zertrümmerte. Die Leichen derer, die sich in der Nähe der Explosion aufgehalten hatten, würden vollkommen vernichtet werden. Blut würde verdampfen, Fleisch würde zu Asche werden. Stützpfeiler und Wände würden von Kräften, die unmöglich zu bändigen waren, nach außen gedrückt werden und bersten. Innerhalb weniger Sekunden würde das gesamte Gebäude in sich zusammenbrechen. Es würde von seinem eigenen Gewicht erdrückt werden, während die Wucht der Explosion, begleitet von grollendem Donner, nach draußen rasen und ihr Zerstörungswerk in den umliegenden Straßen fortsetzen würde.
Er schlug die Augen auf. Auf das Dröhnen der Explosion folgte das schrille Jaulen von Hupen und Sirenen, nachdem jede Alarmanlage in zwei Kilometern Umkreis ausgelöst worden war. Kein Lüftchen regte sich, und so stieg die Rauchsäule senkrecht zum Himmel auf. Da hing sie wie ein gewaltiger schwarzer Dolch, der direkt ins Zentrum der Ruine zeigte.
Er wartete, lauschte angestrengt und wurde durch ein lang gezogenes, tiefes Rumpeln belohnt. Er spürte die Vibrationen in seiner Brust. Das Rumpeln übertönte das aufgeregte Geschnatter der Leute unten auf der Straße, die alle noch nicht so recht begreifen konnten, was da eigentlich los war. Jetzt schoss eine zweite, noch größere Staubwolke in den Himmel, während das angeschlagene Gebäude endgültig einstürzte. Jadeed konnte von seinem Platz aus die Polizeiwache nicht sehen, aber er erkannte, welch große Wirkung ihre Zerstörung hatte.
»Große Ausbreitung«, stellte Khadir nüchtern fest. »Es gibt mehrere Feuer.«
Jadeed fragte sich, wie sein Kommandant das sehen konnte. Ein Spionagesatellit oder vielleicht eine Drohne? Geistesabwesend blickte er zum dunkler werdenden Himmel. »Die Gasleitungen werden …« fing er an, doch noch bevor er seinen Gedanken zu Ende führen konnte, erweiterte eine zweite, dumpfe Explosion das immer größer werdende Chaos. Neue, kleinere Rauchsäulen, in deren Kern Gasfeuer loderten, gesellten sich zu der ersten.
Jadeed erhob sich von seinem Stuhl und nahm das Telefon und das Fernglas in die Hand.
»Ich bin zufrieden«, sagte die Stimme in seinem Ohr. »Der Versuch ist zu meiner vollen Zufriedenheit abgelaufen.« Die letzten Worte klangen, als wären sie an jemand anderen gerichtet.
»Ich gehe jetzt«, erwiderte Jadeed, doch als er den Blick auf sein Smartphone richtete, zeigte das Display eine gerade Linie und keine Welle mehr, während der Countdown bei null stehen geblieben war. Er steckte das Telefon in die Tasche, wo es gegen seine Gebetskette schlug.
Dann nahm er den kleinen Koffer, der alles enthielt, was er brauchte, vom Bett und steckte die kompakte Beretta 84-F in das Hüftholster, das durch den Schnitt seines Anzuges so gut wie gar nicht auffiel.
In all dem Lärm und dem Durcheinander fiel auch der Alarm im Hotel nicht weiter auf, der ausgelöst wurde, als Jadeed das Hilton durch den Notausgang verließ und sich zwischen den Menschen hindurchschlängelte, die mit offenen Mündern die Rauchsäule anstarrten.
2
Die skelettartigen, gelben Arbeitsleuchten, die rund um ein paar Klapptische vor dem Heck eines Renault-Lastwagens aufgebaut waren, warfen harte Schatten in das Innere der Lagerhalle. Die Hecktüren des waldgrün lackierten Fahrzeugs standen weit offen. Gestalten in Schwarz huschten hin und her, und ihren Bewegungen war anzumerken, dass sie in Eile waren.
Marc Dane stieß den Atem aus und wandte sich ab, steckte die Hände in die Jackentaschen und ging im Halbdunkel auf und ab. So kurz vor Beginn der Dämmerung war die Luft kühl und feucht, und er konnte das salzig-rostige Aroma des nahe gelegenen Seehafens riechen. Durch die verschmierten Fensterscheiben waren sogar die hellen Natriumdampflampen der Hafenanlagen von Dünkirchen und die kantigen Frachtcontainerwände, die sich entlang der Kaimauern erstreckten, zu erkennen.
Marc war extrem nervös und bereute den Wachmacher des heutigen Morgens, der in einem Cocktail aus starkem Instant-Kaffee und Red Bull bestanden hatte. Seine Finger zappelten unruhig in den Taschen, während er versuchte, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Das fiel ihm alles andere als leicht.
So war es bei jedem Einsatz, und jedes Mal dachte er, dass es das letzte Mal war. Dass er beim nächsten Mal von diesem unguten Gefühl verschont bleiben würde. Aber bis jetzt war er noch nicht so weit, und bei dem Gedanken, dass es wahrscheinlich immer so bleiben würde, verzog er unwillkürlich den Mund zu einem schiefen Grinsen. Er fuhr sich mit der linken Hand durch die ungekämmten dunkelblonden Haare. Er war blass und sah deutlich jünger aus als Ende dreißig, und durch die schwarzen Kleider wirkte er spindeldürr.
Marc holte noch einmal tief Luft und sah, wie Leon in den Lieferwagen kletterte. Leon Taub war alt genug, um Marcs Vater zu sein, aber immer noch fit und hellwach. Hinter der dicken Brille auf seiner unansehnlichen Nase lauerte ein wacher Geist, der auch nach vierzig Jahren voller riskanter Situationen und verdeckter Operationen in abgedunkelten Gebäuden und nassen Gassen noch nicht abgestumpft war. Taub sah, dass Marc ihn beobachtete, und schickte ihm mit seinem Plastikbecher einen müden Salut, bevor er im Laderaum des LKWs verschwand. Owen Davis folgte dem Älteren, das Gesicht wie immer zu einer griesgrämigen Grimasse verzerrt. Marc sah, wie der mürrische Waliser die Vorbereitungen rund um den Lieferwagen mit verdrießlichen Blicken musterte, und wandte sich ab.
Der Rest des Teams – die Zugriffsgruppe – hatte sich bei den Tischen versammelt. Marc hörte ihr trockenes Gelächter und das metallische Klirren der Waffen, die einsatzbereit gemacht wurden. Wie Marc, Leon und Owen trugen auch die anderen Schwarz, allerdings bestand ihre Kleidung – im Gegensatz zu seiner gebrauchten Armeejacke und seiner unauffälligen Jeans – aus stabilen, reißfesten Materialien und ledernen Kampfstiefeln. Ihre Westen waren mit zahlreichen Taschen, Schutzpanzerung, verschlüsselten Funkgeräten und Holstern ausgestattet. Rein äußerlich hatte die Gruppe große Ähnlichkeit mit dem Sondereinsatzkommando einer Strafverfolgungsbehörde. Allerdings waren nirgendwo Insignien, Rangabzeichen oder sonstige Identifikationsmöglichkeiten zu entdecken. Die gesamte Ausrüstung stammte von unterschiedlichen Herstellern aus aller Welt, und kein einziger Artikel besaß eine verräterische Seriennummer, die zurückverfolgt werden konnte, falls er versehentlich in falsche Hände geriet.
So hatten auch alle Mitglieder der Gruppe unterschiedliche Schusswaffen bei sich – von Heckler-&-Koch-Maschinenpistolen über Mossberg-Schrotflinten bis hin zu einer Karabinerversion des Colt-M-4-Sturmgewehrs. Die einzige Gemeinsamkeit war der zylinderförmige Schalldämpfer, den jede Schusswaffe besaß. Er unterdrückte das Mündungsfeuer und sorgte dafür, dass ein Schuss nicht lauter klang als ein kräftiges Räuspern.
Marcs Dienstwaffe – eine Glock 17 Halbautomatik – lag ungeladen im Laderaum des Lastwagens, gleich neben dem eigens auf seine Bedürfnisse zugeschnittenen Laptop, der Monitorkonsole und den anderen Dingen, die er für seine Arbeit brauchte. In seiner Funktion, die von der Einsatzzentrale nebulös als »Spezialist für vorgeschobene Missionen« bezeichnet wurde, war der aktive Gebrauch einer Waffe nicht vorgesehen. Dennoch war für jedes Teammitglied im Einsatz zwingend Schutzbewaffnung vorgeschrieben. Aber Marc hatte immer das Gefühl, dass er durch das Tragen der Waffe nur die Wahrscheinlichkeit vergrößerte, in Schwierigkeiten zu geraten.
Draußen in der realen Welt, wo die normalen Menschen lebten und arbeiteten, existierte das Grüppchen, das sich in dieser leer stehenden französischen Lagerhalle versammelt hatte, gar nicht. Marc Danes Welt mit ihren Waffen und ihren Geheimnissen war eine düstere Parallel-Realität, gut verborgen in tiefen Schatten.
Es war fast zwei Jahre her, seit er sich dem Operationsteam Sieben, genannt »Nomad«, angeschlossen hatte. Dieses Team war eine von insgesamt zehn schnellen Eingreiftruppen, die streng geheim unter Federführung des britischen Secret Intelligence Service operierten. Nach Beendigung seines Dienstes bei den Luftstreitkräften der Royal Navy war er gezielt angesprochen worden. Lange Monate des intensiven Trainings hatten sich angeschlossen, Schulung in Terrorismusbekämpfung und Techniken der Gegenspionage. Monate, in denen er in der realen Welt nur noch als Geist existiert hatte. Marc Dane war von der Erdoberfläche verschwunden, um sich schließlich hier wiederzufinden.
Er zog seinen Jackenärmel ein Stück nach oben und warf einen schnellen Blick auf seine schon ziemlich mitgenommene Cabot-Taucheruhr, die einzige Erinnerung, die ihm an seine Zeit bei der Navy geblieben war. Spätestens in einer Stunde war Sonnenaufgang. Er nickte geistesabwesend und versuchte vergeblich, die letzte Anspannung abzuschütteln, die sich trotz all seiner Bemühungen als fester Knoten in seinem Nacken festgesetzt hatte.
»Ich hab dir doch gesagt, du sollst auf koffeinfrei umsatteln«, sagte eine Stimme in der Dunkelheit.
Er drehte sich zu ihr um. Samantha Green war einen Kopf kleiner als Marc mit seinen ein Meter achtundachtzig, aber irgendwie schaffte sie es, dass man immer das Gefühl hatte, man müsste zu ihr aufschauen. Sie grinste ihn unter dem Schirm einer dunklen, luftdurchlässigen Baseballmütze hervor an. Und trotz der schwarzen Tarnstreifen im Gesicht sah sie absolut umwerfend aus. »Ich bin ganz ruhig«, erwiderte er.
»Das hättest du wohl gerne«, gab sie nicht unfreundlich zurück. Ihre Hände lagen auf ihrer Maschinenpistole, einer MP-7 A1, die auf Hüfthöhe baumelte, und sie musterte ihn von oben bis unten. »Mach dir keine Gedanken. Wir haben das doch schon hundertmal gemacht.« Sie wies mit einer Kopfbewegung auf die anderen. »Der Chef weiß genau, was er tut.«
Der Mann, den sie damit gemeint hatte, fing ihren Blick auf und nickte zurück. Gavin Rix war der Kommandeur der Nomad-Mission am Boden, ein hochdekorierter ehemaliger Sergeant des Special Air Service, untersetzt, muskulös, mit einem zerfurchten Boxergesicht und kahl rasiertem Schädel. Er reckte die Daumen nach oben und lächelte sie beinahe väterlich an.
»Ja.« Marc wollte eigentlich überzeugend klingen, aber leider klappte es nicht. »Ich mein ja nur … du weißt schon … pass auf dich auf.«
Sam spitzte spöttisch die Lippen. »Ooch, wie süß.« Sie legte den Kopf ein wenig schief. »Würde es dir besser gehen, wenn ich dich kurz drücke?«
»Ich weiß nicht.« Marc musste lachen, obwohl ihm eigentlich nicht danach zumute war. Das war etwas, was Sam fast jedes Mal zustande brachte. »Möchtest du’s vielleicht ausprobieren?«
Ihre braunen Augen blitzten. »Wir sind Profis, also sollten wir uns auch so benehmen.« Sie wandte sich ab.
»Die Grenze haben wir doch schon längst überschritten«, fügte Marc leise hinzu.
Sam hielt inne und wandte sich noch einmal zu ihm um. Und sie hatte wieder diese Miene aufgesetzt, aus der er einfach nicht schlau wurde. »Job ist Job«, sagte sie. »Und Schnaps ist Schnaps. Das solltest du niemals verwechseln.«
»Sam …« Marc legte die Stirn in Falten und suchte nach den richtigen Worten. »Ich verstehe das, aber …«
»Job ist Job«, wiederholte sie, und schlagartig wich sämtliche Wärme aus ihrem Blick.
Die lange Nacht in Tunesien, in der sie sich zum ersten Mal alleine begegnet waren, lag schon Monate zurück, doch Marc wusste immer noch nicht, woran er mit ihr war. Engere Beziehungen innerhalb der Einheit waren nicht vorgesehen, aber falls Rix und die anderen etwas mitbekommen hatten, dann ließen sie sich nichts anmerken.
Sam lebte immer in der Gegenwart, im Rausch des Augenblicks, und das machte sie für ihn so anziehend. Er wusste, dass sie bei der Army zwei Auslandseinsätze als Ordonnanzoffizier eines Sprengstoffkommandos mitgemacht hatte. Sie liebte das Adrenalin.
Aber Marc konnte sie einfach nicht einschätzen. Manchmal glaubte er, sie durchschaut zu haben, in den wenigen Momenten, in denen sie sich fast wie ein normaler Mensch benahm, wie jemand mit einem richtigen Leben. Aber jedes Mal zeigte sie sich dann gleich wieder von ihrer nonchalanten, oberflächlichen Seite, und dann wusste er gar nichts mehr. Der einzige Punkt, bei dem Sam immer ehrlich war, das Einzige, was sie wirklich ernst zu nehmen schien, das war der Auftrag. Die Mission. So kam es Marc jedenfalls vor.
Einerseits wusste er, dass er sie am besten in Ruhe lassen sollte, aber Marc war stur, obwohl er genau spürte, wie ihr Blick abweisend wurde. »Sam …«, fing er an.
»Sammy!« Als einer der Männer aus der Zugriffsgruppe näher kam und ihren Namen rief, war der kurze Augenblick der Intimität dahin. Iain Nash war der stellvertretende Kommandeur, und er hatte genau denselben Gang wie die Gangstertypen aus der Sozialbausiedlung in Südlondon, in der Marc aufgewachsen war. Damals war er solchen Gestalten immer möglichst aus dem Weg gegangen. Nash begrüßte ihn mit einem abschätzigen Kopfnicken. Sein hageres Gesicht wurde von dunklen Haaren und einem Stoppelkinn eingerahmt. Er wirkte immer angespannt, eigentlich fast zu angespannt für jemanden, der im Auftrag des Geheimdienstes verdeckte Operationen durchführte. Aber Nash war ein versierter Spezialist, der, genau wie Sam, ursprünglich in der britischen Armee gedient hatte und dann von Männern aus einer der oberen Etagen des Nachrichtendienstes für diese Laufbahn ausgewählt worden war.
Gemeinsam mit Rob Bell, der ursprünglich in der CO-19-Einheit – bei den Präzisionsschützen der Metropolitan Police – seinen Dienst versehen hatte, und einem ehemaligen britischen Marinesoldaten namens Bill Marshall bildete Nash die Speerspitze des OpTeam Sieben. Marc, Leon und Owen waren für ihre Überwachung und Unterstützung zuständig – Rix nannte sie die Typen im Wagen, im Unterschied zu den Typen mit Waffen.
»Kann ich dich kurz sprechen?«, sagte Nash zu Sam und sah Marc mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Die Zeit läuft«, fügte er hinzu, ohne ihn aus den Augen zu lassen. »Du solltest mal langsam deine Spielzeugkiste einschalten, oder? Geht gleich los.«
»Stimmt.« Nach kurzem Zögern nickte Marc, akzeptierte, dass er quasi weggeschickt worden war, und ging langsam zum Lastwagen zurück. Kaum hatte er Sam und Nash den Rücken zugedreht, hörte er, wie die beiden ein leises Gespräch anfingen. Er runzelte die Stirn.
Marc war kein Idiot, und bis jetzt hatte er seine Gefühle für Sam – welche auch immer das sein mochten, verdammt noch mal – und den Job sehr gut auseinanderhalten können, ganz egal, ob sie ihm das glaubte oder nicht. Aber irgendetwas beschäftigte die Zugriffsgruppe, irgendetwas, was sie den anderen Teammitgliedern nicht verraten wollten. Es war nicht das erste Mal, dass Marc mitbekam, wie Sam oder Nash oder Rix sich nur unter vier Augen unterhielten, und nie hatten sie sich veranlasst gesehen, ihm den Grund dafür mitzuteilen.
Er musste an Rix’ Definitionen denken. Die Typen im Wagen und die Typen mit Waffen. Es war klar, dass zwischen dem taktischen Unterstützer-Team und den operativen Kräften ein Unterschied bestand, das war in einer solchen Gruppe ganz normal. Sie hatten außerhalb des Jobs kaum Berührungspunkte, gingen nicht gemeinsam in die Kneipe oder solche Dinge. Aber Marc machte diese Distanz mehr zu schaffen, als er sich eingestehen wollte.
Er hätte einer von ihnen werden können. Die Männer vom MI6, die ihn rekrutiert hatten, hatten ihm angeboten, sich für die Zugriffsgruppen des OpTeam-Programms zu bewerben, aber er hatte es nicht getan. Und obwohl das jetzt schon eine ganze Weile her war, wusste er immer noch nicht, was ihn eigentlich daran gehindert hatte. Er hatte abgelehnt und sich für die sicherere Variante entschieden, das geringere Risiko.
Marc warf Sam noch einen letzten Blick zu, bevor er in den Lastwagen stieg. Sie nickte gerade nachdrücklich, während Nash etwas sagte, und schien ihn nicht zu bemerken.
Talia Patel war seit sechzehn Stunden auf den Beinen, aber sie würde den Teufel tun und sich das irgendwie anmerken lassen. Nach einem verstohlenen Gähnen im leeren Fahrstuhl zog sie die zerknitterte Bluse unter ihrem Prada-Jackett zurecht und stellte sich dann kerzengerade vor die langsam aufgleitenden Türen.
Sie betrat das Stockwerk, ging durch die Sicherheitsschleuse und legte ihre Smartcard auf den RFID-Scanner an der Wand. Der bewaffnete Wachmann am Monitor winkte sie durch, und sie machte sich so schnell, wie die Etikette es zuließ, auf den Weg in den Raum mit der Bezeichnung Hub White.
Auf ihrem Weg durch den Korridor kam sie ungefähr alle fünfzehn Meter an einer Tür vorbei, die auf Augenhöhe ein digitales Display besaß. Manche waren ausgeschaltet, andere machten durch ein Wort in Leuchtschrift deutlich, dass der dahinter befindliche Raum gerade Gesichert oder In Bereitschaft war. Manche waren auch Verriegelt. Abgesehen von dem bewaffneten Wachmann erinnerte das alles in seiner Unauffälligkeit an irgendwelche x-beliebigen Büroetagen, wie es sie in Dutzenden von Bürohochhäusern in ganz London gab. Allerdings lag dieser Korridor hier rund sechzig Meter unterhalb der Stadt, versteckt in einem der Untergeschosse unter dem Albert Embankment und dem aus Glas und Stein errichteten Gebäude am Vauxhall Cross Nummer 85. Dies hier war die Betriebsetage des MI6, des britischen Auslandsnachrichtendienstes. Hier bemühte man sich rund um die Uhr, die Sicherheit der Nation zu gewährleisten.
Trotz der frühen Stunde ging es sehr lebhaft zu. Die Arbeit beim MI6 verlief nicht in den üblichen Bahnen, was Talia als Leitende Analystin der Sektion K, die für die Durchführung und Überwachung sämtlicher aktiver Einsätze der OpTeams zuständig war, auf schmerzhafte Weise hatte erfahren müssen. Sie zögerte kurz und warf einen unauffälligen Blick auf ihr Spiegelbild im Monitor des kleinen Tablets, das sie bei sich hatte. Harte, aber nicht unattraktive Gesichtszüge, dazu schulterlanges, glattes schwarzes Haar, haselnussbraune Augen und hellbraune Haut. Talia war zufrieden. Sie sah professionell aus, vor allem aber hellwach.
Vor der Tür, die in den Hub White führte, musste sie ihre Smartcard noch einmal benutzen, dazu einen vierstelligen, täglich wechselnden Code. Erst dann öffneten sich die Magnetschlösser mit einem leisen Klonk. Talia trat ein, passierte noch eine schalldichte Tür und befand sich dann auf der niedrigen Empore, die einmal rings um das geschäftige Einsatzzentrum lief. Als kleine Verbeugung vor dem klassischen Theater wurde die Empore »der Rang« genannt, während die Fläche drei Stufen weiter unten »das Parkett« war. Sie war dicht gefüllt mit digitalen Kartentischen, Kommunikationskonsolen und Computermonitoren. An der Decke hingen große Bildschirme, auf denen alle möglichen Daten aus Dutzenden unterschiedlichen Quellen erschienen. Hier also, auf einer Fläche von der Größe eines Tennisfeldes, befand sich das Nervenzentrum der Sektion K. Von hier aus konnten aktive Einsätze an jedem Punkt der Erde gesteuert werden.
Im Augenblick waren alle Systeme des Hub White auf den Hafen von Dünkirchen, jenseits des englischen Kanals, gerichtet. Alle Plätze waren besetzt, alle Monitore aktiv. Talia betrat das Parkett und erhaschte einen Blick auf eine Wetterkarte der französischen Küste. Eine kalte, mondlose Nacht neigte sich ihrem Ende entgegen, und es würde noch mindestens bis zum späten Vormittag dauern, bevor die ersten Regenwolken die Küste erreicht hatten.
Sie entdeckte Donald Royce am Kartentisch. Das Display erinnerte tatsächlich an einen mit Papieren übersäten Schreibtisch – nur dass die »Papiere« in diesem Fall virtuelle Dokumente waren, die durch eine einzige Berührung hin und her geschoben oder auf- und zugeklappt werden konnten. Royce hatte sich gerade tief über eine Tabelle mit verschiedenen Daten gebeugt. Ihr Vorgesetzter hatte weiche Gesichtszüge, war schlank, weder besonders groß noch besonders klein, aber mit einem Blick ausgestattet, der, wenn die Umstände es erforderlich machten, wie ein Laserstrahl sein Ziel erfasste und durchdrang. Er war Eton-Absolvent, was sich auch in seinen makellosen, mittelenglischen Manieren bemerkbar machte, und konnte eine verbissene Intensität an den Tag legen, die Talia gelegentlich als einschüchternd empfand.
Er hob den Blick und sah über die Gläser seiner randlosen Brille hinweg an. »Sie sind spät dran.«
»Tut mir leid, Sir«, erwiderte sie. »Ich wollte nur noch den stündlichen Bericht der Funkaufklärung abwarten.« Talia reichte ihm das Tablet.
»Gründlich wie immer«, sagte er, blätterte mit dem Zeigefinger den Bericht durch und überflog den Inhalt mit geübtem Auge. Die Berichte der allwissenden Informationsspezialisten aus dem GCHQ, den Government Communications Headquarters in Cheltenham, waren umfassend wie immer. »Irgendwas, weswegen wir uns Sorgen machen müssten?«
Sie schüttelte den Kopf. »Gar nichts. Die Operation Nomad ist, soweit wir es beurteilen können, bislang unbemerkt geblieben.«
»Gut so.« Er gab ihr das Tablet zurück und starrte wieder auf den Landkarten-Bildschirm.
Talia warf einen Blick auf die Uhr an der Wand. Zwei Anzeigen, einmal die Westeuropäische Zeit, auch Greenwich Mean Time genannt, und dann noch die lokale Zeit in Dünkirchen. In knapp zehn Minuten würde das OpTeam Sieben den finalen Befehl zum Losschlagen oder Abbrechen erhalten.
Royce legte die Fingerspitzen aneinander und betrachtete ein Foto der Palomino. Der ursprünglich türkische Frachter fuhr mittlerweile unter holländischer Flagge. Er hatte vor zwölf Stunden festgemacht, und das Foto zeigte deutlich, wie weit er aus dem Wasser ragte. Seither war keinerlei Fracht an oder von Bord gebracht worden, nicht einmal Treibstoff oder Proviant.
»Wir sind uns doch sicher, oder nicht?«, fragte Royce leise, so leise, dass nur Talia es hören konnte.
»Sie haben die Nachricht aus dem GCHQ selbst gesehen, Sir«, erinnerte sie ihn. »Ein zurückverfolgtes Handy-Telefonat eines einschlägig bekannten Waffenhändlers. Zusammen mit den nachrichtendienstlichen Erkenntnissen aus dem Netz und aus unseren anderen Quellen ergibt das einen hinreichenden Verdacht.« Sie hatte diese Worte sehr sachlich ausgesprochen, aber ihnen beiden war klar, welche Tragweite diese Entscheidung besaß. Es würde nicht ohne Blutvergießen abgehen. Sonst hätte man kein OpTeam dafür gebraucht.
»Wir müssen uns absolut sicher sein«, fuhr er fort. »Weil, falls … falls die Franzosen Wind davon bekommen, dann stecken wir bis zum Hals in der merde.«
»Die DCRI wird pausenlos überwacht«, sagte sie und zeigte auf einen jüngeren Analysten, der gerade eine Tastatur bediente. Er hatte nur eine einzige Aufgabe: kontinuierlich die Kommunikationsströme des französischen Inlandsgeheimdienstes zu überwachen und auf alles zu achten, was darauf hindeuten konnte, dass die »Direction Centrale du RenseignementIntérieur« von der verdeckten Operation wusste, die da in Kürze auf ihrem Hinterhof stattfinden sollte.
Es war für den Direktor des operativen Einsatzstabes keine leichte Aufgabe gewesen, den Premierminister, den parlamentarischen Geheimdienstausschuss und das Außenministerium von der Richtigkeit eines schwer bewaffneten Einsatzes auf dem Boden eines befreundeten Staates zu überzeugen, und zwar ohne Wissen der DCRI. Der Ausschluss der Franzosen aus allen operativen Überlegungen war ein kalkuliertes, aber notwendiges Risiko.
Die Datenlage war eindeutig. Es bestand die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die DCRI von Unterstützern der Zielpersonen dieses Einsatzes unterwandert war. Zugleich war die Operation von weitreichender Bedeutung, sodass jede potenzielle Bedrohung oder Störung ausgeschlossen werden musste. Royce hatte daher vorgeschlagen, lieber nachträglich um Entschuldigung zu bitten, als vorher um Erlaubnis zu fragen, und so waren die Einsatzpläne für Nomad in aller Heimlichkeit entworfen worden. Mit eventuellen Aus- und Nachwirkungen würden sie sich befassen, wenn es so weit war, aber es bestand immer noch die Hoffnung, dass das OpTeam Sieben die Operation erfolgreich und unbemerkt abschließen konnte und die Franzosen nie erfahren würden, dass sie überhaupt da gewesen waren.
Talia war jedenfalls zuversichtlich. Nomad war eine außerordentlich fähige Einheit. Mit einem proaktiven Mandat des Premierministers ausgestattet, hatten Nomad und die anderen OpTeams bereits mehrfach Gefährdungen der nationalen Sicherheitsinteressen Großbritanniens der Kategorie A ausfindig gemacht und neutralisiert. Und in der heutigen Nacht war die Palomino der Ausgangspunkt einer solchen Bedrohung.
Schon als sie die ersten Bilder der Explosion in Barcelona gesehen hatte, war Talia klar gewesen, dass sich die Sektion K früher oder später mit dieser Gräueltat befassen würde. Der Terrorismus fraß sich wie ein Krebsgeschwür quer durch Europa, ohne Rücksicht auf Grenzen oder Nationalstaaten. Viele hatten sich zu Wort gemeldet, um die Verantwortung für die Toten in Spanien auf sich zu nehmen, aber vor allem ein Name brachte sämtliche Alarmglocken zum Klingeln.
Sie nannten sich Al Saif. Das Schwert. Die Fassade, die sie der Welt zeigten, war die eines radikalen Islamismus. Ihre Mitglieder rekrutierten sich aus dem Bodensatz von Al Qaida, Dschundallah und anderen Splittergruppen. Doch im Inneren war Al Saif eine weitaus komplexere Organisation, deren Strukturen der MI6 noch nicht einmal ansatzweise entschlüsselt hatte. Der religiöse Extremismus war jedenfalls nur ein Teil des Ganzen. In ihrem Manifest hatte die Organisation gedroht, noch vor Jahresende eine britische Stadt zu vernichten. Nicht anzugreifen, nein, sondern zu vernichten. Genau dieses Wort hatten sie benutzt.
Und sie waren wie Gespenster. Al Saif hatte aus den Fehlern anderer radikaler Gruppen gelernt, die entweder nach langer Hetzjagd zur Strecke gebracht oder durch subversive Unterwanderung von innen heraus unschädlich gemacht worden waren. Diese Männer konnten ebenso gut in einer armseligen Bruchbude in Kandahar improvisierte Sprengkörper basteln oder aus einer Millionen Dollar schweren Bürosuite in Dubai Cyberattacken lancieren. Und das OpTeam-Programm des MI6 war eine direkte Reaktion auf eben solche Terrorangriffe.
Da die britischen Geheimdienste keine Möglichkeit hatten, die führenden Köpfe zu verfolgen, folgten sie den Waffen. Al Saif war eine bewegliche und sehr gefährliche Organisation, aber die wenigen handelnden Personen waren über den ganzen Erdball verstreut. Sie brauchten also irgendeine Form von Unterstützungsorganisation, die so groß sein musste, dass sie zwangsweise irgendwo Spuren hinterließ.
Royce hatte sich in die Akte über das sogenannte »Kombinat« vertieft und dachte dabei garantiert das Gleiche wie Patel. Das Kombinat – unter diesem Namen wurden sie am Vauxhall Cross geführt. Eine Organisation, die im Moment nichts weiter war als ein zaghafter Umriss, die Andeutung eines Schattens einer mächtigen Gruppierung am Rand der globalen Bühne. Die sich außerhalb gängiger Kriterien wie Ideologie oder religiöser Fanatismus bewegte. Unabhängig von nationaler Identität. Angetrieben nicht nur von der Gier nach Geld, sondern von einem höheren Plan, der allerdings noch nicht greifbar war.
Die Bombe, die Al Saif in Barcelona gezündet hatte, stammte wahrscheinlich aus Quellen, die mit dem Kombinat in Verbindung standen. Ihr Geschäft bestand darin, Terroristen und paramilitärische Gruppierungen überall auf der Welt mit Waffen und Nachschub zu beliefern. Sie waren die Waffenschmiede und Quartiermeister verzweifelter und skrupelloser Männer, und wenn man Al Saif mit Gespenstern vergleichen konnte, dann waren die Angehörigen des Kombinats weniger als ein Windhauch.
»Seit Jahren hecheln wir diesen glitschigen Scheißkerlen hinterher«, sagte Royce, wie zu sich selbst. »Und heute haben wir endlich mal eine echte Spur.« Er starrte noch einmal auf das Bild der Palomino, als wolle er das Schiff nur mit Blicken dazu bewegen, mehr Informationen preiszugeben.
Es war wirklich eine seltene Möglichkeit, Erkenntnisse zu gewinnen, die sowohl zu Al Saif als auch zu ihren Partnern aus dem Kombinat führen konnten.
Letztendlich war es lediglich einem Bruchstück eines abgehörten Handytelefonats zu verdanken, dass sie überhaupt so weit gekommen waren. In dem Telefonat war eine Andeutung enthalten gewesen, dass der Frachter eine Waffenlieferung des Kombinats an Bord hatte, die für eine Terrorgruppe gedacht war. Der spanische Centro Nacional de Inteligencia hatte seine Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Bombenattentat von Barcelona noch längst nicht abgeschlossen, seinen europäischen Partnern aber wertvolle kleine Hinweise zukommen lassen – ein sicheres Zeichen dafür, dass sie noch keine entscheidenden Erkenntnisse gewonnen hatten.
Irgendwie war ein Sprengkörper mit einer außergewöhnlichen Zerstörungskraft in eine Polizeiwache geschmuggelt worden, vorbei an speziell ausgebildeten Beamten und hochmodernen Metalldetektoren und ohne dass irgendein Alarmsystem angeschlagen hatte. Hundert Menschen waren der Explosion zum Opfer gefallen. Falls die Palomino etwas Vergleichbares an Bord hatte, etwas, was mit konventionellen Überwachungsmethoden nicht zu entdecken war …
Talia schauderte am ganzen Körper. Im Umkreis von Dünkirchen, nur wenige Stunden entfernt, gab es ungefähr ein Dutzend Großstädte, und jede war ein potenzielles Ziel. Brüssel. Paris. Amsterdam. London.
Sie blickte zur Einsatzuhr. »Sir? Sie sind in Position. Es ist Zeit.«
Royce hob nicht einmal den Kopf. »Geben Sie grünes Licht für Nomad.«
3
»Folgende Einsatzregeln«, sagte Rix und sah dabei jedem Einzelnen im Laderaum des Lastwagens tief in die Augen. »Jedes Geräusch vermeiden. Waffengebrauch ist genehmigt, aber keine unbeteiligten Opfer, falls irgendwelche Einheimischen hier auftauchen sollten. Gefangene wären nützlich, sind aber nicht zwingend erforderlich. Oberste Priorität: die Vorrichtung aufspüren und sichern.«
»Es würde schon helfen, wenn wir wüssten, was wir eigentlich suchen«, sagte Bell. Höchste Konzentration sprach aus dem dunklen Gesicht des wortkargen Expolizisten.
»Wenn es einfach wäre, dann hätten sie die Amis losgeschickt«, knurrte Marshall mit seiner rauen Stimme. »Ich rate mal: Sobald wir sie gefunden haben, wissen wir Bescheid, stimmt’s, Boss?«
»Hätte ich nicht besser formulieren können«, gab Rix zurück.
Marc hörte mit halbem Ohr zu, während er ununterbrochen seinen Monitor im Auge behielt. In die Karosserie des Lastwagens waren mehrere Kameras eingebaut, die ihm einen vollständigen Überblick über die gesamte Umgebung ermöglichten, und er sah nach, ob sich irgendwo etwas bewegte.
Nichts. Auch die Patrouille würde frühestens in zwanzig Minuten wieder vorbeikommen.
Owen hatte den Laster zu den Docks gefahren und ihn hinter einem Stapel Frachtcontainer abgestellt. Die Palomino hatte gleich gegenüber festgemacht. An Bord brannten einige wenige Deckleuchten.
»Alles ruhig«, sagte er.
»Kannst du vielleicht eine fliegende Untertasse rausschicken?« Leon warf ihm einen Blick zu.
»Könnte ich machen.« Er sah kurz zu Rix, der ihm zunickte.
Marcs schlanke Finger huschten über die Tastatur einer kompakten, tragbaren Steuerkonsole gleich neben seinem Laptop, und dann ertönte über ihnen ein lautes Klacken.
Auf dem Dach des Aufbaus befand sich ein Plastikkasten, der aussah wie ein bei solchen Fahrzeugen durchaus übliches Kühlaggregat. Jetzt klappte der Deckel auf, und ein Greifarm schleuderte ein diskusförmiges Ding in die leichte Brise, die vom Meer her wehte.
Die »Untertasse« war eine kleine, ferngesteuerte Drohne, gewissermaßen die kleine Schwester der unbemannten Kampfdrohnen, die mittlerweile bei den meisten gut ausgerüsteten Streitkräften dieser Welt zum Einsatz kamen. Sie bestand aus superleichten Polymeren und Aerogel-Komponenten und konnte bis zu zwanzig Minuten über einem bestimmten Ziel schweben. Ein Funksender übertrug die Bilder einer Mikrokamera direkt auf Marcs Monitor. Zur Steuerung benutzte er den umgebauten Controller einer Spielkonsole. Jetzt ließ er das winzige Fluggerät in einem weiten Bogen über dem Anleger kreisen.
»Grünes Licht für Nomad«, sagte eine Stimme auf dem allgemeinen Funkkanal, begleitete vom Pfeifen des Chiffriergerätes.
»Grün«, wiederholte Rix und drückte den Finger auf den Kopfhörer an seinem rechten Ohr. »Bereit machen.«
Marc merkte, dass Nash hinter ihm stand. Er strahlte eine enorme Anspannung aus, und Marc spürte deutlich, wie sehr sein Kollege darauf brannte, endlich loslegen zu können. »Nichts zu sehen?«, wollte er wissen.
»Nichts …«, setzte Marc an, doch da war Nash schon wieder weg und streifte sich eine Netzmaske über den Kopf, um sein Gesicht unkenntlich zu machen.
»Ausrücken«, befahl Rix kurz und bündig, dann stießen er und Marshall die Heckklappen des Lastwagens auf. Keine zwei Sekunden später war die Zugriffsgruppe verschwunden und die Klappe wieder geschlossen. Sam war als Letzte nach draußen gesprungen.
»Dann wollen wir mal, was?« Owen ließ mit großer Geste die Knöchel knacken und beugte sich nach vorne, um sich auf seinen Bildschirm zu konzentrieren, der gespickt war mit Frequenzanzeigen. Jede einzelne repräsentierte ein anderes Funksignal, eine andere elektromagnetische Welle. Leon sagte gar nichts, aber in seiner Brille spiegelten sich gleich mehrere Monitore.
Marc beobachtete das Grüppchen am unteren Rand des Videoausschnitts der Drohne und presste die Lippen aufeinander. Dann schob er den Joystick mit dem Daumen nach vorne und ließ die Untertasse zur Palomino fliegen, um die Route auszukundschaften.
Sam klappte den vorderen Griff und die Schulterstütze ihrer MP-7 aus und schlich geduckt und mit schnellen Schritten, die Maschinenpistole im Anschlag, um eine Wand aus blauen Frachtcontainern herum. An der Ecke blieb sie stehen, ging in die Hocke und sah zur Palomino hinüber. Eine einzige Gangway führte auf das Schiff. An Deck bewegte sich ein undefinierbarer Schatten.
Ein stecknadelkopfgroßer, roter Lichtpunkt glühte auf und erlosch wieder. »Nomad drei«, flüsterte sie, und das Kehlkopfmikrofon an ihrem Hals sorgte dafür, dass die anderen sie hören konnten. »Raucher auf dem Außendeck. Mobil, gibt es noch mehr?«
»Hier Mobil drei. Zwei Mann an Deck«, erwiderte Marc. Sam blickte nach oben, suchte nach der Drohne, fand sie aber nicht. Für einen kurzen Moment glaubte sie, das leise Summen der Rotoren zu hören, aber vielleicht hatte sie sich auch getäuscht. »Kein Sichtkontakt zwischen den Zielpersonen«, fügte er hinzu. »Alles klar für Zugriff.«
»Verstanden.« Rix stand hinter ihr. »Marsh, er gehört dir.«
»Verstanden«, knurrte Bill Marshall zurück, und dann sah Sam ihn gar nicht weit von ihr entfernt hinter einem der Container hervorkommen. Der drahtige ehemalige Elitesoldat war schnell und näherte sich im Halbkreis der Gangway. Gefühlvoll und anmutig, wie man es von einem Mann seiner Statur niemals erwartet hätte, huschte er ohne jedes Geräusch die Gangway hinauf.
Sam entsicherte ihre Waffe und legte an, als die Zigarettenspitze erneut rot aufleuchtete. Sie machte sich schussbereit, nur für den Fall, dass Marshall die Wache nicht überwältigen konnte.
Aber ihre Besorgnis war unnötig. Als der Raucher sich nach vorne ins Licht beugte und seinen Zigarettenstummel ins Wasser warf, zog Marshall sich in den Schatten zurück. Dann blitzte eine eloxierte Messerklinge auf, und der Wachmann sackte lautlos zu Boden, wurde von der Dunkelheit verschluckt.
Einen Augenblick später hatte sie Marshalls Stimme wieder im Ohr. »Alles klar zum Entern.«
Rix klopfte Sam auf die Schulter, und sie glitt geschmeidig um die Ecke und auf die Gangway zu. Nash war einen Schritt vor ihr, die M-4 im Anschlag, und betrat die Gangway als Erster, Rix und Bell folgten ihr. Im Schatten unter der Laufbrücke sah sie einen nicht eindeutig erkennbaren Umriss.
»Schafft den da weg, ja?«, sagte Rix. Marshall nickte und hob den Leichnam auf.
»Hier Mobil drei, Hinweis: einzelne Zielperson auf Vordeck«, berichtete Marc. »Bewaffnet, Sturmgewehr.«
Rix brauchte gar keinen Befehl zu geben. Alle Mitglieder der Zugriffsgruppe suchten unverzüglich Deckung. Kein Wort wurde gesprochen. Sam ließ sich in den Schatten eines Rettungsbootes sinken und riskierte einen Blick nach vorne. »Nichts zu sehen«, flüsterte sie.
»Hier auch nicht«, sagte Nash, der ganz in der Nähe war. Er beugte sich über ein Ölfass, das Gewehr schussbereit. »Mobil drei, hier Nomad zwei. Präzisere Angaben bitte, ja? Mach deine Arbeit.«
»Moment.« Marc verstummte kurz, und Nash wandte sich in Sams Richtung.
»Was hat dein Lover vor?«, wollte er wissen und hob das Mikrofon an, damit die anderen ihn nicht hören konnten.
Sam machte es ihm nach. »Er ist nicht mein Lover. Wo sind wir denn hier, im Kindergarten? Benimm dich mal wie ein erwachsener Mann, Nash.«
Es knisterte in der Leitung, dann war Marc wieder da. »Nomad zwei, er ist gleich bei dir. Drei Sekunden.«
Nash nickte und legte einen Schalter an der Seite der M-4 um. Jetzt schob sich etwas in Sams Blickfeld, ein diffuser Schatten, kaum erkennbar in der Dunkelheit. Sie sah, wie Nash die näher kommende Wache ins Visier nahm und abdrückte. Die M-4 fauchte, dann hing für einen Augenblick ein dunkler Sprühnebel in der Luft.
»Zielperson neutralisiert.«
»Nomad eins bestätigt«, sagte Rix und trat aus der Deckung. »Noch jemand?«
»Hier oben ist keiner mehr, Boss«, sagte Bell. »Aber vielleicht unten, als Bewachung für das Paket.«
»Na ja«, erwiderte der Einsatzleiter. »Geschenkter Gaul und so weiter, stimmt’s?« Er warf dem weiblichen Teammitglied einen Blick zu. »Sammy, du sicherst das Deck …«
»Ich gebe ihr Rückendeckung«, fiel Nash ihm ins Wort.
Rix nickte. »Gut. Marsh, Robby. Ihr kommt mit mir. Wir sehen uns als Erstes die Frachträume an.« Er winkte sie zu sich. »Zügig und mit Köpfchen, meine Herren. Zum Frühstück will ich zu Hause sein.«
»Mach deine Arbeit«, schnaubte Owen und ahmte Nashs ruppigen Tonfall dabei gar nicht so schlecht nach. »Ein Dankeschön wäre auch mal nett.« Er hatte das Mikrofon abgeschaltet, sodass nur Marc und Leon ihn hören konnten.
»Na ja, er ist im Moment ziemlich beschäftigt, findest du nicht?«, erwiderte Leon.
Owens ohnehin griesgrämige Miene wurde noch missmutiger. »Aber ohne Respekt geht es nicht.« Er richtete seinen gestreckten Zeigefinger auf Marc. »Du hättest ihnen ja nichts von dem Typen mit der AK-47 zu sagen brauchen. Und dann?« Er nahm den Daumen hoch und ließ ihn wieder herunterklappen. Dann fuhr er fort: »Ihr wisst doch, wie Nash immer daherredet. Der ganze Quatsch, dass unsere Ausrüstung die Spielzeugkiste ist und so weiter, als würden wir immer nur hier drin hocken und Call of Duty spielen. Dabei tragen wir sehr wohl unseren Teil zum Ganzen bei. Die brauchen uns schließlich.«
»Wer hat das Gegenteil behauptet?«, hakte Leon nach.
»Du weißt doch, wie ich das meine.« Owens Akzent wurde jedes Mal breiter, wenn er sich über etwas aufregte, also eigentlich fast immer. Marc wusste gar nicht mehr, wann er den Mann aus Wales zum letzten Mal hatte lächeln sehen.
»Owen«, sagte er jetzt und tippte auf seinen Bildschirm. »Konzentration.«
Dafür erntete er einen giftigen Blick. »Hör zu, dir macht das vielleicht nichts aus, aber ich bin keiner, der solche Sachen einfach schluckt, klar?« Owen wandte den Blick ab. »Wenn Nash so weitermacht, dann muss ich ihm mal die Meinung geigen.«
Leon warf Marc über den Rand seiner Brille hinweg einen müden Blick zu, und die beiden Männer teilten einen kurzen Moment des stillen Einverständnisses. Owen betonte gerne, was er für ein harter Kerl war, dass er einen Taekwondo-Kurs besuchte und dass er sich nicht einfach so unterbuttern ließ, aber sobald die Zugriffsgruppe in der Nähe war, wurde er jedes Mal auffallend still. Er war ein hervorragender Techniker, aber in jeder anderen Beziehung ein Maulheld.
»Soll ich euch vielleicht einen privaten Kanal zur Verfügung stellen?«, fragte Leon leise und legte die Hand auf die Funksteuerung. »Nur für dich und Nash?«
»Das ist der doch gar nicht wert«, gab Owen nach einer kurzen Pause zurück.
»Du lässt das viel zu sehr an dich ran«, sagte Marc jetzt. »Das ist doch bloß das typische Alphatier-Gequatsche.«
Leon und Marc hatten Owens Gejammer schon oft über sich ergehen lassen müssen. Die drei hatten schon unzählige Male unter ähnlichen Umständen in ähnlichen Fahrzeugen gesessen. Taub witzelte manchmal, dass ihr Arbeitsplatz, abgesehen von der ständig wechselnden Landschaft und den vielen Bewaffneten, auch nichts anderes war als ein ganz normales Büro. Marc hätte sich gerne eine Scheibe von der entspannten Haltung des Älteren abgeschnitten. Leon verfügte über ein offensichtlich endloses Repertoire an Anekdoten, die bis in die glorreichen Zeiten des MI6 während des Kalten Krieges zurückreichten, und erledigte seine Arbeit entsprechend ruhig und gelassen.
Owen murmelte etwas in seinen nicht vorhandenen Bart und starrte auf seinen Bildschirm, auf dem eine schematische Skizze der Palomino zu sehen war, die aus den Versicherungsunterlagen von Lloyds of London stammte. Die blauen Punkte auf der Skizze markierten den Standort der einzelnen Mitglieder des OpTeams. Zwei verharrten an Ort und Stelle, während die drei anderen sich zügig Richtung Schiffsbug bewegten.
Der Waliser beugte sich nach vorne, war urplötzlich voll bei der Sache. »Nomad eins, hier Mobil zwei. Hinweis: Satellit meldet leichte Temperaturerhöhung im Deck unter euch. Könnte ein Generator oder ein Mannschaftsquartier sein.«
»Nomad eins, verstanden, Mobil zwei. Einsatz wird fortgesetzt.«
Bell schleifte den zweiten toten Wachmann zur Reling und ließ ihn fast lautlos ins Wasser gleiten, gefolgt von dem Sturmgewehr. Marshall klappte die Luke auf dem Vordeck auf, während Rix ihm Deckung gab. Der schwarze Umriss seiner Waffe zeigte hinunter in die Tiefen des Schiffsrumpfes.
»Alles frei«, sagte Rix.
Bell huschte an ihm vorbei und kletterte auf der Leiter abwärts, die MP-5 SD3 fest in der Hand. Unter dem integrierten Schalldämpfer der Maschinenpistole befand sich eine Lampe, und er ließ den Strahl jetzt durch den dunklen Flur gleiten. Ohne aufzublicken, winkte er den anderen zu, und sie blieben dicht hinter ihm.
Bell leuchtete an den Wänden entlang und verharrte immer wieder bei Rostflecken und anderen sichtbaren Anzeichen für eine generelle Vernachlässigung. »Instandhaltung scheint hier ja nicht gerade das große Thema zu sein.«
Rix zeigte geradeaus. »Weiter«, sagte er.
Die drei Männer begannen mit einer schnellen Überprüfung des Decks, gingen durch die schmalen Flure und blieben dicht beieinander. Durch die Enge auf dem Schiff konnte im Fall eines Feuergefechts jeder Raum zur Todesfalle werden. Ein einziges aufmerksames Besatzungsmitglied mit einer AK-47, und schon würde der Einsatz sehr schnell sehr laut und schmutzig werden.
Der Flur führte auf eine T-Kreuzung. In die eine Richtung ging es zu einer geschlossenen Luke, in die andere zu einer geöffneten. Sie hörten das leise Geplapper eines Fernsehers. Bell ging in die Knie und signalisierte Rix und Marshall, stehen zu bleiben.
Bell reckte die Nase in die Luft und schnüffelte wie ein Jagdhund – Zigarettenrauch und gebratenes Fleisch. Er spähte um den aufgeklappten Lukendeckel herum und bemerkte in dem sich anschließenden Flur eine offen stehende Tür. Bläuliches Licht drang nach draußen, und noch während er dabei war, die Situation einzuschätzen, spuckte der Lautsprecher des Fernsehers lautes Lachen aus. Mehrere Stimmen in dem Raum fielen ein.
»Vielleicht wollen sie uns ja mitlachen lassen?«, flüsterte Marshall.
Rix nickte Bell zu, der mit drei schnellen Schritten an der Türöffnung war. Er trat ein und schwenkte die MP-5 einmal durch den improvisierten Aufenthaltsraum. Auch ohne sich umzudrehen, wusste er, dass Rix ihm mit seiner schallgedämpften Mossberg Deckung gab.
Es waren drei Männer, alle dunkelhäutig und ungepflegt. Sie trugen schmutzige blaue Overalls, sodass man annehmen konnte, dass sie mit Instandhaltungsarbeiten beschäftigt waren. Die beiden Sturmgewehre jedoch, die an der Wand lehnten, sprachen eine andere Sprache. Zwei Männer saßen auf einem altersschwachen Sofa vor einem tragbaren Fernseher mit schlechtem Empfang, der andere stand an einem kleinen Herd.
»Alles in Ordnung, Kollegen?«, sagte Rix in freundschaftlichem Ton.