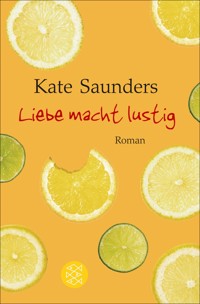9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Laetitias viktorianische Ermittlungen
- Sprache: Deutsch
Reifrock, Tee und Mord: ein neuer Fall für Laetitia Rodd, die Ermittlerin, die alles sieht und keinem auffällt. Laetitia Rodd ist die Frau für diskrete Ermittlungen in der viktorianischen Gesellschaft. Ihr Auftrag: Sie soll Joshua Welland aufspüren. Einst ein brillanter Oxford-Student, zieht er nun als zerlumpte Gestalt durch die Wälder und macht Andeutungen über ein düsteres Geheimnis. Mrs. Rodd nutzt ihre Verbindungen zum Pfarrer von Freshley Wood, um Joshuas Spur zu finden. Doch dann wird der Pfarrer ermordet. Ist Joshua in die schreckliche Tat verstrickt? "Laetitia Rodd bedeutet Lesevergnügen pur." Sunday Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Kate Saunders
Die Schatten von Freshley Wood
Laetitia Rodds zweiter Fall
Kriminalroman
Über dieses Buch
Laetitia Rodd, die Frau für heimliche Ermittlungen in der viktorianischen Gesellschaft, hat einen neuen Auftrag: der reiche Geschäftsmann Jacob Welland ist lungenkrank und will sich vor seinem Hinscheiden mit seinem Bruder Joshia versöhnen, den er seit fünfzehn Jahren nicht gesprochen hat. Joshia war ein brillanter Oxford-Student, aber bitterarm. Vom College enttäuscht, wurde er zum heimatlosen Scholaren, als zerlumpte Gestalt zieht er mit fahrendem Volk durch die Wälder und macht Andeutungen über ein Geheimnis, das die Welt erstaunen wird.
Mrs. Rodd nutzt ihre klerikalen Verbindungen, um Joshias Spur zu finden. Doch dann wird der Pfarrer der friedlichen Landgemeinde, bei dem sie logiert, ermordet. Scotland Yard verdächtigt sofort das fahrende Volk und Mrs. Rodd muss sich fragen, ob Joshia und sein Geheimnis in den Mord verstrickt sind.
Weitere Krimis von Kate Saunders:
»Das Geheimnis von Wishtide Manor. Laetitia Rodds erster Fall«
Weitere Romane:
»Ein Jahr an deiner Seite«, »Es klingt nach Liebe«, »Liebe im Spiel«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Kate Saunders ist erfolgreiche Autorin zahlreicher Romane und Kinderbücher, für die sie – auch in Deutschland – ausgezeichnet wurde. Als Journalistin und Rezensentin schreibt sie u.a. für die »Sunday Times« und »Cosmopolitan«, ist als Jurorin tätig und arbeitet für das Radio. Sie ist begeisterte Londonerin
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de
Impressum
Deutsche Erstausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Case of the Wandering Scholar« im Verlag Bloomsbury, London
© 2019 by Kate Saunders
Für die deutschsprachige Ausgabe: © 2020 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: Arcangel Images, mauritius images und www.buerosued.de
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491182-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Einundvierzig
Zweiundvierzig
Dreiundvierzig
Vierundvierzig
Nachwort
Lass mich das alte Lied noch einmal lesen.
Die Geschichte des armen Oxford-Scholaren
von geist’ger Kraft und raschem Witz
doch müd, an Vorzugstüren nur zu klopfen,
der eines Sommermorgens seine Freunde floh
und lernt’ von den Zigeunern
und wandert heimatlos mit ihnen durch die Welt.
Matthew Arnold, The Scholar Gypsy
Gold verriegelt jede Pforte, Gold allein auch öffnet sie.
Alfred Tennyson, Locksley Hall
Er sprach von Mördern, die, gejagt
Vom Kainsfluch auf Erden,
Die Flamme trugen auf der Stirn,
Die Qual in ihren Gebärden.
Aus: Thomas Hood, Eugen Arams Traum
deutsch von Hermann Harrys
(Carl Rümpler, Hannover 1859)
Eins
Der Morgen war mild und warm, die Luft erfüllt von Maidüften der wilden Gräser und Blumen auf dem Hampstead Heath und der reifenden Heuwiesen dahinter. Mrs. Mary Bentley und ich hatten unsere Arbeit in den Garten verlegt, um wie Salamander die Sonnenwärme aufzusaugen; sie schälte Erbsen aus den Schoten, ich stopfte einen Strumpf. Es war einer dieser goldenen Tage, wo einem das Herze fröhlich springt und selbst die größten Sorgen einfach abfallen.
Ich war recht stolz auf unseren kleinen Garten, auch wenn er kaum mehr als einen schmalen, von rußigen Ziegelmauern begrenzten Streifen Grün umfasste. Als ich zwei oder drei Jahre vor der Zeit, von der ich gerade schreibe, in Mrs. Bentleys Haus am Well Walk gezogen war, hatte es noch keinen Garten gegeben, nur einen feuchten Hinterhof am Waschhaus. Es war einmal vor langer Zeit, da residierte ich als Ehefrau eines Archidiakons über ein ansehnliches Anwesen in Bloomsbury und hatte sogar einen Gärtner. Als verarmte Witwe war ich nun gezwungen, die Gartenarbeit selbst zu verrichten – allerdings bin ich auf dem Lande groß geworden und weiß gut Bescheid, wie ich Dinge zum Wachsen bringen kann. Meine liebe Mutter hatte einmal jedem von uns ein Stück Garten zum Bestellen anvertraut; der Teil meines Bruders verwandelte sich schnell in eine öde Wüste, ich dagegen buddelte vergnügt mit meinem Schäufelchen in der Erde herum. Nie werde ich vergessen, wie stolz ich war, als Papa in den höchsten Tönen meinen ersten Salatkopf lobte.
Ich hatte von der Kletterrose aus dem großen Garten meines Bruders in Highgate einen Ableger genommen, den ich überzeugen konnte, an unserer sonnigsten Mauer emporzuranken. Dann bezahlte ich den jüngsten von Mrs. Bentleys fünf Söhnen dafür, dass er ein hölzernes Spalier baute, und pflanzte eine Heckenkirsche, die mittlerweile so üppig wuchs, dass sie vor Bienen nur so summte und über die Mauer hinweg ausladend in den Garten unseres Nachbarn ragte, eines ehemaligen Kapitäns zur See.
Mit zunehmendem Alter werden Erinnerungen ja immer stärker, und ich hatte ein halbes Jahrhundert schon drei Jahre überschritten, doch der Duft der Heckenkirsche versetzte mich stets an einen lauen Sommerabend im Garten meines Elternhauses zurück, als ich ein romantisches Mädchen und mein teurer Matt ein ansehnlicher junger Vikar war, der neben unserer wasserfallartig wuchernden Heckenkirsche um meine Hand anhielt. Ach, wie glücklich wir doch waren – und wie sicher, unser Glück werde ewig währen!
Es ist nur gut, dass das Schicksal uns nicht in die Zukunft sehen lässt. Ich hatte keinesfalls damit gerechnet, dass unsere Liebesgeschichte auf so abrupte Weise enden würde, denn mein armer Matt starb vollkommen überraschend mit nur einundfünfzig Jahren. Er war ein kräftiger Mann gewesen und so gut wie niemals krank, was erklärt, warum er nie auf die Idee gekommen war, Vorkehrungen für meine Altersversorgung zu treffen. Meine »reduzierten« Lebensumstände hätten ihn zutiefst betrübt, und genau dies gab mir die Kraft, aus den Trümmern meines alten Lebens ein neues aufzubauen. »Dem geschorenen Schaf misst Gott den Wind« – auch wenn ich mich einsam und verlassen fühlte, wusste ich doch, dass jeder meiner Schritte geführt wurde.
Denn ganz gewiss war es mehr als bloßer Zufall gewesen, der mich zu Mrs. Bentley geführt hatte, meiner Vermieterin und nur scheinbar auch Bediensteten, die umgehend meine beste Freundin wurde. Sie war klein, gebeugt und runzlig, mit blassblauen Augen und schlohweißem fedrigen Haar, und als ich ihr Haus zum ersten Mal besichtigte, dünkte sie mir geradezu altersschwach. Sie war jedoch jünger, als sie aussah, dazu äußerst kompetent und (von ihrem Rheumatismus einmal abgesehen) voller Energie und Tatendrang. Dass ihr weißes Haar einmal flammend rot gewesen sein musste, erkannte man an den Schöpfen ihrer fünf Söhne und unzähligen Enkelkinder.
Der verstorbene Mr. Bentley war Hampsteads Postbote gewesen, und um über die Runden zu kommen, nahm Mrs. B Untermieter auf. Wie ich mit Freuden erfuhr, hatte sie ihre Zimmer einst auch an den Dichter John Keats und seine zwei Brüder vermietet.
»So wohlerzogene junge Männer«, seufzte sie hin und wieder, »und viel zu jung verstorben. Es hat mir fast das Herz gebrochen.«
Matt hätte es als »gefühlsduselig« abgetan, doch ich nahm die Verbindung zu Keats als gutes Omen für mein neues Leben in Hampstead. Gewisse Leute (die Frau meines Bruders) betrachteten das Haus im Well Walk als nicht vornehm genug für die Witwe eines Archidiakons und prophezeiten, ich werde das »Experiment« nach wenigen Wochen aufgeben. Auch hielten es gewisse Leute (siehe oben) für ungeheuerlich, dass ich mir meine Unabhängigkeit bewahren wollte, während sie fest damit gerechnet hatten, ich würde als unbezahltes Kindermädchen im Schoße der Familie bleiben – was, wenn sie nicht aufpasste, das übliche Schicksal einer verarmten weiblichen Verwandten war.
An der Küchentür erklang ein scharfes Klopfen. Ich legte mein Stopfzeug beiseite, denn ich ersparte Mrs. B gern einen unnötigen Gang, außerdem erwartete ich den Metzgersjungen, bei dem ich mich über die letzte Lieferung beschweren wollte (zu fettes und zu lange abgehangenes Schaffleisch).
Zu meiner Überraschung stand mein Bruder vor der Tür, grinste von einem Ohr zum anderen und hatte eine seiner grässlichen kleinen schwarzen Zigarren im Mund.
»Fred! Was machst du denn hier?«
»Es ist ein so wunderbarer Morgen, da konnte ich nicht widerstehen und musste einen Spaziergang durch den Park unternehmen. Außerdem wusste ich doch, dass du dich unbändig freuen würdest, mich zu sehen.«
»Tja, du kannst gerne reinkommen … aber deine Zigarre nicht.«
»Ach, Letty, nun sei mal keine Spielverderberin.« Er blies einen Rauchring in die Luft. »In meinem Haus wuseln Kinderfrauen und Babys durcheinander, und meine Kanzlei scheint mir zu dieser Jahreszeit unfassbar trist. Du bist meine einzige Zuflucht vor so viel Ungemütlichkeit.«
»Besten Dank für dieses zweifelhafte Kompliment. Ich nehme an, bei euch zu Haus ist alles in bester Ordnung, sonst würdest du nicht so selbstzufrieden grinsen.«
»Natürlich ist alles in bester Ordnung. Alle sind grauenvoll gesund.« Fred grinste hinterhältig, so wie er es schon als Achtjähriger getan hatte, wenn er mich in einen seiner ungehörigen Streiche hineinziehen wollte – womit er jedes Mal Erfolg gehabt hatte, obwohl ich als »die Vernünftige« galt. »Deine jüngste Nichte trinkt und schreit rund um die Uhr, und Fanny fängt schon wieder an zu zetern … das ist immer ein gutes Zeichen.«
Mein Bruder Frederick Tyson war ein prominenter Anwalt für Strafrecht in London. Seine Spezialität waren unappetitliche Mordfälle, und die Klatschpresse liebte ihn für seine extravaganten Auftritte im Gerichtssaal. In den Schaufenstern der Schreibwarenhändler um den alten Strafgerichtshof Old Bailey herum war er in unzähligen Karikaturen als stämmige und auffällig gekleidete Gestalt gezeichnet, stets mit einem großen weißen Taschentuch in der Hand (das ich als ziemlich vulgär und unangemessen empfand, aber wann hat er je auf mich gehört?).
Fred war ein pummeliger Junge mit lustigen Grübchen und Engelslöckchen gewesen; jetzt mit fünfzig wirkte er wie ein leicht anrüchiger Cherub. Seine Frau hatte vor kurzem das elfte Kind entbunden, alle waren rundum gesund und munter und verschafften mir als Kinderlose unermessliche Freude – allerdings hatte es den Anschein, dass Fanny als Schwangere weitaus verträglicher war als davor und danach, und ich fragte mich oft, ob mein Bruder sie vielleicht mit Absicht immer wieder in diesen Zustand versetzte.
»Und außerdem«, fügte Fred hinzu, »ist dies kein Privatbesuch.«
Sofort horchte ich auf. »Hast du Arbeit für mich?« Ich hatte mir einen bescheidenen Ruf als Privatdetektivin erarbeitet und baute darauf, dass mein Bruder mir passende Aufträge vermittelte. »Ich hoffe, diesmal ist die Aufgabe lohnender als neulich.«
Als letzten bezahlten Auftrag hatte ich die Töchter eines portugiesischen Granden für ein paar Guineen durch die Weltausstellung geführt, die gerade im Hyde Park eröffnet hatte und in aller Munde war (ich brauchte eine geraume Weile, ehe ich mir eingestehen konnte, wie langweilig und anstrengend ich die ganze Chose fand – Stunden um Stunden in einem überhitzten »Gewächshaus« voller Maschinen, während mir höllisch die Füße schmerzten).
»Mehr als lohnend«, erwiderte Fred. »Ich kenne die Details noch nicht, aber der Klient ist reich wie Krösus – und gewillt, für deine Dienste tief in die Tasche zu greifen.«
Nachdem ich mein Alltagskleid aus verblichener grauer Baumwolle gegen das gute aus schwarzer Seide mitsamt schwarzer Seidenhaube getauscht hatte, machten wir uns etwa eine halbe Stunde später auf den Weg. Wie ich aus Erfahrung wusste, wollten die Klienten sich gern meiner Ehrbarkeit vergewissern – und was wirkte ehrbarer als die Witwe eines Geistlichen in schwarzer Seide? Offenbar gefiel es ihnen, wenn ich ein wenig hausbacken und unscheinbar daherkam, ohne jedoch schäbig auszusehen.
»Tadellos siehst du aus«, bemerkte Fred und zog mir ungehörig am Rock. »Neben dir würde selbst der Erzbischof von Canterbury eine zwielichtige Erscheinung abgeben.«
»Lass das!« Ich raffte meinen Rock zusammen. »Mach dich lieber nützlich und erzähl mir etwas über den Fall. Du hast gesagt, wir könnten zu Fuß gehen – wie weit liegt das Haus entfernt?«
»Neben Preacher’s Hill und den alten Kurgärten. Das Haus gehört einem Dr. Chauncey, und unser Mann wohnt dort als Privatpatient.« Ohne seine leutselige Art zu verlieren, wurde mein Bruder ohne Umschweife geschäftsmäßig. »Er heißt Jacob Welland und hat ein Vermögen mit, vornehm ausgedrückt, ›Guano‹ gemacht. Ordinär gesagt, ist es Vogeldreck. Seine Anfrage erreichte meine Kanzlei am gestrigen Nachmittag, übermittelt von einem schneidigen jungen Bediensteten, der wie ein Räuberhauptmann der leichten Oper aussah: olivfarbene Haut und schwarze Augen, Spanier oder Italiener. Er hat in der Kanzlei einen hübschen Aufruhr verursacht; alle jungen Schreibdamen wechselten sich am Schlüsselloch ab, um einen Blick auf ihn zu erhaschen – Beamish musste sie mit dem Lineal vertreiben.«
»Und wie lautet der Auftrag?«
»Das weiß ich nicht; im Brief stand nur etwas von einer ›Familienangelegenheit‹.«
»Ich nehme an, er will mich zuerst unter die Lupe nehmen.«
»Nun, gewiss wird es irgendeine Art von Skandal sein – wie er sich für gewöhnlich hinter dem Ausdruck ›Familienangelegenheit‹ verbirgt.« Er pustete einen Rauchring in die Luft. »Fünf Schillinge, dass es um Ehebruch geht.«
»Fred!« Ich wusste, dass er mich nur necken wollte, und sollte nicht so aufgebracht reagieren, aber ich konnte nicht zulassen, dass er so leichtfertig von einer so ernsten Angelegenheit sprach.
»Nun fall nicht gleich in Ohnmacht. Und sag mir bitte nicht, was Papa sagen würde.«
»Mit den Geboten treibt man keine Scherze.« (Genau das hätte Papa gesagt; der arme Mann hatte nie verwunden, dass sein Sohn ihm nicht in den Dienst der Kirche gefolgt war.)
»Ich hege höchsten Respekt vor den Geboten; vor allem das fünfte hält mich dauerhaft in Lohn und Brot.«
Der Morgen war so schön und die Aussicht auf einen neuen Fall so reizvoll, dass ich beschloss, Fred zu ignorieren – außerdem wollte ich lieber auf die Umgebung achten. Neue Gebäude rückten immer näher an den Park heran, und auf Christchurch Hill wuchs zusehends eine stattliche Kirche in die Höhe. Rufe und Hammerschläge drangen durch die sonnige Luft, und auf den Bürgersteigen blockierten immer wieder Absperrbalken, Schubkarren und gefährlich aufgeschichtete Ziegelsteinhaufen den Weg.
Rosemount, die Klinik von Dr. Chauncey, war im vorigen Jahrhundert entstanden, als Hampstead für einige Jahre als Kurort galt. Es war ein langgezogenes, niedriges Backsteingebäude mit großzügigen Gartenanlagen, das durch eine Ulmenreihe von der Straße abgeschirmt lag.
Ein junges Mädchen öffnete uns die Tür. Es trug ein schlichtes, aber hübsch tailliertes blaues Hausgewand, das um einiges besser aussah als das alte Baumwollding, das ich vorhin angehabt hatte und das Mrs. B bereits zu Staubtüchern zu zerschneiden drohte.
Wir wurden in einen geschmackvoll eingerichteten Salon geführt. Es gab keinerlei Hinweise auf Krankheit – diese Klinik beherbergte nur einen Patienten. Bevor ich dazu kam, meine übliche Schnelleinschätzung der Umgebung vorzunehmen, betrat ein junger Bediensteter den Raum.
»Mrs. Rodd, Mr. Tyson …«
Fred zwinkerte mir fast unmerklich zu und formte lautlos das Wort »Räuberhauptmann«. Dies war also der Kurier, der bei Freds Schreibkräften solchen Aufruhr verursacht hatte. Er war sehr jung, geradezu ein Jüngelchen, von großer und schlanker Gestalt und schön wie ein junger Gott mit seinen dunklen Augen, die romantische Schriftstellerinnen gern als »blitzend« beschreiben. Trotz seiner spektakulären Schönheit trug er eine Livree in nüchternem Grau, und sein Auftreten war zurückhaltend und respektvoll.
»Mein Herr erwartet Sie. Bitte mir folgen.« Er sprach mit auffälligem Akzent, den ich jedoch nicht einordnen konnte.
Der junge Mann führte uns aus der staublosen Stille des Hauses in die jähe Muffigkeit eines Wintergartens mit gläsernem Dach. Ohne die zur Terrasse geöffnete Tür wäre die schwere, feuchte Hitze noch unangenehmer gewesen. Auf halbhohen Säulen stand eine Reihe eingetopfter Farne (was recht modisch aussah, wobei ich diese Pflanzen schon immer hässlich fand), so dass mein erster Blick auf Mr. Welland durch einen Wandschirm aus langen, zotteligen, teils noch eingerollten schmutziggrünen Farnwedeln erfolgte.
»Ich kann nicht aufstehen, bitte verzeihen Sie. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind; Zeit ist das Einzige, das ich nicht kaufen kann.«
Er brauchte nicht weiter zu erklären, warum er solche Eile hatte. Die Zeichen waren offensichtlich und mir nur allzu gut bekannt: eine atemlos flüsternde Stimme, heiß glänzende Augen und fahrige, knochige Finger. Jacob Welland starb an Schwindsucht, derselben unbarmherzigen Krankheit, die auch den armen John Keats ins Grab gebracht hatte; »wie Jugend bleicht und schleicht und siecht und schwindet«.
(Nach der Beerdigung eines jungen Mädchens, das wir gekannt hatten, gestand mir mein lieber Matt einmal, dass es ihn gegen den Allmächtigen aufbringe, solches Leid zu sehen; bei der Bestattung von Kindern, die er selbst getauft habe, könne er sich seiner Tränen nicht erwehren, und gerade die Schwindsucht fordere so viele Opfer, manchmal ganze Familien …)
Mein Bruder machte uns formell miteinander bekannt. Wir nahmen neben der Couch des Kranken auf zwei Korbstühlen Platz, nahe der offenen Tür. Wenn man berücksichtigte, dass Mr. Welland von der Krankheit bereits gezeichnet war, konnte man ihn auf etwa vierzig Jahre schätzen. Seine vormals wohl hellen Haare waren schütter und sandfarben und seine Augen von fiebrig glänzendem Blau. Trotz der Hitze war er in einen gesteppten Morgenmantel aus blauem Satin gehüllt.
»Ihrer Diskretion müssen Sie mich nicht versichern, Mrs. Rodd«, sagte Mr. Welland. »Sie sind mir von jemandem empfohlen worden, zu dem ich vollstes Vertrauen habe; lassen Sie uns Zeit sparen, indem wir gleich zur Sache kommen.« Er sagte etwas in einer fremden Sprache, die ich als Spanisch erkannte, woraufhin sich der junge Bedienstete verbeugte und hinter den Wandschirm aus Farnwedeln zurückzog. »Ich möchte, dass Sie jemanden ausfindig machen, aber niemand darf wissen, dass Sie ihn suchen, am wenigsten der Gesuchte selbst. Sollte er merken, dass Sie ihm nachstellen, wird er sicher untertauchen.«
»Ich kann sehr vieles tun, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekommt«, erwiderte ich. »Aber ich verstehe nicht: Ist der Mann ein Flüchtiger? Ein Verbrecher?«
»Er ist mein Bruder«, flüsterte Mr. Welland. »Joshua Welland, mein einziger lebender Verwandter.«
»Ich nehme an, Sie wollen ihm – bitte entschuldigen Sie meinen Zynismus – Ihr ganzes Erbe hinterlassen«, sagte Fred. »In der Regel lassen sich Menschen, die ein Vermögen erben, aber doch gern aufstöbern. Haben Sie es schon mit einer Anzeige in der Londoner Times versucht?«
»Ich möchte ihn sehen, bevor ich sterbe«, erklärte Mr. Welland leise und ruhig, als würde er durch eine Glaswand mit uns sprechen. »Chauncey wird mich nicht länger als ein paar Monate am Leben halten können.«
»Wann haben Sie Ihren Bruder zuletzt gesehen«, erkundigte ich mich.
»Vor zehn Jahren. Kurz bevor ich nach Südamerika aufbrach. Zu meinem größten Kummer haben wir uns damals im Streit getrennt. Ich möchte mich mit ihm versöhnen – um unserer lieben Mutter willen.«
»Ich verstehe.« (Natürlich hätte ich gern gewusst, worum es bei dem Streit gegangen war, doch Mr. Welland war bedauernswert kurzatmig, und andere Fakten waren wichtiger.) »Können Sie ihn beschreiben? Wie alt ist er?«
»Dreißig Jahre. Jung genug, um noch einmal neu anzufangen.«
»Ist er groß oder klein? Welche Farbe hat sein Haar?«
»Sein Haar ist golden, wie unsere Mutter zu sagen pflegte.« Seine Stimme wurde immer schwächer, aber die Augen glühten vor Entschlossenheit; ich spürte, dass ihn das Verlangen, seinen Bruder zu sehen, am Leben hielt. »Geld spielt für mich keine Rolle. Mein Anwalt, Mr. Harold Mitchell im Barnard’s Inn, wird Sie mit allem Nötigen versorgen. Das Geld, das ich ihm anvertraut habe, schließt Ihr Honorar mit ein, Mrs. Rodd.«
Die von ihm darauf leichthin genannte Summe war so enorm, dass ich Mühe hatte, Fassung zu bewahren (ich hatte gehofft, ich könnte mir davon ein neues Alltagskleid kaufen, aber mit dem Geld würde ich auch eines aus Seide bekommen).
Fred schürzte die Lippen und hätte wohl gepfiffen, hätte er nicht rechtzeitig meinen Blick bemerkt. »Ich kenne Mitchell. Ein respektabler Anwalt.«
»Werden Sie den Auftrag übernehmen, Mrs. Rodd?«
»Mit dem größten Vergnügen, Mr. Welland.« Ich verbannte jeglichen Gedanken an Geld, um mich ganz dem armen Kranken zu widmen. »Obwohl ich solche Fälle normalerweise nicht annehme, habe ich doch einige Erfahrung mit dem Aufstöbern vermisster Personen.« (Insbesondere im Fall Heaton, meinem ersten erfolgreichen Auftrag, bei dem eine vermeintlich verstorbene unverheiratete Tante in munterer Schande mit einem auf Halbsold gesetzten Kapitän zusammenlebte.) »Wissen Sie sicher, dass Ihr Bruder noch lebt?«
»O ja, er ist erst vor kurzem mehrmals gesichtet worden.«
»Wie meinen Sie das?«
»Joshua ist so etwas wie ein weißer Hirsch«, erklärte Mr. Welland. »Er lebt wie ein Wilder, in freier Natur. Die Leute auf dem Land kennen und beschützen ihn.«
»Sie sagten am Anfang, er wolle nicht entdeckt werden. Wenn das der Fall ist, kann ich nicht mehr tun, als Sie über seinen Aufenthaltsort in Kenntnis zu setzen.«
»Er soll wissen, dass ich sterbe. Und dass ich ihn um Vergebung bitte.«
»Diese Botschaft werde ich ihm gern überbringen, Mr. Welland, aber ich muss zugeben, dass ich nicht ganz verstehe, warum Sie mich dazu brauchen.«
Ein qualvolles Halblächeln zuckte um seine Mundwinkel. »Weil er nicht weglaufen wird, wenn er Sie sieht.«
»Warum sollte er vor anderen davonlaufen?«
»Er hat der Welt den Rücken gekehrt.« Mr. Welland hielt inne, um Atem zu schöpfen. »Ich habe alles aufgeschrieben. Mein Bruder hat es als der Ärmste aller Studenten nach Oxford geschafft. Doch am Ende hat ihm die Armut das Herz gebrochen; als seine Kleider nur noch Lumpen waren, floh er aus seinem College in die Wälder, und seitdem lebt er dort.«
»Wissen Sie, wo genau?«
»Nur ungefähr. Irgendwo südwestlich von Oxford, in der Gegend um Cumnor Hill. Er ist aber auch schon in der Nähe vom sogenannten ›Tal des Weißen Pferdes‹ gesehen worden.«
»Wenn Sie sagen, man hat ihn gesehen – was meinen Sie damit? Hat jemand mit ihm gesprochen?«
»Ich meine damit«, erklärte Mr. Welland langsam, »dass er gesichtet wurde. Die Menschen dort kennen ihn.«
Das klang sehr rätselhaft, und ich konnte mir nur schwer vorstellen, wen oder was genau ich suchen würde: einen klugen und gebildeten Mann, der in den letzten zehn Jahren offenbar als Wilder gelebt hatte und bald ein Wilder mit immens viel Geld sein würde.
Fred tupfte sich mit dem Taschentuch über die Stirn; der Wintergarten war schwül und roch nach Kohl. »Ist Ihr Bruder recht bei Sinnen? Verzeihen Sie die Frage, aber meine Schwester sollte wissen, ob sie einen Geistesgestörten verfolgt.«
(Genau dieselbe Frage hatte ich ebenfalls zu formulieren versucht, nur weniger direkt.)
»Mein Bruder ist nicht verrückt. Exzentrisch vielleicht und sonderbar, aber keinesfalls ›gestört‹ im üblichen Sinne. Er ist ein Philosoph, und für ihn war es eine rationale Entscheidung, der modernen Welt den Rücken zu kehren. Ich will ihn auch nicht von dem Leben abbringen, das er für sich gewählt hat. Ich will ihn nur noch einmal sehen, bevor ich sterbe.«
»Ich verstehe.« Uns blieb nicht mehr viel Zeit; Jacob Welland war erschöpft, und auf seinen hervorstehenden Wangenknochen zeichneten sich zwei leuchtend rote Flecken ab. »Mr. Welland, es würde mir sehr helfen zu wissen, warum Sie und Ihr Bruder sich vor all den Jahren entzweit haben.«
»Eine Frau?«, schlug mein Bruder mit neu erwachtem Interesse vor.
»Ja«, bestätigte Mr. Welland flüsternd. »Eine Frau … was mittlerweile eine befremdende Vorstellung ist. Es ging um eine Frau. Wir haben sie beide geliebt. Und sie ist gestorben.« Sein Atem stockte, und wie ein Fisch schnappte er mit offenem Mund nach Luft. Zitternd deutete er zum Tisch, auf dem zwischen allerlei medizinischen Utensilien eine Glocke stand, die ich auf der Stelle läutete.
Binnen Sekunden erschien der junge Diener. Er nahm ein kleines braunes Fläschchen vom Tisch und träufelte ein paar Tropfen in ein Glas mit Wasser. Es berührte mich, wie behutsam, ja fast zärtlich, er das Glas an die Lippen seines Herrn führte. Und einen kurzen Moment lang sah ich in Mr. Wellands furchtsam geweiteten Augen beim Blick auf den Jüngling etwas aufscheinen, das ich nur mit Liebe beschreiben kann.
(Als Pfarrerstochter kam ich nicht umhin, in dieser Szene eine göttliche Botschaft zu sehen: Alles Gold der Welt hatte Mr. Welland keine liebende Familie verschaffen können; der einzige Mensch, den er lieben konnte, war sein Diener.)
Nach einigen Minuten hatte er sich so weit erholt, dass er mit knochigen Fingern meine Hand ergreifen konnte. Der junge Mann überreichte Fred einen Stapel Papiere, die sorgsam mit rosafarbenem Notariatsgarn zusammengebunden waren, und unser Gespräch war beendet.
Nach der drückenden Hitze im Wintergarten war die Luft draußen wunderbar frisch und kühl. Fred seufzte erleichtert auf und zündete sich eine Zigarre an.
»Nun, das war doch schon feine Arbeit am Morgen, findest du nicht?« Er löste das Band, um einen schnellen Blick auf die Dokumente zu werfen. »Aha … ja … hm … soweit ich erkennen kann, ist alles in bester Ordnung. Die ganze Zeit wollte ich fragen, was wir tun sollen, wenn er uns unterdessen stirbt, aber genau dafür hat er bestens vorgesorgt.«
»Er hat an alles gedacht.« Ich nahm Fred die Papiere ab. »Ich hoffe nur, wir finden seinen Bruder noch rechtzeitig.«
»Natürlich, das wirst du – verteil ein paar Schillinge in den Dörfern, dann hast du ihn in wenigen Tagen aufgestöbert.«
»Du gehst davon aus, dass es eine leichte Sache wird. Ich bin mir da nicht so sicher. Mr. Welland hat es bereits selbst versucht und ist gescheitert, sonst würde er meine Dienste nicht benötigen.«
»Weißt du schon, wo du bei deiner Jagd auf den weißen Hirsch unterkommen wirst? Du wirst in der Gegend doch wohl nicht irgendwelche Verbindungen haben, oder?« Wir mussten beide schmunzeln, denn das Ausmaß meiner »Verbindungen« zu Geistlichen im ganzen Land war in der Familie legendär und Anlass für so manchen Scherz. Und Oxford war von Geistlichen geradezu überschwemmt.
»Das ist tatsächlich eine wunderbare Gelegenheit, Arthur Somers und seine Frau zu besuchen«, gab ich zurück.
»Wen?«
»Mr. Somers – du kennst ihn.«
»Nie von ihm gehört.«
»Doch, das hast du, er war der junge Hilfsprediger in Herefordshire – der mit den gelben Haaren, den du immer ›Osterglocke‹ genannt hast.«
»Ach ja«, sagte Fred, als er sich endlich erinnerte (er hatte Mr. Somers bei einem seiner Besuche kennengelernt, an denen er immer alles an Essen verputzte, das ich im Haus hatte). »Hat er dann nicht dieses übellaunige Mädchen mit den vierzigtausend Pfund geheiratet?«
»Rachel Garnett.« Es ärgerte mich ein wenig, dass ich seiner Beschreibung nicht widersprechen konnte. Obwohl er es etwas ungeschliffen ausgedrückt hatte, entsprach es voll und ganz der Wahrheit. Miss Garnett hatte in der Tat vierzigtausend Pfund besessen und unleugbar ein ernstes und grämliches Wesen gezeigt. »Mr. Somers wohnt ein kleines Stück außerhalb von Oxford, was ein idealer Ausgangspunkt für meine Nachforschungen wäre.«
»Sie war recht hübsch«, meinte Fred nun. »Oder hätte es sein können, wenn sie sich nicht wie eine Nonne angezogen hätte. Aber warum sah sie immer so sauertöpfisch aus? Mir hätten vierzigtausend Pfund jahraus, jahrein die beste Laune beschert.«
Zwei
Sobald ich nach Hause kam, schrieb ich Rachel Somers einen Brief, in dem ich mich frech für die nächste Woche als Besuch ankündigte. In dieser Angelegenheit war schnelles Handeln unabdingbar; ich hatte Mr. Welland ins Herz geschlossen und respektierte seinen sehr löblichen Wunsch, sich vor dem Tod mit seinem Bruder zu versöhnen.
»Er meinte, niemand dürfe wissen, dass ich nach Joshua suche«, erzählte ich Mrs. Bentley. »Und dennoch habe ich beschlossen, es genau andersherum zu versuchen: Ich will, dass jeder es weiß, um sicherzustellen, dass er meine Botschaft erhält. Es ist doch nur so wenig Zeit.«
»Vielleicht bleibt Ihnen mehr, als Sie denken«, sagte Mrs. Bentley. »Manche Menschen können das Sterben ewig hinauszögern, wenn sie auf etwas warten. Ich hatte eine alte Tante, die wochenlang zäh am Leben festhielt, bis ihr Sohn von der See nach Hause kam. Dann schied sie dahin wie eine Kerze, die man ausgepustet hat.«
»Ja, Ähnliches habe ich auch schon erlebt, aber dem armen Mr. Welland bleiben sicherlich kaum mehr als ein paar Wochen. Ich werde zusehen, dass sein Bruder die Botschaft erhält, dann kann er selbst entscheiden, was er damit anstellt.« Ich steckte wieder in meinem alten Gewand, wir saßen in der Küche und tranken Brandy mit heißem Wasser. Mrs. B hatte einen Achtelliter Brandy aus dem nahegelegenen Wirtshaus geholt und von irgendwoher Zucker und Zitrone gezaubert. Auf diese Weise feierten wir jeden neuen Fall, und ich war immer gespannt auf Marys Kommentare. »Was für eine Schande, wenn Brüder sich überwerfen!«, fügte ich hinzu.
»Wenn ich nach meinen Jungen gehe, kommt das aber selten vor«, sagte Mrs. B. »Natürlich haben die sich auch gestritten, aber nie so schlimm, dass sie sich völlig entzweit hätten. Meiner Erfahrung nach passiert das nur in zweierlei Fällen: wenn Geld im Spiel ist oder eine Frau.«
»In diesem Falle ist es eine Frau. Ich habe Mr. Wellands Unterlagen noch nicht lesen können, aber er sagte, sie hätten beide dieselbe geliebt, und sie sei gestorben.«
»Ich wusste es!« Traurig zuckte Mrs. Bentley die Achseln. »Liebe oder Geld. Und Liebe ist das Schlimmste.«
»Was mich betrifft, muss ich nun dringend für meine Reise nach Oxford packen. Im Seidenkleid kann ich nicht reisen, aber das schwarze aus Marocain ist zu warm und das aus Popeline in beklagenswertem Zustand.«
»Oh, das können Sie mir geben«, sagte Mrs. B. »Es muss nur gelüftet und gebügelt und über heißen Wasserdampf gehängt werden, und wo ich schon dabei bin, kann ich mich auch gleich um Ihre Handschuhe kümmern.« (Trotz ihres Rheumatismus’ verfügte sie über beachtliches Talent, alten Kleidungsstücken zu neuem Glanz zu verhelfen.)
»Mein Bruder hat eine von Mr. Wellands Banknoten eingewechselt. Ich werde ein hübsches Sümmchen in unserer Schloss-Windsor-Dose deponieren, und ich erwarte, dass Sie es ausgeben.«
»Sie legen immer zu viel hinein, Ma’am«, protestierte sie.
»Sie wissen, dass es mich wahnsinnig macht, wenn Sie um meinetwillen geizig sind.« Ich lachte, denn dies war ein ewiger Streit zwischen uns. »Von allem anderen einmal abgesehen, hält man mich am Ende noch für hartherzig. Denken Sie bitte an meinen Ruf und sorgen Sie dafür, dass Sie Mr. Wellands Geld für Kohlen, anständiges Essen und Kerzen verwenden. Ich habe meine Spione, liebe Mary, und wenn ich höre, dass man Sie wieder dabei ertappt, dass Sie im Dunkeln sitzen, so wird mir das sehr missfallen.«
Von der Straße schallte lärmender Gesang zu uns herein – eine der Cockney-Balladen, die zu jener Zeit so ungemein und unerfreulich beliebt waren, mit plärrendem »Turalu«-Refrain.
In den Garten ging Vilikins wohl im Morgenrot,
Da lag seine Dinah und war mausetot.
Einen Becher mit Gift er wohl neben ihr sieht,
Und die Enten, sie schrie’n, dass für Vilikins sie schied,
In der Hand einen Brief, dass für Vilikins sie schied.
Es war spät und unser Krug mit Brandy geleert. Nachdem Mrs. B gute Nacht gesagt hatte, erklomm ich die Treppe zu meiner kleinen Kammer, wo ich mir im Licht der Chinalampe, die einst mein Wohnzimmer in Bloomsbury zierte, Mr. Wellands Dokumente zu Gemüte führte. Über dem Kamin hing ein Porträt meines seligen Matt von Edwin Landseer und wachte über mich – ein Geschenk der Diözese aus dem Jahr vor seinem Tod und jetzt mein wertvollster Besitz.
In den Unterlagen von Mr. Welland befanden sich Banknoten, ein Fahrschein für die Eisenbahn und zwei Empfehlungsschreiben, mit deren Hilfe ich mich an die beiden Herren wenden konnte, die Joshua seit seinem Verschwinden gesehen hatten (oder zumindest behaupteten, ihn gesehen zu haben): ein Kommilitone aus seinem College und ein Gutsherr, der praktischerweise ganz in der Nähe meiner Unterkunft wohnte. Außerdem gab es, wie Fred bereits erwähnt hatte, eine Liste von Instruktionen mit der Überschrift »Für den Fall meines Todes« sowie einen versiegelten Brief an Joshua.
Am interessantesten fand ich jedoch die Blätter, die mit enger Handschrift beschrieben waren.
Dies ist der vollständige und wahrhaftige Bericht der Missetaten, die Jacob Welland an seinem Bruder Joshua begangenen hat.
Aufgewachsen sind wir in Kent. Unser Vater war ein Kirchenmann der niedersten Art – ein armer Hilfsprediger, der für einen jährlichen Hungerlohn den Großteil der Arbeit des vollbezahlten Pfarrers verrichtete. Unsere Mutter war die Tochter eines anderen armen Hilfspredigers. Ich war ihr ältestes Kind und mein Bruder Joshua, der zehn Jahre später geboren wurde, ihr jüngstes. Zwischen mir und ihm kamen zwei Mädchen zur Welt, Mary und Ruth, und verließen sie wieder. Joshua kannte nur ihre kleinen Gräber auf dem Kirchfriedhof.
Unsere arme Mutter sagte immer, Joshua sei ein später Segen gewesen, den der Himmel geschickt habe, um ihr gebrochenes Herz zu heilen. Er war unser Goldjunge – hübsch, gesund und gutmütig. Ich bin nie besonders gelehrig gewesen, aber Joshua zeigte bereits früh Anzeichen bemerkenswerter Intelligenz. Mit sieben schon hatte er das gesamte Wissen unseres Vaters aufgesogen und kannte jedes Buch im Haus auswendig (von denen es nicht viele gab). Uns allen war klar, dass Joshua studieren müsse. Und es war gleichermaßen klar, dass wir es uns nicht leisten konnten. Schulen, Bücher und Lehrer kosteten Geld, das wir nicht hatten – wie sagt der Dichter: »Gold verriegelt jede Pforte, Gold allein auch öffnet sie.«
Ich war zu jener Zeit ein linkischer Tölpel von siebzehn Jahren. Dank Dutzender Bittbriefe meines Vaters war ich als Bürogehilfe im Marineministerium in Chatham eingestellt worden. Soweit es meine Eltern betraf, war ich ein gemachter Mann. Aber ich hasste die Arbeit, die hauptsächlich darin bestand, lange Listen von Namen und Nummern abzuschreiben. Ich hasste meine feuchte Unterkunft neben einer Brauerei. Chatham war eine Matrosenstadt. Die großen Schiffe in den Docks ragten geheimnisvoll und wunderbar über die Häuser hinaus und versprachen alle Arten von Freiheit und Abenteuer.
Ich sagte meinem Vater, ich könne sicher genug Geld für Joshuas Ausbildung verdienen, wenn ich mein Büro gegen eines der Handelsschiffe eintauschte. Er wollte nichts davon hören, denn er hatte für seine Stellung als »Gentleman« immer hart gearbeitet.
Kurz darauf schien das Problem von Joshuas Ausbildung vorübergehend durch unseren Nachbarn gelöst, einen verarmten Exzentriker, der inmitten von Bücherbergen lebte und sich als exzellenter Lehrer für Joshua erwies; dank seiner gewann Joshua ein Stipendium der Lateinschule im nächsten Ort.
Meinen Wunsch zu fliehen und in der Ferne mein Glück zu finden, hatte ich in der Zwischenzeit jedoch nicht verloren. Dieser Bericht soll aber nicht der Illustration meines Lebens und meiner Karriere dienen; es soll nur darlegen, warum ich mich meinem Vater widersetzte und nach Amerika segelte. Dort erlangte ich mein Vermögen natürlich nicht über Nacht – das von mir gewählte Leben brachte viel Kampf und Beschwernis mit sich, doch es gefiel mir, und ich bereute es kein einziges Mal, dem Beamtendienst den Rücken gekehrt zu haben.
Als ich Joshua das nächste Mal sah, war er ein schlaksiger Junge von sechzehn Jahren und noch genauso bescheiden und gütig wie zuvor, obwohl ihm sein Stipendium großen Respekt verschaffte und er Schulsprecher geworden war. Nur aufgrund seines inständigen Flehens konnten meine Eltern mir vergeben, dass ich geflohen und zur See gegangen war.
Obwohl mein Wohlstand noch in weiter Ferne lag, hatte ich immerhin genug gespart, um unabhängig zu sein. Ich kaufte ein kleines Landgut in der Nähe der Gemeinde meines Vaters. Es war eine schlechte Investition, für die ich viel zu viel bezahlte. Das Bauernhaus war düster und klamm und das umgebende Land zu feucht. Irgendwie schaffte ich es, mich über Wasser zu halten. Seltsam, sich vorzustellen, dass ich jetzt dort leben würde … wäre sie nicht gewesen.
Ja, es gab eine SIE – was sonst hätte zwei sich so nahestehende Brüder auseinanderbringen können?
Hannah Laurie war eine entfernte Base mütterlicherseits, die mit sechzehn Jahren als Waise zu uns kam. Sie hatte Haare wie Gold, die bei manchem Lichte rötlich schimmerten, und Augen von reinstem Blau.
Unser Vater nahm das arme Waisenkind gern auf, nicht nur aus christlichem Pflichtgefühl. Die Gesundheit unserer Mutter ließ allmählich nach, und ihr Verstand begann sich zu trüben. Hannah pflegte sie und wurde zu einer treuen Gefährtin und Freundin – ja, fast zu einer ihrer verlorenen Töchter.
Ich verliebte mich in sie, wusste aber tief im Innern, dass sie meine Gefühle nicht erwiderte. Auch wenn es niemals ausgesprochen wurde, war allen im engeren und weiteren Umfeld klar, dass sie meinen Bruder liebte.
Ich bin von Natur aus nicht eifersüchtig und fand mich in den nächsten Jahren, so gut es ging, damit ab, bis unsere Eltern dann beide starben. Nun war Hannah ganz allein, ohne Wohnung, ohne Einkommen, und besaß nur die Kleider, die sie tagaus, tagein am Leibe trug. Joshua hatte ebenfalls nichts und konnte nicht helfen.
Ich überlege oft, wie anders diese Geschichte verlaufen wäre, hätten wir nur etwas Geld besessen.
Dann hätte Hannah mich wohl nie geheiratet.
Ich musste sie keineswegs dazu zwingen; das arme Mädchen war überaus dankbar, bei mir Zuflucht zu finden. In klaren Worten: Sie hatte keine andere Wahl. Natürlich war mir unterschwellig bewusst, dass ich ihre Hilflosigkeit ausnutzte. Und ein Schmetterling verliert seinen Glanz, wenn er gefangen und aufgespießt wird. Ich glaube wohl, dass Hannah mich mochte und dass sie zu mir aufsah – aber glücklich war sie nicht. Ich tat mein Bestes, um die bittere Tatsache zu ignorieren, dass ihr Herz einem anderen gehörte.
Meinem Bruder erzählte ich von der Heirat erst im Nachhinein. Joshua war tief verletzt und wütend über meinen Verrat und schwor, er wolle mich nie wieder sehen, noch je wieder mit mir sprechen. Ich gebe zu, dass es verabscheuungswürdig war, was ich tat. Es gab nurmehr zwei Menschen auf der Welt, die ich liebte, und beiden hatte ich übergroßen Schmerz zugefügt.
Ohne mich hätte sich das liebe, gute Mädchen nie in die Dunkelheit geflüchtet. Kurz nachdem Joshua das College verließ, um als Einsiedler zu leben, verlor ich sie. Sie nahm das Wenige, mit dem sie gekommen war, und verschwand aus meinem Leben wie der Atemhauch von einem Spiegel. Ihr Abschiedsbrief bestand aus nur zwei Worten: »Vergib mir.«
Ich suchte nach ihr. Ich schickte andere aus, nach ihr zu suchen, meilenweit durchs ganze Land. Es war mir egal, dass sie über mich lachten. Es war mir egal, dass sie mich bemitleideten. Für mich stand fest, dass sie meinem Bruder gefolgt war. Ich habe sie nie gefunden, auch wenn ich alle möglichen Geschichten hörte – sie hätten sich einer Bande Zigeuner angeschlossen, hätten ein Baumhaus errichtet oder seien zu den Antipoden ausgewandert.
Nach fast einem Jahr schickte mir ein treuer Freund die Nachricht, dass Hannah gestorben sei. Die Botschaft brauchte lange Zeit, um mich zu erreichen, und als ich ihr Grab aufsuchte, wuchs dort bereits Gras. Sie liegt auf dem einsamen kleinen Kirchfriedhof von Shotton Barrow. Von meinem Bruder hörte ich nichts. Mit gebrochenem Herzen reiste ich nach Südamerika, wo ich das Vermögen verdiente, das ich nicht länger begehrte. Ich kann nur hoffen, dass Joshua mein Geld besser anlegt, als ich es getan habe. So unser gnädiger Gott es will, werde ich ihn vor meinem Tod noch einmal sehen.
JACOB WELLAND 1851
Ich las die romantische Geschichte mehrere Male und ließ sie mir bis nach Mitternacht durch den Kopf gehen. Fakten über seinen Bruder lieferte Mr. Welland nicht besonders viele. Vielleicht würde es helfen, dachte ich, das Grab von Hannah Laurie aufzusuchen. Ich fragte mich, woran sie wohl gestorben war – dieses unschuldige Mädchen, das möglicherweise mit wilden Zigeunern umhergezogen war.
Wenn sie ihren rechtmäßig angetrauten Ehemann für seinen Bruder verlassen hatte, so war dies eine schwere Sünde gewesen, doch ich mochte sie nicht verurteilen; sie war gezwungen gewesen, sich zwischen einem festen Dach über dem Kopf und einem Leben unter freiem Himmel zu entscheiden. Mr. Welland hatte recht daran getan, sich einzugestehen, dass er ihre Hilflosigkeit auf niederträchtige Weise ausgenutzt hatte. Er wusste, dass sie und Joshua sich nicht offen zu ihrer Liebe bekennen konnten, weil sie zum Heiraten zu arm waren. Ein besserer Mensch jedoch hätte nach einer Möglichkeit gesucht, dem jungen Paar zu helfen, anstatt es auseinanderzureißen.
Und am Ende hatte die Liebe doch gesiegt, als Hannah sich für das Leben unter freiem Himmel entschied – so wie es in dem alten Zigeunerlied heißt: Wenn wir auch kein Deckbett haben, tun wir uns ein Loch ausgraben, legen Moos und Reisig ’nein, das solln unsre Federn sein. Ich merkte, dass ich ganz gegen meine Prinzipien hoffte, sie hätte vor ihrem Tod noch ein wenig Glück gefunden.
Drei
Bei wunderbarem Heuwetter, heiß und windstill unter leuchtend blauem Himmel, reiste ich nach Oxford. Ausnahmsweise war die Zugfahrt einigermaßen bequem. Durch das geöffnete Fenster strömten zu gleichen Teilen laue Sommerluft und Ruß in mein Abteil der Ersten Klasse. Im Wagen der Dritten Klasse hinter uns (der in jenen Tagen nichts weiter war als ein offener Waggon mit Holzbänken) herrschte Ferienstimmung; jemand hatte eine Ziehharmonika dabei und begleitete damit den lautstarken Gesang bekannter Lieder – das von »Vilikens und Dinah« natürlich und auch das gleichermaßen enervierende »Ich hätt lieber ’n Guinee als ’nen Ein-Pfund-Schein«.
Die gute Laune wirkte allerdings ansteckend. Es tat gut, wieder echte Landschaft zu sehen, und der Anblick der Felder und Wälder und strohgedeckten Bauernhäuser versetzte mich gedanklich in die Gemeinde meines lieben Vaters in Gloucestershire zurück. Ich freute mich schon auf die langen Spaziergänge, die ich auf der Suche nach dem heimatlosen Scholaren unternehmen würde.
Außerdem freute ich mich darauf, Rachel und Arthur wiederzusehen, das erste Mal seit ihrer Hochzeit, die nun schon mehr als zehn Jahre zurücklag. Rachel und ich schrieben einander alle paar Monate umfangreiche Briefe, doch Briefe verbergen ebenso viel, wie sie enthüllen, und ich hatte mich schon mehrfach gefragt, ob sie wohl wirklich glücklich war.
Es gab einen persönlichen und in gewisser Weise eigennützigen Grund für meine Sorge. Ich hatte die beiden miteinander verkuppelt und betrachtete es als meinen größten Erfolg als Ehestifterin: meine melancholische (und reiche) junge Freundin und mein Lieblingshilfsprediger. Meinem lieben Matt jedoch war es ein Dorn im Auge gewesen, auch wenn er mir nie einen Grund für sein Missfallen nennen konnte. Bedauerliche Tatsache war, dass wir oft wegen Arthur Somers gestritten hatten.
Er kam direkt aus Oxford zu uns – so frisch ordiniert, dass die Tinte noch feucht war, wie Matt immer sagte –, und ich schloss ihn sogleich in mein Herz. Er war feinfühlig und liebenswürdig und absolut aufrichtig in seinem Wunsch, Gutes zu tun. Zudem war er am Teetisch stets gute Gesellschaft. Mit seinen goldblonden Haaren und den seelenvollen blauen Augen brachte er allerorts die Frauenherzen zum Schmelzen (und ich war die Letzte, die solches verurteilte, da ich ja einst selbst einem hübschen jungen Hilfsprediger erlegen war). Ich war mir sicher, dass er sich binnen weniger Monate mit einer unserer jungen Damen der Gemeinde verloben würde, denn das war es, was unsere Hilfsprediger für gewöhnlich taten (den Rekord hielt ein gewisser Mr. Knox, der schon nach vierzehn Tagen die Jüngste der Morrisons erobert hatte).
Dieser junge Hilfsprediger jedoch blieb über lange Zeit hinweg Junggeselle. Seine Unterkunft im Dorf wurde mit Kuchen, Torten, Puddings und warmen Socken geradezu überschwemmt, und er nahm alle Geschenke mit derselben unverbindlichen Höflichkeit entgegen. Allmählich fragte ich mich, ob er wohl schon ein Einverständnis mit einer uns unbekannten Dame eingegangen war. Oder aber an einem gebrochenen Herzen litt.
Eines Abends dann, als wir einvernehmlich in unserem Wohnzimmer am Kamin saßen, veranlasste mich meine Neugier, ihn geradeheraus danach zu fragen.
»Ich bin zu arm, als dass ich ans Heiraten denken könnte«, erwiderte er.
»Sicher wird man Sie bald in eine gutbezahlte Stellung berufen«, sagte ich. »Und dann werden Sie eine Frau brauchen.«
Leise und sehr ernst erwiderte Mr. Somers: »Ich habe nicht die Absicht zu heiraten, Mrs. Rodd. Ich werde Gottes Heiliger Kirche am besten dienen, wenn ich im Zölibat lebe.« Ich war klug genug, dies meinem Mann gegenüber nicht zu wiederholen, denn dem waren all die übrigen katholischen Anwandlungen seines Hilfspredigers schon hinreichend suspekt: alle fünf Minuten heilige Kommunion, Beten auf Latein und all die anderen Praktiken, die durch die sogenannte »Oxford-Bewegung« in Mode gekommen waren. Aber natürlich versuchte ich, ihm diesen »Zölibat« auszureden – als Ehefrau eines Geistlichen konnte ich kaum anderes tun –, wobei ich allerdings auf Granit biss; so sanftmütig und freundlich er für gewöhnlich auftrat, konnte er auch bemerkenswert stur sein.
Miss Rachel Garnett war auf recht dramatischem Weg in unsere Gemeinde gekommen: als Verstoßene. Ihre Eltern waren Freikirchler, die sie enterbten, als sie der etablierten Kirche beitrat. Eine Tante ihres Vaters, die aus denselben Gründen verstoßen worden war, erbarmte sich ihrer und nahm sie auf. Sie war eine hübsche junge Frau mit dichten Wimpern um dunkelgraue Augen in einem blassen, ovalen Gesicht und mit glatten weichen Haaren von schönstem Kastanienbraun. Sie kleidete sich, wie Fred bereits sagte, sehr schlicht in nonnenhaft graue Gewänder und wirkte überaus trübsinnig.
Doch sobald ich sie näher kennenlernte, schloss ich sie mehr und mehr ins Herz. Sie war intelligent, von tiefer, aufrichtiger Frömmigkeit und wollte dem Herrn ergeben dienen. Außerdem besaß sie vierzigtausend Pfund aus der Familienbrauerei, die ihr verstorbener Vater ihr vor seinem Tod als Geste der Versöhnung doch noch vermacht hatte. Sie zweifelte ernsthaft daran, ob dies moralisch zu vertreten sei, und spielte mit dem Gedanken, alles Geld wegzugeben, wovon ich sie nur mit Mühe abhalten konnte. Meiner Meinung nach würde diese sanftmütige junge Frau dem Herrn am besten dienen, indem sie heiratete und sich um eine Familie kümmerte. Und ich hätte sie auch gewiss nicht mit Arthur verkuppeln wollen, wäre ich nicht sicher gewesen, dass die zwei sich bereits verliebt hatten.
»Pfff«, machte Matt.
»Was meinst du damit?«, fragte ich indigniert. »Sie verbringen viel Zeit zusammen. Und Rachel ist geradezu aufgeblüht.«
»Meine Liebe, dieser lasche Petersilienstängel von Hilfsprediger hat gar nicht das Rückgrat, sich zu verlieben.«
Zu jener Zeit entschied ich, dass er sich einfach nur zu sehr über Arthur ärgerte, um die Lage richtig zu beurteilen. Jemand hatte sich beim Bischof über sogenanntes »römisches Gebaren« beschwert, und im Dorf ging das Gerücht, Arthur wolle sie alle zu Katholiken machen (wenn das jetzt ein wenig hysterisch klingt, so spiegelt es lediglich den Geist jener Zeit wider; es war kurz bevor der anglikanische Pfarrer John Henry Newman durch seinen Übertritt zur römisch-katholischen Kirche nationale Empörung auslöste), und mein guter Mann musste einige sehr ausdrückliche Predigten halten, um dem albernen Gerede um Jesuitenverschwörungen ein Ende zu setzen.
Allerdings sah er dann ein, dass Mr. Somers’ Heirat ein guter Anlass wäre, ihn »ohne großes Tralala« (seine Worte) loszuwerden. Dank Rachels Vermögen gelangte der junge Hilfsprediger nun zu einigem Ansehen und wurde in die Gemeinde von Hardinsett berufen, fünf Meilen außerhalb von Oxford.
Gibt es in England wohl eine schönere Stadt? Während unser Zug sich näherte, tauchten nach und nach hinter den Wiesen und Feldern die Universitäts- und Kirchtürme auf, die im Licht der untergehenden Sonne golden glänzten und dadurch wie Märchenschlösser aus alter Zeit wirkten.
Obwohl ich am Bahnhof zunächst nach meinem Reisekoffer suchen musste, entdeckte ich Rachel, bevor sie mich sah. Sie war schlank und elegant und trug ein graues Kleid und eine graue Haube – beides schlicht, aber aus dem besten Material und exquisit gefertigt.
»Mrs. Rodd – meine liebe Mrs. Rodd!« Sie fasste meine Hände. »Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, Sie zu sehen!«
Sie war in einer kleinen geschlossenen Kutsche angereist, die ebenfalls sehr einfach, aber sichtbar neu war. Ich freute mich zu sehen, dass sie ihr Vermögen auf praktische und komfortable Dinge verwandte, wenn nicht gar auf ein wenig Luxus. Wir fuhren durch üppiges Weideland, und Rachel lächelte, als ich über das saftige Grün und die scharlachroten Mohnblumen am Wegesrand in laute Verzückung ausbrach. Auch die bäuerlich gekleideten Männer, die ihre Kühe nach Hause trieben, waren ein schöner Anblick.
»Sie werden sehen, dass wir hier mindestens ein Jahrhundert hinter der Zeit leben«, sagte sie. »Die moderne Welt berührt uns kaum. Nur eine Meile von der Eisenbahnlinie entfernt kann man in eine Welt eintauchen, die sich seit der normannischen Eroberung nicht verändert hat.«
»Es ist wirklich zauberhaft«, sagte ich. »Und ich hoffe, dass das Wetter hält – ich möchte hier viel von der Landschaft erkunden.«
»Können Sie uns denn irgendetwas verraten?« Rachel wusste von meiner Arbeit und hatte stets überraschend viel Interesse an den abscheulichsten Einzelheiten gezeigt. »Ihr letzter Brief war ja sehr geheimnisvoll.«
»Viel zu erzählen gibt es nicht – ich nehme an, Sie und Arthur wissen viel mehr als ich, und ich hoffe sogar, dass Sie mir behilflich sein können.«
»Oh, das klingt spannend! Ich werde versuchen, meine Neugier im Zaum zu halten, bis Arthur aufwacht.« Schnell fügte sie hinzu: »Er ist nicht krank; er hat nur die ganze letzte Nacht bei einem Sterbenden verbrachte und war heute Morgen so erschöpft, dass ich ihn gleich ins Bett geschickt habe.«
»Du meine Güte! Es ist tatsächlich niemandem gedient, wenn er sich bei seiner Arbeit zugrunde richtet.«
»Genau das sage ich auch immer! Er arbeitet so viel, dass ich mir um seine Gesundheit oft Sorgen mache. Sie erinnern sich bestimmt noch an seinen Hang zur Selbstaufgabe.«
»O ja, sehr gut sogar.« (Sofort kam mir die Erinnerung daran, wie Mr. Somers in der Passionszeit einmal derart intensiv fastete, dass er in einer Morgenandacht ohnmächtig wurde; so verärgert wie damals hatte ich Matt selten erlebt.)
»Gerade haben wir die Grenze zu unserem Pfarrbezirk überquert; an der nächsten Abzweigung können Sie schon unsere Kirche und das Pfarrhaus erkennen. Ach, ich wünschte, es wäre noch hell genug, dass Sie es besser sehen könnten – ich halte es für den schönsten Ort in der ganzen Welt!«
Den Rest der Fahrt über wies Rachel mich auf besondere Einzelheiten hin; Brücken, Scheunen und Dorfkneipen, die im zunehmenden Zwielicht alle gleichermaßen geheimnisvoll wirkten. Als wir anhielten, erkannte ich vage die Umrisse eines quadratischen Kirchturms über einem Nest aus Büschen und Sträuchern und daneben ein großes Haus mit hell erleuchteten Fenstern. Es war ein altes Haus aus dem für Oxfordshire typischen weichen, gelben Sandstein und ähnelte mit seinen Gitterfenstern und noch dazu dem großen Lavendelbeet neben der Eingangstreppe dem Heim meiner Kindheit so sehr, dass ich mich dort wähnte, obwohl es schon vor Jahren abgerissen worden war.
Der Kutscher half mir aus dem Wagen. Ich stand auf der Kiesauffahrt und sog tief die süße Sommerluft in meine Lungen. Dann wurde die Tür geöffnet und eine Bedienstete in schwarzem Kleid mit weißer Schürze trat vor das Haus.
»Mrs. Rodd.« Die Frau machte einen Knicks. »Was für eine Freude, Sie wiederzusehen!«
»Oh, das habe ich ganz vergessen, Ihnen zu sagen«, meinte Rachel. »Mrs. Richards ist jetzt unsere Haushälterin; sie kam letztes Jahr zu uns, nach dem Tod von Tante Harriet.«
»Mrs. Richards, natürlich! Wie schön, Sie zu sehen.« Beim Näherkommen erkannte ich sie sofort, und wir gaben einander die Hand. »Da denke ich sofort an die gute alte Zeit in unserem Dorf zurück!« Sie war groß und kräftig, mit groben Gesichtszügen, aber wachen dunklen Augen. Das Besondere an ihr war, dass sie über eine schier unendliche Reserve an Geduld verfügte, die sie bei ihrer Arbeit für Rachels manchmal giftige Tante auch gut hatte gebrauchen können; diese Frau hatte ihre Bediensteten reihenweise in die Flucht geschlagen.
»Danke, Ma’am«, sagte Mrs. Richards. »Darf ich Sie nach oben bringen?«
Am Ende einer langen Reise gibt es immer diesen Moment, in dem der Trubel abrupt endet und einem bewusst wird, dass man sein Ziel endgültig erreicht hat; plötzlich spürte ich, dass ich ohne eine Tasse Tee vermutlich gleich umfallen würde und dass ich von oben bis unten mit Ruß beschmutzt war.
»Ja, Sie müssen schrecklich müde sein.« Rachel bemerkte meine Erschöpfung, nahm mich in die Arme und küsste meine Wangen. »Ich freue mich ja so, dass Sie hier sind! Aber jetzt lasse ich Sie bis zum Abendessen in Ruhe.«
»Hier entlang, Mrs. Rodd.« Mrs. Richards stieg vor mir die Treppe hinauf, führte das Gespräch über die Schulter jedoch munter weiter. »Oje, ich mag gar nicht daran denken, wie lange es her ist! Wie Miss Rachel schon sagte, kam ich letztes Jahr hierher, nachdem die alte Miss Garnett von uns gegangen war. Unser Stallbursche hat Ihre Reisekiste schon hinaufgebracht, und das Mädchen werde ich gleich mit einem Krug heißem Wasser zum Waschen hochschicken. Und bestimmt möchten Sie einen Tee und eine Kleinigkeit zu essen.«
Sie brachte mich in ein sehr gemütliches Gästezimmer, dessen paarig angeordnete Fenster auf ein Patchwork von jetzt nur schwach erkennbaren Feldern und Wiesen hinausgingen. Nach bemerkenswert kurzer Zeit saß ich neben einem kleinen Feuer auf einem bequemen Sessel, aß dreieckig geschnittene Sandwiches mit Butter und ein paar Scheiben Zitronenkuchen, während Mrs. Richards mir Tee zubereitete.
»Nun, da Sie zu Besuch sind, Ma’am, lassen die beiden mich zur Abwechslung auch mal ein anständiges Abendessen servieren.«
»Sie sind doch als hervorragende Köchin bekannt«, erwiderte ich. »Gibt es denn nicht jeden Abend anständiges Essen?«
»Aber nein! Die zwei essen wie die Spatzen, und der Hausherr fastet ständig wegen irgendeines Heiligen. Aber ich habe Miss Rachel gesagt – also, Mrs. Somers meine ich natürlich –, dass ich für heute Abend keine Widerrede dulde. Ich sagte, ich serviere einen Gang mit Fisch und einen mit Fleisch und einen Nachtisch und basta.«
»Das höre ich sehr gern«, sagte ich, erleichtert, dass man mich nicht zu frommem Hungern verdammen würde.
»Wenn Sie wüssten, was für armselige Mahlzeiten sie sich von mir wünschen, würden Sie weinen. Nennen Sie mich ruhig altmodisch, Mrs. Rodd, aber zu meiner Zeit wurde bei Geistlichen ein gut gedeckter Tisch erwartet.« Sie räusperte sich. »So wie es bei Ihnen und Mr. Rodd immer war, Ma’am«, fügte sie hinzu.
»Danke, aber das kam vor allem daher, dass der gute Mr. Rodd recht verfressen war«, erwiderte ich lächelnd (was Matt betraf, war ein Abendessen ohne eine süße Nachspeise nicht komplett gewesen). »Und wir hatten damals immer viele Gäste. Haben Mr. und Mrs. Somers oft Besuch?«
»Nicht solche Art von Besuch, Ma’am. Sie kümmern sich nicht so um Gesellschaft, wie sie es vielleicht sollten. Den Hilfsprediger werden Sie mit Sicherheit kennenlernen, Ma’am, aber das war es dann auch schon.«
Zu gern hätte ich Mrs. Richards gefragt, ob die beiden denn glücklich waren, und überlegte, wie ich es am besten formulieren sollte, aber da beantwortete sie diese Frage schon von sich aus. »Unter uns gesagt, Ma’am, fehlen in diesem Haus die Kinder. Ich weiß, dass Miss Rachel sich von Herzen welche wünscht.«
»Sie hat mein tiefstes Mitgefühl; aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer es fällt, den Willen unseres Herrn zu akzeptieren, wenn einem Kinder verwehrt bleiben. Hat es denn auch nie irgendwelche Anzeichen gegeben?«
»Nicht, seit ich hier bin.« Mrs. Richards sah mich prüfend an, und ich hatte den Eindruck, dass sie mir gern noch einige andere Dinge erzählt hätte. Doch dann sage sie nur: »Ich hoffe, Sie fühlen sich hier wohl, Ma’am.«
Vier
Meine liebe Mrs. Rodd, was für eine Freude! Ich bin ja fast geneigt, für das sicherlich heimtückische Verbrechen dankbar zu sein, das Sie hergeführt hat – und hoffe, dass es Sie für lange Zeit bei uns hält.«
Arthur und Rachel erwarteten mich im Salon. Arthur war dünner und älter, als ich ihn in Erinnerung hatte, sonst aber noch genauso gutaussehend – auf seine weißgolden heilige Art. Rachel trug ein hübsches Abendkleid in blassblauer Seide. Die zwei gaben ein charmantes Paar ab, wie ich fand, vor allem in diesem charmanten Raum mit seinen edlen alten Möbeln und hellen neuen Tapeten. Die gläserne Flügeltür zum Garten stand offen, und die warme Sommernacht duftete schwer nach Levkojen, Heckenkirsche und Jasmin.
»Diesmal hat es kein Verbrechen gegeben«, versicherte ich ihnen. »Weder ein heimtückisches noch ein anderes. Ich bin auf einer Mission in Sachen Vergebung.«
»Wie? Keine blutigen Morde?«, neckte mich Arthur.
»Leider nein.«
»Ach, egal. Ich werde meine Enttäuschung schon irgendwie überwinden und die Gelegenheit nutzen, Ihnen meinen Pfarrbezirk zu zeigen. Ich hoffe, Sie können mir einigen Rat geben, was ich hier noch tun könnte.« Und in seiner vertrauten jovialen Art fügte er hinzu: »Und bitte entschuldigen Sie, dass ich geschlafen habe, als Sie ankamen.«
»Ich hoffe, Sie haben sich gut erholt. Rachel hat mir den Grund bereits berichtet.«
»Ich habe einem Mann bei seiner Reise in die nächste Welt zur Seite gestanden«, sagte Arthur. »Ich sollte Tom Goodly die Beichte abnehmen, aber der arme Mann hatte nicht mehr alle Sinne beisammen.«
Von draußen ertönte ein lauter Pfiff, dann trat schnellen Schrittes ein Fremder aus dem Garten ins Zimmer – ein kräftiger junger Geistlicher, und so groß, dass er mit dem Kopf die Heckenkirsche über der Tür streifte und sich die Blütenblätter aus dem dunklen Haar schütteln musste.