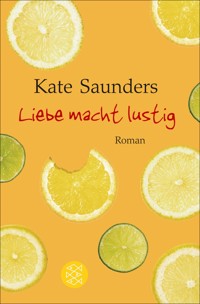3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe ist das, was passiert, während man grade andere Pläne macht. Eine herrliche Liebeskomödie. Ben und Frederick sind charmant, gutaussehend und völlig unwiderstehlich. Leider sind sie auch unordentlich, jeglicher Arbeit abgeneigt und komplett nutzlos. Cassie dagegen ist sehr organisiert – bei Job, Freund, Karriere. Sie kennt die Jungs schon seit ihrer Kindheit. Die Mutter der beiden, Phoebe, erfährt, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Sie bittet Cassie, für ihre Söhne passende Ehefrauen zu suchen. Cassie kann Phoebe diesen letzten Wunsch nicht abschlagen. Aber wie soll sie ihre anspruchsvollen Freundinnen davon überzeugen, es mit Ben und Frederick zu probieren? Und warum hat sie das dumme Gefühl, bei ihren Kuppelversuchen etwas Wichtiges zu übersehen? »Hinreißend komisch!« freundin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Kate Saunders
Es soll Liebe sein
Roman
Über dieses Buch
Ben und Frederick sind charmant, gutaussehend und völlig unwiderstehlich. Leider sind sie auch unordentlich, jeglicher Arbeit abgeneigt und komplett nutzlos. Cassie dagegen ist sehr organisiert – bei Job, Freund, Karriere. Sie kennt die Jungs schon seit ihrer Kindheit. Die Mutter der beiden, Phoebe, erfährt, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Sie bittet Cassie, für ihre Söhne passende Ehefrauen zu suchen. Cassie kann Phoebe diesen letzten Wunsch nicht abschlagen. Aber wie soll sie ihre anspruchsvollen Freundinnen davon überzeugen, es mit Ben und Frederick zu probieren? Und warum hat sie das dumme Gefühl, bei ihren Kuppelversuchen etwas Wichtiges zu übersehen?
Weitere Romane der Autorin:
›Es klingt nach Liebe‹
›Liebe macht lustig‹
›Liebe im Spiel‹
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Kate Saunders verlor als Teenager ihr Herz ans Theater, wo sie aber lieber hinter als auf der Bühne stand. Als Journalistin und Rezensentin schreibt sie u.a. für die »Sunday Times« und »Cosmopolitan«, ist als Jurorin tätig und arbeitet für das Radio. Sie ist begeisterte Londonerin.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildungen: Getty Images / Eisenhut & Mayer
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
›Bachelor Boys‹ im Verlag Arrow Books, London
© Kate Saunders 2004
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2005
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402803-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Danksagungen
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Das Ende und der Anfang
Für Russel
Danksagungen
Viele Menschen haben mir beim Schreiben dieses Romans geholfen, auf vielerlei Weise. Russell Celyn Jones, Amanda Craig, Joanna Briscoe, Charlotte Mendelsohn, Bill Saunders, Charlotte Saunders und Louisa Saunders haben überaus freundlich zugehört und mir Ratschläge erteilt. Felix Wells hat, wie immer, einfach geholfen, indem er wunderbar war (und die weniger wunderbaren Stimmungen seiner Mutter hingenommen hat).
Und ich bin mir bewusst, dass ich durch das Leben und den Tod meiner Eltern, Basil und Betty Saunders, inspiriert wurde.
Sie winken mir vom anderen Ufer zu.
Ich höre sie rufen: »Suche den Weg durch den Strom!
Ihn zu überqueren, ist nicht so schwer,
wie du vielleicht glaubst.«
(Charles Causley: »Eden Rock«)
Kapitel Eins
Ich war gerade damit beschäftigt, einen schrulligen und weitschweifigen Artikel über das Goldene Zeitalter des Kriminalromans zusammenzustreichen, als Phoebe anrief.
»Cassie, Darling. Ich weiß, wie beschäftigt du bist, und will dich nicht lange aufhalten.«
Ihre Stimme klang sanft und frisch, mit einem schwachen Edinburgher Akzent wie der Duft von Heidekraut. Es war die Stimme der Güte und Sicherheit, und ich schmiegte mich unbewusst hinein, legte meine Brille ab und streckte mich auf meinem Schreibtischstuhl.
»Das ist schon in Ordnung, wir sind nicht besonders beschäftigt.«
»Es ist so«, sagte Phoebe, »dass ich über etwas nachgedacht habe. Und da brauche ich deinen Rat.«
»Meinen Rat?«
»Es gehört zu deinem Fachgebiet.«
»Du meinst Bücher.« Ich war die Chefredakteurin von The Cavendish Quarterly, Londons angesehenstem Literaturmagazin, und Phoebe bat mich häufig, ihr Buchempfehlungen für verschiedene Freunde zu geben (ich erwähnte stets erfolglos, dass dies normalerweise nicht zu meinem Job ge-hörte).
»Dieses Mal nicht«, sagte Phoebe. »Ich kann es dir nicht am Telefon erzählen, weil du lachen wirst.«
Ich sagte: »Du hast wieder eine von deinen Ideen.«
Es war keine Frage. Phoebe war berühmt für ihre Ideen.
»Nun ja«, sagte sie mit diesem vertrauten Unterton der Ehrfurcht vor ihrer eigenen Brillanz. »Es ist eine wundervolle Idee, aber ich weiß nicht, wie ich sie ohne dich umsetzen könnte.«
»Solange sie nicht bedeutet, dass ich mich als Eichhörnchen verkleiden muss«, sagte ich.
Phoebe kicherte am anderen Ende der Leitung. Vor zehn Jahren, in meiner Studentenzeit, hatte sie mich dazu überredet, als rotbraunes Eichhörnchen verkleidet Flugblätter zu verteilen. Diese grässliche Erfahrung hatte tiefe Wunden in meiner Seele hinterlassen, was ich sie nie vergessen ließ.
»Nichts dergleichen«, versicherte sie mir. »Es geht um eine völlig andere Idee. Ich kann es kaum erwarten, sie dir zu erzählen – könntest du vielleicht heute Abend vorbeikommen?«
Ich überlegte rasch. Es würde bedeuten, Matthew absagen zu müssen, was ihm nicht gefiele. Aber er würde es verstehen. Er wusste, dass jeglicher Ruf von Phoebe heilig war. Sie war für mich das, was einer Mutter am nächsten kam.
»Natürlich«, sagte ich. »Sehr gerne.«
»Ich mache Abendessen. Ich habe frische Tagliatelle.«
»Soll ich etwas mitbringen?«
»Nicht nötig, Liebling, nur dich selbst«, sagte Phoebe liebevoll. »Wir werden allein sein. Diese Idee möchte ich nicht vor den Jungs besprechen.«
Ich hätte mir denken können, dass es darum ging. Denn Phoebe war, schon solange ich sie kannte, völlig verrückt mit ihren Jungs. Auf jedem anderen Gebiet war sie vollkommen vernünftig, aber wenn es um die Jungs ging, konnte sie sich alles einreden. Ich liebte sie für diese gewaltige Schwäche nur umso mehr.
»Du tust sehr geheimnisvoll«, sagte ich. »Was ist los?«
»Warte es ab.« Ihre Stimme klang heiter und neckend, was ich als gutes Zeichen deutete. »Und Cassie, falls du zufällig Fritz oder Ben triffst, dann erwähne nichts hiervon. Ich -meine, du kannst sagen, dass du zum Abendessen kommst, aber nicht mehr.«
»Okay, kein Sterbenswörtchen wird mir über die Lippen kommen. Bis heute Abend.«
Das Gespräch endete damit, dass ich den Hörer hochhielt, damit Betsy von der anderen Seite des Büros Grüße herüberrufen konnte. Betsy Salmon war meine Stellvertreterin. Ich war mit ihren vier Töchtern zur Schule gegangen, und sie kannte Phoebe schon, seit die Jungen Babys waren – sie hatte Fritz einmal bei einer Geburtstagsparty einen Klaps versetzt, weil er den Zauberer geärgert hatte.
Sobald ich den Hörer aufgelegt hatte, fragte Betsy: »Und? Was glaubst du – wie geht es ihr?«
»Gut. Offensichtlich müde.« Ich war kurz angebunden. Ich sprach nicht gern über Phoebes Gesundheit.
»Und die Jungen?«
»Sie hat nichts davon gesagt, aber ich nehme an, es geht ihnen gut.« Ich war mir bewusst, dass es schäbig war, Betsy gegen-über so kurz angebunden zu sein, obwohl sie so liebenswürdig fragte. Ich streckte mich und rollte meinen Stuhl zurück. »Ich hörte Shay und Puffin gerade zum Pub abdampfen«, sagte ich. »Also sollten wir eine offizielle Mittagspause einlegen.«
»Oh, gute Idee«, sagte Betsy. »Genau das Richtige, um vom Morgen in den Nachmittag überzugehen.« Sie beugte sich zu ihrer Einkaufstasche im Schottenmuster hinab, die sie als Handtasche benutzte, und nahm eine Tupperdose, eine Thermosflasche und eine regenbogenfarbene Strickarbeit hervor. Ihre älteste Tochter hatte Drillinge, und Betsy griff nach der Strickarbeit, wann immer sie die Hände frei hatte.
Ich suchte währenddessen in meiner Handtasche nach dem Käse-Baguette, das ich auf dem Weg zur Arbeit gekauft hatte und das nun zerdrückt unter Band drei einer Biographie von Lord Beaconsfield lag. Während ich aß, sah ich zu, wie Betsy zwischen einzelnen Maschen ihre Gemüsesuppe schlürfte, und dachte, wie angenehm es war, sie in der Nähe zu haben. Sie hatte langes graues Haar, das sie mit einer scheußlichen Lederspange zu einem Knoten feststeckte, und trug gewöhnlich eine ausgeblichene Cordsamtjacke. Sie hielt den Quarterly ungefähr seit der Rücknahme der irischen Getreidegesetze zusammen, und ich war mir bewusst, dass ich ohne sie verloren wäre. Es war seltsam, wie rasch ich mich daran gewöhnt hatte, nur wenige Meter von der Mutter meiner Klassenkameradin Sally Salmon entfernt zu arbeiten.
»Weißt du«, sagte ich, »wir sollten wirklich aufhören, sie ›die Jungs‹ zu nennen. Sie sind inzwischen erwachsene Männer, auch wenn die arme Phoebe das nicht erkennt.«
»Natürlich. Fritz muss schon einunddreißig sein – im gleichen Alter wie du und Sally«, sagte Betsy nachdenklich. »Und ich weiß, dass Ben im gleichen Alter ist wie Jonah, denn Phoebe und ich trafen uns gewöhnlich in der Entbindungsklinik.« Jonah war (und ist) Betsys einziger Sohn, der damals in der Mansarde seines Elternhauses lebte. Sally nannte ihn »Mrs. Rochester«. »Es fällt mir manchmal so schwer, daran zu denken, wie erwachsen ihr heutzutage alle seid.«
Betsy und Phoebe hatten den gleichen Schwachpunkt. Offen gesagt, wunderte ich mich manchmal, warum sich Mütter mit Söhnen so plagen. Die Jungs, mit denen ich in unserem höchst bürgerlichen Stadtteil Londons aufwuchs, waren eher enttäuschend. Betsys Jonah war nur allzu typisch. Seine Stimme besaß einen Umfang von zwei Oktaven (eine mehr, und er hätte als Chor auftreten können), aber er hatte noch nie einen richtigen Job gehabt. Betsys Töchter sagten, er verbringe sein ganzes Leben damit zu essen, zu rauchen und die Telefonrechnungen hochzutreiben. Und es gab so viele wie ihn – kräftige junge Männer, die noch nie in ihrem Leben einen ehrlichen Schweißtropfen vergossen hatten und quietschvergnügt annahmen, die Welt schulde ihnen den Lebensunterhalt.
Meine Freundinnen und ich bemühten uns häufig, das Geheimnis aufzuklären, was mit den Jungs der Mittelklasse unserer Generation falsch gelaufen war. Wir wurden alle bestmöglich erzogen, aber die Wege beider Geschlechter hatten sich irgendwo in den späten Teenagerjahren anscheinend getrennt. Wir Mädchen hatten es – höchst ehrgeizig und erfolgsbesessen – zu etwas gebracht. Wir steckten unsere Ziele so hoch wie möglich und strebten sie an wie hungrige Tigerinnen, die um Nahrung kämpften.
Nehmen Sie zum Beispiel mich. Ich krempelte mit meinen einunddreißig Jahren gerade ein schäbiges altes Schlachtross von Literaturmagazin um. Gewiss waren meine einzigen Qualifikationen für den Job, dass ich eine Zeit lang als Herausgeberin im Verlagsgeschäft und noch länger bei einer überregionalen Zeitung beschäftigt gewesen war und lächerlich viel Chuzpe besaß. Aber seit ich den Job machte, stieg die Auflage. Ich war häufig in Radio-Buchprogrammen zu hören und im Fernsehen zu sehen und hatte bei mehreren Literaturpreisen in der Jury mitgewirkt. Ich rühme mich nicht gerne, aber ich war stolz auf die Dinge, die ich erreicht hatte, weil ich so hart dafür gearbeitet hatte. Und ich wandte diese schonungslose Arbeitsmoral auf alle Bereiche meines Lebens an. Mein natürlicher Status, so dachte ich oft, ist das Chaos. Mir selbst überlassen, produzierte ich Durcheinander und Unordnung – weitaus mehr als ein normaler, ordentlicher Mensch. Ein normaler Mensch kann sich das Haar bürsten und das Gesicht waschen und passabel aussehen. Ich war mir bewusst, dass es mich selbst mehr Mühe kostete. Ich investierte unglaublich viel dafür, so perfekt wie möglich zu sein. Es ist nun mal nicht so, dass ich besonders klug oder talentiert wäre. Das Schlüsselwort hier ist »Arbeit«.
Meine Leistungen waren, verglichen mit denen meiner (weiblichen) Freunde und Bekannten, nur durchschnittlich. Betsys Töchter waren alle höchst erfolgreich – eine im Bankwesen, Sally war Rechtsanwältin, eine drehte preisgekrönte Dokumentarfilme, und diejenige mit den Drillingen war (passenderweise) Geburtshelferin. In derselben Nachbarschaft war die ehemalige Vertrauensschülerin meiner Klasse mit ihren Skulpturen für den Turner-Preis nominiert worden, und das Mädchen, das mit mir zusammen Flötenunterricht nahm, hatte mit einem Modeversand ein Vermögen gemacht. Ich könnte die Liste fortführen.
Wo waren derweil die Jungs, die neben uns aufgewachsen waren? Meine Freundinnen und ich beklagten uns häufig über die schreckliche Knappheit geeigneter Männer. Wir mussten unsere Netze weit auswerfen, weil es zu Hause einfach nichts Fangenswertes gab. In einer Bienengemeinschaft hätten alle diese unnützen Drohnen schon vor Jahren den Todesstich versetzt bekommen. Sie säten nicht, sie ernteten nicht, sie klammerten sich nur an ihre Elternhäuser wie ornamen-tale Stuckatur. Ihre alternden Eltern mussten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag sparsam leben. Ich konnte nur hoffen, dass Menschen ohne Töchter für ihre Beerdigung sparten, denn wenn sie das ihren Söhnen überließen, würden sie in Mülltonnen auf Rädern bestattet werden.
Nicht dass die Mütter es zugeben würden. Betsy, Phoebe und das ganze Regiment wohlerzogener Mums mit unnützen Söhnen fanden alle großes Vergnügen daran, geistreiche Entschuldigungen für die chronische Faulheit ihrer Jungs zu finden. Jonah behauptete zum Beispiel, Schriftstellerei zu betreiben. Natürlich verließ keinerlei Poesie seine Mansarde, und seine Schwestern betrachteten ihn als Schmarotzer, aber seine vernarrte alte Mum beharrte darauf, dass er »sensibel« sei. Das war eine beliebte, fast standardisierte Entschuldigung vernarrter Mütter.
»Sensibel – puuh«, pflegte meine Freundin Hazel (die jüngste Chefredakteurin aller Zeiten eines Hochglanz-Magazins) zu sagen. »Träge ist das Wort, das mir dazu einfällt. Warum können wundervolle, erfolgreiche Frauen wie wir keine annehmbaren männlichen Gegenstücke finden?«
»Nur solvent und selbständig, mehr verlange ich gar nicht«, seufzte meine beste Freundin Annabel (Abteilungsleiterin einer Handelsbank) dann versonnen. »Warum kann ich mich nie in einen Typ verlieben, der einen Job hat?«
»Oder wenigstens in einen Typ, der etwas Hausarbeit übernimmt«, fügte meine Freundin Claudette schließlich hinzu. Claudette war Ärztin. Wir fanden nicht, dass sie das Recht hatte, sich zu beklagen, da sie glücklich mit einem – erraten – Arzt verheiratet war und ihr Bruder einer regelmäßigen Arbeit nachging, wenn auch als Rausschmeißer in einem Nachtclub. Aber Claudette sagte, ihr Bruder gehe dieser Arbeit nur nach, weil er fast zwei Meter groß und schwarz sei, und er würde ohnehin gefeuert, sobald man herausfände, wie faul er sei.
Hazel murmelte dann: »Er sieht trotzdem unheimlich gut aus.«
Und Claudette erwiderte fest: »Vergiss es, Süße. Du hast dich nicht dermaßen abgestrampelt, um einen Mann zu unterhalten, der in Cambridge rausgeflogen ist, weil er den ganzen Tag geschlafen hat.«
»Ja, aber wenn er sich zusammenreißt …«
»Den ganzen Tag, Hazel. Vergiss das nie. Sosehr ich ihn auch liebe, würde ich ihn nicht einmal meiner schlimmsten Feindin wünschen.«
Ich war mir der Tatsache bewusst, dass ich eine der Glücklichen war. Ich liebte Matthew, der mit der zielstrebigen Intensität einer Frau eine glänzende Karriere in Körperschaftsrecht verfolgte. Das lag daran, dass er weit, weit von der Mittelklasse entfernt im verschwommen liberalen Norden Londons aufgewachsen war, und daher über mehr nachzudenken imstande war als nur über Freizeitdrogen und die Club-Szene.
Matthew Jeremy Peales Eltern waren reiche Provinz-Torys ohne Bücherschrank. Er hatte eine ehrbare, aber wenig glanzvolle Public School besucht, aus der er nicht ein einziges Mal rausgeworfen wurde. Er besaß einen ernsthaften Charakter und ernsthafte Neigungen. Ich hatte immer von einem Freund geträumt, der schwere kulturelle Kost durchstehen könnte, ohne mit der Wimper zu zucken, und Matthew hatte mir die Freude gemacht, für uns einen Urlaub in Salzburg zu den Festspielen zu buchen. Gut, -meine Freundinnen zogen mich deshalb entsetzlich auf (Hazel schrieb mir ständig E-Mails mit frechen Vorschlägen über Bademoden), aber ich hatte das Gefühl, dass einen Mann etwas Heroisches umgab, der so viel Mozart ertragen konnte und es als Muße einstufte. Wenn das seine Definition von Muße war, wie ausdauernd machte ihn das dann erst bei der Arbeit?
Wenn meine Freundinnen mäkelten, Matthew sei »langweilig«, hatte ich außerdem das Gefühl, dass ihnen das Grundlegende unserer Beziehung entging. Matthew war der erste Mann, mit dem ich jemals ausgegangen war, der »langweilige« Kultur ebenso sehr mochte wie ich. Ja, ich habe merkwürdige Neigungen. Ich bin eine Intellektuelle – und ich bin stolz darauf. Und für Matthew galt das in noch höherem Maße. Die kompliziertesten Theaterstücke, die anstrengendsten Opern, die obskursten Kammerkonzerte forderten ihm nichts ab. Manchmal vermittelte er mir sogar das Gefühl, oberflächlich zu sein. Das törnte mich total an.
Ich hatte Matthew vor ungefähr zwei Jahren kennen gelernt, bei einer Dinnerparty eines alten Chefredakteur-Kollegen. Er kam direkt aus dem Büro, in einem steifen grauen Anzug und einer gestreiften (nicht einmal annähernd farbenfrohen) Seidenkrawatte. Er hatte helles Haar, grobe, energische Züge und verströmte eine Aura völliger Sicherheit. Seinem Selbstvertrauen wohnte eine Ruhe und seinem Interesse eine Ernsthaftigkeit inne, die ich unglaublich anziehend fand. Ich hatte jahrelang von einem Mann wie ihm geträumt, und Matthew passte genau in den Freiraum, den ich für ihn geschaffen hatte.
Ich sah ihn während des ersten Jahres nicht oft. Seine Firma schickte ihn nach New York, und wir hielten eine ziemlich glamouröse und sehr kostspielige Transatlantik-Beziehung aufrecht. In der Zeit, über die ich gerade schreibe, war er seit ungefähr sechs Monaten wieder in London. Wir planten zusammenzuziehen, wenn der richtige Zeitpunkt käme. Wir waren noch mit den praktischen Fragen beschäftigt. Aber seine lange Abwesenheit hatte meine Zuneigung zu ihm definitiv verstärkt, und ich gebe freimütig zu, dass ich ihn anbetete. Ja, er hatte seine Mängel. Dafür liebte ich ihn noch mehr.
Ich schluckte den Rest meines zerquetschten Baguettes hinunter und wählte dann Matthews gespeicherte Nummer. Ich wusste, dass ich ihn erreichen würde. Er ging nur zum Mittagessen aus, wenn Geld im Spiel war.
»Cassie!« Er klang erfreut. »Hi, Liebling. Wie steht’s?«
»Liebling«, platzte ich gleich heraus, »es tut mir wirklich Leid, aber ich muss dir für heute Abend absagen. Phoebe will mich sehen.«
Matthews Stimme klang augenblicklich sehr besorgt. »Geht es ihr gut?«
»O ja, sie will nur über irgendwas mit mir reden – Gott weiß was.«
»Nun, natürlich musst du hingehen.«
»Oh, Matthew, du bist lieb. Ich hasse es, dich versetzen zu müssen. Kannst du stattdessen morgen Abend vorbeikommen?«
»Ich habe für morgen schon ein besseres Angebot«, sagte Matthew vergnügt. »Es wird dir gefallen. Ich habe es geschafft, im Coliseum eine Loge zu ergattern – für diese neue Inszenierung von Der Fliegende Holländer.«
»Oh, wie toll!«
Er lachte durchs Telefon in sich hinein. »Ich wusste, dass du begeistert sein würdest. Die Karten sind wie Goldstaub.«
»Gott, ja!«
»Ich treffe dich morgen um sechs Uhr fünfundvierzig im Foyer, und wir trinken eine Flasche Champagner. Da wir eine Loge haben, können wir sie mit hineinnehmen.«
»Himmlisch!«
Sie werden, im Gegensatz zu Matthew, die leichte Gezwungenheit meiner Ausrufe bemerkt haben. Ja, ich interessierte mich für die tolle neue Inszenierung von Der Fliegende Holländer in der English National Opera. Aber mein vorherrschendes Gefühl war im Moment Enttäuschung. Matthew und ich hatten seit fast drei Wochen keinen Abend mehr zu Hause verbracht. Er ging lieber aus, als zu Hause zu bleiben. Er besorgte ständig Karten für Opern und Konzerte und sagte, sein Job fördere seinen Hunger nach höherer Kultur. Ich vertrage ja nun alle Arten von Kultur in hohen Dosierungen, aber ich fand es einfach wundervoll, wenn Matthew einfach zum Essen bei mir vorbeikam. Bei diesen Gelegenheiten kochte ich eine der edlen kleinen Mahlzeiten, die Phoebe mir beigebracht hatte. Matthew kam dann mit seiner Aktentasche, einer Flasche Wein und einem sauberen Hemd für den nächsten Tag. Letzterer Gegenstand war eine inoffizielle Garantie dafür, dass wir miteinander vögeln und anschließend gemeinsam schlafen würden.
Ich dachte an die vier Lammkeulen in meinem Gefrierschrank. Ich hatte sie für Matthew gekauft. Jetzt, wo ich Phoebe besuchen würde, käme er nicht zum Essen vorbei, und es gäbe keinen Sex. Und da wir morgen in die Oper gingen, würde ich auch danach keinen Sex bekommen. Matthew zog es vor, nach der Oper allein nach Hause zu gehen, weil er anscheinend ständig im Morgengrauen Sitzungen hatte. Es kränkte mich ein wenig, dass er daran nicht gedacht hatte, während er so stolz auf die Karten war. Wann würden wir wieder Sex haben? Unter diesen Umständen überhaupt nicht.
»Er hat für morgen Karten für Der Fliegende Holländer ergattert«, belehrte ich Betsy und horchte, wie das klang.
»Hmmm. Das ist schön.« Betsy ahnte, was in mir vorging, dachte aber nicht im Traum daran, mich darauf anzusprechen.
»Das Stück hat phänomenale Kritiken – Annabel war drin, und sie sagte, es sei toll.«
»Wunderbar«, sagte Betsy, wohlwollende Skepsis verströmend.
Langsam steigerte ich mich in die passende Begeisterung -hinein. »Ich bin so froh, einen Mann zu haben, der tatsächlich gerne ausgeht und sich etwas Lohnendes ansieht. Ich kann es nicht ertragen, zu viele Abende zu Hause zu verbringen.«
»Dennoch würde es dem jungen Matthew nichts schaden, ein wenig kürzer zu treten. Ist das seine Vorstellung von Spaß, oder versucht er, etwas zu beweisen?«
»Einige Menschen finden wirklich Gefallen an Opern, Betsy, so seltsam das auch scheinen mag.«
»Aber woher weißt du, dass es ihm gefällt? Ich meine, ein Abend in der Oper ist nicht gerade sehr ungezwungen.«
»Er sagt, es entspannt ihn«, erklärte ich.
»Eine komische Vorstellung von Entspannung. Er wird sich nie richtig entspannen, wenn er nicht aufhört, die ganze Zeit an die Arbeit zu denken.«
Es hatte noch nie Sinn gehabt, Betsy die inneren Beweggründe eines ehrgeizigen Mannes verständlich machen zu wollen. »Er kann nicht aufhören, an die Arbeit zu denken, solange er noch nicht Partner in der Kanzlei ist.«
Betsy leerte ihre Suppe und begann eine neue Maschenreihe. »Hat er noch einmal von Verlobung gesprochen?«
Nein. Das hatte er nicht. Aber das würde ich Betsy gegenüber doch nie zugeben, wenn ich es mir kaum selbst eingestehen konnte. »Wir reden manchmal darüber«, sagte ich. »Im Moment ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir haben beide zunächst noch zu viel zu tun.«
Sie sah mich über ihre Brille hinweg ernst an. »Weißt du, ich war in deinem Alter bereits seit sechs Jahren verheiratet und hatte drei Kinder.«
»Ja, ich weiß. Aber inzwischen kam eine Kleinigkeit namens Feminismus daher, gerade rechtzeitig, um Frauen wie mich vor diesem grässlichen Schicksal zu bewahren.«
»Cassie, einer der wenigen Vorteile dessen, eine alte Schachtel zu sein, ist es zu wissen, was wirklich wichtig ist. Es gefällt mir nicht, dass du so viel Energie in deine Karriere investierst. Was für einen Sinn hat es, der erfolgreichste Mensch auf der Welt zu sein, wenn du kein Leben außerhalb des Büros hast?«
Sie erwartete keine Antwort auf diese Frage, die aber nun in der Luft hing wie der Nachgeschmack von Käse. Die unangenehme Tatsache war, dass ich mich sehnte, sehnte, so sehr sehnte, Matthew zu heiraten. Irgendwo in dieser zielstre-bigen Karrierefrau lauerte offenbar ein romantisches Weibchen, das nur danach strebte, geliebt zu werden. Wenn meine Arbeit zu stressig wurde, flüchtete ich häufig in eine heim-liche kleine Phantasie darüber, alles hinzuschmeißen, in einen grünen Vorort zu ziehen und eine Familie zu gründen.
Ich hatte nicht das Gefühl, jemals selbst eine richtige eigene Familie gehabt zu haben. Aus meiner Kindheit war ein beständig brennender Zorn zurückgeblieben. Auf dem Papier hatte ich das große Los gezogen. Meine Eltern waren beide Psychiater (mein Vater schrieb angesagt-populäre Bücher, meine Mutter machte sich einen Namen damit, geisteskranke Kriminelle zu behandeln), und wir lebten in einem hübschen georgianischen Haus im feinen Stadtteil Hampstead.
Aber es war ein Haus ohne Wärme. Meine Eltern – wohl hauptsächlich mein Vater – mochten weiße Wände und helles Holz sowie modernistische Skulpturen, die vor Stacheldraht strotzten. Nichts an diesem Ort erlaubte die Existenz eines Kindes. Meine geschmackvollen pädagogischen Spielzeuge beschränkten sich auf mein kahles und zugiges Spielzimmer. Meine Eltern arbeiteten ständig, mein Vater in einem gemieteten Büro und meine Mutter in ihren geschlossenen Gefängnistrakten. Die Aufgabe, mich aufzuziehen, wurde einer Reihe fremder Aupairmädchen überlassen.
Meine Eltern waren unterkühlte Menschen. Ich kann mich nicht an Zärtlichkeiten oder Ausgelassenheit erinnern. Ich wurde dazu erzogen, mich ruhig zu verhalten und nicht gegen die teuren, Angst einflößenden Möbel zu stoßen. Mein Vater ist ein nüchterner, wortkarger, kritischer Mann. -Meine Mutter war, zu diesem Zeitpunkt, still und unglaublich unzugänglich. Ich wuchs unter dem entschiedenen Eindruck auf, dass mein Vater das Sagen hatte und meine Mutter seine reizbare Gefangene war. Ihre rätselhafte Beziehung zu ihm umgab sie wie eine Aura und ließ nur wenig Raum für mich. Sie trennten sich, als ich Teenager war, und ich empfand nur milde Erleichterung. Ich war froh, unser erstarrtes Haus verlassen und in eine weniger anspruchsvolle, aber gemütlichere Wohnung in der Nähe der Bahn in Gospel Oak ziehen zu können. Ohne meinen Vater konnte ich richtig atmen. Ich stellte fest, dass ich mit der Schwermut meiner Mutter recht gut leben konnte. Man kann Schwermut ignorieren.
Später lernte ich, die zwischen meinen Eltern bestehende Traurigkeit besser zu verstehen, ohne auch nur annähernd vermuten zu können, was sie bewirkt hatte. Als ich erwachsen war, drängte Phoebe mich, mit meiner Mutter in Kontakt zu bleiben. Hauptsächlich Phoebe zuliebe rief ich sie ungefähr ein Mal pro Woche an. Es war Schwerstarbeit. Ruth, meine Mutter, besaß einfach kein Talent für oberflächliche Unterhaltungen. Wir waren auf kühle Art höflich, und ich konnte nicht umhin, an die Szene zu denken, in der Winnie Pu versucht, Eeyore aufzuheitern.
Meinem Vater gegenüber durfte ich Winnie Pu nicht erwähnen. Er verbannte das Buch während meiner Kindheit mit der Begründung, es sei »elitär und anthropomorphisch«. Ja, er war wirklich eine Stimmungskanone. Wir trafen uns damals ebenso wie heute. Er führt mich zwei Mal im Jahr, an Weihnachten und am Geburtstag, zu Simpson’s in the Strand zum Essen aus. Er zeigte gewöhnlich nur schwaches Interesse an meiner Karriere. Und ich war stolz, meine verschiedenen akademischen und beruflichen Triumphe aufzuzählen, bis ich erkannte, dass er nur insoweit Interesse zeigte, wie er es auch gegenüber einem seiner Patienten gezeigt hätte. Ich hatte mein ganzes Leben lang versucht, ihn zu beeindrucken, aber es war reine Zeitverschwendung. Ich glaube nicht, dass er jemals Kinder haben wollte. Welche launischen Hitzezuckungen hatten mich hervorgebracht? Ich kann mich an kein einziges sexuelles Erschauern zwischen ihm und meiner Mutter erinnern.
Alle Wärme und Liebe meiner Kindheit (und der Zugriff auf unpassende Werke von A. A. Milne, E. Nesbit und C. S. Lewis) wurden mir im Nachbarhaus gewährt. Meine Eltern lebten isoliert und freundeten sich nie mit den Nachbarn an, aber sobald ich mir überhaupt irgendeiner Sehnsucht bewusst wurde, sehnte ich mich nach dem Garten nebenan wie die verbannte Peri-Fee an den Toren zum Paradies.
Das Heim der Darling-Familie pulsierte vor Lärm und wogte vor Chaos. Ich pflegte morgens in unserer Fensternische zu sitzen und dem Drama zuzusehen, wie Jimmy Darling zur Arbeit ging. Jimmy war ein gut aussehender, blühender, ungestümer Mann mit einer lauten und melodischen Stimme (wir hörten ihn häufig durch die Mauer singen) und einem fast opernhaften Lachen. Er war Venerologe am Royal Free Hospital. Er platzte immer Zettel verstreuend aus der Haustür und rief seiner Frau und den zwei kleinen Söhnen über die Schulter etwas zu. Manchmal fluchte er, weil er etwas vergessen hatte, und schoss wieder hinein. Manchmal lief er zurück, um seiner Frau und den Jungen noch eine bärige Umarmung zu verabreichen. Obwohl er sehr beschäftigt war und obwohl meine Eltern nur ein Mal mit ihm gesprochen hatten, um sich über ein Baumhaus zu beschweren, das er gebaut hatte, vergaß Jimmy nie, dem einsamen kleinen Mädchen im Fenster zuzuwinken. Er war der freundlichste Mann, den ich je kennen lernte.
Und ich bewunderte seine Frau, die mich stets mit einem liebevollen Lächeln und einem Hallo bedachte, wenn wir uns auf der Straße begegneten. Was kann ich über Phoebe Darling sagen? Selbst den größten Schriftstellern fällt es schwer, wahre Güte zu beschreiben, sodass ich auf laue Klischees zurückgreifen muss wie »liebevoll« und »herzlich« – welche die reine Essenz Phoebes in keiner Weise verdeutlichen können. Ich kann nicht über den Duft einer Rose schreiben.
Sie muss in jener Zeit auf dem Höhepunkt ihrer besonderen Art von Schönheit gewesen sein. Sie war schmächtig und dunkel und sanft, und ihre braunen Samtaugen waren übervoll achtsamen Humors. Ich beobachtete interessiert, wie oft Jimmy sie auf die Lippen küsste und sie in die Arme nahm. Und beide Eltern vergötterten ihre dunkeläugigen Söhne. Die glücklichen Darling-Jungen wurden umarmt und gedrückt und geküsst und in die Luft geworfen. Schmächtig, wie sie war, trug Phoebe Ben auf der Hüfte, bis er mindestens vier war.
Der Tag, an dem die Schranke zwischen den Gärten niedergerissen wurde, ist in meine Erinnerung eingebrannt. Ich war vier Jahre alt. Ein Foto dieser Zeit zeigt das kleine Mädchen, das ich war. Winzig und abwehrend, mit ängstlichen, braunen Augen unter dünnen braunen Locken. Das ist das Kind, das an einem wunderbaren Sommernachmittag einen Küchenstuhl in seinen gepflasterten hinteren Garten zog.
Ich stellte mich auf den Stuhl und schaute in das Grün des Nachbargartens. Dieser Garten war mein Theater, und die Vorstellung an diesem Tag war besonders gut. Sie hatten ein Planschbecken aufgestellt. Der vierjährige Frederick und der dreijährige Benedict waren vollkommen nackt, bespritzten einander und rangen wie zwei lärmende Welpen. Beide -hatten Phoebes wundervolle dunkle Augen. Der kleine Ben hatte Ringellöckchen und benahm sich (wie sein Bruder später behaupten würde) ekelhaft ringellöckchenmäßig – er lutschte am Daumen und vergoss gerne große, fotogene Tränen.
Frederick (genauso niedlich, aber ein unverkennbarer kleiner Teufel) schaute zum oberen Rand des Zauns und bemerkte durch die Clematis mein ernstes Gesicht. Er sah mich an. Ich erwiderte den Blick, geistesabwesend, als schaute ich Fernsehen.
Dann überraschte er mich mit der Frage: »Wie heißt du?«
Er hatte mich bemerkt, was nur wenige Menschen taten. Ich war nicht unsichtbar. »Cassie«, flüsterte ich.
»Ich heiße Frederick. Das ist Ben. Das ist unsere Mummy.«
Phoebe trat gerade mit einem Tablett mit Orangensaft aus der Hintertür und kam über die Wiese auf mich zu. Sie trug eine gestreifte bretonische Hemdbluse und eine Jeans-Shorts, die endlos lange, braune Beine offenbarte. Ihr langer, glänzender schwarzer Zopf lag über einer Schulter.
»Sie heißt Cassie«, teilte Frederick ihr mit.
»Hallo, Cassie. Ich bin Phoebe.«
Fiebie. Ich erwog den drolligen Namen im Geiste, und er gefiel mir.
Phoebe stellte ihr Tablett aufs Gras. Sie goss Orangensaft aus einem Glaskrug in einen Plastikbecher und reichte dieses Trankopfer durch die Clematis, wie die Göttin Hebe Nektar verteilte. Zu Hause durfte ich keinen Orangensaft trinken, und ich trank ihn ehrfurchtsvoll, erstaunt über die heftige goldene Süße, die meine Zunge überflutete.
»Danke«, flüsterte ich und wagte es, den geleerten Becher zurückzugeben.
»Möchtest du in unserem Planschbecken spielen?«
Natürlich wollte ich, aber ich schüttelte den Kopf. Mir fehlten die Worte zu erklären, dass ich nicht stark genug war, um die Schutzwand ins Paradies zu durchbrechen. Ich konnte mir nicht vorstellen, was mit mir geschehen würde, wenn ich es täte. Ich war mehr als schüchtern. Weil ich mich plötzlich preisgegeben fühlte, sprang ich von dem Stuhl herab und zog ihn wieder zum Haus. Teilweise tat es mir Leid, und teilweise war ich froh, dass ich die Unterhaltung beendet hatte.
Ich hatte die Rechnung ohne Phoebe gemacht. Kurz darauf erschien sie mit einem deutschen Sprachführer in der Hand an der Haustür. Sie erklärte Gudrun (das momentane Aupairmädchen, das nett war, wenn auch schwer von Begriff) stockend, dass ich bis sechs Uhr nebenan wäre, und hielt mir eine Hand hin. Ich ließ meine spitze kleine Pfote in ihre -weiche, kühle Handfläche gleiten. Wir gingen hinüber, und ich wurde Teil des wunderschönen Bildes. Ich sank benommen auf die ramponierte Wiese – sah immer noch zu, aber nun von einem besseren Platz aus.
Phoebe überredete mich sanft, mein Kleid auszuziehen und ins kühle, silberne Wasser zu steigen. Ich empfand die Freude daran wie eine innere Explosion, und Phoebe kicherte, als sie den Ausdruck auf meinem Gesicht sah. Die beiden Jungen vergaßen rasch, dass ich neu war, und schlossen mich in ihr Spiel ein. Frederick schien laut und ungestüm zu sein, und ich war ihm gegenüber ein wenig argwöhnisch. Aber er war auch freundlich und ließ mich im tiefen Ende des Planschbeckens sitzen, wo sich die Wiese neigte. Unser Spiel bestand darin, dass Benedict und ich Narzissenzwiebeln waren und Frederick uns hegte. Er bewässerte unsere Köpfe mit seiner roten Plastikgießkanne. Wir waren alle ausgelassen.
Die Zeit bekam Flügel. Das Sonnenlicht tanzte auf den Blättern, Wasserperlen trockneten auf meiner warmen Haut. Phoebe saß im Schneidersitz auf dem Gras und beobachtete uns. Hin und wieder lief sie in die Küche und brachte mehr Saft oder Apfelstücke heraus. Das große Finale, wie ich mich noch heute erinnere, waren erstaunlich köstliche Schokoladenkekse.
Jimmy kam nach Hause. Die Jungen warfen sich mit ihren nassen Körpern auf ihn und durchtränkten sein Hemd. Ich fragte mich, ob er böse würde. Er lachte und kitzelte Ben am Bauch. Er schwang Frederick mit gewaltigem Platschen wieder ins Planschbecken. Er küsste Phoebe fest auf den Mund.
Sie lockerte seine Krawatte und sagte ihm, er sähe toll aus. »Schau, wer hier ist«, sagte sie und deutete mit dem Kopf in meine Richtung.
Er sah lächelnd zu mir herab. »Also habt ihr Rapunzel aus ihrem Turm hervorgelockt.«
»Sie heißt nicht Rapunzel«, sagte Frederick. »Ihr Name ist Cassie. Und weißt du was – sie hat noch nie einen Pillermann gesehen.«
Das stimmte – ich vergaß, das Interesse zu erwähnen, das wir gegenseitig an unseren Geschlechtsteilen hatten. Als meine anfängliche Schüchternheit erst geschwunden war, wollte ich alles wissen.
Jimmy sagte so etwas wie: »Ich wünschte, ich könnte dasselbe behaupten – ich habe den ganzen Tag Pillermänner beäugt.«
Phoebe lachte und sagte: »Nicht, Liebling – was ist, wenn sie es nachplappert? Sie werden sie nicht wiederkommen lassen.«
»Nun, das wollen wir natürlich nicht«, erwiderte Jimmy. »Es hat schon zu lange gedauert, Cassie kennen zu lernen. Wir wollen, dass sie bald wiederkommt. Nicht wahr, Äffchen?«
»Ja«, sagte Frederick bestimmt. »Ich mag sie, und ich mag ihren Hintern.«
So ließ sich meine Aufnahme in die Darling-Familie an. Ben und Frederick wurden meine ersten richtigen Freunde. Wir spielten und rangen und kicherten die langen Sommertage hindurch, die keinen Anfang und kein Ende zu haben schienen. Gudrun und Phoebe stellten fest, dass sie mich durch ein Loch in der Mauer hinüber- und herüberreichen konnten. Ich wurde automatisch in jegliche Vergnügungen einbezogen, die stattfanden. Ich besuchte mit ihnen im Laufe der Jahre das Laienspiel, den Zoo, Madame Tussaud’s, den Tower und all die anderen Attraktionen, an denen wohlhabende Londoner Kinder Gefallen fanden. Phoebe unternahm mit uns hin und wieder auch pädagogische Ausflüge – als kleines Beruhigungshäppchen für meine Eltern –, und ich erinnere mich beglückt daran, wie wir in der National Gallery und der Wallace Collection umherstreiften, wo Männer mit Dienstmützen Frederick schalten, weil er übers Parkett schlidderte und auf den Heizkörpern klimperte.
Jimmy vergaß sehr schnell, dass es eine Zeit ohne mich gegeben hatte. Ich wurde genauso wie die Jungen hochgeworfen, gekitzelt und bekam die Haare zerzaust. Er war ein warmherziger, leidenschaftlicher Mensch, der gerne mit Kindern zusammen war. Er brüllte leicht, aber ich hatte nie Angst, wenn Jimmy mich anbrüllte. Es gehörte alles dazu, so harmlos und erfrischend wie eine steife Brise. Ich fühlte mich dazugehörig.
Frederick warf (zur eisigen Verärgerung meines Vaters) -gerne Erdklumpen an unsere Fenster, damit ich herauskam. Ben gab mir manchmal über die Mauer hinweg Bescheid, wenn Phoebe einen Schub Kekse buk. Einmal, als ich aus einem unbestimmten Grund nicht da war, steckte er netterweise einen Schokoladen-Brownie durch unsere Haustür. Wir drei waren ein Team. Ich schaue nun zurück, und es versetzt mir einen Stich, wenn ich daran denke, wie liebevoll Phoebe zu mir war, wie sie dem stacheligen kleinen Wesen, das ich gewesen sein muss, ihre Arme und ihr Herz öffnete.
Meine Eltern akzeptierten die Darlings nicht. Sie sprachen nicht darüber, sodass ich die Gründe dafür nur vermuten kann. Ich glaube, es hatte etwas mit Kontrolle zu tun. Mein Vater fürchtete Chaos und hatte meiner Mutter eingeimpft, emotionale Zurschaustellungen zu vermeiden, da sie gefährlich sein könnten. Aber sie fanden sich damit ab, dass ich so viel Zeit nebenan verbrachte. Tatsächlich waren sie erleichtert, mich vom Hals zu haben, wenn Gudrun anderweitig zu tun hatte. Sie deuteten häufig an, dass Kinder eine schwere Verantwortung darstellten und dass die Darlings nur zu primitiv wären, um sich darüber Gedanken zu machen.
So vergingen die nächsten paar Jahre. Die Darlings und ich gingen auf verschiedene Schulen, hielten aber den unbeschwerten, zwanglosen Pendelverkehr zwischen beiden Häusern aufrecht. Unsere Eltern gelangten zu einer distanzierten Herzlichkeit. An jedem Weihnachten baten die Darlings -meine Eltern auf einen Drink zu sich herüber (und wie gespenstisch sie inmitten des flitterhaften Chaos wirkten). Eines Tages legte die Beziehung jedoch einen anderen Gang ein.
Es war ein trostloser Nachmittag im Februar, unmittelbar vor meinem siebenten Geburtstag. Ich kam nach Hause, und niemand war da. Ich war von der Mutter einer Klassenkameradin nach Hause gefahren worden, die sofort davonbrauste, als ich ausgestiegen war. Es dämmerte mir allmählich, dass niemand herauskommen würde, um mich in Empfang zu nehmen. Nicht Gudrun, nicht meine Mutter, nicht mein Vater. Das Haus war dunkel, die Fensterläden waren geschlossen – es wirkte kalt wie eine Gruft. Ich erinnere mich, dass ich endlos klingelte und das einsame Echo durch die leeren Räume hallen hörte.
Ich empfand keine wirkliche Angst. Ich hatte hauptsächlich Sorge, ob ich nun das Richtige tun würde, was immer es wäre. Ich war nicht überrascht. Eine Art Dunst legte sich um mich, während ich akzeptierte, was die Vollendung eines langen Prozesses zu sein schien. Sie hatten mich letztendlich verschwinden lassen. Ich konnte nichts anderes tun, als mich auf die Türschwelle zu setzen und darauf zu warten, dass etwas geschähe, und genau das tat ich.
Phoebe fand mich, als sie ungefähr zwanzig Minuten später mit den Jungen nach Hause kam. Ich fröstelte schicksalsergeben und machte gerade meine Französisch-Hausaufgaben. Ich war überrascht über ihre Sorge und bestürzt über ihre Empörung. Sie lächelte, um mir zu zeigen, dass sie nicht auf mich böse war.
»O Liebes«, sagte sie. »Da ist wohl etwas durcheinander geraten. Komm und trink einen Tee mit uns, dann werden wir es entwirren.«
Ich war augenblicklich wieder glücklich. Ich trank gerne Tee mit den Darlings, was ich am Abend eines Schultages normalerweise nicht durfte. Ich durfte am Abend eines Schultages auch nicht fernsehen – was für meinen knospenden Intellekt vielleicht gut war, mich aber auf dem Schulhof zu einer Ausgestoßenen machte. Mein Vater hatte alle diese Regeln aufgestellt. Er war eine echt hochnäsige, humorlose Mittelklasse-Spaßbremse. Bei den Darlings durfte ich auf verbo-tene Speisen wie Fischstäbchen und Penguin-Kekse, auf verbotene Bücher über Tiere, die redeten und bekleidet waren, und auf unglaublich verbotene amerikanische Cartoons zählen. Ich trottete hinter Ben her in die Wärme mit dem Gefühl, dass die Lage sich besserte.
Die Jungen und ich saßen im Kellergeschoss um den Küchentisch und waren alle schrecklich übererregt über die neue Situation. Ich sehe uns jetzt noch vor mir – Frederick und Benedict in ihrer grauen Vorschulkleidung, ich in meiner blauen Kinderschürze, wie wir alle drei so laut sangen, dass das Geschirr klapperte. Der unnachahmliche Frederick hatte ein neues Lied gelernt. Die Worte waren einfach »willy-bum« in verschiedenen Variationen, zur Melodie der Wilhelm-Tell-Ouvertüre gesungen (probieren Sie es zu Hause einmal – willy-bum, willy-bum, willy-bum-bum-BUM!). Benedict, ein musikalisches Kind, fand bald heraus, dass die Worte auch noch zu vielen anderen Melodien passten. Wie wenig vonnöten ist, um Kinder glücklich zu machen. Wir hatten großen Spaß daran, und das unendlich lange. Seltsam, dass ich dieses Gefühl zeitlosen Glücksempfindens mit dem Tag verbinden sollte, an dem ich von meinen Eltern verlassen wurde.
Denn das war es im Grunde, was sie getan hatten. Die Einzelheiten wurden erst bekannt, als Gudrun am nächsten Tag zurückkehrte, von einer unerlaubten Spritztour nach Wales mit ihrem Freund. Anscheinend hatten meine Eltern ihr – ohne sich Gedanken darüber zu machen, wo Gudrun war – eine Nachricht des Inhalts auf dem Dielentisch hinterlassen, dass sie zu einer Konferenz nach Wien gefahren wären.
Am ersten Abend hätten sie, gemäß dem allgemeinen Wissensstand über ihren Aufenthaltsort, ebenso gut nach Samarkand geflohen sein können. Das Haus blieb dunkel und leer, und Phoebe machte sich zunehmend Sorgen. »Du wirst heute Nacht hier bleiben müssen«, sagte sie, beinahe zu sich selbst. »Und Jimmy kann dich morgen früh zur Schule bringen.«
Die Jungen und ich fanden, dass das phantastisch klang. Wir futterten Ingwerkekse und schauten Star Trek, und ich hatte das Gefühl, dies sei das richtige Leben.
Jimmy kam nach Hause, als es dunkel war. Die Jungen warfen sich auf ihn, berichteten ihm das Neueste und sangen das Willy-bum-Lied.
»Hallo«, sagte Jimmy, unter jedem Arm einen kleinen Jungen, »da ist ja Cassie – was machst du hier, meine Süße?«
Phoebe zog ihn zum anderen Ende der langen Großraumküche. Ich hörte, wie sie ihm mit leiser, betroffener Stimme erzählte, was geschehen war. Ich war offensichtlich nur mit den Kleidern, die ich am Leibe trug, verlassen worden. Was, um alles in der Welt, sollten sie tun?
Jimmy sagte: »Diese beiden …«, gefolgt von einer Reihe seltsamer Wörter, die ich damals nicht verstand, deren Bedeutung ich mir aber heute vorstellen kann. Ich erkannte Jimmys zutiefste Ablehnung meines Vaters, seines vollkommenen Gegenteils, in all ihrer Macht. Jimmy verachtete meine Eltern, weil sie ihr einziges Kind vergessen hatten, und hasste sie fast dafür, dass sie Phoebe zum Weinen brachten. Ich sah sie an seiner Schulter schluchzen, tief verletzt darüber, dass es solche Kaltherzigkeit auf der Welt geben sollte.
Wir – die Jungen und ich – hätten in dem Moment Angst bekommen können. Jimmy besaß jedoch die Gabe, alles in Ordnung zu bringen. Er goss Phoebe ein Glas Rotwein ein und führte dann einen mitreißenden Chor des Willy-bum-Liedes an. Er brachte mich zum Kichern, indem er meinte, dass ich zum Schlafen lustige Dinge tragen müsste – Geschirrtücher, Kopfkissenbezüge –, weil ich kein Nachthemd dabeihatte. Schließlich trug ich einen von Bens Pyjamas, und Jimmy schleppte uns alle drei huckepack die Treppe hinauf.
Ich habe nie genau herausgefunden, was zwischen meinen Eltern und den Darlings geschah. Als Gudrun zurückkam und die Nachricht von meinen Eltern gefunden wurde, stürzte sich Jimmy regelrecht auf die angegebene Telefonnummer und hielt meinem Vater eine Standpauke, dass fast der Hörer schmolz. Das Ergebnis war, dass Gudrun nur mit beschämter Miene ein Bündel mit meinen Habseligkeiten herüberbringen durfte. Jimmy weigerte sich, mich hinüberzulassen, bis ich von einem Elternteil abgeholt würde. Bis dahin sollte ich bei den Darlings bleiben, im geweihten Land der Süßigkeiten und des Fernsehens. Besser noch – es wurde arrangiert, dass Phoebe mir ab jetzt jeden Tag Tee machen und meine Hausaufgaben beaufsichtigen würde.
Jetzt gehörte ich wirklich zur Familie. Die Vereinbarung wurde bis zur Scheidung meiner Eltern fortgeführt. Das war das Beste, was mir je passiert ist, wie ich Phoebe häufig erzählte. Sie teilte Jimmys Abneigung gegen meinen Vater, aber sie hielt standhaft die Verbindung zwischen mir und meiner Mutter aufrecht, als die gesamte Beziehung sonst vielleicht für immer abgebrochen wäre. Das ist nur eines der Dinge, die ich ihr verdanke.
Die Jungen akzeptierten das Verhältnis schnell. Frederick, der gerne neckte, gab mir den Spitznamen »Grimble«, nach dem Jungen in Clement Freuds Geschichte, dessen unzuverlässige Eltern nach Peru reisen, ohne es ihm zu erzählen. Mir gefiel der Spitzname nicht, aber mich ehrte Fredericks Aufmerksamkeit. Er war unser Anführer, obwohl ich in dieser Zeit Ben näher stand. Wenn Frederick nicht in der Nähe war, konnten Ben und ich frei unsere Feenreigen und Teddybär-Picknicks ausleben. Wir hatten ein sinnloses Spiel, das »Cotton Houses« hieß und nur darin bestand, in unseren Dufflecoats mit dem Rücken an einer Wand zu sitzen und die Kapuzen über die Gesichter zu ziehen.
Ich muss gegen eine ganze Schar von Erinnerungen ankämpfen, die hochkommen, wann immer ich mich meiner absonderlichen, geborgten Kindheit entsinne. Die Vergangenheit wird mit jedem Tag wichtiger. Man muss jeden Moment speichern und in Ehren halten, wie wir vor sechs Jahren begriffen, als Jimmy starb. Es war Leberkrebs, der ihn innerhalb nur weniger Monate ins Grab brachte.
Sie konnten es nie akzeptieren, ohne ihn zu leben. Phoebe, obwohl sie so liebevoll und humorvoll wie immer war, trug einen Dorn der Qual im Herzen. In meinen traurigeren Momenten dachte ich, dass diese Qual sie langsam umbringen würde. Aber nennen wir die Dinge beim richtigen Namen. Phoebe starb langsam an Leukämie.
Als ich meinen Arbeitsplatz an diesem Abend verließ, lief ich eilig den Piccadilly entlang auf die U-Bahn-Station zu und dachte an alles Mögliche, was mich von der kalten Öde ablenken würde, welche die Zukunft bedeutete. Phoebe verblich so sanft, dass es immer noch weitergehen konnte, wenn man vorgab, die Zeit sei stehen geblieben.
Kapitel Zwei
Es war ein wunderschöner Frühlingsabend. Ich stieg von der U-Bahn hinauf in ein schimmerndes, opalisierendes Licht, das die Ziegelsteine der alten Häuser samtweich wirken ließ. Ich dachte, wie ich schon häufig gedacht hatte, dass Hampstead den Eindruck eines verschwiegenen Dorfes erweckte, in einer anderen Dimension befindlich als das übrige London. Vielleicht hegt jeder diese Gefühle für den Ort, an dem er aufgewachsen ist. Hampstead Village war sowohl beruhigend als auch geheimnisvoll. Die quadratischen, altmodischen Laternenpfähle, die an den Rändern des Heath fahl und unheimlich leuchteten, ließen mich stets vage an das Reich von Narnia denken.
Ich betrat den Spirituosenladen, um eine Flasche Wein für Phoebe zu kaufen, und dann wandten sich meine Schritte automatisch der Straße zu, in der ich einst gelebt hatte. Ich konnte an meinem alten Haus vorübergehen, ohne dass es mir einen Stich versetzte, aber ich konnte mich dem Haus der Darlings nicht nähern, ohne ein warmes, heimisches Glühen zu empfinden. Dies war noch immer der Ort, an dem meine Erfolge am meisten und mein Versagen am wenigsten zählten. Die großen, rechteckigen Fenster leuchteten in der blauen Abenddämmerung golden. Einen Moment, während ich die Stufen hinaufstieg, stellte ich mir jene Fenster dunkel vor, und meine Kehle verengte sich vor Angst.
Phoebes Knochen waren unter ihrer Kleidung deutlich hart zu fühlen. Sie trug den Rollkragenpullover aus Kaschmir in tiefem, dunklem Weihnachtsrot, den ich ihr unmittelbar vor Jimmys Tod gekauft hatte. Ihre Augen wirkten über dem weichen Kragen riesig, und ihr Gesicht schien eingesunken zu sein. Aber ihr Geruch war noch derselbe. Parfums wirkten bei Phoebe nicht. Sie besaß ihren eigenen Duft, eine Mischung aus Biskuitkuchen und Teerosen.
»Cassie – oh, wie schön. Ich habe gehofft, dass du Wein mitbringst.«
Sie wollte nicht, dass man sie fragte, wie es ihr ging. Sie wollte, dass ich wieder genau die alte Beziehung aufnahm, und das tat ich. »In Ordnung«, sagte ich, »raus mit der Sprache. Warum der dramatische Anruf?«
»Lass uns zuerst etwas essen«, sagte Phoebe. Sie war aufgeregt und recht zufrieden mit sich. Ich hörte Jimmy sagen: »Sieh sie dir an, Cass – ich kann spüren, dass sie wieder eine ihrer verrückten Ideen hat.« Er und ich neckten sie ständig wegen ihrer Ideen. Nachdem Jimmy gestorben war, blieb es mir überlassen, es ihr auszureden, wenn sie sinnlose Geschäfte oder aussichtslose Wohltätigkeitsveranstaltungen be--
ginnen wollte. Was war es dieses Mal? Es kümmerte mich nicht. Ich hatte Phoebe seit Monaten nicht mehr so lebhaft gesehen.
»Die Jungs sind ausgegangen«, sagte sie. »Was die tödliche Stille unten erklärt.«
Das Kellergeschoss war vor Jimmys Tod zu einer Wohnung für die beiden Jungs ausgebaut worden, während in Phoebes Doppelwohnzimmer an einem Ende eine neue Küche installiert wurde. Ich stellte meine Aktentasche ab und versuchte, mich nützlich zu machen. Der runde Tisch war bereits wunderschön gedeckt. Es standen eine Platte mit angerichteten Salatblättern und eine Schüssel mit roten Nektarinen darauf. Ich öffnete die Flasche Wein, die ich gekauft hatte, und goss uns beiden ein Glas ein. Phoebe nippte wie abwesend an ihrem, auf das Rühren in einem kleinen Kochtopf auf der Herdplatte konzentriert. Sie ruhte am stärksten in sich selbst, wenn sie Mahlzeiten vorbereitete, was ihr vorzüglich gelang.
»Ben ist in der Festival Hall«, erklärte sie mir über die Schulter hinweg. »Er hat irgendwie eine Karte für Alfred Brendel ergattert, der Glückspilz. Und Fritz ist nach Sheffield gefahren, um einen Freund zu besuchen – nun, du erinnerst dich doch an Toby Clifton? Er ist im Crucible-Theater bei Macbeth dabei, spielt den Donalbain.« (Ich erinnerte mich mit einem seltsamen Gefühl daran, wie lange sich Phoebe und Jimmy geweigert hatten, ihren Frederick »Fritz« zu nennen, obwohl der Spitzname schon mindestens fünfzehn Jahre festgeschrieben war.) »Ich bin froh, dass er letztendlich eine anständige Rolle bekommen hat.«
»Donalbain ist keine anständige Rolle.« Ich musste das sagen. »Es ist so ungefähr die kleinste Rolle, die man in Macbeth bekommen kann, ohne als Möbelstück eingestuft zu werden. Du musst die Leistung der Söhne anderer nicht rühmen.«
Phoebe lächelte und wirkte dadurch jäh um Jahre jünger. »Ich hätte wissen müssen, dass dich das nicht beeindruckt.«
»Es ist jedoch wahrscheinlich nicht schlecht für den Jungen. Er hat zumindest eine Arbeit, die bezahlt wird.«
»Er ist ein guter Tänzer«, sagte Phoebe, während sie die Pasta über dem Spülbecken abgoss. »Vielleicht führt das zu etwas.«
Die Tagliatelle waren frisch und perfekt gekocht. Phoebe servierte sie mit sahniger Pilzsauce. Ich aß mit Genuss, um die Aufmerksamkeit (ihre und meine) von der Tatsache abzulenken, dass Phoebe fast überhaupt nichts aß. Die Gabel wirkte in ihrer Hand riesig. Nach dem Essen kochte sie eine Kanne Tee, und wir traten zu den tiefen Sofas neben dem Kaminfeuer. Die Gerüche von Holzrauch und Essen und Phoebes Duft vermischten sich auf herrliche Weise.
Sie sagte: »Ich habe dich hergebeten, weil ich deine Hilfe brauche.«
»Du weißt, dass ich alles tun werde.«
»Es ist nichts, was ich vor den Jungs besprechen kann. Weißt du – es geht um die Zukunft.«
»Oh.« Wieder zog sich meine Kehle zusammen. Phoebe hatte mit mir nie direkt über die herannahende Veränderung gesprochen.
»Nichts Schlimmes, Liebling«, fügte sie sanft hinzu. »Als Erstes musst du begreifen, dass ich mich recht gut damit ausgesöhnt habe, sterben zu müssen. Ich hätte es lieber nicht getan, aber schließlich muss es jeder irgendwann. Und du weißt, dass ich nie wieder so glücklich sein kann wie früher. Nicht ohne Jimmy.«
»Ich weiß.«
»Ich bin eigentlich nicht religiös«, fuhr sie fort, »aber ich habe viel darüber nachgedacht, was zu erwarten ist, nach dem Sterben und so. Und ich bin mir absolut sicher, dass ich auf irgendeine Weise mit Jimmy zusammenkommen werde. Ich könnte dir nicht erklären, woher oder warum ich mir so sicher bin, aber ich habe diese eigenartige Überzeugung. Ich denke, dass ich mich vielleicht fast darauf freuen könnte.«
Man sollte meinen, ich hätte bei diesen Worten geweint, nicht wahr? Ich tat es jedoch nicht, obwohl mir ein Zentnergewicht auf der Brust lastete. Ich begriff gerade, dass man es nicht tut, wenn die Dinge wirklich schlimm stehen.
Phoebe goss uns Tee ein und schob mir einen Teller mit selbst gemachten Makronen zu. Um ihr eine Freude zu machen und ihr zu zeigen, dass ich noch immer ihr vernünftiges Mädchen war, nahm ich eine Makrone. Sie fühlte sich auf meiner Zunge wie Asche an.
»Aber natürlich mache ich mir Sorgen«, sagte Phoebe. »Ich sorge mich zunehmend um die Jungs.«
»Warum? Was ist mit ihnen?«
»Oh, nichts – das habe ich nicht gemeint. Ich mache mir nur große Sorgen darum, sie zu verlassen. Wer um alles in der Welt wird sich um sie kümmern? Wie werden sie zurechtkommen? Was ich vermutlich meine, ist, wer wird sie lieben?«
Ich blieb standhaft, schluckte die Angst hinunter. »Ich denke, ich kann mit Sicherheit sagen, dass es ihnen an Liebe nie mangeln wird. Die Hälfte aller Frauen Londons ist in sie verliebt.«
»Es ist nicht nur die Liebe«, erwiderte Phoebe und sah mich mit ihren ernsten braunen Augen an. »Wer wird ihnen Essen kochen? Sich um ihre Wäsche kümmern? Wenn sie in diesem Haus bleiben, werden sie es nie richtig in Ordnung halten können. Sie haben keine Ahnung, was alles kostet. Sie sind noch nicht bereit, Waisen zu werden. Ich kann die beiden nicht einfach in die Welt hinausstoßen.«
»Soll ich mit ihnen reden oder so? Ihnen bei der stürmischen Überfahrt ins Leben helfen?«
»Heute Morgen kam mir plötzlich die Idee«, sagte Phoebe, »weshalb ich dich gleich anrief. Wir müssen für Fritz und Ben Frauen finden. Wenn ich weiß, dass sie ihren festen Platz im Leben gefunden haben und umsorgt werden, kann ich in Frieden sterben.«
Ich war zutiefst bewegt – bis ins tiefste Innere. Dieses Mutterherz würde noch lange vor Liebe brennen, nachdem der Körper darum herum bereits zu Staub zerfallen war.
Aber ich war auch leicht irritiert. »Also willst du, dass ich die Frauen beschaffe?«
»Nun, da du mir immer erzählst, deine Freundinnen könnten keine netten Männer finden, dachte ich …«
»Phoebe, meine Freundinnen sind hervorragend, wunderschön und erfolgreich. Ja, überraschend viele sind noch Singles – aber sie sind nicht verzweifelt. Und keine von ihnen verdient es, mit deinen faulenzenden Söhnen belastet zu werden.«
Phoebe lächelte immer noch. Meine Kritik an ihren vergötterten Söhnen störte sie nie, weil sie einfach nicht glaubte, dass ich es ernst meinte. »Du hast selbst gesagt, dass Hunderte von Frauen in sie verliebt wären.«
»Ja – Flittchen und Botox-Schnallen und alternde Rock-Miezen.«
»Wir müssen nur zwei nette Frauen mit Verantwortungsgefühl finden.«
»Warum können Fritz und Ben nicht selbst Verantwortung lernen?«
»Das sagst du immer«, erwiderte Phoebe ruhig, »aber du weißt, dass sie das nie lernen werden. Ich kann sie nicht verlassen, bevor sie nicht ihren Platz im Leben gefunden haben. Warum lachst du?«
»Du kommst mir vor wie eine Gestalt aus einem viktorianischen Roman, die sich um ihre unverheirateten Töchter sorgt. Ich könnte deinen Plan beinahe ernst nehmen, wenn Fritz und Ben achtzehnjährige Mädchen wären.«
»Komm schon, Cassie.« Phoebe war ungeduldig und entschlossen. »Wirst du mir helfen oder nicht?«
Ich liebte sie so sehr für ihre blinde Liebe. Obwohl der Gedanke daran absurd war, solvente Frauen für die Jungs ausfindig zu machen, konnte ich nicht ablehnen. Für Phoebe würde ich alles tun.
Fast alles, sollte ich sagen. »Natürlich helfe ich dir«, antwortete ich, »aber bevor wir anfangen, muss ich eines ganz deutlich sagen. Ich weiß, was du denkst, und die Antwort ist nein.«
Ihre Augen weiteten sich unschuldig. »Was? Wovon sprichst du?«
»Du hoffst, dass ich selbst einen von ihnen heiraten werde.«
Phoebe lachte, war sich keiner Schuld bewusst. »Warum nicht? Du liebst sie beide, seit du klein warst.«
»Sie sind für mich wie Brüder.«
»Nicht mehr. Es wäre nicht viel nötig, um dich richtig in einen von ihnen zu verlieben.«
»Tut mir Leid, aber dann hätte ich das bereits getan.«
»Ich wäre so glücklich, wenn ich wüsste, dass sie bei dir sind!«
»Ich könnte sie ohnehin nicht beide heiraten«, erklärte ich. »Warum inserierst du nicht wegen eines Kindermädchens?«
Ihr Optimismus geriet ins Wanken. Also milderte ich meinen Ton. »Es tut mir Leid, aber ich bin verlobt.«
»Matthew.« Phoebe war Matthew mehrmals begegnet. Ich hatte ihn zum Sonntagsessen bei den Darlings mitgebracht, an einem Tag, an dem ich wusste, dass auch andere Leute da wären, die man ebenfalls für das unausweichliche Rauchen und Fluchen verantwortlich machen könnte.
»Ja«, sagte ich.
»Also denkst du, Matthew sei der Richtige.«
Hatte ich ihr das nicht gesagt? »Ja«, antwortete ich erneut.
»Mir war nicht klar, dass er um deine Hand angehalten hat.«
»Nun, er hat noch nicht wirklich um meine Hand angehalten. Nicht ausdrücklich.« Das war ein wunder Punkt. Matthew sprach von Heirat, aber sehr unbestimmt. Es schien immer nur Bestandteil seiner beständigen Phantasie, einen Tipp von einem Klienten zu bekommen, einen großen Wurf auf dem Markt zu landen und sich mit fünfunddreißig zur Ruhe zu setzen. Er hatte gesagt, dass er mich liebt, aber nicht oft – nicht annähernd so oft, wie ich es hören wollte. Und er hatte nie ausdrücklich gesagt, dass er tatsächlich mich heiraten wollte.
»Also bist du noch nicht verlobt?« (Sie war genauso schlimm wie Betsy – diese Besessenheit, alles offiziell machen zu wollen.)
»Nicht offiziell«, sagte ich. »Wir haben noch kein Datum festgelegt.«
»Na gut«, sagte Phoebe. »Es tut mir natürlich Leid für die Jungs, aber Matthew schien mir sehr nett an dem Abend. -Seine hübsche Begonie ist noch immer ein Blütenmeer.«
Ich musste unwillkürlich lachen. Ich mochte es, wie Phoebe Menschen gedanklich mit den Pflanzen verband, die sie ihr schenkten.
Und sobald ich gelacht hatte, hätte ich weinen können. Matthew musste mich bald fragen. Ich wollte, dass Phoebe uns verheiratet erlebte.
Phoebes Gedanken waren zu dem »Problem« ihrer Jungs zurückgekehrt. Sie griff nach einem Notizbuch und einem Stift auf dem kleinen Tisch neben ihr. »Ich dachte, wir beginnen mit einer Liste ihrer besten Eigenschaften.«
»Ihre Verkaufsargumente«, ergänzte ich, um eine unbewegte Miene bemüht. Es würde keine lange Liste werden, sodass das neue Notizbuch ein wenig überflüssig wäre. O Gott, hatte sie es speziell deshalb gekauft, weil sie dachte, das machte die Sache geschäftsmäßiger? Jimmy wäre in Wolfsgeheul ausgebrochen.
»Stimmt«, sagte Phoebe glücklich.
»Okay.« Ich merkte, dass sie darauf wartete, dass ich etwas sagen würde. »Wollen wir mit Fritz anfangen?«
»Gute Idee – ich wusste, dass es richtig war, dich hinzuzuziehen.« Phoebe schrieb strahlend etwas in ihr Notizbuch, während sie die Worte vor sich hin murmelte. »Frederick -James Darling – weithin bekannt als Fritz – Alter einunddreißig – Berufsschauspieler.«
Ihr Stift schwebte in der Luft. Sie schwieg. Ich füllte das Schweigen unfreundlicherweise nicht aus. Ich wollte sie zu der Erkenntnis bringen, dass nicht viel zu sagen blieb, soweit es die Verkaufsargumente betraf.
»Er hat eine hübsche Singstimme«, fügte sie hinzu.
Erneutes Schweigen.
»Ist absolut lieb zu seiner Mutter.«
Ich lachte schnaubend. »Welch ein Fang!«
Phoebe fragte: »Klingt das nicht gut genug?«
»Wenn überhaupt«, antwortete ich, »wertest du ihn zu sehr auf. ›Berufsschauspieler‹ könnte bei irgendeinem armen Mädchen den Eindruck erwecken, er hätte einen anständigen Job.«
Ihre aufrichtigen braunen Augen sahen mich tadelnd an. »Wir werden nicht sehr weit kommen, wenn du nicht positiv an die Sache herangehst.«
»Tut mir Leid. Du weißt, dass Fritz und ich die Angewohnheit haben, uns zu kabbeln. Ich werde ab jetzt sehr zuvorkommend zu ihm sein.«
»O nein, das darfst du nicht tun«, rief Phoebe, »sonst vermutet er sofort, dass wir etwas vorhaben, und der ganze Plan scheitert!«
Ich ließ mir einen Moment Zeit. Dann sagte ich: »Phoebe, die Jungen müssen von dem Plan erfahren.«
Sie war schockiert. »Nein! Das würde alles verderben.«
»Aber natürlich müssen sie davon wissen«, sagte ich. Ich erkannte, dass ich auf einen der versunkenen Felsen des Eigensinns bei ihrem sanften Charakter getroffen war, und ließ meine Stimme nun fester klingen. »Wir können sie nie verheiraten, wenn sie nicht kooperieren.«
»Aber Liebling«, flehte Phoebe, »wenn wir es ihnen sagen, wird alles so kalt und unromantisch ablaufen! Es könnte sie befangen machen. Sie verhalten sich dann vielleicht nicht natürlich.«
»Wir wollen nicht, dass sie sich natürlich verhalten. Wir wollen, dass sie vorgeben, normal zu sein.«
Phoebe kicherte. »Im Ernst …«
»Ich meine es sehr ernst. Wirst du zumindest erwägen, den Jungen zu sagen, was wir vorhaben?«
»Ich werde darüber nachdenken«, sagte sie. Ich wusste, dass sie es nicht tun würde. Ihre romantische Vorstellung stand fest. »Und jetzt lass uns über Ben nachdenken.« Sie wandte eine Seite in ihrem Notizbuch um. »Das sollte wirklich leicht sein. Benedict Henry Darling – neunundzwanzig – von Beruf Konzertpianist.«
Wie sehr Phoebe das Wort »Beruf« mochte, und wie überaus unangemessen es war. Sosehr ich Fritz und Ben auch liebte, war ich doch versucht, das Notizbuch an mich zu reißen und die Aufzeichnungen zu berichtigen. Fritz war ein arbeitsloser Schauspieler und absolut sexbesessen. Ben war ein arbeitsloser Musiker, ein wenig Muttersöhnchen und ebenfalls sexbesessen. Beide waren auf dem Arbeitsamt in Camden Town bestens bekannt. Soweit ich es mitbekam, verbrachten sie ihre Zeit mit idyllischer Faulenzerei. Wie um alles in der Welt sollte ich ehrbare Freundinnen für diese beiden Müßiggänger finden?
Phoebe blickte nachdenklich ins Feuer. »Ich frage mich, ob wir angeben sollten, dass Fritz Arzt ist.«
»Du könntest sagen, dass er die Prüfungsbedingungen erfüllt hatte, Arzt zu werden, aber nur, weil Jimmy ihm den Kopf abgerissen hätte, wenn er es nicht getan hätte. Er ist nie wirklich als Arzt tätig gewesen – es sei denn, du rechnest den Vertretungsjob in Cornwall dazu, damit er surfen gehen konnte. Ich denke eher, du solltest es ganz weglassen.«
»Meinst du?«
Ich griff nach einer weiteren Makrone und konnte sie jetzt, im Zustand leichter Verärgerung, auch genießen. »Hör mal, bevor wir weitermachen – was ist mit ihrem gegenwärtigen Liebesleben? Haben sie nicht bereits Freundinnen?«
Auf Phoebes Stirn erschien eine nachdenkliche Falte. »Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht ganz sicher. Sie tun beide ziemlich geheimnisvoll, wenn es darum geht, wen sie treffen. Ich glaube, Fritz geht hin und wieder noch mit Madeleine aus – aber sie ist mit jemand anderem verheiratet und macht keinerlei Anstalten, ihren Ehemann verlassen zu wollen. Das bedeutet also, dass er im Grunde genommen frei ist.«
Es tat mir Leid, dieses schmerzliche Thema anschneiden zu müssen, aber es musste sein. »Und was ist mit Ben? Ist er noch immer mit dieser alten Schachtel verbandelt?«