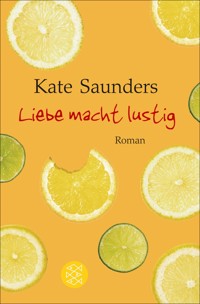3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie ziehen aus, um reich zu heiraten. Und treffen mitten ins Herz. Die Hasty-Schwestern sind jung, hübsch – und pleite. Sie müssen den vom Verfall bedrohten Familiensitz Melismate retten. Klar, denken sich Rufa, Selena, Nancy und Lydia: sie stürzen sich einfach auf den Heiratsmarkt. Liebe ist sowieso ein überbewertetes Gefühl! Ein Reigen von skurrilen Landedelleuten und höchst ungeeigneten Heiratskandidaten in London sorgt für köstliche Verwirrung. Und dann ist auf einmal – Liebe im Spiel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Kate Saunders
Liebe im Spiel
Roman
Über dieses Buch
Sie ziehen aus, um reich zu heiraten. Und treffen mitten ins Herz.
Die Hasty-Schwestern sind jung, hübsch – und pleite. Sie müssen den vom Verfall bedrohten Familiensitz Melismate retten. Klar, denken sich Rufa, Selena, Nancy und Lydia: sie stürzen sich einfach auf den Heiratsmarkt. Liebe ist sowieso ein überbewertetes Gefühl!
Ein Reigen von skurrilen Landedelleuten und höchst ungeeigneten Heiratskandidaten in London sorgt für köstliche Verwirrung. Und dann ist auf einmal – Liebe im Spiel.
»Ein Buch, das mit Witz und psychologischem Scharfsinn erzählt ist.«
Berliner Zeitung
Weitere Romane der Autorin:
›Es soll Liebe sein‹
›Liebe macht lustig‹
›Es klingt nach Liebe‹
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Kate Saunders verlor als Teenager ihr Herz ans Theater, wo sie aber lieber hinter als auf der Bühne stand. Als Journalistin und Rezensentin schreibt sie u.a. für die »Sunday Times« und »Cosmopolitan«, ist als Jurorin tätig und arbeitet für das Radio. Sie ist begeisterte Londonerin.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung: Getty Images / photodisc
Erschienen bei Fischer E-Books
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
›The Marrying Game‹ bei Arrow Books, London
© 2002 by Kate Saunders
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2006
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402804-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Danksagung
Teil Eins
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Teil Zwei
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Dieses Buch ist Felix gewidmet.
Danksagung
Ich bin allen dankbar, die beim Schreiben dieses Buches geholfen haben, besonders Philip Wells, für die Übersetzung des Hasty-Familienmottos in mittelalterliches Französisch, und Felix Wells, der die Ressany-Saga ursprünglich ersann. Dank gebührt auch Amanda Craig, Joanna Briscoe, Charlotte Mendelssohn, Louisa Saunders, Bill Saunders und Charlotte Saunders.
Teil Eins
Kapitel Eins
Das sind die Narnia-Bücher, von Roger«, sagte Nancy. »Das sind Barbie und ihr merkwürdiges Riesenpony, das eher wie ein Kutschpferd aussieht – es ist von Mum.« Sie hielt ihrer Schwester die bunten Päckchen vor das benommene, trübsinnige Gesicht. »Und meines kommt später. Es sind mindestens drei Geschenke mehr, als wir dachten.«
»Vier«, sagte Selena aus den Tiefen ihres Buches. Ihre Lesebesessenheit hielt sie nie davon ab, sich an Unterhaltungen zu beteiligen. »Ich habe ihr etwas Schokoladenkonfekt gemacht und dachte, ich fülle es in meine lackierte Dose – die hat sie immer schon gemocht. Hat jemand noch Geschenkpapier übrig?«
»Ich habe welches«, murmelte Rufa. »Leg die Dose aufs Bett, dann packe ich sie mit ein, wenn ich mein Geschenk einpacke.«
Lydia lächelte verschwommen, wie durch die Wolken hervorbrechende Sonne. »Es wird doch gut werden, oder? Ich kann alles ertragen, solange Linnet nur genug Geschenke bekommt. Ihr seid wunderbar – ich weiß nicht, wie ich euch danken soll.«
»Du könntest sie zum Beispiel davon abhalten, immer schon in der Dämmerung aufzustehen«, schlug Nancy vor. »Es ist so verteufelt kalt hier, dass ich mindestens eine Stunde Vorwarnung brauche, ehe ich mein jungfräuliches Lager verlasse.«
Rufa lachte leise. Sie lag ausgestreckt auf dem Sofa, nach zwei Wochen Weihnachtskocherei erschöpft und nach Nussaroma riechend. Ihr langes kastanienbraunes Haar, das die Farbe von Granatsteinen hatte, ergoss sich über die scheußlichen orangefarbenen Tweedkissen. Ihre drei jüngeren Schwestern rekelten sich auf dem Boden, wobei ihr lang wallendes Haar den aschfarbenen Teppich streiften. Jede drückte einen Körperteil ans Kamingitter vor dem kleinen Feuer.
»Liddy«, sagte Nancy, »nimm deinen dicken Hintern aus dem Weg.«
»Dicker Hintern – das sagt die Richtige.« Lydias sanfte Stimme klang leicht vorwurfsvoll. »Ich brauche mehr Wärme als du. Ich bin dünner, und meine Hautoberfläche ist im Verhältnis zum Volumen größer.« Sie rang mit dem Korken einer Flasche billigen Rotweins.
Schließlich hob Selena den Kopf von den Seiten des Buches Das verlorene Paradies. »Will jemand Kekse?« Sie zog eine Packung Schokoladenkekse aus den ausgebesserten Falten ihrer weiten Jacke.
»Mein Gott«, rief Nancy aus. »Wo, um alles in der Welt, hast du die her?«
»Brian hat sie mir gegeben. Ich glaube, wir tun ihm Leid.«
Brian war der verschwitzte junge Mann vom Auktionshaus, der gegenwärtig den Wert des uralten Hauses und seines verkommenen Inhalts schätzte. Melismate, seit fast eintausend Jahren der Stammsitz der Hasty-Familie, sollte unter den Hammer kommen.
Selena riss das Päckchen auf, und ihre Schwestern streckten bettelnd die Hände aus. Der erschreckende Geldmangel, mit dem nicht mehr zu spaßen war, ließ Schokoladenkekse mindestens so exotisch scheinen wie Kaviar. Sie hatten gerade mehrere Wochen von der kärglichen Lauchsuppe ihrer Mutter gelebt und jeden Penny für das letzte Weihnachten auf Melismate gehortet.
»Das war nett von ihm«, sagte Rufa mit vollem Mund. Sie hatte das Gefühl, dass es wichtig war zu erwähnen, wenn Menschen nett waren. »Er ist manchmal ziemlich ekelhaft, aber es ist nicht seine Schuld, dass wir pleite sind.«
»Sag nicht einfach so ›pleite‹«, murmelte Lydia. Sie goss Wein in vier nicht zueinander passende Teetassen und reichte sie herum. »Immer wenn ich über die Zukunft nachdenke, fühle ich mich einfach schrecklich.«
Es war Heiligabend. Der Mann genoss sein erstes Weihnachten im Himmel. Das Haus, das er hinterlassen hatte, war kalt. Es kam unter den Hammer, und seine Familie wurde zerschlagen. Das Supermarkt-Hähnchen von der Größe eines Kanarienvogels lag fürs morgige Mittagessen fertig im widerhallenden Kühlschrank. Rufa hatte ihre letzten Energiereserven darauf verwendet, den Berg Kartoffeln zu schrubben und zu schälen, die sieben leere Mägen füllen müssten. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, an dem nichts mehr zu tun blieb. Die Pasteten und Kuchen, die sie in Zeiten relativen Wohlstands beschäftigt hatten, gab es dieses Jahr nicht. Ihre Mutter war mit Lydias kleiner Tochter unten. Die Hasty-Mädchen hatten sich in ihrem alten Kinderzimmer versammelt, wie sie es häufig taten.
Dieses Kinderzimmer bestand aus zwei Mansarden unter der Dachschräge, die durch einen Durchbruch zu einem großen Raum geworden waren. Es war so zugig wie das Deck der Cutty Sark und voll gestopft mit Gerümpel. Brian hatte das Gerümpel auf insgesamt vierzig Pfund geschätzt. Man konnte nicht erwarten, dass er den wahren Wert jenseits des Materiellen erkannte. Das Kinderzimmer war ein Inbegriff der Familiengeschichte, wie die Ringe eines Baumes.
Die Bilderwand, mit vergilbten Bildern pausbäckiger Kinder in Matrosenanzügen, war ein Relikt irgendeines viktorianischen Hasty. Der wuchtige Silver-Cross-Kinderwagen, der jetzt verbeult und ruiniert war, stammte aus der Vorkriegskindheit des großen Mannes.
Der große Mann war ihr verstorbener Vater. Er war der Welt vor sechs Monaten entglitten, während seine Hinterbliebenen auf die Erde gestürzt waren wie ausgebrannte Raketen. Der große Mann war himmlisch gut aussehend, verblüffend selbstherrlich, großartig exzentrisch und äußerst charmant gewesen. Er konnte eine lächerliche Geste weit über die Komödie hinaus erheben und mit Grandeur einsetzen. In seinen Flitterwochen in Antibes war er während eines Streits aus dem Zimmer gerauscht und wollte sich der Fremdenlegion anschließen. Einmal hatte er seinen nackten Körper mit blauer Körperfarbe beschmiert und als Höhlenbewohner an einem Kinderkostümfest teilgenommen. Der große Mann hatte Partys geliebt, er hatte praktisch eine Party gelebt. Er hatte es geliebt, wenn dieses Haus vor Leuten barst und vor Lachen widerhallte. Er hatte es geliebt, sein Herz zu verlieren, und seine Frau und seine Töchter hatten ihn durch viele untreue Zeiten hindurch liebevoll gepflegt, wenn dieses empfindliche Organ gebrochen zurückgeschickt wurde – irgendwie war sogar sein Ehebruch anders und zählte nicht als Betrug. Niemand konnte sich erinnern, wann sie angefangen hatten, ihn den großen Mann zu nennen. Er war einfach der ultimative Mann gewesen, der Mann, der alle Männer krönte. Er hatte sich – und sie – mit Glamour und Glanz umgeben. Als er starb, war alle Farbe aus ihrer Welt entwichen.
Rufa mühte sich in eine sitzende Haltung, um ihren Wein zu trinken. Sie hatte ihren Vater vergöttert, musste aber inzwischen allmählich zugeben, dass die höchst individuellen Moralvorstellungen des großen Mannes eine vernichtende Wirkung auf das Gefühlsleben seiner Töchter gehabt hatten. Er war die Ursache ihrer verhängnisvollen Neigung zum Dekorativen anstatt zum Praktischen.
Das Problem war nicht, dass es keine Männer wie ihn gab. Im Gegenteil, es wimmelte auf der Welt entschieden vor charmanten Exzentrikern, die morgens nicht aus dem Bett kamen. Man konnte sie sich leichter einfangen als eine Grippe und wurde stets enttäuscht. Ihre charmante Erfolglosigkeit konnte sich jedoch niemals mit der heroischen, sanften Nutzlosigkeit von Rufus Hasty messen.
Rufas erste romantische Enttäuschung war schrecklich gewesen. So herzzerreißend und demütigend, dass sie, auch noch drei Jahre später, nichts mehr mit der Liebe zu tun haben wollte.
Und nicht nur ich, dachte sie – seht euch auch die anderen an.
Lydia war nach dem Scheitern einer absurden Ehe mit ihrer kleinen Tochter wieder nach Hause gekommen. Nancy war gegenwärtig wahnsinnig in den Sohn des Doktors verliebt, der in einem Wohnwagen unten im Garten seiner Eltern lebte. Selena ging noch zur Schule und war zu jung, um wirklich tiefe Enttäuschungen erlebt zu haben, aber auch sie hatte bereits einen entschiedenen Geschmack für gut aussehende Loser entwickelt. Es war nur eine Frage der Zeit.
Lydia sagte, wie irgendjemand es stets tat: »Wenn wir nur etwas tun könnten!«
Nancy nahm sich einen weiteren Keks. »Nun, wir können nichts tun. Es sei denn, wir heiraten alle Geld.«
»Das wäre vielleicht möglich«, erklärte Selena.
»Was, noch vor der Auktion?« Rufa lachte. »Wir kennen nicht einmal jemand Reichen. Ganz zu schweigen von jemand ausreichend Reichem, dass er die Schulden des großen Mannes bezahlen und das Haus retten könnte.«
Selena legte ihr Buch hin. »Aber es ist immerhin eine Möglichkeit.«
»Ich habe den einzigen verfügbaren Mann in Meilen Umkreis«, sagte Lydia wehmütig, »und seht ihn euch nur an. Wir lernen nie jemand kennen.«
»Das kannst du laut sagen«, stimmte Nancy ihr zu. »Dieser Ort ist wie Brigadoon – Gott allein weiß, welches Jahrhundert sie dort draußen schreiben. Ich muss irgendwann einmal nachsehen, ob sie diese schrecklichen Getreidegesetze inzwischen außer Kraft gesetzt haben.«
»Eigentlich …«, begann Rufa. Ihr Blick war nachdenklich auf eine Flammenzunge gerichtet, die aus den roten Kohlen schoss. »Eigentlich hat Selena Recht. Wenn wir reichen Männern begegnen könnten, sollte es auch durchaus möglich sein, einen zu heiraten.«
»Ich habe eine bessere Idee«, erwiderte Nancy freudlos. »Reiben wir alle Lampen und sehen, ob ein verdammter Dschinn herausspringt.«
»Ich würde das Geld gerne erarbeiten«, sagte Rufa, »wenn ich wüsste, wie ich genug verdienen könnte. Leider wird uns der Verkauf von Marmelade, bei einem Reingewinn von zweiundsechzig Pence pro Glas, bis Ende März keine Millionen Pfund einbringen.«
»Nun, sieh nicht mich an«, sagte Nancy. »Mein Trinkgeld reicht, so wie es aussieht, kaum für Zigaretten.«
Rufa hatte ihre Erschöpfung abgeschüttelt. Sie sah ihren Schwestern eindringlich ins Gesicht. »Ihr seid alle hübsche Mädchen, wisst ihr, und ich kann mich auch sehen lassen, wenn ich nicht gerade nach Minzpastete rieche. Das wäre ein Aktivposten – es ist beinahe schade, dass Brian uns nicht zusammen mit den Möbeln auf der Auktion anbieten kann.«
Schweigen entstand, während die vier die unbestreitbare, eindrucksvolle Schönheit bedachten, die bei einer Hasty selbstverständlich gegeben war. Es war ihnen nie in den Sinn gekommen, dass diese Schönheit mehr bewirken könnte, als ihnen Vorteile bei örtlichen Talentwettbewerben zu verschaffen. Und sie konnten nicht an ihr Aussehen denken, ohne die verzückte Stimme des großen Mannes zu hören: »Mein Serail, meine genetischen Wunder, meine einzigartigen Prinzessinnen …«
Rufa war mit ihren siebenundzwanzig Jahren eine Burne-Jones-Nymphe in Jeans und Timberlands. Ihre Haut war durchscheinend weich und blass, im Kontrast zur prächtigen Burgunderfarbe ihres herrlichen Haars (alle Mädchen besaßen Unmengen von Haar, weil der Mann darauf bestanden hatte, dass seine Lämmchen niemals geschoren würden). Rufas Augen zeigten ein seltenes, dunkles Blau, das im Schatten schwarz wirken und jäh zu saphirfarben erstrahlen konnte. Sie war ebenso groß, wie es der Mann gewesen war, und sehr dünn. Eine Modelagentin hatte sie »entdeckt«, als sie in der fünften Klasse in St. Hildegard’s war, und ihr vorgeschlagen, nach London zu kommen.
Der große Mann hatte sich, bei dem bloßen Gedanken daran, dass seine Erstgeborene und Lieblingstochter den lüsternen Blicken der Öffentlichkeit ausgesetzt werden sollte, ausgeschüttet vor Lachen. Es wurde nie wieder erwähnt.
Nancy war mit ihren sechsundzwanzig Jahren bis auf die üppigen Formen eine Renoir-Schönheit. Sie wirkte wie eine Art alternative erotischere Version von Rufa – weniger atemberaubend schön, sondern mehr vollkommen sexy. Nancys Haar wallte entschieden rot. Ihre großen, festen Brüste waren das Neidobjekt ihrer mageren Schwestern. Ihre Augen wirkten schläfrig und spöttisch, ihre Lippen üppig und wollüstig. Sie war eine Orchidee unter Maiglöckchen.
Die vierundzwanzigjährige Lydia ähnelte eher ihrer Mutter als dem Mann. Ihr Stil war bis ins kleinste Detail kunstvolle Zerbrechlichkeit. Sie war kleiner als Rufa und Nancy. Ihre Augen blickten heller, strahlender blau und ihre Wogen lockigen Haars glänzten goldbraun. An ihren besten Tagen erschien sie wie eine Hilliard-Miniatur, mit feinster Pinselführung gestaltet. Derzeit, ungekämmt und ätherisch, wirkte sie wie ein wehmütiger Grabengel in einem geheimen Garten, der Moos angesetzt hatte.
Selena, der nachträgliche Einfall des Mannes, war siebzehn. Sie war sehr groß und schlaksig, aber man konnte sie nur schwer genau beschreiben. Sie trug ihr Haar, von der gleichen Farbe wie Lydias, in geflochtenen Rastalocken. Weiterhin war sie mit einer kleinen runden Brille und Piercings in Nase, Unterlippe und Zunge verkleidet.
Selena sagte kummervoll: »Niemand heiratet mehr wegen Geld.«
»Die Menschen haben immer wegen Geld geheiratet«, widersprach Rufa, »und sie werden es auch weiterhin tun. Die meisten unserer Vorfahren haben das getan. Damals hat sich niemand um Romantik geschert.«
Die anderen wechselten heimlich viel sagende Blicke. Sie wussten, dass sie an Jonathan dachte, den Mann, der ihr das Herz gebrochen hatte.
»Eine Heirat ohne Liebe ist völlig sinnlos«, sagte Lydia, die Passive und Zurückhaltende, ungewohnt bestimmt. Sie war die einzige von ihnen, die je Erfahrungen mit der Ehe gemacht hatte. »Es ist ohnehin eine absolute Qual. Ich konnte Ran erst verlassen, als ich aufgehört hatte, ihn zu lieben.«
Dieses Mal beteiligte sich Rufa an den viel sagenden Blicken. Lydias Schwestern glaubten nicht, dass sie jemals aufgehört hatte, ihren hoffnungslosen jungen Ehemann zu lieben.
»Das wäre egal gewesen, wenn Ran Unmengen Geld besessen hätte«, sagte Selena.
Rufa goss mehr Wein in ihre Teetasse. »Wir haben der Liebe in dieser Familie stets zu viel Bedeutung beigemessen. Sie hat uns immer nur Schwierigkeiten eingebracht.«
»Ich bekam Linnet aus Liebe«, erklärte Lydia.
»Abgesehen von Linnet.« Rufa schlug die langen Beine übereinander und warf ihr Haar ungeduldig über die Schulter. »Vielleicht sollten wir in Erwägung ziehen, Geld zu heiraten. Vor hundert Jahren wäre es der vernünftige Weg gewesen.«
Die anderen nahmen nur widerwillig die reale Welt in den Blick.
»Ich könnte vermutlich einen Mann heiraten, den ich nicht liebe«, sagte Nancy nachdenklich. »Aber ich müsste ihn zumindest mögen.«
»Bestimmt könntest du dich bemühen«, sagte Rufa, »da du anscheinend auf fast alles abfährst, was ein Rückgrat hat.«
Nancy lächelte, war nicht ungehalten. »Wenn ich genauso wählerisch wäre wie du, hätte ich nie irgendwelchen Spaß.«
Rufa seufzte. »Es hat mir nicht viel genützt, wählerisch zu sein, oder?«
Sie sprach nicht oft über diese Episode in ihrem Leben – das eine Mal, als sie mit dem großen Mann im Streit gelegen hatte. Er hatte sie wegen dieser Sache mit Jonathan unaufhörlich gehänselt. Er hatte die Familie mit solch fabelhaften Imitationen von Jonathan unterhalten, dass sogar Rufa hatte lachen müssen. Es hatte ihn beunruhigt, wie ernst es Rufa mit dieser Liebe war. Der große Mann hatte einmal im Leben seinen Thron teilen müssen.
»Es war wie ein geschmackvoller Film auf Kanal vier«, pflegte er über Rufas kastanienbraunen Kopf hinweg zu sagen, während er lächelnd auf den Esstisch hinabblickte. »Heute Abend, nach den Nachrichten, mietet ein anmaßender Londoner Romanschriftsteller ein Cottage auf dem Lande, verliebt sich in eine ortsansässige Rothaarige – und eilt dann zu seiner Frau nach Hause, um alles niederzuschreiben.«
Das war, kurz gesagt, mehr oder weniger alles. Damals, vor drei Sommern, hatte Rufa nicht erkannt, dass es ein Klischee war, ihr Herz an Jonathan Wilby zu verlieren. Sie war bereit gewesen, ihm ihren Körper und ihre Seele zu schenken – aber er war weder der Intensität dieser dorfgeborenen Schönheit noch den Verrücktheiten ihrer lauten Familie gewachsen gewesen. Rufa hatte nie herausgefunden, warum Jonathan so plötzlich zurückscheute. Sie vermutete, dass der große Mann dahinter steckte – wohinter, wusste sie nicht. Aber es war wie ein Krebsgeschwür in ihrer Erinnerung an ihn.
»Wenn ihr mich fragt«, sagte Nancy und ergriff die Weinflasche, »ist sich zu verlieben das Einzige, was das Leben auf Erden lebenswert macht. Aber was die Ehe betrifft, bin ich mir nicht sicher. Ich meine, seht euch Liddy an.«
»Gott, ja«, seufzte Lydia, »seht mich nur an.«
Vor zehn Jahren hatte sich Lydia im Teenageralter heftig in Randolph Verrall verliebt, der auf einem benachbarten Kleinlandbesitz Ziegen züchtete, und glaubte, einen Kristall in der Schublade mit den Slips aufzubewahren, würde die Liebesfähigkeit erhöhen. Rans Mutter lebte in einem verfallenen schottischen Schloss, das sie in eine Kommune umgewandelt hatte. Sein Vater, der schon lange tot war, hatte ihm ein georgianisches Farmhaus hinterlassen, das auf wenigen verkümmerten Morgen kauerte. Hier fütterte Ran seine Ziegen, veranstaltete Feuerlauf-Wochenenden und meditierte nackt.
Rans außergewöhnliche, dunkle Schönheit hatte Lydia für seine Absurdität blind gemacht. Wie der große Mann war auch er ein einstiger Eton-Schüler der rein dekorativen Art. Lydia hatte ihn auf einer Wiese geheiratet, in indischer Baumwolle und mit einem Kranz aus Butterblumen im Haar.
Wie der große Mann von Tag eins an vergnügt vorausgesagt hatte, endete die Ehe in einem Sumpf aus Mist und Ernüchterung. Rans Inkompetenz war einzigartig. Nachdem sich die Ziegen eine Krankheit eingefangen hatten und starben, hatte er verschiedene Methoden ausprobiert, zu Geld zu kommen, ohne zu viel tatsächliche Arbeit zu leisten. Alles, was er anfasste, roch nach Verhängnis.
An finanzielle Verhängnisse war Lydia gewöhnt. Es war der Ehebruch, den sie nicht ertragen konnte. Ebenso wie der große Mann war Ran ungeheuer untreu. Lydia war schließlich an ihm verzweifelt und kehrte nach Hause, nach Melismate, zurück. Die Familie war überglücklich, sie wiederzuhaben – der große Mann hatte ein Porzellan-Fußbad gegen zwei Flaschen Champagner zum Feiern eingetauscht. Es bedeutete, dass sie Linnet hatten, und sie alle liebten Lydias kleines Mädchen.
Weil Ran der Vater der gepriesenen Linnet war, und weil er eine freundliche Seele war, mochten die Schwestern ihn. Er war ein liebender Vater und ein netter Nachbar –, aber er war keine gute Werbung für die Ehe. Oder für die Liebe.
»Sich zu verlieben«, verkündete Rufa, »wird überbewertet.«
Nancy kreischte auf, als ihr Ideal so abgetan wurde. »O ja. Weit überbewertet, von Millionen Menschen. Aber wir irren uns alle. Hör nicht auf uns.«
»Ist Tim Dent so großartig?«
»Tim ist sagenhaft«, sagte Nancy standhaft. »Du solltest nur seine Gedichte hören.«
»Ernsthaft.« Rufa wollte sich nicht ablenken lassen. »Nach einem reichen Ehemann Ausschau zu halten muss besser sein, als in einem Wohnwagen zu bumsen.«
Nancy stöhnte leise. »Was soll’s? Vielleicht bin ich für den Wohnwagen bald dankbar. Wenn dieses Haus verkauft ist, werden wir keine Zeit mehr haben, reichen Männern hinterherzujagen. Wir werden zu sehr damit beschäftigt sein, uns unser Brot zu verdienen und einen Ort zum Leben zu finden.«
»Ich nicht«, warf Selena mürrisch ein. »Ich muss mit Mum und Roger in diesem beschissenen Cottage in Bangham leben. Sie sagt, ich muss meine Prüfungen beenden.«
»Das musst du auch«, sagte Rufa.
»Ich gehe nicht zur Universität, okay?«
»Sei still. Du gehst hin.«
Lydia runzelte besorgt die Stirn. »Mummy sagt, Linnet könnte sie immer aufnehmen, aber für mich wäre nicht genug Platz. Und ich könnte niemals ohne sie leben. Also sieht es so aus, als müsste ich letztendlich in Rans Scheune kampieren – mit einem Camping-Klo, und mit seiner schrecklichen Freundin drüben im Farmhaus.«
Der Staat machte dankenswerterweise keinen Unterschied zwischen verblasster Vornehmheit und gewöhnlicher Armut. Lydia, als allein stehende Mutter mit mittellosem Exmann, erhielt einige Staatszuwendungen – sie nannte sie ihre »Schecks für einen hohlen Zahn«, weil es sehr geringe Summen waren. Selena beabsichtigte, ab der Sekunde stempeln zu gehen, in der sie St. Hildegard’s verließ, was auch immer Rufa sagte.
»Bleiben noch du und ich, Ru«, sagte Nancy. »Und ich bin nicht so ohne Ehrgeiz, wie du anscheinend denkst. Ich habe Pläne für die Zukunft, weißt du.«
Nancy, die weder das Abitur noch die Uni geschafft hatte, trug ihren Teil zum Familienunterhalt bei, indem sie als Kellnerin im Dorfpub arbeitete. Es nannte sich das Hasty Arms. Als der große Mann hörte, dass sie sich dort einen Job besorgt hatte, wusste er nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Sein eigenes Wappen zierte das quietschende Pub-Schild – mit seinem Familienmotto Evite La Pesne. Der große Mann sagte, das bedeute »Meidet die Mühsal«, und es war nicht der geeignete Ort, an dem man eine echte Hasty mit normannischem Blut Pints zapfen sehen sollte. Nancy hatte ihn jedoch herumgekriegt, indem sie ihm Drinks spendierte – und ihn daran erinnerte, wie sehr sie das Geld brauchten. Der große Mann hatte gesagt oh, gut, er hätte immer schon gehofft, dass sich eine seiner Töchter zur Kellnerin berufen fühlte.
Nancy gefiel ihre Arbeit. In einem Pub konnte man sich geistesverwandter Gesellschaft sicher sein – wie Nancy dem großen Mann stets erklärt hatte. »Ich würde mich sowieso dort aufhalten, also kann ich mich genauso gut dafür bezahlen lassen.« Es gab unendlich viele Gelegenheiten, sich zu verlieben, und Nancy war auch unzählige Male verliebt. Sie sagte immer, ihr Herz sei eine Ansammlung von Rissen, wo es gebrochen und wieder gekittet worden sei. Rufa, die vermutete, dass ihre Lieblingsschwester die Klügste von ihnen allen war, wünschte sich manchmal, sie würde etwas ein wenig Erhabeneres mit ihrem Leben anfangen.
Rufa war nie stempeln gegangen. Sie hatte als Einzige in der Familie das Abitur gemacht (Englisch, Latein, Kunstgeschichte) und wäre zur Uni gegangen, wenn der große Mann nicht so vehement dagegen gewesen wäre. Mit aus seinen wunderbaren Augen rinnenden Tränen hatte er Rufa angefleht, ihn niemals zu verlassen. Er brauchte seine ganze Familie ständig um sich.
In Melismate zu bleiben hatte Rufas natürliche Fähigkeit zum Geldverdienen jedoch nicht gedämpft. Durch irgendeine genetische Eigenart strotzte die Tochter, die dem großen Mann am ähnlichsten war, vor Energie und Unternehmungsgeist. Ein launischer kleiner Teil ihrer DNA drängte sie zur Normalität, wie eine Kompassnadel, die stets nach Norden zeigt. Sie hatte als einzige der Schwestern den Führerschein gemacht. Sie hatte ihre gehorteten Ersparnisse für einen alten blauen Volvo ausgegeben – und der große Mann war sehr verärgert gewesen, als er erkannte, dass es so viel Geld in der Familie gegeben hatte.
In der Obstsaison kochte Rufa Tonnen ausgezeichneter Marmelade, fuhr in den Cotswolds umher und verkaufte sie an Touristenläden. Während der vergangenen sechs Wochen hatte sie Pastetenfüllung gemacht, und kleine Krüge Weinbrandbutter, mit hübschen Etiketten versehen, die sie selbst gezeichnet hatte (es war schwieriger gewesen, den Alkohol vor ihren Verwandten zu verstecken, als ein Atom zu spalten). Sie kochte auch für örtliche Abendgesellschaften und strickte gerne für einen Londoner Designer. Die Geldsummen waren gering und mit harter Arbeit verdient, aber sie halfen.
»Ich muss zugeben«, hatte der große Mann einmal gesagt, »dass deine mittelständischen Mätzchen helfen, uns über Wasser zu halten.«
Der Mann war unaufhörlich über Arbeit hergezogen, was nicht nur witzig, sondern auch ein Ausdruck von Widerstand oder Feindseligkeit war. Es hatte ihn sehr belustigt, dass eine Hasty mit normannischem Blut für Leute kochte, die ihre Vorfahren nicht bis zu William Rufus zurückverfolgen konnten.
Er hatte Nancys Arbeit als Kellnerin akzeptiert, indem er sie als Spaß darstellte, aber bei Rufa war es etwas anderes. Er stellte sie auf gleiche Stufe mit seiner toten Mutter, die die wunderschönste Debütantin ihrer Generation gewesen war. Er konnte idiotische Ortsansässige ertragen, die Nancy »Liebes« nannten und Wodka und Red Bull verlangten, aber er hasste es, wenn Rufa vom benachbarten niederen Adel Befehle entgegennahm. Der große Mann hatte sich nie als Snob empfunden. Snobs waren für ihn Leute, die übermäßig davon besessen waren, ihre Häuser und Familien makellos zu halten. Seiner Meinung nach kümmerten sich nur diejenigen, die sich der Gosse erinnerten, um Hygiene, und er musste seine Vornehmheit nicht durch Zurschaustellung beweisen. Der große Mann war einer langen Reihe gut aussehender rothaariger Vorfahren nach Eton gefolgt und hatte ein Haus geerbt, das unter Denkmalschutz stand. Aber er hatte Jahre für die Erkenntnis gebraucht, dass ihm das kein Anrecht auf besonderen Schutz gewährte.
Rufa, sosehr sie den großen Mann auch geliebt hatte, unterlag diesen Illusionen nicht. Fest und widerwillig in der realen Welt verankert, war sie die Little Dorrit der Familie, die sich abrackerte, um ein Hirngespinst zu finanzieren, an dem sie nicht teilhaben konnte. Manchmal beneidete sie Lydia und Selena für ihre Fähigkeit, durch die Welt zu treiben, ohne sie wirklich zu sehen.
Nancy, deren Weigerung, der Oberklasse anzugehören, eine gewisse eigensinnige Energie innewohnte, war wieder eine andere Geschichte. An sie richtete sich Rufa jetzt.
»In Ordnung, sehen wir uns die verfügbaren Wahlmöglichkeiten an. Du könntest weiterhin als Kellnerin arbeiten und in Tims Wohnwagen leben – in dem Bewusstsein, dass Mum, Roger und Selena in einem ekelhaften Cottage neben einem Garten-Center eingepfercht wären. Und dass Liddy und Linnet in Rans Scheune pennen müssen – mit dieser Metze aus dem Buchladen als Nachbarin, die ständig in der Öffentlichkeit an seinem Ohrläppchen knabbert.« Rufa hielt inne, um die zunehmende Verärgerung in ihrer Stimme zu unterdrücken. »Oder du könntest einen Wahnsinnstreffer landen, indem du Geld heiratest, wobei du bedenken müsstest, dass es eine Menge harte Arbeit bedeuten würde und du dich meist wie eine Dame benehmen müsstest.«
»Eine was?«, murmelte Nancy. »Gott, sie meint es ernst!«
»Das tue ich in der Tat.« Rufa hörte sich selbst erstaunt zu. »Ich halte es für möglich. Es muss reiche Männer geben, die bereit sind, sich in gutes Aussehen und gute Kinderstube zu verlieben. Was wir beides im Übermaß haben.«
Selena, die immer tiefer in ihrem Buch versunken war, tauchte jetzt plötzlich wieder auf. »Ihr könntet euch jederzeit wieder scheiden lassen, wenn ihr erst einmal Zugriff auf das Geld hättet.«
Auch Nancy zeigte unwillkürlich Interesse. »Nun, finde einen reichen Mann für mich, und ich werde es mir gerne überlegen.«
»Ich könnte auf keinen Kerl mit dickem Bauch runtersteigen«, erklärte Selena.
»Verzeihung, Madam«, erwiderte Nancy mit spöttischer Strenge, »Sie sollen von keinem anderen ›Runtersteigen‹ als dem die Treppe hinab wissen.«
Sie streckte mit klingenden Armreifen eine Hand aus, um Rufas Uhr zu sich zu ziehen. »Das Bad gehört mir. Ich gehe zum Abendessen zu den Dents.«
»Lassen sie dich jetzt tatsächlich ins Haus?«, fragte Rufa.
Nancy erhob sich von dem zerschlissenen Teppich vor dem Kamin und streckte sich genüsslich. Ihre enge schwarze Strickjacke spannte über der Brust und rutschte dann hoch, sodass ihr Nabel zum Vorschein kam. Nancys Kleider schienen häufig kurz vor dem Auseinanderfallen.
»Es wird unglaublich langweilig werden, aber es ist eine wichtige Angelegenheit. Dank meiner unermüdlichen Anstrengungen wartet unter dem Baum der Dents ein fabelhaftes Geschenk auf mich.«
»Du Glückliche«, murrte Selena. »Was ist es?«
»Ma Dent fragte mich, ob ich etwas Besonderes haben möchte. Ich sagte sicher und erklärte ihr genau, wo sie es fände.« Sie lächelte zu ihren Schwestern hinab und genoss deren Spannung. »Es ist ein märchenhaftes Outfit, in Regenbogentüll …«
»Oh, Nancy …«, rief Lydia begeistert.
»… das einen Rock, der unten absteht, Flügel, einen glitzernden Zauberstab und ein Diadem umfasst.«
»Du bist ein Schatz.« Lydia musste fast weinen. »Sie wird im siebten Himmel sein.«
Rufa strahlte. »Das wird Linnets großer Tag. Du bist wirklich ein Schatz, Nance.«
»Ich wünschte nur, sie hätten es größer gefertigt«, sagte Nancy. »Dann könnte ich den Zauberstab schwingen und die Dents interessant machen. Im Namen der Menschlichkeit, trinkt nicht allen Wein aus, während ich fort bin – das Haus des Arztes ist verdammt knochentrocken.« Sie warf Rufa einen berechnenden Blick zu. »Kann ich mir dein Auto ausleihen?«
»Nein, kannst du nicht«, erwiderte Rufa scharf. »Zum letzten Mal – nicht bevor du den Führerschein hast. Und außerdem hat es Roger.«
»Na gut, es war einen Versuch wert.« Als Nancy den Raum schon halbwegs verlassen hatte, drehte sie sich noch einmal um und fügte hinzu: »Was ich auch in Bezug auf deine Idee denke, Schätzchen. Ich habe das Gefühl, ich wäre absolut phantastisch im Hochzeitsspiel.«
Kapitel Zwei
Rufa hörte die leise, weinerliche Stimme ihrer Mutter, als sie die riesige Küche betrat. Rose Hasty saß neben dem Herd, ihre mit Tesafilm geflickte Lesebrille auf der Nasenspitze, ein abgegriffenes Paperback in der Hand und Linnet auf den Knien.
»›Möge man das wahrhaft von uns behaupten können, und zwar von uns allen! Und daher, wie Tiny Tim bemerkte …‹«
Ihre Stimme schwankte und verklang.
Linnet beendete den Satz für sie. »›Möge Gott uns segnen, jeden einzelnen!‹« Sie wand sich von Roses Knien. »›Ende.‹«
Rose schloss das Buch und lehnte sich mit lautem Schniefen in ihrem Sessel zurück. »Mein Gott, diese Gefühlsergüsse!«
»Nun, wenn du Dickens liest«, sagte Rufa.
»Ich weiß. Ich muss verrückt sein.«
Rose war fünfzig: eine ehemalige Schönheit, doch Schönheit verliert sich schnell. Die helle Haut um ihre Augen bildete ein Netzwerk von Falten. Schlaffe Haut hing von ihrem Kinn herab, und ihre wirren Locken entarteten zu einem muffigen Pfeffer-und-Salz-Bausch. Man konnte jedoch immer noch die Umrisse des wunderbaren Blumenkindes erkennen, das den großen Mann bei einem schlammigen Rock-Festival vor dreißig Jahren unten im West Country eingefangen hatte.
»Ich habe den Kessel schon aufgesetzt«, sagte sie. »Mach uns einen Tee, sei so lieb.«
»Ist Roger noch nicht zurück?«
Roger war Roses Lebensgefährte und der Nutzlose Mann im Haus, seit der große Mann selbst gestorben war. Er war vor zehn Jahren zufällig in Melismate aufgetaucht und teilte seitdem Roses Bett. Der große Mann, der froh darüber war, dass Roses Bett anständig belegt war, mochte ihn mit der Zeit. Und sie hatten alle von seinem sehr kleinen Privateinkommen profitiert.
»Er ist zu Ran rübergegangen«, sagte Rose. »Dort herrscht offensichtlich eine Krise.«
Linnets Stimme schwebte unter dem großen, uralten Küchentisch hervor. »Die alte Nutte aus dem Buchladen hat ihn verlassen. Er hat angerufen und geweint, und ich habe ihm gesagt, es täte mir nicht Leid.«
Rufas Anstandsgen zuckte unangenehm berührt zusammen. Es war absolut sinnlos, jemanden hier daran zu erinnern, dass kleine Kinder stets die Ohren spitzten. Verlegenheit war ihnen allen fremd.
»In zwanzig Minuten ist es Zeit fürs Bett, Süße«, sagte sie.
Linnet murrte ärgerlich. »Nein! Ich habe in meinem Haus zu tun.«
Sie war fünf und so wunderbar, wie ein Kind es nur sein konnte. Die porzellanartigen Züge und blauen Augen ihrer Mutter hatten sich mit Rans glänzendem, vollkommen glatten schwarzen Haar vermischt und ein blasses, ernstes Rapunzelchen ergeben. Sie trug eine hellgrüne Strickjacke mit noch einer durch die Löcher lugenden gelben Strickjacke darunter und strahlte eine gewisse Würde aus.
Während Rufa ihren Tee trank, kniete sie auf dem Steinboden neben dem Tisch. Linnet hatte ihr Haus mit einem sehr schmutzigen Kissen und einem kahlen Zweig eingerichtet, der einen Weihnachtsbaum darstellen sollte. Ihre beiden Braunbären, die Ressany-Brüder, lagen verdreht auf einem Handtuch. Zwei von Linnets Strümpfen waren in Bärenhöhe ans Tischbein geheftet.
»Das ist ihr Kamin«, erklärte sie. »Sie haben gerade ihre Strümpfe aufgehängt.«
Rufa nahm die Erwähnung der Strümpfe als hoffnungsvolles Zeichen. Vor einigen Wochen hatte Linnet ihre Großmutter über einer gigantischen Stromrechnung weinend vorgefunden. Weil niemand daran dachte, vor dem kleinen Mädchen Verschwiegenheit zu bewahren, hatte sie laute Streitgespräche darüber mit angehört, ob sie an ihrem letzten Weihnachten in Melismate Strom oder Alkohol haben sollten.
Kurz darauf hatte sie bewusst beiläufig zu Rufa gesagt: »Es gibt dieses Jahr wohl nicht viele Geschenke.«
Die Tapferkeit dieser Worte hatte den Schwestern unglaublich wehgetan.
Jetzt, erleichtert durch die Erkenntnis, dass alles in Ordnung käme – dass Linnets Freude ein Fenster der Richtigkeit in der alles durchdringenden Niedergeschlagenheit öffnen würde –, war Rufa beinahe glücklich.
Es gab keinen Tropfen Gin im Haus, und andere Grundnahrungsmittel gingen zur Neige, aber die Opfer waren es wert gewesen. Morgen früh würde Linnet am Fuß ihres Bettes einen prall mit Geschenken gefüllten Strumpf vorfinden.
Linnet wickelte unter dem Tisch zwei schrumpelige Kastanien und einen angelaufenen Messing-Türknauf in Stanniol.
»Die Lieben«, sagte sie nachsichtig und deutete mit dem Kopf auf die Bären. »Sie sind so aufgeregt. Beruhigt euch, Jungs.«
»Es ist fast an der Zeit, auch deinen Strumpf aufzuhängen«, sagte Rufa. »Und wir dürfen nicht vergessen, eine Kleinigkeit für den Weihnachtsmann dazulassen.«
Es schmerzte sie, den scharfsinnigen, misstrauischen Ausdruck auf Linnets Gesicht zu sehen. Der große Mann hatte an Heiligabend immer einen Happen für den überarbeiteten Heiligen dagelassen. Aber der große Mann war tot, und alles hatte sich schrecklich verändert.
Linnet tauchte auf allen vieren aus ihrem Haus auf. »Letztes Mal haben wir ihm Gin und Tonic dagelassen.«
»Kein Gin«, seufzte Rose.
»Eine Tasse Tee und einen Keks«, schlug Rufa vor. »Das würde ich in einer Nacht wie dieser auch selbst mögen.«
Linnet nickte zufrieden. »Und ein bisschen Gras.«
»O nein, Liebling«, widersprach Rose. »Ich glaube nicht, dass der Weihnachtsmann raucht.«
»Nicht das Gras, Dummerchen. Ich meinte, als Fressen für das Rentier.«
Rufa schluckte ein Lachen hinunter – Linnet hasste es, wenn über sie gelacht wurde. »Es ist zu kalt, um rauszugehen. Wie wäre es mit Zuckerstücken?«
»Okay.«
Die Tür flog auf, und Nancy wehte mit der Zugluft herein. »Miss Linnet, Ihre Mutter verlangt oben nach Ihnen.«
Sie kam gerade aus dem Bad, in einer Wolke großartigen Haars und eines unidentifizierbaren Parfums. Sie trug jetzt ein schwarzes Strickkleid, das ihre BH-losen Brüste umschmiegte.
»Komm mit mir rauf«, befahl Linnet.
»In Ordnung.«
»Dieses Kleid steht dir gut«, bemerkte Rufa.
»Nicht wahr? Tut mir Leid, dass ich nicht gefragt habe. Aber es macht dir doch nichts aus, oder?«
»Nein. Ich wünschte nur, ich würde es an denselben Stellen ausfüllen wie du.«
»Danke.« Nancy nahm Rufas Teetasse hoch und ließ drei der verfärbten Zuckerstücke hineinfallen.
Rufa trat zum Herd, um sich eine weitere Tasse Tee zu machen. Nancy könnte wirklich phänomenal aussehen, dachte sie – wenn sie sich wie eine Dame kleiden würde, anstatt wie eine Kreuzung zwischen Angelina Jolie und Posh Spice – pardon, Mrs. Beckham. Der Gedanke, Geld zu heiraten, verfestigte sich in Rufas Geist.
Während sie darauf wartete, dass der Kessel wieder kochte, sah sie sich im Raum um. Diese riesige Küche und die angrenzende, gewölbeartige Große Halle waren die ältesten Teile Melismates. Sie waren im vierzehnten Jahrhundert erbaut worden, und ihre massiven Mauern hatten tiefe, unverrückbare Wurzeln in die Erde Gloucestershires gegraben. Jetzt, wo Rufa ihr Heim verlieren würde, schmerzten sie all die verpassten Gelegenheiten. Was für ein Haus hätte es sein können, wenn genug Geld da gewesen wäre, das undichte Dach und die herabsackenden Balken zu reparieren. Sie hasste die Verschwendung von so viel Schönheit.
Sie bereitete ihren Tee in einem Becher mit der seitlichen Aufschrift: »ICH HABE DIE SCHWEINE AUF DER SEMPLE FARM GESEHEN!« Die Semple Farm war der Ort, wo Ran lebte, aber es hatte dort nie Schweine gegeben. Die Becher waren alles, was von diesem speziellen, zum Scheitern verurteilten Projekt geblieben war.
Sie fragte: »Hat Rans Freundin ihn wirklich verlassen?«
Rose streckte die Beine in verblasstem blauen Kordsamt aus. »Ich wusste, dass es nicht halten konnte. Sie war viel zu sauber.«
Rufa lachte. »Als sie zum Essen hierher kam, hat sie sich beim Rausgehen die Füße abgetreten, das schwöre ich.« Sie setzte sich an den Küchentisch. »Ich wette, Linnet freut sich trotzdem.«
»Und Lydia zweifellos auch«, sagte Rose weise. »Dieses dumme Mädchen liebt Ran immer noch.«
Rufa seufzte. »Sie sagte, sie hätte Angst davor, wieder auf der Farm leben zu müssen – aber nur weil sie Rans Eifersucht nicht ertragen kann.«
Rose seufzte ebenfalls, und dann saßen sie in schweigendem Einvernehmen da. Rose war mit ihrer ältesten Tochter nicht immer zurechtgekommen, trotz deren unaufhörlichen Bemühungen zu gefallen. Rufas Normalität hatte sie verwirrt. Als Teenager war Rose aus einem Süßwarengeschäft in Falmouth davongelaufen, um der Normalität zu entfliehen. Sie hatte sich in Rufus Hasty verliebt, weil er das genaue Gegenteil von normal war. Rose hatte sich entschieden, anders zu sein, und Rufas angeborene Normalität war ihr manchmal wie ein Vorwurf erschienen.
Erst Linnets Geburt hatte Roses verschüttete spießbürgerliche Werte wieder erweckt. Als Mutter hatte sie Verschrobenheit kultiviert. Als Großmutter wollte sie, dass Linnet all die guten, soliden, langweiligen Dinge haben sollte, die andere kleine Mädchen auch hatten. Rufa wollte das auch. Rose hatte plötzlich festgestellt, dass sie viel mit ihrer Erstgeborenen gemeinsam hatte. Sie stützte sich derzeit auf Rufa, wie sie sich auf den großen Mann oder auf Roger nie gestützt hatte. Man konnte Rufa ein normales Gefühl entgegenbringen, ohne dass man eine heftige Reaktion riskierte.
»Mum«, sagte Rufa, »was hältst du davon, Geld zu heiraten?«
»Ernsthaft? Oh, natürlich meinst du es ernst – das ist ja nie anders. Hast du jemand Reichen kennen gelernt?«
»Nein. Im Moment theoretisiere ich nur. Aber was würdest du davon halten, wenn ich einen sehr reichen Mann heiratete, ohne ihn notwendigerweise zu lieben?«
Rose verengte nachdenklich die Augen. »Ich würde denken«, sagte sie bedächtig, »dass du entweder sehr zynisch oder sehr naiv wärst. Zynisch, wenn du ohne Liebe heiratest. Naiv, wenn du dir einbildest, ohne sie leben zu können.«
»Ich kann es«, sagte Rufa abwehrend.
»Du wirst über Jonathan hinwegkommen, weißt du. Du kannst nicht ohne Liebe heiraten, Ru. Du bekämest einen Nervenzusammenbruch. Nancy könnte es – sie kann sich im Handumdrehen davon überzeugen, sich zu verlieben –, aber nicht du. So seltsam es auch für eine meiner Töchter scheint, bist du zu vergeistigt.« Rose beugte sich vor, um ihrem Hauptargument Nachdruck zu verleihen. »Du müsstest vermutlich mit deinem reichen Ehemann schlafen.«
Eine Pause entstand, während der Rufa durch die geöffnete Herdtür ins Feuer starrte. Sie sagte: »Ich würde sogar mit Godzilla schlafen, um uns alle aus diesem Schlamassel herauszuholen.«
Rose zuckte bei dieser unverhohlenen Erinnerung an ihre Lage zusammen, die sie zu ignorieren versuchte. »Liebling, wir werden es schaffen, da herauszukommen. Es wird keine solche Tragödie werden. Der große Mann hat immer von dem Haus und der Familiengeschichte erzählt –, und diese Geschichte kann uns niemand nehmen. Wir werden eben nur wie Millionen anderer leben.«
Rufas Blick aus den blauen Augen wankte nicht. »Es bedeutet zu viel, um es aufzugeben. Das kann ich nicht tun.«
»Du bist jung«, sagte Rose. »Verdirb dir dein Leben nicht.« Sie erhob sich und nahm eine Flasche Rotwein aus dem Schrank. Sie entkorkte sie geschickt und fand zwei trübe Gläser. »Abgesehen von allem anderen müsstest du zuerst einmal reiche Männer treffen.«
»Wir müssten in London sein«, murmelte Rufa. »Wir müssen nach London gehen.«
»O Gott – schreibt wieder Tschechow unsere Drehbücher? Mr. Bean war mir lieber.« Rose nahm einen großen Schluck Wein, wie eine Dosis Medizin.
»Und wir müssen ein paar anständige Klamotten kaufen.«
»Wach auf, Liebling. Womit? Niemand von uns hat einen Heller.«
»Nancy und ich könnten die erste Runde bestreiten«, fuhr Rufa fort. »Wir könnten es uns als eines der Spiele des großen Mannes vorstellen – das Hochzeitsspiel.«
»Zu heiraten ist kein Spiel.«
»Und wir könnten bei Wendy wohnen. Sie würde uns bestimmt aufnehmen.«
Wendy Withers war ihr früheres Kindermädchen. Sie hatte den Zustand des Hauses ertragen – und die Unregelmäßigkeit ihres Gehalts –, weil sie hoffnungslos in den großen Mann verliebt gewesen war. Sie hatte eine seiner kurzen, intensiven Affären mit ihm genossen und war ihm aufgrund dessen nach Hause gefolgt. Die Mädchen hatten sie geliebt, und auch Rose hatte sie zunehmend gemocht. Als Wendy nach fünf Jahren gegangen war, um Platz für irgendwelche balinesischen Tänzerinnen zu machen, hatten beide Frauen geweint. Rose war beeindruckt, dass Rufa ihre Idee schon so weit entwickelt hatte.
»Du hast Recht, sie würde euch begeistert aufnehmen.«
Rufa plante. »Ich kann ein paar Tausend für den Wagen kriegen, dann könnten wir vielleicht zurechtkommen.« Sie runzelte angestrengt die Stirn. »Linnet müsste allerdings zur Schule laufen. Und wie kämst du zum Einkaufen? Vielleicht ist es das Risiko gar nicht wert.«
Das Feuer, das zu düster glühender Kohle heruntergebrannt war, verlieh ihrem kastanienbraunen Haar die Farbe von Wein. Sein Licht fiel goldfarben auf ihre Wange. Sie ist so wunderschön, dachte Rose. Und sie verschwendet hier ihr Leben, weil der große Mann ihr das Versprechen abgenommen hat, für immer zu bleiben.
»Geh das Risiko ein«, sagte sie impulsiv. »Tu einmal in deinem Leben etwas Verrücktes. Ich hasse es, wenn du unglücklich bist, Liebling –, aber dein Hochzeitsspiel ist verdammt nochmal die vernünftigste Idee, die ich seit Ewigkeiten gehört habe.«
Rufa war verblüfft. Die beiden Frauen sahen einander gebannt an.
Der Augenblick unerwarteter Vertrautheit wurde vom Geräusch der Eingangstür unterbrochen, die sich schwerfällig und mit einem Knarren wie Draculas Sargdeckel öffnete. Eine unmelodische Tenorstimme sang:
»Wir sind kein gewöhnlicher Bettler,
der von Tür zu Tür rennt.
Wir sind die Kinder eurer Nachbarn,
die ihr schon kennt!«
»Oh, es ist Ran«, sagte Rose lächelnd und verdrehte die Augen. »Schnell, lass dir etwas einfallen, was wir in die Suppe geben können, sonst wird sie nie reichen.«
Rufa erhob sich, während sie ihr Hochzeitsspiel im Geiste beiseite schob. »Einen Turnschuh?«
»Kannst du nicht eine Kartoffel erübrigen?«
»Du hast mir noch vor einer Sekunde gesagt, ich soll aufwachen«, erwiderte Rufa. »Es gibt hier nirgendwo eine überzählige Kartoffel.«
Die wuchtige, gemaserte Tür zwischen der Großen Halle und der Küche öffnete sich, und kalte Luft peitschte in die verrauchte Wärme. Roger kam herein und zog den Reißverschluss des alten Wachsmantels des großen Mannes auf. Er war ein blasser, schmächtiger Mann von fünfunddreißig. Sein Haaransatz zog sich bereits bis über die Stirn zurück, und ein dünner brauner Pferdeschwanz hing zwischen seinen Schulterblättern herab. Die Hauptsache in Rogers Leben – alles, was man über ihn wissen musste – war, dass er Rose schon seit zehn Jahren liebte und sie bis zum Tode ergeben lieben würde. Er verströmte gütige Ruhe und brachte den exotischen Beigeschmack von gesundem Menschenverstand in den Haushalt ein. Roger war trotz seiner Umgebung auf stille und beharrliche Art normal.
»Tut mir Leid, dass ich zu spät komme«, sagte er leutselig. »Ran wollte nicht allein bleiben, sodass ich ihn mitgebracht habe.«
»Noch ein Maul zu stopfen«, sagte Rose, »aber es liegt mir nicht, zu widersprechen. Das Liebesleben dieses Jungen ist ebenso spannend wie fernsehen.«
Ran platzte in den Raum, drängte Roger beiseite. »Frohe Weihnachten, Mädels.« Er ließ einen feuchten Sack auf den Tisch fallen und stürzte voran, um Rose und Rufa auf die Wange zu küssen. »Gott, ist das kalt. Gebt mir etwas zu trinken.«
»Da brauchst du Glück«, sagte Rose. »Es besteht bereits eine lange Warteliste für diesen Wein.«
Auch bei Ran konnte man behaupten, dachte sie, dass außergewöhnlich gutes Aussehen in der tiefsten Provinz versauerte. Er trug eine gebatikte Weste und einen albernen verzierten Hut, aber seine Schönheit überstrahlte beides. Die Augen und das dichte schulterlange Haar wirkten vor der pergamentenen Haut dunkel und glänzend. Linnets verrückter junger Vater hatte das Gesicht eines Renaissance-Engels.
»Es ist wirklich nett von euch, mich aufzunehmen«, sagte er, während er Rose und Rufa mit durchdringendem Blick ansah. »Ich weiß, wie knapp es bei euch steht, sodass ich nicht mit leeren Händen gekommen bin. Ich habe eine Wagenladung Holzscheite mitgebracht und die Zwiebeln, die ich auf dem Bauernmarkt nicht tauschen konnte.«
Rufa untersuchte den Sack auf dem Tisch. »Großartig. Jetzt können wir die Suppe strecken.«
Ran sah sich hoffnungsvoll um. »Wo ist Linnet?«
»Oben. Liddy bringt sie gerade zu Bett.«
»Und wenn du sie wieder munter machst«, warf Rose streng ein, »wirst du dafür verantwortlich sein, sie nachher wieder zum Schlafen zu bringen.«
Ran fragte: »Könnte sie nicht zum Abendessen aufbleiben?«
»Nein, wir sind viel zu geschafft. Roger, mach dich nützlich. Dreh uns einen Joint.«
»Hmmm. Besser nicht«, sagte Roger. Er senkte die Stimme. »Edward ist bei uns.«
Rose stöhnte leise. »Kann er sich nicht jemand anderen suchen, dem er Vorträge halten kann?«
Rufa schaute vom Zwiebelschneiden auf. »Nicht, Mum. Er versucht nur, freundlich zu sein.«
»Vermutlich. Aber wenn er sich bloß mal entspannen könnte, nur einen Abend lang.«
Edward Reculver, dessen Farm an Rans dem Untergang geweihte Morgen angrenzte, war Rufas Pate, und der beharrlichste Freund der Familie. Die Reculvers lebten schon seit Jahrhunderten als Farmer in dieser Ecke von Gloucestershire und waren zur Zeit des Bürgerkrieges mit den Hastys in Streit geraten. Die Hastys waren Royalisten, während die Reculvers für das Parlament waren. Obwohl der uralte Streit nur noch eine historische Kuriosität war, als Edward Reculver mit dem großen Mann aufwuchs, wirkte er neben Hastys geschniegeltem Kavalier immer noch wie ein grauhaariger Anhänger Cromwells. Seltsamerweise war dieser Republikaner der beste Freund des großen Mannes gewesen.
Er hatte den großen Mann gnadenlos kritisiert, aber der große Mann hatte ihn als eine Art externes Gewissen respektiert und seinen puritanischen Ansichten mit distanziertem Interesse zugehört. Reculver bewohnte eine einsame, menschenfeindliche Welt makelloser Ordnung und Nüchternheit. Er züchtete Kräuter, recycelte jeden Fetzen und war der letzte Mensch auf Erden, der ohne Ironie Strümpfe stopfte. Alle Arten von Überfluss machten ihn misstrauisch.
Das war nicht immer so gewesen. Bis vor sechs Jahren diente er als Offizier in der Armee. Seine Farm war verpachtet worden, und er war gelegentlich – dramatisch – in das Leben der Hasty-Kinder eingebrochen, um sie in einen Zirkus oder zu einem Weihnachtsspiel mitzunehmen. Rufa erinnerte sich lebhaft an Edwards Besuche während ihrer ganzen Kindheit, mit gebräuntem und undurchdringlichem Gesicht, von verschiedenen exotischen Brennpunkten kommend. Nach dem Falkland-Krieg war er ausgezeichnet worden und hatte eine kleine Narbe auf dem Unterarm, wo ihn in Bosnien die Kugel eines Heckenschützen gestreift hatte.
Rufa bewunderte Edward und hatte schon immer ein wenig Ehrfurcht vor ihm empfunden. Sie hatte wie alle anderen angenommen, dass er durch und durch Soldat sei, sodass es sich, als er die Armee verließ, zunächst seltsam anfühlte, ihn die ganze Zeit in der Nähe zu haben. Der große Mann hatte sich oft gefragt, warum er die Armee verlassen hatte. War er gerade hartherzig eingestellt, sagte er: »Edward wusste, dass er es nie bis zum Colonel schaffen würde. Er ist so aufsässig, dass er sich selbst schadete.« In freundlicherer Stimmung seufzte er jedoch und sagte: »Armer alter Edward. Er hat die Armee wegen eines gebrochenen Herzens verlassen. Er kann noch immer nicht ohne sie leben.«
In den zehn Jahren seit dem Tod seiner Frau hatte sich Edward allmählich von der Welt zurückgezogen. Rufa erinnerte sich vage an Alice: eine ruhige, blonde Frau, die auf Fotos immer etwas zur Seite geblickt hatte, sodass man sich nie richtig an sie erinnern konnte. Sie waren kinderlos geblieben, und Edward hatte keinerlei Versuche unternommen, erneut zu heiraten. Anders als der große Mann konnte er anscheinend ohne Romanzen leben. Sein Leben schien vom rechten Pfad abgekommen und gestrandet zu sein.
Nach dem Tod des großen Mannes hatte Edward das fortschreitende Chaos und die Verwahrlosung in Melismate nur vage wahrgenommen. Zwischen Belehrungen berieselte er die Hastys jedoch mit Freundlichkeit. Der große Mann hatte ihm bei seinem Tod bedeutende Summen Geldes geschuldet, was er nie erwähnte. Er hatte nach dem Tod des großen Mannes das Aufräumen übernommen, als niemand sonst ertragen konnte, es zu tun. Als sich Selena bei einem Fahrradsturz den Knöchel brach, hatte er sie jeden Morgen in seinem Landrover zur Schule gefahren. Selena hatte keine Dankbarkeit gezeigt. Wie Rose sagte, hatten Edwards Gunstbezeigungen etwas leicht Strafendes. Er wollte, dass sie der Realität ins Auge blickten, aber sie hatten unterschiedliche Ansichten darüber, wie die Realität wirklich aussah.
Rose erhob sich mürrisch. »Ich weiß, dass er nur versucht, freundlich zu sein«, murrte sie, während sie ihr Weinglas erneut füllte. »Das macht es ja so schrecklich – warum ist es so leicht, sich über jemanden zu ärgern, der freundlich zu sein versucht? Und der arme Kerl wird in seinem Haus nicht viel Weihnachtsfreude erleben.«
Sie hielt jäh inne. Reculver stand im Eingang. Er sah Rufa und Rose ernst an und schaute sich dann im Raum um. Sein Blick schien ein gespenstisches, unbarmherziges Licht auf Untertassen, die randvoll Zigarettenkippen waren, braune Zuckerstücke und den anämischen Suppentopf auf dem Herd zu werfen.
»Hallo«, sagte er.
Er küsste nie jemanden auf die Wange, aber Rufa ging bewusst zu ihm und küsste ihn auf die Wange. Er war immerhin ihr Pate, und sie achtete mehr als die anderen auf angemessene Dankbarkeit. Reculver war ein großer, hagerer Mann irgendwo in den Vierzigern. Er trug einen kurz geschorenen, eisengrauen Bart. Sein dichtes Haar war ebenfalls eisengrau. Er ließ es an jedem Markttag beim Friseur kurz scheren. Er sah sehr gut aus, obwohl es nicht das war, was Menschen zuerst bemerkten.
»Edward«, sagte Rose matt, »welch nette Überraschung.«
Reculver verschwendete keine Worte. »Such ein paar trockene Kleider, sonst wird dieser Mann an Lungenentzündung sterben.«
»Mann?«, echote Rose. »Welcher Mann?«
Reculver schaute über die Schulter. »Kommen Sie herein – hier ist es wenigstens geringfügig wärmer.«
Er trat beiseite, um einen Fremden einzulassen. Der Fremde trug einen Anzug und eine Krawatte sowie Städterschuhe. Er war tropfnass und mit antrocknendem Schlamm beschmiert.
»O ja, das ist Berry«, erklärte Ran unbekümmert. »Er ist mit mir zur Schule gegangen.«
Berry war ein rundlicher, rosiger, junger Mann mit den Augen eines erschreckten Wildes hinter einer Designerbrille.
»Hector Berowne«, sagte er. Und nachträglich: »Hallo.«
Kapitel Drei
Hector Berowne hatte, als er seinen BMW über die eisglatten Straßen lenkte, keine Ahnung, dass er in eine andere Dimension eintreten würde. Er hatte angenommen, sein Ziel wäre ein freundliches Farmhaus – mit Kamin und ganz aus goldfarbenem Stein –, das er und seine Verlobte Polly für den Urlaub für teures Geld gemietet hatten.
»Good King Whatsit pom-pom-pom«, sang er vor sich hin.
Berry besaß die Gabe der Zufriedenheit. Der Verdruss der Arbeit fiel von ihm ab, während er bei den bevorstehenden Freuden verweilte. Seine Eltern, mit denen er den Urlaub normalerweise verbracht hätte, besuchten Diplomatenfreunde auf den Bermudas. Sein Stadtbüro lag zwei ganze Wochen lang hinter ihm. Nicht mehr um Viertel vor sechs aufstehen. Nicht mehr zu erschöpft sein, um Sex zu haben. Und er liebte die Vorfreude auf den Heiligabend immer noch. Holzfeuer und roter Bordeaux, während um Mitternacht die ganze Welt den Atem anhielt – er wusste genau, dass es perfekt sein würde.
Polly hatte im September angefangen, Mietshäuser auf dem Lande auszusuchen, und hatte die vergangenen sechs Wochen damit verbracht, Schinken zu bestellen und Laken zu bügeln. Polly, die Berry seit ihrem ersten Jahr in Oxford behaglich liebte, legte großen Wert auf Korrektheit – Salons und Servietten, Portwein schwenken und keine gelben Blumen im Garten. Sie reagierte bezüglich ihres gesellschaftlichen Ansehens in der Welt gern ein wenig neurotisch. Ihre Besessenheit mit edwardianischem Drum und Dran war zu extrem, um als reiner Snobismus abgetan zu werden. Sie hüllte sich in Stilwillen, um die bedauerliche Tatsache zu verbergen, dass ihre Eltern Australier waren. Die Rede war von vornehmen Goldgräbern und kolonialen Aristokraten, aber für Polly war das fast genauso schlimm, wie insgeheim Waliser zu sein.
Berry wusste aus vergangenen Erfahrungen, dass sein Weihnachten einem Bericht in Harpers ähneln würde – die Art Weihnachten, an das sich im wahren Leben niemand außer einem Heimlichen Australier wagen würde. Ein Kranz an der Tür, Efeu um die Bilder und so weiter. Es würde eine Atmosphäre von Holzrauch, Potpourri, Lavendel und Bienenwachs herrschen – Polly hatte sogar die Gerüche geplant.
Einige Leute, zum Beispiel seine Schwester Annabel, hatten Berry bereits vorgeworfen, Angst vor Polly zu haben. Was für ein Unsinn. Er empfand eher Ehrfurcht vor seinem Glück, dass er bei einer so auffallend hübschen und charmanten Frau landen konnte.
»Sire, die Nacht ist nun dunkler«, sang Berry.
Die Nacht schien tatsächlich dunkler zu werden. Berry verlangsamte den BMW zu Schleichtempo und hielt dann an. Das einzige Licht in Meilen Umkreis strahlte von einem Volvo aus, der die gesamte Straße blockierte. Die beiden Vordertüren standen offen. Berry wartete einen langen Moment, während er der umgebenden Stille lauschte. Niemand kam. Der verlassene Volvo leuchtete weiterhin wie die Titanic.
Er schaltete den Motor aus, zog den Schlüssel ab und stieg aus dem Wagen. Der Schock der Kälte nahm ihm den Atem. In seinem marineblauen Anzug und den Städterschuhen zitternd, näherte sich Berry einem Gewirr dornenbewehrter kahler Äste, knapp fünf Meter seitlich der Straße. Hinter diesem Dornenschirm wirkte das Licht des Volvo gedämpft und von Schatten durchsetzt. Berry machte durch seine Atemwolke zwei Gestalten am Rande eines kleinen Teiches aus.
Ein lebloser Fasan lag auf dem gefrorenen Gras. Eine der Gestalten kniete daneben. Er sagte gerade mit elender Stimme: »Das werde ich mir nie verzeihen. Ich habe dich dazu überredet, die Abkürzung zu nehmen, und habe dadurch dieses Leben vernichtet. Alles, was ich anfasse, geht schief.«
Eine andere Stimme sagte: »Ich friere mir hier die Eier ab. Begrab ihn oder mach eine Mund-zu-Mund-Beatmung, damit wir nach Hause fahren können.«
Ein Schluchzen entrang sich dem knienden Mann. Er wandte den Kopf in Berrys Richtung. Das Licht verwandelte die Tränen in seinen wunderschönen dunklen Augen in Diamanten.
Sie sahen einander an. Die Begegnung erfolgte so unerwartet, dass es mehr als eine Überraschung war.
»Ran?« Berry zögerte. »Du bist Ran Verrall, oder? Aus der Schule?«
Ran sprang auf und fuhr sich mit einem Ärmel übers Gesicht. »Scheiße, ich glaube es nicht – Hector Berowne.«
»Nun, hallo«, sagte Berry. »Ich habe mich gerade gefragt, wessen Auto …«
»Das ist unglaublich«, sagte Ran glücklich an Roger, seinen Begleiter, gewandt. »Berry und ich sind zusammen zur Schule gegangen, Rodge. Ich musste ihn bei einer Aufführung von Romeo und Julia auf die Lippen küssen, und so etwas vergisst man nicht so leicht.«
Berry hatte die Erinnerung verdrängt. Nun erinnerte er sich, und er war froh, dass es zu kalt war, um zu erröten.
»Er konnte großartig deklamieren«, fuhr Ran fort, der bitteren Kälte anscheinend ungeachtet. »Ich wurde nur genommen, weil ich richtig lange Haare hatte. Nun, nun. Wie geht es dir, du alter Theopisjünger?«
»Oh, absolut gut«, sagte Berry. »Eh – könntest du deinen Wagen vielleicht wegfahren? Er blockiert die Straße ziemlich.«
»Es muss zehn Jahre her sein, mindestens«, sagte Ran.
»Ja.« Berry hatte das dumpfe Gefühl, dass ihm die Unterhaltung langsam entglitt. »Wenn du mich durchlassen könntest …«
»Lass den Mann durch«, sagte Roger. »Und ich will auch nach Hause – Rose wird sich schon Sorgen machen.«
»Ich habe eine Tochter«, verkündete Ran. »Ihr Name ist Linnet. Sie ist fünf. Hast du schon Kinder?«
»Noch nicht. Ich heirate erst nächsten Sommer.« Wie absurd, dachte Berry, hier draußen Smalltalk zu betreiben.
»Schaff dir viele Kinder an«, sagte Ran. »Sie sind das Einzige, was dem Leben einen Sinn gibt.« Er blickte auf den Fasan hinab, der leblos auf dem kalten Boden lag. »Meine Linnet hätte diesen Vogel geliebt. Sie liebt alle Lebewesen. Ich schenke ihr ein Meerschweinchen.«
»Rose wird durchdrehen«, prophezeite Roger. »Sei nicht überrascht, wenn sie es kocht.«
Ran betrachtete den toten Fasan mit nachdenklichem Bedauern. Er schien, trotz der Kälte, eine tränenvolle Begräbnisrede anstimmen zu wollen.
»Wir haben ihn überfahren. Ich sagte Roger, er sollte bremsen, aber ich konnte nichts tun. Es war zu spät.«
Ran war schon in der Schule dafür berühmt gewesen, wie er tränenüberströmt aus Prüfungen und Gottesdiensten herausgeführt wurde. Er sah hilflos zu und wünschte, er brächte den Mut auf, erneut das Auto zu erwähnen. Polly würde warten, und ihre Mahlzeiten verdarben leicht.
»Seine Freundin hat ihn verlassen«, erklärte Roger.
»Oh.«
»Komm schon, Franziskus. Gehen wir zurück nach Assisi.«
»Ich muss diesem Geist folgen«, sagte Ran. »Er verweilt noch.«
Der Fasan erwachte plötzlich ruckartig wieder zum Leben. Er erhob sich mit großartigem Flügelschlag vom Boden und flatterte Berry trunken ins Gesicht. Berrys handgenähte Ledersohlen glitten auf Klumpen gefrorener Erde aus.
Die nächsten wenigen Sekunden vergingen wie in Zeitlupe. Berry verspürte einen Moment der stillen, einsamen Verzweiflung, bevor er vorwärts stürzte. Er sah den schwarzen Teich sehr rasch, aber in jeder Einzelheit, auf sich zu rauschen. Er krachte durch eine Eisschicht in zwei Fuß eiskaltes Wasser. Frostige Messerklingen schnitten durch seine Kleidung. Der Donnerschlag der Kälte ließ Berrys gequälten Schrei verstummen.
Die aufkommende Verlegenheit trug noch zum Entsetzen bei. Berry kämpfte sich hoch und zog dabei klebrige Unkrautranken mit sich. Es gelang ihm, Rogers ausgestreckte Hand zu ergreifen, und er stolperte wieder ans Ufer. Seine Brille war schlammbespritzt. Er nahm sie, nach Atem ringend, ab und griff automatisch in seiner nassen Tasche nach einem Taschentuch.
»Hier.« Roger reichte ihm ein Papiertaschentuch.
»D-danke …«
»Sind Sie in Ordnung?«
»Ich denke schon …«
»Ich habe ihn nicht getötet«, jubelte Ran. Er deutete auf den Fasan, der in die Büsche hastete. »Es klebt kein Blut an meinen Händen.«
In diesem Moment erkannte Berry, während ihm der Magen in die Knie sank, dass er seine Autoschlüssel nicht mehr in der Hand hielt.
»Ich habe meine Schlüssel verloren!«, krächzte er. »O Gott im Himmel!«
Nicht dass er irgendwie Angst vor Polly hätte, aber sie würde ihn dafür umbringen. Und – Gott! Gott! – die Telefonnummer des Farmhauses war im Kofferraum eingeschlossen! Bis er in sein Auto gelangte, konnte er Polly nicht anrufen, um sie wissen zu lassen, dass er nicht tot war.
Er stand stöhnend am Ufer und zitterte heftig. Roger rollte seine Ärmel hoch, legte sich auf den Boden und tastete in dem eisigen Wasser umher. Ran streifte seine gefütterte Jacke ab, drapierte sie um Berrys Schulter und schob sich neben Roger. Die beiden plantschten im Wasser umher und fluchten. Roger schnitt sich an einer zerbrochenen Flasche in den Finger. Berry kämpfte gegen das betäubende Gefühl zunehmender Irrealität an. Wie, um alles in der Welt, war er in diese grässliche Situation geraten?
Ein weiteres Auto kam auf der Straße heran. Sie hörten es hinter dem Volvo scharf bremsen. Ein ärgerliches Hupen erklang.
»Großartig«, murmelte Roger.
Eine Autotür schlug zu. Ein großer Mann trat in das silberne Licht der Scheinwerfer. Er sah Ran und fauchte: »Ich hätte es wissen müssen. Was geht hier vor?«
Er sah sehr gut aus, auf grimmige, alttestamentarische Art. Er hörte den wirren Erklärungen schweigend zu. Ran stellte ihn als Edward Reculver vor. Er runzelte die Stirn, als er Berrys Hand ergriff.
»Sie sind ziemlich lädiert«, sagte er. »Wo wohnen Sie?«
»Ich weiß nicht … ungefähr zwanzig Meilen weiter …«
»Wir sollten Sie besser nach Melismate bringen.«
»Ich k-kann meinen Wagen nicht zurücklassen …«
»Machen Sie sich darum keine Sorgen. Ich komme mit einem Netz zurück und suche den Teich richtig ab. Er ist nicht tief.«
Berry war sich durch seinen zitternden Veitstanz hindurch der Tatsache bewusst, dass Reculver einigen gesunden Menschenverstand in diesen Albtraum einbrachte. Die Tür des BMW war unverschlossen. Reculver stieg ein, löste die Handbremse und befahl Ran und Roger, ihn von der Straße zu schieben.
»Ich fürchte, wir können ihn im Volvo nicht mitnehmen«, sagte Roger. »Die Rückbank ist voller Holzscheite.«
Reculver fragte: »Ist euch das Heizöl ausgegangen? Das hättet ihr mir sagen sollen. Ich nehme Berowne mit.« Er hatte sich Berrys Namen bereits gemerkt.
Berry hatte allen Antrieb verloren. Reculver musste ihn fast auf den Beifahrersitz seines Landrovers heben. Darinnen war es herrlich warm. Seine Ohren fühlten sich an, als wären sie am Kopf angenagelt. Reculver kletterte ins Auto, und sie brausten davon.
Berry schaute zur Seite, auf sein unerbittliches, rechtschaffenes Profil. Reculver sah jünger aus, als er zunächst angenommen hatte. »Das ist wirklich nett von Ihnen.«
»Schon gut«, sagte Reculver.
»W-wohin sagten Sie, wollen Sie mich bringen?«
»Nach Melismate. Das alte Herrenhaus, in dem Roger lebt. Nur ein paar Meilen entfernt.«