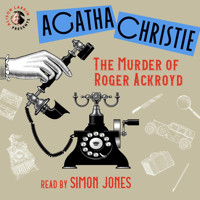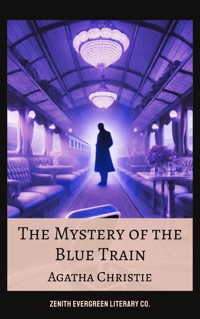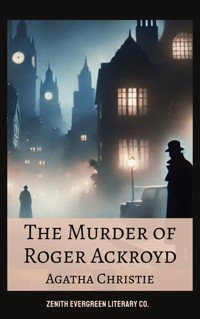9,99 €
Mehr erfahren.
In der Hoffnung auf ein ruhigeres Leben, hat sich der junge Jerry Burton mit seiner Schwester im idyllischen Städtchen Lymstock niedergelassen. Doch in kürzester Zeit verwandelt sich der Ort zum Schauplatz einer Reihe von Intrigen. Was mit anonymen Hassbriefen beginnt, gipfelt im Selbstmord einer Bewohnerin. Miss Marple ist zur Stelle, um den Geheimnissen von Lymstock auf die Spur zu kommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Agatha Christie
Die Schattenhand
Ein Fall für Miss Marple
Aus dem Englischen von Sabine Roth
Atlantik
Meinen Freunden
Sydney und Mary Smith
Erstes Kapitel
I
Als ich den Gips endlich los war und die Ärzte mich nach allen Regeln der Kunst zurechtgebogen hatten und ich unter gutem Zureden der Schwestern zaghaft begann, meine Gliedmaßen wieder zu gebrauchen, und die Babysprache, mit der sie mich traktierten, mir gründlich zum Hals heraushing, verordnete Marcus Kent mir eine Dosis Landleben.
»Gute Luft, Beschaulichkeit, Faulenzen – das ist das beste Rezept für Sie. Ihre Schwester soll sich um Sie kümmern. Essen Sie, schlafen Sie und frönen Sie ansonsten dem Stumpfsinn.«
Ich fragte ihn nicht, ob ich je wieder imstande sein würde zu fliegen. Manche Fragen stellt man nicht, aus Angst vor der Antwort. So hatte ich mich während der vergangenen fünf Monate auch gehütet zu fragen, ob ich den Rest meines Lebens ans Bett gefesselt bleiben würde. Ich fürchtete die heuchlerisch-muntere Schelte der Krankenschwester: »Nein wirklich, wie reden Sie denn! So etwas wollen wir gar nicht hören!«
Also hatte ich nicht gefragt – und Glück gehabt. Ich würde kein hilfloser Krüppel sein. Ich konnte meine Beine bewegen, auf ihnen stehen, schließlich sogar ein paar Schritte wagen, und wenn ich mir dabei wie ein Kleinkind bei den ersten abenteuerlichen Gehversuchen vorkam, mit schlackernden Knien und Fußsohlen, die sich anfühlten wie aus Watte – nun, das war Schwäche und mangelnde Übung und würde nicht ewig dauern.
Marcus Kent, der ein guter Arzt ist, gab mir die Antwort auch so.
»Sie werden wieder völlig gesund«, sagte er. »Bis zur Abschlussuntersuchung am Dienstag waren wir etwas im Zweifel, aber jetzt kann ich es mit Gewissheit sagen. Allerdings wird es eine langwierige Geschichte. Langwierig und, das sage ich Ihnen gleich, mühselig. Bei verletzten Nerven und Muskeln muss das Gehirn dem Körper nachhelfen. Nichts ist so schädlich wie Ungeduld und Aufregung. Und glauben Sie ja nicht, es sei ›alles nur eine Frage der Willenskraft‹. Dann landen Sie sofort wieder im Sanatorium. Sie müssen das Leben langsam und locker angehen, Adagio sozusagen. Nicht nur Ihr Körper muss zu Kräften kommen, die vielen Medikamente, die wir Ihnen geben mussten, haben auch Ihre Nerven geschwächt. Deshalb mein Rat: Gehen Sie aufs Land, mieten Sie ein Haus, nehmen Sie Anteil an der Lokalpolitik, an Klatsch und Tratsch und Dorfskandalen. Stecken Sie die Nase in die Angelegenheiten Ihrer Nachbarn. Und wenn ich Ihnen noch eine Empfehlung geben darf: Suchen Sie sich eine Gegend, wo Sie keine Bekannten in der Nähe haben.«
Ich nickte. »Das«, sagte ich, »hatte ich sowieso vor.«
Nichts schien mir unerträglicher als die Vorstellung, dass meine alten Freunde vorbeischauen könnten, überquellend von Mitleid und ihren eigenen Geschichten.
»Du siehst großartig aus, Jerry – sieht er nicht großartig aus? Phantastisch. Jerry, du glaubst nicht, was Buster sich wieder geleistet hat …«
Ohne mich. Hunde sind weise. Sie verziehen sich in eine stille Ecke, um ihre Wunden zu lecken, und kehren erst ins Leben zurück, wenn sie wiederhergestellt sind.
So kam es, dass Joanna und ich aus der Fülle von »Objekten« überall auf den Britischen Inseln, die die Makler in so glühenden Farben priesen, auch Little Moor bei Lymstock zur Besichtigung auswählten – hauptsächlich deshalb, weil wir nie in Lymstock gewesen waren und niemanden dort kannten.
Und als Joanna Little Moor sah, wusste sie auf der Stelle, dass es das Richtige für uns war.
Es lag etwa eine halbe Meile oberhalb von Lymstock, an der Straße, die ins Moor hinaufführte – ein adrettes Häuschen, niedrig und weiß, mit einer schräg überdachten, blassgrünen viktorianischen Veranda und einem hübschen Blick auf sacht abfallendes Heideland, an dessen linkem unterem Rand der Kirchturm von Lymstock ins Bild ragte.
Little Moor hatte einer Familie von »Fräuleins« gehört, den Misses Barton, von denen nur noch eine übrig war, die jüngste, Miss Emily.
Miss Emily Barton war eine reizende kleine alte Dame, die bestens zu ihrem Haus passte. Mit leiser, entschuldigender Stimme erklärte sie Joanna, sie habe Little Moor noch nie vermietet, ja, nicht einmal im Traum daran gedacht, »aber wissen Sie, meine Liebe, es ist alles so anders als früher – die Steuern, und dann meine Aktien und Wertpapiere, ich habe sie immer für etwas so Sicheres gehalten, ein paar davon hat mir sogar der Bankdirektor persönlich empfohlen, aber sie scheinen heutzutage rein gar keinen Gewinn abzuwerfen – alles ausländisch natürlich! Das macht die Lage so schwierig. Sie verstehen mich doch hoffentlich recht, meine Liebe, und sind nicht beleidigt – Sie haben so ein liebes Gesicht! –, aber es ist keine schöne Vorstellung, sein Haus an fremde Leute zu vermieten – nur, so wie bisher konnte es nicht weitergehen, und jetzt, wo ich Sie gesehen habe, bin ich richtig froh, dass Sie hier wohnen werden – das Haus braucht junges Blut, wissen Sie. Und ich muss zugeben, bei dem Gedanken, einen Mann hier zu haben, war mir nie ganz wohl!«
Hier musste Joanna ihr beibringen, dass es mich gab. Miss Emily trug es wacker.
»Ojemine. Wie traurig! Beim Fliegen, sagen Sie? Diese tapferen jungen Männer. Ja, wenn Ihr Bruder praktisch ein Invalide ist …«
Der Umstand schien die zarte kleine Dame zu trösten. Ein Invalide konnte sich unmöglich all jenen männlichen Unsitten ergeben, die Miss Emily Bange machten. Zaghaft erkundigte sie sich, ob ich rauchte.
»Wie ein Schlot«, sagte Joanna. »Aber«, fügte sie hinzu, »das tu ich auch.«
»Oh, sicher. Wie dumm von mir. Es tut mir leid, aber ich glaube, ich bin nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Meine Schwestern waren alle älter als ich, und meine liebe Mutter ist siebenundneunzig geworden – stellen Sie sich das vor! – und war recht eigen. Natürlich, heutzutage rauchen ja alle. Das Dumme ist nur, es gibt überhaupt keine Aschenbecher im Haus.«
Joanna versprach, dass wir jede Menge Aschenbecher mitbringen würden, und setzte mit einem Lächeln hinzu: »Keine Angst, wir drücken unsere Zigaretten nicht auf Ihren schönen Möbeln aus. Ich könnte aus der Haut fahren, wenn jemand das tut.«
So wurde der Handel geschlossen; wir mieteten Little Moor für sechs Monate, mit Option auf weitere drei, und Emily Barton versicherte Joanna, sie selbst werde bestens versorgt sein, denn sie werde Zimmer bei ihrem ehemaligen Stubenmädchen beziehen, »meiner treuen Florence«, die geheiratet hatte, »nach fünfzehn Jahren bei uns. So ein nettes Mädchen, und ihr Mann ist im Baugeschäft. Sie haben ein allerliebstes Häuschen in der High Street mit zwei wunderschönen Zimmern im Obergeschoss, wo ich es sehr, sehr gemütlich haben werde. Florence freut sich schon so, dass ich komme.«
Damit schien alles zur allseitigen Zufriedenheit geregelt, der Vertrag wurde unterzeichnet, und wenig später zogen Joanna und ich ein und fanden uns in guten Händen, denn Miss Emily Bartons Haushälterin Partridge hatte sich bereit erklärt zu bleiben, unterstützt durch eine »Hilfe«, die jeden Morgen kam und beschränkt schien, aber freundlich.
Partridge, eine hagere, sauertöpfische Frauensperson mittleren Alters, kochte ausgezeichnet, und obschon sie spätes Dinieren missbilligte (Miss Emily hatte stets nur ein leichtes Nachtmahl in Form eines weichen Eis zu sich genommen), fügte sie sich in unsere Gepflogenheiten und ging sogar so weit einzuräumen, dass ich ein wenig Aufpäppeln bitter nötig hätte.
Als wir uns in Little Moor eingerichtet hatten und die erste Woche hinter uns lag, sprach mit feierlicher Miene Miss Emily Barton vor und hinterließ ihre Visitenkarte. Ihrem Beispiel folgten Mrs Symmington, die Gattin des Anwalts, Miss Griffith, die Schwester des Arztes, Mrs Dane Calthrop, die Pfarrersfrau, und Mr Pye von Prior’s End.
Joanna war beeindruckt.
»Ich wusste gar nicht«, sagte sie voller Ehrfurcht, »dass es wirklich Leute gibt, die Visitenkarten abgeben.«
»Das kommt daher«, erwiderte ich, »dass du keine Ahnung vom Landleben hast, mein Kind.«
»Unsinn. Ich hab doch hundertmal Leute in ihren Wochenendhäusern besucht.«
»Das ist etwas anderes«, sagte ich.
Ich bin fünf Jahre älter als Joanna. Ich kann mich noch an das große, heruntergekommene, unordentliche weiße Haus erinnern, in dem wir wohnten, als ich klein war, an die Felder, die sich bis zum Fluss hinzogen. Ich weiß noch, wie ich unter die Himbeernetze kroch, wenn der Gärtner nicht hinschaute, und wie der weiße Staub im Hof vor dem Stall roch; ich sehe die rote Katze vor mir, die über den Hof spazierte, und höre das Poltern der Pferdehufe in den Boxen.
Aber als ich sieben war und Joanna zwei, kamen wir nach London zu einer Tante, und von da an verbrachten wir die Weihnachts- und Osterferien in der Stadt, mit Theater- und Kinobesuchen, Bootsfahrten in Kensington Gardens und später Ausflügen auf die Rollschuhbahn. Im August ging es in ein Hotel irgendwo am Meer.
Das hielt ich mir vor Augen, und dann sagte ich zu Joanna, nachdenklich, voll schlechten Gewissens, dass aus mir ein so selbstsüchtiger, ichbezogener Krüppel geworden war: »Du wirst es hier wahrscheinlich grässlich finden. Dir wird London so abgehen.«
Denn Joanna ist sehr hübsch und sehr lebhaft und geht gern tanzen und mag Cocktails und Flirts und schnelle Autos.
Joanna lachte und sagte, dass es ihr überhaupt nichts ausmache.
»Im Gegenteil, ich bin sogar ganz froh, da mal rauszukommen. Die alte Clique ging mir langsam auf die Nerven, und auch wenn ich weiß, dass ich von dir kein Mitgefühl zu erwarten habe – die Sache mit Paul setzt mir wirklich ziemlich zu. Es wird eine Weile dauern, bis ich darüber weg bin.«
Da hatte ich meine Zweifel. Joannas Liebesgeschichten verlaufen immer nach dem gleichen Muster. Sie verliebt sich bis über beide Ohren in einen rückgratlosen Jüngling, der ein verkanntes Genie ist. Sie lauscht seinem endlosen Gejammer und setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um ihm Anerkennung zu verschaffen. Wenn er sich dann undankbar zeigt, ist sie tief getroffen und behauptet, ihr Herz sei gebrochen – bis der nächste umwölkte Jüngling des Weges kommt, was in der Regel drei Wochen später der Fall ist.
Also nahm ich Joannas gebrochenes Herz nicht weiter tragisch. Aber mir wurde klar, dass das Landleben meiner attraktiven Schwester als ein neues Spiel erschien.
»Immerhin«, sagte sie, »bin ich schon mal richtig angezogen.«
Ich musterte sie kritisch und konnte ihre Ansicht nicht teilen.
Joanna war für le Sport ausstaffiert, und zwar von Mirotin. Das soll heißen, dass ihr Rock nicht nur hauteng war, sondern außerdem ein schockierendes, groteskes Karomuster hatte. Obenherum trug sie ein lächerliches kurzärmliges Tirolerjäckchen und zu all dem durchsichtige Seidenstrümpfe und Golfschuhe, die zwar wunderbar robust waren, aber nagelneu.
»Nein«, sagte ich, »du bist völlig falsch angezogen. Du solltest einen uralten Tweedrock tragen, möglichst in Schlammgrün oder einem verschossenen Braun. Dazu einen schönen warmen Kaschmirpullover in derselben Farbe, vielleicht noch mit einer dicken Jacke darüber, einen Filzhut, grobe Strümpfe und alte Schuhe. Dann, und nur dann, würdest du hier in Lymstock ins Bild passen, statt herauszustechen, wie du es im Moment tust.« Ich fügte hinzu: »Und dein Gesicht passt auch nicht.«
»Was gibt es an meinem Gesicht auszusetzen? Ich habe extra Landfrische Nummer zwei aufgelegt.«
»Eben«, sagte ich. »Wenn du von hier wärst, würdest du dir nur ein bisschen die Nase pudern, damit sie nicht so glänzt, und vielleicht noch ein klein wenig Lippenstift auftragen – nicht besonders gekonnt –, und unter Garantie hättest du deine ganzen Augenbrauen und nicht nur ein Viertel davon.«
Joanna prustete; sie schien höchst erheitert.
»Meinst du, sie werden mich schrecklich finden?«, fragte sie.
»Nein«, sagte ich. »Nur sonderbar.«
Sie wandte sich wieder den Karten zu, die unsere Besucher dagelassen hatten. Einzig die Pfarrersfrau hatte das Glück – oder möglicherweise das Pech – gehabt, Joanna daheim anzutreffen.
»Fast wie Familienquartett, findest du nicht?«, meinte Joanna. »Frau Recht, die Richtersgattin, Fräulein Dosis, die Doktorstochter, und so weiter.« Und ganz erfüllt fuhr sie fort: »Es ist wirklich ein nettes Städtchen, Jerry! So rührend und drollig und altmodisch. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass hier irgendetwas Böses passiert, du?«
Und obwohl ich wusste, dass es eigentlich Unsinn war, stimmte ich zu. In einem Städtchen wie Lymstock konnte nichts Böses passieren. Seltsam zu denken, dass nur eine Woche später der erste Brief eintraf.
II
Ich merke, dass ich falsch angefangen habe. Ich habe Lymstock selbst nicht beschrieben, und ohne ein Bild von Lymstock ist meine Geschichte nicht zu verstehen.
Lymstock, das vielleicht als Erstes, war einmal ein Ort von Bedeutung. Seine große Zeit liegt weit zurück, in den Tagen Wilhelms des Eroberers, und sein Glanz war vorwiegend geistlicher Art. Es gab ein Kloster hier, Sitz einer langen Reihe ehrgeiziger und einflussreicher Priore. Die Lords und Barone in der Umgegend suchten sich mit dem Himmel günstig zu stellen, indem sie Teile ihrer Ländereien dem Kloster vermachten. Das Kloster von Lymstock gewann an Reichtum und Geltung, und mehrere Jahrhunderte lang war es mächtig im ganzen Land. Unter Heinrich VIII. jedoch erlitt es das Schicksal aller Klöster, und von da an beherrschte eine Burg Lymstock. Die Stadt war immer noch angesehen. Sie genoss Privilegien und Wohlstand.
Und dann, irgendwann im achtzehnten Jahrhundert, schwemmte die Flut des Fortschritts Lymstock ins Abseits. Die Burg verfiel. Weder Bahngleise noch größere Straßen kamen in die Nähe von Lymstock. Es wurde zu einem Provinznest, einem unbedeutenden, in Vergessenheit geratenen Marktflecken inmitten von friedvollen Bauernhöfen und Äckern, oberhalb derer das Hochmoor begann.
Jede Woche war Markt, dann begegneten einem auf allen Wegen und Straßen Schafe. Zweimal jährlich fand ein kleines Pferderennen statt, bei dem nur Pferde zwielichtigster Abstammung an den Start gingen. Die hübsche High Street war mit ehrwürdigen Häusern gesäumt, die alle ein Stück von der Straße zurückgesetzt standen, sodass die Brötchen oder das Obst und Gemüse in den Erdgeschossfenstern leicht deplatziert wirkten. Es gab ein Stoffgeschäft, lang gestreckt und mit vielen Anbauten, eine große, bedrohlich anmutende Eisenwarenhandlung, ein protziges Postamt, dazu eine Reihe bescheidener Läden ungewisser Ausrichtung, zwei miteinander konkurrierende Metzgereien und einen Lebensmittelladen. Es gab außerdem einen Arzt, eine Anwaltskanzlei, Messrs Galbraith, Galbraith & Symmington, eine schöne und unerwartet große Kirche aus dem Jahr 1420 mit ein paar Überbleibseln aus sächsischer Zeit, eine neue, potthässliche Schule sowie zwei Wirtshäuser.
Das war Lymstock, und angeführt von Emily Barton machten uns alle, die irgendetwas darstellten, ihre Aufwartung; und nach angemessener Frist zog Joanna mit einem Paar eigens zu diesem Zweck angeschaffter Handschuhe und einem abgetragenen Samtbarett aus, um die Besuche zu erwidern.
Für uns war all dies neu und unterhaltsam. Wir würden nicht bis ans Ende unserer Tage hierbleiben. Es war ein Intermezzo. Ich gedachte dem Rat meines Arztes zu folgen und meine Nase in die Angelegenheiten meiner Nachbarn zu stecken.
Joanna und ich hatten unseren Spaß daran.
Irgendwo im Hinterkopf hatte ich sicher auch Marcus Kents Bemerkung über die Dorfskandale. Aber ich ahnte nicht, auf welche Weise diese Skandale sich Einlass in mein Leben verschaffen sollten.
Das Merkwürdige ist, dass der Brief uns zunächst in erster Linie amüsierte.
Wir saßen beim Frühstück, als er kam, das weiß ich noch. Ich drehte ihn um, mit der müßigen Neugier eines Menschen, für den die Zeit langsam vergeht und der jedes Ereignis zur Gänze ausschöpfen muss. Er kam aus dem Ort, stellte ich fest, die Adresse war maschinengeschrieben.
Ich öffnete ihn vor den beiden Umschlägen mit Londoner Poststempel, da der erste eine Rechnung enthielt und der zweite den Brief einer nicht gerade spritzigen Kusine.
Zum Vorschein kam ein einzelnes Blatt Papier, beklebt mit Wörtern und Buchstaben, die aus einem Buch ausgeschnitten worden sein mussten. Ein, zwei Minuten starrte ich auf die Worte, ohne ihren Sinn zu begreifen. Dann entfuhr mir ein Laut der Bestürzung.
Joanna, die stirnrunzelnd Rechnungen studierte, sah auf.
»Hoppla«, sagte sie. »Was ist denn? Du schaust ja völlig verschreckt.«
Der Brief war mit Obszönitäten gespickt und verlieh der Meinung Ausdruck, dass Joanna und ich nicht Bruder und Schwester seien.
»Es ist ein anonymer Brief«, sagte ich, »und zwar ein ziemlich widerwärtiger.«
Ich stand noch unter Schock. Es war nicht ganz das, womit man in einem beschaulichen Städtchen wie Lymstock rechnete.
Joanna war sofort Feuer und Flamme.
»Nein! Was steht denn drin?«
In Romanen, ist mir aufgefallen, werden anonyme Briefe vulgären oder abstoßenden Inhalts nach Möglichkeit vor dem weiblichen Geschlecht verborgen gehalten. Frauen haben offenbar ein zu zartes Nervenkostüm, als dass ihnen dergleichen zugemutet werden könnte.
Leider muss ich gestehen, dass es mir keine Sekunde in den Sinn kam, Joanna den Brief vorzuenthalten. Ich händigte ihn ihr unverzüglich aus.
Mein Vertrauen in ihre Robustheit erwies sich als gerechtfertigt, denn ihre einzige Gemütsregung war Belustigung.
»Was für ein ekliges Geschreibsel! Ich habe oft von anonymen Briefen gehört, aber gesehen habe ich noch nie einen. Sind sie immer so?«
»Das darfst du mich nicht fragen«, sagte ich. »Ich bin genauso unerfahren wie du.«
Joanna kicherte.
»Du hattest wohl doch recht mit meinem Make-up, Jerry. Sie denken sicher, ich kann gar nichts anderes sein als verrucht.«
»Erstens das«, sagte ich, »und dann die Tatsache, dass unser Vater ein großer dunkelhaariger Mann mit knochigem Gesicht war und unsere Mutter ein blondes blauäugiges kleines Ding, und dass ich ihm nachschlage und du ihr.«
Joanna nickte gedankenvoll.
»Stimmt, wir sehen uns kein bisschen ähnlich. Niemand würde uns für Bruder und Schwester halten.«
»Offensichtlich«, sagte ich mit Verve.
Joanna sagte, dass es doch furchtbar komisch sei.
Sie ließ den Brief zwischen zwei Fingern baumeln und fragte, was wir damit tun sollten.
»Die korrekte Vorgehensweise, wenn ich richtig informiert bin«, sagte ich, »wäre, ihn mit einem schrillen Schrei der Empörung ins Feuer zu werfen.«
Ich ließ den Worten die Tat folgen, und Joanna klatschte Beifall.
»Das hast du großartig gemacht! Absolut bühnenreif. Ein Glück, dass wir noch Kaminfeuer haben, findest du nicht?«
»Der Papierkorb wäre längst nicht so dramatisch gewesen«, stimmte ich zu. »Natürlich hätte ich den Brief auch mit einem Streichholz anzünden und ihm langsam beim Verbrennen zusehen können – oder muss es heißen, zusehen, wie er langsam verbrennt?«
»Wenn etwas brennen soll, brennt es doch nie«, sagte Joanna. »Es geht aus. Du hättest wahrscheinlich ein Streichholz nach dem anderen anzünden müssen.«
Sie stand auf und stellte sich ans Fenster. Dann wandte sie mit einem Ruck den Kopf.
»Was meinst du, wer das geschrieben hat?«, fragte sie.
»Das werden wir vermutlich nie erfahren.«
»Nein – wahrscheinlich nicht.« Sie schwieg einen Moment, dann sagte sie: »Wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich gar nicht, ob ich es wirklich so komisch finde. Ich – ich hatte gedacht, die Leute hier mögen uns.«
»Tun sie ja auch«, sagte ich. »Das hat doch eindeutig ein Spinner geschrieben.«
»Wahrscheinlich. Puh – widerlich!«
Sie ging hinaus in den Sonnenschein, und ich rauchte meine Verdauungszigarette und dachte mir dabei, dass sie völlig recht hatte. Es war widerlich. Jemand stieß sich an unserem Hiersein – jemand stieß sich an Joannas frischer, junger, mondäner Schönheit – jemand wollte uns treffen. Darüber zu lachen, war vielleicht die beste Reaktion – aber im Grunde war es nicht komisch …
An diesem Vormittag kam Dr. Griffith. Ich hatte mit ihm vereinbart, dass er mich einmal wöchentlich untersuchte. Ich mochte Owen Griffith. Er war brünett und unbeholfen, mit linkischen Bewegungen, aber geschickten, außerordentlich sanften Händen. Er sprach immer etwas abgehackt, und er war schüchtern.
Meine Fortschritte, so meldete er, seien zufriedenstellend. Dann fragte er: »Sie fühlen sich doch gut? Vielleicht bilde ich es mir ja nur ein, aber Sie kommen mir heute Morgen ein bisschen angeschlagen vor.«
»Nichts Schlimmes«, sagte ich. »Wir haben nur einen sehr unflätigen anonymen Brief zum Frühstück bekommen, von dem habe ich noch einen schlechten Geschmack im Mund.«
Er ließ seine Tasche auf den Boden fallen. Sein schmales dunkles Gesicht verriet Erregung.
»Heißt das, Sie haben auch einen erhalten?«
Mein Interesse war geweckt.
»Sie gehen also um?«
»Ja. Seit einer Weile schon.«
»Ach«, sagte ich. »Ich verstehe. Ich hatte angenommen, es richtet sich gegen uns als Fremde.«
»Nein, nein, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Es ist nur …« Er stockte und fragte dann: »Was stand darin? Wenigstens …« Er brach ab, plötzlich rot und verlegen. »Vielleicht sollte ich besser nicht fragen?«
»Ich sage es Ihnen mit dem größten Vergnügen«, erwiderte ich. »In dem Brief stand, das angemalte Flittchen, das ich hier angeschleppt hätte, sei nicht meine Schwester – wen ich denn damit für dumm verkaufen wolle? Das ist eine bereinigte Version, sollte ich hinzufügen.«
Er lief rot an vor Zorn.
»Wie abscheulich! Ihre Schwester hat aber doch nicht – sie nimmt es sich hoffentlich nicht zu sehr zu Herzen?«
»Joanna«, sagte ich, »sieht vielleicht aus wie ein Rauschgoldengel, aber sie ist durch und durch modern und ziemlich hart im Nehmen. Sie findet die Sache höchst unterhaltsam. Es ist etwas ganz Neues für sie.«
»Das will ich hoffen«, erklärte Griffith mit Nachdruck.
»Wie auch immer«, sagte ich fest. »Ich glaube, das ist die gesündeste Einstellung. Es als etwas völlig Lächerliches abtun.«
»Ja«, sagte Owen Griffith. »Nur …«
»Genau«, sagte ich. »›Nur‹ ist das Wort.«
»Das Problem ist«, sagte er, »wenn so etwas einmal angefangen hat, zieht es immer weitere Kreise.«
»Das kann ich mir vorstellen.«
»Es ist natürlich krankhaft.«
Ich nickte. »Haben Sie eine Ahnung, wer dahintersteckt?«, erkundigte ich mich.
»Nein – leider. Wissen Sie, es gibt zwei Arten von anonymen Briefen. Entweder sie sind gezielt, das heißt, sie richten sich an eine bestimmte Person oder einen bestimmten Personenkreis, dann existiert ein Motiv, jemand hat eine Rechnung zu begleichen (oder glaubt das zumindest) und wählt dazu einen besonders hässlichen und heimtückischen Weg. Gemein und ekelhaft, aber nicht unbedingt verrückt, und in der Regel lässt sich der Urheber relativ leicht ermitteln – ein entlassener Dienstbote, eine eifersüchtige Frau, etwas in der Art. Aber wenn es allgemein ist und nicht gezielt, dann ist der Fall ernster. Die Briefe werden wahllos verschickt, der Absender will damit irgendwelchen Hassgefühlen Luft machen. Wie gesagt, es ist entschieden krankhaft. Und der Wahn verstärkt sich. Irgendwann kommt man dem Schuldigen natürlich auf die Schliche – in der Regel ist es jemand, den keiner auf der Rechnung hatte –, und der Spuk ist vorbei. Wir hatten gerade letztes Jahr so eine Geschichte auf der anderen Seite der Grafschaft – da war es die Leiterin der Kurzwarenabteilung in einem großen Stoffgeschäft. Eine ruhige, kultivierte Frau – hatte schon Jahre dort gearbeitet. In meiner letzten Praxis oben in Nordengland gab es auch einen Fall – aber der stellte sich als persönliche Rache heraus. Trotzdem, ich habe genug gesehen, dass so etwas mir Angst macht!«
»Geht das schon lange so?«, fragte ich.
»Wohl nicht. Aber das ist schwer zu sagen – Leute, die solche Briefe erhalten, hängen es meist nicht an die große Glocke. Sie verbrennen sie.«
Er machte eine Pause.
»Ich habe einen bekommen. Symmington, der Anwalt, hatte einen. Und von einem oder zwei meiner ärmeren Patienten habe ich es auch gehört.«
»Alle in diesem Stil?«
»O ja. Der Tenor ist immer der Gleiche. Ein entschiedener Hang zum Erotischen.« Er grinste. »Symmington wurden unzulässige Beziehungen zu seiner Sekretärin unterstellt – der armen, alten Miss Ginch. Sie ist mindestens vierzig und trägt einen Kneifer, und Hasenzähne hat sie auch. Symmington ist mit dem Brief geradewegs zur Polizei gegangen. Mir wird vorgeworfen, ich würde mit meinen Patientinnen gegen die guten Sitten meines Berufs verstoßen, unter genauer Angabe von Details. Alles kindisch und absurd, aber extrem gehässig.« Sein Ausdruck wurde düster. »Wie gesagt, es macht mir Angst. Solche Dinge können eskalieren.«
»Möglich, ja.«
»Verstehen Sie«, sagte er, »so plump und kindisch die Briefe auch sind, früher oder später wird einer ins Schwarze treffen. Und weiß Gott, was dann passiert! Die Frage ist auch, wie geht ein primitives, schwerfälliges, misstrauisches Hirn mit so etwas um? Was schwarz auf weiß zu lesen steht, ist für viele Leute wahr. Daraus können alle möglichen Komplikationen erwachsen.«
»Es war ein sehr ungebildeter Brief«, sagte ich nachdenklich. »Verfasst von jemand extrem Ungebildetem, meine ich.«
»Ja?«, fragte Owen und ging seiner Wege.
Ein »Ja?«, das ich, als ich später darüber nachsann, recht verstörend fand.
Zweites Kapitel
I
Ich will nicht leugnen, dass unser anonymer Brief einen üblen Nachgeschmack hinterließ. Das auf jeden Fall. Dennoch beschäftigte er mich nicht lange. Ich nahm ihn zu diesem Zeitpunkt einfach nicht ernst. Ich weiß noch, wie ich bei mir dachte, dass dergleichen in abgelegenen Dörfern wahrscheinlich nicht selten vorkam. Im Zweifel steckte irgendeine Hysterikerin mit theatralischen Anwandlungen dahinter. Und wenn die Briefe alle so kindisch und albern waren wie der an uns, würden sie schwerlich Schaden anrichten.
Der nächste Zwischenfall, wenn ich es so nennen darf, ereignete sich eine Woche später, als Partridge mich mit zusammengekniffenen Lippen davon in Kenntnis setzte, dass Beatrice, die Haushaltshilfe, an diesem Tag nicht zur Arbeit kommen würde.
»Anscheinend, Sir«, meldete Partridge, »ist dem Mädel was aufs Gemüt geschlagen.«
Ich war mir nicht ganz sicher, was Partridge mit Gemüt meinte, schloss aber (fälschlicherweise) auf eine Magen-DarmVerstimmung, die unverblümter zu benennen Partridge zu vornehm war. Ich sagte, dass mir das leid tue und dass ich hoffe, sie sei bald wieder wohlauf.
»Dem Mädel fehlt nichts, Sir«, sagte Partridge. »Ihre Gefühle sind verletzt.«
»Oh«, sagte ich unschlüssig.
»Wegen einem Brief«, fuhr Partridge fort, »den sie gekriegt hat. Und der wohl ANDEUTUNGEN macht.«
Ihr grimmiger Blick im Verbund mit den unüberhörbaren Kapitälchen des Wortes ANDEUTUNGEN ließ in mir die Befürchtung aufkeimen, dass die Andeutungen mit mir zu tun hatten. Da ich von Beatrice so wenig Notiz genommen hatte, dass ich Mühe gehabt hätte, sie auf der Straße zu erkennen, regte sich eine nicht unerklärliche Empörung in mir. Ein Invalide an zwei Stöcken taugt nur bedingt zum Verführer von Dorfmädchen. Gereizt sagte ich:
»So ein Unsinn!«
»Genau das hab ich der Mutter von dem Mädel auch gesagt, Sir«, verkündete Partridge. »›TECHTELMECHTEL in diesem Haus‹, hab ich ihr gesagt, ›das hat’s nie gegeben, und das wird’s auch nicht geben, solang ich ein Wörtchen mitzureden hab. Von wegen Ihrer Beatrice‹, hab ich gesagt, ›bei den Mädels von heute herrschen andre Sitten wie früher, und von wegen Techtelmechtel sonst wo, da weiß ich nichts.‹ Nur ist es wohl so, dass der junge Mann aus der Autowerkstatt, mit dem Beatrice ausgeht, den Brief auch gesehen hat und einen fürchterlichen Tanz aufführt.«
»Ich habe in meinem ganzen Leben nichts so Absurdes gehört«, sagte ich verärgert.
»Wenn Sie mich fragen, Sir«, sagte Partridge, »seien wir froh, dass wir das Mädel los sind. Ich sag’s Ihnen, sie hat was zu verbergen, sonst würde sie sich nicht so haben. Wo Rauch ist, sag ich immer, da ist auch Feuer.«
Ich ahnte nicht, wie satt ich dieses Sprichwort noch bekommen sollte.
II
Für diesen Vormittag stand ein Abenteuer auf dem Programm: ein Spaziergang ins Dorf (Joanna und ich nannten es das Dorf, auch wenn das technisch gesehen nicht korrekt war und die Einwohner von Lymstock ziemlich entrüstet hätte).
Die Sonne schien, die Luft war kühl und frisch und schmeckte schon nach Frühling. Ich klaubte meine Stöcke zusammen und marschierte allein los, sosehr Joanna auch darauf drängte, mich zu begleiten.
»Nein«, sagte ich, »ich brauche keinen Schutzengel, der neben mir hertrippelt und ermutigende Zwitscherlaute ausstößt. Denk an das Sprichwort: Der reist am schnellsten, der alleine reist. Wichtige Geschäfte harren meiner. Ich muss zu Galbraith, Galbraith und Symmington, diese Aktienübertragung unterschreiben, ich muss zum Bäcker, mich wegen des Rosinenweckens beschweren, und ich muss das Buch zurückgeben, das wir ausgeliehen haben. Und zur Bank muss ich auch. Lass mich ziehen, Weib, der Morgen ist allzu kurz.«
Wir einigten uns darauf, dass Joanna mit dem Auto nachkommen und mich rechtzeitig zum Mittagessen wieder den Hügel hinaufschaffen würde.
»Da müsstest du genug Zeit haben, um mit jedem Bürger von Lymstock deinen Morgenplausch abzuhalten.«
»Ich bezweifle nicht«, sagte ich, »dass ich bis dahin alles gesehen haben werde, was Rang und Namen hat.«
Denn vormittags war die High Street Treffpunkt für die einkaufende Bevölkerung und Umschlagplatz für Neuigkeiten.
Letzten Endes ging ich doch nicht ohne Geleit in die Stadt. Ich hatte vielleicht zweihundert Meter zurückgelegt, als ich hinter mir eine Fahrradglocke hörte und dann Bremsenknirschen; gleich darauf plumpste Megan Hunter mir von ihrem Gefährt mehr oder minder vor die Füße.
»Hallo«, sagte sie atemlos, während sie aufstand und sich abklopfte.
Ich mochte Megan und empfand immer ein bisschen Mitleid mit ihr.
Sie war die Stieftochter von Symmington, dem Anwalt – Mrs Symmingtons Tochter aus erster Ehe. Über Mr (oder Captain) Hunter hörte man wenig; offenbar verspürte niemand den Wunsch, sein Andenken zu bewahren. Es hieß, er habe Mrs Symmington schändlich behandelt und sie habe nach einem oder zwei Ehejahren die Scheidung eingereicht. Sie hatte eigenes Vermögen und war mit ihrer kleinen Tochter nach Lymstock gezogen, »um zu vergessen«. Nach einiger Zeit hatte sie dann den einzigen in Betracht kommenden Junggesellen am Ort geheiratet, Richard Symmington. Aus dieser zweiten Ehe gab es zwei Söhne, der ganze Stolz der Eltern, und ich stellte mir vor, dass Megan sich zuweilen wie das fünfte Rad am Wagen vorkam. Sie hatte gar nichts von ihrer Mutter, einer kleinen, anämischen Frau, hübsch, aber verblüht, die mit matter, melancholischer Stimme über Ärger mit dem Personal und ihren Ischias klagte.
Megan war groß und schlaksig, und trotz ihrer zwanzig Jahre wirkte sie wie ein sechzehnjähriges Schulmädchen. Sie hatte einen wirren braunen Haarschopf, grünbraune Augen, ein schmales, knochiges Gesicht und ein unerwartet reizvolles schiefes Lächeln. Ihre Kleider waren schäbig und unvorteilhaft, und sie trug fast immer Wollstrumpfhosen mit Löchern darin.
Eigentlich, fand ich an diesem Morgen, ähnelte sie viel mehr einem Pferd als einem Menschen. Hätte man sie ein bisschen gestriegelt, hätte sie sogar ein sehr hübsches Pferd abgegeben.
Sie sprach wie üblich atemlos und überstürzt.
»Ich war oben bei Lashers – der Farm, Sie wissen schon –, weil ich schauen wollte, ob ich vielleicht Enteneier kriege. Die haben einen furchtbar goldigen Wurf Ferkel. So was Süßes. Mögen Sie Schweine? Ich mag sogar den Geruch.«
»Gepflegte Schweine sollten nicht riechen«, sagte ich.
»Im Ernst? Die Schweine hier riechen alle. Wollen Sie in die Stadt? Ich hab gesehen, dass Sie ganz allein sind, da dachte ich, ich halte an und leiste Ihnen Gesellschaft, nur hab ich ein bisschen scharf gebremst.«
»Du hast deinen Strumpf zerrissen«, sagte ich.
Megan blickte bekümmert an ihrem rechten Bein hinab.
»Stimmt. Aber es sind sowieso schon zwei Löcher drin, da macht es nicht so viel.«
»Stopfst du deine Strümpfe denn nie, Megan?«
»Manchmal. Wenn Mama mich erwischt. Aber meistens achtet sie nicht auf mich – ein Glück eigentlich, nicht?«
»Dir scheint entgangen zu sein, dass du erwachsen bist«, sagte ich.
»Sie meinen, ich sollte mehr so sein wie Ihre Schwester? So schnieke?«
Eine Beschreibung Joannas, die mir nicht sonderlich gefiel.
»Sie sieht sauber und gepflegt aus«, sagte ich. »Eine Freude für jedes Auge.«
»Sie ist ungeheuer hübsch«, sagte Megan. »Sie sieht Ihnen kein bisschen ähnlich. Wie kommt das?«
»Geschwister müssen sich nicht immer ähnlich sehen.«
»Auch wahr. Ich sehe Brian und Colin ja auch nicht besonders ähnlich. Und sie sich untereinander auch nicht.« Sie hielt inne und sagte dann: »Schon komisch, oder?«
»Was ist komisch?«
»Familien«, antwortete Megan bündig.
»Hm«, sagte ich nachdenklich.
Ich fragte mich, was ihr wohl durch den Kopf ging. Einen Moment lang wanderten wir schweigend nebeneinander her, dann fragte Megan ganz zaghaft: »Sie fliegen, oder?«
»Ja.«
»Und dabei hatten Sie auch Ihren Unfall?«
»Ja, ich bin abgestürzt.«
Megan sagte: »Hier bei uns fliegt niemand.«
»Nein«, sagte ich. »Hier nicht. Hättest du Lust zu fliegen, Megan?«
»Ich?« Sie klang verblüfft. »Guter Gott, nein. Ich müsste sicher brechen. Ich breche ja sogar im Zug.«
Sie machte eine Pause und fragte dann mit einer Direktheit, wie man sie sonst nur von Kindern kennt: »Werden Sie wieder, ich meine so, dass es zum Fliegen reicht, oder bleiben Sie immer ein bisschen tapplig?«
»Mein Arzt sagt, ich werde wieder.«
»Ja, aber ist er einer von denen, die Lügen erzählen?«
»Ich glaube nicht«, antwortete ich. »Das heißt, ich bin sogar ziemlich sicher. Ich vertraue ihm.«
»Dann ist’s ja gut. Aber viele Leute lügen.«
Diese unbestreitbare Tatsache nahm ich schweigend zur Kenntnis.
Und Megan erklärte in sachlichem, unparteiischem Ton: »Aber das freut mich. Ich dachte schon, Sie gucken vielleicht deshalb so miesepetrig, weil Sie Ihr Leben lang humpeln müssen – aber wenn Sie von Haus aus so sind, dann ist das was anderes.«
»Ich bin nicht miesepetrig«, sagte ich kühl.
»Dann eben reizbar.«
»Ich bin reizbar, weil ich es so eilig habe, wieder auf die Beine zu kommen, und so etwas braucht seine Zeit.«
»Warum dann die Eile?«
Ich musste lachen.
»Mein liebes Kind, passiert es dir nie, dass du etwas nicht erwarten kannst?«
Megan überlegte.
»Nein«, sagte sie dann. »Woher denn? Was sollte ich nicht erwarten können? Es passiert ja nie was.«
Etwas Verlorenes klang aus ihren Worten. Ich fragte behutsam: »Womit vertreibst du dir denn so die Zeit?«
Sie zuckte die Achseln.
»Was weiß ich.«
»Hast du keine Hobbys? Spiele, die du gern spielst? Freundinnen, die hier in der Nähe wohnen?«
»Bei Spielen stelle ich mich immer dämlich an. Außerdem machen sie mir keinen Spaß. Viele Mädchen gibt es hier nicht, und die paar, die da sind, mag ich nicht. Sie finden mich schrecklich.«
»Unsinn. Warum sollten sie?«
Megan schüttelte den Kopf.
»Warst du denn auf gar keiner Schule?«
»Doch, bis vor einem Jahr.«
»Bist du gern zur Schule gegangen?«
»Schon. Nur wird einem da alles auf so idiotische Art beigebracht.«
»Wie meinst du das?«
»Na ja, so durcheinander. Ein bisschen dies, ein bisschen das. Es war eine billige Schule, und die Lehrer waren nicht besonders gut. Keine Frage konnten sie ordentlich beantworten.«
»Das können die wenigsten Lehrer«, sagte ich.
»Wieso eigentlich? Dafür werden sie doch bezahlt.«
Ich musste ihr recht geben.
»Gut, ich bin natürlich auch ziemlich dumm«, sagte Megan. »Aber so vieles kommt mir einfach hirnrissig vor. Geschichte zum Beispiel. In jedem Buch steht was anderes!«
»Das macht es doch gerade interessant«, sagte ich.
»Und Grammatik«, fuhr Megan fort. »Und dann diese blöden Besinnungsaufsätze. Und der ganze Quatsch, den Shelley geschrieben hat, mit seinen Feldlerchen, oder Wordsworth, der völlig aus dem Häuschen gerät wegen ein paar albernen Narzissen. Und Shakespeare erst.«
»Was macht denn Shakespeare Hirnrissiges?«, fragte ich interessiert.
»Verrenkt und verdreht sich, nur damit auch ja keiner versteht, was er eigentlich will. Na ja – ein paar Sachen von Shakespeare sind ganz in Ordnung.«
»Da wird er aber erleichtert sein«, sagte ich.
Für Sarkasmus hatte Megan kein Ohr. Ihre Miene hellte sich auf, als sie sagte: »Regan und Goneril mag ich.«
»Warum gerade die?«
»Ach, ich weiß nicht. Sie haben irgendwie so was Einleuchtendes. Warum, glauben Sie, waren sie so?«
»Wie, so?«