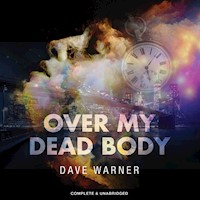9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eigentlich wollte Detective Daniel Clement nie nach Broome zurückkehren. Dank seiner Exfrau ist er aber nun doch wieder hier, im australischen Nirgendwo, 2000 Kilometer entfernt von der nächsten Großstadt. Viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt dem Detective nicht, denn in einem nahegelegenen Wasserloch wird eine Leiche entdeckt. Der zu Lebzeiten unauffällige Mann wurde brutal umgebracht - übertötet, wie man in Polizeikreisen sagt. So etwas gab es in dieser abgelegenen Gegend noch nie. Als ein zweiter Mord geschieht, scheinbar ohne jede Verbindung zum ersten, ahnt Clement, dass ihm der schwierigste Fall seiner Karriere bevorsteht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 656
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
PROLOG
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
28. KAPITEL
29. KAPITEL
30. KAPITEL
31. KAPITEL
32. KAPITEL
33. KAPITEL
34. KAPITEL
35. KAPITEL
36. KAPITEL
37. KAPITEL
38. KAPITEL
39. KAPITEL
40. KAPITEL
41. KAPITEL
42. KAPITEL
43. KAPITEL
44. KAPITEL
45. KAPITEL
46. KAPITEL
47. KAPITEL
48. KAPITEL
49. KAPITEL
50. KAPITEL
51. KAPITEL
52. KAPITEL
53. KAPITEL
54. KAPITEL
55. KAPITEL
56. KAPITEL
57. KAPITEL
58. KAPITEL
59. KAPITEL
60. KAPITEL
61. KAPITEL
62. KAPITEL
63. KAPITEL
64. KAPITEL
65. KAPITEL
66. KAPITEL
Danksagung des Autors
Über das Buch
Eigentlich wollte Detective Daniel Clement nie nach Broome zurückkehren. Dank seiner Exfrau ist er aber nun doch wieder hier, im australischen Nirgendwo, 2000 Kilometer entfernt von der nächsten Großstadt. Viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt dem Detective nicht, denn in einem nahegelegenen Wasserloch wird eine Leiche entdeckt. Der zu Lebzeiten unauffällige Mann wurde brutal umgebracht – übertötet, wie man in Polizeikreisen sagt. So etwas gab es in dieser abgelegenen Gegend noch nie. Als ein zweiter Mord geschieht, scheinbar ohne jede Verbindung zum ersten, ahnt Clement, dass ihm der schwierigste Fall seiner Karriere bevorsteht.
Über den Autor
Dave Warner, Jahrgang 1953, ist ein Multitalent. In seiner Heimat Australien zählt er zu den bekanntesten Musikern, Drehbuch- und Buchautoren des Landes. So veröffentlichte er bisher zehn Musikalben, sechs Sachbücher und neun Romane. Sein neuester Roman Die Schlingen der Schuld wurde 2016 mit dem renommierten NED KELLY AWARD ausgezeichnet, dem australischen Krimipreis. Dave Warner lebt mit seiner Familie in Sydney.
Dave Warner
DIE SCHLINGEN DER SCHULD
Kriminalroman
Aus dem australischen Englisch von Holger Hanowell
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2015 by Dave WarnerTitel der australischen Originalausgabe: »Before It Breaks«
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Judith MandtTextredaktion: Christiane Geldmacher, WiesbadenTitelillustration: © FinePic/shutterstockUmschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5683-0
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Für Nicole, meinen Fels in der Brandung
PROLOG
Der Vater hatte den Jungen dank der hellblauen Windjacke immer gut im Blick, aber er blieb ein wenig zurück, um dem kleinen Mädchen die Zeit zu lassen, die ersten paar Schritte zu machen. Sie schaffte etwa fünf, ehe sie stolperte und mit dem Po ins weiche Gras plumpste. Wie ein Pfadfinder folgte der Junge dem Verlauf der steil ansteigenden Böschung, dem letzten Stück der Runde, ehe es wieder nach Hause ging. Der Sommer war auf dem Rückzug, die Luft war bereits deutlich kühler als noch vor einer Woche, aber immer noch angenehm. Da der Vater den ganzen Tag auf den Computerbildschirm gestarrt hatte, genoss er diesen kleinen Ausflug mit seinen Kindern vor dem Abendessen. Sie waren über die breiten Rasenflächen des Parks geschlendert, hatten die kleine Holzbrücke überquert, über die der Junge immer schnell rannte, um ja nicht dem Troll zu begegnen, der darunter hauste, und waren durch das winzige Waldstück gegangen, in dem man hinter den hohen, schlanken Bäumen gut Verstecken spielen konnte. Erfrischt von diesen Aktivitäten im Freien wollten die drei wieder nach Hause, wo bestimmt schon die Nachrichten über den Fernsehbildschirm flimmern, der Duft des Schweinebratens durchs Haus ziehen und seine Frau wie immer lautstark verlangen würde, sie sollten bitte alle sofort ihre dreckigen Schuhe ausziehen. Später würden sie die Kinder in die Wanne stecken und Gutenachtgeschichten vorlesen, ehe der Junge unter Tränen protestieren würde, er wolle noch aufbleiben – also würden sie einen Kompromiss finden und ihm anbieten, eine Geschichte vorzulesen, in der es um Roboter und die Vernichtung des Planeten ging. Ein Angebot, das der Kleine zunächst ausschlagen, letzten Endes aber doch widerwillig annehmen würde. Zwanzig Minuten dauerte es meist, dann fielen ihm für gewöhnlich die Augen zu, das blonde Haar über das Kopfkissen gefächert. Seine Mutter und sein Vater würden ihm einen Gutenachtkuss geben und sich dann leise aus dem Zimmer schleichen, um in Ruhe ein Glas Wein zu genießen. Vielleicht schauten sie sich eine Lieblingssendung im Fernsehen an oder hörten noch gemeinsam etwas Musik.
Der Vater schaute auf. Der Junge war aus seinem Blickfeld verschwunden. Doch das beunruhigte ihn nicht sonderlich. Die grasbewachsene Böschung war steil, und sobald man die Kuppe überwunden hatte, war man für diejenigen, die langsamer folgten, nicht mehr zu sehen. Trotzdem rief er den Jungen beim Namen und forderte ihn laut auf, er solle gefälligst warten. Das kleine Mädchen, das wohl das Gefühl hatte, nicht mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, stolperte etwas zu offensichtlich über ihre eigenen Füße. Sie kicherte, und ihre goldenen Ringellocken umrahmten ihr engelsgleiches Gesicht. Der Vater zog sie rasch wieder auf die Beine und rief erneut hinter dem Jungen her, er solle zurückkommen. Aber als sich oben auf der Anhöhe immer noch nichts tat, schnappte der Vater sich die Tochter, legte sie sich über die Schultern und ließ die Anhöhe mit langen, federnden Schritten hinter sich, sehr zur Freude der Kleinen, die ordentlich durchgeschüttelt wurde. Aber er machte sich auch jetzt keine Gedanken wegen des Jungen, er lief nur deshalb schneller, weil er wusste, dass das der Kleinen gefiel. Als er jedoch fast die Kuppe erreicht hatte, hatte sich eine Spur von Angst in seine pragmatische Seele gebahnt, denn der Junge war immer noch nirgends zu sehen. Hatte er ihn denn nicht gehört?
Oben auf der Anhöhe angekommen, glitt sein Blick sofort nach rechts, denn in dieser Richtung ging es nach Hause. Sein Herz krampfte sich zusammen. Nichts, nur ein schmaler Streifen Gras und vereinzelt stehende Bäume. Reflexartig schaute er nach links und spürte im selben Moment, wie ihn Erleichterung durchströmte. Etwa zwanzig Meter entfernt stand der Junge und starrte auf etwas, das am Boden lag. Der Vater machte drei beherzte Schritte in seine Richtung und erkannte schnell, warum der Junge nicht geantwortet hatte. Seine ganze Aufmerksamkeit galt einem niedlichen schwarzen Cockerspaniel. Der Junge liebte Hunde, und sein Vater hätte ihm auch gern einen gekauft, aber in dem Apartmentblock, in dem sie wohnten, waren keine Haustiere erlaubt.
Als der Vater jedoch näher kam, erkannte er, dass irgendetwas an dieser Szene nicht stimmte. Der Hund winselte, hatte den Schwanz eingekniffen und konnte sich in seiner Unruhe nicht entscheiden, ob er sich setzen oder auf und ab laufen sollte. Auffällig war indes, dass er nicht nur ein Halsband trug, sondern noch angeleint war. Und der Junge hatte gar nicht den Cockerspaniel betrachtet, wie der Vater jetzt sah: Im Gras lag ein Mann, ein ziemlich großer Mann mit vollem weißem Haarschopf. Noch im Gehen setzte der Vater seine kleine Tochter ab. Sein erster Gedanke war, dass der Mann kollabiert sein musste. Während er sein Handy aus der Tasche fischte, bereute er es, sich nicht bei einem dieser Erste-Hilfe-Kurse angemeldet zu haben, in denen man Herz-Lungen-Wiederbelebung lernte. Schon oft hatte er sich gesagt, dass plötzlich etwas passieren könnte: Die Kinder würden vielleicht aus Versehen an eine freiliegende Stromleitung fassen, und in so einem Fall entschieden die ersten Minuten über Leben und Tod. Doch wann immer er in Erwägung gezogen hatte, einen solchen Kurs zu machen, stets hatte sich die gute Absicht verflüchtigt wie Rauch im Wind.
Dann erstarrte er, als hätte jemand für einen Augenblick die Zeit angehalten.
Er sah dem am Boden liegenden Mann ins Gesicht. Sofort war ihm klar, dass er es hier nicht mit einem Herzinfarkt zu tun hatte. Ein Pfeilschaft ragte aus dem Hals des Mannes, seine Federn berührten fast das Kinn, und die Pfeilspitze trat am Nacken des Mannes wieder aus. Es bestand kein Zweifel: Der Mann war tot.
1. KAPITEL
Broome, Westaustralien
Dong, Dong, Dong. Da war er wieder, der Typ mit dem Hammer, wie immer um Viertel vor sechs am Morgen. Das konnte doch nur irgendetwas Illegales sein! Das Geräusch von Metall auf Metall war weithin zu hören, aber über dem Wasser hallte es noch lauter. Clement überlegte, ob er seine Shorts anziehen und runter zum Dock stapfen sollte, um die Nervensäge zu finden und den Dicken zu markieren. Hey, ich bin Detective Inspector Daniel Clement, und du benimmst dich daneben, Kumpel! Wenn er das tun würde, wäre es sowieso Zeit, zur Arbeit zu fahren. Trotzdem, es könnte diesen Typen in Zukunft davon abhalten, so viel Lärm zu machen. Aber was, wenn der Kerl bockte und nachhakte, wo Clement eigentlich wohnte? Denn womöglich wusste er, dass das Apartment über dem Schiffsausrüster offiziell kein Wohnraum war, sondern wie die ganze Kaianlage ausschließlich Gewerbegebiet.
Clement richtete sich auf, schwang die Beine rüber und blieb auf dem Bett sitzen. Mit beiden Händen fuhr er sich durchs Gesicht, als rechnete er damit, dass die Bude dann besser aussähe. Okay, niemand wollte freiwillig in so einem Chaos aufwachen, aber es könnte schlimmer sein: eine Flasche Weißwein, die drei Tage gereicht hatte, und drei Longneck-Bierpullen, die er am Abend zuvor in anderthalb Stunden geleert hatte – nicht so toll. Im Zimmer war es stickig, noch regte sich kein Lüftchen. Clement nahm die leeren Flaschen und versenkte sie in einem großen, grünen Müllbeutel. Dann trat er ans Fenster und blickte hinaus aufs Meer, das hier im Nordwesten immer grüner wirkte als anderswo. Die Wohnung war zwar klein und dürftig eingerichtet, dafür hatte man aber einen tollen Blick. Er hatte Glück gehabt, überhaupt etwas in der Art zu finden, vielleicht hatte ihm das Schicksal die Bleibe in die Hände gespielt, ein spezielles Erkennungszeichen von einem getrennt lebenden Ehemann zum anderen. Denn die Ehe des Schiffshändlers war auch gescheitert, und eine Zeit lang hatte er in seinem Büro über der Werkstatt geschlafen. Eine Toilette war bereits vorhanden gewesen. An einem Wochenende hatte der Schiffshändler ein winziges Bad und eine Küchenzeile eingebaut und sich somit ein neues Zuhause geschaffen. Doch im Gegensatz zu Clement hatte der Mann sich letzten Endes wieder mit seiner Frau ausgesöhnt und war wieder zu ihr gezogen. Als er erkannt hatte, dass er aus seiner Junggesellenbude Kapital schlagen könnte, hatte er das Büro in eine Ecke des Ladens verlagert und begonnen, das »Apartment« gegen Barzahlung zu vermieten. Clement hatte davon über ein paar Ecken erfahren und gleich zugegriffen. Nachts war es hier oben ruhig und einsam, aber tagsüber hatte man das Gefühl, in einem Lagerhaus zu leben, außerdem war die Bude vollkommen ungeeignet für eine Neunjährige. Um die Wochenenden mit seiner Tochter Phoebe verbringen zu können, hatte Clement sich also eine zweite Wohnung gemietet, in Derby, etwa zweihundert Kilometer östlich. Er liebte Derby. Eine offene, unverbaute Stadt, unberührt und irgendwie unzeitgemäß, aber Clement hatte einen echten Glücksgriff getan und einen Pfahlbau gefunden, von dem aus man in nördlicher Richtung auf die Mangroven blickte. Der berühmte Pier von Derby war in der Ferne zu sehen. Zugegeben, die Miete war so hoch, dass nicht mehr viel für einen annehmbaren Lebensstil übrig blieb, aber wie wollte er überhaupt leben? Er hatte ein Runabout, ein kleines Sportboot, und Phoebe verbrachte gern Zeit mit ihm auf dem Wasser.
Nachdem er es keine zwei Minuten unter der kalten Dusche ausgehalten hatte, trocknete er sich ab und zog sich an. Mit seinen T-Shirts und Hosen kam er drei Tage hin, bis er wieder waschen musste, manchmal schaffte er sogar vier Tage. In der kleinen Wohnung gab es natürlich keine Waschmaschine, daher wusch er die Sachen mit der Hand oder fuhr zum Waschsalon in der Nähe vom Bahnhof.
Vor ein paar Monaten hatte Daniel Clement sich ins eigene Fleisch geschnitten, seine Zukunftsperspektiven verbaut und auf seinen guten Ruf gepfiffen. In Perth war er so etwas wie eine kleine Berühmtheit gewesen. Nicht, dass es ihm je darum gegangen wäre; all die Pressekonferenzen und Schlagzeilen in den Abendnachrichten, das war nicht sein Ding. Er war kein Blender, sondern ein cleverer, hart arbeitender Detective bei der Mordkommission, der lange geschuftet und viel zu viel geopfert hatte.
Und das ist der springende Punkt, das Paradoxe an der Sache, dachte Clement nicht zum ersten Mal. Du kannst etwas gut, du stichst hervor. Du quälst dich an die Spitze, verlierst dabei aber Stück um Stück der eigenen Identität. Zunächst nur ein bisschen, später immer mehr. Da bist du also in Perth, gehörst zu einem Spitzen-Team und hast clevere Kollegen, die herausragendsten in der Verbrechensaufklärung und die am besten ausgestatteten. Pro Woche hast du es mit mindestens einem Mordfall zu tun. Es gibt Restaurants und Bars und die Privat-Terrassen von Kollegen, wo man sich über die Fälle austauscht, zu den sanften Geräuschen eines Rasensprengers. Du verbesserst dich selbst ständig, gehörst zur Elite.
Aber dann merkst du, dass das nicht reicht, dass die Dinge, die du auf dem Weg zur Spitze außer Acht lassen musstest, genau die Dinge waren, die du hättest behalten und bewahren sollen. Wie eine Ehe zum Beispiel. Und, nein, du nimmst nicht die ganze Schuld auf dich, aber es ist sowieso zu spät, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, weil es einfach passiert ist. Und dann, kurz vor deinem einundvierzigsten Geburtstag, eröffnet dir Marilyn, dass sie mit eurer Tochter zurück zu ihrer Familie zieht …
Clement schüttelte unwillkürlich den Kopf, als er an die Vergangenheit dachte. Damals hatte er nur eine Wahl gehabt: auf Wiedersehen sagen oder dicht bei der einen Sache bleiben, die er nicht versauen wollte.
Er hatte sich für Letzteres entschieden, für seine Tochter. Und so war er also hierhergekommen, in genau jenen Landstrich, wo das Eisenerz verladen wurde, von dem die Behörden in Perth profitierten, und wo er nun kleine Fälle mit ziemlich unerfahrenen oder verbrauchten Detectives bearbeitete, die am liebsten Bier tranken und Fisch aßen.
Und wo er keine Waschmaschine besaß.
Im Kühlschrank entdeckte Clement nichts Gescheites, nur noch ein Stück Käse und einen Apfel, aber da er kein Brot mehr hatte, beschloss er, den Käse fürs Abendessen aufzubewahren. Er nahm den Apfel und hatte ihn schon halb aufgegessen, ehe er die letzten Stufen der wackligen Außentreppe erreichte, an der sein Auto parkte. Er stieg ein, umfasste das Lenkrad mit beiden Händen, den halben Apfel im Mund, saß einfach nur da und fühlte sich leer und verbraucht. Der Tag verhieß nicht gerade viel. Es gab einen Fall, bei dem es um häusliche Gewalt ging und der am nächsten Tag vor Gericht verhandelt würde. Clement musste nur dafür sorgen, dass der Mistkerl nicht ungeschoren davonkam. Abgesehen davon hatte er es mit illegalem Besitz von Gras und tätlichen Übergriffen unter Alkoholeinfluss zu tun. Normalerweise wäre er mit Hagan und Lalor nach Norden gefahren, wo es zu Streitigkeiten zwischen zwei Aborigine-Clans gekommen war, aber an diesem Wochenende hatte er Phoebe bei sich, und das wollte er auf keinen Fall verschieben.
Er hatte lange genug getrödelt, warf das Apfelgehäuse aus dem Fenster, startete den Motor und fuhr gemächlich an. Obwohl mittwochs um diese Zeit der Berufsverkehr einsetzte, war kaum etwas auf den Straßen los, nicht viel mehr jedenfalls als damals, als er als Zehnjähriger mit seinem Fahrrad in dieser Gegend unterwegs gewesen war, mit einer Spielkarte, die er mit einem Abstandshalter am Hinterrad befestigt hatte, damit sie in den Speichen klapperte. Denn er hatte sich vorgestellt, auf einem Motorrad zu fahren.
Er machte den Polizeifunk an und hörte Mal Gross, den Sergeant im Innendienst, der gerade einen Streifenwagen zum alten Schlachthof dirigierte: möglicherweise ein Einbruch. Clement war ganz in der Nähe. Er bog links in die Abfahrt. Natürlich hätte er Gross über Funk Bescheid sagen müssen, aber der Sergeant hätte ihm sowieso nur gesagt, man brauche ihn in diesem Fall nicht. Die mit Schlaglöchern übersäte Zubringerstraße mit dem niedrigen Gestrüpp an beiden Seiten sah noch genauso aus, wie Clement sie als Junge in Erinnerung hatte. Sofort hatte er wieder diesen Geruch in der Nase, den der Wind früher vom Meer in Richtung Schule wehte, ganz so, als wäre der längst stillgelegte Schlachthof noch in Betrieb. Der Geruch war so intensiv, dass Clement sich schon ernsthaft fragte, ob der Schlachthof nicht vielleicht wieder eröffnet worden wäre. Aber im nächsten Moment war er verflogen, und da wusste Clement, dass es nur Einbildung gewesen war, wie manchmal morgens, wenn er aufwachte und fest davon überzeugt war, Marilyn neben sich im Bett atmen zu hören.
Die Umrisse des Schlachthofs zeichneten sich ab, im Grunde nichts weiter als eine Ansammlung von flachen Wellblechschuppen. Vor dem rostigen Zaun hatte ein Streifenwagen gehalten, zwei Beamte stiegen aus. Die dunkelhaarige Frau war Constable di Rivi. Wie hieß sie noch gleich? Jo? Seit neun Wochen war Clement hier im Dienst, konnte sich aber immer noch nicht die Namen der Kollegen merken, die im Rang unter ihm standen. Die Beamten blieben stehen, als sie seinen Wagen sahen. Verwunderung lag in ihren Blicken, auch Argwohn, und als sie schließlich erkannten, mit wem sie es zu tun hatten, zeigte sich kurz so etwas wie Angst in ihren Gesichtern, als fürchteten sie, etwas falsch gemacht zu haben.
»Hi, Sir.«
Es war di Rivi, die die Sprache wiederfand. Ihr Partner, ein junger Typ in ihrem Alter, wirkte wie erstarrt.
Clement wollte die Kollegen nicht beunruhigen. »Alles okay, ich war hier gerade unterwegs und habe den Funkspruch gehört. Sie sind di Rivi?«
»Ja, Sir.«
Sie hatte offenbar geahnt, dass er den Namen ihres Partners vergessen hatte, und zeigte auf den jungen Mann. »Das ist Nathan Restoff.«
Der Mann nickte Clement zu und brachte ihn auf den neuesten Stand.
Ein gewisser Mr Symonds, ein Mitglied des örtlichen Geschichtsvereins, war auf das Gelände gefahren, um Fotos für seine »Old Broome«-Facebook-Seite zu machen, hatte aber dann Geräusche im Gebäude gehört. Es hatte geklungen, als hätte jemand Schmerzen. Daraufhin hatte er die Polizei gerufen.
Während Restoff sprach, untersuchte di Rivi das Tor, das mit einem Vorhängeschloss gesichert war. »Also, hier ist keiner rein«, meinte sie.
Clement deutete mit dem Daumen über die Schulter. »Ist nicht gerade Fort Knox. Kommen Sie, schauen wir uns ein wenig um.«
Sie brauchten keine drei Minuten, bis sie eine Lücke im alten Zaun fanden, die bestimmt schon über Jahre als Durchgang gedient hatte. Jo di Rivi hielt den Stacheldraht hoch, damit Clement das Schlachthofgelände betreten konnte.
»Haben Sie Ihre Dienstwaffe dabei, Sir?«
»Nein.«
Restoff bot ihm einen Taser an. Aber Clement hatte Bedenken, den Elektroschocker falsch zu bedienen, und lehnte ab. Er wollte nicht wie ein Idiot dastehen.
»Geht schon, danke. Mir passiert schon nichts.«
Hinter einer offen stehenden Tür erwartete sie gähnende Dunkelheit. Restoff und di Rivi näherten sich dem Eingang vorsichtig, ehe Restoff mit ruhiger, fester Stimme rief: »Polizei! Ist da jemand?«
Als sie keine Antwort erhielten, zwängten die beiden Beamten sich durch die Tür ins Innere der Halle. Inzwischen bereute Clement es, den Elektroschocker abgelehnt zu haben. Einfach so konnte er den Kollegen nicht folgen.
Daher blieb er vor der Tür stehen und hörte, wie die Kollegen mehrmals riefen. Beide hatten Taschenlampen, aber im Wellblechdach klafften so viele Löcher, dass man sich bei Tageslicht auch so zurechtfand. Dann hörte Clement Geräusche, die sich wie schlurfende Schritte anhörten, doch sie kamen nicht aus der Halle selbst, sondern von dem Innenhof gleich um die Ecke. Vorsichtig spähte Clement hinüber. Auf dem einst großen Hof, der sich zwischen der Halle und einigen kleineren Schuppen erstreckte, erhob sich ein Haufen aus Dreck und Schutt, als hätte jemand alles mit einem Bulldozer zusammengeschoben: Sand, alte Ziegel, morsches Holz und Stacheldraht. Der Haufen war gerade so hoch, dass Clement nicht sehen konnte, ob jemand auf der anderen Seite stand. Er griff nach einem durchgebrochenen Backstein und wagte sich ein Stück weit um den Haufen herum.
Der Eindringling drehte ihm den Kopf zu und starrte ihn aus kalten Augen an, wie jemand, der nichts mehr zu verlieren hat.
Clement streckte langsam die linke Hand aus. »Ganz ruhig …«
Sie war schlank, das Fell stumpf, doch sie bleckte die Zähne, und ihr struppiger Schwanz zeigte steif nach unten. Wahrscheinlich halb Dingo, halb Schäferhund, jedenfalls war sie auf der Hut.
»Ich tue dir nichts.«
Seine Worte hatten ungefähr denselben Effekt wie das, was er zu Marilyn gesagt hatte. Das Tier knurrte, stürmte auf ihn zu, sprang ihn an und schnappte nach seinem Hals. Beim Cricket war Clement früher allenfalls ein durchschnittlicher Schlagmann gewesen, aber er hatte die Technik noch drauf. Genau das rettete ihm das Leben. Denn er wich aus und holte mit dem halben Backstein zum Schlag aus. Ein Knacken, als er das Tier genau am Schädel traf. Der Hund sackte schlaff zu Boden.
Restoff und di Rivi liefen herbei, die Waffen im Anschlag, und Clement fühlte sich schlecht, wie er so über dem toten Hund stand. Wer beginnt seinen Tag damit, einem halb verhungerten Köter den Schädel einzuschlagen?
In dem Großraumbüro hatte sich Clement eines von drei Einzelbüros gesichert. Die beiden anderen gehörten seinem Boss, Scott Risely, und Anna Warren, dem Assistant Regional Commander. Sie hatte Sonderurlaub, war ohnehin selten in Broome und pendelte per Flieger zwischen den Minen und weit abgelegenen Gemeinden. Es war gut, dass Clement ein wenig Privatsphäre hatte, denn drei Stunden nach dem Einsatz beim Schlachthofgelände starrte er immer noch auf die Schreibtischplatte. Mit dem Schlag hatte er das Tier nicht getötet, aber es war so gut wie tot gewesen. Nicht viel mehr als ein dahinvegetierender Organismus. Vielleicht hatte die Hündin nur ihre Kleinen verteidigen wollen, doch jetzt hatte man sie mit halb zertrümmertem Schädel ins städtische Tierheim geschleppt. Bestimmt würde sie dort eingeschläfert. Alles für die Katz. Keine Spur von anderen Eindringlingen, nur dieser eine abgemagerte Hund, der vielleicht alte Rinderknochen in dem Schutthaufen ausbuddeln wollte.
Clement hatte Durst. Selbst bei laufender Klimaanlage laugte einen die Hitze aus. Er verließ sein Büro und steuerte auf den Wasserspender zu. Die Major-Crime-Abteilung lag nahezu verlassen da. Mal Gross war gerade damit beschäftigt, eine Aussage von einem Aborigine-Paar aufzunehmen. Es hörte sich ganz danach an, als wäre bei ihnen eingebrochen worden. Selbst im Paradies gab es Diebe. Clement trank von dem kühlen Wasser. Als sein Zahn auf Kälte reagierte, fiel ihm ein, dass er wieder etwas auf die lange Bank geschoben hatte.
»Was für eine Axt?«, fragte Sergeant Gross.
»Na, Sie wissen schon, so eine, die man fürs Holzhacken nimmt«, antwortete der Mann, als wäre Gross nicht ganz bei Trost.
Die Frau, um die fünfzig und vermutlich etwas jünger als ihr Mann, gab zu Protokoll, sie habe Sonntagnacht etwas gehört. Gross machte sich Notizen. »Wir wussten nicht, dass sie fehlte, bis er heute Morgen Holz hacken wollte.«
Gestohlenes Werkzeug, entwendete Fahrräder und Handys, so erstreckte sich hier die Landschaft des Verbrechens bis zum Horizont. Clement versenkte den Plastikbecher im Papierkorb und ging durch die rückwärtige Tür auf den Parkplatz.
Draußen überlegte er kurz, ob er sich unterwegs etwas Anständiges zu essen kaufen sollte, aber als er erstmal am Steuer saß, musste er sich eingestehen, dass er eigentlich keinen Appetit hatte. Ohne festes Ziel fuhr er weiter. Irgendwann brachte ihn das Auto aus der Stadt, als hätte es einen eigenen Willen. Nach etwa fünf Kilometern, auf Höhe der Tankstelle, bog er rechts ab. Ob er die Bäume dort tatsächlich wiedererkannte, wusste er nicht, aber er hatte zumindest das Gefühl. Als er ein Kind gewesen war, hatte diese Waldung eine Art Grenze gebildet, eine geografische Zone, hinter der das »Zuhause« zum »Anderswo« wurde – aber da er im Augenblick in die entgegengesetzte Richtung fuhr, hätte es korrekt heißen müssen, wo das »Anderswo« das »Zuhause« wurde. Marilyn hatte immer gern ausgeblendet, dass auch er hier aufgewachsen war. Zugegeben, sein Stammbaum war nicht so grandios; keine Perlenfarm, nur ein Caravan-Park, den seine Mum und sein Dad aus dem Nichts aufgebaut hatten, aber dies war nun mal für fünfzehn Jahre sein Zuhause gewesen. Er war ihm fast entkommen.
Aber nur fast.
Das Buschland hatte sich in den dreißig Jahren nicht viel verändert, aber ein Stück weit die Straße hinauf sah die Sache schon wieder anders aus. Der Caravan-Park, den seine Eltern gegründet hatten, war fort, und statt seiner stand dort nun ein Industriekomplex. Zwei große Gebäude im Fertighaus-Stil: ein Center für Schalldämpfer und mehrere kleinere Hallen, eine Spritzlackierwerkstatt, daneben ein Reifenhandel. Clement fuhr über die marode Asphaltfläche und versuchte sich zu erinnern, wie alles früher ausgesehen hatte.
Es war das erste Mal seit seiner Rückkehr, dass er diesen Ort aufsuchte; das erste Mal, nachdem er vor all den Jahren abgehauen war. Seine Eltern lebten inzwischen in Albany am südlichen Zipfel des Bundesstaates. Zu seinen alten Freunden hatte er keinen Kontakt mehr. Nichts und niemand hatte ihn zurückgezogen in diese Hitze und diesen Staub. Er wusste auch nicht, warum er überhaupt zu diesem Ort seiner Jugend gefahren war, aber vermutlich hatte es etwas zu tun mit dem Hund und mit Phoebe und all den anderen Dingen, die er in seinem Leben verbockt hatte.
Die Gebäude hier waren bestimmt nicht älter als zehn Jahre. Er überlegte, wie lange der Caravan-Park noch existiert haben mochte, nachdem seine Eltern alles verkauft hatten. Er hatte damit gerechnet, dass der alte Komplex mit den Duschen und Toiletten noch stehen würde, aber er konnte nichts dergleichen entdecken, zumindest nicht von seinem Standort aus. Vielleicht lag die alte Baracke hinter den Hallen, aber er hatte keine Lust auszusteigen und über das Gelände zu schlendern.
Nicht zum ersten Mal fühlte er sich wie ein Fremder in einer Gegend, die einst sein Zuhause gewesen war, und er spürte, dass sich innerlich etwas in ihm regte und ihn zum Handeln antreiben wollte. Er hätte wenden und auf die Hauptstraße fahren können, dann in südlicher Richtung weiter, den ganzen Weg bis Perth. Er verdrängte das Gefühl zwar problemlos, ahnte aber, dass es ihn nie ganz loslassen würde, ähnlich wie das schlechte Gewissen wegen des Hundes. Es würde sich nie ganz vertreiben lassen und irgendwann womöglich stärker sein als seine Kraft, zu widerstehen.
2. KAPITEL
Jasper’s Creek, Westaustralien
Die Sonne versank an diesem Abend ungewöhnlich schnell, als wäre sie erschöpft von einem anstrengenden Tag, an dem sie vom Firmament aus die Erde unter sich in einen rotglühenden Backofen verwandelt hatte. So gingen die Tage in diesen Breiten zu Ende, nicht gemächlich wie ein herabschwebendes Taschentuch, sondern mit der Wucht eines Fallbeils.
Im Verlauf der letzten dreißig Jahre war er fast immer allein eingeschlafen. Er hatte durchaus Gesellschaft gehabt, sie sogar gesucht, zumindest für ein paar Stunden, normalerweise in einer Bar, manchmal auch in einem Café. Ab und an war es vorgekommen, dass er bei einem Kollegen zum Abendessen eingeladen gewesen war. Manchmal hatte er mit einer Frau geschlafen, das war aber seit Längerem nicht mehr geschehen. Inzwischen hatte er herausgefunden, dass er sich in Gesellschaft von Leuten nicht mehr so oft wie eine Insel fühlte. Das Gegenteil war der Fall. Hier, auf der anderen Seite der Welt, fühlte er sich weniger isoliert als während all der Jahre in seiner deutschen Heimatstadt. Abgeschiedenheit war hier der Normalzustand. An manchen Tagen stand man schweigend da und wusste, dass im Umkreis von hundert Meilen kein anderes Herz schlug. Aber das Alleinsein konnte man nicht gleichsetzen mit dem Gefühl der Einsamkeit.
Damals hatte er Freunde gehabt, nicht nur Leute, die man in einer Bar traf. Männer, mit denen er zur Schule gegangen war, mit denen er gearbeitet hatte, aber in deren Gesellschaft er gerade eine oft verzweifelte Einsamkeit verspürt hatte. Oft hatte er das Gefühl gehabt, nur sein Avatar kommuniziere mit diesen Menschen, während sein wahres Ich in einem Verlies vor sich hin dämmerte. Aber wie man sich bettet, so liegt man … oft allein.
Mit den Fingerspitzen fuhr er sich über seinen Schnurrbart. Wenn er sich Mühe gab, konnte er sich erinnern, wie seine Frau über die Schnurrbarthaare gestrichen hatte. Letzten Endes war sie es leid gewesen, sich mit einem Mann abzugeben, der so distanziert und in sich gekehrt war. Sie hatte ein neues Leben begonnen, befreit von all den Bürden, die ein Leben an seiner Seite mit sich brachte.
Aber wieso war es wieder so weit gekommen mit ihm?
Die Stimme, die ihm diese Frage stellte, war ständig in seinem Kopf und meldete sich in immer demselben Tonfall zu Wort. Sie zerrte ihn zurück in die verräucherten Bars, zu den speckigen Lederjacken, dem Knistern eines Radios, das irgendwo in einer Ecke lief. Komisch eigentlich, ein Gesicht verblasste mit den Jahren in der Erinnerung, nicht aber eine Stimme; eine Stimme alterte nicht. Er hatte keine Antwort darauf – wozu auch? Das war lange her, und inzwischen war es zu spät, etwas daran zu ändern. Ein Leben jenseits der vierzig war nur Bedauern.
Ein Geräusch, das nicht aus der Natur stammen konnte, riss ihn aus seinen Überlegungen. Ein Fahrzeug irgendwo auf der anderen Seite des Mangrovensumpfes, dessen stehendes Wasser nicht weit entfernt schillerte. Es mochten etwa zwanzig Meter von seinem kleinen Stellplatz bis zum Ufer des Wasserlochs sein, nicht mehr als fünfzig Meter bis zum anderen Ufer, also weniger als hundert Meter insgesamt. Solange die dort drüben unter sich blieben, sollte es ihm egal sein.
Mühelos baute er sein kleines Zelt auf, setzte sich wieder ins Auto und öffnete eine Bierdose. Eine warme Brühe, aber egal. Ihm ging es um das leichte Beduseltsein, nicht um den Geschmack. Das sumpfige Wasserloch lag vollkommen ruhig da, Spiele aus Licht und Schatten erzeugten die Illusion von Bewegung. Er leerte die Dose schnell und warf sie in den Fußraum des Beifahrersitzes, zu all den anderen. Bei einem Imbiss hatte er sich ein gebratenes Hähnchen gekauft. Er wickelte es aus der Folie und brach einen Unterschenkel heraus. Moskitos umschwirrten ihn, aber aus einem unerfindlichen Grund ärgerten sie ihn nur selten. Fliegen waren auch unterwegs, doch weniger als tagsüber. Langsam zerkaute er das Hähnchenfleisch und dachte an Südamerika. Dorthin hatte er immer schon mal reisen wollen. Noch so ein Vorhaben, das er nie realisiert hatte, genau wie die Schiffsfahrt entlang Alaskas Küste, mit einem tollen Hotelaufenthalt, vielleicht zusammen mit Britt Ekland. Sein Leben war eine Reihe schwarzer Punkte, deren Umrisse zusammengenommen eine Null ergaben. Ein Glück für ihn, wie die Dinge sich hier für ihn entwickelt hatten, bemerkenswert irgendwie. Er war ein Risiko eingegangen, das genauso gut nach hinten hätte losgehen können, aber andererseits hatte nicht viel auf dem Spiel gestanden, oder? In ganz Hamburg hatte er Geld verplempert, der HSV hatte scheiße gespielt, und in der Stadt zu bleiben war der Beweis seines Versagens gewesen. Egal, dort hatte er wenigstens das Gefühl gehabt, lebendig zu sein. Seine Risikobereitschaft hätte ihn sein Leben kosten können, so elend es auch war. Aber letzten Endes war es die richtige Entscheidung gewesen. Hier sollten jetzt alle Nebenflüsse seines Lebens zusammenfließen. Hier würde er sterben.
Er drehte den Schlüssel im Zündschloss und schaltete den CD-Player an. Countrymusic – was auch sonst für einen alleinstehenden Mann, der sich nicht länger selbst darüber belügen wollte, dass er in den besten Jahren war?
Lange lauschte er der Musik, die sich in der zunehmenden Dunkelheit verlor. Eine Erinnerung stellte sich ein: seine Eltern, sein Vater, der selbst beim Abendessen Hosenträger getragen hatte. Die Erinnerung zerlief und ließ andere Bilder entstehen: die Straße, in der er aufgewachsen war, ein Schulfreund, ein Ladenbesitzer, der immer sehr großzügig gewesen war, ein Mädchen, das er gernhatte, das sich dann aber für einen seiner Freunde entschieden hatte, das Handball-Spiel, bei dem er sich den kleinen Finger gebrochen hatte. Was war wohl aus dem Leben derjenigen geworden, die seinen Lebensweg gekreuzt hatten? Einige waren bestimmt schon tot, andere saßen vielleicht in einer kleinen Apartment-Wohnung oder hockten an einem wärmenden Lagerfeuer auf einer Hochebene in Argentinien und aßen Roastbeef; im Hintergrund schrammelte vielleicht einer auf der Gitarre, die Melodie schwebte hinauf zum Sternenhimmel, so samtschwarz wie jener, den er im Augenblick über sich sah. Womöglich dachten auch diese Leute an ihre Eltern, an großzügige Ladenbesitzer und vielleicht auch an ihn.
Seine Beine fühlten sich steif an, als er aus dem Wagen stieg und das Dinghi aus Aluminium vom Dach des Pajero löste. Er spürte das Gewicht des Bootes und genoss dieses Gefühl, denn als seine Arme sich anspannten, wusste er, dass er wirklich da war und nicht nur in seinen Erinnerungen wühlte. Das Boot setzte er auf dem matschigen Ufergürtel ab und holte den Außenbordmotor aus dem Kofferraum. Zum Angeln rausfahren und Bier trinken – zwei lohnenswerte Beschäftigungen, mit denen man sich die Zeit bis zum nächsten Sonnenuntergang vertreiben konnte. Dass Krokodile in der Nähe sein könnten, beunruhigte ihn nicht sonderlich, doch er würde keine unnötigen Risiken eingehen. Zwar kursierten in der Gegend Storys von Krokodilen, die kleinere Boote umgestoßen hatten, aber er kannte niemanden, der das wirklich mit eigenen Augen gesehen hatte. Und da die Leute immer übertrieben, wenn sie dem Tod entkommen waren, musste er sich fragen, ob das Fehlen von Augenzeugen der Beweis dafür war, dass das Ganze in den Bereich der Mythen gehörte. Während er den Außenbordmotor anbrachte, kehrten seine Gedanken auf Umwegen zur vergangenen Nacht zurück: Zwei junge Frauen hatten gemeinsam mit ihm gelacht, als er seine Geschichten zum Besten gegeben hatte. Die jungen Typen, die zu den Frauen gehörten, waren voll gewesen, das war offensichtlich gewesen. Aber er hatte das bei sich, was die Frauen haben wollten, also hatten sie bei ihm gesessen, sein Bier getrunken und über seine Storys gelacht – hatten sich, so hoffte er, wirklich amüsiert –, denn er war niemand, der Dinge vortäuschte. Dann hatte er sich selbst in einem der Spiegel gesehen. Die Falten hatten sich in letzter Zeit tiefer in sein Gesicht gegraben, der klare Blick hatte ein bisschen gelitten, wirkte etwas stumpfer. Er ahnte, dass er unvermeidlich aufs Alter und den Tod zusteuerte. Aber noch nicht, denn es gab immer noch Bier und Fische, die sich fangen ließen.
Aus dem Busch drang ein Geräusch aus der Richtung, aus der er gekommen war. Er stellte die Musik leiser und lauschte.
Nichts. Doch er spürte etwas, eine unsichtbare Präsenz. In dieser Gegend waren viele verwilderte Hausschweine unterwegs. Er hatte schon einige erlegt und gegessen. Tatsächlich spielte er mit dem Gedanken, das Fleisch nach Hause zu schicken, denn dort galt Wildschwein als Delikatesse, aber dann hatte er festgestellt, dass schon jemand vor ihm auf die Idee gekommen war. Wann immer er einen guten Einfall hatte, stellte sich heraus, dass er zu spät kam. Er spitzte weiterhin die Ohren, aber da gab es kein auffälliges Geräusch mehr.
Den Rest des Hähnchens wickelte er in die Folie und legte es in den Zelteingang. Er würde es später aufessen, nach dem Angeln. Als er gerade den Reißverschluss seines Zeltes zumachte, hörte er, dass etwas ziemlich schnell durch die Sträucher hinter ihm lief. Er fuhr herum. Noch ehe er registrieren konnte, was es war, wurde er von grellem Licht geblendet.
»Wer ist da?«, rief er und versuchte mit einer Hand, den Lichtstrahl der Taschenlampe abzuwehren. Die Antwort war etwas Kaltes und Schweres, das auf seinen Schädel niederfuhr. Er sackte mit den Knien zuerst auf den Boden und spürte, wie sein Körper pochte, wie sein Kopf schmerzte, doch das Gefühl schien von seiner Wahrnehmung entkoppelt zu sein. In all dem Gewirr aus Eindrücken begriff er, dass ihm jemand ans Leben wollte. Eine Stimme erreichte ihn aus dem Dunkel. Die Stimme, die er bereits zuvor vernommen hatte, als wäre der Schlangengeist der Aborigines über die Kontinente gekrochen, durch all die Jahre, um ihn zu finden.
Sein Verstand versuchte ihm zu suggerieren, dass dies nicht möglich war. Es konnte nicht die Stimme sein, daher wähnte er sich bereits jenseits der Schwelle des Todes. Aber der Schmerz war intensiv und wurde immer schlimmer. Schläge hagelten auf seinen Körper, er stürzte schwer zu Boden, versuchte zu schreien, aber es wollte nicht gelingen. Die Hölle, die er so lange vor sich hergeschoben hatte, zog ihn nun an ihre Brust. Die Wahl, die er getroffen hatte, war ihm so heimlich gefolgt wie ein Reptil aus der Tiefe, das ihn jetzt zerstörte. In einem entlegenen Winkel seines Verstands begriff er, dass es so hatte kommen müssen … dass es richtig so war.
»Tut mir leid«, hörte er sich selbst keuchen, aber das war bloß ein Trick, den ihm seine Wahrnehmung vorgaukelte.
Denn er war längst tot, bevor der Gedanke sich zu Worten hatte formen können.
3. KAPITEL
Abenteuerurlauber hatten berichtet, dass Schüsse gefallen seien, junge Leute, die bewusst auf Deckenventilatoren, Hair-Conditioner, weiche Laken und überteuerten Schnaps verzichtet hatten und sich mutig dem Busch, den Krokodilen und Moskitoschwärmen stellen wollten, um einmal das »echte Australien« zu erleben. Clement hatte längst damit aufgehört, sich Gedanken zu machen, was das »echte Australien« war. Wenn es nach ihm ginge, gehörten zum echten Australien Maoris und Leute aus Sri Lanka, die sich vor laufender Kamera die Lunge aus dem Leib sangen, um ein paar Jurymitglieder aus Übersee zu beeindrucken, in der Hoffnung, sie könnten Karriere machen mit amerikanischen Songs, die sie irgendwo zum Besten geben könnten, bloß nicht hier. Das echte Australien war bestimmt nicht die vordere Bar des Picador am späten Samstagabend. Zumindest hoffte er, dass es nicht so wäre. Doch bei den meisten Leuten hatte sich festgesetzt, dass betrunkene Loser, die sich gegenseitig Billardqueues auf dem Schädel zertrümmerten, ein Glied einer langen Kette waren, die zurückreichte bis zu den Truppenlandungen in Anzac Cove auf Gallipoli.
»Das echte Australien.«
Er gab ein Schnauben von sich und drückte das Gaspedal durch. Ihm wäre es am liebsten gewesen, das Internet wäre nie erfunden worden. Er sehnte sich zurück in jene Zeit, als das Fliegen noch so teuer war, dass es sich nur die wirklich Reichen leisten konnten, ein anderes Land zu besuchen. Denn dann hätten all die Abenteuerurlauber aus Tokio, Oslo oder Rio keinen Schimmer gehabt von der Kimberley-Region im Nordwesten des Great Southland. Und er hätte sich keine Gedanken über Schüsse machen müssen, die irgendwo abgefeuert worden waren. Vielleicht hatte wieder jemand versucht, illegal Krokodile zu fangen, aber das war nicht sein Metier. Damit sollten sich die Jungs der Fischerei-Aufsicht, der Nationalparks oder der Wildlife-Behörden abgeben. Leider waren diese Naturschützer rar gesät. Der Anruf war auf dem Polizeirevier eingegangen, und inzwischen twitterten die Touris bestimmt, »wie knapp sie dem Tod entkommen waren«. Irgendwer musste sich ja auf den Weg machen, um sich die Sache einmal anzusehen. Gut, er hätte ablehnen können, aber die Streifenbeamten liefen sich schon die Hacken wund. Hagan und Lalor waren immer noch tief im Inland damit beschäftigt, den Streit zwischen den Clans zu schlichten, und di Rivi und Restoff hatten alle Hände voll zu tun, eine Abschlussfeier abzuwickeln, die aus dem Ruder gelaufen war. Was seine direkten Kollegen betraf, die Detectives, so war Sergeant Graeme Earle zum Angeln rausgefahren, und sein jüngerer Kollege Josh Shepherd hatte am Gericht mit einem Fall von häuslicher Gewalt zu tun. Dienstältester Detective hin oder her, er musste mal wieder die Drecksarbeit machen.
Die Sache mit dem Hund am Vortag ging ihm einfach nicht aus dem Kopf, außerdem flammte der Zahnschmerz zwischendurch auf, und der Typ mit dem Hammer hatte schon wieder vor sechs am Morgen losgelegt. All das half Clement sicher nicht aus dem Stimmungstief. Er zwang sich, mehrmals tief durchzuatmen. Phoebe hatte schon angefangen, ihn als »Mr Griesgram« zu bezeichnen, aber das hatte sie bestimmt bei ihrer Mutter aufgeschnappt. Marilyn hatte ihm immer noch nicht verziehen, in diese Gegend zu ziehen. »Wegen dir sind wir ständig auf Achse«, hatte sie oft gesagt. Marilyn war sauer auf ihn, denn sie war überzeugt davon, dass er sich für ihre gemeinsame Tochter, aber nie für sie geopfert hätte.
Wahrscheinlich hatte sie recht, aber Clement würde sie immer lieben, ein Teil von ihm sowieso … der Teil, den man genauso wenig erklären konnte wie den Teil, der sich wie ein Brecheisen zwischen sie gezwängt hatte. Und sie war auch kein Unschuldsengel; nicht er war an allem schuld. Erstaunlicherweise hatte sie diesen Trottel Brian noch nicht geheiratet. Vielleicht hatte Brian sie noch nicht gefragt, oder aber sie behandelte ihn genauso, wie sie mit ihm, Dan, umgesprungen war, als könne er ihr nichts recht machen. Wäre ihr alter Herr noch am Leben, dann hätte Clement einen Verbündeten gehabt. Der alte Nick war zwar als reicher Perlenzüchter gestorben, angefangen hatte er aber als verdammter Bootsmechaniker. Das eigentliche Problem war Geraldine gewesen, von Anfang an. Sie hatte es geliebt, die Lady des Anwesens zu spielen, und Clement war immer nur der Stallbursche gewesen – also nicht gut genug für ihre Tochter. Es hatte zwölf Jahre gedauert, aber schließlich hatte Marilyn sich in diesem Punkt mit ihrer Mutter vertragen. Manchmal spielte Clement mit dem Gedanken, ihr könnten Zweifel kommen und sie könnte womöglich kapiert haben, welche Rolle sie beim Scheitern der Beziehung gespielt hatte. Vielleicht war sie deshalb nicht noch einmal vor den Altar getreten.
Er hatte sich inzwischen beruhigt. Es war nicht ganz so schlecht, das Büro verlassen zu können. Auf diese Weise entfloh er dem Scheiß, mit dem jeder Anfänger klarkam. Das niedrige, trockene Gestrüpp auf beiden Seitenstreifen der Straße erinnerte ihn an jene heißen Tage, als er als Junge Soldat gespielt hatte, der sich an den imaginären Feind heranschlich. Aus Erfahrung wusste er, dass der Feind meistens nicht dort lauerte, wo man ihn vermutete, und obendrein anders aussah, als man dachte.
Die Abfahrt musste jeden Moment kommen. Australier beschilderten ihre Straßen genauso kurz und knapp, wie sie sprachen. Hundert Jahre lang hatte niemand Australien einen Besuch abgestattet, ausgenommen englische Cricket-Teams oder russische Zirkusartisten, aber weder Cricketspieler noch Zirkuskünstler hatten sich je die Mühe gemacht, an Orte wie diesen zu kommen. Daher war es Zeitverschwendung gewesen, Schilder aufzustellen. Wenn man nicht hier aus der Gegend stammte, hatte man hier sowieso nichts verloren, so einfach war die Formel. Und wenn man nicht hier aus der Gegend stammte und es einen trotzdem hierher verschlagen hatte, sollte man besser nicht hierbleiben. Man war ein Freak, also nicht erwünscht, und deshalb sollten einen Schilder nicht auch noch zum Bleiben ermuntern.
Womöglich hatten sich die Dinge geändert, aber diese Haltung hatte sich so tief in die nationale Psyche gegraben, dass sie sich festgesetzt hatte. Wer nicht wusste, dass gleich linker Hand ein Weg abging, der hinunter zum Wasserloch führte, landete wahrscheinlich in Darwin und suchte immer noch nach dem nicht existierenden Schild mit der Aufschrift »Jasper’s Creek«.
Aber Clement wusste Bescheid.
Er bremste und bog gemächlich in den breiten, unbefestigten Weg ein. In dieser Gegend war ein Allrad-Antrieb genauso wichtig wie Mückenschutz. Clement fuhr an einem von Kugeln gespickten Park-and-Wildlife-Schild vorbei, auf dem ein Krokodil abgebildet war, darunter stand DANGER. Straßen wurden nicht ausgeschildert, aber dass jemand auf spektakuläre Weise einem Krokodil zum Opfer fallen könnte, jagte den Bürokraten in der Tourismusbehörde so viel Angst ein, dass jeder blöde Fluss im Umkreis von fünfhundert Kilometern mit diesen Warnhinweisen gepflastert war. Um die Einschusslöcher auf dem Schild hatte sich Rost gebildet, daher wusste Clement, dass die Löcher nichts mit den Schüssen zu tun haben konnten, die die Touris in den frühen Morgenstunden gemeldet hatten. Am Telefon hatten sie ihm genau erklärt, wo sie gewesen waren, als die Schüsse fielen, daher fuhr Clement zu einem Wasserloch, das er immer schon unter dem Namen Jasper’s kannte. Wer zum Teufel dieser Jasper gewesen war, hatte ihm nie jemand sagen können. Das von Sümpfen geprägte Wasserloch war auf keiner Karte vermerkt, es war schlichtweg zu klein. Der Busch war ziemlich dicht hier, durchsetzt mit Tee- und Grasbäumen und einigen dicken Eukalyptusbäumen. Clement hielt an der Stelle an, wo der befahrbare Weg schmaler wurde.
Ganz gleich, wie lange man schon in der Gegend lebte, man gewöhnte sich nie ganz an den Schwall trockener, heißer Luft, der einen erfasste, sobald man einen vollklimatisierten Bereich verließ. In diesem Moment spürte Clement diese morbide, unbarmherzige Hitze. Langsam arbeitete er sich durch den Busch in Richtung des Ufergürtels vor. Fliegen empfingen ihn wie einen lang vermissten Herrn.
Die Touris hatten sich offenbar gut über Krokodile informiert, denn sie hatten sicherheitshalber auf dem Dach ihres Campers geschlafen. Eine Praxis, die Clement nicht empfohlen hätte. Seit seiner Rückkehr war es zweimal vorgekommen, dass Leute nachts im Schlaf von ihren Autos gepurzelt waren und sich die Knochen gebrochen hatten. Ein besoffener Typ hatte schlichtweg das Gleichgewicht verloren, der andere war bei Anbruch der Dämmerung aufgewacht, hatte vergessen, wo er sein Lager aufgeschlagen hatte, und war wie ein Stein vom Trailer geplumpst. Da war es ratsamer, sich in das Auto zu quetschen oder einen Schlafplatz zu suchen, der weit genug vom Wasser weg war. Dennoch, man musste den Touris zugutehalten, dass sie vorsichtig gewesen waren. Vor Kurzem war von einem großen Krokodil die Rede gewesen, das hier in der Gegend einen Terrier gefressen haben sollte.
Er brauchte nicht lange, um die Wagenspuren und das Gestrüpp zu finden, das die Touris bei ihrem hastigen Aufbruch niedergewalzt hatten. Am Telefon hatten sie gesagt, die Schüsse seien am westlichen Ufer von Jasper’s Creek gefallen, aber da es dunkel gewesen sei, hätten sie ohnehin nichts gesehen, ehe sie sich aus dem Staub machten. Clement nahm ihnen das nicht krumm. Er vermutete, dass es nur ein paar Besoffene gewesen waren, die einfach in den Nachthimmel geballert hatten. Es hätte aber auch irgendein Schwachkopf sein können, der hinter Krokodilen her war.
Dicht am Ufergürtel hingen die Zweige der Bäume ins Wasser, Wurzeln zogen sich durch den matschigen Untergrund. Das Sonnenlicht, das durch das Blattwerk fiel, bildete eigenartige Muster auf dem Boden, und bei dem Geruch von verrottendem Unkraut und morschem Holz dachte man unweigerlich an Libellen und Moskitoschwärme. Clement wusste, dass er vorsichtig sein musste. Wenn man aus dem gleißenden Licht in die Schatten der Mangrovengürtel trat, brauchten die Augen einen Moment, um sich an die veränderten Lichtverhältnisse zu gewöhnen, und dann konnte es durchaus passieren, dass man über ein Krokodil stolperte, das faul im Schlamm döste.
Nachdem er sich vergewissert hatte, dass es sich bei den Baumstämmen am Ufer tatsächlich um Baumstämme handelte, wagte er sich weiter vor, bis er einen ungehinderten Blick auf die andere Seite des lang gestreckten Wasserlochs werfen konnte – die vielleicht die anderthalbfache Länge eines Schwimmbeckens entfernt sein mochte, also etwa achtzig Meter. Auf den ersten Blick konnte er nichts Außergewöhnliches entdecken, aber als er genauer hinsah, spürte er, dass irgendetwas nicht stimmte, auch wenn er es nicht sofort entdeckte. Sein Augenmerk galt einem Kormoran, der scheinbar über der Wasseroberfläche schwebte, ohne die Flügel zu spreizen. Erst dann sah er, dass der schwarze Vogel auf einem gewölbten Gegenstand saß, der silbern schillerte: der Boden eines umgedrehten Aluminium-Boots. Es lag im flachen Wasser, unweit des gegenüberliegenden Ufers. Das Alu-Boot wirkte zum Greifen nah, aber Clement wäre nie auf die Idee gekommen, zur anderen Seite zu waten. Eine Vorahnung regte sich in seiner Brust, kein hektisches Flügelschlagen, sondern ein dumpfes Pochen. Er machte sich auf den Weg, das Wasserloch zu umrunden.
»Ist da jemand?«
Seine Worte hallten über das stille Wasser und erzeugten ein Echo.
Keine Antwort.
Der Busch war dicht und dornig an dieser Stelle. Scharfrandige Blätter bohrten sich in seinen Nacken und drückten von hinten gegen seine Beine. Ineinander verflochtene Zweige kratzten über seine Arme. Es kam ihm fast so vor, als würde der Busch sagen: »Bleib weg, lass mich in Ruhe, ich will dich hier nicht!« Obwohl er sich beeilte, brauchte er gut zehn Minuten, um das Jasper’s-Creek-Wasserloch zu Fuß zu umrunden. Schließlich fand er sich genau gegenüber von der Stelle wieder, an der er seinen Wagen abgestellt hatte. Er war nur fünfundzwanzig Meter vom Wasser entfernt, immer noch im Busch, aber in Sichtweite des umgekippten Boots. An einer Stelle klaffte eine Lücke im Strauchwerk, wie geschaffen, um ein Boot zu Wasser zu lassen. Eigenartig war nur, dass am Heck des Bootes kein Außenbordmotor zu sehen war. Die Alarmglocken schrillten ein wenig lauter, denn hier in der Gegend hatte jeder einen Außenborder am Boot.
Er rief erneut in die Stille hinein, hörte aber nur den geisterhaften Nachhall der eigenen Stimme. Schließlich kämpfte er sich weiter durch dichtes Buschwerk, schwitzte wie ein Schwein und blieb auf derselben Höhe, da er nach dem Fahrzeug suchte, mit dem das Alu-Boot transportiert worden war. Nach weiteren zehn Metern erreichte er eine kleine Lichtung, auf der ein älteres Pajero-Modell stand. Die Fahrertür stand offen. Ein leises, beharrliches Brummen erregte seine Aufmerksamkeit. Er drehte sich um und sah ein Ein-Mann-Zelt, das aussah, als hätte jemand einen Sack Tee darüber ausgeschüttet: Buschfliegen, zu Tausenden. Von einem der Bäume brach Clement einen Ast ab und schwenkte ihn vor dem Eingang des Zelts. Als die Fliegen aufstoben, erkannte er, dass sie es auf das Blut abgesehen hatten, das teils auf der Nylonschicht des Zelts klebte, teils den Boden am Eingang dunkel verfärbt hatte. Geronnenes Blut, aber höchstens einige Stunden alt.
Clement machte sich aufs Schlimmste gefasst und schob den Zelteingang mit dem Ast zur Seite.
Wieder ein Schwarm Fliegen. Etliche flogen ihm in die Augen und die Nasenlöcher, andere blieben hungrig auf einem Klumpen am Boden, der wie ein halb abgenagtes Hähnchen aussah. Abgesehen von einem Schlafsack, ein paar Camping-Utensilien und einem Trinkbecher aus Plastik war im Zelt nichts zu sehen. Kein Blut im Innern, soweit er das beurteilen konnte. Falls das Blut auf dem Zelt draußen von einem erlegten Tier stammte, so fehlte der Kadaver. Sein Magen krampfte sich zusammen. Hier war jemandem irgendwas Grauenvolles widerfahren.
»Hallo, ist da wer?«
Er rief so laut wie möglich, aber seine Stimme verhallte in der endlosen Weite. Er rief noch einmal. Ein viertes Mal. Keine Reaktion. Dann besah er sich den Pajero, den er auf acht bis zehn Jahre schätzte. Hier und da ein paar Schrammen am Lack, kleinere Dellen. Entweder hatte der Besitzer den Wagen in diesem Zustand gebraucht gekauft, oder er machte sich nicht viel aus Autos und gab das Geld lieber für Fusel aus. Die Schleifspuren auf dem Dach verrieten ihm, dass das Boot dort oben festgezurrt gewesen war. Durch die Heckscheibe sah er Angelruten, Angelzubehör, einen Eimer, eine Kühlbox, jede Menge Kram, alte Handtücher und eine Abdeckplane. Ohne das Auto anzufassen, versuchte er, durch die Scheibe auf die Rückbank zu schauen. Dort lagen ein Paar Anglerstiefel, andere Schuhe und drei leere Flaschen Victoria Bitter. Als er sich dem Fahrersitz zuwandte, war er verblüfft, dass der Zündschlüssel noch steckte. Der Lichtschalter stand auf On, aber die vorderen Scheinwerfer leuchteten nicht. Ganz vorsichtig und mit spitzen Fingern drehte er den Schlüssel ein Stück – Fingerabdrücke fanden sich bestimmt dort.
Nichts. Wahrscheinlich war die Batterie platt. Die Klappe vom Handschuhfach stand offen, das Fach selbst sah durchwühlt aus. In dem Spalt, in dem die Drehgelenke saßen, steckte eine scharfe Patrone, Kaliber 22, wie er schätzte. Eine zweite lag auf dem Boden, wahrscheinlich aus dem Fach gekullert. Aber nirgends eine Waffe.
Es sah tatsächlich immer mehr nach einem Tatort aus. Aber es war kein Blut im Auto. Bislang kein Hinweis, dass mehr als eine Person im Wagen gesessen hatte, keine Frauenkleidung. Langsam umrundete Clement den Pajero. Ein Aufkleber pries die Vorzüge der Broome-Angler.
Clement machte ein paar Aufnahmen mit dem Handy, auch vom Nummernschild und dem Kilometerzähler. Plötzlich erwachte ganz in der Nähe ein Handy zum Leben. Ein typischer Klingelton. Clement folgte ihm bis zu einer Stelle nur wenige Meter vom Flussufer entfernt. Vorsichtig griff er nach dem Handy im Dreck, wobei er seine Hand mit dem Stoff seines T-Shirts bedeckte. Es war ein älteres Smartphone. Eine unterdrückte Anrufernummer war im Display zu lesen. Clement nahm das Gespräch entgegen.
»Hallo?«
Keine Antwort, aber da war jemand am anderen Ende der Verbindung.
»Hier ist Detective Inspector Daniel Clement …«
Jemand beendete das Gespräch. Clement starrte auf das Display. Im Polizeiwagen würde ihm der Computer anhand des Nummernschilds verraten, woher der Pajero stammte, aber zurück durch den Busch bräuchte er bestimmt zwanzig Minuten bis zum Auto. Vorsichtig scrollte er durch die letzten Anrufe. Vor Kurzem hatte jemand mit Namen »Rudi« angerufen.
Er tippte die Nummer in sein eigenes Handy.
Mailbox. Männerstimme mit ausländischem Akzent, wahrscheinlich Europäer. »Bin nicht zu erreichen. Hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton.«
Clement wartete den Piepton ab und bat »Rudi« um einen Rückruf. Dann scrollte er zum nächsten Anrufer, der zu »AngClub« zusammengeschoben war. Clement war noch nie im örtlichen Anglerclub gewesen, aber schon etliche Male am Vereinshaus vorbeigefahren. Ein kleines, modernes Backsteingebäude im Gewerbegebiet, so unauffällig, es hätte auch eine öffentliche Toilette oder das Hauptquartier der Pfadfinder sein können. Broome war eine Kleinstadt, und Clement bezweifelte, dass der Anglerclub mehr als fünfzig Mitglieder hatte. Trotzdem versuchte er es. Es läutete ein paarmal. Er wollte gerade auflegen, als eine Frauenstimme zu hören war.
»Anglerclub.«
»Detective Inspector Daniel Clement hier.« Er leierte die Fakten herunter und erzählte, er sei bei einem Fahrzeug, das verlassen im Busch stehe und womöglich einem Mitglied des Vereins gehöre. Nachdem die Frau ihm verraten hatte, sie heiße Jill, beschrieb er ihr den Geländewagen.
»Augenblick bitte«, meinte Jill. Er hörte, dass sie nach jemandem rief. Dann war sie wieder in der Leitung. »Hört sich nach Dieters Auto an.«
»Dieter … und weiter?«
Wieder musste sie bei irgendjemandem nachfragen, ehe sie sagte: »Schäfer. Fragen Sie mich aber jetzt nicht, wie man das schreibt. Ist alles okay so weit?«
Genau das war die Frage.
Clement erfuhr, dass Dieter Schäfer Mitte sechzig war, im Ruhestand, unverheiratet. Für gewöhnlich fuhr er allein zum Angeln raus. Die einzige Nummer, die der Verein hatte, war die Handynummer. Offenbar wohnte Schäfer irgendwo in der Cape Leveque Road. Mit dem Namen Rudi konnte Jill nichts anfangen. Clement bedankte sich, legte auf und ging seine Optionen durch. Sein Bauchgefühl verriet ihm, dass es sich hier sehr wahrscheinlich um den Tatort handelte, aber für das, was er bislang gesehen hatte, könnte es verschiedene Erklärungen geben. Schäfer könnte sich zum Beispiel aus Versehen selbst angeschossen oder verletzt haben, und vielleicht hatte er daraufhin Rudi oder einen anderen Kumpel angerufen, der ihn abholen sollte. Clement rief im Derby Hospital an und hatte Karen am Apparat, die ihm schon mehrmals unmissverständlich klargemacht hatte, dass es dort immer ein Bett für ihn gäbe, mit ihr als Zugabe. Karen war Ende vierzig, was man ihr auch ansah, aber ihren durchtrainierten Body hätte man auf Mitte zwanzig geschätzt.
»Willst du endlich mit mir ausgehen?«
Clement umging die Frage.
»Habt ihr einen Dieter Schäfer bei euch? Mitte sechzig, deutscher Akzent, vermutlich Notaufnahme.«
»In der Notaufnahme haben wir einen Mittzwanziger, einen Idioten, der sich selbst mit der Gaskartusche seines Grills halb in die Luft gesprengt hat.«
»Ist innerhalb der letzten zwanzig Stunden jemand mit einer Schussverletzung oder einer anderen Verletzung eingeliefert worden?«
»Nein. Und du hast meine erste Frage nicht beantwortet.«
»Ich mache keine Dates.«
»Ich habe ja auch nicht nach einem Date gefragt.«
Er musste sich irgendwie herauswinden. »Ich lade dich auf ein Bier im Banksia ein.«
»Dan, sie kommt nicht zu dir zurück. Je eher du das kapierst, desto besser geht’s dir.«
»Danke dir, Karen.«
»Gern geschehen. Ich melde mich bei dir, falls dein Mr Schäfer hier auftaucht.«
Als er noch mit Marilyn zusammen gewesen war, hatte er nie in der Gegend herumgevögelt. Ein- oder zweimal hatte er vielleicht eine andere Frau geküsst, aber nur zur Begrüßung oder zum Abschied, und dann war er immer wieder zurückgezuckt. Wenn er gewollt hätte, hätte er alles haben können, aber er hatte immer einen Rückzieher gemacht, ganz gleich, wie schlecht es gerade mit Marilyn lief. Er wusste nicht genau, ob das ein Beweis für seine Moralvorstellungen war; so stellte er es sich jedenfalls vor, aber vielleicht wollte er sich einfach nur moralisch im Recht fühlen. Sie hatten sich vor eineinhalb Jahren getrennt. Acht Monate hatte es gedauert, ehe er mit einer anderen geschlafen hatte, und es war seltsam gewesen, nicht unangenehm, nicht weltbewegend, aber wie ein Gefühl, neue Schuhe zu tragen. Danach schlief er kurz hintereinander mit noch zwei anderen Frauen und wusste, dass er sie nicht mit Marilyn vergleichen durfte, tat es aber trotzdem. Er hasste sich für diese Schwäche. Sie kommt nicht zurück. Selbst wenn, wäre es ein Fehler, also bist du ein Trottel, wenn du das Unvermeidliche noch länger hinauszögerst. Karen hat recht, dachte er, aber andererseits irrt sie sich. Marilyn und er, ihre Beziehung war ihm ein Rätsel gewesen, wie die Quadratur des Kreises. Trotzdem kam er immer noch nicht mit seinem Leben klar. Als Junge war er fasziniert gewesen von der Geschichte von Scott am Südpol. Der Forscher musste geahnt haben, dass er sehenden Auges ins Verderben fuhr. Clement wollte sich dieses Verhalten nicht zum Vorbild nehmen, aber manchmal kam er sich doch wie Scott vor.
Das Schwirren der Fliegen summte in seinen Ohren, und inzwischen wurden die gelangweilten oder zu schwachen Biester, die nicht ans Blut kamen, von seinem Schweißgeruch angezogen.
Clement umrundete Jasper’s Creek und schlug sich durch denselben Busch zurück zu seinem Wagen, wobei er auf dieselben überfreundlichen Fliegen traf, die ihn erneut willkommen hießen. Sie krochen einem die Nase hinauf oder gelangten in den Mund, ehe man sie wegscheuchen konnte. Unterwegs versuchte er, Graeme Earle zu erreichen. Doch der Kollege nahm nicht ab. Earle gehörte zu den Typen, die das Leben genossen: angeln, saufen, blauer Himmel, endlose Weiten und die böswillige Hitze. Wenn Earle einen Tag freigenommen hatte, war er nicht zu erreichen. Clement hielt ihn nicht für einen besonders guten Detective, aber wenn er ehrlich war, gab es nicht viele Vergleichsmöglichkeiten. Sie hatten hier mit tätlichen Übergriffen, Überfällen, Vergewaltigungen und einem Familienzoff zu tun gehabt, der auf versuchten Mord hinausgelaufen war. Earle leistete gute Arbeit, er war nicht inkompetent. Sie deckten hier ein Riesenareal von tausend Kilometern im Umkreis ab, und gemessen daran war die Anzahl der Verbrechen ziemlich überschaubar, daher gab es kaum je Gelegenheit für echte, anspruchsvolle Ermittlungen. Selbst wenn die Kollegen über ungeahnte Fähigkeiten verfügten, so konnten sie sie kaum unter Beweis stellen. Earle lebte schon seit fünfzehn Jahren in der Gegend, und auf Clement wirkte er eher wie ein Kleinstadt-Sheriff als ein Detective.
Als Nächsten rief er Shepherd an. Der Detective Constable ging sofort ran.
»Schuldig. Aber der Kadi hat ihn mit ’nem blauen Auge davonkommen lassen. Nur drei Monate, verdammt.«
Shepherd hatte eigentlich immer etwas zu meckern, wenn man ihn am Telefon hatte. Aber in diesem Fall fühlte Clement mit ihm. Sie hatten einen Typen verhaftet, der ständig seine Frau verprügelte. Solche Fälle kamen selten genug vor Gericht, und wenn das Strafmaß dünner ausfiel als die Haut einer Zikade, überkam einen das Gefühl, dass man den falschen Job auf der falschen Seite der Erdkugel machte. Die Frauen sahen einen dann an, als wäre man selbst derjenige, der ihnen ein blaues Auge oder eine aufgesprungene Lippe verpasst hätte.
Clement beschrieb, wo er gerade war und was er entdeckt hatte – oder eben auch nicht entdeckt hatte. Er teilte Shepherd mit, die Stelle am Wasserloch müsse abgesperrt und wie ein Tatort eingestuft werden.
»Sag Jared Bescheid. Auch den Jungs, die die Callum-Creek-Krokos gefangen haben. Schau nach, ob sie Zeit haben.«
Schließlich gelangte er zu seinem Auto, öffnete die Fahrertür und riskierte es, sich den Arsch auf dem Sitz zu verbrennen. Dann gab er das Nummernschild des Pajero in den Computer ein. Bingo. Geboren am 14.04.1948. Wie Jill befürchtet hatte, war die Adresse eine Parzelle auf der Capa Leveque Road, ein Streifen Asphalt, der in Nord-Süd-Richtung hundert Kilometer durch die Wildnis verlief. Die einzige Telefonnummer war die Handynummer. Shepherd jammerte weiter, wie schwierig es sei, all das zu organisieren. Er ignorierte ihn jetzt. »Bis dann, Shep.«
Clement rief auf der Wache an und fragte Mal Gross, ob er einen Dieter Schäfer kenne.
Natürlich kannte er ihn. Gross kannte so gut wie jeden in der Kimberley-Region. »Klar, der Dieter. Sie nennen ihn ›Schultz‹. War früher mal Bulle in Deutschland.«
Gross zufolge lebte Schäfer allein, und zwar draußen im Busch in einem Haus, das nicht viel besser aussah als ein Schuppen. Er wolle einen Wagen dorthin schicken, um nach dem Rechten zu sehen, aber es seien gut hundert Kilometer, daher müsse Clement sich gedulden.
Typisch.