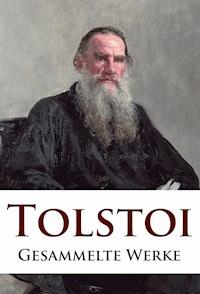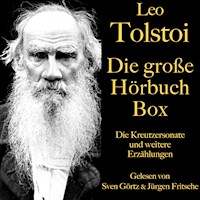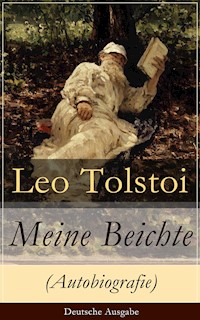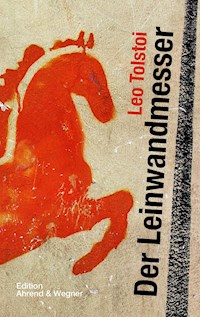Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die schönsten Erzählungen von Lew Tolstoi bieten einen faszinierenden Einblick in das Leben im zaristischen Russland des 19. Jahrhunderts. Tolstois einfühlsamer und realistischer Schreibstil fängt die tiefen menschlichen Emotionen und die sozialen Konflikte der Zeit ein. Diese Erzählungen zeichnen sich durch ihre klare Sprache, ihre tiefgründigen Charaktere und ihre moralischen Botschaften aus, die auch heute noch relevant sind. Durch die Vielfalt der Themen und Figuren zeigt Tolstoi seine Meisterschaft als Erzähler und Kritiker der russischen Gesellschaft. Die schönsten Erzählungen von Lew Tolstoi sind ein wichtiger Beitrag zur Weltliteratur und ein unverzichtbares Werk für alle Liebhaber der russischen Literatur. Tolstois tiefes Verständnis für das menschliche Herz und seine lebendige Darstellung der sozialen Realität machen dieses Buch zu einem zeitlosen Klassiker, der Leser jeden Alters und Hintergrunds anspricht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 948
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die schönsten Erzählungen von Lew Tolstoi
Books
Inhaltsverzeichnis
Glück der Ehe
Inhalt
I. Kapitel
Wir trauerten damals um meine Mutter, die im Herbst gestorben war, und lebten – Katja, Sonja und ich – den ganzen Winter zurückgezogen auf dem Lande.
Katja war eine alte Freundin unseres Hauses, unsere Gouvernante, die uns großgezogen hatte und die ich kannte und liebte, solange ich zurückzudenken vermag. Sonja war meine jüngere Schwester.
Der Winter, den wir in Pokrowskoje, unserem alten Gutshause zubrachten, war düster und traurig. Es war kalt, der Wind fegte den Schnee in dichten Haufen hoch an den Fenstern hinauf; die Scheiben blieben gewöhnlich dicht zugefroren, und wir gingen und fuhren fast nirgends hin. Besuche kamen selten, und die wenigen, die sich einfanden, brachten weder Heiterkeit noch Unterhaltung in unser Haus. Alle hatten traurige Gesichter, alle sprachen so leise, als ob sie jemand zu wecken fürchteten, sie lachten nie, seufzten und weinten oft, wenn sie mich und besonders die kleine Sonja in ihrem schwarzen Kleidchen ansahen. Es war, als ob noch immer der Tod im Hause zu spüren sei, als ob seine Schrecknisse noch immer die Luft erfüllten. Das Zimmer der Mutter war geschlossen, aber sooft ich daran vorüberging, um mich schlafen zu legen, war mir zumute, als ob mich etwas in das öde, kalte Gemach hineinzöge.
Ich war damals siebzehn Jahre alt, und die Mutter wollte gerade in dem Jahre, in dem sie starb, in die Stadt übersiedeln, um mich in die Gesellschaft einzuführen. Der Verlust der Mutter war ein großes Unglück für mich, aber ich muß bekennen, daß ich in allem Kummer um sie auch das schmerzliche Gefühl hatte, jung und – wie alle sagten – hübsch zu sein und nun schon den zweiten Winter in tödlicher Einsamkeit auf dem Lande zubringen zu müssen. Nach und nach erreichte die aus Gram, Einsamkeit und Langeweile gemischte Empfindung einen solchen Grad, daß ich das Zimmer nicht mehr verließ, das Klavier nicht mehr öffnete und kein Buch mehr zur Hand nahm. Wenn mir Katja zuredete, mich mit diesem oder jenem zu beschäftigen, gab ich zur Antwort: »Ich habe keine Lust – ich mag nicht!« – und im Herzen fragte eine Stimme: Warum denn? Warum etwas tun, wenn meine beste Lebenszeit so nutzlos vorübergeht? Warum? Und auf dies »Warum« hatte ich keine andere Antwort als Tränen.
Ich hörte sagen, daß ich mager würde und mich zu meinem Nachteil verändere, aber auch das ließ mich gleichgültig. Was lag daran? Wer kümmerte sich darum? Mir war zumute, als ob mein ganzes Leben in dieser trostlosen Öde, dieser rettungslosen Langeweile verfließen müßte, und dem zu entfliehen, hatte ich für mich allein nicht die Kraft, ja nicht einmal den Wunsch.
Zu Ende des Winters fing Katja an, für mich zu fürchten, und beschloß, mich so bald als möglich ins Ausland zu bringen. Dazu war Geld erforderlich, wir aber wußten kaum, was uns nach dem Tode der Mutter geblieben war, und warteten von Tag zu Tag auf den Vormund, der unsere Angelegenheiten ordnen sollte.
Im März kam der Vormund endlich.
»Gott sei Dank!« sagte Katja eines Tages, als ich wieder ohne Beschäftigung, ohne Gedanken, ohne Wünsche wie ein Schatten aus einer Ecke in die andere schlich. »Sergej Michailowitsch ist angekommen. Er hat hergeschickt, sich nach uns erkundigen zu lassen, und wird zum Mittagessen hier sein. Nimm dich zusammen, liebe Maschetschka«, fügte sie hinzu. »Was soll er denn von dir denken? Er hat euch so lieb! Er hat alle so liebgehabt.«
Sergej Michailowitsch war einer unserer Nachbarn und ein Freund meines verstorbenen Vaters, obwohl viel jünger als dieser. Abgesehen davon, daß seine Ankunft unser Leben anders gestaltete und uns vielleicht die Möglichkeit gab, das Landgut zu verlassen, war ich von Kindheit an gewohnt, ihn zu lieben und zu achten, und Katja wünschte, daß ich mich zusammennähme, weil sie erriet, daß es mir unter allen meinen Bekannten am schmerzlichsten gewesen wäre, Sergej Michailowitsch gegenüber in ungünstigem Lichte zu erscheinen.
Und nicht allein, daß ich ihn – wie alle im Hause, von Katja und seinem Patchen Sonja an bis zum letzten Pferdeknecht – liebhatte, er besaß für mich noch eine besondere Bedeutung wegen einer Äußerung, die meine Mutter einst in meiner Gegenwart getan hatte. Sie sagte: einen solchen Mann hätte sie mir gewünscht. Damals fand ich das sonderbar, ja sogar unangenehm, denn mein Ideal sah ganz anders aus. Mein Ideal war jung, hager, blaß und schwermütig. Sergej Michailowitsch dagegen war kein Jüngling mehr, war groß, stark und, wie mir schien, immer vergnügt. Trotzdem aber kamen mir die Worte der Mutter häufig in den Sinn, und schon sechs Jahre früher, als ich elf Jahre alt war, er noch du zu mir sagte, mit mir spielte und mich »Veilchen-Kind« zu nennen pflegte, fragte ich mich zuweilen mit einer gewissen Angst: Was soll ich tun, wenn er mich plötzlich heiraten will?
Kurz vor dem Mittagessen, dem Katja eine Mehlspeise, Creme und Spinatsauce zugefügt hatte, kam Sergej Michailowitsch. Ich sah ihn durchs Fenster, als er sich in einem kleinen Schlitten dem Hause näherte, eilte, sobald er um die Ecke bog, in den Salon und wollte mich stellen, als ob ich nicht auf ihn gewartet hätte. Als ich aber im Vorzimmer das Stampfen seiner Füße, seine laute Stimme und Katjas Schritte hörte, hielt ich’s nicht aus und ging ihm entgegen.
Er hielt Katjas Hand, sprach laut und lächelte. Sobald er mich sah, verstummte er, blieb stehen und blickte mich eine Weile an, ohne mich zu grüßen. Mir wurde unbehaglich zumute, und ich fühlte, daß ich errötete.
»Ach! Ist’s möglich? Sie sind’s!« sagte er dann in seiner einfachen, herzlichen Weise, indem er mit ausgestreckten Händen auf mich zukam. »Ist’s möglich, sich so zu verändern? Wie Sie gewachsen sind! Das soll unser Veilchen sein? Es ist eine volle Rose geworden.«
Mit seiner großen Hand ergriff er die meinige und drückte sie fest, beinahe schmerzhaft. Ich glaubte, er würde mir die Hand küssen, und hatte mich schon zu ihm geneigt, aber er drückte mir nur noch einmal die Hand und sah mir mit seinem festen, heiteren Blick gerade in die Augen.
Ich hatte ihn seit sechs Jahren nicht gesehen und fand ihn sehr verändert. Er war älter, dunkler geworden und trug einen starken Bart, der ihm nicht gut stand; aber er hatte dasselbe einfache, offene, ehrliche Wesen wie früher und dasselbe Gesicht mit den kräftigen Zügen, den klugen, blitzenden Augen und einem freundlichen, beinahe kindlichen Lächeln.
Nach fünf Minuten hatte er aufgehört, unser Gast zu sein, und war für uns alle ein Familienglied, selbst für unsere Leute, deren Diensteifer bewies, wie sehr sie sich über seine Ankunft freuten.
Er benahm sich nicht wie unsere anderen Nachbarn, die, wenn sie nach dem Tode unserer Mutter kamen, für nötig hielten, zu schweigen und zu weinen, solange sie bei uns blieben; er war im Gegenteil gesprächig, heiter und erwähnte die Mutter mit keinem Wort, so daß ich diese Gleichgültigkeit anfangs sonderbar und von einem so nahestehenden Freunde sogar unpassend fand. Später aber sah ich ein, daß es nicht Gleichgültigkeit, sondern Aufrichtigkeit war, und dankte ihm dafür.
Abends setzte sich Katja zum Tee-Einschenken auf den alten Platz im Salon, wie es bei Mama der Fall gewesen war. Ich und Sonja setzten uns neben sie, der alte Grigorij brachte Sergej Michailowitsch eine von des Vaters Pfeifen, und wie in früheren Zeiten fing er an, im Zimmer hin und her zu gehen.
»Wie viele traurige Veränderungen hier im Hause – wenn ich bedenke!« sagte er plötzlich, indem er stehenblieb.
»Ja!« antwortete Katja mit einem Seufzer, deckte den Samowar zu und machte ein Gesicht, als ob sie weinen wollte.
»Sie erinnern sich wohl Ihres Vaters?« fragte er, zu mir gewandt.
»Wenig!« gab ich zur Antwort.
»Wie gut wäre es jetzt für Sie, wenn Sie ihn hätten!« sagte er leise und nachdenklich, indem er auf meine Stirn niedersah. »Ich habe Ihren Vater sehr liebgehabt«, fügte er noch leiser hinzu, und ein feuchter Glanz kam in seine Augen.
»Der liebe Gott hat ihn uns genommen!« rief Katja, legte die Serviette auf die Teekanne und fing an zu weinen.
»Ja, traurige Veränderungen sind hier vorgegangen!« wiederholte er und wandte sich ab. »Sonja, zeige mir deine Spielsachen«, sagte er nach einer Pause und ging in den Saal hinaus. Mit Augen voll Tränen sah ich Katja an, als er hinausging.
»Das ist ein treuer Freund!« sagte sie.
»Ja, gewiß!« antwortete ich, und es wurde mir eigentümlich wohl und warm zumute bei dem Mitgefühl dieses fremden, guten Menschen.
Aus dem Saale klangen Sonjas Stimmchen und sein Scherzen mit ihr zu uns herein. Ich schickte ihm den Tee, und dann hörten wir, daß er sich ans Klavier setzte und mit Sonjas Händen auf die Tasten schlug.
»Maria Alexandrowna!« rief er nach einer Weile. »Bitte kommen Sie her, spielen Sie etwas.«
Es freute mich, daß er so einfach, freundschaftlich-befehlerisch mit mir sprach. Ich stand auf und ging zu ihm.
»Spielen Sie dies«, sagte er, indem er in einem Heft das Adagio der Beethovenschen Sonate quasi una fantasia aufschlug. »Lassen Sie sehen, wie Sie spielen«, fügte er hinzu und begab sich mit seinem Teeglas an das andere Ende des weiten Saales.
Ich fühlte – ich weiß nicht aus welchem Grunde –, daß es unmöglich war, sein Verlangen abzuschlagen oder Vorbemerkungen über schlechtes Spiel zu machen.
Gehorsam setzte ich mich ans Klavier und fing an zu spielen, so gut ich konnte; übrigens fürchtete ich sein Urteil, denn ich wußte, daß er ein Musikfreund und -kenner war.
Das Adagio sprach dieselben Gefühle der Erinnerung aus, die durch das Gespräch am Teetisch in mir wachgerufen waren, und mein Vortrag schien ihm zu genügen. Das Scherzo dagegen ließ er mich nicht spielen.
»Nein, das spielen Sie nicht gut«, sagte er herantretend. »Lassen Sie’s lieber. Das erste war nicht schlecht. Sie scheinen Verständnis für Musik zu haben.«
Dieses maßvolle Lob erfreute mich so sehr, daß ich errötete. Es war mir neu und angenehm, daß Sergej Michailowitsch, der Freund meines Vaters, ernsthaft und wie ein Gleichgestellter mit mir sprach, statt mich wie früher als Kind zu behandeln.
Katja ging hinauf, Sonja zu Bett zu bringen, und wir beide blieben allein im Saale.
Er erzählte mir von meinem Vater, wie er ihn kennengelernt und wie heiter sie miteinander verkehrt hatten, während ich noch bei meinen Schulbüchern und Spielsachen gesessen hatte. In seinen Erzählungen trat mir mein Vater zum ersten Male einfach als liebenswürdiger Mensch entgegen, wie ich ihn anzusehen bis jetzt noch nicht gelernt hatte. Später befragte er mich über meine Liebhabereien, meine Lektüre, wollte wissen, was ich jetzt vorzunehmen gedächte, und gab mir verschiedene Ratschläge. Er war nicht mehr mein heiterer, scherzender Spielkamerad, sondern ein ernster, einfacher, warmherziger Mann, der mir Achtung und Zuneigung einflößte. Mir war leicht und angenehm zumute, und doch fühlte ich einen gewissen Zwang, wenn ich mit ihm sprach. Ich fürchtete für jedes meiner Worte und wollte die Neigung, die ich jetzt nur dadurch erworben hatte, daß ich meines Vaters Tochter war, durch eigene Kraft verdienen.
Nachdem Katja mein Schwesterchen Sonja schlafen gelegt hatte, gesellte sie sich wieder zu uns und beklagte sich bei Sergej Michailowitsch über meine fast krankhafte Teilnahmslosigkeit, von der ich ihm nichts gesagt hatte.
»Die Hauptsache hat sie mir also nicht erzählt!« sagte er und schüttelte halb lächelnd, halb vorwurfsvoll den Kopf.
»Was ist davon zu erzählen?« antwortete ich. »Das ist sehr langweilig, und es geht vorüber.« – Mir schien es wirklich, als ob mein Trübsinn nicht nur vergehen würde, sondern als ob er schon verginge oder nie vorhanden gewesen sei.
»Es ist schlimm, die Einsamkeit nicht ertragen zu können«, sagte er. »Sind Sie denn ein wohlerzogenes Fräulein?«
»Freilich bin ich ein solches Fräulein«, gab ich lächelnd zur Antwort.
»Nein! Ein schlechtes Fräulein, das nur lebt, solange man ihm huldigt, und zusammensinkt und an nichts mehr Freude hat, alles nur für andere, nichts für sich selbst.«
»Sie haben eine schöne Meinung von mir«, antwortete ich, nur um etwas zu sagen.
»Nein«, sagte er nach kurzem Schweigen, »nicht umsonst sind Sie Ihrem Vater so ähnlich! Es steckt etwas in Ihnen …«, und sein guter, aufmerksamer Blick tat mir wohl und versetzte mich in freudige Verwirrung.
Erst jetzt bemerkte ich diesen nur ihm eigentümlichen Blick, der anfangs so heiter schien und dann immer forschender und selbst etwas traurig wurde.
»Sie sollen und Sie können sich nicht langweilen«, sagte er. »Sie haben die Musik, für die Sie Verständnis haben, Bücher, Studien aller Art – vor Ihnen liegt das ganze Leben, auf das Sie sich nur jetzt vorbereiten können, wenn Sie später nichts zu bereuen haben wollen. In einem Jahr schon ist es zu spät.«
Er sprach mit mir wie ein Vater oder Onkel. Ich fühlte, wie er sich Mühe gab, sich mit mir auf gleichen Fuß zu stellen. Es kränkte mich, daß er glaubte, sich zu mir herablassen zu müssen, und es war mir auch wieder schmeichelhaft, daß er für nötig hielt, um meinetwillen anders zu sein als sonst.
Den Rest des Abends sprach er mit Katja über Geschäftssachen.
»Und nun leben Sie wohl, meine lieben Freundinnen«, sagte er schließlich, indem er aufstand, zu mir trat und meine Hand faßte.
»Wann sehen wir uns wieder?« fragte Katja.
»Im Frühling«, antwortete er und hielt noch immer meine Hand. »Jetzt gehe ich nach Danilowka (unser zweites Landgut), sehe zu, wie es dort steht, richte ein, was ich kann, und begebe mich dann – auch wegen meiner eigenen Angelegenheiten – nach Moskau. Im Sommer sehen wir uns öfter.«
»Warum wollen Sie so lange fort?« fragte ich betrübt. Ich hatte schon gehofft, ihn täglich zu sehen, und war über das Fehlschlagen dieser Hoffnung so bestürzt, daß meine ganze Mutlosigkeit wiederkehrte.
Wahrscheinlich drückte sich dies in meiner Stimme und meinem Blick aus, denn Sergej Michailowitsch sagte: »Ja, Sie müssen sich mehr beschäftigen, dürfen nicht wieder schwermütig werden.« Dabei war sein Ton, wie mir schien, viel zu ruhig und kalt.
»Im Frühling werde ich Sie prüfen«, fügte er hinzu, ließ meine Hand fallen und sah mich nicht an.
Im Vorzimmer, wohin wir ihn begleitet hatten, beeilte er sich, den Pelz anzuziehen, und vermied noch immer, mich anzusehen.
Warum gibt er sich diese unnötige Mühe? dachte ich. Ist’s möglich, daß er glaubt, es wäre mir so angenehm, wenn er mich ansieht? Er ist ein guter Mensch – ein sehr guter –, aber das ist auch alles!
Diesen Abend konnten Katja und ich lange nicht einschlafen und sprachen immer wieder – nicht von ihm, sondern wie wir den künftigen Sommer verleben und wo und wie wir den nächsten Winter zubringen würden. Die trostlose Frage: warum? kam mir nicht in den Sinn. Es schien mir klar und selbstverständlich, daß wir leben, um glücklich zu sein – und in der Zukunft sah ich Glück in Fülle. Unser altes, finsteres Haus in Pokrowskoje war plötzlich wie von Licht und Leben erfüllt.
II. Kapitel
Der Frühling kam, und mein Trübsinn verschwand und verwandelte sich in schwärmerisches Sehnen voll unklarer Hoffnungen und Wünsche. Ich lebte jetzt ganz anders als bisher, beschäftigte mich bald mit Sonja, bald mit Musik, bald mit meinen Büchern, ging oft in den Garten, irrte lange, lange in den Alleen umher oder saß auf einer Bank, dachte an Gott weiß was, träumte und hoffte. Zuweilen blieb ich ganze Nächte lang – besonders im Mondschein – am Fenster meines Zimmers oder schlüpfte, in einen Mantel gehüllt, heimlich, daß es Katja nicht bemerkte, in den Garten hinaus und wanderte im Tau am Teich entlang; einmal ging ich sogar ins Feld und lief allein in der nächtlichen Stille um den ganzen Garten herum.
Es fällt mir schwer, mich jetzt der Träumereien, die damals meine Phantasie erfüllten, zu erinnern und sie festzuhalten. Selbst wenn ich mich darauf besinne, wird es mir schwer zu glauben, daß dies wirklich meine Träume waren – so seltsam waren sie und so ganz dem Leben entrückt.
Ende Mai kehrte Sergej Michailowitsch, wie er versprochen hatte, von seiner Reise zurück.
Zu uns kam er das erste Mal an einem Abend, an dem wir ihn nicht erwarteten. Wir saßen auf der Terrasse und wollten eben Tee trinken. Der ganze Garten war schon grün, im Gebüsch hatten sich die Nachtigallen eingenistet, um die Petrifastenzeit zu feiern. Die struppigen Fliedersträucher waren über und über mit Weiß und Lila besät. Die Blüten wollten eben aufbrechen. Das durchsichtige Laub der Birkenallee wurde von der untergehenden Sonne durchleuchtet. Die Terrasse lag im kühlen Schatten. Reichlicher Nachttau breitete sich über die Grasflächen. Vom Hof klangen die letzten Tageslaute und die Stimmen der heimgetriebenen Herde herüber; der einfältige Nikon fuhr mit der Wassertonne längs der Terrasse hin, und der kalte Strahl aus seiner Gießkanne bildete auf der frisch umgegrabenen Erde dunkle Kreise um die Stäbe der Georginen. Auf der Terrasse blitzte und brodelte der blank geputzte Samowar, und auf der weißen Serviette standen Sahne, Brezeln und anderes Gebäck. Katja spülte mit ihren rundlichen Händen in ihrer häuslichen Weise die Tassen. Ich konnte – da mich nach dem Bade hungerte – den Tee nicht erwarten und aß im voraus Brot mit frischer dicker Sahne. Ich trug eine leinene Bluse mit offenen Ärmeln und hatte über das nasse Haar ein weißes Tuch gebunden.
Katja war die erste, die den Ankommenden erblickte. »Ach, Sergej Michailowitsch!« sagte sie. »Wir haben eben von Ihnen gesprochen.«
Ich sprang auf und wollte flüchten, um mich umzukleiden, aber er hielt mich an, als ich eben in die Tür schlüpfte. »Wozu die Umstände auf dem Lande?« sagte er, indem er mein Kopftuch lächelnd ansah. »Sie genieren sich doch nicht vor Grigorij, und ich bin wirklich für Sie nichts anderes als er.« Mir kam es freilich vor, als ob er mich in anderer Weise ansähe, als es Grigorij tat, und ich fühlte mich befangen.
»Ich komme gleich wieder«, antwortete ich und machte mich von ihm los.
»Was haben Sie gegen Ihren Anzug?« rief er mir nach. »Sie sehen aus wie ein Bauernmädchen.« Wie sonderbar er mich angesehen hat! dachte ich, während ich mich oben eilig umkleidete. Gott sei Dank, daß er wieder da ist – nun wird sich unser Leben heiterer gestalten.
Nachdem ich mich im Spiegel betrachtet hatte, lief ich vergnügt die Treppe hinunter, und ohne verbergen zu wollen, daß ich mich beeilt hatte, trat ich atemlos auf die Terrasse.
Er saß am Tisch und sprach mit Katja über Geschäftssachen. Als er mich erblickte, lächelte er, fuhr aber mit seinem Bericht fort. Seinen Mitteilungen nach befanden sich unsere Angelegenheiten im besten Stande. Wir sollten nur noch den Sommer auf dem Lande zubringen und dann zu Sonjas Erziehung entweder nach Petersburg gehen oder ins Ausland.
»Ja, wenn Sie mit uns ins Ausland reisen wollten!« sagte Katja. »Allein würden wir uns vorkommen, als ob wir uns im Wald verirrt hätten.«
»Ach, wie gerne reiste ich mit Ihnen um die Welt!« antwortete er halb scherzend, halb im Ernst. »Gut denn«, sagte ich, »lassen Sie uns eine Reise um die Welt antreten.«
Er lächelte und schüttelte den Kopf.
»Und mein Mütterchen, und meine Geschäfte?« antwortete er. »Aber lassen wir das – erzählen Sie mir lieber, wie Sie gelebt haben. Waren Sie wieder verdrießlich?« Als ich ihm erzählte, daß ich mich eifrig beschäftigt und gar nicht gelangweilt hätte, und als Katja meine Worte bestätigte, lobte er mich und liebkoste mich mit Worten und Blicken, als ob ich ein Kind wäre und er ein Recht dazu hätte. Mir kam es wie etwas Notwendiges vor, ihm alles Gute, was ich getan hatte, ausführlich und offenherzig mitzuteilen, ihm aber auch alles, womit er unzufrieden sein konnte, wie in der Beichte zu gestehen. Der Abend war so schön, daß wir nach dem Abräumen des Teetisches auf der Terrasse blieben, und unser Gespräch interessierte mich so sehr, daß ich nicht bemerkte, wie nach und nach das Geräusch der menschlichen Tätigkeit um uns verstummte. Von allen Seiten kam der Blumenduft stärker zu uns, reichlicher Tau netzte das Gras, im nahen Fliederbusch sang die Nachtigall und verstummte, als sie unsere Stimmen hörte. Und es war, als ob der Sternenhimmel sich zu uns herniederließe.
Daß es dunkel geworden war, bemerkte ich erst, als plötzlich eine Fledermaus lautlos unter das Segeltuchdach der Terrasse flog und zappelnd mein weißes Tuch streifte. Ich drückte mich an die Wand und war im Begriff zu schreien, als die Fledermaus ebenso lautlos und schnell unter dem Dache fortflog und im Halbdunkel des Gartens wieder verschwand.
»Wie ich Ihr Pokrowskoje liebhabe!« sagte er, das Gespräch unterbrechend. »Mein ganzes Leben möchte ich hier so auf der Terrasse sitzen.« »Tun Sie’s doch!« sagte Katja.
»Ja – tun Sie’s doch«, wiederholte er, »das Leben erlaubt es nicht!«
»Warum heiraten Sie nicht?« fragte Katja. »Sie würden ein ausgezeichneter Ehemann sein.«
»Weil ich gern stillsitze?« sagte er lächelnd. »Nein, Katharina Karlowna, für Sie und für mich ist’s zu spät zum Heiraten. Alle meine Bekannten haben schon lange aufgehört, mich als heiratsfähigen Mann zu betrachten, und ich selbst noch viel länger – seit der Zeit ist mir erst wohl geworden, wahrhaftig!«
Es kam mir vor, als ob er die letzten Worte mit erzwungener Lebhaftigkeit sagte.
»Das ist hübsch – sechsunddreißig Jahre alt, und schon mit dem Leben abgeschlossen!« rief Katja.
»Und wie abgeschlossen!« fuhr er fort. »Stillsitzen ist mein einziger Wunsch, und zum Heiraten ist anderes nötig. Fragen Sie die da«, fügte er hinzu, indem er mit einem Kopfnicken auf mich deutete. »Die da müssen wir verheiraten – an ihr werden wir beide uns erfreuen.« In seinem Ton lag eine versteckte Wehmut und eine Selbstbeherrschung, die mir nicht entging. Er verstummte eine Weile, und weder ich noch Katja unterbrachen das Schweigen. »Stellen Sie sich einmal vor«, fing er wieder an, indem er sich auf dem Stuhl umwandte, »stellen Sie sich einmal vor, daß ich durch eine unglückliche Fügung dazu käme, ein siebzehnjähriges Mädchen zu heiraten, etwa Masch – Maria Alexandrowna. Das ist ein vortreffliches Beispiel, ich freue mich, daß ich es gefunden habe. Es ist das allerbeste Beispiel.«
Ich lachte und konnte nicht begreifen, warum er sich freute und was er gefunden haben wollte.
»Hand aufs Herz – sagen Sie mir die Wahrheit«, wandte er sich zu mir. »Wäre es nicht ein Unglück für Sie, Ihr Leben mit einem alten, ausgedienten Mann zu vereinigen, der nur stillsitzen mag, während in Ihnen Gott weiß was gärt und treibt und Gott weiß welche Wünsche sich regen?« Mir wurde unbehaglich zumute. Ich schwieg und wußte nicht, was ich antworten sollte. »Ich mache Ihnen ja keinen Antrag«, fuhr er lachend fort, »aber gestehen Sie nur – Sie träumen nicht von einem solchen Mann, wenn Sie abends allein in der Gartenallee umherwandeln. Ein solcher Mann wäre auch gewiß ein Unglück für Sie.«
»Ein Unglück gerade nicht …«, fing ich an.
»Aber doch kein Glück!« fügte er hinzu.
»Nein! Aber ich irre mich vielleicht …«
Er fiel mir wieder ins Wort. »Sehen Sie wohl!« rief er aus. »Und sie hat vollkommen recht, und ich bin ihr dankbar für diese Aufrichtigkeit. Es freut mich, daß wir dieses Gespräch gehabt haben. Übrigens ist das noch das wenigste, für mich wäre das Unglück noch größer«, fügte er hinzu.
»Welch ein Sonderling Sie sind! Sie haben sich gar nicht verändert!« sagte Katja und verließ die Terrasse, um das Abendessen anzuordnen. Nachdem uns Katja verlassen hatte, wurden wir beide still, wie alles um uns her. Nur die Nachtigall sang, aber nicht mehr wie gestern in abgebrochenen, zaudernden Sätzen, sondern in langgedehnten, ruhigen Tönen, die den ganzen Garten mit ihrem Klang überströmten. Und dann ließ, zum ersten Male an diesem Abend, eine zweite Nachtigall vom Hohlweg herüber ihre Antwort erschallen. Die erste schwieg einen Augenblick, als ob sie lauschte, um dann noch lautere, vollere, klangreichere Triller über den Garten auszugießen. In ruhiger Majestät tönten diese Stimmen durch die nächtliche Welt.
Der Gärtner ging vorüber, sich im Gewächshaus schlafen zu legen; seine schweren Schritte verhallten nach und nach in der Ferne. Drüben am Berge wurde zweimal gellend gepfiffen, dann war alles wieder still. Kaum hörbar fing das Laub sich an zu wiegen, das Sonnendach der Terrasse wehte leise hin und her, und mit der bewegten Luft kamen Düfte heran und ergossen sich über die Terrasse.
Nach dem, was zuletzt gesprochen worden war, wurde mir das Schweigen peinlich; aber ich wußte nicht, was ich sagen sollte. Seine Augen blitzten mich im Halbdunkel an.
»Es ist doch schön zu leben!« sagte er endlich.
Ich atmete schwer auf.
»Was haben Sie?«
»Es ist doch schön zu leben!« wiederholte ich.
Dann schwiegen wir wieder, und mein Unbehagen wuchs. Ich sagte mir selbst, daß ich ihn kränkte, als ich zugegeben hatte, daß er alt sei, und wünschte ihn zu versöhnen, wußte aber nicht wie.
»Leben Sie wohl!« sagte er plötzlich, indem er sich erhob. »Meine Mutter erwartet mich zum Abendessen, ich habe sie heute kaum gesehen.«
»Ich wollte Ihnen eine neue Sonate vorspielen …«, fing ich an.
»Ein anderes Mal«, sagte er ziemlich kühl, wie mir schien. »Leben Sie wohl!«
Ich glaubte jetzt noch mehr, daß ich ihn gekränkt hätte, und es tat mir leid. Katja und ich begleiteten ihn die Freitreppe hinunter, blieben auf dem Hof stehen und sahen ihm nach, bis er verschwunden war. Während der Hufschlag seines Pferdes in der Ferne verklang, kehrte ich auf die Terrasse zurück. Ich blickte abermals in den Garten hinunter, und in dem feuchten Nebelschleier, in dem die Töne der Nacht verschwammen, hörte und sah ich noch alles, was ich hören und sehen wollte.
Nachdem er ein zweites und drittes Mal bei uns gewesen war, verschwand das Unbehagen, das mir von dem sonderbaren Gespräch zurückgeblieben war, und kehrte nicht wieder. Den ganzen Sommer über kam er nun wöchentlich zwei-bis dreimal, und ich gewöhnte mich so an ihn, daß ich – wenn er einmal länger ausblieb – das Gefühl hatte, als ob es mir schwer würde, ohne ihn zu leben, und ich zürnte ihm und fand, daß er unrecht tat, mich allein zu lassen. Er behandelte mich wie einen lieben jüngeren Kameraden, fragte mich auf die herzlichste Weise aus, gab mir Rat und trieb mich an. Zuweilen schalt er auch oder hielt mich von etwas zurück; aber trotz seines Bemühens, sich mir gleichzustellen, fühlte ich, daß unter dem, was ich von ihm kannte, noch eine ganze mir fremde Welt verborgen lag, in die mich einzulassen er nicht für nötig hielt. Gerade das zog mich am stärksten an und erhöhte meine Achtung vor ihm.
Von Katja und den Nachbarn wußte ich, daß er außer von den Sorgen um die alte Mutter, die bei ihm lebte, der Bewirtschaftung seines Gutes und unserer Vormundschaft noch von gewissen Adelsangelegenheiten, die ihm manchmal Mühe und Verdruß bereiteten, in Anspruch genommen wurde. Aber wie er das alles ansah, welche Meinungen, Pläne, Hoffnungen er hatte, darüber konnte ich nichts von ihm erfahren. Sobald ich die Unterhaltung auf seine Angelegenheiten brachte, runzelte er die Stirn in der ihm eigenen Weise, als ob er sagen wolle: »Bitte, lassen Sie das – was kann Ihnen daran liegen?«, und lenkte das Gespräch auf andere Dinge.
Anfangs kränkte mich das, aber nach und nach gewöhnte ich mich so daran, nur von dem zu sprechen, was sich auf mich bezog, daß ich es natürlich fand.
Was mir auch anfangs nicht gefiel, später aber angenehm wurde, war seine vollständige Gleichgültigkeit und Nichtachtung gegen mein Äußeres. Nie sagte er mir, weder mit Wort noch Blick, daß ich schön wäre; im Gegenteil, er runzelte die Stirn oder lachte, wenn man mich in seiner Gegenwart hübsch nannte. Es machte ihm sogar Freude, äußerliche Mängel an mir zu finden und mich damit zu necken. Modische Kleider oder Haartrachten, mit denen mich Katja bei feierlichen Gelegenheiten gern schmückte, riefen nur seinen Spott hervor; was dann die gute Katja kränkte und mich anfangs an ihm irremachte.
Katja, die überzeugt war, daß ich ihm gefiel, begriff nicht, daß er es nicht gern sah, wenn ich mich im vorteilhaftesten Licht zeigte. Ich verstand aber sehr bald, was er wollte: er wünschte mich frei von Eitelkeit zu sehen, und sobald ich das erkannt hatte, blieb wirklich nicht ein Schatten von Koketterie in meiner Kleidung, meiner Haartracht und meinem Benehmen; dafür aber fing ich an, mit Einfachheit zu kokettieren, solange ich noch nicht wirklich einfach zu sein vermochte. Ich wußte, daß er mich liebhatte; ob wie ein Kind oder wie ein Weib, fragte ich mich noch nicht; aber seine Liebe war mir wert, und indem ich fühlte, daß er mich für das beste Mädchen hielt, war ich nicht imstande zu wünschen, daß ihm sein Irrtum klar würde, und fing unwillkürlich an, ihn zu täuschen. Indem ich das tat, wurde ich jedoch besser. Ich fühlte, daß es etwas Edleres und Würdigeres war, ihm die Vorzüge meiner Seele zu zeigen als die Reize des Äußern. Mein Haar, meine Hände, meine Züge, meine Haltung waren ihm mit allem, was gut oder schlecht daran sein mochte, so genau bekannt, daß in bezug darauf keine Täuschung möglich gewesen wäre. Meine Seele aber kannte er nicht, weil er sie liebte, weil sie gerade zu jener Zeit wuchs und sich entwickelte, und was sie betraf, konnte ich ihn täuschen und tat es auch. Wie leicht wurde mir zumute, als ich das erkannte! Meine grundlose Befangenheit verschwand vollständig; ich fühlte, daß er mich immer beobachtete und daß ich ihm – mochte ich mich zeigen, wie ich wollte, sitzend oder stehend, so oder so gekleidet und frisiert – immer gefiel, wie ich eben war. Ich glaube, wenn er gegen seine Gewohnheit plötzlich gesagt hätte, er fände mich schön, würde mir das nicht angenehm gewesen sein. Wie erquickend war es dagegen und wie hell wurde es in meiner Seele, wenn er mit einer Rührung, die er unter einem scherzenden Ton zu verbergen suchte, zu mir sagte:
»Ja, Sie haben etwas in sich. Sie sind ein prächtiges Mädchen – das muß ich Ihnen sagen.«
Und warum wurde mir damals solches Lob zuteil, das mein Herz mit Stolz und Freude erfüllte? Weil ich gesagt hatte, daß ich die Liebe des alten Grigorij für seine Enkelin nachfühlen könne, oder weil ich über ein Gedicht oder einen Roman zu Tränen gerührt war, oder weil mir Mozart besser gefiel als Schulhof. Und merkwürdig erscheint es mir jetzt, mit welchem außerordentlichen Instinkt ich erriet, was gut war und was ich schätzen sollte, obgleich ich damals durchaus kein klares Urteil über das hatte, was gut war und was ich schätzen sollte.
Die meisten meiner früheren Gewohnheiten und Neigungen sagten ihm nicht zu; aber er brauchte nur mit einer Bewegung der Augenbrauen, mit einem Blick anzudeuten, daß er mit dem, was ich sagen wollte, nicht einverstanden war – und seine abweisende oder geringschätzige Miene genügte, mich zu überzeugen, daß mir, was ich früher gern gehabt hatte, nicht mehr gefiel.
Wie oft, wenn er mir einen Rat geben wollte, wußte ich schon im voraus, was er sagen würde. Er befragte mich, indem er mir nur in die Augen sah, und sein Blick rief die Einfälle hervor, die er in mir zu finden wünschte. So waren denn alle meine damaligen Gedanken und alle meine Gefühle nicht die meinen, sondern seine Gedanken und Gefühle, die plötzlich die meinen wurden, in mein Leben übergingen und es erleuchteten.
Mir unbewußt fing ich an, alles mit andern Augen anzusehen: Katja, unsere Dienstleute, Sonja, mich selbst und meine Beschäftigungen. Das Lesen, das ich früher nur getrieben hatte, um die Langeweile zu töten, wurde plötzlich eine meiner liebsten Freuden, weil ich mit ihm darüber sprach, mit ihm zusammen las oder weil er mir die Bücher brachte. Früher war mir die Beschäftigung mit Sonja und ihr Unterricht eine schwere Aufgabe, die ich nur aus Pflichtgefühl erfüllte. Nun aber wohnte er zuweilen dem Unterricht bei, und es wurde mein Stolz, Sonjas Leistungen zu fördern. Ein gutes Musikstück zu üben, schien mir ehemals unmöglich; aber nun ich wußte, daß er es hören und mich vielleicht dafür loben würde, konnte ich dieselbe Stelle, ohne zu ermüden, vierzigmal wiederholen, so daß sich die arme Katja die Ohren mit Watte verstopfte. Meine alten Sonaten bekamen einen anderen Inhalt, einen anderen, lebendigeren Ausdruck. Sogar Katja, die ich kannte und liebte wie mich selbst, wurde eine andere in meinen Augen. Erst jetzt kam mir zum Bewußtsein, daß sie nicht die Verpflichtung hatte, Mutter, Freundin, Sklavin für uns zu sein, wie sie es war; erst jetzt verstand ich die ganze Aufopferung und Ergebenheit dieses liebreichen Wesens, begriff, wie tief ich in ihrer Schuld war, und fing an, sie noch mehr zu lieben als bisher.
Auch unsere Leute: Bauern, Hofgesinde, Mägde, lehrte er mich anders ansehen. Es klingt seltsam, aber ich hatte bis zu meinem siebzehnten Jahre unter diesen Menschen gelebt und war ihnen fremder geblieben als anderen, die ich kaum zu sehen bekam. Ich hatte nie bedacht, daß diese Menschen ebenso liebten, wünschten und litten wie ich … Unser Garten und unsere Wälder und Felder, die ich so lange kannte, wurden mir plötzlich etwas Neues und Schönes.
Nicht umsonst sagte er, es gäbe nur ein unzweifelhaftes Glück: das Leben für andere. Anfangs kam mir das sonderbar vor; ich verstand es nicht. Doch nach und nach drang mir seine Überzeugung ohne alle Gedankenarbeit ins Herz. Er öffnete mir eine ganze Welt von Freuden, ohne in meinem Leben etwas zu ändern und ohne jedem Eindruck etwas anderes hinzuzufügen als sich selbst. Alles, was mich seit frühester Kindheit schweigend umgeben hatte, war plötzlich zum Leben erwacht. Er brauchte nur zu kommen, damit alles sprach und wetteifernd in meine Seele drang, um sie mit Glück zu erfüllen.
Oft, wenn ich in diesem Sommer in mein Zimmer hinaufging und mich niederlegte, konnte ich nicht schlafen; aber anstatt der früheren Frühlingsschwermut, der Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft, durchbebte mich das Gefühl gegenwärtigen Glücks. Zuweilen stand ich wieder auf, setzte mich auf Katjas Bett und sagte ihr, wie glücklich ich war – was, wie ich jetzt erkenne, gar nicht nötig gewesen wäre, da sie es selbst sah. Auch sie sagte mir dann, indem sie mich küßte, daß sie keine Wünsche habe, daß sie sich glücklich fühle, und ich glaubte ihr. Es erschien mir notwendig und gerecht, daß alle glücklich wären.
Zuweilen freilich wollte Katja schlafen, stellte sich erzürnt, schickte mich zu Bett und schlummerte ein, während ich noch lange wach lag und mich in die Betrachtung alles dessen versenkte, was mein Glück ausmachte. Es kam aber auch vor, daß ich mich wieder erhob, niederkniete und zum zweiten Male betete, mit eigenen Worten betete, um Gott für alles Gute zu danken, das er mir gegeben hatte.
Wie still war es dann im Zimmer! Nur die gleichmäßigen Atemzüge der schlafenden Katja waren zu hören oder das Ticken der Uhr, die neben ihr lag, oder das Summen einer Fliege. Und ich flüsterte meine Gebete, bekreuzigte mich oder küßte das Kreuz an meinem Hals. Die Tür war zu, die Fensterläden waren geschlossen, und ich wünschte, dieses Zimmer niemals wieder zu verlassen. Ich hatte kein Verlangen, daß der Morgen anbräche, und nur den einen Wunsch, daß die seelische Atmosphäre, die mich umfing, sich nie verflüchtigen möge. Meine Träume, Gedanken und Gebete erschienen mir als lebendige Wesen, die hier im Dunkeln mit mir lebten, mein Bett umschwärmten und über mir schwebten. Und jeder Gedanke war sein Gedanke, jedes Gefühl sein Gefühl. Damals wußte ich noch nicht, daß das Liebe war; ich glaubte, daß es immer so bleiben könnte und daß es, um so zu empfinden, nicht eines besonderen Anlasses bedürfe.
III. Kapitel
Eines Nachmittags, zur Zeit der Kornernte, gingen Katja, Sonja und ich in den Garten auf unsere Lieblingsbank im Schatten der Linde am Hohlwege, hinter dem sich eine Aussicht auf Wald und Felder öffnete.
Sergej Michailowitsch war schon zwei, drei Tage nicht bei uns gewesen, und heute erwarteten wir ihn um so sicherer, als wir durch unseren Verwalter wußten, daß er versprochen hatte, aufs Feld zu kommen. Gegen zwei Uhr sahen wir ihn auch wirklich zu den mit der Ernte beschäftigten Leuten hinausreiten. Katja befahl, Pfirsiche und Kirschen zu bringen, die er sehr gern aß, und indem sie mich lächelnd ansah, rückte sie sich auf der Bank zurecht und schlummerte ein. Ich brach einen Lindenzweig mit saftigen Blättern und saftigem Bast, der mir die Hand feucht machte. Damit fächelte ich Katja, indem ich zu lesen fortfuhr, mich darin aber immerwährend unterbrach und auf den Feldweg sah, auf dem er kommen mußte.
Sonja saß auf den Wurzeln einer alten Linde und baute eine Laube für ihre Puppen. Der Tag war heiß, die Luft regungslos, der Boden duftete stark, und die dunklen Wolken, in denen vom frühen Morgen an ein Gewitter braute, hatten sich eine Weile zusammengezogen. Ich war aufgeregt, wie immer vor dem Gewitter. Aber jetzt fingen die Wolken an, sich zu zerteilen und aufzulösen; die Sonne drang durch, der Himmel klärte sich; nur in weiter Ferne ließ sich dann und wann ein Donner hören, und aus den schweren Wolken, die noch am Horizont lagen und sich mit dem Staub des Feldes zu mischen schienen, fuhr dann und wann das blasse Zickzack eines Blitzes zur Erde nieder. Für heute war also das Gewitter, wenigstens an unserer Gegend, vorübergegangen.
Auf dem Weg, der hinter dem Garten hie und da sichtbar wurde, kamen unaufhörlich Wagen vorbei, die sich bald, hoch mit Garben beladen, langsam und knarrend vorüberschleppten, bald rasselnd wieder hinausfuhren, während der Bauer mit zitternden Beinen und flatterndem Hemde daraufstand. Der dicht aufwirbelnde Staub wurde nicht fortgetrieben und sank nicht zu Boden, sondern blieb hinter dem geflochtenen Zaun zwischen den durchsichtigen Laubkronen der Bäume förmlich stehen. Von der Scheune herüber klangen Stimmen und Räderknarren, die Garben, die langsam am Zaun vorübergefahren waren, flogen dort durch die Luft, und bald wuchsen vor meinen Augen große, spitzig zulaufende Korndiemen in die Höhe, auf denen sich die Gestalten der Bauern regten.
Auch auf dem staubigen Feld war buntes Treiben zu sehen, und Wagengerassel, Stimmen und Gesänge klangen von weitem herüber. Auf der einen Seite wurde der Acker leerer und leerer. Zwischen dem gemähten Korn zeigten sich grüne, mit Wermut bewachsene Raine und die hellen Gestalten der Binderinnen, die das Getreide zusammenbanden und die Garben aufstellten. Es war, als ob sich vor meinen Augen der Sommer in Herbst verwandelte. Staub und Hitze waren überall, nur nicht an unserem Lieblingsplätzchen im Garten. Von allen Seiten wogte in diesem Staub, dieser Hitze, in glühender Sonne, schwatzend und die Hände regend das Arbeitsvolk.
Aber Katja schlummerte währenddessen sanft atmend unter dem weißen Batisttuche auf unserer kühlen Bank; schwarzglänzende, saftige Kirschen standen auf dem Tisch; unsere Kleider waren frisch und rein; das Wasser im Krug spielte in Regenbogenfarben in der Sonne, und mir war so wohl!
Was tun? dachte ich. Wodurch habe ich es verdient, daß ich so glücklich bin? Und wie kann ich mein Geschick teilen, wie mich und all mein Glück anderen hingeben und wem?
Die Sonne versank schon hinter den Wipfeln der Lindenallee, der Staub im Felde legte sich, die Ferne war in der Seitenbeleuchtung klarer und deutlicher zu sehen, und die Wetterwolken verschwanden vollständig. Im Hofe hinter den Bäumen waren drei neue Diemen zu sehen, von denen die Bauern eben herunterkletterten, und unter dem Geschrei der Fahrenden rasselten die Wagen, sichtlich zum letzten Mal, vorüber. Weiber mit Rechen auf der Schulter und Strohseilen am Gürtel zogen singend nach Haus. Aber Sergej Michailowitsch kam noch immer nicht, obwohl ich längst gesehen hatte, daß er die Höhe herabgeritten war.
Plötzlich zeigte sich seine Gestalt in der Allee von der Seite, wo ich ihn nicht erwartete (er war nicht durch den Hohlweg gekommen). Mit heiterem, leuchtendem Gesicht und entblößtem Haupt kam er raschen Schrittes auf mich zu. Als er bemerkte, daß Katja schlief, preßte er die Lippen zusammen, kniff die Augen zu und ging auf den Zehen. Ich bemerkte sogleich, daß er sich in jener eigentümlichen Stimmung grundloser Lustigkeit befand, die mir so besonders lieb an ihm war und die wir »wildes Entzücken« zu nennen pflegten. Er war dann wie ein Schulknabe, der dem Unterricht entronnen ist, und sein ganzes Wesen vom Kopf bis zu den Füßen atmete Fröhlichkeit, Glück und kindliche Ausgelassenheit.
»Guten Tag, junges Veilchen! Wie geht’s? Gut?« sagte er leise, indem er herantrat und mir die Hand drückte.
»Mir ausgezeichnet«, antwortete er auf meine Frage, »heute bin ich dreizehn Jahre alt, ich hätte Lust, Pferdchen zu spielen und auf Bäume zu klettern.«
»In wildem Entzücken also?« sagte ich, indem ich seine lachenden Augen ansah und fühlte, daß das »wilde Entzücken« auch auf mich überging.
»Ja!« antwortete er, mit einem Auge blinzelnd und ein Lächeln zu unterdrücken suchend. »Aber warum wird denn Katharina Karlowna auf die Nase geschlagen?« Da ich ihn ansah, während ich mit dem Zweige zu fächeln fortfuhr, hatte ich nicht bemerkt, daß ich das Tuch von Katjas Gesicht gestreift hatte und sie mit den Blättern berührte.
Ich lachte.
»Sie wird behaupten, daß sie gar nicht geschlafen habe«, sagte ich ganz leise, weniger um sie nicht zu wecken, als weil es mir angenehm war, leise mit ihm zu sprechen.
Er ahmte die Bewegungen meiner Lippen nach, als ob er ausdrücken wollte, daß ich zu leise spräche, um verstanden zu werden. Dann erblickte er den Teller mit den Kirschen, griff danach wie verstohlen, ging zu Sonja unter die Linden und setzte sich auf ihre Puppen. Sonja war böse, aber er versöhnte sich bald mit ihr, indem er ihr das Spiel vorschlug, daß sie um die Wette Kirschen essen wollten.
»Wünschen Sie, daß ich noch welche bringen lasse«, sagte ich, »oder wollen wir selbst welche holen?«
Er nahm den Teller, legte die Puppen darauf, und so gingen wir nach dem Gewächshaus; Sonja lief lachend hinter uns her und zog ihn am Rockschoße, damit er ihr die Puppen wiedergäbe. Er erfüllte ihr Verlangen und wandte sich zu mir.
»Nun, sind Sie etwa kein Veilchen?« sagte er noch immer leise, obwohl hier nicht zu fürchten war, daß er jemand weckte. »Als ich vorhin aus all dem Staub, der Hitze, der Arbeit in Ihre Nähe kam, umfing mich gleich ein Veilchenduft – und nicht der Duft der Treibhausveilchen, sondern jener ersten, dunklen, die im tauenden Schnee im Frühlingsgras sprießen.«
»Und wie steht es? Geht in der Wirtschaft alles gut?« fragte ich, um die süße Verwirrung zu verbergen, die seine Worte in mir hervorgerufen hatten.
»Ausgezeichnet! Diese Leute sind immer ausgezeichnet. Je mehr man sie kennenlernt, um so lieber hat man sie.«
»Ja«, erwiderte ich. »Heute, ehe Sie kamen, sah ich vom Garten aus den Arbeitern zu und fühlte mich beschämt, daß sie sich abmühen, während ich es so gut habe und …«
»Kokettieren Sie damit nicht, liebe Freundin«, unterbrach er mich und nahm plötzlich einen ernsten Ton an, sah mir dabei aber freundlich in die Augen, »das ist etwas Heiliges … Gott behüte Sie davor, sich damit schmücken zu wollen!« »Ich sage das ja nur Ihnen!«
»Nun ja, das weiß ich! Wo sind die Kirschen?«
Das Gewächshaus war verschlossen und keiner der Gärtner zu sehen. (Er hatte sie alle mit aufs Feld geschickt.) Sonja lief den Schlüssel holen; aber er wollte nicht darauf warten, kletterte an dem Mauerwerk hinauf, hob das Netz ab und sprang hinein.
»Wollen Sie welche haben? Geben Sie mir den Teller!« hörte ich seine Stimme von innen.
»Nein, ich will selbst pflücken; ich werde den Schlüssel holen«, sagte ich, »Sonja findet ihn nicht.«
Aber in demselben Augenblick überkam mich das Verlangen zu verfolgen, was er tun, wie er aussehen und sich bewegen würde, während er unbeobachtet zu sein glaubte. Vielleicht trieb mich auch einfach der Wunsch, ihn nicht einen Augenblick aus den Augen zu verlieren. Auf den Zehen lief ich durch das Unkraut auf die andere Seite um das Gewächshaus herum, wo es niedriger war, und stieg auf eine leere Tonne, so daß die Mauer mir nur noch bis an die Brust reichte, bog mich hinunter und übersah das Innere des ganzen Hauses mit seinen alten, knorrigen Bäumen und breiten Blättern, zwischen denen die schweren, schwarzen, saftigen Kirschen niederhingen, und nachdem ich den Kopf unter das Netz geschoben hatte, entdeckte ich Sergej Michailowitsch unter den Ästen eines alten Kirschbaumes. Er glaubte wahrscheinlich, daß ich fortgegangen wäre und daß ihn niemand sähe, hatte den Hut abgenommen, die Augen geschlossen, saß auf dem Stumpfe eines alten Obstbaumes und drehte ein Stück Kirschharz eifrig zu einem Ball zusammen. Plötzlich zuckte er mit den Achseln, schlug die Augen auf und sagte lächelnd ein Wort vor sich hin.
Dieses Wort und dieses Lächeln waren mir so ungewohnt an ihm, daß ich mich schämte, ihn zu belauschen. Mir war, als hätte er »Mascha« geflüstert. »Es kann nicht sein!« sagte ich zu mir selbst; aber in demselben Augenblick wiederholte er noch leiser und zärtlicher: »Liebe Mascha!« Ich hörte diese Worte ganz genau; mein Herz fing heftig an zu klopfen, und die Freude, die mich durchbebte, hatte etwas von der Aufregung eines verbotenen Gefühls. Ich mußte mich an der Mauer halten, um nicht zu fallen und mich nicht zu verraten. Aber er hatte meine Bewegung gehört, sah erschrocken umher, schlug plötzlich die Augen nieder, errötete tief, wie ein Kind, wollte etwas sagen, konnte nicht und erglühte mehr und mehr. Aber dann sah er mich lächelnd an, und ich lächelte ebenfalls; sein Gesicht leuchtete vor Freude. Das war nicht mehr der alte, mich liebkosende oder belehrende Onkel, das war ein mir gleichstehender Mensch, der mich liebte und mich fürchtete und den ich liebte und fürchtete. Wir sagten nichts – wir sahen uns nur an; aber plötzlich wurde er ernst, das Lächeln und der Glanz der Augen verschwanden, er wandte sich wieder väterlich kühl zu mir, als hätten wir etwas Böses getan und als wäre er wieder zu sich gekommen und gäbe mir den Rat, mich zu besinnen.
»Steigen Sie da herunter – Sie können sich weh tun!« sagte er. »Und streichen Sie das Haar zurück! Wie sehen Sie aus!«
Warum verstellt er sich – warum will er mir weh tun? dachte ich betrübt, und in demselben Augenblick kam das unüberwindliche Verlangen über mich, ihn noch einmal in Verlegenheit zu bringen und meine Macht über ihn zu prüfen.
»Nein, ich will Kirschen pflücken«, sagte ich, griff mit beiden Händen nach dem nächsten Ast, schwang mich auf die Mauer und sprang, ehe er noch Zeit hatte, mich zu unterstützen, in das Gewächshaus hinunter.
»Was machen Sie für Torheiten!« rief er aus, indem er abermals errötete und unter dem Schein des Ärgers seine Verwirrung zu verbergen suchte. »Sie hätten sich sehr weh tun können. Und wie wollen Sie wieder herauskommen?«
Er war noch verlegener als vorher; aber jetzt war mir diese Verlegenheit nicht angenehm, sondern peinlich. Sie steckte mich an. Ich fühlte, daß ich errötete, wandte mich von ihm ab, war nicht imstande, ihm etwas zu sagen, und fing an, Kirschen zu pflücken, die ich nirgends hinzulegen wußte. Ich machte mir Vorwürfe, bereute mein Benehmen, fürchtete den Eindruck, den ich auf ihn gemacht haben könnte, und mir war zumute, als ob ich mich in seinen Augen auf immer vernichtet hätte. Wir schwiegen beide, und es war ein peinlicher Zustand, bis Sonja mit dem Schlüssel herbeikam und uns befreite; und auch dann sprachen wir noch nicht miteinander, sondern wandten uns Sonja zu.
Erst als wir zu Katja zurückkehrten, die uns versicherte, daß sie nicht geschlafen, sondern alles gehört habe, wurde ich ruhiger. Er versuchte wieder, seinen wohlwollend väterlichen Ton anzuschlagen, aber dieser Ton wollte ihm nicht mehr gelingen und täuschte mich nicht mehr, denn ich erinnerte mich lebhaft eines Gespräches, das einige Tage vorher zwischen uns stattgefunden hatte. Katja war damals der Ansicht, daß es dem Manne leichter wäre zu lieben und seine Liebe auszusprechen als dem Weibe. »Der Mann kann sagen, daß er liebt, die Frau aber nicht«, bemerkte sie.
»Nein, ich glaube, auch der Mann kann und darf nicht sagen, daß er liebt«, antwortete er. »Warum denn nicht?« fragte ich.
»Weil es immer eine Unwahrheit sein wird. Was ist das für eine wichtige Entdeckung, daß ein Mensch liebt! Als ob, wenn er dies Geständnis gemacht hat, plötzlich wie mit einem Knall etwas dastände! Klapp: er liebt! Als ob in dem Augenblick, in dem er dieses Wort gesagt hat, etwas Außergewöhnliches geschehen müßte! Wunder und Zeichen – oder aus allen Kanonen gefeuert werden müßte. Ich glaube«, fügte er hinzu, »daß Menschen, die feierlich beteuern ›Ich liebe Sie!‹ entweder sich selbst oder – was noch schlimmer ist – andere betrügen.« »Wie aber erfährt eine Frau, daß sie geliebt wird, wenn der Mann es ihr nicht sagt?« fragte Katja.
»Das weiß ich nicht«, antwortete er, »jeder Mensch hat seine eigene Ausdrucksweise. Und wenn das Gefühl da ist, wird es sich kundzugeben verstehen. Wenn ich Romane lese, muß ich mir immer vorstellen, was für ein verlegenes Gesicht der Leutnant Strelski oder Alfred machen muß, wenn er sagt: ›Ich liebe dich, Eleonore!› – und nun denkt, es müsse etwas Außerordentliches geschehen, während bei ihm wie bei ihr alles beim alten bleibt: dieselben Augen, dieselbe Nase und alles dasselbe.«
Schon damals fühlte ich aus diesem Scherz etwas Ernstes heraus, das sich auf mich bezog. Aber Katja duldete nicht, daß mit den Romanhelden so geringschätzig umgegangen wurde.
»Ewig Paradoxa!« rief sie aus. »Sagen Sie aufrichtig: haben Sie niemals einer Frau gestanden, daß Sie sie lieben?«
»Niemals habe ich so etwas gesagt und bin auch niemals auf die Knie gefallen und werde das auch künftig nicht tun!« gab er lachend zur Antwort.
Er braucht mir gar nicht zu sagen, daß er mich liebt, dachte ich jetzt, indem ich mich dieses Gespräches erinnerte; er liebt mich, ich weiß es, und alle seine Versuche, gleichgültig zu scheinen, werden mir diesen Glauben nicht nehmen!
Er sprach den ganzen Abend wenig mit mir, aber in jedem seiner Worte zu Katja, zu Sonja, in jeder Bewegung, jedem Blick sah ich seine Liebe und zweifelte nicht an ihr. Aber ich empfand ein Gemisch von Ärger und Bedauern. Warum hält er es noch für nötig, geheim zu tun und Kälte zu heucheln, wenn alles so klar ist, so leicht und einfach sein könnte, wenn es so möglich wäre, unaussprechlich glücklich zu sein? fragte ich immer wieder. Aber es peinigte mich wie ein Verbrechen, daß ich zu ihm ins Gewächshaus hinuntergesprungen war.
Nach dem Tee ging ich ans Klavier. Er folgte mir.
»Spielen Sie etwas – ich habe Sie lange nicht gehört«, sagte er, als er mich im Saale einholte.
»Das wollte ich auch – Sergej Michailowitsch!« sagte ich und sah ihm plötzlich gerade in die Augen. »Sie sind mir doch nicht böse?«
»Warum sollte ich?« fragte er. Es war mir immer, als müßte er aufgehört haben, mich zu achten, als müßte er mir böse sein.
»Weil ich am Nachmittag ungehorsam war«, meinte ich errötend.
Er verstand mich, schüttelte lächelnd den Kopf, und sein Blick schien zu sagen, daß er eigentlich schelten müsse, aber nicht die Kraft dazu in sich fühle.
»Es schadet also nichts – wir sind wieder Freunde?« fragte ich und setzte mich ans Klavier.
»Versteht sich!« sagte er.
In dem großen, hohen Saal brannten nur die beiden Kerzen auf dem Klavier; der übrige Raum lag im Halbdunkel. Durch die geöffneten Fenster schien die helle Sommernacht herein; alles war still, nur Katjas ungleichmäßige Schritte ließen sich aus dem dunklen Salon hören, und sein Pferd, das vor dem Fenster angebunden war, schnaubte und schlug mit den Hufen in die Kletten.
Er saß hinter mir, so daß ich ihn nicht sehen konnte, aber überall, im Halbdunkel des Zimmers, in den Tönen, in mir selbst empfand ich seine Gegenwart; jeden seiner Blicke, jede seiner Bewegungen fühlte ich, ohne sie zu sehen, in der Tiefe meines Herzens.
Ich spielte die Fantasie-Sonate von Mozart, die er mir mitgebracht und die ich bei ihm und für ihn gelernt hatte. Ich dachte nicht an das, was ich spielte, muß aber meine Sache wohl gut gemacht haben, denn er schien damit zufrieden zu sein. Ich teilte den Genuß, den er dabei hatte, und ohne ihn zu sehen, fühlte ich, daß sein Blick auf mir ruhte. Endlich sah ich mich nach ihm um, fuhr aber unwillkürlich und halb bewußtlos fort, die Finger zu bewegen. Sein Kopf zeichnete sich auf dem hellen Hintergrunde des Nachthimmels ab; er hatte die Wange auf die Hand gestützt und sah mich mit glänzenden Augen unverwandt an. Ich lächelte, als ich seinem Blick begegnete, und hörte auf zu spielen; auch er lächelte, deutete aber vorwurfsvoll mit einer Kopfbewegung auf die Noten, damit ich weiterspiele.
Als ich mein Spiel unterbrach, stieg eben der Mond herauf, und es wurde heller in dem Saal, den jetzt außer dem schwachen Licht der Kerzen auch noch der silberne Schein erleuchtete, der durch die Fenster auf den Fußboden fiel. Katja kam herbei und sagte, es habe weder Sinn noch Verstand, so an der schönsten Stelle abzubrechen, und überdies hätte ich schlecht gespielt. Er dagegen versicherte, ich hätte nie so gut gespielt wie heut, und fing an, in den Zimmern hin und her zu gehen, aus dem Saale in den dunklen Salon und wieder zurück in den Saal, wobei er sich jedesmal lächelnd nach mir umsah. Auch ich lächelte, ich hätte sogar ohne jede Veranlassung lachen mögen, so freute ich mich über irgend etwas, das heute, soeben geschehen sein mußte. Als er wieder einmal in der Salontür verschwand, umarmte ich Katja, die neben mir am Klavier stand, und küßte sie auf den vollen Hals unter dem Kinn. Als er aber zurückkehrte, machte ich ein ernstes Gesicht, obwohl ich das Lachen kaum zu unterdrücken vermochte.
»Was ist nur heute mit ihr vorgegangen?« fragte Katja. Er antwortete nicht. Er lächelte mir nur zu – denn er wußte, was mit mir vorgegangen war.
»Sehen Sie, welch eine Nacht!« rief er gleich darauf aus dem Salon, indem er vor der offenen Balkontür stehenblieb, die nach dem Garten hinausging.
Wir folgten ihm, und wirklich, es war eine Nacht, wie ich keine je wiedergesehen habe. Der volle Mond stand hinter uns über dem Haus, so daß er nicht zu sehen war und der Schatten des Daches, der Säulen und der Markise auf der Terrasse schräg über den sandbestreuten Weg und den Rasenplatz fiel. Alles übrige war hell und vom Silber des Taus und des Mondlichts übergossen. Der breite Weg zwischen den Blumenbeeten, auf den von der einen Seite der Schatten der hohen Georginen und ihrer Stäbe fiel, verlor sich, ganz in Licht und Kühle gehüllt und von Kieselsteinen funkelnd, in der nebligen Ferne. Hinter den Bäumen war das helle Glasdach des Treibhauses zu sehen, und aus dem Hohlweg stieg weißer wallender Nebel auf. Die bereits entlaubten Fliederbüsche waren bis auf die kleinsten Zweige von Licht umflossen. Die vom Tau benetzten Blumen konnte man alle deutlich erkennen, während in den Alleen Licht und Schatten so eigentümlich verschwammen, daß sie nicht mehr Bäume und Wege, sondern hohe, durchsichtige, schwankende, zitternde Wölbungen zu sein schienen. Rechts, im Schatten des Hauses, war alles schwarz und unheimlich. Aber um so heller hob sich aus dieser Finsternis der phantastische, leuchtende Wipfel der Silberpappel, die wie mit ausgebreiteten Flügeln bereit schien, fortzuschweben in die schimmernde, tiefblaue Weite.
»Wollen wir nicht spazierengehen?« fragte ich.
Katja stimmte zu, bemerkte aber, ich sollte Überschuhe anziehen.
»Das ist nicht nötig, Katja«, sagte ich, »Sergej Michailowitsch wird mir den Arm geben.« Als ob meine Füße dadurch vor Nässe geschützt werden könnten! Damals aber verstanden wir alle, was ich meinte, und fanden es in der Ordnung.
Er pflegte mir niemals den Arm zu geben; jetzt aber nahm ich ihn ohne weiteres, und er schien sich nicht darüber zu wundern. Wir gingen alle zusammen die Terrasse hinunter; die ganze Welt sah fremdartig aus – dieser Himmel, dieser Garten, diese Luft waren mir unbekannt.
Wenn ich die Allee, in der wir gingen, hinuntersah, war mir, als ob wir nicht weiterkönnten, als ob dicht vor uns jede Möglichkeit der freien Bewegung aufhörte und alles auf immer in unantastbare Schönheit wie eingeschmiedet wäre. Aber wir bewegten uns, und die Zauberwand der Schönheit tat sich auf, ließ uns ein, und nun war es wieder unser Garten mit seinen Blumen, seinen Wegen, seinen trockenen Blättern; und wir gingen auf diesen Wegen, traten auf die Lichtkreise und Schatten, und wirkliches trockenes Laub raschelte unter unseren Füßen, und ein frischer Zweig berührte meine Wange. Und er war es, der in gleichmäßigen, langsamen Schritten an meiner Seite wandelte und behutsam meinen Arm führte, und Katja war es, die mit knarrenden Schuhen neben uns ging. Und der Mond stand am Himmel und sah durch regungslose Zweige auf uns nieder. Aber mit jedem Schritt hinter uns und vor uns schloß sich wieder die Zauberwand, und ich glaubte nicht mehr daran, daß man noch weitergehen könnte. Ich glaubte nicht mehr an alles das, was war.
»Ach, ein Frosch!« rief Katja.
Wer sagt das und warum? dachte ich, aber dann fiel mir ein, daß es Katja war und daß sie sich vor Fröschen fürchtete. Ich sah vor meine Füße nieder; ein Fröschlein sprang auf und blieb dann regungslos liegen, so daß sein kleiner Schatten auf dem hellen Lehmboden des Weges zu sehen war.
»Sie fürchten sich nicht?« fragte er.
Ich sah zu ihm auf. Wo wir standen, war eine Lücke in der Lindenreihe, und ich sah deutlich sein schönes, glückliches Gesicht. »Sie fürchten sich nicht?« hatte er gesagt, ich aber hörte deutlich die Worte: »Ich liebe dich! Geliebtes Mädchen!« Und: »Ich liebe dich! Ich liebe dich!« wiederholte sein Blick, seine Hand – und Licht, Schatten; Luft, alles wiederholte und bestätigte diese Worte.
Wir gingen durch den ganzen Garten; Katja begleitete uns mit ihren kleinen Schritten und atmete schwer. Endlich sagte sie, es wäre Zeit, ins Haus zurückzukehren. Ich hatte Mitleid mit der Armen. – Warum fühlt sie nicht dasselbe wie du? dachte ich. Warum sind in dieser Nacht nicht alle Menschen jung und glücklich wie ich und er?
Wir gingen ins Haus zurück, aber obwohl schon die Hähne krähten, alles im Hof schlief und sein Pferd immer ungeduldiger schnaubte und stampfte, ritt er noch nicht fort. Auch Katja mahnte uns nicht, daß es spät sei, und so saßen wir, ohne es zu wissen, bis drei Uhr morgens beisammen und sprachen von den gleichgültigsten Dingen; die Hähne krähten schon zum drittenmal, und der Tag begann zu grauen, als er endlich aufbrach. Er nahm Abschied wie gewöhnlich, sagte nichts Besonderes, aber ich wußte jetzt, daß er mein war und daß ich ihn nicht wieder verlieren würde.
Und dann gestand ich mir, daß ich ihn liebte, und sobald ich das getan hatte, ging ich zu Katja und erzählte ihr alles. Sie war erfreut und gerührt – aber sie konnte schlafen, die Arme! In dieser Nacht! Ich dagegen ging noch lange, lange auf der Terrasse und im Garten umher, dachte zurück an jedes seiner Worte, an jede seiner Bewegungen und wanderte wieder durch die Alleen, durch die ich mit ihm gegangen war. Die ganze Nacht blieb ich wach, zum erstenmal im Leben sah ich den Sonnenaufgang und das Morgengrauen. Und nie wieder habe ich weder eine solche Nacht noch einen solchen Morgen gesehen.
Warum aber sagt er nicht einfach, daß er mich liebt? fragte ich mich selbst. Warum sucht er nach Hindernissen und nennt sich alt, während alles so einfach und schön ist? Warum verliert er die goldene Zeit, die vielleicht so nie wiederkommt? Ob er mit Worten sagt: »Ich liebe dich!« oder nur meine Hand faßt, errötet, die Augen niederschlägt – ich würde ihn verstehen und ihm alles sagen. Nein, sagen nicht! Ihn umarmen, mich an ihn schmiegen und weinen. Aber wie, wenn ich mich irrte? Wenn er mich nicht liebte? fiel mir plötzlich ein.
Ich erschrak vor meinem Gefühl. Gott weiß, wohin es mich führen und sein und mein Empfinden verwirren könnte! Und dann fiel mir wieder ein, wie ich ins Gewächshaus hinuntergesprungen war, und mir wurde schwer, sehr schwer zumute, Tränen stürzten mir aus den Augen, und ich fing an zu beten. Und dann kam mir plötzlich ein seltsamer Einfall, der mich beruhigte und mit Hoffnung erfüllte. Ich nahm mir vor, von heute an zu fasten, um mich zum Abendmahl vorzubereiten, das ich an meinem Geburtstag nehmen wollte, und an diesem Tage wollte ich seine Braut werden. Warum, wie das geschehen könnte – ich wußte es nicht, aber ich glaubte und wußte von diesem Augenblick an, daß es so sein würde.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: