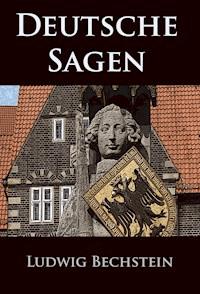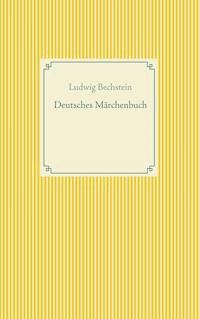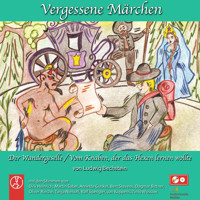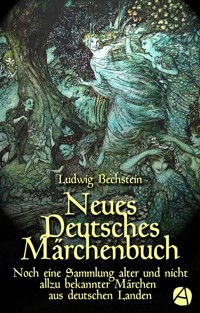Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Laufe seines Lebens hat Ludwig Bechstein viele Volksmärchen gesammelt. Die schönsten wurden aufgeschrieben und erscheinen jetzt in diesem Buch! Tauche in eine märchenhafte Welt hinein, wo alle Freude und Spannung finden werden – egal ob groß oder klein. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Bechstein
Die schönsten Märchen
Saga
Die schönsten Märchen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1914, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726997156
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Schneeweißchen
Es war einmal eine Königin, die hatte keine Kinder und wünschte sich eins, weil sie so ganz einsam war. Da sie nun eines Tages an einer Stickerei saß und den Rahmen von schwarzem Ebenholz betrachtete, während es schneite, war sie in so tiefen Gedanken, daß sie sich heftig in die Finger stach, so daß drei Blutstropfen auf den weißen Schnee fielen; und da mußte sie wieder daran denken, daß sie kein Kind hatte. »Ach!« seufzte die Königin, »hätte ich doch ein Kind, so rot wie Blut, so weiß wie Schnee, so schwarz wie Ebenholz!«
Und nach einer Zeit bekam diese Königin ein Kind, ein Mägdlein. Das war so weiß wie Schnee an seinem Leibe, und seine Wangen blüheten wie blutrote Röselein, und seine Haare waren so schwarz wie Ebenholz. Die Königin freute sich, nannte das Kind Schneeweißchen, und bald darauf starb sie. Da der König nun ein Witwer geworden war und kein Witwer bleiben wollte, so nahm er sich eine andre Gemahlin, das war ein stattliches Weib voll hoher Schönheit, aber auch voll unsäglichen Stolzes, und auch so eitel, daß sie sich für die schönste Frau in der ganzen Welt hielt. Dazu war sie zumal durch einen Zauberspiegel verleitet, der sagte ihr immer, wenn sie hineinsah und fragte:
»Spieglein, Spieglein an der Wand,
Wer ist die Schönste im ganzen Land?«
»Ihr, Frau Königin, seid die Schönst im Land.«
Und der Spiegel schmeichelte doch nicht, sondern sagte die Wahrheit wie jeder Spiegel.
Das kleine Schneeweißchen, der Königin Stieftochter, wuchs heran und wurde die schönste Prinzessin, die es nur geben konnte, und wurde noch viel schöner als die schöne Königin.
Diese fragte, als das Schneeweißchen sieben Jahre alt war, einmal wieder ihren treuen Spiegel:
»Spieglein, Spieglein an der Wand,
Wer ist die Schönst im ganzen Land?«
Aber da antwortete der Spiegel nicht wie sonst, sondern er antwortete:
»Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier,
Aber Schneeweißchen ist tausendmal schöner als Ihr.«
Darüber erschrak die Königin zu Tode, und es war ihr, als kehre sich ihr ein Messer im Busen um, und da kehrte sich auch ihr Herz um gegen das unschuldige Schneeweißchen, das nichts zu seiner übergroßen Schönheit konnte.
Und weil sie weder Tag noch Nacht Ruhe hatte vor ihrem bösen neidischen Herzen, so berief sie ihren Jäger zu sich und sprach: »Dieses Kind, das Schneeweißchen, sollst du in den dichten Wald führen und es töten. Bringe mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen, daß du mein Gebot vollzogen!«
Und da mußte das arme Schneeweißchen dem Jäger in den wilden Wald folgen, und im tiefsten Dickicht zog er seine Wehr und wollte das Kind durchstoßen. Das Schneeweißchen weinte jämmerlich und flehte, es doch leben zu lassen, es habe ja nichts verbrochen, und die Tränen und der Jammer des unschuldigen Kindes rührten den Jäger auf das innigste, so daß er bei sich dachte: Warum soll ich mein Gewissen beladen und dies schöne unschuldige Kind ermorden? Nein, ich will es lieber laufen lassen! Fressen es die wilden Tiere, wie sie wohl tun werden, so mag das die Frau Königin vor Gott verantworten.
Und da ließ er Schneeweißchen laufen, wohin es wollte, fing ein junges Wild, stach es ab, weidete es aus und brachte Lunge und Leber der bösen Königin. Die nahm beides und briet es in Salz und Schmalz und verzehrte es und war froh, daß sie, wie sie vermeinte, nun wieder allein die Schönste sei im ganzen Lande. Schneeweißchen im Walde wurde bald angst und bange, wie es so mutterseelenallein durch das Dickicht schritt, und wie es zum ersten Male die harten spitzen Steine fühlte, wie die Dornen ihm das Kleid zerrissen, und vollends, als es zum ersten Male wilde Tiere sah. Aber die wilden Tiere taten ihm gar nichts zuleide; sie sahen Schneeweißchen an und fuhren in die Büsche. Und das Mägdlein ging den ganzen Tag und ging über sieben Berge.
Des Abends kam Schneeweißchen an ein kleines Häuschen mitten im Walde, da ging es hinein, sich auszuruhen, denn es war sehr müde, war auch sehr hungrig und sehr durstig. Darinnen in dem kleinen, kleinen Häuschen war alles gar zu niedlich und zierlich und dabei sehr sauber. Es stand ein kleines Tischlein in der Stube, das war schneeweiß gedeckt und darauf standen und lagen sieben Tellerchen, auf jedem ein wenig Gemüse und Brot, sieben Löffelchen, sieben Paar Messerchen und Gäbelchen, sieben Becherchen. Und an der Wand standen sieben Bettchen, alle blütenweiß überzogen. Da aß nun das hungrige Schneeweißchen von den sieben Tellerchen, nur ein Kleinwenig von jedem, und trank aus jedem Becherchen ein Tröpflein Wein. Dann legte es sich in eins der sieben Bettchen, um zu ruhen, aber das Bettchen war zu klein, und sie mußte es in einem andern probieren, doch wollte keins recht passen, bis zuletzt das siebente, das paßte, da hinein schlüpfte Schneeweißchen, deckte sich zu, betete zu Gott und schlief ein, tief und fest, wie fromme Kinder, die gebetet haben, schlafen.
Derweil wurde es Nacht, und da kamen die Häuschensherren, sieben kleine Bergmännerchen, jedes mit einem brennenden Grubenlichtchen vorn am Gürtel, und da sahen sie gleich, daß eins dagewesen war. Der erste fing an zu fragen: »Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen?«
Der zweite fragte: »Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?«
Der dritte fragte: »Wer hat von meinem Brötchen gebrochen?«
Der vierte: »Wer hat von meinem Gemüslein geleckt?«
Der fünfte: »Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten?«
Der sechste: »Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen?«
Und der siebente fragte: »Wer hat aus meinem Becherchen getrunken?«
Wie die Zwerglein also gefragt hatten, sahen sie sich nach ihren Bettchen um und fragten: »Wer hat in unsern Bettchen gelegen?« bis auf den siebenten, der fragte nicht so, sondern: »Wer liegt in meinem Bettchen?« denn da lag das Schneeweißchen darin.
Da leuchteten die Bergmännerchen mit ihren Lämpchen alle hin und sahen mit Staunen das schöne Kind, und sie störten es nicht, sondern sie ließen den siebenten in ihren Bettchen liegen, in jedem ein Stündchen, bis die Nacht herum war. Da nun der Morgen mit seinen frühen Strahlen in das kleine, kleine Häuschen der Zwerglein schien, wachte Schneeweißchen auf und fürchtete sich vor den Zwergen. Die waren aber ganz gut und freundlich und sagten, es solle sich nicht fürchten, und fragten, wie es heiße. Da sagte und erzählte nun Schneeweißchen alles, wie es ihm ergangen sei. Darauf sagten die Zwergmännchen: »Du kannst bei uns in unserem Häuschen bleiben, Schneeweißchen, und kannst uns unsern Haushalt führen, kannst uns unser Essen kochen, unsre Wäsche waschen und alles hübsch rein und sauber halten, auch unsre Bettchen machen.« Das war Schneeweißchen recht, und es hielt den Zwergen haus. Die taten am Tage ihre Arbeit in den Bergen, tief unter der Erde, wo sie Gold und Edelsteine suchten, und abends kamen sie und aßen und legten sich in ihre sieben Bettchen.
Unterdessen war die böse Königin froh geworden in ihrem argen Herzen, daß sie nun wieder die Schönste war, wie sie meinte, und versuchte den Spiegel wieder und fragte ihn:
»Spieglein, Spieglein an der Wand,
Wer ist die Schönst im ganzen Land?«
Da antwortete ihr der Spiegel:
»Frau Königin! Ihr seid die Schönste hier,
Aber Schneeweißchen über den sieben Bergen,
Bei den sieben guten Zwergen,
Das ist noch tausendmal schöner als Ihr!«
Das war wiederum ein Dolchstich in das eitle Herz der Frau Königin, und sie sann nun Tag und Nacht darauf, wie sie dem Schneeweißchen ans Leben käme, und endlich fiel ihr ein, sich verkleidet selbst zu Schneeweißchen aufzumachen, und sie verstellte ihr Gesicht und zog geringe Kleider an, nahm auch einen Allerhandkram und ging über die sieben Berge, bis sie an das kleine, kleine Häuschen der Zwerge kam. Da klopfte sie an die Türe und rief: »Holla! Holla! Kauft schöne Waren!« Die Zwerge hatten aber dem Schneeweißchen gesagt, es solle sich vor fremden Leuten in acht nehmen, vornehmlich vor der bösen Königin. Deshalb sah das Mägdlein vorsichtig heraus, da sah sie den schönen Tand, den die Frau zu Markte trug, die schönen Halsketten und Schnüre und allerlei Putz. Da dachte Schneeweißchen nichts Arges und ließ die Krämerin herein und kaufte ihr eine Halsschnur ab, und die Frau wollte ihr zeigen, wie diese Schnur umgetan würde, und schnürte ihm von hinten den Hals so zu, daß Schneeweißchen gleich der Odem ausging und es tot hinsank. »Da hast du den Lohn für deine übergroße Schönheit!« sprach die böse Königin und hob sich von dannen.
Bald darauf kamen die sieben Zwerglein nach Hause, und da fanden sie ihr schönes liebes Schneeweißchen tot und sahen, daß es mit der Schnur erdrosselt war. Geschwinde schnitten sie die Schnur entzwei und träufelten einige Tropfen von der Goldtinktur auf Schneeweißchens blasse Lippen, da begann es leise zu atmen und wurde allmählich wieder lebendig. Als es nun erzählen konnte, erzählte es, wie die alte Krämersfrau ihr den Hals böslich zugeschnürt, und die Zwerge riefen: »Das war kein anderes Weib als die falsche Königin! Hüte dich und lasse gar keine Seele in das kleine Häuschen, wenn wir nicht da sind.«
Die Königin trat, als sie von ihrem schlimmen Gange wieder nach Hause kam, gleich vor ihren Spiegel und fragte ihn:
»Spieglein, Spieglein an der Wand,
Wer ist die Schönst im ganzen Land?«
Und der Spiegel antwortete:
»Frau Königin! Ihr seid die Schönst allhier,
Aber Schneeweißchen über den sieben Bergen,
Bei den sieben guten Zwergen,
Das ist noch tausendmal schöner als Ihr.«
Da schwoll der Königin das Herz vor Zorn, wie einer Kröte der Bauch, und sie sann wieder Tag und Nacht auf Schneeweißchens Verderben. Bald nahm sie wieder die falsche Gestalt einer andern Frau an, durch Verstellung ihres Gesichts und fremdländische Kleidung, machte einen vergifteten Kamm, den tat sie zu anderm Kram und ging über die sieben Berge, an das kleine, kleine Zwergenhäuslein. Dort klopfte sie wieder an die Türe, rief: »Holla! Holla! Kauft schöne Waren! Holla!«
Schneeweißchen sah zum Fenster heraus und sagte: »Ich darf niemand hereinlassen!«
Das Kramweib aber rief: »Schade um die schönen Kämme!« Und dabei zeigte sie den giftigen, der ganz golden blitzte. Da wünschte sich Schneeweißchen von Herzen einen goldenen Kamm, dachte nichts Arges, öffnete die Türe und ließ die Krämerin herein und kaufte den Kamm.
»Nun will ich dir auch zeigen, mein allerschönstes Kind, wie der Kamm durch die Haare gezogen und wie er gesteckt wird«, sprach die falsche Krämerin und strich dem Schneeweißchen damit durchs Haar; da wirkte gleich das Gift, daß das arme Kind umfiel und tot war. »So, nun wirst du wohl das Wiederaufstehen vergessen«, sprach die böse Königin und entfloh aus dem Häuschen.
Bald darauf – und das war ein Glück – wurde es Abend, und da kamen die sieben Zwerge wieder nach Hause, hielten das arme Schneeweißchen für tot und fanden in seinem schönen Haar den giftigen Kamm. Diesen zogen sie geschwind aus dem Haar, und da kam es wieder zu sich. Und die Zwerglein warnten es aufs neue gar sehr, doch ja niemand ins Häuschen zu lassen.
Daheim trat die böse Königin wieder vor ihren Spiegel und fragte ihn:
»Spieglein, Spieglein an der Wand,
Wer ist die Schönst im ganzen Land?«
Und der Spiegel antwortete:
»Frau Königin! Ihr seid die Schönst allhier,
Aber über den sieben Bergen,
Bei den sieben guten Zwergen
Ist Schneeweißchen – tausendmal schöner als Ihr.«
Da wußte sich die Königin vor giftiger Wut darüber, daß alle ihre bösen Ränke gegen Schneeweißchen nichts fruchteten, gar nicht zu lassen und zu fassen und tat einen schweren Fluch, Schneeweißchen müsse sterben, und solle es ihr, der Königin, selbst das Leben kosten. Und darauf machte sie heimlich einen schönen Apfel giftig, aber nur auf einer Seite, wo er am schönsten war, nahm dazu noch einen Korb voll gewöhnlicher Äpfel, verstellte ihr Gesicht, kleidete sich wie eine Bäuerin, ging abermals über die sieben Berge und klopfte am Zwergenhäuslein an, indem sie rief: »Holla! Schöne Äpfel kauft! Kauft!«
Schneeweißchen sah zum Fenster heraus und sagte zu ihr: »Geht fort, Frau! Ich darf nicht öffnen und auch nichts kaufen!«
»Auch gut, liebes Kind!« sprach die falsche Bäuerin. »Ich werde auch ohne dich meine schönen Äpfel noch alle los! Da hast du einen umsonst!«
»Nein, ich danke schön, ich darf nichts annehmen!« rief Schneeweißchen.
»Denkst wohl gar, der Apfel wäre vergiftet? Siehst du, da beiße ich selber hinein! Das schmeckt einmal gut! So hast du in deinem ganzen Leben keinen Apfel gegessen.« Dabei biß das trügerische Weib in die Seite des Apfels, die nicht vergiftet war, und da wurde Schneeweißchen lüstern und griff nach dem Apfel hinaus, und die Bäuerin reichte ihn hin und blieb stehen. Kaum hatte Schneeweißchen den Apfel auf der andern Seite angebissen, wo er ein schönes rotes Bäckchen hatte, so wurden Schneeweißchens rote Bäckchen ganz blaß, und es fiel um und war tot.
»Nun bist du aufgehoben, Ding!« sprach die Königin und ging fort, und zu Hause trat sie wieder vor den Spiegel und fragte wieder:
»Spieglein, Spieglein an der Wand,
Wer ist die Schönst im ganzen Land?«
Und der Spiegel antwortete dieses Mal:
»Ihr, Frau Königin, seid allein die Schönst im Land!«
Nun war das Herz der bösen Königin zufrieden, soweit ein Herz voll Bosheit und Tücke und Mordschuld zufrieden sein kann.
Aber wie sehr erschraken die sieben guten Zwerge, als sie abends nach Hause kamen und ihr Schneeweißchen ganz tot fanden.
Vergebens suchten sie nach einer Ursache, und vergebens versuchten sie die Wunderkraft ihrer Goldtinktur, Schneeweißchen war und blieb jetzt tot.
Da legten die betrübten Zwerglein das liebe Kind auf eine Bahre und setzten sich darum herum und weinten drei Tage lang, hernach wollten sie es begraben. Aber da Schneeweißchen noch nicht wie tot aussah, sondern noch frisch wie ein Mägdlein, das schläft, so wollten sie es nicht allein in die Erde senken, sondern sie machten einen schönen Sarg von Glas, da hinein legten sie es und schrieben darauf: Schneeweißchen, eine Königstochter – und setzten dann den Sarg auf einen von den sieben Bergen und hielt immer einer von ihnen Wache bei dem Sarge. Da kamen auch die Tiere aus dem Walde und weinten über Schneeweißchen, die Eule, der Rabe und das Täubelein.
Und so lag Schneeweißchen lange Jahre in dem Sarge, ohne daß es verweste, vielmehr sah es noch so frisch und so weiß aus wie frischgefallener Schnee, und es hatte wieder rote Wängelein wie frische Blutröschen und die schwarzen ebenholzfarbenen Haare. Da kam ein junger schöner Königssohn zu dem kleinen Zwergenhäuslein, der sich verirrt hatte in den sieben Bergen, und sah den gläsernen Sarg stehen und las die Schrift darauf: Schneeweißchen, eine Königstochter – und bat die Zwerge, ihm doch den Sarg mit Schneeweißchen zu überlassen, er wolle denselben ihnen abkaufen.
Die Zwerge aber sprachen: »Wir haben Goldes die Fülle und brauchen deines nicht! Und um alles Gold in der Welt geben wir den Sarg nicht her.«
»So schenkt ihn mir!« bat der Königssohn. »Ich kann nicht sein ohne Schneeweißchen, ich will es aufs höchste ehren und heilig halten, und es soll in meinem schönsten Zimmer stehen; ich bitte euch darum!«
Da wurden die Zwerglein von Mitleid bewegt und schenkten ihm Schneeweißchen im gläsernen Sarge. Den gab er seinen Dienern, daß sie ihn vorsichtig forttrügen, und er folgte sinnend nach. Da stolperte der eine Diener über eine Baumwurzel, daß der Sarg schütterte, und sie hätten ihn beinahe fallen lassen, und durch das Schüttern fuhr das giftige Stückchen Apfel, das Schneeweißchen noch im Munde hatte (weil es umgefallen war, ehe es den Bissen verschluckt), heraus, und da war es mit einem Male wieder lebendig.
Geschwind ließ es der Königssohn niedersetzen, öffnete den Sarg und hob es mit seinen Armen heraus und erzählte ihm alles und gewann es nun erst recht lieb und nahm es zu seiner Gemahlin, führte es auch gleich in seines Vaters Schloß, und es wurde zur Hochzeit zugerüstet mit großer Pracht, auch viele hohe Gäste wurden geladen, darunter auch die böse Königin. Die putzte sich auf das allerschönste, trat vor ihren Spiegel und fragte wieder:
»Spieglein, Spieglein an der Wand,
Wer ist die Schönst im ganzen Land?«
Darauf antwortete der Spiegel:
»Frau Königin, Ihr seid die Schönst allhier,
Aber die junge Königin
ist noch tausendmal schöner als Ihr!«
Da wußte die Königin nicht, was sie vor Neid und Scheelsucht sagen und anfangen sollte, und es wurde ihr ganz bange ums Herz, und sie wollte erst gar nicht auf die Hochzeit gehen; dann wollte sie aber doch die sehen, die schöner sei als sie, und fuhr hin. Und wie sie in den Saal kam, trat ihr Schneeweißchen als die allerschönste Königsbraut entgegen, die es jemals gegeben, und da mochte sie vor Schrecken in die Erde sinken.
Schneeweißchen aber war nicht allein die Allerschönste, sondern sie hatte auch ein großes edles Herz, das die Untaten, die die falsche Frau an ihr verübt, nicht selbst rächte. Es kam aber ein giftiger Wurm, der fraß der bösen Königin das Herz ab, und dieser Wurm war der Neid.
Das Dornröschen
Es waren einmal ein König und eine Königin, die hatten keine Kinder, wünschten sich aber tagtäglich ein Kind. Zu einer Zeit geschah es, daß die Königin badete und seufzete, als sie so allein war: »Ach, hätte ich doch ein Kind!«
Da hüpfte ein Frosch aus dem Wasser und sprach: »Was du wünschest, soll dir werden!« Und darauf hat die Königin ein Töchterlein bekommen, das war schön über alle Maßen, und der König hatte darüber die größte Freude, daß sein liebster Wunsch erfüllt war, und stellte ein großes Fest an, zu dem er alle seine Freunde einlud. Nun lebten in dem Lande auch weise Frauen, die waren begabt mit Zauber- und Wundermacht und genossen große Ehrfurcht vor allem Volke; die lud der König auch ein, und sie sollten auf goldnen Tellern essen. Damals hatten aber die Könige nicht so viele Schüsseln und Teller wie jetzt, und dieser König hatte nur ein Dutzend, das sind zwölf, und der weisen Frauen waren dreizehn, da konnte er auch nur zwölf einladen, und die dreizehnte blieb uneingeladen.
Die weisen Frauen begabten das Königskind mit gar köstlichen Gütern, nicht mit Schönheit, denn die besaß es schon, sondern mit Liebenswürdigkeit, Heiterkeit, Anmut, Sanftmut, Bescheidenheit, Frömmigkeit, Sittsamkeit, Tugend, Aufrichtigkeit, Verstand und Reichtum, und eben wollte die zwölfte weise Frau auch noch ihren Wunsch aussprechen, als die dreizehnte in das Zimmer trat, die nicht eingeladen worden war, und zornig ausrief: »In fünfzehn Jahren soll die Königstochter sich in eine Spindel stechen und tot hinfallen!« Mit diesen Worten war die böse Alrune wieder verschwunden, und die andern standen starr vor Schrecken, denn die weisen Frauen machten keine vergeblichen Worte.
Ein Glück, daß die zwölfte weise Frau ihren Wunsch noch nicht ausgesprochen hatte. Sie konnte zwar das, was einmal eine weise Frau gedroht hatte, nicht abändern, aber ihm doch eine mildernde Wendung geben, und rief: »Die Königstochter soll nur in einen tiefen Schlaf fallen, der soll hundert Jahre dauern und nicht länger.« Der König ließ sogleich ein Regierungsmandat im ganzen Lande ergehen, kraft dessen alle Spindeln überall abgeschafft und dafür die Spinnräder eingeführt wurden; indes erwuchs die schöne Königtochter zu einem Fräulein, das an Schönheit, Holdseligkeit, Freundlichkeit, Milde, Demut, Züchtigkeit, Herzensgüte, Tugend und Verstand seinesgleichen suchte, und so kam es zu seinem fünfzehnten Jahre, von allen, die es kannten, geliebt, ja angebetet. Und da bekam die Prinzessin gerade Lust, sich im Schloß ein bißchen umzusehen, ging durch mehrere Gemächer und kam an eine Treppe, die zu einem alten Turm führte; diese stieg es hinan und kam an ein niedrig Kammertürlein, da steckte ein alter verrosteter Schlüssel daran, und neugierig, wie die ganz jungen Mädchen sind, drehte die Prinzessin an dem Schlüssel, und die Türe ging gleich auf. Da saß ein uraltes Spinneweiblein und spann emsig mit einer Spindel; es mochte wohl des Königs Gesetz nicht gehört oder gelesen oder es längst vergessen haben. Die umhertanzende, auf und nieder wirbelnde Spindel machte der jungen Königstochter viel Freude, sie haschte nach der Spindel, wollte auch spinnen und stach sich damit, denn es war gerade der Tag, an welchem die Prophezeiung der erzürnten weisen Frau in Erfüllung gehen sollte.
Und die Königstochter fiel nieder in einen Schlaf. Und da überkam derselbe Schlaf auch den König und die Königin und das ganze Schloß. Da mag es schön langweilig gewesen sein! Der ganze Hofstaat schlief ein, vom Hofmarschall bis zum Küchenjungen, den der Koch wegen eines Versehens gerade an den Haaren zauste und ihm eine Ohrfeige geben wollte, und Koch und Kellner, Kammerfrau und Kammerjungfer, Kind und Kegel, Hund und Katze, ja die Tauben und Sperlinge auf dem Dache, die Pfauen und Papageien und selbst die Fliegen an der Wand, die schliefen alle. Und das Feuer auf dem Herd legte sich und schlief ein, und der Wind legte sich auch, und wurde alles piepstill, daß man kein Mäuschen im ganzen Schloß mehr knuspern hörte, dieweil die Mäuslein auch schliefen. Und da kam kein Mensch mehr in das verzauberte Schlummerschloß, um welches rund herum eine mächtige Dornenhecke emporwuchs, jedes Jahr einige Schuh höher, bis sie den höchsten Turm überwachsen hatte, daß man nicht einmal die Fahne und den Wetterhahn mehr sah, und so dicht, daß kein menschliches Wesen eindringen konnte.
Und da wurde das Schloß allmählich ganz vergessen, und es ging nur die Sage, hinter den Dornen stehe ein Schloß, darin schlafe das Dornröschen, die verzauberte Prinzessin, wie lange schon und wie lange noch, wisse niemand. Zwar kamen von Zeit zu Zeit Königssöhne, die wollten hindurchdringen durch die Hecke, allein dieselbe war allzu dicht, und konnten es nicht erlangen, blieben wohl gar in den Dornen verstrickt und kamen elendiglich darin um.
Und so waren nun hundert Jahre vergangen, und die Zeit war da, daß das Dornröschen wieder erwachen sollte, es wußte dies aber niemand genau, und da kam auch ein Königssohn, der hörte die Mär von dem schlafenden Dornröschen aus dem Mund eines Alten, der sie ihm gewiß versicherte, denn sein Vater und Urgroßvater hätten ihm oft davon erzählt, und der Alte mußte den Königssohn hin an die verrufene Dornhecke führen. Und das geschah just am hundertsten Jahrestag, seit das Dornröschen in seinen Zauberschlaf gefallen war. Und die Dornhecke stand über und über voll Rosenblumen, das war seit Menschengedenken nicht der Fall gewesen, auch konnte der Königssohn frei durch die Dornhecke gehen, kein Dorn berührte sein Gewand, aber gleich hinter ihm schloß sich die Hecke wieder. Und da fand er alles unversehrt; kein Wind hatte geweht und kein Regen genäßt, das Jahrhundert war über den Häuptern der Schlummernden so leise hinweggeflogen wie ein Schwan über einen stillen See voll träumender Wasserlilien. Da schliefen noch alle Fliegen und alle Mäuschen, da schliefen Huhn und Hahn, Katz und Hund, Magd und Zofe, Kammerherr und Kammerknecht und auch König und Königin.
Das alles sah der Königssohn mit großer Verwunderung, ging nun hinauf in den Turm und kam in die Kammer, wo das süße Dornröschen lag und so sanft schlief, hehr umflossen vom Heiligenschein seiner Unschuld und vom Glanze seiner Schönheit. Da beugte der Prinz sich nieder und küßte das Dornröschen, und alsbald schlug es die Augen auf. Der Königssohn sagte ihm, wie alles sich zugetragen, und führte es herab in das Schloß. Da erwachte alles, König und Königin, Zwerg und Zofe, Hunde und Pferde, Feuer und Wasser, Wind und Wetterhahn, und der Koch gab dem Küchenjungen die Ohrfeige, die er ihm vor hundert Jahren schuldig geblieben war, und alles ging wieder seinen Gang, und es wurde eine stattliche Hochzeit ausgerichtet, nämlich des Dornröschens mit dem Königssohn, der es aus dem Schlummer erlöst, und sie lebten glücklich und zufrieden miteinander, bis an ihr Ende.
Goldener
Vor langen Jahren hat einmal in einem dichten Wald ein armer Hirte gelebt, der hatte sich ein bretternes Häuschen mitten im Wald erbaut, darin wohnte er mit seiner Frau und sechs Kindern, die waren alle Knaben. An dem Hause war ein Ziehbrunnen und ein Gärtlein, und wenn der Vater das Vieh fütterte, so gingen die Kinder hinaus und brachten ihm zu Mittag oder zu Abend einen kühlen Trunk aus dem Brunnen oder ein Gericht aus dem Gärtlein.
Den jüngsten Knaben riefen die Eltern nur: »Goldener«, denn seine Haare waren wie Gold, und obgleich der jüngste, so war er doch der stärkste von allen und auch der größte. So oft die Kinder hinaus in die Flur gingen, so ging Goldener mit einem Baumzweige voran, anders wollte keins gehen, denn jedes fürchtete sich, zuerst auf ein Abenteuer zu stoßen; ging aber Goldener voran, so folgten sie freudig eines hinter dem andern nach, durch das dunkelste Dickicht, und wenn auch schon der Mond über dem Gebirge stand.
Eines Abends ergötzten sich die Knaben auf dem Rückwege vom Vater mit Spielen im Walde, und Goldener hatte sich vor allen so sehr im Spiele ereifert, daß er so hell aussah wie das Abendrot. »Laßt uns zurückgehen!« sprach der Älteste, »es scheint dunkel zu werden.«
»Seht da, der Mond!« sprach der Zweite. Da kam es auf einmal licht zwischen den dunklen Tannen hervor, und eine Frauengestalt, leuchtend wie der Mond, setzte sich auf einen der moosigen Steine, spann mit einer kristallenen Spindel einen lichten Faden in die Nacht hinaus, nickte mit dem Haupte gegen Goldener und sang:
»Der weiße Fink, die goldne Ros,
Die Königin im Meeresschoß!«
Sie hätte wohl noch weiter gesungen, da brach ihr der Faden, und sie erlosch wie ein Licht. Nun war es ganz Nacht, die Kinder faßte ein Grausen, sie sprangen mit kläglichem Geschrei, das eine dahin, das andere dorthin, über Felsen und Klüfte, und verlor eins das andere.
Wohl viele Tage und Nächte irrte auch Goldener in dem dicken Wald umher, fand aber weder einen seiner Brüder, noch die Hütte seines Vaters, noch sonst die Spur eines Menschen, denn es war der Wald gar dicht verwachsen, ein Berg über den andern gestellt und eine Kluft unter die andere.
Die Brombeeren, welche überall herumrankten, stillten seinen Hunger und Durst, sonst wär er gar jämmerlich gestorben. Endlich am dritten Tage – andere sagen gar erst am sechsten oder siebenten Tage – wurde der Wald hell und immer heller, und da kam Goldener zuletzt hinaus auf eine schöne grüne Wiese.
Da war es ihm so leicht um das Herz, und er atmete mit vollen Zügen die freie Luft ein.
Auf derselben Wiese waren Garne ausgelegt, denn da wohnte ein Vogelsteller, der fing Vögel, die aus dem Wald flogen, und trug sie in die Stadt zum Kaufe.
»Solch ein Bursche ist mir gerade vonnöten«, dachte der Vogelsteller, als er Goldener erblickte, der auf der grünen Wiese nah an den Garnen stand und in den weiten blauen Himmel hineinsah und sich nicht satt sehen konnte.
Der Vogelsteller wollte sich einen Spaß machen, er zog seine Garne und husch! war Goldener gefangen und lag unter dem Garne ganz erstaunt, denn er wußte nicht, wie das geschehen war. »So fängt man die Vögel, die aus dem Walde kommen«, sprach der Vogelsteller laut lachend, »deine roten Federn sind mir eben recht. Du bist wohl ein verschlagener Fuchs? Bleibe bei mir, ich lehre dich auch die Vögel fangen!«
Goldener war gleich dabei, ihm deuchte unter den Vögeln ein gar lustig Leben, zumal er ganz die Hoffnung aufgegeben hatte, die Hütte seines Vaters wiederzufinden.
»Laß erproben, was du gelernt hast«, sprach der Vogelsteller nach einigen Tagen zu ihm. Goldener zog die Garne, und bei dem ersten Zuge fing er einen schneeweißen Finken.
»Packe dich mit diesem weißen Finken!« schrie der Vogelsteller, »du hast es mit dem Bösen zu tun!« und so stieß er ihn gar unsanft von der Wiese, indem er den weißen Finken, den ihm Goldener gereicht hatte, unter vielen Verwünschungen mit den Füßen zertrat.
Goldener konnte die Worte des Vogelstellers nicht begreifen, er ging traurig, doch getrost wieder in den Wald zurück und nahm sich noch einmal vor, die Hütte seines Vaters zu suchen. Tag und Nacht lief er über Felsensteine und alte gefallene Baumstämme, fiel auch gar oft über die schwarzen Wurzeln, die aus dem Boden überall hervorragten.
Am dritten Tage aber wurde der Wald endlich wieder heller, und da kam er hinaus in einen schönen lichten Garten, der war voll der lieblichsten Blumen, und weil Goldener dergleichen noch keine erblickt, blieb er voll Bewunderung stehen. Der Gärtner im Garten erblickte ihn nicht so bald – denn Goldener stand unter den Sonnenblumen, und seine Haare glänzten im Sonnenschein nicht anders als so eine Blume – , als er sprach: »Ha! Solch einen Burschen hab ich gerade vonnöten!« und das Tor des Gartens schloß. Goldener ließ es sich gefallen, denn ihm deuchte unter den Blumen ein gar buntes Leben, zumal da er ganz die Hoffnung aufgegeben hatte, die Hütte seines Vaters wiederzufinden.
»Fort in den Wald!« sprach der Gärtner eines Morgens zu Goldener, »hol mir einen wilden Rosenstock, damit ich zahme Rosen darauf pflanze!« Goldener ging und kam mit einem Stock der schönsten goldfarbenen Rosen zurück, die waren auch nicht anders, als hätte sie der geschickteste Goldschmied für die Tafel eines Königs geschmiedet.
»Packe dich mit diesen goldnen Rosen!« schrie der Gärtner, »du hast es mit dem Bösen zu tun«, und so stieß er ihn gar unsanft aus dem Garten, indem er die goldenen Rosen unter vielen Verwünschungen in die Erde trat.
Goldener konnte die Worte des Gärtners nicht begreifen, doch ging er getrost wieder in den Wald zurück und nahm sich nochmals vor, die Hütte seines Vaters zu suchen.
Er lief Tag und Nacht, von Baum zu Baum, von Fels zu Fels. Am dritten Tage endlich wurde der Wald hell und immer heller, und da kam Goldener hinaus an das blaue Meer; das lag in einer unermeßlichen Weite vor ihm, die Sonne spiegelte sich eben in der kristallhellen Fläche, da war es wie fließendes Gold, darauf schwammen schön geschmückte Schiffe mit langen fliegenden Wimpeln. Einige Fischer hielten in einer zierlichen Barke am Ufer, in die trat Goldener und sah mit Erstaunen in die Helle hinaus.
»Ein solcher Bursch ist uns gerade vonnöten«, sprachen die Fischer, und husch stießen sie vom Lande. Goldener ließ es sich gefallen, denn ihm deuchte bei den Wellen ein goldenes Leben, zumal er ganz die Hoffnung aufgegeben hatte, seines Vaters Hütte wiederzufinden. Die Fischer warfen ihre Netze aus und fingen nichts. »Laß sehen, ob du glücklicher bist!« sprach ein alter Fischer mit silbernen Haaren zu Goldener. Mit ungeschickten Händen senkte Goldener das Netz in die Tiefe, zog und fischte – eine Krone von hellem Golde.
»Triumph!« rief der alte Fischer und fiel Goldener zu Füßen, »ich begrüße dich als unsern König! Vor hundert Jahren versenkte der alte König, welcher keine Erben hatte, sterbend seine Krone in das Meer, und so lange, bis irgendeinem Glücklichen das Schicksal bestimmt hätte, die Krone wieder aus der Tiefe zu ziehen, sollte der Thron ohne Nachfolger in Trauer gehüllt bleiben.«
»Heil unserm König!« riefen die Fischer und setzten Goldenern die Krone auf. Die Kunde von Goldener und der wiedergefundenen Königskrone erscholl bald von Schiff zu Schiff und über das Meer weit in das Land hinein. Da war die goldene Fläche bald mit bunten Nachen besetzt und mit Schiffen, die mit Blumen und Laubwerk geziert waren; diese begrüßten mit lautem Jubel alle das Schiff, auf dem König Goldener stand. Er stand, die helle Krone auf dem Haupte, am Vorderteile des Schiffs und sah ruhig der Sonne zu, wie sie im Meer erlosch. Im Abendwinde wehten seine goldnen Locken.
Des kleinen Hirten Glückstraum
Es war einmal ein sehr armer Bauersmann, der war in einem Dörflein Hirte, und das schon seit vielen Jahren. Seine Familie war klein, er hatte eine Frau und nur ein einziges Kind, einen Knaben. Doch diesen hatte er sehr frühzeitig mit hinaus auf die Weide genommen und ihm die Pflichten eines treuen Hirten eingeprägt, und so konnte er, als nur einigermaßen der Knabe herangewachsen war, sich ganz auf denselben verlassen, konnte ihm die Herde allein anvertrauen und konnte unterdessen daheim noch einige Dreier mit Körbeflechten verdienen. Der kleine Hirte trieb seine Herde munter hinaus auf die Triften und Raine; er pfiff oder sang manch helles Liedlein und ließ dazwischen gar laut seine Hirtenpeitsche knallen; dabei wurde ihm keine Zeit lang. Des Mittags lagerte er sich gemächlich neben seine Herde, aß sein Brot und trank aus der Quelle dazu, und dann schlief er auch wohl ein Weilchen, bis es Zeit war weiterzutreiben.
Eines Tages hatte sich der kleine Hirte unter einen schattigen Baum zur Mittagsruhe gelagert, schlief ein und träumte einen gar wunderlichen Traum: Er reise fort, gar unendlich weit fort – ein lautes Klingen, wie wenn unaufhörlich eine Masse Münzen zu Boden fielen – ein Donnern, wie wenn unaufhörlich Schüsse knallten – eine endlose Schar Soldaten, mit Waffen und in blitzenden Rüstungen – das alles umkreisete, umschwirrte, umtosete ihn. Dabei wanderte er immerzu und stieg immer bergan, bis er endlich oben auf der Höhe war, wo ein Thron aufgebaut war, darauf er sich setzte, und neben ihm war noch ein Platz, auf dem eine schöne Frau, die plötzlich erschien, sich niederließ. Nun richtete sich im Traum der kleine Hirte empor und sprach ganz ernst und feierlich: »Ich bin König von Spanien.« Aber in demselben Augenblick wachte er auf. Nachdenklich über seinen sonderbaren Traum trieb der Kleine seine Herde weiter, und des Abends erzählte er daheim seinen Eltern, die vor der Türe saßen und Weiden schnitzten, wobei er ihnen auch half, seinen wunderlichen Traum und sprach zum Schluß: »Wahrlich, wenn ich noch einmal träume, so gehe ich fort nach Spanien und will doch einmal sehen, ob ich nicht König werde!«
»Dummer Junge«, murmelte der alte Vater, »dich macht man zum König, laß dich nicht auslachen!«
Und seine Mutter kicherte weidlich und klatschte in die Hände und wiederholte ganz verwundert: »König von Spanien, König von Spanien!«
Am andern Tag zu Mittag lag der kleine Hirte zeitig unter jenem Baume, und o Wunder! derselbe Traum umfing wieder seine Sinne. Kaum hielt es ihn bis zum Abend auf der Hut, er wäre gern nach Hause gelaufen und wäre aufgebrochen zur Reise nach Spanien. Als er endlich heimtrieb, verkündete er seinen abermaligen Traum und sprach: »Wenn mich aber noch einmal so träumt, so gehe ich auf der Stelle fort, gleich auf der Stelle.«
Am dritten Tage lagerte er sich denn wieder unter jenen Baum, und ganz derselbe Traum kam zum dritten Male wieder. Der Knabe richtete sich im Traume empor und sprach: »Ich bin König von Spanien«, und darüber erwachte er wieder, raffte aber auch sogleich Hut und Peitsche und Brotsäcklein von dem Lager auf, trieb die Herde zusammen und geraden Wegs nach dem Dorfe zu. Da fingen die Leute an mit ihm zu zanken, daß er so bald und so lange vor der Vesperzeit eintreibe, aber der Knabe war so begeistert, daß er nicht auf das Schelten der Nachbarn und der eignen Eltern hörte, sondern seine wenigen Kleidungsstücke, die er des Sonntags trug, in ein Bündel schnürte, dasselbe an ein Nußholzstöcklein hing, über die Achsel nahm und so mir nichts, dir nichts fortwanderte. Gar flüchtig war der Knabe auf den Beinen; er lief so rasch, als sollte er noch vor nachts in Spanien eintreffen. Doch erreichte er nur an diesem Tage einen Wald, nirgends war ein Dorf oder ein einzelnes Haus; und er beschloß, in diesem Wald in einem dichten Busch sein Nachtlager zu suchen. Kaum hatte er aber zur Ruhe sich niedergelegt und war entschlummert, als ein Geräusch ihn wieder erweckte: Es zog eine Schar Männer in lautem Gespräch an dem Busch vorüber, in welchen er sich gebettet. Leise machte der Knabe sich hervor und ging den Männern in einer kleinen Entfernung nach und dachte, vielleicht findest du doch noch eine Herberge; wo diese Männer heute schlafen, kannst du gewiß auch schlafen.
Gar nicht lange waren sie weitergewandert, als ein ziemlich ansehnliches Haus vor ihnen stand, aber so recht mitten im dunklen Wald. Die Männer klopften an, es wurde aufgetan, und neben den Männern schlüpfte auch der Hirtenknabe mit hinein in das Haus. Drinnen öffnete sich wieder eine Türe, und alle traten in ein großes, sehr spärlich erhelltes Zimmer, wo auf dem Fußboden umher viele Strohbunde, Betten und Deckbetten lagen, die zum Nachtlager der Männer bereitgehalten schienen. Der kleine Hirtenbub verkroch sich schnell unter einem Strohhaufen, der nahe an der Türe aufgeschichtet war, und lauschte nun auf alles, was er nur aus seinem Versteck hören und wahrnehmen konnte. Bald kam er dahinter, denn er war ohnehin klug und aufgeweckt, daß diese Männerschar eine Räuberbande sei, deren Hauptmann der Herr dieses Hauses war. Dieser bestieg, als die neu angelangten Mitglieder der Bande sich hingelagert hatten, einen etwas erhöhten Sitz und sprach mit tiefer Baßstimme: »Meine braven Genossen, tut mir Bericht von eurem heutigen Tagewerk, wo ihr eingebrochen seid und was ihr erbeutet habt!«
Da richtete sich zuerst ein langer Mann mit kohlschwarzem Bart empor und antwortete: »Mein lieber Hauptmann, ich habe heute früh einen reichen Edelmann seiner ledernen Hose beraubt, diese hat zwei Taschen, und so oft man das Oberste zuunterst kehrt und tüchtig schüttelt, so oft fällt ein Häuflein Dukaten heraus auf den Boden.«
»Das klingt sehr gut!« sprach der Hauptmann.
Ein anderer der Männer trat auf und berichtete: »Ich habe heute einem General seinen dreieckigen Hut gestohlen; dieser Hut hat die Eigenschaft, wenn man ihn auf dem Kopf dreht, daß unaufhörlich aus den drei Ecken Schüsse knallen.«
»Das läßt sich hören!« sprach der Hauptmann wieder.
Und ein dritter richtete sich auf und sprach: »Ich habe einen Ritter seines Schwertes beraubt; so man dasselbe mit der Spitze in die Erde stößt, ersteht augenblicklich ein Regiment Soldaten.«
»Eine tapfere Tat!« belobte der Hauptmann.
Ein vierter Räuber erhob sich nun und begann: »Ich habe einem schlafenden Reisenden seine Stiefel abgezogen, und wenn man diese anzieht, legt man mit jedem Schritt sieben Meilen zurück.«
»Rasche Tat lobe ich!« sprach der Hauptmann zufrieden, »hänget eure Beute an die Wand und dann esset und trinket und schlafet wohl.« Somit verließ er das Schlafzimmer der Räuber; diese zechten noch weidlich und fielen dann in festen Schlaf.
Als alles stille und ruhig war und die Männer allesamt schliefen, machte sich der kleine Hirte hervor, zog die ledernen Hosen an, setzte den Hut auf, gürtete das Schwert um, fuhr in die Stiefel und schlich dann leise aus dem Haus. Draußen aber zeigten die Stiefel zur Freude des Kleinen schon ihre Wunderkraft, und es währte gar nicht lange, so schritt das Bürschchen zur großen Residenzstadt Spaniens hinein; sie heißt Madrid.
Hier fragte er den ersten besten, der ihm aufstieß, nach dem größesten Gasthof, aber er erhielt zur Antwort: »Kleiner Wicht, geh du hin, wo deinesgleichen einkehrt, und nicht wo reiche Herren speisen.« Doch ein blankes Goldstück machte jenen gleich höflicher, so daß er nun gerne der Führer des kleinen Hirten wurde und ihm den besten Gasthof zeigte.
Dort angelangt, mietete der Jüngling sogleich die schönsten Zimmer und fragte freundlich seinen Wirt: »Nun, wie steht es in eurer Stadt? Was gibt es hier Neues?«
Der Wirt zog ein langes Gesicht und antwortete: »Herrlein, Ihr seid hier zu Land wohl fremd? Wie es scheint, habt Ihr noch nicht gehört, daß unser König, Majestät, sich rüstet mit einem Heer von zwanzigtausend Mann? Seht, wir haben Feinde; oh, es ist gar eine schlimme Zeit! Herrlein, wollt Ihr auch etwa unters Militär gehen?«
»Freilich, freilich«, sprach der zarte Jüngling, und sein Gesicht glänzte vor Freude.
Als der Wirt sich entfernt hatte, zog er flugs seine ledernen Hosen aus, schüttelte sich ein Häuflein Goldstücke und kaufte sich kostbare Kleider und Waffen und Schmuck, tat alles an und ließ beim König um eine Audienz bitten. Und wie er in das Schloß kam und von zwei Kammerherren durch einen großen herrlichen Saal geführt wurde, begegnete ihnen eine wunderliebliche junge Dame, die sich anmutig vor dem schönen Jüngling, der in der Mitte der Herren ging und sie zierlich grüßte, verneigte, und die Herren flüsterten: »Das ist die Prinzessin, die Tochter des Königs.«
Der junge Mann war nicht wenig von der Schönheit der Königstochter entzückt, und seine Entzückung und Begeisterung ließen ihn keck und mutvoll vor dem Könige reden. Er sprach: »Königliche Majestät! Ich biete hiermit untertänigst meine Dienste als Krieger an. Mein Heer, das ich Euch zuführe, soll Euch den Sieg erfechten, mein Heer soll alles erobern, was mein König zu erobern befiehlt. Aber eine Belohnung bitte ich mir aus, daß ich, wofern ich den Sieg davontrage, Eure holde Tochter als Gemahlin heimführen dürfe. Wollt Ihr das, mein gnädigster König?«
Und der König erstaunte ob der kühnen Rede des Jünglings und sprach: »Wohl, ich gehe in deine Forderung ein; kehrst du heim als Sieger, so will ich dich als meinen Nachfolger einsetzen und dir meine Tochter zur Gemahlin geben.«
Jetzt begab sich der ehemalige Hirte ganz allein hinaus auf das freie Feld und begann, sein Schwert drauf und drein in die Erde zu stoßen, und in wenigen Minuten standen viele Tausende kampfgerüsteter Streiter auf dem Platz, und der Jüngling saß als Feldherr kostbar bewaffnet und geschmückt auf einem herrlichen Roß, welches mit goldgewirkten Decken behangen war; der Zaum blitzte von Edelsteinen, und der junge Feldherr zog aus und dem Feind entgegen, da gab es eine große blutige Schlacht; aus dem Hut des Feldherrn donnerten unaufhörlich tödliche Schüsse, und das Schwert desselben rief ein Regiment nach dem andern aus der Erde hervor, so daß in wenigen Stunden der Feind geschlagen und zerstreut war und die Siegesfahnen wehten. Der Sieger aber folgte nach und nahm dem Feinde auch noch den besten Teil seines Landes hinweg. Siegreich und glorreich kehrte er dann zurück nach Spanien, wo ihn das holdeste Glück noch erwartete. Die schöne Königstochter war nicht minder entzückt von dem schmucken Jüngling gewesen, wie sie ihm im Saale begegnet war, als er von ihr; und der gnädigste König wußte die sehr großen Verdienste des tapfern Jünglings auch gebührend zu schätzen, hielt sein Wort, gab ihm seine Tochter zur Gemahlin und machte ihn zu seinem Nachfolger und Thronerben.
Die Hochzeit wurde prunkvoll und glänzend vollzogen, und der ehemalige Hirte saß ganz im Glück. Bald nach der Hochzeit legte der alte König Krone und Szepter in die Hände seines Schwiegersohns, der saß stolz auf dem Thron und neben ihm seine holde Gemahlin, und es wurde ihm, als dem neuen König, von seinem Volke Huldigung gebracht. Da gedachte er seines so schön erfüllten Traumes und gedachte seiner armen Eltern und sprach, als er wieder allein bei seiner Gemahlin war: »Meine Liebe, sieh, ich habe noch Eltern, aber sie sind sehr arm, mein Vater ist Dorfhirte weit von hier, und ich selbst habe als Knabe das Vieh gehütet, bis mir durch einen wunderbaren Traum offenbart wurde, daß ich noch König von Spanien werde. Und das Glück war mir hold, sieh, ich bin nun König, aber meine Eltern möcht ich auch gern noch glücklich sehen, daher ich mit deiner gütigen Zustimmung nach Hause reisen und die Eltern holen will.« Die Königin war's zufrieden und ließ ihren Gemahl ziehen, der sehr schnell zog, weil er die Siebenmeilenstiefel anhatte. Unterwegs stellte der junge König die Wunderdinge, die er den Räubern abgenommen, ihren rechtmäßigen Eigentümern wieder zu, bis auf die Stiefel, holte seine armen Eltern, die vor Freude ganz außer sich waren, und dem Eigentümer der Stiefel gab er für dieselben ein Herzogtum. Dann lebte er glücklich und würdiglich als König von Spanien bis an sein Ende.
Des Königs Münster
Es war einmal ein König, der erbaute ein prachtvolles Münster zur Ehre und zum Lobe Gottes, und es durfte niemand zu diesem Bau einen Heller beisteuern, nach des Königs ausdrücklichem Gebot, sondern er wollte es ganz aus dem eignen Schatz erbauen. Und so geschah es auch, und das Münster war vollendet, schön und würdig, mit aller Pracht und aller Zier. Und da ließ der König eine große marmorne Tafel zurichten, in diese ließ er mit goldnen Buchstaben eine Schrift graben, daß er, der König, allein den Dom erbaut habe und niemand habe dazu beigesteuert. Aber als die Tafel einen Tag und eine Nacht lang aufgerichtet war, so war in der Nacht die Schrift verändert, und statt des Königs Namen stand ein anderer Name darauf, und zwar der Name einer armen Frau, so daß es nun lautete, als habe sie das ganze prächtige Münster erbaut. Das verdroß den König mächtig; er ließ den Namen austilgen und den seinigen wieder einschreiben. Aber über Nacht stand wieder der Name jener armen Frau auf der Tafel, und jedermann las, daß sie des Münsters Stifterin sei. Und zum dritten Male ward des Königs Name auf die Tafel geschrieben, und zum dritten Male verschwand er, und jener kam zum Vorschein. Da merkte der König, daß hier Gottes Finger schreibe, demütigte sich und ließ nach der Frau forschen und sie vor seinen Thron heischen. Voll Angst und erschrocken trat sie vor den König, der sprach zu ihr: »Frau, es geben sich wunderliche Dinge, sage mir bei Gott und deinem Leben die Wahrheit! Hast du mein Gebot nicht vernommen, daß niemand zu dem Münster geben solle? Oder hast du doch dazu gegeben?«
Da fiel das Weib dem Könige zu Füßen und sprach: »Gnade, mein Herr und König! Ich will alles auf deine Gnade bekennen! Ich bin ein ganz armes Weib; ich muß mich kümmerlich mit Spinnen ernähren, daß mich der Hunger nicht ertötet, und da hatte ich doch ein Hellerlein erübrigt, das mocht ich gar zu gerne darbringen zu deinem Tempelbau und Gott zu Ehren, aber ich fürchtete, o Herr, deinen Bann und deine harte Bedräuung, und da kaufte ich um das Hellerlein ein Bündelein Heu, das streute ich auf die Straße den Ochsen hin, welche die Steine zu deinem Münster zogen, und sie fraßen es. So tat ich nach meinem Willen und ohne dein Gebot zu verletzen.«
Da ward der König mächtiglich bewegt von der Frauen Rede und sah, wie Gott der Herr, ihren reinen Sinn gewürdigt und ihn als höheres Opfer angenommen als des Königs reichen Schatz. Und der König beschenkte die arme Frau reichlich und nahm sich die Strafe seiner Eitelkeit wohl zu Herzen.
Die Hexe und die Königskinder
Mitten in einem Walde wohnte eine alte schlimme Hexe ganz allein mit ihrer Tochter, die ein gutes, mildes Kind war und bei der das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamme, nicht zutraf. Der Stamm nämlich war über alle Maßen knorrig, stachlig und häßlich; wer die Alte sah, ging ihr aus dem Wege und dachte: Weit davon ist gut vorm Schuß. Die Alte trug beständig eine grüne Brille und über ihrem Zottelhaar, das ungekämmt ihr vom Kopfe weit herunterhing, einen roten Tuchlappen, sie ging gern in kurzen Ärmeln, daß ihre dürren wettergebräunten Arme weit aus dem sie umschlotternden Gewand hervorragten. Auf dem Rücken trug sie für gewöhnlich einen Sack mit Zauberkräutern, die sie im Walde sammelte, und in der Hand einen großen Topf, darin sie dieselben kochte und damit Ungewitter, Hagel und Schloßen, Reif und Frost zu Wege brachte, so oft es ihr beliebte.
Am Finger trug sie einen Hexenreif von Golde mit einem glühroten Karfunkelstein, mit dem sie Menschen und Tiere bezaubern konnte. Dieser Ring machte die Alte riesenstark und lebenskräftig und machte sie, wenn sie wollte, auch ganz und gar unsichtbar; da konnte sie hingehen, wohin sie wollte, und nehmen, was sie wollte – und das tat sie auch, und im Walde suchte sie die Hirschkühe auf, und wenn die Tiere den Ring sahen und sahen den Stein funkeln, da mußten sie an eine Stelle gebannt stehen bleiben, und dann ging die Alte zu den Hirschkühen und molk deren Milch in ihren Topf und trank sie mit ihrer Tochter. Diese Tochter hieß Käthchen und hatte es nicht gut bei ihrer bösen Mutter, doch trug sie geduldig alles Leid. Am schmerzlichsten war ihr, daß ihre Mutter manchesmal Kinder mitbrachte, mit denen Käthchen gern gespielt hätte, allein die Alte nahm immer den Kindern ihre Kleider, sperrte die Kinder ein und fütterte sie mit Hirschmilch, daß sie fett wurden, und was sie dann mit ihnen vornahm, ist gruselig zu erzählen; sie verwandelte sie nämlich in Hirschkälbchen und verkaufte diese an Jäger. Die Jäger aber schossen die armen verwandelten und verkauften Hirschkälbchen tot und lieferten sie in die Stadt, wo die Leute das junge Wildbret gar gern essen. So schlimm und böse war die häßliche Alte, und da sie den ganzen Tag nichts tat, als zaubern und böse Ränke ersinnen, und dabei oft und viel laut vor sich hin murmelte, so lernte ihre Tochter Käthchen ihr unvermerkt einige Zauberstücklein ab, die sie ganz im stillen für sich behielt.