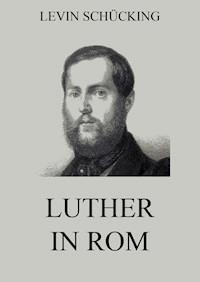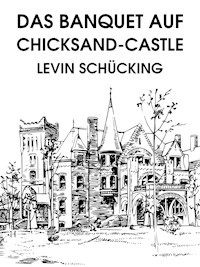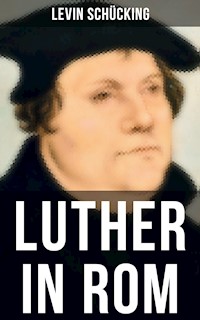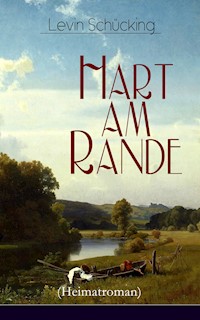1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der historische Roman "Die schwarz-weiße Perle" von Levin Schücking entführt den Leser in die faszinierende Welt des 17. Jahrhunderts, in der die Geschichte einer ungewöhnlichen Perle und ihrer Besitzer erzählt wird. Schücking zeigt in diesem Werk sein Talent für detaillierte Beschreibungen und lebendige Charaktere, die den Leser in eine vergangene Epoche eintauchen lassen. Der Roman ist geprägt von einer romantischen Erzählweise und einem Hauch von Abenteuer, der die Spannung konstant aufrecht erhält. Dieses Werk steht als Jugendbuch und Liebhaber des historischen Genres gleichermaßen geeignet. Levin Schücking, der Autor von "Die schwarz-weiße Perle", war ein bekannter deutscher Schriftsteller und Übersetzer des 19. Jahrhunderts. Seine Liebe zur Geschichte und zur Literatur spiegelt sich in seinem Werk wider, das für seinen detailreichen Schreibstil und seine genaue Recherche bekannt ist. Schücking war bekannt für seine Fähigkeit, historische Ereignisse und Fakten mit fiktiven Elementen zu verweben, und schuf auf diese Weise mitreißende Romane, die bis heute ihre Leser fesseln. Empfohlen für Leser, die sich für historische Romane interessieren, bietet "Die schwarz-weiße Perle" von Levin Schücking ein fesselndes Leseerlebnis voller Abenteuer, Romantik und spannender historischer Einblicke. Tauchen Sie ein in die Welt des 17. Jahrhunderts und begleiten Sie die Protagonisten auf ihrer Reise durch eine Welt voller Geheimnisse und Intrigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die schwarz-weiße Perle
(Historischer Roman)
Books
Inhaltsverzeichnis
1.
Es war im Frühling 1741. Die Hälfte Europas stand in Flammen, die Völker befehdeten sich und die Länder wurden von verwüstenden Kriegsheeren überschwemmt; und all dies Blut, alle diese Gräuel, alle diese wider einander entfesselten Leidenschaften: weshalb?
Weil der geistreichste und interessanteste, der liebenswürdigste junge Mann jener Zeit einen Zank mit dem bezauberndsten, schönsten und reichsten jungen Mädchen, das es damals auf dem Erdenrunde gab, angefangen hatte, ohne daß es ihn im Geringsten verletzt oder gereizt hätte, nicht einmal dadurch, daß es ihm einen Korb gegeben.
Vielleicht, hätten sie sich je gesehen und sich kennen gelernt, so hätten sie sich in einander verliebt, sich die Hände gereicht und eine glückliche Ehe zusammen geführt; und eine glückbringende »Ehe« in dem alten Sinn des Wortes, das eine von den Göttern geheiligte Bundesgemeinsamkeit bedeutet, hätte ihre Völker umschlossen, und die Schicksale der Welt seit hundert Jahren wären andere, glücklichere gewesen.
Aber dies sollte nicht sein, und wie gesagt, diese beiden hinreißend liebenswürdigen jungen Leute, die, wenn das Schicksal nur ein ganz klein wenig von jener Dichterader und jener Gutmüthigkeit hätte, welche die Romanschreiber belebt, zu einem glücklichen Paare zusammengebracht worden wären, geriethen, da es offenbar unmöglich war, daß sie sich gleichgültig blieben, in Streit und Hader.
Wenn aber die Götter der Erde in Streit gerathen, so senden sie, wie bekannt, seit den ältesten Zeiten junge Männer in großen Heeren widereinander aus, die miteinander ringen. Die, welche die Stärksten sind, sichern ihrer Seite das Recht. Weshalb das Recht der Stärke zufällt, das ist ein Problem, welches es bis jetzt nicht gelungen ist auf philosophischem Wege zu lösen. Man könnte das Recht auch auf der Seite der Zahl suchen und vor einer Schlacht die Heere zählen, um ihnen die Anstrengung und das Aufreibende der Kampfesarbeit zu ersparen. Ja, man könnte dann weiter gehen und das Recht auch an andere Zahlen als just an die von jungen Männern geknüpft annehmen; man könnte auch die Eichbäume zählen, welche sich in den beiderseitigen Ländern befinden, und erzielte damit nebenbei noch eine unabsehbare Verbesserung der Waldcultur. Aber es ist nun einmal Thatsache, daß in dem Streit der Großen der Erde die jungen Männer des Landes berufen werden, das Recht mit ihren bewaffneten Armen festzustellen, und in die Thatsachen muß der Mensch sich fügen, dazu ist er da, dazu ward er geboren, das ist der Schicksalsspruch, der ihm an der Wiege gesungen wird.
Die junge Dame, von der wir reden und die in der Hofburg zu Wien wohnte, bedurfte also aller ihrer bewaffneten Männer, ihrer sämmtlichen Heerschaaren, um sie denen ihres Feindes entgegenzustellen, und mußte sie zusammenziehen aus allen Theilen ihres weiten Reiches, um sie gen Norden zu senden. So kam es, daß der Süden dieses Reiches, der schönste, blühendste Theil ihrer Erblande, um den gierige Nachbarn sie neideten, von ihren Truppen entblößt wurde und daß diese Nachbarn sich rüsteten, ihr zu entreißen, was sie zu vertheidigen nicht im Stande war. Ein frommer alter Geistlicher, der eben Frankreich regierte und welcher der Cardinal Fleury hieß, verbündete sich mit einer ebenfalls frommen alten Frau, die als Stiefkönigin über Spanien verfügte, und Beide streckten die Hände aus, jenem armen von Allen verlassenen jungen Weibe die besten Perlen aus ihrer Krone zu reißen, nämlich Alles, was sie besaß im schönen Lande Italien, auf der Sonnenseite ihres väterlichen Erbes.
Zwischen ihr und diesen neuen Feinden stand ein mächtiger Fürst, mächtig durch eine kleine, aber tüchtige Streitmacht und seine Festungen, und noch mächtiger durch die Lage seines Landes. Es war der »Markgraf Italiens«, der seit 1720 der König von Sardinien hieß.
König von Sardinien war damals Carl Emanuel, einer jener klugen und kriegerischen Fürsten aus dem Hause Savoyen, ein Herr, der die Vortheile seiner Stellung sehr wohl begriff und sehr gut einsah, daß, wenn er seine Alpenpässe schließe, die Franzosen und die Spanier lange Zeit brauchen würden, bis sie über das österreichische Erbe in Italien herfallen könnten; daß aber dies Erbe verloren sei, wenn er sein Schwert in andere Wagschale werfe und spreche: »Theilt mit mir!«
In der That, es war eine vortheilhafte Stellung für einen ehrgeizigen Mann, den Sohn eines Geschlechts, dessen Erbweisheit darin bestand, die Gunst des Augenblicks zu benutzen, und Carl Emanuel hatte den festen Entschluß gefaßt, diesem Augenblick in der Geschichte seines Hauses Alles abzugewinnen, was sich ihm abgewinnen ließ. Bis dahin, daß er im Stillen abgewogen, was auf der einen Seite ihn lockte und was ihm die andere verhieß, geruhte er mit abgemessener, sich gleichbleibender Huld die Botschafter der beiden Mächte anzuhören, welche sich um seine Bundesgenossenschaft mühten, mit kühler Freundlichkeit ihre Bemühungen um seine Gnade aufzunehmen und still lächelnd auf das Spiel der Intriguen herabzublicken, welches sie wider einander führten.
2.
Damals war die Zeit großer fürstlicher Bauten. Jeder große und kleine Herr, hat man bemerkt, wollte gern Ludwig XIV. nachahmen und sein Versailles haben. Aber war das in der That nur der Trieb der Nachahmung? Gewiß nicht. Die Zeit gab eben jedem dieser kleinen oder großen Herren sein Versailles, wie unsere Zeit jeder Stadt ihren Bahnhof giebt, ihren zoologischen Garten und ihr Sommertheater. Die Jahrhunderte spiegeln ihren Geist ab durch die Art, wie sie bauen, aber noch weit mehr durch das, was sie bauen. Auf den Kuppeln dieser Schlösser von Schönbrunn, Nymphenburg, Caserta, Stupinigi ruht ein tieferer culturhistorischer Gedanke, als der an die Rococo-Mode, welche Ludwig XIV. zur Herrschaft gebracht, und die Sucht darin mit ihm zu wetteifern.
Stupinigi heißt das Versailles Carl Emanuel’s, des Sardenkönigs. Südlich von Turin liegt es, unfern von Montcalieri, in der Fläche, die der kleine Sangone durchfließt, in einer heißen, staubigen Gegend, die eigentlich sehr reizlos wäre, wenn sie nicht die Aussicht auf das prachtvolle Panorama hätte, die blauen, in schneeigen Gipfelzacken aufsteigenden Alpen, die cottischen, grauen und penninischen Alpen, welche nach drei Seiten hin, im Westen, im Norden und im Osten, den Horizont einrahmen.