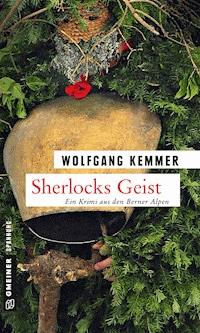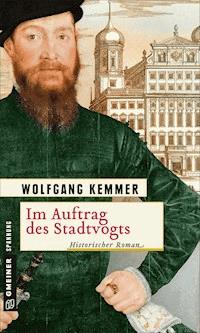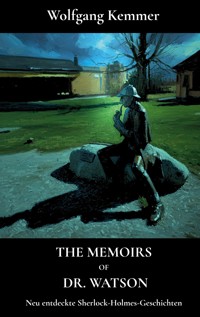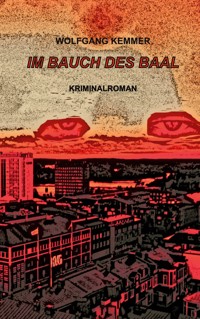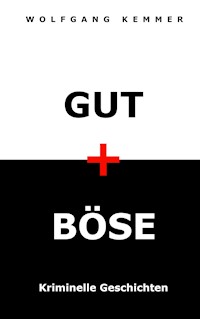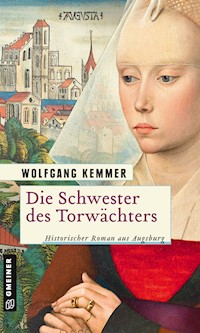
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Augsburg im Sommer 1530: Nachdem die Protestanten auf dem Reichstag Kaiser Karl ihr Bekenntnis vorgelegt haben, verschwindet einer ihrer Anführer spurlos aus der Stadt. Kurz darauf wird ein fremder Buchmaler in den Lechauen erstochen aufgefunden. In die Fälle verstrickt sind der Torwächter Gottfried Rosenplüt und seine Schwester Magdalena, deren unschuldige Schönheit selbst in ihrem vertrauten Umfeld Neid und Begierden geweckt hat. Völlig arglos wird sie zum Opfer einer heimtückischen Intrige …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Kemmer
Die Schwester des Torwächters
Historischer Roman aus Augsburg
Zum Buch
Weibliches Ränkespiel Augsburg 1530: Während sich der Prozess gegen die bankrotte Kaufmannssippe Höchstetter hinzieht, sammeln sich die Großen und Mächtigen zum Reichstag. In die bunte Völkerschar mischen sich Geoffrey, ein junger Angelsachse, und sein Übersetzer Berthold, den die Wirren des Bauernkrieges nach England gespült hatten. Nachdem die Protestanten dem Kaiser ihr Bekenntnis überreicht haben, flüchtet einer ihrer Anführer bei Nacht und Nebel aus der Stadt. Hilfe erhält er dabei von Torwächter Gottfried, in dessen Haus er einquartiert war. Heimliche Mitwisser sind Geoffrey und Berthold, die beide großes Interesse an Gottfrieds schöner Schwester Magdalena, vor allem aber an der Bewachung der Stadttore haben. Sie stehen im Dienst des nach England entkommenen Joachim Höchstetters und sollen Wege finden, um seine noch in Augsburg inhaftierten Verwandten zu befreien. Doch dann wird Geoffrey in den Lechauen ermordet und Gottfried und Magdalena werden Ziel eines teuflischen Intrigenspiels …
Wolfgang Kemmer wurde 1966 in Simmern/Hunsrück geboren. Er studierte Germanistik, Anglistik und Angloamerikanische Geschichte in Köln und veröffentlichte in dieser Zeit seine ersten Kriminalromane. Nach dem Studium arbeitete er als Lektor in einer Literatur-Agentur. Heute lebt Wolfgang Kemmer als freiberuflicher Autor und Dozent mit seiner Familie in Augsburg. Er schreibt Kurzgeschichten für Anthologien und Zeitschriften und betreute viele Jahre als Herausgeber den Kurzkrimi-Podcast von Jokers-Weltbild. Mit seinen historischen Augsburg-Krimis veranstaltet er regelmäßig Lesungen und kombiniert diese mit Stadtführungen zu den Schauplätzen seiner Geschichten.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Im Auftrag des Stadtvogts (2017)
Sherlocks Geist (2015)
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Rogier_van_der_Weyden_-_Portrait_of_a_Woman_-_WGA25712.jpg und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schedel,_Wolgemut,_Pleydenwurff,_Durer_-_Liber_Chronicarum_(Nuremberg_Chronicle).jpg
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6236-8
Widmung
Für Dorothee
Zitate
Denn ich weis nicht / was ich thu / Denn ich thu nicht das ich wil / sondern das ich hasse / das thu ich. So ich aber das thu / das ich nicht wil / so willige ich / das das Gesetz gut sey. So thu nu ich dasselbige nicht / sondern die sünde /die in mir wonet.
(Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 7, Vers 15–17)
Fleuch die Bulerin / das du nicht in jre stricke fallest.
(Aus dem Buch Jesus Sirach, Kapitel 9, Vers 3)
Prolog
Confectio
Lange schon rumorte es im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Unzufriedenheit machte sich breit. Vor allem die Landbevölkerung litt, während Adel und Klerus in Wohlstand und Ausschweifungen schwelgten. Da wagte ein kleiner Mönch aus Wittenberg, gegen den allmächtigen Papst in Rom aufzubegehren. Er übersetzte dem gemeinen Mann das Wort Gottes und verkündete die frohe Botschaft von der Freiheit des Christenmenschen. Aus dem Rumoren erwuchs ein Getöse, allerorten wurden Stimmen laut, welche die frohe Botschaft aufnahmen und nach ihrem Gutdünken auslegten. Bald reichten Worte allein nicht mehr aus, wenn es darum ging, Rechte durchzusetzen. Martin Luthers Botschaft schürte die Hoffnungen des kleinen Mannes und legte die Lunte an ein Pulverfass.
Entzündet wurde sie von anderen, die damit eine wahre Feuersbrunst entfachten. Im Sommer 1524 schwang sich der Theologe Thomas Müntzer auf zum Propheten des Aufruhrs. In Allstedt hielt er vor dem sächsischen Herzog Johann und dessen Sohn Johann Friedrich eine flammende Predigt, in der er weitere Vertröstungen auf das Jenseits ablehnte und verlangte, das Reich Gottes auf Erden nötigenfalls mit dem Schwert durchzusetzen.
Viele verstanden dies als Aufruf zum gewaltsamen Widerstand gegen die Obrigkeit. Die ersten Aufstände brachen im Schwarzwald aus und breiteten sich schnell in Süddeutschland und von dort nach Tirol, die Steiermark, Franken und bis nach Thüringen aus. Vertreter der ländlichen Oberschicht, Schultheißen, Dorfrichter, kleine Handwerker und verarmte Landadlige setzten sich an die Spitze von Bauernhorden, die, Dreschflegel und Sensen schwingend, das Land durchzogen und in ihrer entfesselten Wut Schlösser und Klöster plünderten, brandschatzten und mordeten.
Die anfänglichen Erfolge führten jedoch nicht zu einem gemeinsamen Vorgehen, so dass die Aufstände immer häufiger an der Aufsplitterung und mangelnden gegenseitigen Unterstützung der Bauernhaufen scheiterten. Durch geschickte Verzögerungstaktik, Verhandlungen und kleine Zugeständnisse verstanden es die im Schwäbischen Bund zusammengeschlossenen Adligen, Zeit zu gewinnen. Finanziell unterstützt von den Augsburger Fuggern, stellten sie neue Truppen auf und schlugen gnadenlos zurück.
Im Frühjahr 1525 eskalierte die Gewalt auf beiden Seiten. Anfang Mai distanzierte Martin Luther sich ausdrücklich in seiner Schrift »Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern« von den Aufständischen und lieferte den Fürsten damit die Rechtfertigung für ein blutiges Gemetzel.
Kurz darauf versuchte Thomas Müntzer, die mitteldeutschen Bauernhorden im Thüringischen Frankenhausen zum letzten großen Gefecht zu sammeln. Am elften Mai traf er mit dreihundert Mann und acht Karrenbüchsen unter seiner Regenbogenfahne mit den Worten »Verbum domini maneat in aeternum« von Mühlhausen her ein, um mit den vereinigten Haufen nach Heldrungen zu ziehen und dem verhassten Grafen von Mansfeld den Garaus zu machen.
Bevor es dazu kam, rückten jedoch schon am Morgen des vierzehnten Mai die feindlichen Truppen des Landgrafen Philipp von Hessen und des Herzogs von Braunschweig heran. Bei ersten Scharmützeln holten sie sich eine blutige Nase und zogen sich auf die Linie von Rottleben zurück. Dort wollten sie sich von den Strapazen des Marsches erholen und auf die heranrückenden Truppen der sächsischen Albertiner unter Herzog Georg dem Bärtigen warten.
Die Aufständischen werteten dies als Schwäche, woraufhin ein Großteil des Frankenhäuser Haufens die Stadt verließ und auf dem für strategisch günstig gehaltenen Hausberg in einer Wagenburg aus Tross- und Bauernkarren Stellung nahm. Um den äußeren Ring aus Planwagen zogen sie zudem noch einen Graben, der die Reiterei des Fürstenheeres fernhalten sollte. Die vorher auf der Stadtmauer aufgestellten Geschütze wurden ebenfalls auf den Hausberg gebracht.
Ungeachtet seiner kleinen Schlappe forderte Landgraf Philipp die Aufständischen zur sofortigen Niederlegung der Waffen und Auslieferung Müntzers und der übrigen Hauptleute auf – ein Schachzug, der die wenig kampferprobten Bauern an einem entschlossenen Ausnützen des errungenen Vorteils hinderte. Gemäßigte Kräfte unter der Führung der Grafen Stolberg, Rüxleben und Werther mahnten angesichts der militärischen Überlegenheit des Gegners zur Besonnenheit und ließen sich auf Verhandlungen mit den Fürsten ein. Die von ihnen ausgehandelte Waffenruhe nutzte Landgraf Philipp, um noch am selben Abend seinerseits Geschütze auf dem östlichen Hausberg in Stellung zu bringen, von wo aus die Aufständischen beschossen werden konnten.
So herrschte bei Einbruch der Nacht eine eher düstere Stimmung an den Feuern innerhalb der Wagenburg. Der so glorreich begonnene Tag hatte den nur lose zusammengehaltenen Bauernhaufen weiter gespalten. Ohnehin war es eine bunt zusammengewürfelte Schar, die um die Feuer versammelt lag: Männer jedweden Alters, teils nur in Lumpen, teils in zerschlissenen Bauernkitteln und löchrigen Lodenwämsern, ganz wenige nur gerüstet mit erbeuteten Sturmhauben und Kürassen, andere dafür geschmückt mit der Beute aus Klöstern, Kirchen und Schlössern, so dass mancher zu seinen übrigen Fetzen eine festliche Albe, ein Messgewand oder eine Schaube mit silbernen Knöpfen und auf dem Kopf eine Chorkappe oder gar einen Hut mit kecker Straußenfeder trug. Genagelte Schuhe oder gar Stiefel waren eine Seltenheit, die meisten waren barfuß oder trugen die üblichen Bundschuhe. In ihren wettergegerbten, abgezehrten Gesichtern spiegelten sich Müdigkeit, Angst, Verzweiflung, Enttäuschung, aber auch immer noch Hoffnung und hin und wieder sogar wilde Entschlossenheit.
Zwei, deren Äußeres sie schon auf den ersten Blick nicht als Bauern, sondern als städtische Handwerksburschen auswies, hatten sich aus dem hell erleuchteten Kreis inmitten der Wagenburg entfernt, saßen nebeneinander im Schatten auf der Deichsel eines Planwagens und blickten hinüber zu den feindlichen Stellungen, wo ebenfalls die Lagerfeuer flackerten.
»Wir dürfen nicht aufgeben«, sagte der Ältere der beiden. »Wir haben das Gemetzel bei Leipheim überlebt und den langen Weg hierher gemacht, um den Müntzer zu sehen, zu hören und mit ihm zu kämpfen. Und jetzt ist er endlich hier und diese feigen Halunken wollen ihn den Pfaffen und Junkern ausliefern.«
Er nickte verächtlich mit dem Kopf in Richtung der Feuer hinter ihnen. An seiner linken Hand fehlten zwei Finger und ein Verband war um seinen Kopf gewickelt, wo ein Schwerthieb ihm den größten Teil des rechten Ohrs abgetrennt hatte.
Sein jüngerer Begleiter, dessen linke Gesichtshälfte von Brandnarben entstellt war, schüttelte den Kopf. »Aber Paulus, das sind doch nur eine Handvoll, die überhaupt darüber nachdenken.« Er blickte sinnend zu den feindlichen Linien. »Und ehrlich gesagt: Ich weiß ja manchmal auch nicht mehr, was ich noch denken soll. Der Luther …«
»Sei mir still mit dem elenden Fürstenknecht!«, unterbrach der Ältere. »Wenn ich nur dran denk, dass ich nach ihm meinen Jungen getauft hab, und jetzt kriecht er den Junkern wieder ganz tief hinten hinein!«
»Aber du hast doch gar nicht gelesen, was er geschrieben hat!«
»Muss ich das denn? Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern, der Titel sagt doch schon alles! Wer das Schwert ergreift, wird durch das Schwert sterben, soll er geschrieben haben. So hat’s mir der Franz erzählt. Der hat’s gelesen und drauf geschissen. Und recht hat er. Denn was ist mit den Fürsten, frag ich dich? Was haben die in der Hand, wenn nicht ihre Schwerter? Wir dagegen haben nicht einmal ordentliche Waffen! Und was haben sie bei Leipheim gemacht mit ihren Schwertern? Ein einziges blutiges Schlachten. Nein, nein, lieber verreck ich, als dass ich noch mal klein beigeb.«
»Und was wird aus deinem Jungen, wenn du verreckst?«
»Ach, Berthold, mach mir doch das Herz nicht so schwer!« Er puffte seinem Kameraden rau in die Seite. »Über den Martin und die Therese will ich lieber gar nicht nachdenken.«
»Nachdenken hat noch niemandem geschadet.«
»Geh, wer ist eigentlich der Ältere von uns zweien?«, brummte Paulus verdrießlich.
»An Jahren bist du es, aber wenn ich dich manchmal so reden hör … Wenn man grad erst mit knapper Not dem Tod entronnen ist, darf man doch schon mal ins Grübeln kommen.«
»Bin ich nicht genauso dem Tod von der Schippe gesprungen?«
»Ja, das bist du. Und du hast mir dabei sogar das Leben gerettet, was ich dir nie vergessen werde. Deshalb versteh ich erst recht nicht, wie du nach Leipheim noch genauso weitermachen kannst.«
»Du bist doch auch hier.«
»Ja, aber vor allem, weil ich den Müntzer sehen wollt. Weil ich gehofft habe, dass er weiß, wo es hingehen soll. Ich will nicht auf Teufel komm raus kämpfen, wenn es sich vermeiden lässt.«
»Wohl gesprochen!«
Die beiden zuckten zusammen. Paulus’ Rechte fuhr zum Dolch.
»Lass stecken. Ich bin einer von euch«, kam die Stimme seitlich von ihnen aus der Dunkelheit.
»Was schleichst du dann im Finstern herum und lauschst? Zeig dein Gesicht!«
»Gern. Auch wenn’s nicht das schönste ist, so ist es doch ein ehrliches, dessen ich mich nicht schämen muss.«
»Das kann jeder sagen«, brummte Paulus und musterte den untersetzten Mann, der sich ihnen nun mit friedlich ausgebreiteten Händen näherte.
Er sah nicht aus wie ein Kämpfer. Seine Kleidung wirkte städtisch, aber einfach, und war dabei erstaunlich ordentlich und sauber. Er schien weder Waffen zu tragen noch hatte er sichtbare Verletzungen. Sein rundes Gesicht war glatt rasiert und flach und bleich wie die Scheibe des Mondes. Seine kurz geschnittenen Haare schimmerten im schwachen Feuerschein rötlich blond. Seine Augen sahen listig, aber nicht feindselig drein.
»Kenn ich dich nicht aus Augsburg?«, fragte Paulus, immer noch misstrauisch.
»Ja, das mag sein, denn da komme ich her.«
»Wie heißt du?«
»Bartel.«
»Und weiter?«
»Körber. Mein Urgroßvater und mein Großvater waren Korbmacher und mein Vater auch, bis er anfing, für den Fugger zu arbeiten.«
»Den Fugger, soso.« Paulus stieß den Namen hervor, als ob er ihm die Zunge verbrenne. »Und du, hast du etwa auch für den Fugger gearbeitet?«
»Ja, auch, aber nur kurz, denn da hat’s mir nicht behagt. Jakob der Reiche war mir zuwider, ehrlich gesagt. Ein fürchterlicher Pfeffersack vor dem Herrn. Aber sein Stern ist längst schon im Untergehen, wenn ihr mich fragt. Der Alte macht’s nicht mehr lange. Mir soll’s jedenfalls recht sein.«
»Hast dir wohl was zuschulden kommen lassen, wie?«
»Wär das denn ein Makel?«
»Eigentlich eher das Gegenteil«, schnaubte Paulus, »aber wenn man schon was macht, sollte man’s auch richtig machen.«
»Aha«, sagte das Mondgesicht spöttisch. »Und was heißt das? Hätt ich ihn umbringen sollen?«
»So hat er’s nicht gemeint«, sagte der junge Berthold. »Wenn man für jemanden arbeitet, liefert man ordentliche Arbeit ab. Wenn einem der Herr oder die Arbeit aber zuwider sind, sucht man sich was, was einem besser taugt, und stiehlt nicht, denn das ist ehrlos.«
»Aha«, sagte Bartel wieder. »Besten Dank für die Belehrung.« Es klang noch spöttischer als zuvor. »Und eine Arbeit, die einem taugt, die findet man natürlich überall.«
»Lieber verhungern, als sich mit Dieben gemeinzumachen«, knurrte Paulus.
»Vergib meinem Freund«, sagte Berthold, der sich für sein eigenes siebengescheites Geschwätz zu schämen begann. »Er ist heute Abend schlechter Dinge. Aber sag uns doch, was dich hertreibt. Du siehst nicht aus, als ob du schon viele Schlachten geschlagen hättest, und deine Worte vorhin lassen das auch vermuten.«
»Du hast recht. Ich bin kein Mann des Schwertes, sondern des Wortes und der Feder und nur als Chronist hier, weil ich unbedingt den Müntzer sehen und …«
»Ach«, fuhr ihm Paulus ins Wort. »Ich bin auch ein Mann des Wortes, genauer gesagt: des gedruckten Wortes. Ich habe in Augsburg eine kleine Offizin gemeinsam mit Florian Brandner. Warum kenn ich dich denn da nicht?«
Bartel seufzte. »Weil ich nur ein kleines Licht bin und es noch nichts Gedrucktes von mir gibt. Ich hoffe, das Schlachten zu überleben, und wenn dir das auch gelingt, dann hilfst du mir ja vielleicht, meine Schriften zu verbreiten.«
»Kann ich mir kaum vorstellen«, brummte Paulus.
»Ich merke, dein Kamerad hat recht, du bist nicht sehr umgänglich. Ich lasse euch wohl besser allein. Alles Gute für morgen.« Er schickte sich an zu gehen.
»Glaubst du denn, dass es zur Schlacht kommt?«, fragte Berthold.
Bartel hielt noch einmal inne. »So sicher wie das Amen in der Kirche.«
»Und was hältst du von dem Vorschlag, den Müntzer auszuliefern?«, fragte Paulus lauernd.
»Davon halte ich gar nichts. Die Sache muss ordentlich zu Ende gebracht werden. Ohne Blutvergießen wird das leider nicht abgehen, aber wo gehobelt wird, fallen Späne, und wer Fleisch essen will, muss auch schlachten.«
»Ach, und wie passt das zu deinem übrigen Geschwätz?«
»Ich muss ja nicht mittun beim Schlachten. Ich sagte ja schon, dass ich ein Mann der Feder bin. Ein solches Ereignis bedarf auch kundiger Zeugen, die hinterher der Welt die Wahrheit darüber zu berichten vermögen.«
»Verschwind mir aus den Augen, bevor ich mich vergesse, du Feigling!« Paulus machte eine Drohgebärde.
Bartel wich zurück, zuckte die Achseln. »Spar deine Kräfte besser, wenn du den morgigen Tag überleben willst. Hitzköpfe wie du werden gewöhnlich schnell kaltgemacht.« Damit huschte er mit katzenhaften Bewegungen davon.
»Ein unangenehmer Mensch!« Paulus starrte ihm eine Weile misstrauisch hinterher ins Dunkel. »Verdammt!«, durchfuhr es ihn plötzlich. »Wo ist der jetzt hin?«
»Wieso?«
»Warum ist er nicht in die Wagenburg gegangen?«
»Er wird in die Stadt zurück sein.«
»Da kommt er doch jetzt gar nicht mehr rein.« Paulus schüttelte den Kopf. »Ist er nicht auch aus der Richtung gekommen, in der das Fürstenlager liegt?«
»Du hältst ihn für einen Spion?«
»Und für eine gottverdammte Memme obendrein.« Paulus lachte grimmig. »Na, von uns hat er jedenfalls nichts erfahren, was er dem Feind zutragen kann.«
»Sei’s drum. Wir sollten uns jetzt auch noch ein Weilchen aufs Ohr legen. Wer weiß, was uns morgen erwartet.«
Paulus hielt ihn zurück. »Das, was der Kerl von den Hitzköpfen gesagt hat, war vielleicht gar nicht so falsch.«
»Unsinn!«
»Nein, warte. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten.«
»Jeden, den du willst, wenn es in meiner Macht steht. Du hast mir das Leben gerettet.«
»Dafür hast du mir diesen Anhänger geschenkt.« Paulus zog ein kunstvoll gefertigtes Silberkreuzchen hervor, das er an einem Lederriemen um den Hals trug.
»Das ist nichts.«
»Doch, das ist sehr viel. Du hast es selbst gemacht und es ist wunderschön. Man sieht daran, wie hervorragend du dein Handwerk verstehst. Wenn ich den morgigen Tag nicht überlebe, möchte ich, dass du den Anhänger meinem Jungen gibst.«
»Unsinn, das kannst du eines Tages selbst tun.«
»Versprichst du es?«
Berthold nickte.
Wortlos gingen sie zu ihren Schlafplätzen im Innern der Wagenburg.
*
Am nächsten Morgen kamen erneut Unterhändler der Fürsten und forderten die Aufständischen auf, sich zu ergeben. Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, wiesen sie zu den Geschützen auf der östlichen Höhe und erzählten von den heranrückenden Truppen des Albertiners. Sie versprachen den Bauern Milde, verlangten aber im Gegenzug die Auslieferung der Anführer, insbesondere die Thomas Müntzers. Noch einmal verständigte man sich auf einen Waffenstillstand von vier Stunden. Stolberg, Rüxleben und Werther begaben sich wieder ins Fürstenlager, um Gnade auch für die Hauptleute zu verlangen.
Müntzer aber sah mit Erbitterung, wie mancher feindliche Blick auf ihn fiel, wie sich in vielen Herzen das Verlangen regte, den Mann, der ihnen die Freiheit gepredigt und sie damit in diese Lage gebracht hatte, zu opfern. Enttäuscht musste er erkennen, dass er seine Sache auf Menschen gebaut hatte, denen ihr Leib und Leben wichtiger waren als seine Idee der Freiheit. Er trat vor sie in den Ring, in dessen Mitte er seine Regenbogenfahne gepflanzt hatte, und rief:
»Brüder! Die Fürsten haben euch Gnade versprochen, wenn ihr mich ihnen überantwortet! Ich würde mein Leben geben, wäre ich überzeugt, dass euch mein Tod zum Heil diente. Nur zu gern würde ich mein Blut lassen, wüsste ich, dass ich euch damit das himmlische Gut der Freiheit erkaufte! Aber sind wir hier, um zu kämpfen oder um Gnade zu erbitten? Ist dadurch denn etwas gewonnen, wenn die Fürsten euch wieder in ihr Joch spannen? Könnt ihr die Freiheit dadurch erwerben, dass ihr die Freunde opfert, die mit euch zu sterben bereit sind? Vertraut nicht auf die Gnade eurer Unterdrücker! Bedenkt, was sie euren Brüdern angetan haben! Sie werden niemals vergessen, dass ihr euch gegen ihre Willkür aufgelehnt habt! Sobald ihr kleinmütig die Waffen aus der Hand gebt, werden sie euch einzeln zertreten! Traut ihnen nicht, denn sie sind voll Arglist!«
Ein Murmeln erhob sich, das Müntzer zu seinen Gunsten deutete. Er schien die Zweifler überzeugt zu haben.
Da trat ihm einer der Landjunker entgegen und rief mit lauter Stimme: »Willst du diese armen Leute wirklich ins Verderben stürzen, Thomas? Sieh unsre Kräfte an und die der vereinigten Fürsten. Sie werden uns erdrücken mit ihrer Waffengewalt. Dauern dich die Kinder dieser armen Leute nicht, die du zu Waisen machen willst? Du hast diese Händel begonnen, also ist es nun auch recht und billig, dass du sie ausbadest! Wenn du tatsächlich Liebe zu deinem Volk empfindest, so darfst du dein Leben nicht schonen und musst hinübergehen zu den Fürsten, um die armen Leute zu retten. Tust du das aber nicht und schätzt deinen Kopf höher als das Blut dieser Tausenden hier, so müssen wir dich binden und ausliefern, damit das Blutvergießen verhindert wird!«
Eine Weile lastete eine fürchterliche Stille über dem Ring in der Wagenburg. Jemand hatte laut auszusprechen gewagt, was viele dachten. Endlich erhob sich ein zerlumpter Bettelmönch, trat neben den Junker und begann mit zittriger Stimme zu sprechen. Er erklärte, dass ein Eid, den man einem Ketzer geschworen habe, nichts gelte. Nicht nur die heilige Kirche, sondern selbst Martin Luther habe das Tun des Müntzers verdammt. So einem müsse man nicht die Treue halten. Und wenn Gott den Reuigen und Bußfertigen vergebe, so würden das sicher auch die Fürsten aus christlicher Barmherzigkeit tun!
Die Stimme des Mönchs war zum Ende hin fester geworden. Alle Augen richteten sich nun auf Müntzer, der seine Widersacher voller Verachtung musterte.
»Wohlan«, rief er, »wollt ihr handeln wie Verräter? Hier bin ich! Bindet mich und liefert mich den blutdürstigen Räubern aus, damit sie ihr Mütchen an mir kühlen!«
»Nein!« Ein Mann mit blutverschmiertem Kopfverband drängte sich nach vorne in den Ring und reckte seine verstümmelte Linke in die Höhe. »Seht her: Ich bin Paulus Althammer, ein kleiner Drucker aus Augsburg. Mein Ohr und einen Teil meiner Hand hab ich in der Schlacht bei Leipheim eingebüßt, trotzdem bin ich jetzt hier und werde, wenn es sein muss, auch noch mein Leben geben für die Freiheit. Wir sind keine Verräter und Fürstenknechte. Wir wollen mit dir leben oder sterben, Müntzer!«
Aus dem einsetzenden Stimmengewirr gingen diejenigen, die ihm zustimmten, deutlich als Sieger hervor. Tiefe Befriedigung stand Müntzer ins Gesicht geschrieben. »Wenn ihr das wollt«, rief er, »so wird Gott uns beistehen, denn wir dienen einer gerechten Sache! Die Elenden aber, die Verrat stiften wollten, sollen die Strafe empfangen, die Verrätern gebührt. Greift sie, in Gottes Namen!«
Im Nu sahen sich die beiden Widersacher von Müntzers Getreuen umringt und ergriffen. Auf der Stelle wurden sie wegen Verrats und Aufwiegelei zum Tode verurteilt und ohne Federlesens enthauptet.
Doch die ehrfürchtige Stille nach dem Rollen der Köpfe war noch nicht verflogen, da kehrte Graf Werther alleine aus dem Fürstenlager zurück und berichtete den Versammelten, man habe seine Gefährten Stolberg und Rüxleben als Geiseln behalten. Die Fürsten seien keinesfalls bereit, die Anführer des Aufstandes zu verschonen. Und in der Tat hätten sie wohl auch keinen Grund mehr nachzugeben. Mit eigenen Augen habe er gesehen, dass die Reihen des Feindes mittlerweile geschlossen seien. Nun, da sich die Truppen des Albertiners mit denen des hessischen Landgrafen vereinigt hätten, sei die Lage auf dem Hausberg völlig aussichtslos. »Unsere Stellung ist von den bis an die Zähne bewaffneten Feinden völlig eingeschlossen«, endete er seinen Bericht.
Sogleich sah Müntzer Angst und Wankelmut in die Gesichter der Umstehenden zurückkehren. Er erkannte, dass er allein mit dem strengen Gericht, das er gehalten hatte, nicht vermochte, der Unruhe und Zwietracht unter dem Haufen Herr zu werden. So trat er erneut zu seiner Fahne, um unter den Verzagenden noch einmal das Feuer der Begeisterung zu wecken.
»Liebe Brüder!«, rief er. »Ihr seht, dass unsre Feinde, die hergekommen sind, weil sie uns abschlachten wollen, nun doch zu furchtsam sind, um uns anzugreifen. Stattdessen fordern sie, ihr sollt abziehen und ihnen eure Anführer überantworten! Nun, liebe Brüder, ihr wisst, dass ich unsere Sache auf Gottes Befehl angefangen habe und nicht aus eignem Antrieb oder Wagemut, da ich nie ein Krieger gewesen bin. Aber Gott hat mir geboten auszuziehen, und deshalb schulde ich ihm den Gehorsam, bis zum Ende auszuharren.
Denkt daran: Gott befahl Abraham, seinen Sohn zu opfern. Abraham wusste nicht ein noch aus und dennoch folgte er Gott und wollte das fromme Kind opfern und töten. Da errettete Gott Isaak und erhielt ihn am Leben. Also wird es auch uns ergehen! Daran habe ich keinen Zweifel, es wird alles wohl geraten, und wir werden heute Gottes Hilfe erleben und unsere Feinde vertilgen. Denn Gott spricht in der Schrift, er wolle den Armen und Frommen helfen und die Gottlosen ausrotten. Und wir sind die Armen, welche Gottes Wort folgen, darum sollen wir nicht zweifeln! Das Glück wird auf unsrer Seite sein!«
Er blickte sich um. Alle schienen an seinen Lippen zu hängen. Beflügelt fuhr er fort: »Was aber sind die Fürsten? Nichts als Tyrannen! Sie schinden die Leute und verhöhnen unsern Schweiß und unser Blut mit ihrer Hoffart, mit unnützer Pracht und Hurerei. Gott hat geboten: Der König soll nicht viele Pferde haben und keine große Pracht um sich, auch soll der König das Gesetzbuch täglich in Händen halten. Was aber tun unsere Fürsten? Sie hören die armen Leute nicht, sprechen nicht Recht, sondern verderben die Armen mit immer neuen Beschwerden und Lasten. Sie gebrauchen ihre Macht nicht zur Erhaltung des Friedens, sondern rüsten, damit sie stärker als ihre Nachbarn sind, und verheeren die Lande mit unnötigen Kriegen, rauben, brennen und morden! Das sind ihre fürstlichen Tugenden! Aber ihr sollt nicht denken, dass Gott solches länger leiden wird. So wie er einst die Kanaaniter vertilgt hat, so wird er auch diese Fürsten vertilgen.
Und ebenso wenig wird Gott es leiden, dass sie den falschen Gottesdienst der Pfaffen und Mönche verteidigen. Wir alle wissen doch, welch scheußliche Abgötterei geschieht mit dem Schachern um Pfründe und Ablässe. Wie Christus die Krämer aus dem Tempel stieß, so wird er auch diese Pfaffen und alle, die ihnen anhängen, verderben.
Was hülfe es, frag ich euch, wenn wir Frieden machten mit ihnen, sie würden ja doch nur fortfahren mit ihrem Treiben und uns nicht die Freiheit geben. Wäre es da nicht sogar besser, als Märtyrer zu sterben, als zu dulden, dass uns das Evangelium genommen und von den Pfaffen missbraucht wird? Ich weiß aber gewiss, dass Gott uns helfen wird, denn er hat mir dies zugesagt und mir befohlen, dass ich alle Stände reformieren soll. Es ist nicht das erste Mal, dass Gott den Schwachen und Ungerüsteten beisteht. Denkt an Gideon, an Jonathan oder an David, der nur mit der Schleuder den großen Goliath getötet hat! Oder denkt nur daran, wie sich des Meeres Natur änderte, auf dass den Israeliten geholfen wurde, da ihnen der Pharao nacheilte. Lasst euch nicht schrecken, gebt nicht dem schwachen Fleische nach und greift kühn die Feinde an! Ihr dürft ihre Geschütze nicht fürchten, denn ihr sollt sehen, dass ich alle Büchsensteine, die sie gegen uns schießen, in meinem Ärmel auffangen will!«
Er hatte sich hinreißen lassen und atmete auf, als er sich umblickte und die Wirkung seiner Rede erkannte. Und die Natur selbst schien sich mit ihm zu verbünden. Obwohl es nicht regnete, wölbte sich in der Sonne ein Regenbogen über das reine Blau des Himmels. Mit triumphierendem Blick zeigte er darauf.
»Da seht«, rief er, »Gott ist auf unsrer Seite, denn er gibt uns ein Zeichen! Seht den Regenbogen! Er bedeutet, dass Gott uns, die wir den Regenbogen im Banner führen, helfen will, und er droht den mörderischen Fürsten Gericht und Strafe an. Darum seid unerschrocken und stellt euch zur Wehr. Gott will nicht, dass ihr Frieden mit den gottlosen Fürsten macht!«
Müntzers Getreue jauchzten auf, sanken auf die Knie nieder und stimmten das Lied »Komm heiliger Geist!« an. Und alle übrigen folgten ihrem Beispiel und fielen mit ein.
Sie hatten den Gesang noch nicht beendet, da bebte die Erde vom Donner der feindlichen Geschütze. Die mit den Fürsten ausgehandelte Waffenruhe war zwar noch nicht verstrichen, aber das Überraschungsmoment war diesen wichtiger als Absprachen mit dem niederen Volk. Kanonengeschosse pflügten durch die Reihen der Bauern, zerfetzte Körper und abgerissene Glieder flogen umher, Blut floss in Strömen. Gleichzeitig rückten die Feinde in dicht geschlossenen Reihen gegen die Wagenburg vor. Die zu Tode Erschrockenen standen wehrlos wie die Lämmer an der Schlachtbank, blickten lediglich gen Himmel, ob Gott nicht seine Engel niedersenden würde. Tausende wurden erschossen, erstochen, jämmerlich erschlagen, als die Söldner, ohne Widerstand zu finden, in die Wagenburg einbrachen und wie die Wölfe unter der wehrlosen Herde wüteten. In ihrer Bestürzung wussten die Bauern nicht, ob sie sich wehren oder laufen sollten. Schreckensbleich in ihrer Mitte stand Thomas Müntzer und starrte auf das blutige Gemetzel. Er rief zum Kampf auf, aber seine Stimme verhallte im Donner der Geschütze.
So löste sich der ganze Haufen auf in wilder Flucht. Viele stürzten den Berg hinab und eilten nach den nahen Waldhöhen, um sich zu verbergen. Müntzer folgte dem Strom, der sich gegen Frankenhausen dahinwalzte. Die Truppen des Landgrafen waren ihnen dicht auf den Fersen; im Fliehen dauerte der Kampf fort, und die Landsknechte stürzten sich schließlich mit den Bauern zugleich in die Stadt. Hier tobte das Gemetzel noch fürchterlicher durch die Straßen. Die Söldner kannten kein Erbarmen, ihre Schwerter mähten alles nieder, was ihnen in den Weg kam. Sie drangen in die Kirchen und das Kloster ein, wohin die Verfolgten flohen, und schreckten auch nicht davor zurück, vor den Altären zu morden. Überall lagen Erschlagene wie Schlachtvieh und der durch die Stadt fließende Bach färbte sich purpurn von ihrem Blut.
Auch Berthold und Paulus waren bei dem plötzlich einsetzenden Geschützdonner wie gelähmt. Erst als sich die Schreie der Sterbenden und Verwundeten in den Donner mischten und Paulus von einem Splitter an der linken Hüfte getroffen wurde, erwachten sie aus der Erstarrung. Paulus fasste an die verwundete Stelle, spürte den Schmerz, die warme Nässe und brüllte wie ein wütender Stier. Er sah, wie die ersten Landsknechte den äußeren Ring der Wagenburg durchbrachen, und riss den Dolch aus dem Gürtel. Bertholds Blicke hingegen hatten Thomas Müntzer gesucht und hingen an jeder seiner Bewegungen. Als er sah, dass der Prediger keineswegs die Kugeln mit dem Ärmel auffing, sondern sich vom Strom der Fliehenden mitreißen ließ, wandte er sich dem mit gefletschten Zähnen auf den Feind wartenden Paulus zu und packte ihn an der Schulter.
»Los! Wir müssen weg! Das hier ist völlig aussichtslos. Zurück in die Stadt, das ist unsere einzige Rettung!«
Paulus wollte ihn wegstoßen. Dann sah auch er den gen Frankenberg laufenden Müntzer inmitten seiner Getreuen.
»Ich kann nicht mehr!«, stöhnte er, als habe ihm dieser Anblick die Kraft geraubt. »Mich hat’s erwischt.«
Berthold sah nun erst die Wunde an der linken Seite des Freundes, fasste ihn unter und zog ihn in Richtung der Stadt. Ein Mann fiel ihnen direkt vor die Füße, krümmte sich zusammen, ein Schwall Blut ergoss sich aus seinem Mund, als sie über ihn stolperten. Kugeln pfiffen ihnen um die Ohren. Pistolen krachten. Pulverdampf, Staub und der Gestank nach Blut und Exkrementen verdickten die Luft. Das Geschrei und der Waffenlärm betäubten die Sinne.
»Lauf allein!«, brüllte Paulus in Bertholds Ohr, doch der schleppte ihn weiter, als hätte er gar nichts gehört.
Ein reiterloses Pferd jagte in wilder Panik auf sie zu, Berthold warf sich zur Seite, riss den Freund mit um. Ein Mann hinter ihnen kreischte auf, als er unter die Hufe geriet. Berthold rappelte sich auf, zerrte an Paulus. Der blieb liegen. Jede Farbe war aus seinem Gesicht gewichen, der Mund war weit geöffnet, ein einziger Schrei, aber Berthold hörte nichts. Seine Ohren verweigerten die Arbeit. Er starrte entsetzt auf die Stelle, an der sich Paulus’ rechter Unterschenkel befunden hatte, wo jetzt nur mehr ein blutiger Stumpf zu sehen war. Ein Wunder, dass der Schock ihn nicht hatte ohnmächtig werden lassen. Noch einmal versuchte Berthold, ihn hochzuzerren. Der Drucker schüttelte den Kopf, stieß ihn zurück, schwach nur, aber er verweigerte jegliche Mithilfe. Stattdessen fasste er sich mit seiner verstümmelten linken Hand unter das Wams, zog das silberne Kreuz hervor und schickte sich an, mit dem Dolch in der Rechten den Riemen zu durchschneiden, an dem es hing. Im nächsten Augenblick spürte Berthold etwas in seinem Rücken, und Paulus stieß mit letzter Kraft den Dolch in seine Richtung. Er traf den Landsknecht, der hinter Berthold aufgetaucht war, in den Unterarm. Der gewaltige Schwertstreich, den der Söldner gegen Berthold führen wollte, rutschte ab und fuhr Paulus in den Schädel. Der Schmerz und die Wucht des eigenen fehlgeleiteten Schlages ließen den Mann zusammen mit Berthold über dem gefällten Paulus zu Boden gehen. Berthold wurde es schwarz vor Augen, er fühlte Panik, eine unglaubliche Enge in der Brust. Das musste das Ende sein. Er wusste nicht, wie lange er unfähig war, sich zu regen. Als er wieder etwas fühlte, konnten jedoch nur Augenblicke vergangen sein. Paulus lag unter ihm, der Landsknecht immer noch auf ihm. Beide rührten sich nicht mehr. Mühsam gelang es ihm, sich unter dem Landsknecht hervorzuarbeiten. Der Mann war tot. Paulus’ Dolch steckte in seinem Hals.
Berthold nahm das Silberkreuz an sich, das er seinem Freund geschenkt hatte. Im Sterben hatte dieser ihm erneut das Leben gerettet. Immer noch am Boden kauernd, sah Berthold sich um. Das Gemetzel hatte sich Richtung Stadt verlagert.
Nur wenige Landsknechte trieben sich noch in der Wagenburg herum, um zu plündern. Es hatte sich herumgesprochen, dass es sinnlos war, die Leichen der getöteten Bauern zu fleddern. Berthold kroch auf allen vieren in den Schutz eines Gesträuchs und beobachtete, wie die Fliehenden und die sie verfolgenden Rotten fast gleichzeitig durch die Tore stürzten.
Erst im Schutze der Dunkelheit wagte er es, sich der Stadt zu nähern. Immer noch zogen Plünderer durch die Gassen. Berthold wich ihnen aus und drückte sich im Schatten der Häuser herum, auf der Suche nach etwas Essbarem. Vor allem aber plagte ihn schrecklicher Durst. Aus dem Bach, in dem sich die Leichen türmten, wagte er nicht zu trinken. Der Brunnen auf dem Marktplatz war von einem Trupp Landsknechte umlagert und streng bewacht. In sicherer Entfernung, im Schutze einer dunklen Hofeinfahrt, sprach er ein Mädchen an, das mit einem Eimer Wasser geholt hatte, und bat sie, ihm einen Trunk zu überlassen. Sie hatte eine Schöpfkelle an ihrem Eimer, mit der sie selbst schon direkt am Brunnen getrunken hatte. Bereitwillig ließ sie Berthold daraus trinken.
»Du bist einer von ihnen, das seh ich dir an«, sagte sie. »Ich habe euch den Sieg so gewünscht. Aber jetzt ist alles nur noch schrecklicher, und ihn werden sie bestimmt auch noch töten.«
»Wen meinst du?«
»Na, den Müntzer! Die Mutter meint, sie werden ihn foltern, damit er seine Schuld eingesteht und alles widerruft, was er über die Fürsten und Pfaffen gesagt hat.«
»Sie haben ihn also gefangen?«, fragte Berthold.
»Ja, und ich habe es sogar mit ansehen müssen.«
»Du?«, fragte Berthold ungläubig.
»Ja, er hatte sich im Haus meiner Base Martha in der Nähe vom Anger-Tor versteckt. Er war unter den anderen Flüchtigen, die in die Stadt strömten. Marthas Mutter hat ihn sofort erkannt, beiseitegezogen und in die Kammer unters Dach gebracht. Dort hat sie ihm den Kopf verbunden und befohlen, dass er sich ins Bett ihres zu den Landsknechten davongelaufenen Knechts legen solle, und wenn einer käme, sollte er sagen, er sei einer vom Gesinde und läge schon seit Wochen krank darnieder.«
Sie verstummte, als sich ein Trupp Bewaffneter der Einfahrt näherte. Berthold hielt den Atem an. Die Landsknechte zogen vorüber, ohne sie zu bemerken.
»Was geschah dann?«, fragte Berthold.
»Es schien zu gelingen. Die ersten Plünderer sind einfach weitergezogen und haben ihn in Frieden gelassen. Aber nachdem die Fürsten Müntzer nicht unter den Toten gefunden hatten, haben sie einen Preis auf seinen Kopf ausgesetzt. Zu seinem Unglück kam der davongelaufene Knecht zurück und entdeckte ihn auf dem Dachboden in seinem Bett. Als er ihn barsch fragte, was er da verloren habe, antwortete Müntzer, er sei nur ein armer, kranker Mann, dem die Hausfrau gnädiglich Zuflucht gewährt habe, weil sein Bett doch freigeworden sei, und da liege er nun schon seit Wochen krank darnieder.
Der Knecht war misstrauisch, hätte sich aber vielleicht sogar damit beschieden, doch er hatte noch einen Kumpanen dabei, der Müntzers Tasche durchwühlte. Und da fand er Briefe vom Grafen von Mansfeld an Müntzer. Damit war er verraten. Sie rissen ihm die Verbände vom Kopf. Ich war gerade bei meiner Base, als die Schergen kamen und ihn abführten. Der Knecht und sein Kumpan standen auch dabei. Der Fürstendiener hat ihnen einen Beutel mit hundert Gulden für ihren Verrat gegeben.«
Berthold seufzte. Er bedankte sich für das Wasser, als sich erneut Schritte der Hofeinfahrt näherten. Er drückte sich tiefer in den Schatten und zog auch das Mädchen herein. Es waren zwei Männer. Sie schienen verletzt zu sein, schwankten und stützten sich gegenseitig. Der eine hatte ein blasses, rundes Mondgesicht. Berthold erkannte Bartel, den Schreiberling aus Augsburg. Er wollte sich zu erkennen geben, als das Mädchen ihn zurückhielt und warnend den Finger an die Lippen legte.
Die Männer schwankten vorüber. Die beiden waren nicht verwundet, sie waren betrunken.
»Kennst du die Kerle?« Berthold blickte das Mädchen fragend an.
Sie nickte wild. »Das ist ja der fortgelaufene Knecht, und der andere, das ist sein Kumpan, der zusammen mit ihm den Müntzer verraten hat!«
TEIL I
Augsburg Anno 1529
Confusio
Angst und Misstrauen lagen über der Stadt wie eine Dunsthaube, unter der die Menschen in ständiger Beklemmung lebten. Was sollte man glauben, wem durfte man trauen, konnte man überhaupt noch planen, womit musste man rechnen? Alles war ungewiss, nebulös.
Schon für das letzte Pfingstfest hatten die Wiedertäufer den Weltuntergang prophezeit. Die Feiertage waren ereignislos verstrichen, aber dann war der Sturm gekommen. Auf Peter und Paul war ein Unwetter über die Stadt hereingebrochen wie seit Menschengedenken nicht mehr. Feuer war vom Himmel gefallen, begleitet von ungeheurem Dröhnen und Krachen und einem Hagel, der mit Brocken dick wie Kanonenkugeln gewaltigen Schaden im Umkreis von vielen Meilen angerichtet hatte.
Der Weltuntergang war trotzdem nur für viele unter den Täufern gekommen. Man hatte sie gejagt und verurteilt und eine ganze Reihe von ihnen hingerichtet. Dennoch ließ sich die Unruhe nicht vertreiben. Der Bauernkrieg war noch in böser Erinnerung. Die Glaubensspaltung ging wie ein tiefer Riss durch die Stadt. Dass man ein paar Täufer mundtot machte, änderte daran nichts. Die Reichen in der Oberstadt waren mittlerweile in der Mehrzahl Lutheraner, doch diejenigen, die das Sagen hatten, waren immer noch Katholiken. Und in der Unterstadt und unter den Grüblern und Zweiflern, die sich Gedanken machten, wie alles zusammenhing, ob der Lauf der Welt und die Verteilung der irdischen Güter tatsächlich so von Gott gewollt sein konnten, gab es mittlerweile auch viele Zwinglianer, welchen die Ideen der Täufer keineswegs fremd waren. Unter den Katholiken wiederum gab es nicht wenige, die, wenn auch nicht direkt mit den Lutheranern liebäugelten, so doch immerhin sehr viel Verständnis für die neue Lehre aufbrachten.
Einer ihrer prominentesten war der Stadtschreiber Conrad Peutinger, der indessen aber auch beharrlich dafür sorgte, dass die freie Reichsstadt Augsburg sich nicht von Papst und Kaiser lossagte. Er war ein Mann der Feder und der Worte und hasste nichts mehr als den Krieg, den er unweigerlich kommen sah, wenn die Glaubensspaltung weiter voranschritt. Dabei durchschaute er sehr wohl, dass die Religion nur vorgeschoben wurde, während es in Wahrheit um Macht und Geld ging. So oder so: Die Verheerungen, die der Bauernkrieg hinterlassen hatte, waren überall noch deutlich sichtbar. Es durfte keinen neuen Krieg geben.
Der von den Täufern verkündete Weltuntergang hatte zwar nicht stattgefunden, war aber nun für das nächste Pfingstfest vorausgesagt. Peutinger war ein kluger Kopf. Er glaubte nicht alles, was die Schwarzseher und Möchtegern-Propheten verkündeten. Dennoch wusste er um die verhängnisvolle Macht solcher Prognosen und die allgemeine Unsicherheit nagte auch an ihm.
Die Welt hatte sich in den Jahren, seit er zum ersten Mal ihr Licht erblickt hatte, rasend schnell verändert. Es hatte Entdeckungen und Erfindungen gegeben, welche die Welt größer und das Leben einfacher machten. Wenn er nur an den Buchdruck dachte: Er hatte vielen Menschen völlig neue Möglichkeiten eröffnet, Horizonte erweitert. Aber die raschen Veränderungen und gewaltigen Dimensionen, die sich plötzlich vor ihnen auftaten, machten auch vielen Menschen Angst. Kaiser Karl konnte sich zwar rühmen, über ein Reich zu herrschen, in dem die Sonne niemals unterging, über das er aber immer mehr die Kontrolle verlor.
Die Neuerungen und die mit ihnen einhergehende Verunsicherung hatten alle Bereiche des Lebens erfasst, insbesondere die Wirtschaft. Die Risiken des Fernhandels ermöglichten geschickten Kaufleuten innerhalb kurzer Zeit einen märchenhaften Aufstieg, konnten sie aber auch noch schneller wieder ins Unglück stürzen. Peutinger hatte es im Fall der Höchstetter hautnah miterlebt. Von der kleinen Schneiderfamilie schafften sie es binnen zweier Generationen zum einflussreichen Handelshaus, wurden Kreditgeber für Fürsten und Kaiser und schließlich sogar in den Adelsstand erhoben. Ein schwindelerregender Aufstieg, bei dem es eines kühlen Kopfes, eisernen Willens und starker Nerven bedurfte, wie sie nur wenige Menschen besaßen. Jakob Fugger war so ein Mensch gewesen. Ambrosius Höchstetter war es nicht.
Conrad Peutinger hatte das Unglück lange kommen sehen, nun stand es vor der Tür und drohte jene hinwegzuraffen, denen er sich seit Kindesbeinen verbunden fühlte. Ein Jahr alt war er gewesen, als sein Vater gestorben und der alte Ulrich Höchstetter zu seinem Vormund bestellt worden war. Ambrosius war nur zwei Jahre älter als er. Sie waren zusammen aufgewachsen.
Mittlerweile war Peutinger Mitte sechzig und seit mehr als dreißig Jahren Stadtschreiber. Er hatte viel erlebt, viel gesehen, allen Stürmen getrotzt und die Stadt auch in den schwersten Zeiten immer wieder in ruhiges Fahrwasser gebracht. Er war Kaiserlicher Rat des alten Maximilian gewesen und hatte erlebt, wie Jakob Fugger mit seinem Geld dem kaiserlichen Enkel Karl zum Thron verholfen hatte. Seit zwei Jahren war Jakob der Reiche nun schon tot und der neue Mann, der die Geschicke in der Goldenen Schreibstube lenkte, hieß Anton Fugger. Er hatte sich als ebenso knochenharter und, wenn es sein musste, auch gnadenloser Geschäftsmann wie sein Onkel Jakob erwiesen. Conrad Peutinger graute vor dem Besuch bei ihm. Er, der Ältere, musste zu dem Mann, der sein Sohn hätte sein können, wie ein Bittsteller gehen. Dabei wusste er, dass es wohl ohnehin nichts mehr bewirken würde. Trotzdem hätte er es sich nie verziehen, wenn er nicht zumindest einen Versuch gemacht hätte.
Er seufzte und rief den kleinen Althammer zu sich. Ein Junge von höchstens elf oder zwölf kam in die Stube. Er war dünn und blass, was seine vollen fleischigen Lippen in seltsamen Kontrast setzte und ihn fast ein wenig mädchenhaft aussehen ließ.
»Martinus«, sagte Peutinger, »es ist an der Zeit, dass du etwas anderes lernst als nur die Theorie in der Lateinschule. Ich möchte, dass du dich nützlich machst und praktische Erfahrung sammelst.«