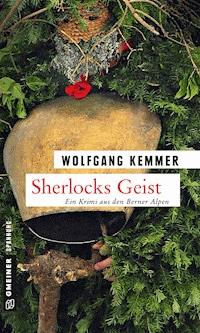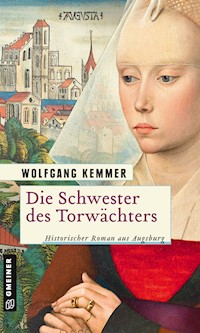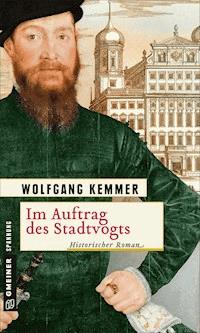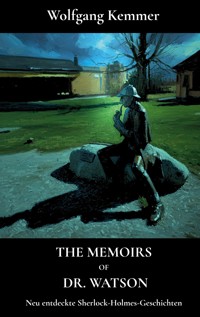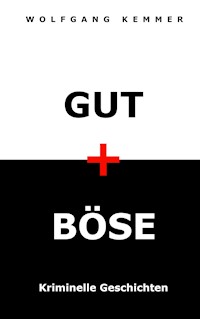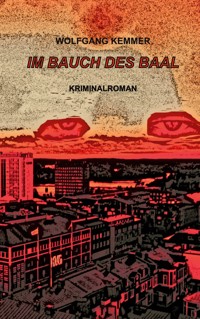
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
1983 In der namenlosen Stadt herrschen Angst und Verrohung: Ein Enthüllungsjournalist wird in einer Spelunke von einem Maskierten erstochen. Auf Kinderspielplätzen treffen sich Schlägertrupps zu tödlichen Auseinandersetzungen. Die Polizei sieht zu. Was steckt hinter der Orgie aus Blut und Gewalt? Wer zieht die Fäden? Zeitungsfürst Balthasar Asmoth oder der kürzlich aufgetauchte Bestattungsunternehmer Höhling? Die engagierte Fernseh-Journalistin Lena und der abgetakelte Bestseller-Autor Jasper geraten in dem mörderischen Spiel zwischen die Fronten. Dystopie, düsterer Großstadt-Thriller, surreale Parabel oder historischer Roman? Auf jeden Fall ein Stück Literatur, das in keine Schublade passt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Kemmer, 1966 in Simmern/Hunsrück geboren, studierte Germanistik, Anglistik und Angloamerikanische Geschichte in Köln und arbeitete anschließend als Lektor in einer Literaturagentur. Heute lebt er als freiberuflicher Autor, Lektor und Dozent mit seiner Familie in Augsburg. Er schreibt Romane und Kurzgeschichten, gibt Anthologien heraus und betreute viele Jahre den Krimi-Podcast von Jokers-Weltbild. 2011 war er nominiert für den Agatha-Christie-Preis, 2016 für den Schwarzwälder und 2019/2020 für den Freiburger Krimipreis.www.wolfgang-kemmer.de
Personen und Handlung der Geschichten sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für Matthias, ohne den dieses Buch nicht erschienen wäre
Der Geist verlangt nach Gewissheit, und sein größtes Verlangen ist vielleicht nach einer Gewissheit, die ihn erschlägt. Was der Geist versteht, was er in mühevoller Kleinarbeit beweisen und bestätigen kann, ist womöglich auch das, was er am meisten verachtet. Er verlangt danach, hinterrücks überfallen zu werden, auf einer dunklen Straße, Gewissheit als Messer an der Kehle.
(Julian Barnes, In die Sonne sehen)
Inhaltsverzeichnis
Prolog: Die Maske des Todes
I. Kapitel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Epilog
Prolog
Die Maske des Todes
Eine fast authentische Geschichte von Jasper Siegers, nach einer Vorlage von E.A. Poe
Lange schon wütete der Tod in der Stadt; nie waren die Morde grässlicher, nie die Verbrecher gewissenloser. Blutig begannen die Tage, blutig endeten sie – überall das Rot und der Schrecken des Blutes. Mit Messerstechereien und Raubüberfällen fing es an, dann floss das Blut in Strömen auf den Straßen, und das war der Beginn des Terrors. Durchgeschnittene Kehlen, in den Staub getretene Gesichter waren die Zeichen der Zeit und markierten die Schneise, die der Tod auf seinem Weg durch die Stadt schlug. Wer in seinen Bannkreis geriet, durfte nicht auf die Hilfe und Teilnahme seiner Mitmenschen rechnen; den eigenen Hals retten, mit heiler Haut davonkommen war alles, was zählte.
Robert Bonifaz aber war frisch, fromm, furchtlos und unerschrocken. Als die Stadt sich anschickte, in einer verzweifelten Karnevalsorgie das selbstzerstörerische Chaos zu feiern, beschloss er, mitten ins Herz des Bösen vorzudringen, um dessen schwarze Seele zu erforschen.
Es war dies eine heruntergekommene Spelunke mit dem exzentrischen Namen PRINZ PROSPERO, hinter deren Mauern sich der Abschaum und Bodensatz der Stadt ein Stelldichein gaben, eine trotzig geschlossene Gesellschaft, in die leicht hineinzukommen war, aber umso schwerer wieder hinaus.
Am Abend der Weiberfastnacht, während draußen in den Straßen der Alkohol und die Angst das irrwitzige Fieber zur Raserei steigerten, versammelte sich eine erlauchte Schar von Halsabschneidern im großen Saal des PRINZ PROSPERO zu einem zügellosen Maskentreiben.
Fenster und Türen waren mit schwarzen Tüchern verhängt, ebenso die Wände. Kein Licht brannte, nur in der Mitte des Raumes, auf einem schweren Dreifuß, loderte in einem kupfernen Becken ein Feuer, dessen Flammen durch die eigens darum aufgestellten blutigroten Scheiben den maskierten Gestalten ein gespenstisches Aussehen verliehen. Im Saal befand sich an der westlichen Wand eine riesenhafte Schwarzwälder Kuckucksuhr. Ihr Pendel schwang mit dumpfem, wuchtigem, eintönigem Schlag hin und her; und wenn der Minutenzeiger seinen Kreislauf über das Zifferblatt beendet hatte und die Stunde schlug, so kam aus der Tür darüber ein monströser Kuckuck hervor, dessen hoher, schriller Schrei selbst die Musik übertönte und die ansonsten wenig schreckhaften Mitglieder dieser ehrenwerten Gesellschaft zusammenfahren ließ.
So eigenwillig wie die Einrichtung des Saales war auch der Geschmack, der den Charakter der Maskerade bestimmte. Gewiss, da gab es verwegen herausgeputzte Freibeuter und Banditen und viel falschen Prunk und Glitter. Aber es gab auch Masken mit seltsam verrenkten Gliedmaßen, die Bettler und Krüppel vorstellen sollten, abgerissen und in schmutzige Lumpen gehüllt. Es gab Gaukler und Wahrsagerinnen, Hexen und Teufel und allerlei groteske Fabelwesen, die man nur mit den Hirngespinsten eines Wahnsinnigen vergleichen konnte. In der Tat, es schien, als wogte eine Unzahl von Alpträumen durcheinander.
Von Zeit zu Zeit aber rief der Kuckuck aus der Riesenuhr die Stunden in den schwarzen Saal, und die Träume erstarrten für einen kurzen Augenblick. Doch der Schrei verhallte – und ein leicht verächtliches Lachen folgte dem Verstummen. Die Musik rauschte weiter, die Alpträume belebten sich erneut und wogten noch zügelloser durch das Strahlenlicht des Flammenbeckens.
Gerade hatte der seltsame Vogel die elfte Stunde herausgekreischt, als Robert Bonifaz, furchtlos und kühn, als rächender Zorro den Plan betrat. Scheinbar unbemerkt hielt er Einzug, doch dem aufmerksamen Ohr schien das Lachen, das dem Verstummen des Kuckucks folgte, noch eine Spur verächtlicher. Redlich bemüht in dem Treiben unterzutauchen, schritt er ziellos durch den Saal, die Augen, verborgen hinter der schwarzen Larve, ohne Rast umherwandernd auf der Suche nach dem Wesen des Bösen, als ihm eine Wahrsagerin den Weg vertrat.
Jung und schön glühte ihr unverhülltes Gesicht im blutroten Schein der Flammen, unbestimmt matt war der Schimmer ihrer Augen, eindringlich und furchtsam die Stimme, mit der sie Verderben verhieß. Voll Eifer entlockte sie dunkle Warnungen der Kristallkugel in ihren Händen und flüsterte sie dem kühnen Eindringling entgegen:
»Freitag enthüllt das Wesen des Bösen. Freitag zeigt dir den Tod.«
Kaum hatte sie dies ausgesprochen, lief ein Raunen und Murmeln durch die versammelte Menge. Eine Maske, die bisher noch von niemandem bemerkt worden war, zog die Aufmerksamkeit auf sich.
Lang und hager war die Erscheinung, von Kopf bis Fuß in Leichentücher gehüllt. Die Maske, die das Gesicht verbarg, war dem Antlitz eines Toten täuschend nachgebildet. Die Augenhöhlen waren blicklos und leer, so leer wie die knochigen Hände, die, weit ausgebreitet, der Gestalt eine Gasse durch die Menge bahnten.
Die Musik setzte aus. Die Wahrsagerin erbleichte. Die Kristallkugel entglitt ihren zitternden Händen. Die Zukunft zersprang zu tausend Scherben.
Gemessenen Schrittes nahte sich die unheimliche Gestalt dem reglos ungläubigen Robert Bonifaz.
»Wer immer du bist«, sagte er furchtlos, »es ist an der Zeit, dir die Maske vom Gesicht zu reißen, denn der Tod hat seine Rolle ausgespielt in dieser Stadt.«
Er griff nach der Maske. Ein Dolch blitzte auf. Und im nächsten Augenblick sank Robert Bonifaz im Todeskampf zu Boden. Sterbend hörte er den Kuckuck schreien. Die Wahrsagerin war verschwunden. Es war Freitag. Brechenden Blickes sah er die Maske des Todes fallen. Dahinter war nichts als Leere.
Am frühen Morgen, als die Glut im Kupferkessel längst verglommen war, wurde Robert Bonifaz' Leichnam abgeholt.
Neben seinen mit weißer Kreide auf den Boden gezeichneten Umrissen lagen noch die mit seinem Blut getränkten Leichentücher und die Totenmaske des Täters. Die große Schwarzwälder Uhr war zur Tatzeit stehen geblieben. Mehr greifbare Hinweise fanden die untersuchenden Kriminalisten nicht.
Das PRINZ PROSPERO wurde bis auf Weiteres geschlossen. Fenster und Türen wurden vernagelt und anschließend von den Behörden versiegelt. Finsternis und der Geruch des Todes breiteten sich aus hinter seinen Mauern. Und während in den Straßen der Karneval ungehemmt weitertobte, krochen sie heimlich durch die Ritzen und legten sich langsam aber sicher über die ganze Stadt.
( erschienen im Beobachter, am 12. Februar 1983 )
I.
Auf einem Häuserblocke sitzt er breit. Die Winde lagern schwarz um seine Stirn. Er schaut voll Wut, wo fern in Einsamkeit Die letzten Häuser in das Land verirrn.
( Georg Heym, Der Gott der Stadt )
1. Kapitel
Im Gegensatz zu den trüb verhangenen, für die Jahreszeit viel zu warmen Fastnachtstagen war der Aschermittwoch klar und kalt wie Glas. Dennoch schwitzten die Totengräber den Restalkohol von dem riesigen Leichenbegängnis aus, das in der Nacht zuvor die ganze Stadt in ein groteskes Heer heulender, zähneknirschender Narren verwandelt hatte. Die Fastnacht war tot, und die Stadt schien es auch.
Kühl wie ein Leichenbeschauer hob die Wintersonne das neblichte, zwischen Fabrikschloten und hohen Wohnburgen gespannte Tuch, legte die erschlafften Arterien bloß, durch die fast eine Woche lang das Leben in fiebrigen Schlägen pulsiert war und enthüllte in ihrem bleichen Licht das nunmehr entmenschlichte Gerippe. Pestbeulen gleich lagen die erkalteten Überreste der Narrenfeuer auf den Kreuzwegen, an denen das Volk in lustvollem Masochismus seine frivole Gottheit verbrannt hatte. Ein aasiger Hauch hing über den übergequollenen Abfallbehältern, zwischen denen zottelige Kanalratten sich in den Haufen synthetischer Fast-Food-Häute um Fleischfasern und zertretene Pommes balgten. Ungerührt ob der beginnenden Verwesung führten derweil die grauen Bahnen dem Herzen der Stadt erneut ihre verbrauchte Fracht zu: blutleere Gespenster mit eingefallenen Gesichtem, behaftet noch vom Geruch schalen Bieres, kalten Rauchs und eingetrockneten Schweißes.
Einzig ein Gewimmel weißer Lieferwagen mit grellroten Führerhäuschen fraß sich madengleich durch den stinkenden Leichnam. Hie und da verharrten sie unerwartet für einen Augenblick, entledigten sich ihres Auswurfs, eines nach frischer Druckerschwärze duftenden Packens, um gleich darauf wieder weiterzuwimmeln. Der Tod war ihr Brot. Tagelang hatten sie sich schon gemästet an dem munter Dahinsiechenden, gespannt die letzten ekstatischen Zuckungen verfolgt, um dann vollends über ihn herzufallen und sein Verscheiden mit ausschweifenden Requien zu feiern. Schreiend bunte Todesanzeigen, vierfarbige Fotos der Leichenzüge und Aufmärsche, die den Frohsinn in einem letzten verzweifelten Aufbäumen hochleben ließen, ehe sie ihn für den Rest des Jahres endgültig zu Grabe trugen. Um elf Uhr elf hatte die Zeit begonnen und um zwölf war sie stehen geblieben.
Der kleine Zeiger der Uhr an der Kapelle des Nordfriedhofs hatte sich hinter seinem großen Bruder versteckt, der steil nach oben gerichtet, wie im Triumph erstarrt war. Die Totengräber hatten es mittlerweile aufgegeben und ihre Hacken und Schaufeln beiseitegestellt. Der Boden war über Nacht zu tief gefroren. Erst als der große Kompressor herangekarrt wurde, griffen sie wieder zu, nahmen die kalten Metallgriffe in die behandschuhten Fäuste, und als das Wummern der Presslufthämmer ihre steifen Glieder durchrüttelte, erwachte auch die Stadt allmählich wieder zu mechanischem Leben.
Jasper Siegers hatte nicht vorgehabt, an der Trauerfeier teilzunehmen. Er hatte den Helden seiner Geschichte nicht gekannt und war nicht so sentimental zu glauben, dass er ihm etwas schuldete. Das Geld, das er bekommen hatte, war zur Hälfte dafür draufgegangen, seine Rechnung zu begleichen und den Mumpitz der letzten Tage mit ein paar Flaschen in seinem Hotelzimmer auszusitzen, den Rest wollte er Lucia geben, um sie versöhnlich zu stimmen für einen neuen Vorstoß, den er hinsichtlich der Scheidung zu unternehmen gedachte.
Als ihn um halb elf das Rumpeln des schweren Staubsaugers weckte, den die Putzfrau an seiner Tür vorbei über den alten Holzfußboden schleifte, wusste er nicht einmal, dass Bonifaz' Leiche schon zur Bestattung freigegeben war.
Seine Glieder waren taub, sein Brustkasten beengt, seine Augen geblendet, weil er vergessen hatte, die Vorhänge zuzuziehen. Und über den Augen, die er schnell wieder schloss, presste sich sein Him penetrant gegen die Innenseite seiner fliehenden Stirn, um der heranschwappenden Flutwelle des Alkohols zu entkommen, die immer noch seine Körpersäfte entzündete. Siegers drehte sich von der Seite auf den Rücken, um seinen linksseitigen Gliedmaßen etwas bessere Durchblutung zu gönnen und das Pumpen seines Herzens nicht länger spüren zu müssen.
Als das Rumpeln hinter einer der Zimmertüren verklungen war, fiel er in einen leichten Schlaf, um nach fünf Minuten hustend wieder zu erwachen. Er rang nach Luft, kämpfte mit einem Schleimbrocken, der sich in seiner Lunge gelöst hatte und spuckte ihn in das Taschentuch, das er aus der vor dem Bett liegenden Hose gezogen hatte. Jasper Siegers Bronchien vertrugen die Rückenlage nicht mehr. Höchstens dann, wenn er sich mit drei oder vier Kissen hochbettete. Doch dann schmerzte morgens seine Wirbelsäule. Er drehte sich auf die rechte Seite und schaffte es, noch einmal für eine Viertelstunde wegzudösen.
Als er erneut erwachte, war sein rechter Arm eingeschlafen. Der Arzt hatte ihm schon vor vier Jahren prophezeit, dass seine Arme und Beine eines Tages überhaupt nicht mehr aus dem Schlaf erwachen würden, wenn er weiterhin drei bis vier Schachteln am Tag rauchte.
Jasper Siegers war seitdem nicht mehr beim Arzt gewesen. Es gab keinen Grund, warum irgendein Teil seines Körpers wach sein sollte. Genauso wenig wie es einen Grund gab, ins Bett zu gehen, mit dem Rauchen aufzuhören, mit dem Saufen, oder mit Lucia zusammenzuleben. Oder sich von ihr scheiden zu lassen. Und der einzige Grund, warum er sich ab und zu noch dazu aufraffte, eine Geschichte zu schreiben oder überhaupt etwas zu tun, war der, dass er zu schlapp und zu feige war, es nicht zu tun.
Er sah ein, dass er nicht mehr einschlafen würde, setzte sich auf, wobei ihm ein scharfer Geschmack nach Galle in der Kehle hochstieg, und zündete sich die erste Zigarette an. Es war hell, so hell wie seit Tagen nicht mehr, und die Rauchkringel umkreisten die in den einfallenden Sonnenstrahlen schwirrenden Staubpartikel.
Das Zimmer war klein und enthielt außer dem Bett nichts als einen dunkel gebeizten, mannshohen Schrank, einen farblich nicht dazu passenden Tisch, auf dem Siegers' alte Reiseschreibmaschine stand, einen wackligen Stuhl und einen sich in seine Einzelteile auflösenden Flickenteppich. In einer Ecke war ein Waschbecken. Die Nachttischlampe befand sich neben dem Bett auf dem Boden. Daneben stand ein leeres Whiskyglas und lagen Jasper Siegers' Kleider: die Hose, die er schon vier Wochen getragen hatte, das Hemd, das es auf zwei Wochen gebracht hatte und die Socken, die er immer noch jeden Tag wechselte.
Er vermisste seine Schuhe, beruhigte sich aber bei dem Gedanken, dass er am Abend offenbar daran gedacht haben musste, sie vor die Zimmertür zu stellen. Das ABENDRUH bot einmal in der Woche einen kostenlosen Schuhputzservice.
Jasper Siegers griff sich die nächste Zigarette, entzündete sie am Stummel der ersten, die er anschließend in das Whiskyglas fallenließ, und beobachtete wie zwischen den Zügen der rotglühende Kopf langsam, unaufhaltsam das weiße Zigarettenpapier verschlang und in Asche verwandelte. Als die Glut seine nikotingelben Finger erreichte, drückte er sie in einer gewaltsamen Bewegung im Glas aus, schlug die Decke zurück und schwang die schweren Beine aus dem Bett.
Er ging zum Schrank, öffnete den Lederkoffer, nahm frische Wäsche heraus und ein Badetuch und griff nach dem schäbigen Kulturbeutel, den er neben dem Koffer abgestellt hatte und der nichts enthielt außer seinem Rasierzeug, seiner Zahnbürste und einem altersschwachen, fast schon zahnlosen Kamm, der für seine schütteren Haare allerdings vollends hinreichte.
Das Bad lag am anderen Ende des Flurs. Jasper Siegers trat barfuß und in Unterhosen aus seinem Zimmer, überzeugte sich, dass seine Schuhe vor der Tür standen und schlüpfte hinein, um sich auf den rohen Dielenbrettern keinen Splitter einzuhandeln.
»Guten Morgen, der Herr«, sagte die abgehärmte Putzfrau aus einem der Zimmer tretend. Sie schleifte den Staubsauger hinter sich her. »Ganz schön kalt heute, auch wenn endlich mal wieder die Sonne lacht.«
»Ja«, sagte Siegers. »Kümmern Sie sich um Ihren Dreck!« Er ging, ohne sie weiter zu beachten, ins Bad.
Nachdem er heiß geduscht, frische Wäsche angezogen und sich mühselig mit der viel zu stumpfen Klinge die angegrauten Bartstoppeln entfernt hatte, war er so erschöpft, dass er sich am liebsten wieder hingelegt hätte.
Da er das alles aber schon einmal auf sich genommen hatte, würde er auch zu Lucia gehen und versuchen, noch einmal mit ihr zu reden, auch wenn es keinen Sinn hatte. Wahrscheinlich war genau das der Punkt, warum er es immer wieder versuchte. Die Sinnlosigkeit. Er wusste nicht einmal mehr, warum er diese Scheidung wollte. Sie waren seit fünfzehn Jahren verheiratet, die letzten drei davon hatten sie getrennt gelebt.
Jasper Siegers ging zurück in sein Zimmer, öffnete den Schrank und nahm ein frisches Hemd aus dem Koffer und den grauen Anzug vom Bügel. Das letzte Mal hatte er ihn vor zwei Monaten angehabt, als er Fiesler gegenübergesessen hatte. Fiesler hatte ihm erklärt, dass sein Manuskript in den letzten zwei Jahren nicht besser geworden sei und ihm vorgeschlagen, es doch einmal bei einem kleineren Verlag zu probieren, bei dem sein Name vielleicht noch Eindruck machen könnte. Es gab keine kleineren Verlage mehr, bei denen er es noch nicht probiert hatte. Und seinen Namen kannte nicht einmal mehr Fieslers Vorzimmerdame. Jasper Siegers konnte sich noch an die Zeiten erinnern, da sie ihm im Vorzimmer des Vorzimmers mit kokett devotem Augenaufschlag ihre Pralinenschachtel hingehalten hatte.
Er ging hinunter in den schmuddeligen Frühstücksraum, in dem die schmuddelige Bedienung dabei war, mit einem schmuddeligen Lappen die schmuddeligen Tische abzuwischen und setzte sich an den Einzeltisch in der Ecke, wo er immer saß, wenn er es rechtzeitig vor zwölf Uhr schaffte.
Auf dem Nebentisch lag ein zurückgelassenes Exemplar des Beobachters. Siegers nahm sich die zerknüllte Zeitung und blätterte ziellos darin herum, während er auf seinen Kaffee wartete. An einem Foto »unseres verblichenen Redakteurs Robert Bonifaz« blieb sein Blick hängen. Es war das gleiche wie in der Freitagsausgabe. Der gleiche Blick, die gleiche furchtlose Naivität, die darin zu lesen war. Nur war es diesmal nicht groß auf der ersten Seite unter einer schreiend roten Schlagzeile, sondern klein und unscheinbar im hinteren Teil unter den vermischten Nachrichten. Siegers las:
»Nachdem die Staatsanwaltschaft die Leiche überraschend schnell zur Bestattung freigegeben hat, findet die Beisetzung mit anschließender Trauerfeier heute um 14.00 Uhr auf dem Nordfriedhof statt.«
Scheppernd stellte die Bedienung das Tablett mit der Tasse und dem Kaffeekännchen vor ihm auf den Tisch. Sie hatte schnell gelernt: nur Kaffee, sonst nichts. Nicht einmal mehr ein »Bitte schön«. Als sie kehrtmachte, um wieder in die Küche zurückzutrotten, verschob sich ihre Kittelschürze im Nacken, und Jasper Siegers sah die Tätowierung auf ihrem Halsansatz. Ein offenes Grab mit einem schief darinstehenden Kreuz, an dem sich eine Schlange hinaufwand. Es fiel ihm nicht ein, wo er so etwas schon einmal gesehen hatte.
Er trank seinen Kaffee und rauchte. Die Bedienung kam wieder mit einem Cognacschwenker. Sie setzte ihn vor ihm ab.
»Heute nicht.« Er musste sich zwingen. Lucia würde es riechen, selbst wenn er sich noch einmal die Zähne putzte. Seine Hand zitterte als er sich die nächste Zigarette anzündete.
Mürrisch schlurfte die Bedienung davon. Siegers sah ihr nach, aber die Schlange blieb diesmal verhüllt. Vor der Küchentür kippte die Frau den Cognac in einem Zug, ohne stehenzubleiben. Er würde darauf achten müssen, dass sie ihn nicht auf seine Rechnung setzte.
Auf der Straße traf ihn die Kälte wie ein Schlag ins Gesicht. Seine frisch rasierten Wangen brannten. Nach ein paar Schritten zitterte er am ganzen Leib. Als er sich am Kiosk eine Fahrkarte kaufte, hatte er Mühe das Klappern seiner Zähne zu beherrschen.
In der U-Bahn-Station lagerten drei Männer in zerlumpten Schlafsäcken zwischen Bergen alter Zeitungen. Ihre Augen waren so leer wie die herumliegenden Wermuthflaschen. Trotz der Kälte roch es durchdringend nach Pisse und Erbrochenem. Jasper Siegers ging vorsichtig um die Männer herum, um sie nicht aus ihrer Apathie aufzuschrecken.
Ein Schuss krachte. Jasper Siegers zuckte zusammen. Die Männer rührten sich nicht. Zwei Jungen mit Schulranzen kamen johlend die Rolltreppe herunter. Der eine hielt eine rauchende Schreckschusspistole in der Hand. Er richtete sie auf Siegers.
»Sie sind ein toter Mann!«
Jasper Siegers starrte ihn an.
Der Junge drückte ab.
Siegers zuckte erneut zusammen.
»Verpisst euch!«
Die Jungen rannten kichernd an ihm vorbei zum anderen Ausgang, versuchten die Rolltreppe gegen die Fahrtrichtung hinaufzulaufen, stolperten, lachten.
»Verpisst euch!«, brüllte Siegers noch einmal.
Einer der Penner begann sich zu rühren. Grinste Siegers herausfordernd an. Stieß seine Kumpels in die Seiten.
Die Bahn lief ein. Siegers ging ein paar schnelle Schritte neben ihr her. Starrte auf eine der Türen. Ein Schwall scharf mit Galle durchsetzten Kaffees kam ihm hoch. Er spuckte ihn aus, bevor er die drei Stufen hinaufstürzte in das überheizte Abteil.
Lucia wohnte im »Paradiesviertel«. Vor fünfzehn Jahren, als sie hier hergezogen waren, hatten die Zeitungen es so genannt, wegen seiner gediegenen Eigenheime und den großzügig angelegten, blühenden Gärten.
Jetzt war es ein Stadtteil wie jeder andere, die Anlagen waren verwildert, die Häuser frühzeitig gealtert und die aufstrebenden Bewohner waren weggezogen auf der Suche nach neuen Paradiesen oder hatten sich resigniert dem schnellen Verfall ihrer Traumhäuser angepasst. Schon damals, als er selbst noch hier gewohnt hatte, hatte Jasper Siegers das Viertel umgetauft in »Verließviertel«.
Er öffnete das kleine Gartentürchen. Im Gegensatz zu den meisten Nachbargärten waren die Beete und der Rasen in tadellosem Zustand. Lucia liebte die Gartenarbeit. Er selbst hatte sie immer verabscheut.
Er trat die halbaufgerauchte Zigarette aus, bückte sich und schleuderte die Kippe in eine Rhododendronhecke, bevor er die Klingel betätigte. Die Anfangstöne von »Üb immer Treu und Redlichkeit« erklangen. Jasper Siegers zog fröstelnd die Schultern hoch.
»Warum trägst du keinen Mantel bei dieser Kälte?« Sie hatte ein frisches Aschenkreuz auf der Stirn.
»Hallo, Lucia. Wie geht's?«
Ihr Blick glitt vorwurfsvoll über seine erbärmlich schlotternde Gestalt.
»Ich habe ihn vergessen.«
Sie glaubte ihm nicht. Das sah er ihr an. Sie wusste, dass er keinen mehr hatte.
»Du weißt, du kannst jederzeit wieder hier einziehen. Es ist auch dein Haus, Jasper.«
Das war es, was er meisten an ihr hasste. Ihr ewiges Verzeihen. Ihre zwanghafte Großmut. Sie konnte für alles Verständnis zeigen und verstand doch nichts.
Er folgte ihr durch den Flur in die Küche.
»Ich habe gerade gegessen. Es ist noch was übrig.«
Der Fischgeruch hing noch in der Luft. Soweit er sich erinnern konnte, hatte es Aschermittwoch immer Fisch gegeben. Fisch und Pellkartoffeln.
»Wie läuft's denn so?«, fragte er und setzte sich auf den Stuhl direkt neben dem Ofen, möglichst weit vom Tisch entfernt.
»Ich habe deine Geschichte in der Zeitung gelesen«, sagte sie. »Es war nicht richtig.«
»Seit wann studierst du die Boulevardpresse?« Jasper Siegers zog spöttisch die Brauen hoch.
»Lena hat sie mir gezeigt.«
Jasper Siegers zuckte die Achseln. »Lena war schon immer eine alte Klatschtante, die gern Zwietracht sät.«
»Sie ist meine Schwester.«
»Erstaunlich genug. Kocht sie immer noch Kaffee für diese Dreckschleuder? «
»Sie arbeitet als Redakteurin, und ich weiß nicht, ob ausgerechnet du das Recht hast, den Sender als Dreckschleuder zu bezeichnen. Im Gegensatz zu den Blättern, in denen du neuerdings veröffentlichst, bemüht sich der FRG um eine seriöse Berichterstattung. Lena versucht mit ihrer Sendung, die gesellschaftlichen Missstände in dieser Stadt aufzudecken.«
»Wie interessant.«
»Ja, und auch dringend nötig. Selbst dir dürfte nicht entgangen sein, welches Klima der Gewalt und Verrohung in dieser Stadt herrscht. Oder kommst du mittlerweile überhaupt nicht mehr aus den Qualmwolken hinter deiner Schreibmaschine heraus? Die ganze Verwahrlosung, überall Dreck. Und die Kälte ...«
Jasper Siegers empfand das als erneuten Seitenhieb wegen seines nicht vorhandenen Mantels. Er hasste ihren selbstgerechten Predigerton.
»Die Menschen laufen wie stumpfsinniges Vieh durch die Straßen, und sie benehmen sich auch so. Nur tragen sie die Messer ständig gewetzt in der Tasche. Vor zwei Wochen ist ein achtjähriger Junge aus der Nachbarschaft in der Schule von älteren Mitschülern vergewaltigt worden. Auf dem Schulhof, während der Aufsicht führende Lehrer nur ein paar Meter danebenstand. Am Sonntag schlug eine Horde Verrückter den Pfarrer von St. Nikolaus krankenhausreif. Auf der Kanzel, während der Messe. Und davon stand nicht mal was in der Zeitung. Dein sauberer Beobachter tut es nicht unter Mord. Und im Übrigen sind ihm die Börsennachrichten und die perversen Bäumchen-wechsel-dich-Spielchen der High Society auch viel wichtiger. Ich weiß nicht, wo das alles noch hinführen soll, wenn es so weitergeht und die Gottlosigkeit und Unmoral weiter so um sich greifen.«
»Doch«, sagte Siegers ungeduldig, um sie endlich dorthin zu bringen, wo sie sowieso früher oder später hinkommen würde. »Du weißt es. Du wusstest es doch schon immer.«
»Ja«, sagte sie und schlug demütig die Augen auf zu dem einfachen, hölzernen Kruzifix über der Küchentür. »Ich weiß es. Denn ich habe Ohren zu hören und Augen zu sehen. Und ich sage dir, es wird nicht mehr lange dauern, dann wird das Zeichen am Himmel erscheinen, genau wie es in der Offenbarung geschrieben steht.«
»Und es wird Feuer vom Himmel fallen und uns alle verzehren. Amen.«
»Lästere nicht, Jasper.« Ihre Stimme war vorwurfsvoll und doch sanft. Früher war sie immer laut geworden, wenn er sich über ihren Kinderglauben lustig gemacht hatte.
»Außer dir, natürlich, Lucia. Denn du hast deine Rüstung ja reingewaschen im Strom des lebendigen Wassers und bist so klar wie Kristall. Du wirst nicht in den feurigen Pfuhl geworfen werden, sei ganz unbesorgt. Du bist eine von denen, die im Lichte wandeln werden.«
»Jasper.« Sie legte ihm die Hand auf die Schulter.
Er schüttelte sie ab. Er wollte sie brüllen hören. Er wollte sehen, wie die Zornesadern auf ihrer Stirn schwollen. Er wollte, dass sie ihn anspuckte, sich ihre Nägel in sein Fleisch bohrten, damit er sie schlagen konnte.
»Sieh nur, wie sanft du bist«, sagte er. »Eine würdige Braut des Lammes, der nichts Unreines mehr anhaften darf. Siehe, ich bin gekommen, dich auch vom letzten Makel zu befreien, denn ich kann es nicht länger ertragen, dass deine reine Seele immer noch an mich gekettet ist, einen sündigen Bock.« Er lachte. »Jawohl, einen alten Sündenbock in der Gefolgschaft des großen Tiers mit den zehn Häuptern und sieben Hörnern. Oder war es nicht umgekehrt? Zehn Hörner, sieben Häupter?«
»Jasper«, sagte sie. »Du weißt, dass eine Scheidung nicht möglich ist.«
»Ja. Was Gott verbunden hat ... ich weiß. Aber du willst es doch auch.«
»Nein. Ich möchte, dass du wieder zurück nach Hause kommst.«
Er schüttelte resigniert den Kopf.
»Jasper. Ich sehe doch, dass es dir nicht gutgeht. Früher hattest du es nicht nötig, dich unter Wert an ein Blatt wie den Beobachter zu verkaufen. Du hast den Mantel versetzt, nicht wahr?«
»Der Mantel ...« Es war einfach unglaublich.
»Ich weiß, dass es nicht mehr so wie früher sein wird. Wir sind älter geworden. Wir haben uns verändert. Alles hat sich geändert. Die ganze Welt um uns herum ist so kalt und schmutzig und leer. Ich weiß noch, wie uns früher das Singen der Vögel, das Gurren der Tauben vor unserem Schlafzimmerfenster geweckt hat. Seit man sie alle vergiftet hat, gibt es überall nur noch Ratten. Selbst unser Garten wimmelt von Ratten. Im Gegensatz zu den Tauben scheinen sie immun zu sein gegen das Gift.«
Er fand es unerträglich, wie selbstverständlich sie immer noch darauf beharrte, »wir« und »uns« zu sagen.
»Die Tauben haben deine geliebte Kirche zugeschissen. Deshalb hat man sie vergiftet.«
Sie schüttelte den Kopf. »Die Taube ist ein Symbol der Kirche. Ein Symbol des Friedens und des Heiligen Geistes. Man hat sie vergiftet, weil in dieser Stadt der Ungeist und die Gewalt Einzug gehalten haben.«
»Scheiße!«, sagte er. »Alles nur Scheiße.«
»Du bist auch so kalt geworden, Jasper. Kein Wunder.«
Er hatte sie noch nie geschlagen, obwohl er schon oft genug kurz davor gewesen war. Wenn sie jetzt noch einmal mit dem Mantel anfangen würde, würde er ihr die Zähne einschlagen.
»Du solltest wieder nach Hause kommen. Hier gibt es immer einen warmen Platz für dich. Es ist nicht gut, allein und verbittert durch diese kalte Welt zu gehen, so wie du es tust, Jasper.«
»Wer sagt dir denn, dass ich alleine bin?«
Sie sah ihn nur an.
»Und du? Bist du etwa nicht allein? Ist es das, weshalb ich unbedingt zurückkommen soll? Damit du nicht alleine sonntags in die Kirche gehen musst? Damit du nicht alleine abends vor dem Fernseher hockst? Damit du nicht alleine gegen die Ratten im Garten zu kämpfen hast? Ist es das, was du willst? Den Vorzeigemann für die Kirche? Den Alibimann vor dem Fernseher? Den Kammerjäger für Haus und Hof?«
»Jasper«, sagte sie. »Du bist allein, weil du dich vor den Menschen zurückgezogen hast. Weil du dich vor ihnen fürchtest. Und vor dir selbst.«
Er lachte. »Na und? Habe ich denn nicht allen Grund, mich vor den Menschen zu fürchten? Mit ihren gewetzten Messern in den Taschen? Du widersprichst dir, meine Liebe.«
»Jasper.«
»Hör auf mit deinem ewigen Jasper! Bisher wollte ich eine einvernehmliche Scheidung. Aber es geht auch anders.«
»Jasper, warum....«
»Du gehst mir auf die Nerven. Ich hasse dich!«
»Nein Jasper, du hasst nicht mich. Du hasst dich selbst.«
»Bitte jetzt nicht auch noch die große Psychologennummer. Das steht dir nicht.«
»Du weißt selbst, dass es so ist.«
»Na schön, wenn du so genau über mich Bescheid weißt, dann weißt du sicher auch, dass ich dich niemals wirklich geliebt habe. Dass ich dich nur geheiratet habe, weil ich scharf auf deinen geilen Arsch war und es keinen anderen Weg gab, ihn ins Bett zu kriegen. Weil du schon immer so eine kleine beschränkte bigotte Eifererin warst und lieber als alte Jungfer gestorben wärst, als dich einem Mann vor der Ehe hinzugeben. Und dass ich es schon von der ersten Nacht an bereut habe, weil du gar nicht in der Lage warst, dich hinzugeben. Weil du deinen Arsch einfach nicht hochbekommen hast vor lauter Verklemmtheit.«
»Jasper«, sagte sie, »du weißt, dass das alles nicht wahr ist. Du weißt, dass du mich damit nicht verletzen kannst. Warum willst du mir wehtun?«
»Hör auf, mir ständig zu sagen, was ich weiß! Ich brauche deine verdammte Bevormundung nicht. Deine ach so christliche Nächstenliebe. Du kotzt mich an mit deiner ewigen Nachsicht, deinem mütterlichen Verständnis. Nichts verstehst du. Nichts weißt du. Du bist eine weltfremde Närrin, die einfach nicht einsehen will, dass ihr Gott ein toter Mann ist, der einen sinnlosen Tod gestorben ist vor zweitausend Jahren. Und alles was von ihm übrig geblieben ist, ist eine Herde von Schafen wie du.«
Sie fing leise an zu weinen.
»Aha, das musste ja jetzt kommen.«
Er kramte umständlich eine Zigarette heraus. Als er sie anzündete und sich suchend nach einem Aschenbecher umblickte, sah sie ihn vorwurfsvoll an.
»Ich wollte sowieso gerade gehen. Werde dich nicht länger mit meiner lästerlichen, stinkenden Anwesenheit belästigen.«
»Jasper, bitte bleib! Es stört mich nicht, wenn du rauchst.«
»Nein, natürlich nicht. Ich vergaß, du hast ja für alles Verständnis.« Er stand auf. »Ich bin sowieso nur vorbeigekommen, weil ich zur Beerdigung von Bonifaz will und deshalb hier in der Nähe war.« Er ging zur Tür.
»Jasper, bitte bleib!«
»Du hörst dann von meinem Anwalt.«
Der Nordfriedhof war mehr als mannshoch eingesäumt von einer alten Bruchsteinmauer, auf der die Stacheldrahtbewehrung so aufgesetzt wirkte wie eine Raketenabschussrampe in einer mittelalterlichen Burg. Das schwere schmiedeeiserne Tor, das abends geschlossen wurde, um die Toten vor Leichenräubern und den Ritualen der Sektierer zu schützen, zeigte Figuren aus Holbeins Totentanz. Der uralte Custos in dem dahinter befindlichen Pförtnerhäuschen sah aus, als hätte er selbst noch für den Sensenmann Modell gestanden.
Als Jasper Siegers an dem vergitterten Fensterchen vorbeiging, verzog sich sein schiefer, zahnloser Mund zu einem wissenden Grinsen, und er lüpfte spöttisch die schwarze Schirmmütze.
Die schuppig belaubten immergrünen Lebensbäume am Rande der Kieswege wucherten ungepflegt. Neben einigen hoch aufragenden Grabsteinen lagen die zerbrochenen Reste gefallener Engel. Siegers schritt zwischen eingefallenen Gräbern hindurch, zwischen frisch aufgehäuften Hügeln mit Bergen von Kränzen und Plastikblumen. Die Friedhofskapelle, in der die Trauerfeier stattfand, lag hinter den Urnenfeldern. Einst war sie als ein kleines, aber eindrucksvolles Werk moderner Architektur von den Fachzeitschriften gelobt worden. Nun blätterte von den graffitibeschmierten Wänden der Putz ab, und an dem von einem berühmten Künstler entworfenen Kreuz fehlte der Querbalken, so dass es wie ein aufgereckter Mittelfinger in den Himmel ragte.
Jasper Siegers trat in die mit schwarzem Marmor ausgelegte Halle. Die Bankreihen waren nur zur Hälfte mit Menschen gefüllt, die in ihren dunklen Wintermänteln zitternd vor Kälte dasaßen und den Worten eines hochaufgeschossenen, schlanken Mannes lauschten, der neben dem schmucklosen Sarg stand.
Während er sprach, kondensierte sein Atem in der Luft, so dass seine Worte wie in einer dunstigen Sprechblase über die Köpfe der Sitzenden dahinzuschweben schienen. Er trug einen weißen Mantel aus teuerem Wollstoff und einen davon abstechenden, grellroten Schal, der sich wie eine blutende Wunde um seinen Hals wand. Jasper Siegers setzte sich fröstelnd in die letzte Bankreihe, von wo er ihn gut im Blick hatte, da die beiden Reihen davor völlig leer waren.
»Ich mag keine Trauerfeiern, weil ich die Verlogenheit der Grabreden verabscheue«, sagte der Mann. Er sprach laut und deutlich, mit tiefer, emotionsloser Stimme, die von den nackten Wänden widerhallte. »Dass ich trotzdem hier bin und sogar das Wort ergriffen habe, hat nichts damit zu tun, dass ich ein Loblied auf meinen ehemaligen Mitarbeiter singen will. Ich kannte ihn, wie ich alle meine Angestellten kenne, und ich kann weder besonders gut noch besonders schlecht über ihn sprechen. Grabreden werden gehalten für die Angehörigen. Man spricht gut über die Toten, um sie in guter Erinnerung zu behalten. Ob man den Angehörigen damit den Abschied erleichtert, mag dahingestellt sein. Ein so plötzlicher gewaltsamer Tod wie in diesem Falle ist immer besonders schwer zu verkraften und zu verstehen.
Da es innerhalb kürzester Zeit nun schon der zweite Todesfall dieser Art ist, der einen meiner Angestellten getroffen hat, sehe ich mich genötigt, ein paar Worte dazu zu sagen, um allen aufkommenden Gerüchten einen Riegel vorzuschieben. Ebenso wie Roland Gottlieb starb auch Bonifaz nicht in Ausübung seines Berufs als Reporter und Redakteur meiner Zeitung. Der Beobachter ist eine seriöse Tageszeitung und betreibt keinen Enthüllungsjournalismus, der seine Mitarbeiter wegen einer reißerischen Story auf ein Himmelfahrtskommando schickt. Wenn Bonifaz und auch Gottlieb sich in Kreisen bewegten, die solche Vermutungen nahelegen, so taten sie dies ohne speziellen Auftrag und aus freien Stücken. Was ihnen dabei zugestoßen ist, kann ich nur bedauern, aber ich lehne jede Verantwortung dafür ab. Wer sich in die Gefahr begibt, muss damit rechnen, auch darin umzukommen.
Stimmen sind lautgeworden, die die literarische Aufarbeitung des Mordes an Bonifaz kritisierten, die am Samstag im Beobachter erschien. Ich kann dazu nur sagen, dass Jasper Siegers eine der namhaftesten Stimmen dieser Stadt ist, und er hat es in meinen Augen meisterhaft verstanden, uns die Atmosphäre der zügellosen, sinnlosen Gewalt, die in dieser Stadt immer mehr um sich greift, vor Augen zu führen.«
Jasper Siegers fühlte den klaren Blick des Mannes prüfend auf sich gerichtet. Einen Moment lang hielt er ihm stand, dann schlug er die Augen nieder.
»Bonifaz ist kaltblütig ermordet worden. Wir wissen nicht warum. Wir können bisher nur zu seinen Gunsten annehmen, dass es eigenmächtige Recherchen waren, die ihn in jene Schlangengrube geführt haben, in der er letztendlich den Tod fand.
Meine Worte mögen Sie bei diesem Anlass vielleicht ein wenig befremden, aber sie mussten gesagt werden, und ich habe unter den hier Anwesenden einige gesehen, die wissen werden, warum.«
Jasper Siegers blickte in die Richtung, in welche die Augen des Redners für einen flüchtigen Moment abgeirrt waren. Zwischen zwei in schlichtes Grau gekleideten Männern entdeckte er Lena. Sie trug einen schwarzen Pelz und eine Trauermiene zur Schau, denen er auf den ersten Blick anzusehen glaubte, dass sie nicht echt waren.
Der Redner endete, indem er den Angehörigen von Bonifaz sein Mitgefühl aussprach und ihnen Unterstützung zusagte, soweit es in seiner Macht stehe. Dann kam er mit festen Schritten auf Jasper Siegers zu, setzte sich mit einem kurzen Nicken neben ihm in die Bank und hörte mit angewidertem Gesicht dem bestellten Trauerredner zu, der mit süßlichen Worten sein Loblied auf den Dahingeschiedenen sang.
Als er fertig war und die Träger sich daran machten, den Sarg in die kalte Winterluft hinauszutragen, blieb der Mann sitzen, so dass auch Jasper Siegers nicht aus der Bankreihe herauskam, wenn er nicht über ihn steigen wollte.
Lena verließ mit den anderen die kleine Kapelle. Als sie an der letzten Bank vorbeikam, würdigte sie ihren Schwager keines Blickes.
»Es wird Zeit, dass wir uns persönlich kennenlernen«, sagte der Mann, als sie alleine zurückgeblieben waren.
»Ja«, sagte Siegers.
»Ich möchte, dass Sie öfter für mich schreiben.«
»Woran haben Sie mich erkannt? Die Zeiten, als man mich erkannt hat, sind lange vorbei.«