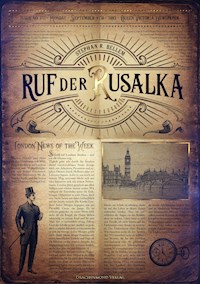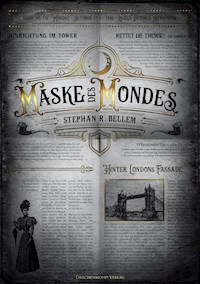6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
»Fliegen wird die Welt verändern!« Auf dem Kontinent Rhilok herrscht seit Jahrhunderten ein brüchiger Frieden zwischen den magischen Völkern – gesichert von der ultimativen Vernichtungsmaschine: Dem Wächter. So kann der junge Gnom, Rhaflit, seinem Erfindertum nachgehen. Nach der Armbrust, Morfius' Gesetz und dem Demeterschen System ist seine dampfbetriebene Flugmaschine das Gespräch unter den gnomischen Ingenieuren. Doch als die Orks plötzlich einen Krieg beginnen, muss er erkennen, dass nicht nur der Verantwortung für seine Heimat übernimmt, der eine Waffe trägt. Mit einem Mal ist Rhaflits Prototyp die letzte Hoffnung auf Hilfe, bevor der Wächter erwacht und alles vernichtet …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Seele des Wächters
Stephan R. Bellem
Copyright © 2018 by
Lektorat: Laura Labas
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Umschlagdesign: Marie Graßhoff
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-891-6
Alle Rechte vorbehalten
Für Nina
Nur du und ich auf dem Pfeiler.
Und für dich, Papa
Irgendwann erzähle ich dir alle Geschichten.
Inhalt
Prolog
1. Weil Schweben nicht Fliegen ist
2. Die Grausamkeit der Menschen
3. Der erste Schlag
4. Nur hiermit
5. Beide Seiten der Medaille
6. Die Lüge eines Lebens
7. Invar
8. Die Bedeutung des Glücks
9. Das erste Blut
10. Der Wächter
11. Der Wille zum Sieg
12. Das Siegel des Königs
13. Die Lektion
14. Trommeln
15. Eine edle Klinge
16. Der Tod mit Flügeln
17. Zeit der Rache
18. Einen König zu töten
19. Durchbruch
20. Unverhoffte Hilfe
21. Der Eiserne Wächter
22. Dreihundertachtundvierzig
23. Der Wächter
Epilog
Glossar
Danksagung
Prolog
Die Axt spaltete den Orkschädel sauber in der Mitte und ließ das grüne Monster in einem roten Sprühregen hintenüberkippen.
Gundarik vergeudete keine Zeit damit, seinem Opfer beim Sterben zuzusehen, sondern wandte sich um und eilte seinem nächststehenden Kameraden zu Hilfe. Dabei versuchte er, die unzähligen Orkleichen auf dem Boden zu ignorieren – und vor allem die drei toten Zwergenkörper, die Hälfte seiner Truppe. Weitermachen. Rache für unsere Brüder. Keinen weiteren Toten mehr zulassen. Das waren die Gedanken, die er sich verzweifelt immer wieder in den Geist rief.
Olfdan war zum ersten Mal im Gebirge und wohl auch zum ersten Mal in einen echten Kampf mit den Bestien des Nordens verwickelt. Der junge Zwerg hielt sich wacker, doch Gundarik erkannte sofort, dass seine Verteidigung Lücken aufwies.
Lücken, die dem erfahreneren Ork ebenfalls nicht entgingen.
Das Monster leckte sich gierig über die scharfkantigen Zähne, die aus seinem aufgerissenen Maul ragten, und schwang sein Schwert wild über den Kopf.
Olfdan fiel auf die Finte herein und machte einen Schritt nach vorn, um dem Ork sein eigenes Schwert in den Bauch zu rammen.
Die Bestie hatte mit diesem Zug gerechnet und drehte sich um Olfdans Schlaghand herum, in die nun völlig ungeschützte rechte Flanke des Zwergs.
Gundarik warf sich mit lautem Gebrüll gegen den Ork und verhinderte so das Schlimmste. Die Klinge verfehlte den jungen Zwerg und kratzte funkensprühend über den Boden. »Such dir einen in deiner Größe!«, keifte Gundarik und präsentierte die blanken Zähne in einem selbstsicheren Grinsen.
»Danke«, keuchte Olfdan und ging neben Gundarik in Stellung. »Wie konnte das passieren?«
Ja, wie konnte das passieren … Gundarik hatte selbst keine Erklärung. Sie waren wie immer auf Patrouille durch die westlichen Gebirgspässe gewesen, als sie plötzlich in einen Hinterhalt der Orks geraten waren. Dabei hatte die seit hundert Jahren niemand mehr so nah an Invar gesehen.
Er wurde jäh aus seinen Gedanken gerissen, als der Ork erneut zum Angriff ansetzte.
Ohne Rücksicht auf Verluste stürmte das Monster auf sie zu, brüllte ihnen all seine Verachtung entgegen und wurde nicht langsamer.
Ein gellender Schrei übertönte den allgemeinen Kampfeslärm und Gundarik ließ die Axt für einen Moment sinken. Ein weiterer Gebirgsläufer war den Orks zum Opfer gefallen.
Er wurde an der linken Schulter getroffen, hart und umfassend. Aus den Augenwinkeln sah er noch, wie Olfdans Schwert dem jungen Zwerg bei der Parade aus der Hand glitt.
Die krude Klinge des Orks drang tief in den Bauch des Gebirgsläufers ein, der gerade das Leben seines nutzlosen und unachtsamen Kommandanten gerettet hatte.
Gundarik schrie auf. Hackte nach dem Arm des Orks, nach seinem Körper, seinem Kopf und Hals.
Immer wieder traf die Axt das Monster, doch die grüne Bestie versuchte nicht einmal sich zu wehren. Stattdessen stach der Ork immer wieder auf Olfdan ein, als wolle er sichergehen, dass er den Zwerg mit sich in den Tod riss.
Schließlich sackten Ork und Zwerg zusammen und Gundarik ließ den vom Blut glitschigen Griff seiner Axt los und sank neben dem sterbenden Zwerg auf die Knie.
»Wie war ich?«, fragte Olfdan und blickte Gundarik dabei mit weit aufgerissenen Augen an.
»Du hast dich tapfer geschlagen.«
»Bin ich einer von euch?«
Gundarik blinzelte eine Träne weg und nickte heftig. »Du bist ein Gebirgsläufer durch und durch.«
Er wusste nicht, ob Olfdan ihn noch verstanden hatte. Der Brustkorb des jungen Zwergs regte sich nicht mehr.
Ein Schatten legte sich über Gundariks Gesicht, doch er weigerte sich, den toten Körper loszulassen.
Selbst dann nicht, als ein heißer Schmerz ihm in den Rücken fuhr.
1
Weil Schweben nicht Fliegen ist
Duibel zerknüllte das Papier und warf es in einen kleinen Eimer. Oder versuchte es, denn auch wenn sein Wurf ganz vortrefflich war – für einen Gnom sogar schon fast rekordverdächtig –, prallte die Papierkugel an dem kleinen Haufen anderer zerknüllter Papiere ab, die bereits über den Rand des Eimers quollen.
»Das ist alles Mist«, fluchte der Gnom leise vor sich hin und stieß sich mitsamt seinem Stuhl vom Tisch ab. »Eine Erfindung. Ich brauche eine Idee!« Während er in seiner Werkstatt auf und ab schritt, lauschte er dem Lärm der Stadt, der immer leise im Hintergrund zu hören war.
Die Schmiede Invars waren in ihr Tagwerk vertieft und ihre Hammerschläge erzeugten einen gleichförmigen Takt, der Duibel immer beruhigte. Der Gnom ließ seine Gedanken kurz zu den Schmiedeöfen und Essen wandern, Gussformen, die nach gnomischen Bauplänen erstellt worden waren und die die Zwerge nun zur Fertigung ihrer Werkzeuge und Waffen nutzten.
Wie viele von ihnen gerade eine Armbrust nach deinem Vorbild bauen?, fragte er sich, als sein Blick über die Kohlezeichnung seines Vaters an der Wand schweifte. Mirzons Sohn wird seinen Vater noch übertreffen … Duibel wusste nur zu gut, was von ihm erwartet wurde. Der Satz seines Vaters, dass in seinem Sohn »vier Fuß Genialität schlummern«, half ihm nicht gerade dabei, gelassen an die Sache ranzugehen.
Und der junge Ingenieur wünschte sich nichts sehnlicher, als dass eine seiner Erfindungen einmal in aller Munde wäre, so wie Rhaflits Flugversuche.
»Verdammt!«, rief Duibel laut aus und schlug sich mit der flachen Hand auf die Stirn. »Rhaflits Flugversuch!«
Sofort ließ er alles stehen und liegen und eilte aus seiner Werkstatt.
Im Gegensatz zu Invar war der gnomische Bezirk, Ventril, alles andere als ausgeschlafen. Duibel war einer der wenigen Frühaufsteher, denn die meisten Ingenieure bevorzugten die nächtliche Ruhe, wenn der letzte Hammer geschwungen war, um an ihren Erfindungen zu arbeiten. Ihn selbst störte der Lärm nicht – im Gegenteil. Durch den Rhythmus der Hammerschläge verfiel Duibels Hirn in eine Art Denk-Takt, der es ihm ermöglichte, seine Gedanken geordnet zu verfolgen.
Vielleicht könnte ich ein Gerät erfinden, das den Zwergen die Hammerschläge vorgibt?, dachte er, während er die Straßen entlangrannte. Hammerzähler oder so.
Aber wofür wäre ein solches Gerät schon nützlich im Vergleich zu Mirzons Armbrust?
Er verwarf den Gedanken vorerst und konzentrierte sich auf seinen Weg zu dem Plateau, von dem aus Rhaflit heute starten wollte.
Ventrils Stadttor war weit geöffnet und die beiden Gnome, die gerade ihren Dienst zur Sicherung des Türmechanismus verrichteten, grüßten ihn aufgeregt.
»Hat Meister Rhaflit schon begonnen?«, fragte ein junger Gnom, kaum älter als zwanzig Jahre, aber mit knapp vier Fuß schon genauso groß wie Duibel.
Der ältere Ingenieur hielt nicht an, sondern grüßte die beiden Lehrlinge nur mit einem strengen Blick. Er hatte keine Zeit, sich mit ihren neugierigen Fragen zu beschäftigen, auch wenn er ohnehin zu spät käme.
Sollte er den heutigen Flugversuch seines Freundes verpassen, und sollte es Rhaflit diesmal tatsächlich gelingen, wäre Duibel untröstlich, diesen Triumph nicht miterleben zu können.
Und sollte Rhaflit stattdessen wieder – wie all die Male zuvor – scheitern …
Daran wollte Duibel erst recht nicht denken, während er durch Invars Straßen rannte.
Zwerge transportierten hier alle möglichen Waren und Gegenstände hin und her. Eisen, Kohle und Holz für die Schmieden, Leder und gefertigter Stahl für die Rüstungsbauer. Bierfässer wurden entlanggerollt, aber es duftete auch nach frisch gebackenem Brot und gerade kamen ihm zwei der Gärtner entgegen, die schon vor Sonnenaufgang in den Gärten südlich von Invar unterwegs gewesen waren, um dort nach dem Rechten zu sehen.
Sie alle überragten den Gnom um gut einen Kopf, dennoch blickte keiner der Zwerge auf ihn herab. Man grüßte sich freundlich und tauschte noch rasch kleine Nettigkeiten aus, auch wenn er jedes Mal in ihren Blicken lesen konnte, dass sie auf Neuigkeiten von Rhaflits Flugversuch brannten.
Duibel hoffte, dass es im Lauf des Tages eine weitere Geschichte über ein gnomisches Meisterstück der Erfindungskunst zu erzählen gäbe.
Er atmete erleichtert auf, als er das Plateau erreichte und sah, dass Rhaflit noch nicht begonnen hatte.
»Hilf mir, ihn davon abzubringen«, begrüßte Kerellic den gnomischen Ingenieur. Der Zwergenschmied war einer von Rhaflits engsten Freunden und hatte bisher jeden Plan des Gnoms unterstützt. Mit seinem aktuellen Vorhaben war er jedoch absolut nicht einverstanden.
Rhaflit schenkte ihnen keinerlei Beachtung. Der frühmorgendliche Wind schnitt ihm ins Gesicht und der Gnom schirmte seine Augen gegen die aufgehende Sonne ab, als er das östliche Tal überblickte.
Hier oben fühlte sein Freund sich am wohlsten, wusste Duibel. Wenn die Sonne sich über dem Horizont erhob, die Bergkämme wie in Bronze gegossen erscheinen ließ und der kalte Nachtwind langsam den milderen Temperaturen des Tages wich.
Rhaflits Blick streifte in der Ferne die Umrisse eines Adlerhorstes und der Ingenieur schmunzelte. Er drehte sich zu seinen Begleitern um und bedachte sie mit einem bedeutungsvollen Nicken seines rundlichen Kopfes, wodurch ihm eine schwarze Haarsträhne über das rechte Auge fiel, die er sich mit einer fahrigen Handbewegung wieder aus dem Gesicht strich. »Ich denke, heute wird es gehen«, sagte er voller Vorfreude.
Eine Freude, die Duibel ganz und gar nicht teilte. Von allen gnomischen Ingenieuren – die alle einen leichten Hang zum Größenwahn hatten – war Rhaflit der »monumentalste Visionär«, wie er sich selbst gern bezeichnete. Duibel warf einen besorgten Blick zur Seite und zweifelte einmal mehr am Vorhaben seines Freundes.
»Du weißt, wir sind nicht dafür gemacht«, formulierte er vorsichtig seine Bedenken, die sein Freund wie jedes Mal nur mit einer gelangweilten Handbewegung beiseitewischte.
»Das ist alles nur eine Frage der Berechnung«, sagte Rhaflit schließlich mit einem Grinsen.
Duibel zuckte bei diesem Satz unwillkürlich zusammen, denn er konnte sich nur viel zu gut an Rhaflits letzte Versuche auf dem Berggipfel erinnern. Der Traum vom Fliegen beschäftigte den Ingenieur nun schon seit knapp siebzehn Jahren. Selten zuvor hatte ein Gnom so lange an einer Erfindung gebastelt und noch seltener war ein Gnom so häufig und spektakulär gescheitert wie Rhaflit. Aufgeben gehörte zu keinem seiner vielen Charakterzügen und so hatte er unermüdlich weitere Berechnungen aufgestellt und war ein ums andere Mal hier oben gestanden und hatte versucht, sich diesen Traum zu erfüllen.
Ein wütendes Schnauben ließ Duibel erschrocken aufblicken.
»Ich frage dich noch einmal«, forderte Kerellic entnervt, als er sich zu ihnen gesellte. Er hatte zuvor noch mit den drei Gebirgsläufern gesprochen, die bereitstanden, um Rhaflit zu bergen, falls er abstürzte.
Duibel wagte kaum daran zu denken, aber die Vergangenheit hatte zu oft und zu deutlich gezeigt, dass diese Absicherung mehr als nötig war.
»Wird es diesmal funktionieren?« Der Schmied war immer an Rhaflits Erfindungen beteiligt, da er das Metall nach den Vorgaben des gnomischen Ingenieurs formte. Duibel dachte kurz darüber nach, ob dies schon immer so gewesen war, und kam zu dem Schluss, dass sich das Leben in Invar – der großen zwergischen Bergfestung – in den letzten Jahrhunderten wohl nicht verändert hatte. Die Gnome Invars machten die Erfindungen und die Zwerge setzten sie um.
Zwerge waren durch ihre Statur für handwerkliche Arbeiten – worunter nach zwergischer Meinung auch das Kriegshandwerk gehörte – besser geeignet als Gnome. Aus diesem Grund blieben die Gnome stets im Hintergrund, erfanden im Stillen neue Kriegsmaschinen oder neue Metalllegierungen und die Zwerge setzten sie zu beiderseitigem Nutzen ein.
Jeder Gnom hoffte, die eine bahnbrechende Idee zu verwirklichen, die ihm zu ewigem Ruhm in den Annalen der Zwerge und Gnome verhelfen würde.
Duibels Vater hatte die größte Erfindung der letzten dreihundert Jahre gemacht: die Armbrust. Diesem unscheinbaren Gerät verdankten die Zwerge noch immer ihre militärische Überlegenheit, da kein anderes Volk es bisher geschafft hatte, sich effektiv gegen sie zu schützen und selbst etwas Besseres zu erfinden. Nicht den bloßen Mechanismus, dieser war leicht zu durchschauen; aber die richtigen Materialien in die Gesamtkomposition zu bringen, das war die Kunst. Die gnomische Armbrust feuerte fast ebenso weit und genau wie ein Bogen, bot dabei aber eine viel höhere Durchschlagskraft. Zudem eignete sich die Armbrust vortrefflich für den Kampf in den beengten Gängen des Minenkomplexes.
Durch diesen Umstand genoss Duibel in der Gesellschaft der Gnome wie auch der Zwerge ein hohes Ansehen. Allerdings lastete auf ihm auch ein enormer Erwartungsdruck, denn jeder rechnete damit, dass er die Erfindung seines Vorfahren noch übertreffen würde.
»Wird es funktionieren, Rhaflit?« fragte Kerellic nun noch lauter und riss Duibel aus seinen Gedanken.
»Ich sagte doch bereits, mein lieber Freund«, versuchte Rhaflit ihn zu beschwichtigen, »es hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab, die ich unmöglich alle kontrollieren kann. Es müsste diesmal funktionieren, ja.«
»Garantiere es«, forderte Kerellic. »Ich habe weder die Zeit noch die Lust, dich und deinen Drachen von der Bergwand abzukratzen. Geschweige denn das ganze Drachenleder zu flicken, das wir für die Flügel benutzt haben.«
»Es müsste funktionieren«, wiederholte Rhaflit mit einem entwaffnenden Lächeln.
»Ich hasse es, wenn du das sagst.« Kerellic stöhnte und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Duibel grinste breit – meist endeten ihrer Unterhaltungen auf diese Art.
»Du hast doch den Ring vom Elfenkönig, mit dem du schweben kannst. Wieso reicht dir das nicht?«, unternahm Kerellic einen letzten Versuch und spielte damit auf das Geschenk von König Pellaréion an.
Der Elfenkönig hatte Rhaflit als Dank für die Erfindung eines neuartigen Schiffes einen Levitationsring geschenkt und damit ungewollt Rhaflits Traum vom Fliegen geboren.
Duibel wusste, was sein Freund nun sagen würde, formte die Worte bereits mit den Lippen und bewegte seine Hand wie ein Puppenspieler, der einen kleinen Holzkopf zum Sprechen brachte. Rhaflit holte tief Luft, ehe er laut in den Wind rief: »Weil Schweben nicht Fliegen ist! Fliegen wird die Welt verändern!«
»Lass es gut sein, Kerellic.« Duibel stellte sich neben den Schmied und blickte ihm aufmunternd ins Gesicht. »Vielleicht schafft er es ja diesmal.«
»Und vielleicht kracht er wieder gegen den Berg«, antwortete Kerellic trocken und erinnerte Duibel damit nur zu deutlich an Rhaflits letzten Versuch, der bereits ein Jahr zurücklag.
Kurz nach dem Start hatte Rhaflit die Kontrolle über seinen Drachen verloren und war gegen die steile Bergwand getrieben worden. Nach seiner Rettung war er mehrere Monate an sein Bett gefesselt gewesen und selbst heute noch ertappte Duibel ihn dabei, dass er mit dem linken Bein leicht hinkte, wenn er zu viel gelaufen war. Aber der Gnom beschwerte sich nicht. Er hatte sich so viele Knochen gebrochen und Schnittwunden erlitten, dass man ihn schon fast für einen zwergischen Veteranen halten konnte. Auch seiner Vision hatte es keinen Abbruch getan. Stattdessen hatte er sich sein Krankenlager in seiner Werkstatt eingerichtet und sofort mit neuen Berechnungen begonnen. Für den beharrlichen Gnom war der Unfall nicht mehr als ein »kleiner« Rückschlag gewesen.
»Dann halte dich besser bereit«, warnte Duibel und seine Worte ließen den um einen Kopf größeren Zwerg zusammenzucken.
Kerellic seufzte. »Ich wünschte, er hätte einen anderen Traum.«
»Ich wünschte, er würde wenigstens diesen hier aufgeben«, erwiderte Duibel.
»Nein! Aufgeben ist eine Schwäche der Menschen oder anderer niederer Völker. Ihr Gnome seid fast schon Zwerge«, fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu, »also benehmt euch auch wie wir.«
Duibel verstand, worauf Kerellic anspielte. Zwerge waren sehr stoische Zeitgenossen, deren Stolz sich darin begründete, über alle Maßen tapfer und entschlossen – manchmal sogar starrsinnig – zu sein. Und diese Eigenschaften bei einem Gnom zu sehen, erfüllte Kerellic mit Freude, sagte man den Gnomen bisweilen nach, sie seien Feiglinge – oder schlimmer noch: Pazifisten.
Rhaflit schenkte dem Treiben um ihn herum nicht die geringste Beachtung. Er zog den letzten Gurt fest, der das Drachengestell mit seinem Rücken verband, und prüfte ein weiteres Mal die Windrichtung, indem er den Zeigefinger in den Mund steckte und danach in die Luft hielt.
Er nickte entschlossen, um sich selbst noch ein wenig Mut zu machen, dann spurtete er los. Seine kurzen Beine machten kleine, schnelle Schritte und die Tragkraft der Flügel ließ ihn bereits winzige Hopser auf dem Stück bis zur Felskante machen.
Rhaflit konzentrierte sich einzig auf diesen Punkt. Er wollte so viel Anlauf wie möglich nehmen, um dann kräftig von der Kante abzuspringen.
Noch fünf Schritte, dann hätte er sie erreicht. Noch drei, noch zwei: Er drückte sich mit aller Kraft vom Boden ab und sprang in die große Leere des Abgrunds.
Er spürte den Wind, der ihn sofort ergriff und an den sorgfältig gearbeiteten Flügeln aus Drachenleder riss. Rhaflit spürte den Aufwind, fühlte, wie er nicht zu Boden – und dem unweigerlichen Tod – gezogen, sondern hinaufgetragen wurde.
Erst jetzt bemerkte er, dass er beim Absprung vor Angst die Augen geschlossen hatte, und öffnete sie vorsichtig. Der Gegenwind schnitt ihm heftig ins Gesicht und Tränen strömten über seine Wangen. Der gnomische Ingenieur kniff die Augen wieder zusammen, um sie vor dem Wind zu schützen, doch er weinte auch vor bloßer Freude.
Er flog! Wahrhaftig, er flog!
Rhaflit blickte hinunter und betrachtete seine vertraute Heimat aus einem neuen Blickwinkel. Er sah die Schornsteine der Schmieden Invars, die aus dem Berg ragten und ohne Unterbrechung dichten schwarzen Rauch ausstießen. Sein Blick schweifte über Kerellic und Duibel, die an seinem Startpunkt auf ihn warteten und ihm freudig zujubelten. Ein Windstoß trug ihn weiter hinauf und über Invars massive Eisentore, die, einmal geschlossen, von keinem Angreifer überwunden werden konnten. Er legte sich in eine sanfte Kurve und überflog die Felder, auf denen die Zwerge unter anderem den Weizen für ihr Bier anbauten, und die Bewässerungsanlagen, welche die Gnome dafür entwickelt hatten.
Rhaflit war so fasziniert von dem Anblick, der sich ihm bot, dass er völlig vergaß, sich zu seinen korrekten Berechnungen zu gratulieren.
Eine kleine Böe trug ihn noch höher und er fühlte sich einen kurzen Moment wie einer jener majestätischen Adler. Frei und uneingeschränkt könnte er sich über Rhilok bewegen, mal fliegend, mal laufend.
Doch ein Vogel war ihm noch immer einen Schritt voraus, bemerkte er plötzlich. Vögel konnten mit den Flügeln schlagen und an Höhe gewinnen – er musste auf dem Wind gleiten.
Auf jener Windströmung, die gerade abbrach!
Rhaflit merkte noch, wie der Drachen ins Trudeln kam, als der Aufwind ihn im Stich ließ. Von einem Moment auf den anderen verlor er gut fünfzehn Meter an Höhe. Kerellic und Duibel waren plötzlich erschreckend nah und dennoch würde es schwer werden, das Plateau zu erreichen. Der gnomische Ingenieur wusste allerdings auch, dass es sein sicherer Tod wäre, wenn er es nicht schaffte .
»Verdammt!«, fluchte Duibel, als sie erkannten, dass Rhaflit kurz vor einem Absturz stand.
»Jungs, macht euch bereit!«, rief Kerellic den drei Gebirgsläufern zu, die er für einen Moment wie diesen mitgenommen hatte.
Sie waren die besten Bergsteiger der Zwerge. Die meisten Zwerge gruben lediglich ihre Stollen in die Erde, die Gebirgsläufer stellten allerdings sicher, dass die Minen von außen keine versteckten Zugänge besaßen.
Gebirgsläufer hatten vor langer Zeit dieses Hochplateau gefunden und so abgesichert, dass man es von unten nicht erklettern konnte. Zusätzlich war die Bergwand mittlerweile nur eine Fassade für einen eisernen Wachturm und ließ sich vom Inneren des Turms in einem gewaltigen Erdrutsch lösen. Das Plateau bot einen unermesslich wichtigen Überblick über die gesamte Ostseite des Gebirges. Aus diesem Grund hatten die Zwerge lange Zeit überlegt, wie man es strategisch nutzen könnte. Schließlich war es dem gnomischen Ingenieur für Verteidigungsanlagen, Gotti Ittog, gelungen, die Idee eines versteckten Wachturms durchzusetzen.
Er hatte die Pläne dafür entworfen. Hinter der nun falschen Bergwand lag ein gewaltiger Wachturm. Wenn die meisten Feinde erst unter Tonnen von Geröll begraben wären, hätten die Verteidiger leichtes Spiel mit ihnen. Zusätzlich konnte man von dort aus mit Steinschleudern den gewundenen Pfad, der zu Invars Haupttor führte, unter Beschuss nehmen.
Gottis Erfindungen waren stets voller Tücke und er war es auch, der die Lehre der doppelten Absicherung aufgebracht hatte. So hatte er, als er ein wenig in die Jahre gekommen war, seinen Familiennamen geändert. »Zur Sicherheit«, wie er sagte, damit er ihn sich leichter merken könne.
Tatsächlich starb Gotti eines Tages an fortschreitender Vergesslichkeit. Beim Öffnen seiner Kammertür hatte er die zweite Falle vergessen, die sie sicherte, und sich selbst mit einem riesigen von der Decke herabschwingenden Hammer erschlagen.
Seitdem waren die einzigen Fallen an den großen Außentoren und den kleineren Durchgangstüren im Innern Invars angebracht und wurden stets von mehreren Zwergen und Gnomen bewacht. Persönliche Fallen waren strikt verboten.
Die Gebirgsläufer waren nun mit Seilen an eine stabile Säule gesichert und bereit, sich die Bergwand hinabzulassen, um Rhaflit zu bergen, sollte er tatsächlich abstürzen.
»Aber eines muss ich ihm lassen«, stellte Duibel nüchtern fest. »Für einen kurzen Moment hat es funktioniert.«
Kerellic blickte ihn zur Antwort missmutig an.
Rhaflit versuchte verzweifelt, den Drachen wieder in eine stabile Fluglage zu bringen, war nun jedoch einem Seitenwind zum Opfer gefallen, der ihn weiter vom Plateau zu entfernen drohte. Rhaflit versuchte mit aller Kraft, die sperrige Konstruktion aus Eisengestänge und Drachenleder aus dem Wind herauszudrehen, um schneller an Höhe zu verlieren. Er würde keine saubere Landung mehr hinlegen können, also wollte er lieber auf das Plateau stürzen, als in eine der vielen Bergschluchten.
Es gelang ihm unter größter Kraftanstrengung, den Absturz des Drachen zu beschleunigen. Im Sturzflug hielt er nun auf das Plateau zu und wurde dabei stetig schneller.
Mit einem Mal zweifelte der Gnom an seiner Idee.
Kurz vor dem Aufschlag riss er den Drachen erneut herum und der linke Flügel bohrte sich durch die Wucht des Aufpralls in den massiven Stein, dann überschlug er sich.
Die Konstruktion kippte zu Rhaflits Glück auf den Rücken und schlitterte so über den Stein. Direkt auf den nächsten Abgrund zu.
Duibel sah mit Entsetzen, dass Rhaflit zwar unverletzt, doch auch unkontrolliert an ihnen vorbeirauschen würde. Die Gedanken des Ingenieurs rasten, denn er war nicht bereit, tatenlos zuzusehen, wie sein bester Freund in den Tod stürzte.
»Jungs, hier rüber!«, rief er den Gebirgsläufern zu. »Schwingt euch quer zu ihm über den Rand und strafft die Seile!«
Kerellic sah ihn fragend an, doch Duibel schenkte ihm keine Beachtung. Er hatte auch schlichtweg nicht die Zeit, dem Zwerg jede Einzelheit zu erklären. Die Gebirgsläufer blickten allerdings ähnlich begriffsstutzig drein und Duibel brüllte so laut er konnte: »Tut es!«
Achselzuckend setzten sich die Zwerge in Bewegung und rannten über das Plateau. Gerade rechtzeitig sprangen sie über den Rand der Klippe, als Rhaflits Drachen quietschend in ihre gespannten Seile rutschte.
Duibel sandte ein kurzes Stoßgebet an den Schöpfer, dass er Rhaflit retten solle.
Kerellics Miene hellte sich auf, als er endlich den Sinn hinter Duibels Idee verstand.
Die Gebirgsläufer wirkten durch ihr Gewicht wie ein Bremsklotz für Rhaflits Drachen, der sich komplett in den über das Plateau gespannten Seilen verfangen hatte. Der Drachenschlitten wurde langsamer, bis er schließlich am Rand des Plateaus zum Stillstand kam.
Duibel stürzte zu seinem Freund und kämpfte sich durch das Gewirr aus verbogenen Eisenstangen und den Seilen der Gebirgsläufer.
»Ich sagte doch, es würde funktionieren!«, begrüßte Rhaflit ihn mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht.
»Ich hasse es, wenn du das sagst!«, brummte Kerellic, der ebenfalls herbeigeeilt war.
Duibel sah kurz von Rhaflit zu Kerellic und der Zwerg konnte sein Grinsen nicht länger verbergen. Schließlich mussten sie alle lachen und ließen so die Anspannung der letzten Momente hinter sich.
Der gnomische Ingenieur seufzte. »Dann wollen wir mal sehen, wie wir dich da wieder herausbekommen.«
»Keine falsche Zurückhaltung«, forderte Rhaflit sie auf. »Der Drachen wird nicht mehr benötigt …«
»Das heißt, du hörst endlich damit auf?«, fragte Kerellic hoffnungsvoll.
»Lass mich aussprechen, du Tölpel eines Schmieds«, erwiderte er mit einem viel zu breiten Grinsen im Gesicht. Rhaflit war der Einzige, ob Gnom oder Zwerg, der auf diese Weise mit Kerellic sprechen durfte, ohne sich eine blutige Nase einzufangen. »Ich brauche den Drachen nicht mehr, weil ich nicht wieder im Wind gleiten werde. Das nächste Mal werde ich wirklich fliegen!«
Kerellic schnaubte und schlug die Hände über dem Kopf zusammen.
»Bringen wir erst mal alles wieder nach Ventril«, schlug Duibel vor und begann, den Bruchpiloten aus den Wrackteilen zu befreien.
Sie luden die Überreste des Drachens auf einen kleinen Karren und schoben ihn an die Treppenkante. Ein von den Gnomen entwickelter Flaschenzug wartete dort bereits darauf, seine Ladung entgegenzunehmen und sicher gen Boden zu befördern. Als man die Wachtürme erbaute, hatte man darauf geachtet, möglichst viel Platz zu lassen. Die Wendeltreppe schmiegte sich an die Wand und im Inneren des Turms standen ungefähr fünf Meter Raum für den Flaschenzug zur Verfügung.
So konnte man im Ernstfall schweres Kriegsgerät oder Ölfässer auf das Plateau befördern, ohne den beschwerlichen Weg über die vielen Stufen nehmen zu müssen.
Die gesamte Luke wurde oben mit einer massiven Steinplatte verschlossen, die von mindestens vier Zwergen gestemmt werden musste. Doch auch hier hatte der gnomische Erfindergeist ausgeholfen. Anstatt die Platte anzuheben und dann über den Felsen des Plateaus schieben zu müssen, hatten die Gnome eine kleine Fläche der Hochebene präpariert. Es genügte nun, die Platte anzuheben und dann auf kleine Rollen zu schieben, die in den Boden eingelassen waren. So ließ sich die Platte relativ leicht bewegen und auch die Rollen konnten über einen Hebelmechanismus im Inneren des Turms versenkt werden und so den Eingang zusätzlich sichern. Ohne die falsche Bergwand bildete das Plateau ein Flachdach für den eisernen Wachturm und machte ihn zu einer schier uneinnehmbaren Festung.
Der Seilzug wurde von den drei Gebirgsläufern betätigt, während Kerellic, Rhaflit und Duibel die Teile nacheinander einluden und fest verzurrten.
Die nahezu unversehrten Flügel waren nicht einfach auf dem großen Zugkasten zu verstauen gewesen, doch schon bald machte sich die letzte Fuhre auf ihren Weg. Als die Ladung ihr Ziel erreicht hatte, traten sie ins Innere des Turms, die vier Zwerge schlossen die Luke und sperrten das Tageslicht aus dem Turm aus. Alle zehn Stufen waren Öllampen an den Wänden befestigt, die das polierte Eisen jetzt golden erstrahlen ließen. Und obwohl das Lichtspiel faszinierend war, so war es dennoch nicht vergleichbar mit der Schönheit des Sonnenlichts, das sich durch die kleinen Fenster großflächig an den Wänden spiegelte.
»Danke für eure Hilfe, Jungs«, sagte Kerellic an die Gebirgsläufer gerichtet. »War auch bitter nötig«, fügte er mit einem grimmigen Seitenblick auf Rhaflit hinzu.
Am Boden des Turms trennten sich ihre Wege. Die Gebirgsläufer gingen wieder ihren üblichen Aufgaben nach, der Schmied und die beiden Gnome zogen den beladenen Karren in Richtung Invar.
Die Zwergenstadt war nicht einfach nur ein in den Berg gehauener Stollen. Invar war eine echte Stadt unter Tage. Jetzt liefen sie jedoch noch durch einen engen Gang aus behauenem Fels, der kaum mehr als zwei Meter breit und hoch war und sie tiefer in den Berg führte. Von jedem möglichen Eingang in die Stadt führte zunächst ein schmaler Tunnel in den Berg hinein. Auf diese Weise wurde verhindert, dass ein möglicher Angreifer sich gleich zu Hunderten in die Zwergenstadt ergießen könnte.
Am Ende des Ganges erwartete sie eine Torwache, die aus vier zwergischen Schildwachen und einem gnomischen Ingenieur bestand, der die verschiedenen Fallen bediente und ihre tadellose Funktion zu jeder Zeit sicherstellte.
Die polierten Plattenrüstungen der Schildwachen funkelten silbern und rötlich zugleich im flackernden Licht der Öllampen. Duibel war stets aufs Neue gebannt von dem Lichtspiel, das in der besonderen Legierung des Mithrils seinen Ursprung hatte. Um die Rüstungen selbst dem Atem eines ausgewachsenen Drachens widerstehen zu lassen, hatten die gnomischen Ingenieure einen Weg gefunden, zerstäubte Schuppen der Riesenechsen mit dem Metall zu verbinden. Hinter den mannshohen Turmschilden konnte ein Zwerg bequem in Deckung gehen, den tödlichen Feuerodem über sich ergehen lassen und der Bestie im Anschluss den Garaus machen. Eine Aufgabe, die den regulären Soldaten zufiel.Jeder Zwerg war ein fähiger Kämpfer, doch nur die Schildwächter verbrachten ihre gesamte Zeit mit der Übung in den Waffenkünsten. Sie bildeten eine kleine, aber äußerst effektive Streitmacht und nur im Notfall würde der König einen allgemeinen Ruf zu den Waffen ausgeben. Erst dann würde Invar zu einer einzigen kämpfenden Masse aus Tausenden von Zwergen werden, die jedem Feind den Tod brächte.
Tatsächlich war eine solche Mobilmachung schon seit gut achthundert Jahren nicht mehr vorgekommen. Manche der älteren Zwerge neckten ihre Enkel mit Geschichten aus ihrer Jugend »als die Orks noch wild waren und man hinter jeder Ecke einem wütenden Troll begegnen konnte«. Heute wagten sich nur selten Monster in die Nähe des Zwergenreichs. Und wenn sie es taten, wurden sie bereits früh von den Gebirgsläufern erspäht und zur Strecke gebracht.
Kerellic grüßte die Zwerge mit einem knappen Kopfnicken. Der Schmied war einst selbst ein Schildwächter gewesen, hatte dann jedoch die Esse seines Vaters übernommen, als dieser bei einem Unfall in der Schmiede ums Leben gekommen war. Dieser Vorfall lag nun bereits zweihundertsiebenunddreißig Jahre zurück, doch Kerellic war noch immer nicht über die Trauer seines Verlustes hinweggekommen. Und noch immer genoss er unter den Schildwachen großes Ansehen, ebenso wie unter den übrigen Schmieden.
Rhaflit und er waren schon sehr lange eng befreundet. Der Ingenieur hatte in seinen jungen Jahren als Lehrling auch die Fallenwache gehalten, wie die Gnome den Dienst an den Eingangstoren nannten. Dort war er mit Kerellic zusammengetroffen und der Zwerg hatte an Rhaflits überschäumendem Enthusiasmus einen Narren gefressen.
Seit Kerellic als Schmied arbeitete, fertigte er für Rhaflit jeden benötigten Gegenstand nach dessen Vorgaben an. So auch die Drachenkonstruktion, und Kerellic war sicher nicht minder stolz darüber, dass der letzte Versuch ein – zumindest kleiner – Erfolg war.
Der junge Gnom, der die Fallen überwachte, blickte Rhaflit ehrfürchtig an. Kein anderer Ingenieur wurde gleichzeitig so verehrt und gefürchtet wie der ehrgeizige Rhaflit. Sein bereits Jahrzehnte andauernder Kampf um die Eroberung des Luftraumes war schon jetzt legendär. Selbst die Zwerge lobten seine Beharrlichkeit.
»Meister Rhaflit!«, quiekte der junge Gnom aufgeregt, was den angesprochenen Ingenieur entnervt die Augen verdrehen ließ.
»Nenn mich nicht so«, sagte er schnell. »Sag einfach Rhaflit zu mir.« Rhaflit war, ebenso wie Duibel, ein vollwertiges Mitglied des Ingenieurs–Ausschusses und trug damit offiziell den Titel eines Meisters. Jeder Gnom, der seine Lehrjahre und die Fallenwache überstand, wurde zu einem Meister, deshalb maß Rhaflit dem formellen Titel keinerlei Bedeutung bei.
»Aber Euer Gleiter, Meister Rhaflit!«, äußerte der junge Gnom voller Staunen und überging damit komplett die Bemerkung des Älteren.
»Was ist damit?«
»Er ist völlig zerstört!«, rief der Gnom entsetzt. »Hat es denn wieder nicht funktioniert?«
Duibel und Kerellic warfen sich einen vielsagenden Blick zu und der Zwerg verbarg sogar ein Grinsen in seinem buschigen braunen Bart. Rhaflit hingegen lief in verschiedenen Tönen rot an. Zuerst war es nur eine leichte Färbung um die Wangen, dann staute sich zusehends mehr Blut in seinem Schädel.
Er schloss die Augen und zählte leise bis zehn und seine Gesichtsfarbe normalisierte sich wieder. Dann blickte er den jungen Gnom, der seit Beginn des Schauspiels unruhig von einem Bein aufs andere trippelte, an und sagte gefasst: »Meine Experimente sind geheim. Und einem Grünschnabel wie dir muss ich rein gar nichts sagen.«
Die Schildwachen kicherten leise, als Rhaflit an dem völlig verdutzten Gnom vorbeimarschierte, gefolgt von Kerellic, der den Karren mit den Überresten des Gleiters zog.
Laufende Versuche und Entwicklungen waren stets geheim. Auch wenn die Gnome ein friedfertiges Volk waren, wenn es um bahnbrechende Erfindungen ging, waren sie wie Kannibalen. Schon manche Erfindung war einem Namen zugeordnet worden, der sie lediglich kurz vor Fertigstellung schneller kopiert und vollendet hatte als der Gnom, der die Arbeit daran begann.
Für Rhaflit bestand keine wirkliche Gefahr – kein Gnom außer ihm war verrückt genug, sich mit dem Fliegen länger als in unruhigen Träumen zu beschäftigen. Dennoch machte er ein großes Geheimnis aus seiner Arbeit, oder versuchte es zumindest, denn die Gerüchteküche kochte beinahe über, wann immer er von einem Testflug zurückkehrte. Ganz abgesehen davon, dass manche seiner Fehlschläge so spektakulär waren, dass sie sich schwerlich hätten verschweigen lassen.
»Jedes Mal das gleiche Spiel mit diesen Taugenichtsen«, schimpfte Rhaflit, als sie außer Hörweite des Tores waren.
Duibel seufzte. »Du vergisst wohl, wie wir beide waren, bevor wir Meister wurden.«
»Wir waren anders«, beharrte Rhaflit.
»Ja, wir waren noch schlimmer!« Er lachte laut und entließ auf diese Weise die noch immer angestaute Anspannung. Eines Tages kommt er bei einem Versuch ums Leben, dachte er.
»Moment!« Rhaflit blieb stehen und wedelte übertrieben mit den Händen. »Du hast dich doch stets damit gebrüstet, dass dein Vater, Mirzon, der Erste Ingenieur war. Und du hast immer so lange auf ihn eingeredet, bis wir bei seinen Experimenten zuschauen durften.«
»Aber hast du nicht versucht, ihn zu einigen Versuchen zu überreden, die du dir ausgedacht hattest?«
»Natürlich«, gab Rhaflit unumwunden zu. »Das ist ja auch, was ich meine. Wir haben den Meistern damals wirklich geholfen und sind nicht bloß vor ihnen gekrochen.«
Duibel schüttelte nur lachend den Kopf und damit war die Diskussion beendet. Er wollte sie auch gar nicht weiter fortsetzen, denn ihr schmaler und düsterer Tunnel endete und öffnete sich in die gewaltige Zwergenstadt Invar. Er atmete erleichtert auf, als er den beengten Tunnel verlassen und in die Stadt eintreten konnte.
Ein Anblick, den der junge Gnom stets aufs Neue genoss. Invar erhob sich inmitten einer gewaltigen Höhle, deren Durchmesser mehrere Tausend Meter betrug. An manchen Stellen war die Höhlendecke so weit entfernt, dass man sie kaum ausmachen konnte. Funkelnde Edelsteine waren in sie eingesetzt und glitzerten wie ein bunter Sternenhimmel.
Kleine und große Steinhäuser säumten nun ihren weiteren Weg, der sich durch die breiten Hauptstraßen und engeren Seitengassen schlängelte. Kerellic führte sie auf direktem Wege nach Ventril, dem Wohnort der Gnome. Doch zuvor passierten sie noch den Schmiedehammer, die größte Schänke Invars und auch die älteste. Auch ihr Besitzer konnte sich dem Reiz von Rhaflits Erfindungen nicht entziehen und streckte neugierig den Kopf zu einem Fenster heraus. Kerellic grüßte den Wirt, Thorvan, mit einem knappen Kopfnicken und gab ihm zu verstehen, dass er ihn in den nächsten Stunden bereits aufsuchen würde. Die Art der Zwerge, mit ihrer Anspannung umzugehen, dachte Duibel.
Dumpf hallte das Hämmern aus den großen Schmieden von den Wänden. Das rhythmische, fast schon beruhigende Geräusch nahm stetig zu, bis sie schließlich eine der Treppen passierten, die in die labyrinthartigen Ebenen unter Invar führten. Direkt unter der Stadt, auf einer Fläche beinahe ebenso groß wie Invar selbst, befanden sich die Essen und Ambosse der Zwergenstadt. Und noch weiter darunter die Stollen, aus denen das Erz gefördert wurde.
Hier oben, wie die Zwerge zu sagen pflegten, bemerkte man von dem geschäftigen Treiben nicht mehr als den wiederkehrenden Schlag der vielen Hämmer.
Schließlich standen sie erneut vor einem massiven Eisentor. Nur war dieses um ein Vielfaches größer als das Durchgangstor im Wehrtunnel. Und dieses hier wurde auch nicht von bewaffneten Zwergen bewacht, sondern lediglich von zwei Gnomen bedient, die dabei auch ständig den Schließmechanismus überprüften. Duibel fühlte sich unbehaglich, als er auf den großen Riegel blickte, den man von außen vor das Tor legen konnte. Selbst die Luftschächte waren mit Klappen versehen, die von zwergischer Seite verschlossen werden konnten.
Sie würden uns tatsächlich einschließen, nur zu ihrem eigenen Wohl, dachte er dann immer. Sie würden im Falle eines missglückten Experiments Ventril opfern, um Invar zu retten. Sein Blick folgte einer Mauerfuge, als er vergeblich nach einem zweiten Ausweg suchte. Eigentlich gleicht Ventril mehr einem riesigen Haus als einer Stadt, dachte Duibel, als er sich die Mauerkonstruktion, die sich wie eine Kuppel um die Behausungen der Gnome schloss, genauer ansah. Einem Haus, das auch ein Gefängnis werden kann. Ein eisiger Schauer überkam ihn, als sie durch das geöffnete Tor traten und direkt Rhaflits Behausung ansteuerten.
Die Straßen Ventrils waren ungleich schmaler als die der Zwergenstadt. Und die Häuser waren auch allesamt kleiner. Doch etwas an Ventril war tausendmal schöner als Invar, wusste Duibel. Um die Eisenkuppel ansehnlicher zu gestalten, hatten die Gnome eine aufwendige Konstruktion verschiedener Spiegel an ihr angebracht. Diese Spiegel reflektierten das Licht mehrerer Öllampen, sodass das graue Eisen wie ein goldenes Dach anmutete.
Neugierige Blicke verfolgten sie, als sie gemächlich durch die Straßen marschierten, begleitet von dem dumpfen Poltern des Karrens.
Duibel reichte Rhaflit einen großen Schraubenschlüssel. »Du hättest da oben sterben können.«
»Das mag schon sein«, gestand der Gnom, während er mit dem Werkzeug eine verbogene Querverstrebung des Drachengestänges löste. »Aber glaube mir, Duibel, der Flug war es wert.« Rhaflit blickte ihm direkt in die Augen. Duibel konnte das Freudenfeuer, das in ihnen loderte, deutlich sehen. »Dieses Gefühl, diese Freiheit! Duibel, es ist das Unglaublichste, was jemals einer von uns erreicht hat.«
»Was denn?«, brummte Kerellic, der hinter einem der Flügel aus Drachenleder damit beschäftigt war, den Rahmen mit einem kleinen Hammer wieder auszurichten. »Du warst kurz oben und bist dann schnell wieder runtergefallen. Und dabei hättest du dich beinahe noch selbst getötet. Verrückter Gnom!«
»Du dummer Zwerg!«, schalt Rhaflit den Schmied und Duibel sog hörbar die Luft durch die Zähne. »Du sollst nur die Flügel richten! Das restliche Gestell ist unwichtig!«
»Aber du sagtest doch, dass du das nächste Mal fliegen willst«, verteidigte Kerellic seine Arbeit.
»Ja«, räumte Rhaflit ein, »aber Fliegen ist hiermit nicht möglich. Ich brauche nur die Flügel. Den Rest muss ich neu konstruieren.«
»Also auch neu testen?«, fragte Duibel erschrocken und Kerellic ließ den Hammer unter lautem Scheppern zu Boden fallen.
»Selbstverständlich«, gestand Rhaflit mit zufriedenem Grinsen.
»Ich hasse es, wenn du das sagst«, brummte Kerellic resignierend.
»Keine Sorge«, versuchte Rhaflit den Schmied zu beruhigen. »Die nächsten Versuche werden erst begonnen, wenn die Konstruktion wirklich ausgereift ist. Fliegen wird nämlich viel gefährlicher als gleiten.« Dann fing er an, vor sich hin zu murmeln: »So viele Dinge müssen berücksichtigt werden. Gewicht, Fluglage, Luftwiderstand, Tragfähigkeit, Antrieb …«
»Sagtest du gerade Antrieb?«, rief Duibel fassungslos.
Kerellic hatte den Hammer gerade wieder vom Boden aufgehoben, nur um ihn erneut fallen zu lassen.
»Ich sagte doch, dass ich das nächste Mal fliegen werde.« Rhaflit grinste freudig.
Der Zwergenschmied baute sich nun drohend vor Rhaflit auf und verschränkte die Arme vor der kräftigen Brust. »Rhaflit. Nein.«
Der Gnom stutzte und blickte Kerellic fragend an.
»Diesmal werde ich dir nicht helfen.«
»Aber …«, begann Rhaflit, doch auch Duibel stellte sich neben Kerellic und schüttelte energisch den Kopf.
»Ich ebenfalls nicht. Das ist Wahnsinn.«
»Es ist mein Traum!«, konterte der Freund und seine Stimme wurde laut. Rhaflit wurde selten laut, außer man störte ihn bei seinen Experimenten.
»Wenn es dein Traum ist, dich selbst umzubringen – bitte«, fuhr Kerellic fort. »Aber ich werde dir dafür sicher nicht die nötigen Mittel liefern. Nicht dieses Mal.«
Damit stapfte der Schmied schnaubend an dem verdutzten Gnom vorbei und zog die Tür hinter sich krachend ins Schloss.
»Also nur wir zwei«, stammelte Rhaflit.
Duibel klopfte ihm mitfühlend auf die Schulter und schüttelte traurig den Kopf. »Diesmal stehst du allein da, mein Freund. Ich kann nicht zulassen, dass du dich selbst in so große Gefahr bringst.«
»Es ist mein Traum«, wiederholte Rhaflit mit bebender Stimme und blinzelte eine Träne beiseite.
»Du bist geflogen«, appellierte Duibel an die Vernunft des Freundes. »Niemand vor dir hat das geschafft. Und vermutlich wird auch niemals wieder jemand fliegen! Du bist heute unsterblich geworden und für alle Zeit in die Annalen Ventrils eingegangen.«
»Darum ging es mir nie.«
»Wir sind dafür nicht gemacht«, beharrte Duibel.
»Wir sind für viele Dinge nicht gemacht und dennoch benutzen wir unseren Verstand, um die Wirklichkeit zu ändern«, konterte Rhaflit verzweifelt.
Duibel zuckte erschrocken zusammen. Rhaflit hatte den Leitspruch der Gnome zitiert. Den Leitspruch, den Mirzon, Duibels Vater, einst verkündete. »Das ist ein gemeiner Trick«, sagte er resignierend. Wie könnte ich mich gegen die Lebensweise meines Volkes stellen? Es ist sein Leben und seine Entscheidung. Wenn es nur nicht so gefährlich wäre …
»Dein Vater hatte aber vollkommen recht damit«, wagte sich Rhaflit weiter nach vorn, als er spürte, dass Duibels Widerstand nachließ.
»Es ist einfach so verflucht gefährlich«, schimpfte Duibel. »Man bräuchte haargenaue Pläne …«
Rhaflit verfiel in heftig zustimmendes Kopfnicken.
»… und vielleicht erst einmal ein Modell in kleinerem Maßstab«, überlegte der junge Gnom und spürte, wie ihn die Experimentierfreude allmählich packte.
»Was immer du sagst, wenn du mir bloß hilfst, mein Freund!« Die Augen des exzentrischen Ingenieurs wurden groß, als Duibel zaghaft nickte.
»Es darf nichts schiefgehen«, ermahnte er, doch je mehr er über die Idee nachdachte, desto stärker wog sein Erfindergeist. Wenn es funktioniert, dann werden wir beide in die Annalen eingehen, dachte er und fügte laut hinzu: »Du wirst meine Mitarbeit aber nicht leugnen.«
Rhaflit zögerte einen Moment, streckte Duibel aber schließlich die Hand entgegen. »Einverstanden. Bei dieser Sache sind wir gleichwertig beteiligt.«
Ich hoffe, ich mache keinen Fehler, dachte Duibel, als er die Hand ergriff. Plötzlich musterte er den breit grinsenden Freund mit skeptischem Blick. »Du hast doch bereits an Plänen gearbeitet, nicht wahr?«
»Ein wenig«, flunkerte Rhaflit und deutete auf den großen Schrank in seinem Arbeitszimmer. »Ich werde meine bisherige Arbeit zusammentragen und wir gehen sie morgen gemeinsam durch, einverstanden?«
»In Ordnung«, verabschiedete sich Duibel und ließ Rhaflit allein in der Werkstatt zurück.
Rhaflit fuhr mit der Hand über das verbogene Drachengestell. Bald. Bald werde ich fliegen. Fliegen wird die Welt verändern.
Er setzte sich an einen schweren Schreibtisch aus poliertem Granit, den Kerellic einst für ihn angefertigt hatte. Vor ihm lag ein sauberer Bogen Pergament und ein Kohlestift, dessen Ende er in mühevoller Kleinarbeit zu einer dünnen Spitze gefeilt hatte. Nicht zu fest aufdrücken, sonst bricht der Stift beim Feilen ab. Immer nur in eine Richtung. Und nie zu übermütig werden, sinnierte Rhaflit über das Anspitzen des Stiftes.
2
Die Grausamkeit der Menschen
Der Arm des Mannes schnellte hervor und hielt sie damit zurück.
»Nicht, Hohe Tochter«, presste er im Flüsterton hervor. Sein Blick fiel auf seine Hand, die den Arm der zarten Elfe so fest packte, dass sich das Blut bereits darin staute. Er ließ sie augenblicklich los, senkte demütig den Blick und fügte hinzu: »Es ist zu gefährlich.«
Nefhiliel lächelte gutmütig, denn selbst diese vergleichsweise grobe Berührung des Mannes brachte ihr Herz aus dem Takt. Und sie hätte nur zu gerne weitere Herzschläge damit verbracht, in den dunklen Tiefen seiner mandelförmigen Augen, die so perfekt von langem braunem Haar eingerahmt wurden, zu versinken.
Bevor ihre Gedanken zu weit ausschweiften und sie erröten ließen, strich sie sich eine blonde Haarsträhne hinter das spitz zulaufende Ohr und ergriff das Wort: »Es sind nur Menschen, mein guter Culnauir. Ich möchte sie mir wenigstens einmal ansehen, bevor ich über ihr Schicksal entscheide.«
Lyssetra, die elfische Hohepriesterin, die sie auf der Reise begleitete, warf Culnauir einen finsteren Blick zu.
»Verzeiht mir«, stammelte der Elfenkrieger, den Blick noch immer zu Boden gerichtet. »König Pellaréion hat mir ausdrücklich befohlen, dass ich Euch und die Hohepriesterin über die verborgenen Tunnel direkt ins Zwergenreich führe.«
Als würde er seinen Schwur vor ihrem Vater nachstellen, legte Culnauir sich die rechte Faust auf die Brust. Seine Rüstung war aus mehreren Lederteilen gefertigt, die wie Ahornblätter geformt waren und sich gegenseitig überlappten. Die einzelnen Teile konnten sich ineinander verschieben und ermöglichten dem Elfenkrieger so ein Höchstmaß an Beweglichkeit.
»Und die Hohe Tochter und damit Thronfolgerin hat etwas anderes beschlossen«, belehrte Lyssetra den Mann und achtete darauf, Nefhiliels zukünftige Stellung als Königin der Elfen besonders zu betonen. Ihre Augen blitzten gefährlich auf. Nefhiliel wusste, dass die Hohepriesterin trotz ihres unscheinbaren Äußeren, das sich unter glatten schwarzen Haaren und einer schlichten Robe verbarg, ein Furcht einflößender Gegner war. Auch wenn die Prinzessin sich immer wieder dabei ertappte, dass sie sich fragte, wo die Hohepriesterin den langen Dolch versteckte, mit dem sie so vortrefflich umzugehen wusste.
Die beiden wandten sich um und wagten sich langsam bis an den Waldrand vor. Seit die Menschen auf Rhilok angelandet waren, waren die Wege vom Elfenreich in den südlichen Wäldern zu den Zwergen nicht mehr sicher. Zeit ihres Lebens hatte Nefhiliel gelernt, sich in der Welt außerhalb ihres sicheren Waldes zu tarnen. Auch jetzt trug sie keines ihrer Kleider aus silbrig schimmernder Mondseide, sondern eine einfache Robe, die der von Lyssetra glich.
Im Schutz einiger niedriger Äste und Büsche betrachteten sie das Treiben auf der Lichtung. Männer in abgewetzten Lederhosen hatten ihnen den Rücken zugekehrt und unterhielten sich ausgelassen, während sie nacheinander den Stamm eines frisch geschlagenen Baumes entasteten.
Nefhiliel konnte deutlich den Schmerz der edlen Eiche fühlen, der sich in dem heraussickernden Harz bemerkbar machte. Es gab keine Schreie, keinen Überlebenskampf. Nur das goldene Blut des Baumes, das aus dem nun toten Holz herausfloss. Wieso nehmen sie stets die gesunden Bäume und nie die alten und schwachen?, fragte sie sich.
Einer der Männer betrachtete bereits prüfend die übrigen Bäume und deutete dann auf eine weitere kerngesunde Eiche. Sie konnte seine gleichgültige Stimme hören, als er rief: »Fällt den als nächsten!«
Haut ihn um? Ohne ihm vorher für sein Opfer zu danken? Nefhiliel war fassungslos ob einer solchen Respektlosigkeit.
»Ihr seht«, flüsterte Lyssetra, »wozu die Kinder des Zerstörers fähig sind.«
Nefhiliel nickte langsam, schüttelte dann aber den Kopf. »Ich muss noch mehr sehen.«
»Noch mehr?«, fragte die Priesterin erstaunt
»Ich will eine ihrer Städte sehen«, beschloss die Hohe Tochter. »Ich will wissen, wie sie als Gemeinschaft leben.«
»Sie kennen keine Gemeinschaft!«
Nefhiliel warf ihr einen strengen Blick zu. »Ich muss es wissen. Ich kann die Zwerge nicht um Beistand in einem möglichen Krieg bitten, wenn ich mir nicht vollkommen sicher bin.«
»Gewiss, meine Herrin«, lenkte die Priesterin mit einem Nicken ein. »Unsere Reise wird sich dann jedoch erheblich verzögern«, gab sie zu bedenken. Die Hohepriesterin warf den Männern noch einen letzten Blick zu, als diese gerade ihr grausames Werk an der zweiten Eiche verrichteten, und stieß ein verächtliches Schnauben aus.
Nefhiliel drehte sich um und verschwand bereits wieder im Dickicht des Waldes. »Ein kleiner Preis, wenn ich dafür die richtige Entscheidung treffen kann.«
Wie leicht den Spuren der Menschen doch zu folgen ist, dachte Nefhiliel, als sie die gut sichtbaren Fußabdrücke aus ihrem Versteck heraus betrachtete. Culnauir und die übrigen Krieger mussten sich nicht einmal aus der schützenden Deckung des Waldes herausbewegen, um uns zu führen. Was immer diese Menschen auch sind, sie sind nicht sehr vorsichtig.
»Wir haben ihre Siedlung gefunden, Hohe Tochter«, erklang eine vertraute Stimme aus dem Dickicht. Sie konnte Culnauir nicht sehen, doch es beruhigte sie, dass der fähige Mann ganz in ihrer Nähe war.
»Ist sie weit entfernt?«, fragte Lyssetra.
»Nein, Hohepriesterin. Etwa eine halbe Stunde von hier.«
»Und ist sie groß?«, wollte Nefhiliel wissen.
»Nein. Sie bauen sie erst auf. Bisher stehen nur ein paar Hütten.«
Lyssetra knurrte wütend. »Noch mehr Land, das sie sich einfach nehmen. Kinder des Zerstörers.«
Nefhiliel hob beschwichtigend eine Hand. »Lasst uns keine voreiligen Schlüsse ziehen.« Wobei ich ihrer Einschätzung nicht widersprechen kann, nachdem ich diese Baummörder sah, fügte sie in Gedanken noch hinzu. Dennoch, Lyssetras Wut auf die Menschen darf nicht meine Entscheidung beeinflussen. »Bringt mich zu dieser Siedlung.«
»Hohe Tochter«, warf Lyssetra ein. »Ich muss Euch daran erinnern, dass unsere eigentliche Aufgabe keinen Aufschub duldet. Und noch viel weniger, wenn die Menschen sich weiter ausbreiten. Wir müssen so rasch wie möglich zu den Zwer–«
»Danke, Lyssetra!«, beendete Nefhiliel die Ansprache und verlieh ihrer Stimme einen scharfen Unterton, welcher der Priesterin ihren Platz in der Hierarchie verdeutlichte. »Führt mich zu ihnen, mein lieber Culnauir.«
Nefhiliel betrachtete eingehend die kleine menschliche Siedlung. Lyssetra hatte unrecht. Sie leben in einer Gemeinschaft. Diese zwanzig hier bauen Häuser. Dafür brauchen sie die Baumstämme. Und deshalb nehmen sie nur die starken und gesunden Bäume. Man beschrieb mir die Menschen stets als Monster, doch diese hier scheinen fürsorglich aufeinander aufzupassen, sinnierte sie während ihrer Beobachtung.
Zwei Männer bearbeiteten einen entasteten Eichenstamm. Sorgfältig und behutsam entfernten sie die Rinde. Ein Blick zu einer der fertigen Hütten verriet der Elfe, dass sie mit der Rinde das Dach des Hauses deckten. Selbst die zuvor entfernten Äste wurden noch einer weiteren Verwendung zugeführt. Dünne Triebe wurden zu Bündeln zusammengeschnürt und mit einem längeren Ast zu einem Besen zusammengefügt. Da in dieser kleinen Gemeinschaft kaum ein solch hoher Bedarf an Besen herrschen konnte, vermutete Nefhiliel, dass die Menschen versuchen würden, sie zu verkaufen.
Ihre Methoden mögen verwerflich sein, doch ihre Ziele sind die gleichen wie unsere eigenen, schloss Nefhiliel. Ein Krieg gegen die Menschen wäre falsch. Man muss ihnen beibringen, wie sie ihre Umwelt rücksichtsvoller nutzen können.
Gellende Schreie rissen sie aus ihren Gedanken. Erschrocken kauerte sie sich tiefer in den Schutz des Gebüschs und starrte wie gebannt auf die kleine Siedlung.
Eine Handvoll Reiter, die ihrer Kleidung nach nicht zu den Siedlern zu gehören schienen, preschte durch die aufgescheuchte Meute der Siedler. Metall blitzte, als Waffen blankgezogen wurden und wenige Herzschläge später war das grausame Geräusch zu vernehmen, das entstand, wenn eine Klinge Haut und Muskeln zerschnitt. Die Reiter unterschieden nicht zwischen Männern und Frauen oder Alten und Jungen. Wahllos schlugen sie um sich. Eine Frau wurde von einem Speer aufgespießt, der zwischen ihren Schulterblättern eindrang und ihren Körper komplett durchstieß. Die tödlich getroffene Frau sank bereits kraftlos auf die Knie, als eine Klinge sie streifte. Die Wucht des Aufpralls drehte ihren Körper um die eigene Achse. Schließlich lag sie am Boden, nur um von den Hufen eines kräftigen Hengstes niedergetrampelt zu werden.
Nefhiliel unterdrückte einen Schrei. Neben ihr kauerte Culnauir, dessen Hand sich so fest um den Griff seines Schwertes geschlossen hatte, dass die Knöchel weiß hervortraten. »Wir sollten gehen«, flüsterte er ihr zu.
»Nein«, zischte Lyssetra. »Die Hohe Tochter muss dies sehen. Sie muss sehen, wie die Menschen miteinander umgehen.«
»All diese Grausamkeit«, hauchte die anmutige Elfe.
»Eine Grausamkeit, zu der nur Kinder des Zerstörers fähig sind«, fügte Lyssetra hinzu.
»Hohe Tochter, wir müssen nun gehen!«, drängte Culnauir eindringlicher, als das Massaker unter den Siedlern auf sein Ende zusteuerte.
Nefhiliel nickte stumm und wollte sich gerade zurückziehen, als die Schreie plötzlich verstummten. Sie fürchtete schon, dass die Reiter alle Siedler getötet hätten, doch ein erneuter Blick zeigte ihr das Gegenteil.
Man hatte die Überlebenden auf dem freien Dorfplatz zusammengetrieben und die Reiter hielten sie mit ihren Waffen vom Rücken der Pferde aus in Schach.
Nefhiliel wagte kaum zu atmen, als ein Mann sein Pferd in den von den übrigen Reitern gebildeten Kreis dirigierte und schon beinahe schmerzlich langsam absaß. Er trug wie die anderen einen langen Mantel aus dunklem Leder, der seinen Körper völlig bedeckte. Die einzige Auffälligkeit, die ihn von seinen Begleitern unterschied, war ein blutrotes Halstuch, das er bis über die Nase gezogen hatte.
»Wo ist Handrup?«, fragte er mit Eiseskälte. Seine Worte fuhren der Elfe durch Mark und Bein, so scharf war jeder einzelne Ton. Viele Menschen neigten zu eher fahrigem Umgang mit ihrer Stimme, doch dieser Mann gebrauchte sie wie eine geschliffene Waffe.
Als ihm niemand antwortete, trat er tonlos einen Schritt nach vorn und durchschnitt einem Mann, der durch die Last des Alters kaum aufrecht stehen konnte, mit einem kurzen Dolch die Kehle. Der Alte japste vergeblich nach Luft und sank blutüberströmt zu Boden. Eine junge Frau schrie entsetzt »Vater!« und wollte ihm zu Hilfe eilen, doch die Spitze einer schlanken Klinge auf ihrer Brust hielt sie zurück.
»Wenn du etwas für ihn tun willst, dann bitte die Sterne, ihn zu leiten«, sagte der Mann gelassen.
Culnauir und die übrigen Elfenkrieger tauschten vielsagende Blicke. Dieser scheint wahrlich gefährlich zu sein, dachte Nefhiliel. Die kaltherzige Grausamkeit erschütterte und faszinierte sie zugleich. Die Art, wie er seine Worte wählte, sich bewegte, zeugte von absoluter Kontrolle. Er strebt nach Perfektion. Einer Perfektion im Töten. Mitleid scheint ihm fremd. Vermutlich ebenso Freundschaft. Er schreitet auf einem Pfad, der ihn nur ins Verderben führen kann.
»Nun, sag du es mir«, setzte der Mörder nach einer kurzen Pause an. »Wo ist Handrup?«
Mit zitternder Hand deutete die Frau in die Richtung des Waldrandes, wo sich Nefhiliel und ihre Begleiter versteckten. Die Elfe biss sich vor Schreck auf die Lippe und der Geschmack von Blut erfüllte ihren Mund. Keine dreißig Fuß von ihr entfernt trat die Gruppe der Holzfäller gerade aus dem Wald. Sie mussten den Kampfeslärm gehört haben und waren zu ihren Familien und Freunden geeilt. Die Männer packten ihre Äxte, bereit, im Kampf unterzugehen, doch einer hob gebietend die Hand. »Nein, es ist gut … es musste so kommen.« Dann wandte er sich dem Mann mit dem Halstuch zu. »Ich bin Handrup!«
»Ich gehe davon aus, du weißt auch, wer ich bin«, sagte der Fremde. Sein Tonfall hatte sich unmerklich verändert. Einem Menschen wäre dies nicht aufgefallen, doch Nefhiliels feines Gehör nahm es ganz deutlich wahr. In seiner Stimme schwang ein Anflug von Trauer mit. Er betreibt das Töten nicht aus Leidenschaft. Er scheint mit sich selbst im Widerstreit zu sein.
Handrup nickte. »Und ich weiß, weshalb du gekommen bist. Also beende deinen Auftrag und lass die anderen in Frieden.«
Der Fremde schüttelte sich in einem gespielten Lachen. »Was aus ihnen wird, entscheide ich allein!«
Sein Blick fiel auf die in seinen Händen ruhenden Waffen. Rechts das Schwert, links der Dolch. Für einen Moment schien er unschlüssig darüber zu sein, was er als Nächstes tun sollte. Er wog den Dolch und schien die Entfernung zu Handrup abzuschätzen.
»Wenn ihm der Wurf gelingen sollte, wäre ich wirklich beeindruckt«, flüsterte Culnauir und handelte sich einen tadelnden Blick von Lyssetra ein. Sie waren den Menschen zwar weit überlegen, doch es blieb zu befürchten, dass jemand bei einem Kampf zu Schaden kommen könnte, sollte man sie entdecken.
»Es geht das Gerücht umher, dass du ein guter Kämpfer bist, Handrup«, sinnierte der Fremde. »Wollen wir deine Fähigkeiten auf die Probe stellen?«
»Habe ich denn eine Wahl?«
»Du könntest dich natürlich auch für das Schicksal dieses Greises entscheiden«, erwiderte der Fremde und deutete auf den mittlerweile verbluteten Mann.
Handrup kniff die Augen bedrohlich zusammen und packte den Schaft seiner langen Axt fest mit beiden Händen. Mit einem wütenden Knurren auf den Lippen rannte er auf den Fremden zu.
Die Reiter lenkten ihre Pferde beiseite, um den Kontrahenten ausreichend Platz zu verschaffen.
Handrup stürmte mit wildem Gebrüll heran, während der Fremde völlig ruhig stehen blieb.
Als der Holzfäller nur noch fünf Schritte entfernt war, zuckte der linke Arm des Fremden nach vorn und für den Bruchteil eines Augenblicks war das aufblitzende Metall der Dolchklinge zu erkennen. Handrup strauchelte, als der Dolch in seinen ungeschützten rechten Oberschenkel eindrang. Er verlor das Gleichgewicht und stolperte auf den Fremden zu. Der machte einen Schritt zur Seite, obwohl man ihm kaum ansah, dass er sich überhaupt rührte. Seine Bewegungen waren vollendet und brachten ihn genau in dem Moment neben den vorbeistolpernden Handrup, als dieser aus purer Verzweiflung mit der Axt weit ausholte.
Das Schwert des Fremden drang tief in Handrups Bauch ein und ein kräftiger Ruck riss eine klaffende Wunde.
Blut ergoss sich in Strömen über Handrups Beine, als er auf die Knie sackte. Seine Augen hatten bereits ihren Glanz verloren, als der Fremde mit der Linken seinen Haarschopf packte und seinen Kopf in den Nacken riss.
»Mögen die Sterne dich leiten.«
Der Mörder zog den Kopf des toten Handrup weiter zurück und ließ ihn dann los. Der aufgeschlitzte Oberkörper fiel rücklings zu Boden und ließ die Leiche in einer grotesken und gleichsam grausamen Stellung offen liegen, sodass alle Umstehenden sie genau sehen konnten.
Lässig, ja gar respektlos wischte der Fremde sein blutiges Schwert an Handrups Kleidung ab und steckte es in die Scheide. Den Dolch ließ er zurück, da er sich anscheinend nicht die Hände an der völlig blutüberströmten Waffe schmutzig machen wollte. Er wandte sich den vor Angst erstarrten Siedlern zu. »Mit dem Tod dieses Mannes ist eure Schuld gesühnt. Begeht keinen erneuten Fehler und entrichtet von nun an eure Steuern. Dafür wird Meisterin Celless euch erlauben, Handel zu treiben und in Frieden zu leben.« Er betonte die letzten Worte sehr genau und deutete mit der Linken auf den toten Handrup.
Ohne ein weiteres Wort stieg er auf den Rücken seines Pferdes und ritt mit seinen Männern davon. Die überlebenden Siedler fielen sich weinend in die Arme und sanken verzweifelt auf die Knie.
»Ihr seht, Hohe Tochter«, flüsterte Lyssetra, »sie töten sich gegenseitig, wie Tiere. Sie kennen keine Gemeinschaft.«
»Du irrst, Lyssetra«, widersprach Nefhiliel. »Dieser da hat sich für die anderen geopfert. Obwohl er kein Krieger war, hat er die Herausforderung angenommen, nur um die Achtung des Mörders zu gewinnen. Vielleicht hat diese Entscheidung das Leben der anderen verschont, vielleicht war es bedeutungslos. Seine Tat jedoch war selbstlos und verdient unseren Respekt.«
»Ebenso wie die Perfektion des Mörders«, sagte Culnauir tonlos. »Wir werden es heute nicht mehr zum geplanten Unterschlupf schaffen«, fügte er hörbar hinzu.
Seit die ersten Menschen an Rhiloks Südküste gelandet waren, hatten die Elfen sich auf dem langen Weg zu den Zwergenreichen einige versteckte Höhlen eingerichtet. Alle lagen in einem genau berechneten Abstand zueinander, damit man die Distanz zwischen ihnen in einem Tagesmarsch bewältigen konnte. Durch Nefhiliels Interesse an den Menschen würden sie ihren Schlafplatz allerdings nicht mehr erreichen.
»Dann werden wir heute Nacht unter den Sternen nächtigen«, entgegnete die Hohe Tochter gelassen. Es war ihre erste längere Reise über den Kontinent, und Nefhiliel genoss diese neu gewonnene Freiheit. Selbst nach den Schrecknissen des heutigen Tages.
»Und morgen?«, fragte Lyssetra ein wenig gereizt.
»Morgen werden wir bis zur Höhle gehen, die wir heute erreichen wollten«, sagte Nefhiliel leise.
»Dann verlieren wir einen ganzen Tag!«, platzte es aus Lyssetra heraus.
»Haben wir denn Grund zu solcher Eile?«
Lyssetra wurde sich wieder gewahr, mit wem sie sprach und senkte demütig das Haupt. »Selbstverständlich nicht, Hohe Tochter.«
»Sehr schön. Culnauir, gib deinen Spähern Bescheid, dass sie uns einen geeigneten Lagerplatz suchen sollen.«
»Gewiss, Hohe Tochter.« Der Krieger verneigte sich tief und gab seinen Männern die nötigen Anweisungen. Er selbst blieb bei den beiden Frauen zurück. Niemals würde Culnauir von seiner Schutzbefohlenen weichen.
3
Der erste Schlag
Später am Nachmittag verließ Duibel sein kleines Haus, das er in der Nähe des Zentrums von Ventril besaß. Sein Vater Mirzon hatte es gebaut, und obwohl es eher klein war, gehörte es dennoch zu den schönsten Häusern der Gnomenstadt. Zumindest empfand Duibel das zweigeschossige Steinhaus so. Die Wände bestanden aus dunkelgrauem Granit, doch sein Vater hatte auf etwa zwei Drittel Höhe jedes Stockwerks eine Reihe aus helleren Steinen gesetzt. Sie streckten das Haus für den Betrachter und ließen es größer erscheinen. Dazu ein hell gedecktes Dach, das deutlich zwischen den Nachbarhäusern hervorstach.
Aber das deutlichste Merkmal waren die Fensterrahmen. Mirzon hatte dafür eigens eine Metalllegierung erfunden, die aus verschiedenen Stahlsorten bestand und nach der Bearbeitung in Säure geätzt wurde. Dadurch entstand ein fein ziseliertes Muster, das jedes Schmiedestück einzigartig machte.
Für Gnome war eine solche Hingabe zum Detail äußerst ungewöhnlich, aber Duibel liebte die Fensterrahmen. In jedem einzelnen von ihnen konnte er die Zuneigung seines Vaters und seine Freude an Schönheit erkennen.
Und dann war die Legierung auch noch überaus waffentauglich, sinnierte der Gnom. Vater war wirklich genial.
Er lief schnellen Schrittes über die glatt geschliffene Granitfläche, welche die Straße darstellte, und erreichte nach kurzer Zeit das größte Gebäude Ventrils: die Halle der Ingenieure. Hier hielten die Meister ihren Ausschuss und befanden über die einzelnen Erfindungen. Sollte Rhaflit – nein, sollten wir es jemals schaffen zu fliegen, dann müssen wir uns danach auch den kritischen Fragen des Ausschusses stellen, dachte Duibel. Sie werden wissen wollen, wie viel Zeit die Herstellung benötigt, und ob es einen Nutzen für die Kriegsführung oder unsere Gesellschaft hat.
Äußerlich war die Halle der Ingenieure, wenn man von der fünfzig Meter in jede Richtung messenden Größe absah, ein unscheinbares Gebäude. Gnome verzierten selten die Fassaden ihrer Behausungen. Anders als die Zwerge, die meist eine lange Ahnenliste auf die Außen– und Innenseite ihrer Türen schrieben, ebenso wie sie wichtige Errungenschaften oder heroische Taten in feinen Meißelarbeiten nachstellten. Duibel hatte diese übermäßige Verehrung der Vergangenheit niemals verstehen können. Er selbst bewahrte einige Handschriften seines Vaters in einer kleinen Truhe auf, doch größtenteils waren diese wissenschaftlicher Natur, da sein Vater kaum persönliche Aufzeichnungen geführt hatte. Mirzons Abbild war als Statue in der Halle der Ingenieure verewigt, fiel ihm gerade wieder ein, und so freute er sich umso mehr, als er eine der vielen Türen des Gebäudes öffnete. Gleich mehrere Eingangstüren zierten die Außenwand der Halle, denn Gnome hassten nichts mehr als Ineffizienz. Und eine einzige Tür, bei der es womöglich zu Engpässen und Warteschlangen käme, war eine unerträgliche Vorstellung.