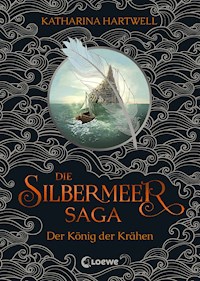
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Silbermeer-Saga
- Sprache: Deutsch
Nominiert für den SERAPH 2021 - Bester Roman! Diese Geschichte beginnt mit den Kaltwochen, mit Fischern, die dem Meer nicht trauen, und den verschwundenen Kindern von Colm. Eine schwarze Feder ist das Einzige, was Edda von Tobin geblieben ist. Gleich zu Beginn der Kaltwochen ist ihr Bruder verschwunden. So wie jedes Jahr eines der Kinder Colms verschwindet. Niemand sucht nach ihnen, das Meer ist feindlich, voller magischer Kreaturen und Gefahren. Aber für Tobin überwindet Edda ihre Angst und begibt sich ins Inselreich. Denn irgendwo dort draußen lebt der geheimnisvolle Krähenkönig, der die verlorenen Seekinder mitgenommen haben soll ... "Katharina Hartwell sucht im Phantastischen stets die Poesie und findet Worte, die ihren Welten eine ganz eigene Schönheit verleihen." Kai Meyer Ein sagenhaftes Inselreich hoch im Norden, eine Welt voller fantastischer Wesen und eine starke Heldin sind der Auftakt zu Katharina Hartwells hinreißender Fantasy-Trilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 760
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Prolog – Seekinder
Die Feder, die Hexe, der Mann ohne Farben
Tobin und der Schatten
Farbe des Blutes, Farbe des Feuers
Ein Junge geht ins Meer
Das Feuerfest
Die Rückseite der Furcht
Meeresgrund
Ein Schwarz voller Grün, voller Gelb und Blau
Halb Mensch, halb Vogel
Hinkebein und Rotschopf
Der Mann ohne Farben
Wo die Antworten liegen
Eine andere Geschichte
Der Sohn des Holzfällers
Die Schatten an den Wänden
Ein Schatz oder ein Ungeheuer
In einem dunklen Wort
Insel aus Staub
Drei Kugeln
Im weißen Wald
Der Vogel in den Knochen
Weißdorn und Bittersüßer Nachtschatten
Die Fischer von Halv
Von Kellern und Käfigen
Der Wortfänger
Die erste Flucht
Ogatje
Die zweite Flucht
Makri
Infried
Hagers Haus
Zähne gegen Steine
Der Aufstieg
Der Pfau schlägt ein Rad
Für alle, die losgehen
Diese Geschichte hat viele Anfänge.
Sie beginnt mit einer Karte, die nicht stillsteht, mit einem Schiff, das die See nicht berührt, und mit einer Rüstung aus Silberschuppen.
Sie beginnt mit zwei Puppen aus Holz, einer nachtschwarzen Feder und einem Vogel in den Knochen.
Sie beginnt mit zwei Hexen und einem Mann ohne Farben.
Sie beginnt mit einer Lüge.
Sie beginnt in dem grauen, dem blauen, dem silbernen, dem teerschwarzen Meer.
Sie beginnt mit den Kaltwochen, mit den Fischern, die dem Meer nicht trauen, und den verschwundenen Kindern Colms.
Vor allem aber beginnt sie mit einem Mädchen.
Wie in jedem Jahr war der Winter gerade erst zur Erinnerung geworden und die Ankunft des Frühlings zur Gewissheit, als die Kaltwochen über Colm hereinbrachen. Es begann jene Zeit, in der sich die Angst wie dickflüssiger Schlick durch die Straßen des Fischerdorfes schob, über unebenes Pflaster und hart gefrorene Erde hinweg, vorbei am Haus des Apothekers, bis in die Mitte des Dorfplatzes, bis zum Glockenturm und weiter die Westgasse hinauf zum Friedhof und in die Kapelle der Heiligen Schwestern.
Obwohl die Tage länger wurden, breitete sich die Finsternis aus. Sie quoll auf in den Schatten hinter den Schuppen, in den staubigen Zimmerecken, unter Betten und im Inneren der Öfen, wann immer kein Feuer brannte, um sie zu vertreiben.
Der dritte Mond des Jahres kam und ging, und die Frauen malten die Türen der Häuser rot. Abends saßen sie zusammen mit den älteren Mädchen im Fischhaus, um kleine Puppen aus Holz zu schnitzen. Während sie schnitzten, flüsterten sie die Namen ihrer Söhne und Töchter, ihrer Schwestern und Brüder.
Manche von ihnen gingen vom Fischhaus gleich nach Hause und lagen lange wach oder träumten von den Seekindern der vorangegangenen Jahre, von Jonas und Klaas, von Friederike und Magnus und jenen anderen, an die sich die jüngeren Kinder nicht einmal mehr erinnern konnten. Manche von ihnen suchten noch die Kapelle auf, um vom kühlen Boden zu den steinernen Gesichtern der Heiligen Schwestern aufzusehen.
Die Fischer ließen sich in der Kapelle nur selten blicken. Für ihre Gebete gingen sie hinunter zum Strand. Dort knieten sie sich nieder, den Blick zunächst auf die See, beugten sich hinab, bis ihre Stirnen den feuchten Sand berührten, und murmelten die Namen ihrer Kinder über das Rauschen des Meeres hinweg.
Lasst uns Ilsa.
Lasst uns Hensy.
Lasst uns Jost.
Lasst uns Tobin.
Nachts, wenn längst niemand mehr auf den Straßen war, nicht oben bei der Kapelle, nicht unten am Hafen, ging noch immer ein Flüstern durch das Dorf und bis zum Strand, wo es sich vermengte mit dem Rauschen der Silbersee.
Doch wie in jedem Jahr würden die Gebete, die roten Türen, die Puppen aus Holz eines der Kinder nicht schützen können. Ein Kind, das in den kommenden Tagen zum Seekind werden und bald schon nicht mehr dem Land, dem Dorf und seinen Eltern gehören würde, sondern den Fluten, dem nassen Blau, dem kühlen Grau, der dumpfen Stille tiefer Wasser.
Edda sah aus dem Fenster. Eine gute Stunde war verstrichen, seitdem sie Tobins blonden Haarschopf zum letzten Mal gesehen hatte. Draußen nahm das Licht bereits ab, wurde trist und grau. Noch waren die Tage kurz, und die Dämmerung schien bereits in den Mittagsstunden einzusetzen. Samuel, der Krüppel, humpelte an den Fenstern vorbei. Sein Atem stieg in weißen Gespinsten auf und geisterte noch einen Augenblick über den Dorfplatz, bevor er sich zersetzte. Auch im Fischhaus war es kalt. Freya hatte der alten Muriel verboten, ein Feuer zu entfachen, und die Frauen und Kinder ertrugen die klamme Kälte schweigend. Edda schloss die Augen. Der Geruch von nassem Haar und feuchter Wolle lag in der Luft. Etwa dreißig Frauen und Mädchen und eine Handvoll Jungen hatten sich in dem Saal versammelt. Sie alle trugen den Winter noch in den Knochen und mit ihm den Hunger, die Kälte, die Müdigkeit. Wohl keiner von ihnen fühlte sich bereit für den Sommer und die harte Arbeit, die dieser mit sich bringen würde.
Wieder irrte Eddas Blick hinüber zu den Fenstern. Wo steckte Tobin? Sie hatte ihn ermahnt, dass er in Sichtweite bleiben sollte. Sie konnte nur hoffen, dass die anderen Jungen ihn nicht dazu gebracht hatten, mit ihnen zum Friedhof zu laufen. Während der Kaltwochen ließ Edda ihren Bruder nur ungern aus den Augen, nahm ihn sogar an die Hand, wenn sie morgens zum Fischhaus und abends wieder nach Hause liefen. Sie unterdrückte ein Seufzen, zwang sich, weiter Freya zuzuhören, dem endlosen Fluss an Anweisungen und Ermahnungen, lediglich unterbrochen von gelegentlichem Husten und Ächzen. Die Bänke waren hart und viele unter den Frauen zu alt, um stundenlang still zu sitzen und Freyas ausufernder Rede zu lauschen.
Teofin, der dicht neben Edda auf der Bank saß, gähnte verhalten.
»… ist es dieses Jahr besonders wichtig, dass die Mädchen darauf achten, die Bottiche anschließend ordentlich zu säubern«, sagte Freya und sah sich um. Suchte und fand Edda. Das Grau ihrer Augen war unheilkündend wie der wolkenverhangene Himmel an einem stürmischen Tag – auch und vor allem, wenn sie Edda ansah. Und die Gründe, aus denen sie Edda mit einem Gewitterblick bedachte, waren so zahlreich wie die Fische im Meer – weil sie den Boden nicht gründlich genug geschrubbt oder den Brei nicht lange genug gestampft hatte, weil sie zu spät gekommen oder zu früh gegangen war, weil sie Teofin abgelenkt oder zu viel Zeit damit verbracht hatte, nach Tobin zu sehen.
Beiläufig und so, als wisse sie selbst noch nicht, wohin ihre Füße sie tragen würden, schlenderte Freya durch den Saal und blieb vor Edda und Teofin stehen. Seitdem sie im Vorjahr eine einzelne Schuppe in Eddas Brei gefunden hatte, verstrich kaum ein Tag, an dem sie Edda nicht daran erinnerte, wie wichtig es war, sorgfältig zu arbeiten.
»Wir alle wissen, was geschieht, wenn die Schuppen nicht gründlich zerstampft werden, nicht?«, fragte sie.
Edda hielt den Kopf gesenkt. Angestrengt musterte sie den schmutzigen Saum von Freyas Leinenrock. Versuchte, zuzuhören und nicht an Tobin zu denken. Aber es geschah wie von selbst, dass ihre Augen wieder zu den Fenstern wanderten. Freyas Hand schnellte vor, packte Eddas Kinn und drehte ihren Kopf.
»Was passiert dann, Edda?«
»Schon eine einzige Schuppe kann den ganzen Brei verunreinigen«, antwortete Edda in dem leiernd gehorsamen Ton, den sie sich für diese Art Antworten angewöhnt hatte.
»Und dann?«
»Verunreinigtes Colmin können wir nicht verkaufen.«
Beinahe widerstrebend gab Freya Eddas Kinn frei und setzte ihre Runde durch den Saal fort. Während sie langsam die Bankreihen ablief, musste jede Frau und jedes Mädchen jenen Moment genau spüren können, in dem Freyas Gewitteraugen über sie hinwegwanderten. Vor ihrer eigenen Tochter, Ilsa, blieb Freya stehen.
»Die Pausen sind kurze Unterbrechungen«, erklärte Freya Ilsa. »Keiner hier hat Zeit, den halben Tag auf den Bänken herumzuliegen und von Centria zu träumen.«
Sie sah sich unschlüssig um. Wenn das Jahr voranschritt, die Müdigkeit zunahm und sich die Fehler häuften, mussten die Frauen oft bis spät in den Abend im Fischhaus bleiben und mit gesenktem Kopf Freyas Vorhaltungen lauschen. Aber das Frühjahr stand noch bevor, und noch hatte niemand einen Fehler gemacht. Lass uns gehen, betete Edda stumm, wie so oft unsicher, an wen sie ihr Gebet richtete, an Agatha und Lor oder schlicht an alle, die bereit waren, ihr zuzuhören.
Schließlich nickte Freya ergeben. Selbst sie konnte nicht ewig reden, wenn es nicht das Geringste zu sagen gab.
»Geht nach Hause. Ruht euch aus. In den nächsten Wochen werdet ihr genug Zeit hier verbringen.«
Edda presste die Rückseiten ihrer Beine weiter gegen das raue Holz der Bank, um nicht aufzuspringen und aus dem Raum zu rennen. Fiel Freya erst auf, dass Edda es eilig hatte, würde sie sicher einen Grund finden, sie zurückzurufen. Also ließ Edda erst Ilsa und Keva, Sige und Agnes, Roven, Jost und die anderen aufstehen, bevor sie selbst scheinbar gemächlich aus dem Saal schlenderte. Erst draußen im Flur wurden ihre Schritte schneller.
Drei Stunden waren verstrichen, seitdem Tobin gemeinsam mit den anderen Jungen das Fischhaus verlassen hatte.
Keine Spur von ihrem Bruder. Zumindest nicht auf den ersten Blick. War er etwa allein nach Hause gelaufen? Oder doch zum Friedhof gegangen, obwohl sie es ihm verboten hatte? Sie wollte gerade noch einmal ins Fischhaus laufen, um Teofin zu fragen, ob er sie zur Kapelle begleiten würde, als sie die Jungen bemerkte. Sie standen halb verborgen hinter den Goldenen Fischen, standen im Kreis, so als würden sie jemanden umringen.
Edda rannte los.
Der lange Ulf sah sie kommen und stieß einen Warnruf aus. Zwei der Jungen fuhren herum, stolperten zur Seite und gaben den Blick auf Tobin frei. Er stand in ihrer Mitte, einen halben Kopf kleiner als der Kleinste von ihnen. Noch im Laufen sah Edda die klaffende Wunde auf seiner Stirn, einen Streifen verschmierten Blutes, der sich von seinem Haaransatz bis zur Augenbraue zog. Die Jungen stoben auseinander, genau wie die Möwen, die sich keifend und mit raschem Flügelschlag von den Goldenen Fischen und in den Abendhimmel erhoben. Obwohl die Jungen sich kaum voneinander unterschieden – die gleichen Leinenhosen und Drachenrochenjacken, die gleichen schlickbraunen Haare und verschlagenen Augen –, war Edda sicher, mindestens zwei von ihnen erkannt zu haben: Hensy Moot, den seine abstehenden Ohren und seine sonderbar schlenkernde Art zu laufen verrieten. Und Hans Piel. Natürlich Hans. Er war nie weit, wenn irgendwo ein Kind unglücklich gestürzt war, sich einen Finger eingeklemmt oder die Hand verbrannt hatte.
Genau wie die anderen war auch Hans losgelaufen, doch schon nach wenigen Schritten blieb er stehen. Drehte sich zu Edda um. Spitzte die Lippen. Etwas Kaltes, Klebriges traf Eddas Wange, und Hans schoss davon, noch bevor Edda ganz begriffen hatte, was geschehen war. Unsicher tastete sie nach ihrer Wange. Spucke. Hans Piel hatte sie angespuckt. Hatte Tobin es gesehen? Sie wischte die Spucke mit ihrem Jackenärmel fort, bevor sie sich zu Tobin umdrehte. Er stand reglos neben den Goldenen Fischen. Mit zwei schnellen Schritten war sie bei ihm und kniete sich vor ihm auf das Pflaster. Es war noch nass vom Regen, der Tag und Nacht auf Colm hinabzugehen schien und nur an diesem Nachmittag einmal ausgesetzt hatte. Edda strich Tobin das Haar aus der Stirn, rieb mit ihrem Daumen behutsam das Blut fort. Die elenden Jungen. Dass sie noch weiter Angst und Schrecken verbreiten mussten. Als gäbe es in dieser Zeit des Jahres nicht schon genug. Gleichzeitig aber hatte Edda gewusst, dass sie sich nicht für immer damit zufriedengeben würden, Tobin mit Liedern, Reimen und Beschimpfungen zu verfolgen. Nur aus einem einzigen Grund hatten die sich so lange zurückgehalten: Sie fürchteten sich vor Edda. Selbst Hans Piel fürchtete sich vor ihr.
Vor einigen Jahren – Edda musste damals etwa so alt wie Tobin gewesen sein – hatten ein paar der Jungen sie hoch zum Friedhof gejagt. Hans war unter ihnen gewesen und Hans’ älterer Bruder Merek, der inzwischen als Fischer hinaus zur See fuhr und nichts mehr auf die Spiele der Kinder gab. Die Jungen hatten sich im Kreis um Edda aufgestellt, und der lange Ulf war vorgesprungen, um ihr eine Haarsträhne auszureißen – Merek hatte seinem Bruder und den anderen Jungen erzählt, dass Eddas Haar nicht brennen würde, wenn man es aufs Feuer legte.
Aus rein kopfloser Angst hatte Edda Ulf einen Schlag verpasst, der ihn gegen die Steinmauer in seinem Rücken hatte stolpern lassen. Ulf, ein Tölpel und Tumbtaumler an seinen besten Tagen, war so unglücklich gegen den Stein geprallt, dass er sich seinen Arm gebrochen hatte.
Nach dem Vorfall hatten die Jungen Edda einige Wochen Edda Knochenbrecher genannt, und keiner von ihnen, nicht einmal Hans Piel, war ihr seitdem wieder zu nahe gekommen. Dabei hatten sie wenig Grund, Edda zu fürchten: Als die Fischersfrauen von Ulfs gebrochenem Arm erfahren hatten, war die Aufregung im Dorf groß gewesen. Wäre es nach Freya, Agnes, Roven und Sige gegangen, hätte man Tobin und Edda in einen Karren gepackt und irgendwo in der Nähe Maunlands ausgesetzt. Ruben, Eddas Ziehvater, hatte jeden Gefallen einfordern müssen, den ihm die anderen Fischer schuldeten, damit Edda und Tobin in Colm bleiben durften. Und Edda hatte Ruben versprechen müssen, dass es nie wieder zu einem ähnlichen Vorfall kommen würde. Wenn sie Hans oder einem der anderen Jungen über den Weg lief, vergrub sie die Hände in den Taschen, achtete darauf, die Jungen nicht zu berühren, nein, nicht einmal zu streifen. Es war immer nur eine Frage der Zeit gewesen, bis es einem von ihnen auffallen würde.
Edda nahm ihren Daumen von Tobins Stirn. »Was ist passiert? Was haben sie gemacht?«
»Einen Stein geworfen«, murmelte Tobin.
»Wer? Hensy Moot? Hans?«
Aber Tobin sah nicht Edda an; sein Blick ging starr an ihr vorbei. Er hatte die Unterlippe eingesogen, wie um sich für einen weiteren Angriff zu wappnen, und nun hörte auch Edda die sich eilig nähernden Schritte in ihrem Rücken, das Klappern hölzerner Sohlen auf dem Pflaster und Freyas Stimme.
»Was ist das für ein Geschrei? Seid ihr Möwen oder Kinder?«
Edda sprang auf. Sie zog Tobin zu sich heran und kreuzte schützend die Arme vor seiner Brust. Freya hatte sie beinahe erreicht. Am Fischhaus stand noch eine kleine Gruppe von Frauen, Roven, Sige und Hans’ Mutter Agnes. Die Frauen machten keinen Hehl aus ihrer Neugier, glotzten unverholen, während Freya die Hände in die Hüften stemmte. Von Teofin war nichts zu sehen, dabei war Edda sicher, dass er das Fischhaus in der Zwischenzeit verlassen haben musste.
»Gibt es auch einen Grund für das Gezeter?«, fragte Freya.
»Einer der Jungen hat einen Stein nach Tobin geworfen«, brachte Edda hervor.
»Warst du dabei? Hast du es selbst gesehen?«
»Nein, aber ich habe sie weglaufen sehen. Und Tobin blutet. Er hat gesagt –«
»Das möchte ich selbst hören, was er sagt.« Freya beugte sich zu Tobin hinab. »Stimmt das? Haben die Jungen einen Stein nach dir geworfen?«
Obwohl Tobin wusste, dass es nicht die Antwort war, die Freya verlangte, nickte er. Eddas Arme schlangen sich eine Spur fester um ihn. Freya richtete sich auf und strich sich über ihren Rock, als sei der Stoff schmutzig geworden.
»Na, sie hatten sicher guten Grund«, stellte sie fest und lief achselzuckend zurück zu den anderen.
Edda fröstelte. Für kurze Zeit hatte sie die Kälte nicht spüren können. Während sie über den Platz gerannt war, während sie Hans Piels Spucke von ihrer Wange und das Blut von Tobins Stirn gewischt hatte. Nun aber zitterte sie in ihrem regennassen Rock und ihrer dünnen Drachenrochenjacke. Die Kälte war nicht bloß in der Luft, nicht bloß im Wind, der den Metallgeruch der Silbersee bis mitten ins Dorf brachte. Die Kälte war auch in Edda selbst, während sie zusah, wie Freya sich bei Agnes unterhakte und zusammen mit ihr davonschlenderte.
»Lass uns nach Hause gehen«, sagte sie zu Tobin. Doch statt sich von der Stelle zu rühren, stand sie weiter still, und der Seewind ging ihr durch Haar und Kleider.
***
Obwohl Eddas Ziehvater Ruben einer der einflussreichsten Fischer Colms war, lebte er nicht im Herzen des Fischerdorfes, sondern an dessen östlichem Rand, nur wenige Schritte vom Hafen entfernt. Ilsa hatte es sich nicht nehmen lassen, Edda zu erzählen, dass bereits ein Haus am Dorfplatz für ihn vorgesehen gewesen war – ein Haus, das er hatte aufgeben müssen, als er Tobin und Edda bei sich aufnahm. War es ihrem Ziehvater schwergefallen, auf das Haus zu verzichten? Wann immer Edda ihn danach fragte, stritt er es ab. »Ich störe mich nicht dran. Mein Weg zum Hafen ist der kürzeste«, behauptete er.
Auch Edda war es recht so, denn am Ende der Hafengasse lebten sie in größtmöglicher Entfernung zu Hans, Freya und Ilsa. Einzig in der Zeit der Kaltwochen fluchte sie auf die Entfernung zum Fischhaus.
Je weiter man sich vom Dorfkern, dem großen Platz vor dem Fischhaus, entfernte, umso bescheidener gerieten die Behausungen, in welchen die weniger angesehenen Fischer und ihre Familien lebten. Als Edda und Tobin von der Ost- in die Hafengasse bogen, war nicht einmal mehr der Boden unter ihren Füßen gepflastert. Im Frühjahr und im Herbst kam es vor, dass sie mit ihren Stiefeln in der aufgeweichten Erde stecken blieben, noch aber lag eine dünne Eisschicht über dem Schlamm. Behutsam setzten sie einen Fuß vor den anderen, um nicht ins Rutschen zu geraten.
»Tobin, wenn du das nächste Mal allein bist und Hans und die anderen Jungen siehst, dann musst du rennen«, ermahnte Edda ihren Bruder.
Tobin nickte, ohne sie anzusehen. Wie oft sie diese Unterhaltung bereits geführt hatten, und doch dauerte es nie lange, bis Tobin den Jungen wieder in die Fänge ging. Wenn er wenigstens größer wäre, breitschultrig wie Hans Piel oder hoch aufgeschossen wie der lange Ulf. Aber natürlich wusste Edda, dass die Jungen Tobin auch dann nicht in Ruhe lassen würden, wenn er doppelt so groß wäre wie Ulf.
Den Rest des Heimwegs über versuchte sie, aus ihm herauszubekommen, welcher der Jungen den Stein geworfen hatte und wie genau es zu dem Angriff gekommen war. Tobin aber war schweigsam und in sich gekehrt, und als sie das Ende der Hafengasse erreichten, war Edda so schlau wie zuvor.
Sie erreichten Rubens Haus, das zwar so klein und bescheiden wie die anderen in der Straße war, dabei aber sorgfältiger gezimmert und besser instand gehalten. Als Edda sah, dass Licht in den Fenstern der Wohnstube brannte, sank ihr das Herz. Die Fischer waren erst gegen Mittag aufgebrochen, und sie hatte gehofft, dass Ruben noch auf See sein würde. Dann hätte sie Tobins Wunde versorgen können, ohne dass ihr Ziehvater je davon hätte erfahren müssen.
»Lass mich mit ihm sprechen«, sagte sie zu ihrem Bruder, bevor sie die Haustür öffnete.
Ruben saß am Esstisch, über eines seiner Netze gebeugt. Als Edda und Tobin eintraten, hob er den Kopf, und beim Anblick der Wunde auf Tobins Stirn presste er die Kiefer fest aufeinander.
»Wie ist es dazu gekommen?«
Tobin zog die Schultern zusammen und blickte zu Boden.
»Er hat draußen vor dem Fischhaus auf mich gewartet«, sagte Edda. »Die Jungen haben einen Stein nach ihm geworfen. Sie sind weggelaufen, als sie mich kommen sahen.«
Ich bin keinem von ihnen zu nahe gekommen. Die Worte hingen unausgesprochen im Raum.
Rubens Knie gaben ein unheilvolles Knacken von sich, als er sich erhob. Edda konnte sich nicht erinnern, je erlebt zu haben, dass ihr Ziehvater sich bewegte, ohne dass zumindest eines seiner Gelenke aufbegehrte. Jedes Aufstehen, jedes Hinsetzen, jedes Beugen und Aufrichten war unweigerlich von einem Knacksen oder Knacken begleitet.
»Darum müssen wir uns kümmern«, sagte er und deutete auf Tobins Stirn.
Tobin trottete zu einem der Stühle, Edda setzte sich neben ihn. Schweigend warteten sie, während Ruben im Haus verschwand und kurz darauf wiederkehrte, in der einen Hand eine Flasche Weißbrand und ein Leinentuch, in der anderen ein kleines Silberdöschen. Beim Anblick des Döschens sackte Tobin noch weiter in sich zusammen.
»Es nützt nichts, Junge, die Wunde ist tief«, sagte Ruben. »Sie wird nicht von allein heilen.« Er kniete sich vor Tobin auf die Dielen und stellte das Silberdöschen zunächst auf den Esstisch. Schnell schraubte er den Verschluss der Weißbrandflasche auf und tränkte die Spitze des Leinentuchs. Er hatte große, grob wirkende Hände, doch während er Tobins Wunde mit dem weißbrandgetränkten Tuch abtupfte, war er sanft und geschickt, seine Fingerkuppen schienen Tobins Haut kaum zu berühren.
»Freya schickt die jüngeren Kinder nach draußen, während die Frauen und wir Älteren bis nach Einbruch der Dunkelheit bleiben müssen«, sagte Edda, ohne den Blick von Rubens Händen zu nehmen. »Und das, obwohl die Kaltwochen angebrochen sind. Es ist ihr gleich, dass Tobin und die anderen dort draußen allein herumlaufen. Sie hat Ilsa bei sich, also muss sie sich keine Sorgen machen.«
»Was soll ich tun, Edda?«, fragte Ruben müde, während er das Silberdöschen aufschraubte. »Mit wem soll ich sprechen? Mit Freya? Mit Bent? Glaubst du, die Jungen werden aufhören, Tobin aufzuziehen, wenn wir eine Vollversammlung einberufen?«
»Sie haben ihn nicht aufgezogen. Sie haben einen Stein nach ihm geworfen.«
Vorsichtig nahm Ruben mit dem Tuch etwas von der bläulich weißen Salbe aus der Silberdose auf. Erst vor wenigen Tagen hatte Edda die Dose vom Haus des Apothekers mit nach Hause gebracht. Teofins Eltern, Tomas und Pessa Bornholm, waren seit Jahren für die Herstellung der Colminsalben und Tinkturen verantwortlich. Ein Glück, denn die beiden verarbeiteten das Colmin denkbar gewissenhaft und sorgfältig, bemaßen und vermischten die Anteile an Colmin, Pflanzenfett und Wasseralgen genau. Zu viel Colmin konnte mehr Schaden anrichten als Gutes tun. Doch selbst die am genauesten bemessene Salbe trug nun einmal jene Eigenschaften in sich, für welche Colmin unter den Kindern Colms berüchtigt war. Edda, die an den Bottichen nie achtsam genug war, wusste nur zu gut um den grellen Schmerz, den schon wenige Colminspritzer auf der Haut verursachten. Während Ruben das Tuch näher an Tobins Gesicht zu bringen suchte, rutschte dieser immer weiter zurück, bis sich sein Hinterkopf gegen die Stuhllehne presste. Er zuckte, als das Tuch seine Haut berührte, und seine Augen tränten. Auch Edda musste blinzeln, als ihr der stechende Colmingeruch in die Nase stieg, aber sie zwang sich, Tobin weiter zuversichtlich anzusehen.
Tobins Finger zuckten, und er presste die Lippen aufeinander, während die Salbe einzog und sich die Wunde langsam schloss. Keine Narbe blieb zurück, lediglich eine leichte Rötung, die wahrscheinlich schon am nächsten Tag verschwunden sein würde.
»Gleich ist es vorbei«, behauptete Ruben. Er sprach ruhig, beschwichtigend, aber Edda konnte die Anstrengung hören, die es ihn kostete, geduldig mit Tobin zu sein. Nicht zum ersten Mal kam ihr der Gedanke, dass Ruben als Junge vermutlich mehr mit Ole oder Hans’ Bruder Merek gemein gehabt hatte als mit Teofin oder Tobin.
***
Zum Abendbrot gab es Reisbrei. In dieser Zeit des Jahres gab es an beinahe jedem Abend Reisbrei. Weder Ruben noch Edda oder Tobin wussten dem kargen Garten Gemüse zu entlocken. Eddas Ernte hatte nur aus wenigen kümmerlichen Zwiebeln bestanden, und die hatten sie längst gegessen.
Nachdem Tobin zu Bett gegangen war, half Edda Ruben mit dem Abwasch. Als Ruben den Zuber mit Wasser auf die Ablage wuchtete, entfuhr ihm ein unterdrücktes Stöhnen. Edda warf ihm einen besorgten Blick zu. Die Kaltwochen setzten ihm zu wie allen anderen Fischern auch. Er hatte ihr oft erzählt, dass die Kälte draußen auf See eine andere war als an Land, dass sie tiefer in die Knochen eindrang und auch dann nicht weichen wollte, wenn man in der warmen Wohnstube dicht vorm Feuer saß.
»Ich kann das allein machen«, sagte Edda, während sie die schmutzigen Schalen vom Esstisch zum Zuber trug.
Ruben schüttelte den Kopf, griff nach der Bürste und begann, die Schalen zu schrubben.
»Du hilfst ihm nicht, Edda«, sagte er und reichte ihr eine tropfend nasse Schale. »Heute hast du ihn geschützt, aber die Jungen werden es ihm bei der nächsten Gelegenheit heimzahlen.«
»Und was hätte ich stattdessen tun sollen? Zusehen, wie sie ihn mit Steinen bewerfen?«
Rubens Hände bewegten sich langsam durch das warme Wasser. »Sie haben Angst vor dir. Aber sie müssen Angst vor ihm haben.«
»Angst vor Tobin«, sagte sie leise. Die Jungen würden sich eher vor einer Strandmaus fürchten.
»Wenn er erst ein Fischer ist, wird er seine Tage allein dort draußen verbringen. Dort wirst du ihn nicht mehr schützen können.«
Sie schwieg, hatte sich ihren Bruder ja ohnehin nie als Fischer vorstellen können. Er fürchtete sich vor der See und den Kreaturen, die in ihr lebten, den Wassermännern und Drachenrochen und all den namenlosen Ungeheuern, von denen Ilsa ihm erzählt hatte. Er fürchtete sich vor der Weite des Himmels, der stets Stürme und schweren Regen in sich zu tragen schien, und er fürchtete sich vor den Umrissen Achums, der ersten Insel des Archipels, die an klaren Tagen sogar von der Küste aus zu sehen war. Warum konnte Edda nicht an seiner Stelle fahren? Sicher, genau wie Tobin, genau wie all die anderen Kinder Colms hatte auch sie Angst vor dem Archipel, aber der Schrecken, die Furcht davor, dort draußen auf See zu sein, schien ihr leichter zu ertragen als die Ödnis, die reine Langeweile an den Bottichen, wo tagein, tagaus dieselben Handgriffe verrichtet wurden und Jahr um Jahr verstreichen konnte, ohne dass sich etwas im immer gleichen Ablauf der Tage änderte.
»Edda.« Erst als Ruben ihren Namen sagte, bemerkte sie, dass die nasse Schale in ihren Händen auf den Boden tropfte. Sacht nahm Ruben sie ihr aus der Hand. Aber er strich Edda nicht über den Kopf, so wie Teofins Mutter Pessa es manchmal tat, er legte ihr keine Hand auf die Schulter, er umarmte sie nicht.
»Es hat noch ein paar Jahre Zeit«, sagte er.
»Ja«, sagte Edda. »Ein paar Jahre.«
Als wüssten sie nicht beide, dass ein paar Jahre keinen Unterschied machen würden. Der Junge, der Eddas Bruder war, würde nie zu einem Fischer heranwachsen.
***
Eddas Schlaf war immer tief und traumlos gewesen, aber sie kannte die Geschichten, die man sich an den Bottichen hinterm Fischhaus erzählte. Während der Kaltwochen träumten die Frauen und Mädchen von Schatten, denen Klauen und Zähne wuchsen, von geschuppten Leibern, die sich in der Brandung wanden, von Wolken, die vom Himmel hinabstiegen und über das Pflaster krochen.
In der Nacht, nachdem sie Hans’ Spucke von ihrer Wange gewischt und Tobin das Blut von der Stirn getupft hatte, träumte auch Edda.
Sie war zu Hause. Oder zumindest fast. Denn der Ort, an dem sie sich wiederfand, war ihr vertraut und gleichzeitig fremd. Sie stand am oberen Ende der Treppe. Die Öllampen an den Wänden spendeten kaum Licht, und dort, wo sich die Türen zu den Schlafkammern hätten befinden sollen, sah sie weit geöffnete Fenster. Ein kalter Wind ging durch den Gang, erfasste Edda und ließ sie frösteln. Aber konnte man in einem Traum frieren? Sie rieb sich die Oberarme, sah den spinnwebartigen Gespinsten nach, die aus ihrem Mund und zur Decke aufstiegen. In der Dunkelheit des Traumes verschob sich etwas, sie ordnete sich neu an und gab Tobin frei. Tobin und einen Schatten, einen lang gezogenen Schemen, der hinter ihrem Bruder stand und die Arme um ihn gelegt hatte. Arme? Oder Schwingen? Von dem fedrig dunklen Haar bis zu den Umrissen war alles an der Gestalt ungefähr und nicht ganz richtig.
»Tobin? Hörst du mich?«, fragte Edda.
Tobin antwortete nicht, hing reglos in den Armen des Schattens.
»Tobin!« Edda lief los – wollte loslaufen, aber ihre Beine gehorchten nur widerstrebend, sie kam kaum von der Stelle. Auch der Schatten am anderen Ende des Flurs setzte sich in Bewegung, mühelos glitt er durch die Luft, zog Tobin mit sich, fort von Edda, dem nächstgelegenen Fenster entgegen. Die ganze Zeit über blieben Tobins Augen geschlossen, und lange bevor Edda die beiden hätte erreichen können, zog der Schatten ihren Bruder durch das Fenster und hinaus in die Nacht.
Der Traum gab Edda nur widerwillig frei. Zunächst noch reglos, lag sie im Bett. Erst als ihr die Kaltwochen wieder einfielen, der Stein, das Blut auf Tobins Stirn, streifte sie die Decke ab, sprang auf, lief aus dem Zimmer und in den Flur. Vor Tobins Tür hielt sie inne. Die Stirn gegen das Holz gepresst, suchte sie, sich zu beruhigen: Tobin war sicher auf der anderen Seite, in seinem Bett. Ihre Hände aber zitterten, als sie die Tür öffnete.
Der Mond hatte den Raum in ein bleiches Licht getaucht. Unter der Decke zusammengekugelt, wie um sich selbst vor neuen Angriffen zu schützen, lag Tobin. Edda schloss die Augen, hielt sich am Türrahmen fest. »Bloß ein Traum«, flüsterte sie. Doch ein Traum zur Zeit der Kaltwochen war nie bloß ein Traum, und das wusste auch Edda, während sie weiter festhielt und darauf wartete, dass ihr Herz wieder zurück in seinen Takt fand.
So leise wie möglich schloss Teofin die Tür hinter sich. Einen Moment stand er still und wartete, bis das Pochen in seinem Bein nachließ. Er stützte sich an der Wand ab, während er seine Stiefel abstreifte, und stellte sie in die Ecke. Auf Strümpfen schlich er über den Flickenteppich zur Treppe, doch bevor er auch nur einen Fuß auf die unterste Stufe stellen konnte, trat seine Mutter aus der Küche. Wahrscheinlich hatte sie schon seit dem frühen Nachmittag auf ihn gewartet, unruhig auf jedes Geräusch gelauert.
»Ich wollte deinen Vater schon zum Fischhaus schicken, damit er nach dir sucht, aber dann kam Jeppe vorbei«, sagte sie, und Teofin dankte stumm Agatha und Lor, dass sie seinen Eltern Jeppe geschickt hatten. Wann immer die schmächtige Gestalt seines Vaters am Fischhaus auftauchte, eilte Teofin rasch in die andere Richtung – als würden die anderen Jungen vergessen, dass er der Sohn des Apothekers war, wenn sie die beiden nur nie zusammen sähen.
»Ist Jeppe noch hier?«, fragte er und sah an seiner Mutter vorbei in die Küche.
»Sie sind in der Mischstube. Jeppe ist vor ein paar Tagen mit dem Arm an einem rostigen Nagel hängen geblieben und hat sich die Haut aufgeschürft. Er hätte gleich zu uns kommen sollen, aber er hat abgewartet, und nun ist die Wunde entzündet. Es sieht schlimm aus.«
Es musste auch schlimm sein, dachte Teofin, damit einer wie Jeppe an die Tür des Apothekers klopfte. Die meisten Fischer – im Grunde alle bis auf Eddas Ziehvater – gingen Tomas Bornholm aus dem Weg. Teofin musste sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass sein Vater genau wie Jeppe, Rolf, Bent und Ruben in Colm geboren worden war, denn die Männer und Frauen behandelten ihn wie einen Zugezogenen. Sie trugen ihm noch immer nach, dass er vor gut zwanzig Jahren das Fischerdorf verlassen hatte, um in Klammtal die hohe Kunst der Colminverarbeitung zu lernen. Noch weniger verzeihen konnten sie ihm, dass er eine Fremde, Teofins Mutter Pessa, aus Klammtal geheiratet und mit nach Colm gebracht hatte. Teofin wusste, dass man seine Eltern nur aus einem einzigen Grund duldete: weil man sie brauchte. Wenn ein Fischer eine Hand an einen Drachenrochen verloren hatte oder eines der Kinder auf eine Brandqualle getreten war, rief man den Apotheker. Und der Apotheker tat das Einzige, was er tun konnte: Er verabreichte Colmin. Colmin als Salbe, Colmin als Trank, Colmin als Puder. Teofins Vater kannte sich besser mit Colmin aus als jeder andere in Colm. Und auch das konnten ihm die Fischer nur schwer verzeihen.
Ein unterdrücktes Stöhnen drang aus der Mischstube zu ihnen hinaus, und Pessa bedeutete Teofin, ihr in die Wohnstube zu folgen. »Na komm. Das Essen ist längst fertig.«
Teofin achtete darauf, sein linkes Bein so wenig wie möglich zu belasten, während er zu seinem Platz am Esstisch ging. Er hatte keinen Hunger. Hatte keinen Hunger, obwohl er sich den halben Tag aufs Abendbrot gefreut hatte. Hatte keinen Hunger, obwohl er Möhren besonders mochte, lieber noch als Kartoffeln oder Kohl. Und trotzdem wäre es ihm ein Leichtes gewesen, auf sie zu verzichten, wenn er im Gegenzug in sein Zimmer hätte gehen dürfen. Dieser Abend war keiner, um sich zu unterhalten, sondern einer, an dem man sich ins Bett legen, einschlafen und vergessen wollte, dass er überhaupt je stattgefunden hatte.
»Hat Freya euch wieder nicht gehen lassen?«, fragte Pessa und stellte einen Teller vor Teofin auf den Tisch.
»Wenn sie könnte, würde sie die ganze Nacht reden.«
Teofin schob seine Möhren von einem Tellerrand zum anderen. In vermutlich jedem anderen Haus Colms wurde an diesem Abend Reisbrei aufgetischt. Aber die Familie des Apothekers hatte schon immer besser gegessen als die meisten anderen in Colm. Im Garten hinter ihrem Haus wuchsen nicht nur Zwiebeln, sondern auch Möhren und Äpfel und Kohl und sogar Beeren. Oft genug hatte Teofin die Fischersfrauen tuscheln hören, dass seine Mutter wohl in der Alten Sprache auf die Erde einrede, bis die alles hervorbrächte, was das Herz begehrte. Teofin, der Sommer um Sommer an den Bottichen stand und dem Geschwätz der Fischersfrauen lauschte, hatte längst verstanden, dass es Freya und Sige, Agnes und Roven weniger um den Garten seiner Mutter ging, als um ihr blondes Haar, ihre klaren blauen Augen, ihre besondere Art zu sprechen, immer in einem leichten Singsang, der die Worte nur so ineinanderfließen ließ. Die Fischersfrauen gaben vor, Pessa nicht zu verstehen, schüttelten bloß missmutig den Kopf, wenn sie ihnen eine Frage stellte oder sie grüßte.
»Ich dachte, dass du vielleicht Edda mitbringst. Ich wollte ihr ein paar unserer Zwiebeln mitgeben«, sagte seine Mutter nun und setzte sich zu ihm an den Tisch.
Statt zu antworten, spießte Teofin eine Möhre auf und schluckte sie geräuschvoll. Obwohl seine Mutter eine gute Köchin war, schmeckte er nichts.
»Hast du sie heute nicht gesehen? War sie nicht beim Fischhaus?«
»Doch, sicher. Wo sollte sie sonst gewesen sein?«
Stumm fuhr er fort, Möhren aufzuspießen und zusammen mit dem Brot hinunterzuschlingen. Sobald er den Teller geleert hatte, sprang er auf. Schnell, bevor ihm seine Mutter weitere Fragen stellen konnte, brachte er das dreckige Geschirr zum Waschzuber. »Ich kann kaum noch stehen, ich muss mich hinlegen«, erklärte er barsch und übertrieb sein Hinken, damit sie ihn gehen ließ.
Aber schon auf der Treppe musste er niemandem mehr etwas vorspielen. Schwer schleifte sein linkes Bein über die Stufen. In seinem Zimmer angelangt, ließ er sich aufs Bett fallen. Jeder Muskel in seinem Bein schien wütend zu sein. Er schloss die Augen, lauschte auf die Geräusche im Haus. Unten hörte er Jeppe und seinen Vater, wie sie sich im Flur unterhielten. Dann wurde die Haustür geöffnet und wieder geschlossen, kurz darauf erklangen die gedämpften Stimmen seiner Eltern. Sicher sprachen sie über ihn, über sein Bein, seine Schweigsamkeit. Er strich über sein Hosenbein, spürte den verkrampften Muskel darunter deutlich, wie etwas, das nicht zu ihm gehörte, einen Stein oder ein Holzstück in der Haut. In dem Muskel selbst lauerte der Schmerz, ein Kreischen, ein Heulen, ein unerträglich hoher Ton. Wenn zumindest in seinem Kopf Ruhe gewesen wäre, aber auch dort tobten die Gedanken. Hatte Edda bemerkt, dass er ihr aus dem Fischhaus gefolgt war? Wusste sie, dass er alles gesehen hatte – das Blut auf Tobins Stirn und Hans Piel, der die Lippen spitzte und spuckte? Er hatte ihr zu Hilfe eilen wollen, das hatte er wirklich. Sein linkes Bein, das zornige, krumme, hatte sich gehoben, bereit gemacht für den ersten schweren Schritt. Doch statt zu Tobin und Edda zu laufen, hatte er den Fuß einfach wieder abgesetzt, gleich neben den rechten. Stehen geblieben war er und schließlich ganz zurückgewichen. Und während Edda mit Tobin gesprochen hatte, war er unbeobachtet über den Platz und in die Nordgasse gehumpelt, um sich dort hinter Alfs Schuppen zu verstecken. Er sah Edda noch immer vor sich, er sah sie vor sich, wie sie über das Pflaster flog und ihre Füße den Boden nur anzutippen schienen, so als müssten sie kein Gewicht tragen. Einmal laufen wie Edda, dachte er, und unter seinen Rippen brannte es. Und dann war das Brennen in seinem Kopf, eine weiße Wut, und bevor er wusste, was er tat, ballte er die Hand zur Faust und schlug auf seinen Oberschenkel. Das verdammte Bein! Das verdammte Bein, es würde dafür sorgen, dass er eines Tages wie Samuel, der Krüppel, endete. Er schlug ein zweites Mal zu, und der Schmerz ließ ihn keuchen, beinahe im selben Moment, da er Schritte draußen auf dem Flur hörte. Er presste die Lippen zusammen. Zu spät, die Schritte waren unmittelbar vor seiner Tür verstummt. Es klopfte, und bevor er seine Mutter hereinbitten oder hätte fortschicken können, öffnete sich die Tür, und sie trat ein.
Er starrte an die Decke, so als würde er sie nicht bemerken. Hatte sie nicht schon unten in der Wohnstube gemerkt, dass er nicht mit ihr sprechen wollte? Aber Pessa Bornholm konnte hartnäckig sein. Kein Geheimnis, das sie ihm nicht entlocken, keine Lüge, die sie nicht früher oder später aufdecken würde. Vorsichtig darauf bedacht, sein Bein nicht zu berühren, setzte sie sich neben ihn aufs Bett. Teofin drehte den Kopf zur Seite.
»Hattest du Ärger mit Hans und den anderen?«
Er nickte, das Gesicht noch immer abgewandt.
»Sind sie dir wieder nachgelaufen?«
»Mir nicht.«
»Sondern?«
»Tobin.« Er murmelte den Namen wie ein Geständnis. Seit Wochen schon hatten die Jungen es auf Eddas Bruder abgesehen, und nicht zum ersten Mal hatte Teofin es bemerkt. Nicht zum ersten Mal wäre er Tobin beinahe zu Hilfe geeilt. Beinahe. Immer nur fast. Nie tatsächlich.
»Ich hab sie gesehen, Tobin und die anderen Jungen, aber geholfen habe ich nicht.«
Das Bett knarrte, als seine Mutter ihr Gewicht verlagerte.
»Und Edda? Wo war Edda?«, fragte sie sanft.
»Edda, sie war …«
Bei Tobin. Dort, wo er hätte sein sollen. Stattdessen hatte er sich versteckt. Schlimmer noch: Während er am Schuppen gelehnt hatte, da war er erleichtert gewesen. Erleichtert, dass der Stein nicht ihn getroffen hatte. Erleichert darüber, dass die Jungen ihn in Frieden ließen, seitdem sie es auf Tobin abgesehen hatten.
»Teofin, du hättest es wahrscheinlich nur schlimmer für ihn gemacht. Warten wir ab, was geschieht, wenn Ruben von dem Vorfall hört. Wenn er mit Jeppe und Bent spricht …«
»Als ob es einen Unterschied machen würde!«, schnappte Teofin.
Wussten sie nicht beide, dass auch Ruben seinen Sohn nicht beschützen konnte? Die Fischer mochten noch so viel auf sein Wort geben, sie alle waren sich einig: Edda und Tobin hatten in Colm nichts verloren; Ruben hätte sie niemals bei sich aufnehmen sollen.
Seine Mutter drehte den schmalen Kupferring, den ihr Teofins Vater zur Verlobung geschenkt hatte. Drehte ihn eine Spur zu schnell. »Was hältst du davon, wenn wir noch in die Kapelle gehen?«
Überrascht sah Teofin auf. Um zur Kapelle zu gelangen, mussten sie durchs halbe Dorf laufen, und auf ihrem Rückweg würde die Silbersee die Sonne längst geschluckt haben.
»So spät noch?«
Seine Mutter zuckte die Achseln. »Du brauchst Ruhe. Und es gibt keinen besseren Ort als die Kapelle, um Ruhe zu finden. Es wird dir guttun.«
Teofin runzelte die Stirn. Seinem Bein würde weder die Kälte noch der lange Weg guttun, ihm stand der Sinn eher nach heißem Tee oder warmen Wickeln. Trotzdem stand er widerstandslos auf. Seine Mutter hatte oftmals eigene Vorstellungen davon, was für andere Menschen gut war, und nicht selten lag sie richtig.
Draußen war es so kalt, dass sie noch einmal zurück ins Haus gehen mussten, um Handschuhe zu holen. Die Kaltwochen waren dafür bekannt, dass sie erst dann über die Küste hereinbrachen, wenn der Winter sich endgültig zurückgezogen zu haben schien, und obwohl sie so zuverlässig wie der Sonnenuntergang am Ende des Tages waren, hoffte Teofin jedes Jahr auf ein Wunder. Doch schon am Morgen, als er aufgewacht war, hatte ein eisiger Reif wie eine feine Schicht pudrigen Zuckers auf der Fensterbank gelegen.
In der Kleinen Ostgasse begegneten sie zunächst niemandem. In den meisten Häusern brannte nicht einmal mehr Licht. Doch als sie in die Westgasse bogen, kam ihnen Hensy Moots Mutter Stine entgegen. Auch sie musste noch in der Kapelle gewesen sein. Pessa hob die Hand zum Gruß, Stine Moot aber eilte weiter, als hätte sie es nicht bemerkt.
So verlassen wie die Straßen waren, zeigte sich auch die Kapelle. Widerstrebend folgte Teofin seiner Mutter zwischen den Bänken hindurch, um auf der vordersten Platz zu nehmen. Er fröstelte. Gleich, wie kalt es draußen war, in der Kapelle war es immer noch eine Spur kälter. Der eisige Wind fand einen auf jeder der Bänke. Noch schlimmer als der Wind und die klamme Kälte aber waren Agatha und Lor. Wer auch immer die Heiligen Schwestern angefertigt hatte, ein geschickter Kunsthandwerker war er nicht gewesen. Ihre Münder waren Wölbungen, ihre Augen ungefähre Ausbuchtungen. Als wären sie blind, gleichzeitig aber schienen sie einen zu beobachteten, spürten einen genau wie der Wind auf, gleich, auf welcher Bank man sich niederließ.
»Warum sind wir so oft hier?«, flüsterte Teofin. »Du glaubst doch nicht einmal an Agatha und Lor.«
»Oh, aber sicher tue ich das. Ich glaube nur nicht, dass sie ins Meer gegangen sind, um sich für diesen Ort zu opfern. Niemand würde ins Meer gehen, um sich für Colm zu opfern.«
Während seine Mutter sprach, sah sie nicht Teofin an, sondern die steinernen Mädchen auf ihrem Altar. Teofin wusste wenig darüber, wie seine Mutter aufgewachsen war. Sie sprach nie über Klammtal. Sicher hatte man sich auch dort Geschichten wie die von Agatha und Lor erzählt, sicher hatte es auch dort eine Kapelle gegeben und etwas, einen Mensch, ein Tier, ein einäugiges Ungeheuer, das auf einem Altar stand, doch falls seine Mutter die Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend noch immer in ihrem Herzen trug, fanden sie nie den Weg auf ihre Zunge.
»Und trotzdem betest du zu ihnen?«
»Natürlich. Manchmal bete ich auch zu den Sternen oder zu den beiden Fischen draußen auf dem Dorfplatz. Ich bete darum, dass sie dich und Edda und Tobin während der Kaltwochen beschützen.«
Sie legte ihre Hand auf seine und drückte zu. Wollte er ihren Trost überhaupt? Vielleicht wäre es leichter gewesen, wenn sie ihm Vorhaltungen gemacht hätte. Trotzdem zog er seine Hand nicht zurück.
»Erzählst du mir die Geschichte von Agatha und Lor?«, fragte sie.
»Du kennst die Geschichte.«
»Ja. Aber ich mag es, wenn du sie mir erzählst.«
Teofin starrte den Altar an, versuchte, nicht an Edda, an Tobin, an Hans Piel und das Blut und die Spucke zu denken. Die Geschichte von Agatha und Lor, warum nicht? Jede Geschichte, die sich vor Dutzenden Jahren zugetragen hatte, war besser als jene, die sich im Hier und Jetzt abspielten.
»Es war das Jahr, in dem eine große Flut bevorstand«, begann er. »Im Dorf lebte eine Hexe, und sie wusste von der Flut, weil ihr die Möwen davon erzählt hatten, und sie wusste auch, was getan werden musste, um sie abzuwenden. Wenn die Bewohner Colms nicht allesamt ertrinken wollten, mussten sich zwei ihrer Kinder opfern und hinaus in die Silbersee gehen.« Teofin spürte, dass Agatha und Lor ihn aufmerksam beobachteten. »Keines der Kinder Colms konnte schwimmen, und jeder im Dorf wusste, dass sie ertrinken würden. Dennoch erklärten sich zwei Schwestern bereit, ihr Leben für Colm zu opfern.«
»Agatha und Lor.« Pessas Stimme klang schläfrig.
»Agatha und Lor. Die Hexe färbte ihre Gewänder in tiefem Rot.«
»Farbe des Blutes, Farbe des Feuers«, murmelte Pessa.
»Farbe des Blutes, Farbe des Feuers«, wiederholte er ergeben. Es war das einzige Gebet, das er kannte.
»Und dann am Morgen des Mittsommerfests versammelte sich das ganze Dorf unten am Strand. Alle waren gekommen, jeder Fischer und jede Fischersfrau und all ihre Kinder – auch die Schwestern Agatha und Lor in ihren roten Kleidern.«
Er verstummte, und als er nicht fortfuhr zu sprechen, zupfte Pessa an seinem Ärmel. »Und dann?«
»Dann ertranken Agatha und Lor, und die große Flut kam nicht, und deswegen beten wir noch heute zu den Heiligen Schwestern«, sagte Teofin schnell. Er mochte das Ende der Geschichte so wenig wie die Geschichte selbst. Es war überhaupt keine tatsächliche Geschichte, fand er. Da fehlte etwas; das Schicksal der beiden Schwestern müsste sich im letzten Wimpernschlag wenden, sie von der barmherzigen See doch noch verschont oder durch einen unwahrscheinlichen Vorfall gerettet werden.
Stumm betrachteten Mutter und Sohn die steinernen Mädchen auf dem Altar.
Stumm sahen Agatha und Lor zurück.
Edda konnte nicht länger als ein paar Stunden geschlafen haben, als der schwere Klang der Messingglocke sie weckte. Tagsüber wurde die große Glocke aus allen möglichen Gründen geläutet: Weil die Fischer mit Netzen voller Colminfische nach Hause gekehrt waren, weil Freya wollte, dass sich die Frauen und Mädchen am Fischhaus versammelten, weil gearbeitet werden musste, weil eine Versammlung anstand. Nachts aber, nachts schlug sie nur aus einem einzigen Grund.
Einen Moment saß Edda reglos in ihrem Bett. Hatte sie das Läuten tatsächlich gehört oder bloß geträumt? War die Nacht, auf die sie seit Tagen gewartet, gelauert, die sie gefürchtet und gleichzeitig herbeigesehnt hatte, gekommen? Ein zweites Mal erfüllte der dumpfe Laut ihr Zimmer, und Edda stand auf, rannte zur Tür und hinaus auf den Flur.
Auch Tobin musste der Glockenschlag geweckt haben, denn er stand bereits vor seinem Zimmer, die Augen klein, das Haar noch wirr vom Schlaf. Mit drei schnellen Schritten war sie bei ihm und zog ihn an sich. Er war hier, bei ihr. Wegen der Puppen, wegen der geflüsterten Gebete, weil Agatha und Lor es so wollten, oder aus Gründen, die Edda nie würde verstehen können und die auch kaum einen Unterschied machten. Er war hier, und auch wenn die Jungen ihn weiter quälen mochten, wenn Freya weiter mit ihnen schimpfte und Ruben weiter ratlos die Achseln zuckte, würde sich daran für ein ganzes Jahr nichts ändern.
Sie hob nicht den Kopf, als sich die Tür zu Rubens Schlafkammer öffnete und ihr Ziehvater hinaustrat. Alle drei standen sie im Flur, und keiner bewegte sich, und keiner sagte etwas, während die Glocke ein drittes Mal schlug. Erst als das Läuten ganz verstummt war, löste Ruben sich aus seiner Starre.
»Zieht euch an«, sagte er. Mehr nicht, mehr hatte er nie gesagt, auch in den Jahren zuvor nicht. Aber als er an Tobin vorbeiging, legte er ihm kurz eine Hand auf die Schulter, und Edda sah, dass sie zitterte.
Edda war sechs Jahre alt gewesen, als das erste Kind verschwand, ein Junge namens Jonas, über den sie wenig wusste und an den sie sich nun, Jahre später, kaum erinnern konnte. Auch über sein Verschwinden wusste sie so gut wie nichts. Tobin und sie waren erst wenige Wochen zuvor nach Colm gekommen, und Ruben hatte sein Möglichstes getan, um sie aus dem Geschehen herauszuhalten. Vermutlich hatte man sich auch damals nachts auf dem Dorfplatz getroffen, vermutlich war man auch damals mit Fackeln durch die Straßen gezogen, um nach dem Jungen zu suchen. Und anders als in den Jahren, die folgen würden, hatte man wohl geglaubt, dass man ihn finden würde.
Man fand ihn nicht.
Nicht in der Nacht seines Verschwindens und auch nicht in den Tagen, den Wochen, den Monden, die folgten.
Edda wusste nicht, welche Geschichten man sich damals in den ersten Tagen erzählt hatte, ob man sich überhaupt Geschichten erzählt hatte. Etwas wie Jonas’ Verschwinden war in der Geschichte Colms noch nie vorgekommen, und so hielt keiner für möglich, dass auf Jonas weitere Kinder folgen könnten. Doch der Sommer verstrich, der Herbst und der Winter, und pünktlich zum Einbruch der nächsten Kaltwochen verschwand ein Mädchen namens Karla.
Den Kindern erzählte man nun, Jonas und Karla seien fortgelaufen, um die Städte, die Berge und Wälder Farlands zu sehen. Aber nicht einmal die Jüngsten waren tumb genug, um es zu glauben. Warum hätten Jonas und Karla sich beide ausgerechnet zur Zeit der Kaltwochen aufmachen sollen? Warum hätten sie sich überhaupt aufmachen sollen? Genau wie ihre Väter und Mütter fürchteten die Kinder die Welt jenseits Colms. Sie misstrauten der See und dem Land gleichermaßen, sie misstrauten auch den Wäldern, den Bergen, den Städten Farlands, ja sogar das nahe liegende Maunland war ihnen nicht geheuer.
Und schon bald erzählte man sich eine andere, düsterere, aber unendlich viel wahrscheinlichere Geschichte. Die Kinder waren verschwunden, weil die See selbst sie sich geholt und sie zu Seekindern gemacht hatte. Eines ihrer Geschöpfe hatte die See geschickt; vielleicht war es auf zwei Beinen aus der schäumenden Gischt gestiegen, vielleicht hatte es seinen glatten, schweren Leib über den Strand geschleift, vielleicht war es geglitten, gekrochen, geflogen. Wie auch immer es seinen Weg bis ins Dorf zurückgelegt hatte, niemand war ihm begegnet, niemand hatte es gesehen.
Jahr um Jahr gingen die Mütter der Seekinder hinunter zum Strand, um die Blicke über die See schweifen zu lassen. Dort draußen vermuteten sie ihre Kinder. Und jeden Tag erwarteten sie, dass das Meer sie ihnen zurückgeben würde, so wie es früher oder später alles wieder zurückgab, wie ein geschuppter Seedrachen seine Schätze ausspuckte, Holzplanken und zerfetzte Segel und leere Truhen und die bleichen Knochen der Fischer, die irgendwann über Bord gegangen und viele Monde lang verschollen geblieben waren.
Irgendwann in den Jahren, die folgten, begann man, die Türen der Häuser rot anzumalen und kleine Puppen aus Holz zu schnitzen. Doch gleich, wie wachsam die Mütter, die Väter, die Brüder und Schwestern waren, in jedem Jahr verschwand ein weiteres Kind. Und niemand hatte Jonas oder Karla oder irgendeines der anderen sieben Kinder um Hilfe rufen hören. Es gab keine eingeschlagenen Fenster, keine aufgebrochenen Türen, keinen verdächtigen Fremden, der während der Tage zuvor durchs Dorf geschlichen und den Bewohnern aufgefallen war, kein Boot, das sich vom Reich der Inseln genähert, kein geschupptes Ungetüm, das sich vom Strand bis nach Colm geschleppt hatte. Es gab keine Spur, und es gab keine Hinweise. Stets war es so, als habe sich ein Spalt in der Luft oder im Boden aufgetan, um die Jungen und Mädchen zu schlucken.
***
Ruben, Edda und Tobin gehörten zu den Letzten, die auf dem Dorfplatz eintrafen. Unruhig suchten Eddas Augen das Gedränge ab, erspähten Hans und seine Eltern, Freya und Ilsa, Samuel, den Krüppel, den langen Ulf, Muriel, Keva und Jost. Während ihre Augen über die Köpfe hinwegflogen, war es, als ob sich ihre Rippen langsam zusammenzögen, ihr Herz, ihre Lungen, ihren Magen fester fassten. Wo war Teofin? Wo waren Pessa und Tomas? Waren sie noch nicht gekommen, oder konnte Edda sie nicht sehen, weil …
»Er steht dort drüben mit seinen Eltern, bei Bent«, sagte Ruben.
Edda atmete ein. Atmete aus. Tagelang hatte es nicht genug Luft für sie gegeben. Ob sie lief, saß, stand oder lag, sie hatte um jeden Atemzug ringen müssen. Und nun, mit einem Mal, als hätte da jemand einen Knoten gelockert, eine fest verschlossene Tür geöffnet, rauschte die Luft in ihren Körper hinein, so schnell, dass ihr schwindelte. Sie taumelte. Atme!, befahl sie sich, während ihre Augen von Teofin zu Tobin wanderten und wieder zurück.
Als der Schwindel nachließ, stellte sie sich auf ihre Zehenspitzen, um zwischen den Köpfen der anderen hindurchsehen zu können, wer neben Bent vor den Goldenen Fischen stand.
Es war Stine Moot.
»Kannst du etwas sehen? Kannst du sehen, wer es ist?« Fragend sah Tobin zu ihr auf.
»Ich glaube …«
Bent schlug mit einem Stock gegen die Goldenen Fische, und das Gemurmel auf dem Platz verstummte.
»Stine Moots Sohn Hensy ist heute Nacht verschwunden«, erklärte er.
Auf dem Platz war es so still, dass man einen Angelhaken hätte fallen hören können. Bent wandte sich Stine Moot zu. »Erzähl uns, was passiert ist, Stine.«
Die Menge rückte näher heran. Hälse wurden gereckt, Ohren wurden gespitzt. Aber wie in all den Jahren zuvor gab es im Grunde nichts zu erzählen. Stine Moot war spät am Abend noch einmal zur Kapelle der Heiligen Schwestern gegangen, um für Hensy zu beten, und als sie nach ihrer Rückkehr einen Blick in sein Zimmer geworfen hatte, war sein Bett leer gewesen.
»Ich habe ihn im ganzen Haus gesucht, aber ich …«, sagte sie und sah zu Pelle auf, so als hoffe sie, dass ihr Mann ein anderes Ende für die Geschichte finden würde als jenes, das sie bereits kannte.
Während Stine Moot sprach, sah Edda hoch zum Glockenturm, wollte Hensy Moots Mutter nicht angaffen, so wie die anderen auf dem Platz. Wieso musste die eigene Erleichterung immer bezahlt werden von einer Frau mit aschgrauer Haut, mit abwesendem Blick und Händen, die aus nichts als roten Fingerknöcheln zu bestehen schienen? Edda dachte an Tobin, an Teofin, an den Sommer, der bevorstand und an den sie bis zu diesem Moment mit keinem einzigen Gedanken, mit keiner Erwartung oder Hoffnung zu rühren gewagt hatte. Erst als Ruben ihr eine Hand auf die Schulter legte, schreckte sie auf.
»Es geht los, Edda«, sagte er.
Stillschweigend setzten sich die Männer, Frauen und Kinder in Bewegung. Ohne dass Bent oder ein anderer Fischer ihnen hätte sagen müssen, was zu tun war, teilten sie sich auf. Freya, Sige und Roven gingen ins Fischhaus, um dort auf jene Kinder aufzupassen, die noch zu klein waren, um an der Suche teilzunehmen. Der Rest der Versammelten spaltete sich in drei Gruppen auf. Die erste, angeführt von Bent, würde hinunter zum Hafen laufen, die zweite, angeführt von Rolf, die Häuser durchsuchen, die dritte, angeführt von Ruben, zum Strand gehen und mit der Hexe Maron sprechen. Rubens Gruppe zog die wenigsten Freiwilligen an. Niemand wollte nachts hinunter zum Meer; niemand wollte an Marons Hütte klopfen.
»Bring Tobin rüber zu Freya und Sige«, sagte Ruben zu Edda, während er Jeppe durch Handzeichen zu verstehen gab, dass er bereit war.
»Können wir Tobin nicht mitnehmen?«, flüsterte Edda zurück.
Ruben schüttelte den Kopf. »Für ihn ist es sicherer, wenn er bei Freya bleibt.«
Edda öffnete den Mund, um zu widersprechen. Ruben aber machte bereits einen ersten Schritt in die nachtdunkle Gasse, die hinunter zum Hafen führte. Die Entscheidung war getroffen, und Ruben konnte seine Ohren schließen wie andere Menschen ihre Augen.
Widerstandslos ließ Tobin sich von Edda zu Freya und den anderen bringen. »Pass auf, dass du in Samuels Nähe bleibst«, flüsterte sie ihm zu. »Und halt dich von Hans und den anderen fern.«
Während sie sich ihren Weg durch das Gedränge und zurück zu Ruben bahnte, meinte sie, mit jedem Schritt spüren zu können, wie sich ihre Rippen wieder fester um ihre Lungen schlossen.
Stine und Pelle Moot, Edda und Teofin, Teofins Eltern und sechs weitere Männer und Frauen schlossen sich gemeinsam mit Ruben Bents Gruppe an und gingen zum Hafen. Während Bents Männer ausströmten, um die Stege und anliegenden Boote abzusuchen, lief Rubens Trupp die rutschigen Holzplanken hinunter zum Strand. Als hätte die Silbersee nur darauf gewartet, dass sich jemand nahe genug heranwagte, stieg Seenebel auf, kaum dass der Letzte der Gruppe seinen Fuß auf sandigen Untergrund gesetzt hatte. Die Fackeln der am Hafen zurückgebliebenen Fischer schrumpften zu matten Lichtpunkten zusammen, Colm selbst verschwand hinter weißen Schwaden.
Schweigend legten sie ihren Weg über den Strand zurück. Schon nach wenigen Schritten waren Edda und Teofin hinter den anderen zurückgefallen. Wenn Edda den Kopf ein wenig drehte und der Brandung lauschte, konnte sie das Meer flüstern hören. Es erzählte etwas von Hensy, den Seekindern, den Kaltwochen, der Zukunft und von Edda selbst. Aber immer, wenn sie glaubte, einzelne Worte verstehen zu können, zersetzten sie sich im Rauschen, lösten sich auf im Schaum der Gischt.
»Edda.« Teofin boxte sie leicht in die Schulter. »Was ist da drüben? Siehst du Seegespenster?«
Er lachte, aber sein Lachen passte nicht zu dem Ausdruck in seinem Gesicht. Er war nicht gerne unten am Strand, nicht tagsüber, wenn die Sonne schien, und sicher nicht nachts, wenn der Seenebel die Grenzen zwischen Land und Wasser verschwinden ließ.
Edda zuckte die Achseln. Sie hätte weder ihm noch sich selbst erklären können, warum sie glaubte, dass die Silbersee ihr etwas erzählte. Was sollte das Meer ausgerechnet Edda über die Inseln und ihre Geheimnisse zuraunen wollen?
Je näher sie der Hütte kamen, umso langsamer wurde die Gruppe. Alle im Dorf fürchteten sich vor der Hexe. Ilsa behauptete, Maron esse nichts anderes als Schlangensuppe und dass sie eines grauen Wintermorgens wie ein Aal aus dem Meer gekrochen sei und sich erst am Strand in einen Menschen verwandelt habe. Auch wenn Edda Ilsa noch nie eine ihrer Geschichten geglaubt hatte, ging sie Maron aus dem Weg. Etwas an der Art, wie die Hexe sie bei ihren seltenen zufälligen Begegnungen im Dorf ansah, stieß Edda quer. Die Hexe hatte kaum mehr als einen flüchtigen Blick übrig für die Kinder, die sich hinter Schuppen oder Mauern vor ihr versteckten, sie hob nicht einmal den Kopf, wenn ein Fischer oder eine Frau ihren Weg kreuzten. Edda aber hatte über die Jahre hinweg immer wieder bemerkt, wie Maron sie musterte.
Vor Marons Hütte rückten sie alle ein wenig dichter zusammen. Edda spürte, wie sich Teofins Oberarm gegen ihren presste, und sah, wie Tomas nach Pessas Hand griff und sie kurz drückte. Damals, als der erste Junge verschwunden war, hatten alle im Dorf die Hexe verdächtigt. Von Ruben wusste Edda, dass Marons Hütte durchsucht und die Hexe selbst für drei Tage in den Keller des Fischhauses gesperrt worden war. Erst als eine der Frauen gestand, in der Nacht von Jonas’ Verschwinden wegen eines Tranks bei Maron gewesen zu sein, ließ man sie wieder frei.
Obwohl vermutlich niemand in Colm glaubte, dass Maron etwas mit Hensys Verschwinden zu tun hatte, fanden sie sich auch in diesem Jahr wieder vor ihrer Hütte ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie Hensy dort antreffen würden, war schließlich genau so groß – oder vielmehr: genau so gering – wie die, dass man ihn in einem der Boote oder in der Kapelle fand.
Wie in jedem Jahr war es Ruben, der an die Tür der Hexe klopfte. Die anderen, selbst Stine und Pelle Moot, achteten darauf, einige Schritte Abstand zu halten. Nur wenige Augenblicke verstrichen, bevor Maron ihnen öffnete.
»Maron, wir suchen Hensy Moot. Er ist heute Abend verschwunden«, erklärte Ruben.
»Hier ist kein Kind«, antwortete die Hexe, so wie sie es in jedem Jahr tat. »Hier sind bloß Wasserratten, Meerkrebse und Möwen. Die könnt ihr mitnehmen.«
Ihre Augen wanderten über die Köpfe der Frauen und Männer, die vor ihr standen, hinweg, den Strand hinunter zur Silbersee und weiter in jene meilenweite Finsternis, in der sich die erste Insel verbarg und alle Inseln dahinter. Und während Edda die Hexe musterte, da stieg etwas in ihr auf, ähnlich wie der Seenebel, ein schleichender Verdacht: Die Hexe wusste etwas, etwas, das sie für sich behielt.
»Vielleicht ist er ins Meer gegangen«, murmelte Maron. Dann zuckte sie die Achseln und schloss die Tür.
Hensy Moot war nicht ins Meer gegangen.
Maron wusste es, und Edda wusste es, und Ruben und Teofin und alle Fischer und alle Fischersfrauen wussten es auch. Denn sie alle misstrauten dem Meer und lehrten ihre Kinder, es ebenfalls zu tun. Kein Kind Colms wäre auf die Idee gekommen, in der Brandung zu spielen – sicher nicht während der Kaltwochen.
Hensy Moot war nirgendwo hingegangen.
Jemand hatte ihn zu sich geholt. Und wer immer es war, ob er aus dem Landesinneren, Maunland oder Klammtal gekommen war, ob er aus Colm selbst stammte oder von einer der Inseln, die sich wie Sprenkel durch die Silbersee zogen – im nächsten Jahr würde er wiederkommen.
In den Jahren zuvor war es immer dasselbe gewesen: Ein Junge oder Mädchen war verschwunden, bleierne Ergebenheit hatte sich über die Menschen Colms gesenkt, und die Kaltwochen hatten ihr Ende gefunden. Mit dem Feuerfest verabschiedete man die dunklen, kalten Tage und begrüßte das Frühjahr. In diesem Jahr aber war die Ordnung aus dem Lot, die Abfolge aus den Fugen geraten. Noch lag Eis in der Luft und Nebel im Wasser. Der Himmel schien, als hielte er noch Regen und Schnee für das ganze Jahr bereit, und die Nacht von Hensy Moots Verschwinden war die kälteste seit Langem. Unter ihren Wolldecken zitterte Edda; die Beine eng an den Körper gezogen träumte sie von Schnee und Eis.
Am Morgen verkündete Ruben gleich beim Frühstück, dass er hinunter zum Hafen gehen und Tobin mit sich nehmen werde. Tobin ließ den Löffel in die Schüssel sinken und warf Edda einen flehenden Blick zu. Sie gab vor, es nicht zu bemerken.
Als Ruben vom Tisch aufstand und für einen Augenlick in der Küche verschwand, rückte Tobin dichter an sie heran.
»Edda? Kannst du ihn nicht …?«


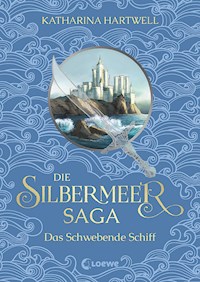
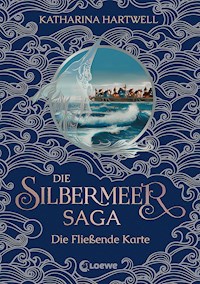














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










