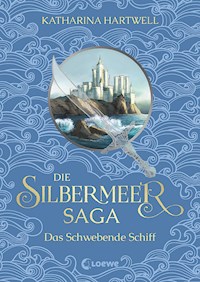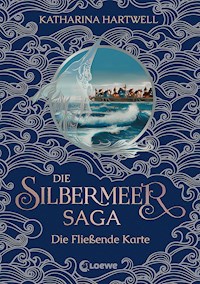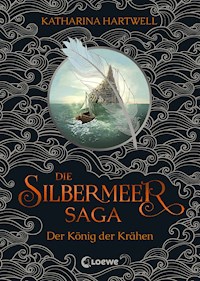19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Maren und Inga sind dreizehn, als sie über das Tennisspiel Freundinnen werden. Doch ist auch das keine echte Gemeinsamkeit, denn die Mädchen trennt ihre soziale Herkunft. »Große Lieben« verfolgt beider Leben von den 90er-Jahren bis in die Gegenwart – während die eine sich weiter in der Welt des Geldes bewegt, wird die andere Schriftstellerin. Mit Lakonie und viel Witz erzählt Katharina Hartwell davon, was es heißt, als Mädchen aufzuwachsen, über Identitätsfindung, patriarchale Strukturen und die schwierige Balance zwischen Selbstverwirklichung und Mutterschaft. »Katharina Hartwell erzählt mit herzzerreißender Komik und schonungslosem Scharfsinn. Ich wünschte, ich hätte dieses Buch als junge Frau lesen können. Es zählt schon jetzt zu meinen großen literarischen Lieben.« Isabelle Lehn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2025
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Barbara Hoogeweegen / Bridgeman Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
13
1. Pool
2. Tennis
3. Zuhause
4. Parasit
5. Perücke
6. Imagination
7. Wonder Street
8. Cola
23
1. Rückbank
2. Kitz
3. Generation
4. Ehre
5. Hilfe
6. Pampelmuse
7. Antwort
8. Los
33
1. Traum
2. Taxi
3. Rakete
4. Galle
5. Willen
6. Arena
7. Spiegel
8. Mami
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
13
1. Pool
Als Inga und ich uns das erste Mal verabredeten, sagte sie am Telefon, ich solle einen Badeanzug mitbringen. Sie hätten einen Pool zu Hause, sagte sie, und weil wir telefonierten und ich ihr Gesicht nicht sehen konnte, dachte ich, sie hätte einen Witz gemacht, und brachte keinen mit.
In Ingas Haus gab es aber tatsächlich einen Pool, außerdem eine Sauna, einen Induktionsherd, einen Crosstrainer, einen Fernseher, so groß wie eine Kinoleinwand, und eine Alarmanlage. Dann gab es noch zwei Zimmer, die nur Inga gehörten: das Kinder- und das Spielzimmer. Damals dachte ich lange darüber nach, was man wohl im Kinderzimmer machte, wenn man zum Spielen ins Spielzimmer ging.
Meine Mutter brachte mich zu meiner ersten Verabredung mit Inga. In den Jahren danach nahm ich den Bus oder das Fahrrad, aber zu unserer ersten Verabredung fuhr sie mich. Warum, weiß ich nicht genau. Ich war dreizehn und eigentlich schon zu alt, um von meiner Mutter irgendwohin eskortiert zu werden. Allerdings wohnten die meisten meiner Freunde fußläufig und waren meinen Eltern bekannt. Die Stroms wohnten nicht direkt in Hanau, sondern in einer der umliegenden noch kleineren Kleinstädte. Das könnte der Grund gewesen sein. Vielleicht aber war es auch bloß Neugier.
Wir hielten vor Ingas Haus, und meine Mutter sagte erst mal nichts. Stumm saßen wir im Auto und schauten uns um. Viel sehen konnte man nicht. Das Haus lag versteckt hinter einer hohen Buchsbaumhecke, einer Mauer, zwei Bäumen und einer Garage mit zwei Toren.
»Aha«, sagte meine Mutter dann. Irgendwie wusste ich, was sie damit meinte, und irgendwie wusste ich es nicht, traute mich aber auch nicht zu fragen.
In der Mauer war ein Tor, und neben dem Tor war ein Klingelschild, und auf dem Schild stand kein Name. Inga hatte mir Straße und Hausnummer genannt und am Telefon gesagt, dass ich mir beides merken müsse. Ich verstand nicht, warum es den Stroms so wichtig war, dass niemand wusste, dass sie in diesem versteckten Haus lebten. Ihre Vorsicht hatte wohl etwas mit ihrem Geld zu tun, aber hätten mögliche Einbrecher nicht alleine wegen der Lage des Hauses wissen können, dass sich hier ein Einbruch lohnte? Welchen zusätzlichen Erkenntnisgewinn würden sie aus dem Namen Strom ziehen? Kurz zuvor hatte ich im Fernsehen einen Bericht über das Leben der Hollywoodstars gesehen, die nicht in Häusern wohnten, sondern in mansions. Ihre Namen standen nie neben dem Eingangstor, und man brauchte einen Experten, jemanden, der sich in Hollywood auskannte, wenn man einen bestimmten Star in seiner mansion aufspüren und fotografieren wollte. Wie auch immer, die Stroms waren bloß die Stroms, und ich hätte gern den gesehen, der sie aufspüren und fotografieren wollte.
Ein Summton erklang, aber wir reagierten nicht schnell genug und rüttelten zu spät an dem Tor. Meine Mutter klingelte ein weiteres Mal, und als es wieder summte, rissen wir das Tor auf und stürmten hindurch. An der Garage vorbei ging es durch einen Vorgarten zum Haus, das groß war, aber, soweit ich es beurteilen konnte, keine mansion. Ingas Mutter öffnete die Tür. Inga war klein, kleiner noch als ich, und ihre Mutter war klein, kleiner noch als meine Mutter. Sie tat mir leid. Bis ich sie besser kennenlernte, tat sie mir immer leid. Sie war nicht schön wie meine Mutter und wusste nichts aus sich zu machen. Sie kleidete sich auf eine unbeholfene Weise, wie ich fand. Lange Zeit dachte ich, sie hätte keinen Geschmack, aber heute weiß ich, dass ich es war, die keinen Geschmack hatte. Ingas Mutter war elegant, zu elegant für Hanau, elegant auf eine ganz bestimmte mondäne Art, die mir nichts sagte, weil ich ihr so noch nie begegnet war und sie nicht einzuordnen wusste. Oft trug sie weiße Blusen, die asymmetrisch geschnitten waren oder über ein bestimmtes, auffallendes Detail verfügten, einen ungewöhnlich breiten oder aber schmalen Kragen, speziell geformte Knöpfe oder vermeintlich sinnlose Raffungen im Stoff. Zu besonderen Anlässen sah man sie in voluminösen, dunklen Kleidern, die an Säcke oder Ballons erinnerten und ihre Taille nicht betonten. Von meiner Oma, die einmal Schneiderin gewesen war, hatte ich gelernt, dass Frauen immer ihre Taille betonen sollten. Es sei denn, sie hatten keine. Dann mussten sie sich auf andere Vorzüge besinnen. Zur Not die Knöchel.
Noch merkwürdiger als Frau Stroms Kleidung war ihr Haar. Es saß auf ihrem Kopf wie ein silbern glänzender Helm; in seiner Beschaffenheit hatte es nichts gemein mit der Art Haar, die ich bisher auf den Köpfen anderer Leute hatte wachsen sehen. Es wirkte künstlich. Seine Farbe, seine Struktur, der akkurate Schnitt. Scharfe Kanten über blassen Augenbrauen, neben den Schläfen, über den Schultern.
Ingas Mutter und meine Mutter begrüßten sich und tauschten ein paar Floskeln. Ich dachte, dass Frau Strom sie hereinbitten würde, so wie die Mütter meiner anderen Freundinnen es getan hätten, aber sie blieb in der Tür stehen, mitten in der Tür, als müsste sie darauf achten, dass niemand sich an ihr vorbei ins Haus schlich. Wahrscheinlich war es meiner Mutter ganz recht so. Sie mochte Ingas Mutter nicht. Meiner Mutter konnte man immer ganz genau ansehen, ob sie jemanden mochte oder nicht. Das hatte ich von ihr, auch mir konnte man alles immer ansehen, und manchmal war es ein Vorteil, meist aber nicht.
Ingas Mutter, vermutete ich, mochte meine Mutter ebenfalls nicht. Aber das war bloß eine Vermutung, denn Ingas Mutter war das genaue Gegenteil meiner Mutter; man konnte ihr überhaupt nichts ansehen. Sie hätte von einer Affäre ihres Mannes erfahren können oder dass sie selbst an einer tödlichen Krankheit litt oder dass ein Trickbetrüger sich mit ihrem gesamten Vermögen davongemacht hatte, man hätte es ihr nicht angesehen. Ihr Gesicht war immer glatt und ausdruckslos und so, als wäre sie neu in der Welt und hätte noch nichts erlebt und keine Meinung zu irgendwas.
Das Haus der Stroms hätte eher in ein Magazin gepasst als in eine triste, mansionarme Kleinstadt. Oh und Wow, sagte ich, als ich eintrat, aber ich sagte es, weil ich irgendwie wusste, dass es von mir erwartet wurde, nicht weil ich das Oh, das Wow wirklich fühlte. Durch einen kurzen Flur gelangte man in eine Art Halle. Die Halle selbst war groß und weiß, und alles andere darin war es auch. Der Boden etwa bestand aus weißen, glänzenden Steinfliesen. Inga tat mir leid. Ich fand Teppich am besten, schön flauschig wie bei meiner Oma. Zu Hause hatten wir nur Linoleum, aber selbst das war besser als Fliesen. Die Fenster der Stroms waren eigentlich keine Fenster, sondern gläserne Wände, die man aufschieben konnte, um in den Garten zu spazieren. Zumindest theoretisch konnte man das, praktisch nicht, weil irgendetwas mit der Alarmanlage nicht stimmte. Nur Herr Strom war befugt und fähig, diese Fenstertüren zu öffnen, und das auch erst, nachdem er etwas in ein kleines Gerät in der Wand getippt hatte. Jedes Mal, wenn ich zu Besuch war, schärfte mir Inga ein, dass ich auf keinen Fall die Türen öffnen dürfe. Das sagte sie so oft zu mir, dass es mich in den Fingern juckte, es doch zu tun, auch wenn ich ja gar nicht in den Garten wollte.
In der großen weißen Halle standen ein großes weißes Sofa und ein großer weißer Tisch. Es gab auch Bilder an den Wänden – keine schönen wie im Haus meiner Oma, auf denen es viel zu entdecken gab, Berge und Elche und kleine Häuser und, wenn man genauer hinsah, auch den ein oder anderen Wanderer. Die Bilder der Stroms zeigten irgendwelche Formen und Farben. Eine Reihe dieser Bilder, alle in Schlammfarben gehalten, hing über einer Vase, die mir in etwa bis zum Kinn reichte und die, anders als zu erwarten, nicht mit baumgroßen Blumen gefüllt war, sondern mit überhaupt nichts. Sämtliche Einrichtungsgegenstände legten nahe, dass Riesen an diesem Ort lebten und nicht die kleine Inga mit ihrer kleinen Mutter und ihrem Vater, der eigentlich nie da war und irgendetwas mit Büromöbeln machte.
Von der Halle aus führte eine geschwungene Treppe in die obere Etage hinauf. Die Treppe war das Protzigste im Haus und gefiel mir, weil sie mich an Beverly Hills und Melrose Place erinnerte. Es schien möglich, ja wahrscheinlich, dass jeden Moment eine hochgewachsene, untergewichtige Frau mit platinblondem Haar und glitzerndem Paillettenkleid die Treppe herunterkommen könnte. Als ich hinter Inga die Stufen hinaufging, stellte ich mir vor, ich wäre eine hochgewachsene, untergewichtige Frau mit platinblondem Haar und glitzerndem Paillettenkleid. Ich würde Jennifer heißen oder Heather und ein Alkoholproblem haben und vielleicht bald im Rollstuhl sitzen oder jemanden umbringen.
Ingas Zimmer hatten beide einen mintgrünen Teppich und waren sehr aufgeräumt. Das Kinderzimmer zeigte sie mir zuerst; sie zeigte mir ihren Fernseher und ihren Gameboy und ihren CD-Spieler und ihre CDs. Im Spielzimmer zeigte sie mir dann auch noch ihre alten Spielsachen, über die wir uns lustig machten, weil wir uns zu gut erinnern konnten, was uns diese Dinge gerade erst, vielleicht noch im Jahr zuvor, bedeutet hatten: ein pinkfarbenes Barbie-Haus, ein pinkfarbener Barbie-Ferrari und ein pinkfarbenes Barbie-Pferd. Nachdem wir über Ingas Spielsachen gelacht hatten, gingen wir zurück ins Kinderzimmer und lackierten uns die Fingernägel. Inga schlug vor, im Pool zu schwimmen, und ich gestand, dass ich meinen Badeanzug nicht mitgebracht hatte. Ein wenig überraschend bot sie an, mir ihre Schwimmsachen zu leihen – überraschend, weil Inga spindeldürr war, ich eher kurvig. In einer Zeitschrift hatte ich gelesen, dass ich eine Birne sei. Da Inga meine Birnenhaftigkeit bisher wohl nicht bemerkt hatte, wollte ich sie nicht mit der Nase drauf stoßen und überlegte, stattdessen einen Grund zu erfinden, warum ich nicht ins Wasser konnte. Zum Beispiel eine Wasserallergie. Ich weiß nicht, weshalb, aber wenn ich log – was oft vorkam, immer wenn ich mir eine Demütigung ersparen wollte –, dann log ich extravagant, so übertrieben, dass die Lüge für jeden, der seine fünf Sinne beisammenhatte, offensichtlich war. Inga gegenüber behauptete ich, gerade erst eine neue Zahnfüllung bekommen zu haben, die nicht in Kontakt mit gechlortem Wasser kommen dürfe.
»Na, dann nächstes Mal«, sagte sie, und ich versprach, bei meinem nächsten Besuch einen Badeanzug mitzubringen.
Bei meinem nächsten Besuch brachte ich einen Badeanzug mit. Von der großen weißen Halle aus gingen wir diesmal nicht die Beverly Hills-Treppe hinauf, sondern stiegen eine andere, bescheidenere Treppe in den Keller hinab.
»Hier ist der Partykeller«, sagte Inga.
Auf den ersten Blick unterschied sich der Partykeller nicht von einem ganz normalen Keller. Das Einzige, was in dem modrig riechenden Raum an Party denken ließ, war eine Lichterkette. Schaltete man sie an, leuchteten Glühlampen in Blau, Rot, Grün und Gelb. Ausgeschaltet aber wirkte sie so trist wie das ausrangierte Ledersofa, das Regal, in dem sich Brettspiele in ausgeblichenen Kartons stapelten und Getränkekisten mit Mineralwasser (Klassik). Ich war noch nie auf einer Partykeller-Party gewesen, und während Inga mir von den Runden Twister berichtete, die ihre Freunde und sie hier unten an ihrem elften, zwölften und dreizehnten Geburtstag gespielt hatten, hoffte ich, dass sich daran auch nie etwas ändern würde. Die Hölle war ein Partykeller, in dem man von früh bis spät Twister spielen musste. Oder Trivial Pursuit.
Vom Partykeller aus gelangten wir in einen gekachelten Zwischenraum. Geradeaus weiter ging es in den Pool-Raum, zur Rechten befand sich ein Holzverschlag – die Sauna. Inga und ich wussten, dass dicke, alte Menschen in Saunen saßen, und auch wenn Ingas Eltern weder dick noch besonders alt waren, stellten wir sie uns in der Sauna so vor. Als ob die Hitze eine andere Wahrheit aus ihren Körpern locken würde.
»Ich würde niemals in eine Sauna gehen«, sagte Inga schnell.
»Ich auch nicht«, sagte ich.
Wir waren beide erleichtert, vielleicht auch, weil wir endlich eine Gemeinsamkeit gefunden hatten, etwas, das uns verband.
Der Pool war nichts Besonderes, gleichzeitig aber sehr besonders. Was ihn besonders machte, war, dass er sich im Haus der Stroms befand. Es gab Dinge, die erwartete man nicht in den Häusern anderer Leute. Ein Kino zum Beispiel, einen Operationssaal, eine Disco oder eben: einen Pool. Diese Dinge, hatte ich bisher immer angenommen, gehörten der Allgemeinheit, allen Menschen. Man konnte keinen Bus besitzen, keine Schule, keine Bibliothek, kein Schwimmbad.
Ingas Pool, sagte ich im Kopf zu mir und kicherte stumm. Wir schwimmen jetzt in Ingas Pool, und diese Worte waren irgendwie gleichzeitig lächerlich und beeindruckend und unanständig. Das verstand ich zwar nicht, ich fühlte es aber. Hätte Inga mir ein Dokument gezeigt, das besagte, ihrem Vater würde die ganze Stadt gehören, ich hätte genauso gekichert.
Das Besondere an dem unbesonderen Pool war also, dass man etwas, das man hätte teilen müssen, nicht teilen musste. Keine kleinen Kinder, die heimlich ins Wasser pinkelten, keine alten Frauen mit Badehauben, die tratschend nebeneinanderher schwammen. Weil ich noch nie einen Pool für mich alleine gehabt hatte, brauchte ich eine Weile, bis ich begriff, dass ich auch gar keinen Pool für mich alleine haben wollte, zumindest nicht den der Stroms. Er war so klein, dass man mit fünf Schwimmzügen von einem Ende zum anderen gelangte – was im Grunde keinen Unterschied machte; ich war ja viel zu faul, um tatsächlich schwimmen zu wollen. Wir hielten uns am Beckenrand fest und strampelten mit den Beinen. Anschließend sprangen wir vom Rand des Pools ins Wasser, weil man das in einem normalen Schwimmbad nicht gedurft hätte, und johlten und schrien dabei – unsere Stimmen klangen unheimlich; die gekachelten Wände warfen sie merkwürdig schrill zurück.
Hinter jedem großen Spaß lauert die nächste Langeweile, und so wurden wir immer wilder. Bei einem besonders waghalsigen Sprung schlug ich mit dem Hintern mit voller Wucht auf der Wasseroberfläche auf. Der Aufprall trieb mir Tränen in die Augen, und ich hätte am liebsten laut geheult vor Scham, vor Wut und Schmerz, doch dafür war mir mein Übermut zu peinlich. Also ließ ich mich bloß mit unbeteiligtem Gesicht im Wasser treiben.
In der einen Ecke des Pools hatten die Fugen zwischen den Kacheln angefangen zu schimmeln, und auch sonst ekelte ich mich ein wenig vor dem Becken. Ab und an waren gluckernde Geräusche zu hören, als würde etwas eingesaugt oder ausgespuckt werden. In den Wänden befanden sich Öffnungen, kleine dunkle Schlünde, die unter Wasser nur verschwommen zu erkennen waren.
»Gibt es hier unten eigentlich Ratten?«, fragte ich Inga. Ich fragte beiläufig, weil ich meinen Ekel für mich behalten wollte. Sich vor einem privaten Pool zu ekeln, war unangebracht. Man durfte sich so wenig vor einem Pool ekeln wie vor einem Einhorn, das plötzlich im eigenen Badezimmer stand. Es blieb einem gar nichts anderes übrig, als niederzuknien und andächtig den Kopf zu senken, selbst wenn die Mähne des Einhorns stumpf und sein Fell struppig war, selbst wenn es lahmte und stank und einen mit seiner klebrigen Zunge ableckte. Ein Einhorn war ein Einhorn, war immer etwas Besonderes. Genau wie so ein Pool immer etwas Besonderes war, selbst wenn er schimmelte und man ihn vielleicht mit Ratten teilen musste.
Laut Inga gab es aber keine Ratten, und so ließen wir uns eine Weile auf dem Rücken treiben und schauten zur grau-braun gefleckten Decke hinauf. Als auch das zu langweilig wurde, kletterten wir aus dem Becken und trockneten uns ab. Die Fliesen unter unseren Füßen waren warm. Die Sonne konnte sie nicht aufgeheizt haben, der Pool-Raum lag ja im Souterrain, ein Wort, das die Stroms für Keller benutzten, wahrscheinlich weil es schwedischer klang. Inga erklärte, der Boden sei beheizt. Von so etwas hatte ich noch nie gehört – ein Boden wie eine einzige große Heizung. Wir legten uns auf die Fliesen und redeten über die neue Folge Beverly Hills, die wir zwar noch nicht gesehen, von der wir aber bereits gehört hatten.
In den nächsten Tagen gab ich zu Hause und in der Schule bei jeder Gelegenheit mit dem Pool an. Ich erzählte allen, die es hören wollten, und meiner Schwester Caro, dass ich in einem privaten Pool geschwommen und gleich mehrmals vom Beckenrand gesprungen war. Meine Rattenangst und den Ekel vor den braunen Flecken behielt ich für mich, ebenso wie die Tatsache, dass mir die warmen Fliesen viel besser als der Pool gefallen hatten. Wie die Wärme von dem Stein in meine Haut übergegangen war, in Fußsohlen, Waden, in die Unterseite der Schenkel, Schulterblätter und in den Hinterkopf. Ich hatte die Augen geschlossen und mich sicher und geschützt gefühlt, ganz anders als in dem kühlen Wasser, das durch das grelle Türkis der Wände abweisend und irgendwie feindselig gewirkt hatte.
2. Tennis
Schwer zu sagen, warum Inga Strom und ich überhaupt Freundinnen wurden. Wir gingen nicht auf dieselbe Schule, hatten also weder gemeinsame Freunde noch gemeinsame Feinde. Wir wohnten nicht in derselben Gegend und interessierten uns nicht für dieselben Dinge. Wenn uns etwas verband, dann Tennis, aber eigentlich verband uns auch das nicht, weil es für uns beide nicht dasselbe bedeutete. Für Inga war es eine Selbstverständlichkeit, ihre Mutter spielte Tennis, ihr Vater und all ihre Onkel. In meiner Familie machte niemand Sport, und warum ich mir ausgerechnet Tennis in den Kopf gesetzt hatte, verstand keiner. Der Tennislehrer nicht, meine Mutter am wenigsten, und selbst ich war mir nicht ganz sicher.
Der Unterricht kostete meine Eltern wahrscheinlich ziemlich viel Geld, aber darüber machte ich mir damals keine Gedanken. Mir kam es ja so vor, als würde ich ihnen einen Gefallen tun. Wenn ich mein Zimmer verließ, dann immer nur, weil ich ihnen einen Gefallen tat. Oder weil ich Hunger hatte oder auf die Toilette musste. In meiner Familie nannten sie mich Milbe, weil man mich in der Regel im Bett oder auf dem Teppich fand.
Meine Eltern sahen die Sache ein wenig anders als ich: Sie glaubten, mir einen Gefallen zu tun, weil es gesund war, sich zu bewegen und möglichst viel Zeit unter Menschen zu verbringen. Sie waren der Meinung, dass ich zu viel über mich selbst nachdachte und dass man besser nicht zu viel, eigentlich sogar überhaupt nicht über sich selbst nachdachte. So handhabten sie das ja auch.
Wäre es jedenfalls nach mir gegangen, hätte ich gar keinen Sport gemacht. Am liebsten tat ich Dinge, bei denen man saß oder – besser noch – lag, wie beim Lesen oder Fernsehen. Aber meine Mutter bestand auf einem Sport, wahrscheinlich weil Brigitte, ihre Freundin, die am liebsten herumsaß und Russischbrot aß, gesagt hatte, dass Sport ja sehr wichtig sei für Körper und Geist. Meine Mutter war um beides besorgt, vor allem seitdem meine Oma ihr am Telefon erzählt hatte, dass sie der Meinung sei, ich hätte Tendenzen. Darunter konnte meine Mutter sich nichts vorstellen und erzählte meinem Vater abends aufgebracht in der Küche davon. Wie immer sprach sie sehr laut. Wenn meine Eltern sich geheime Dinge über meine Schwester und mich anvertrauen wollten, gingen sie in die Küche, um sie sich dort zuzuschreien. Die Küche lag ungefähr vier Meter von unseren Kinderzimmern entfernt, aber unsere Eltern waren von Natur aus laute Menschen, außerdem fehlte es ihnen an Vorstellungskraft. Sie konnten einfach nicht glauben, dass es Caro und mich auch dann gab, wenn man uns nicht sah.
»Mama sagt, ihr sei aufgefallen, dass Maren Tendenzen hat«, rief meine Mutter an diesem Abend.
»Tendenzen!«, rief mein Vater zurück. »Was soll das denn heißen?«
»Ich weiß nicht, aber du hast selbst gesagt, dass Maren zu viel alleine in ihrem Zimmer ist. Und dann immer diese Außerirdischen.«
Ich war gespannt, was mein Vater zu mir und den Außerirdischen zu sagen hatte, aber wie in den meisten Unterhaltungen, die sich nicht unmittelbar um ihn drehten, hatte er nach etwa zwanzig Sekunden das Interesse verloren und erinnerte meine Mutter daran, dass in fünf Minuten der Tatort anfing.
Als feststand, dass ich mich für irgendeinen Sport würde entscheiden müssen, traf ich meine Wahl: Ballett. Nach der ersten Stunde aber nahm die Ballettlehrerin meine Mutter beiseite und riet ihr, mich wieder aus dem Kurs zu nehmen, dann könne man das Ganze auch als Probestunde verbuchen und die Gebühr erstatten. Ich hatte eine auffällige Hüftfehlstellung und ein Hohlkreuz, das war bereits bekannt, aber laut der Ballettlehrerin hatte ich außerdem keine Körperintelligenz.
»Es tut mir leid, aber Ihre Tochter hat überhaupt keine Körperintelligenz«, sagte sie zu meiner Mutter, und meine Mutter gab mir das so weiter, da sie mir oft weitererzählte, was andere Leute über mich dachten.
Nach dem Ballett-Desaster versuchte ich es mit Rollschuhkunstlauf, doch auch dafür brauchte man anscheinend Körperintelligenz oder irgendetwas anderes, das ich nicht hatte. Ohnehin war Rollschuhkunstlauf ein Kompromiss gewesen, denn eigentlich wollte ich Eiskunstläuferin sein. Drei Jahre zuvor hatte ich Oksana Baiul Gold bei der Winterolympiade in Lillehammer gewinnen sehen, und es war neben dem Serienstart von Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI einer der Höhepunkte meines Lebens gewesen. Eine Zeit lang vergaß ich, dass Oksana Baiul nicht meine beste Freundin war und auch gar nichts von mir wusste. Ich liebte sie nicht wegen, sondern gegen etwas: gegen meine Eltern, die sie albern fanden, ihr Kostüm, ihren Gesichtsausdruck, ihre Frisur. Meine Mutter nannte Oksana puppig. Die Frauen in meiner Familie nannten andere Frauen stets puppig, statt sie geradeheraus als dumm zu bezeichnen. So war es leichter, zu behaupten, man habe ja niemanden beleidigen, sondern lediglich eine Beobachtung machen wollen. (Gleiches galt für: gesund statt dick, lebenslustig statt dick, kurvenreich statt dick. Unkompliziert statt dumm.) Ich fand Oksana nicht puppig. Ich liebte sie als schwarzen Schwan, als weißen Schwan, als pinken Pudel. Ich liebte sie, wenn sie sprang, und ich liebte sie, wenn sie fiel. Als ich sah, wie sie mit rosafarbenen Federn geschmückt einer euphorischen Kinderbraut gleich übers Eis sprang, musste ich die Hände zu Fäusten ballen, weil ich so viel Schönheit kaum aushalten konnte. Was es damals für mich bedeutete, Oksana Baiul zu lieben, kann ich im Nachhinein schlecht erklären. Einerseits malte ich mir aus, sie sei meine beste Freundin, und auf dem Nachhauseweg von der Schule stellte ich mir vor, sie würde neben mir herlaufen, und ich könnte mich bei ihr über die Hausaufgaben beschweren und über den Unterricht. Gleichzeitig träumte ich davon, selbst Oksana zu sein, übers Eis zu fliegen und so zu strahlen, als hätte ich keine Zähne im Mund, sondern radioaktive kleine Perlen.
In den Wochen nach der Winterolympiade sah ich mir gleich mehrere Reportagen über Oksana Baiul an, ihre tragische Vergangenheit, ihr Schicksal, ihren Aufstieg und Triumph. Sie war ein Waisenkind, lebte unter katastrophalen Umständen in einem Hochhausghetto, trainierte unter katastrophalen Umständen auf löchrigem Eis. Während ich vor dem Fernseher kauerte und mich durch eine Tüte Snackbrezeln snackte, hatte ich das Gefühl, hier werde meine Geschichte erzählt. Als würde jemand endlich über die katastrophalen Umstände berichten, unter denen ich aufgewachsen war und gekämpft hatte, auch wenn ich heute nicht mehr weiß, wo genau ich die Parallelen sah. Ich war kein Waisenkind und hatte nie auf löchrigem Eis trainiert. Ich besaß nicht einmal Körperintelligenz. Und trotzdem weinte ich im Winter 1994 oder tat zumindest so, als würde ich weinen vor Rührung, als Oksana Baiul ihre Wertung erfuhr und sich schluchzend die roten Hände vors Gesicht schlug, während meine Eltern stöhnten. Nummer eins. Gold. Gold. Gold. Ein großer Sieg für Oksana, ein kleiner Sieg für mich.
Noch besser als an Oksanas dreifachen Flip kann ich mich daran erinnern, wie wütend ich damals auf meine Eltern war, weil sie sich über Oksana lustig machten. Unter all meinen Tendenzen war es die Wut, die meiner Mutter die größten Sorgen machte. Ich war ein wütendes Baby gewesen, ein wütendes Kleinkind, das zu einem wütenden Mädchen herangewachsen war. In meiner Familie und angeblich auch in der Nachbarschaft war ich für meine Wutanfälle bekannt. Manchmal tobte ich, bis ich zu hyperventilieren begann oder einen Schluckauf bekam.
Die meisten Frauen in meiner Familie – meine Oma, meine beiden Tanten, meine Großtanten – hatte ich noch nie wütend gesehen. Wenn die Wut sich ankündigte, so wie sich eine Erkältung etwa durch ein erstes Niesen oder Kratzen im Hals ankündigt, dann flohen sie umgehend. Ich nehme an, dass sie sich irgendwo im Haus versteckten, wahrscheinlich im Keller oder im Waschraum, wo sie ihre Wut zu einer kontrollierten Explosion brachten, indem sie, so stellte ich mir das zumindest vor, ein hasserfülltes Wort fauchten oder besonders aggressiv bügelten. Wenn sie wieder hervorkamen, war ihr Haar gerichtet, ihre Miene unbewegt, ihre Stimme hell, ja beinahe fröhlich.
Mit zehn hatte ich zwei Strategien, um meine Wut zu kontrollieren. Die erste war, mir in die Hand zu beißen, die zweite, Dinge kaputt zu machen, manchmal meine eigenen, öfter aber die der anderen. In dem Jahr, in dem Oksana in Lillehammer lief, machte ich kaputt: eine Bee-Gees-Platte meines Vaters, drei T-Shirts und einen Pullover von Caro, einen Bildband über den Schwarzwald, zwei Mathematik-Nachhilfebücher, einen goldenen Gel-Stift, der nie richtig schrieb, zwei Gläser (unabsichtlich), ein weiteres Glas (mit Absicht), eine Schmuckausgabe der Buddenbrooks, die meinem Vater gehörte, eine Drei Fragezeichen-Kassette (meine), eine TKKG-Kassette (Caros), einen besonders schönen Teller und zwei hässliche, eine kleine Porzellanfigur, die ich meiner Oma hatte schenken wollen, eine Topfpflanze, einen Schal, die aussortierten Turnschuhe meines Vaters. Zerbrechliches zerbrach ich, in Textilien schnitt ich, aus Kassetten zog ich das Band.
Meine Mutter sagte häufig, auch viele Jahre später noch, dass sie nie habe verstehen können, warum ich mich so oft über Dinge ärgerte, die doch gar nichts mit mir zu tun hätten. Aber natürlich hatten sie nur auf den ersten Blick nichts mit mir zu tun. Auf den zweiten alles. Wer über Oksana Baiul lachte, lachte auch über mich, die ich sie ja liebte. Wer Oksana Baiul lächerlich machte, der machte mich lächerlich. Und eine meiner Tendenzen war, dass ich immer hoffte, die Welt werde mich sehr ernst nehmen.
Wahrscheinlich hatte ich geglaubt, mich beim Rollschuhkunstlauf wenigstens einmal die Woche wie Oksana fühlen zu können, aber Rollschuhkunstlauf ist nicht Eiskunstlauf, und die einzige (eher unelegante) Figur, die wir über Wochen einstudierten, war die Kanone, bei der wir auf dem Boden kauern und ein Bein von uns strecken mussten. Statt dass wir uns in luftige Höhen schwangen und atemberaubend schnell um die eigene Achse drehten, würden wir nach Monaten anstrengenden Trainings wohl nur einen Hüpfer zustande bringen. Und eine weitere meiner Tendenzen war, dass ich mich nicht gerne anstrengte.
Warum ich mir als Nächstes Tennis aussuchte, weiß ich nicht mehr genau. Wahrscheinlich hatte es etwas mit dem Fernsehen zu tun; alle meine Entscheidungen damals, meine Wünsche, Träume, Hoffnungen und Befürchtungen hatten etwas mit dem Fernsehen zu tun. Ich hatte wohl eine Serie gesehen, in der schöne, reiche Menschen Tennis spielten. An Tennis gefiel mir, dass man nicht in einer Mannschaft spielte. Wenn wir in der Schule zu Gruppenarbeit gezwungen wurden, weil wir Teamwork lernen sollten, dann lachte ich insgeheim, weil ich bereits wusste, dass ich niemals in Teams worken würde. Lieber alleine sterben als im Team worken.
Was mich das Fernsehen über Tennis gelehrt hatte, war, dass man seinem Gegner kleine gelbe Bälle entgegenschmetterte. Das gefiel mir. Es ging eben nicht darum, etwas miteinander zu machen, sondern gegeneinander. Außerdem ging es immer ums Gewinnen. Auch das gefiel mir, weil ich kompetitiv war. Schon immer wollte ich alles gewinnen, auch wenn es gar nichts zu gewinnen gab. Vor allem dann.
Unser Tennislehrer hieß Georgi und kam aus Bulgarien. Wenn ich heute, da ich mich nicht einmal mehr an sein Gesicht erinnere, an ihn denke und ihn mit einem einzigen Wort beschreiben müsste, wäre es müde. Er war ein müder Mann, der mit schwerfälligen, trägen Schritten über den Tennisplatz schlurfte und uns hin und wieder die Bälle mit lustloser Gleichgültigkeit zuspielte. Meistens schaltete er aber bloß die ballspuckende Maschine an oder ließ uns gegeneinander antreten. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihn je selbst spielen gesehen zu haben.
Lange Zeit hatte ich von einer bedeutungsvollen Lehrer-Schüler-Beziehung geträumt, von einem strengen, aber weisen Mentor, der mir gegenüber eine unerklärliche, aber tiefe Verbundenheit empfände, so wie auch umgekehrt ich mich ihm tief verbunden fühlte, ein moderner Gandalf, der mich erkennen und meine Begabung fördern, so wie ich ihn erkennen und ihm Lebensfreude zurückgeben würde, das Gefühl, eine echte Aufgabe zu haben.
Georgi war nicht mein Gandalf. Weder erkannte er eine geheime, auch mir verborgene Begabung noch gelang es mir, ihm Lebensfreude zu schenken. Damals hätte ich ihn sogar als meinen Feind bezeichnet, aber mit dieser Bezeichnung ging ich recht großzügig um. Unsere Feindschaft beruhte vor allem darauf, dass Georgi wollte, dass ich mich bewegte, und ich das nicht wollte. Außerdem störte ihn mein Fluchen. Es stimmte; auch meine Oma beschwerte sich oft über mein Schandmaul. Ich fluchte allerdings nicht, um Georgi zu provozieren, zumindest nicht am Anfang, sondern weil mir die Flüche so selbstverständlich über die Lippen gingen wie die Luft, die ich atmete.
»So spricht keine Dame!«, bemerkte Georgi oft. Und darauf wusste ich nichts zu antworten. Konnte er mir nicht ansehen, dass ich so wenig eine Dame sein wollte wie eine Amöbe oder ein Kaugummiautomat?
Den größten Ärger hatten Georgi und ich wegen meiner Schuhe. Die Regeln besagten, dass in der Halle Tennisschuhe zu tragen waren – Turnschuhe also mit hellen, sauberen Sohlen. Natürlich hatte ich keine solchen Schuhe. Die Vereinbarung mit meiner Mutter war, dass sie mir den Kurs bezahlte – sie hatte mir auch noch einen Tennisschläger gekauft –, die weitere Ausstattung und Sportkleidung aber musste ich von meinem eigenen Geld besorgen, was bedeutete, dass ich keine besaß, weil ich mein Taschengeld lieber für Käsebrötchen und Schoko-Croissants, Zeitschriften mit Abnehmtipps und Romane in meinem liebsten Literaturgenre ausgab: Bücher zur Serie (Akte X, Star Trek, Xena – Die Kriegerprinzessin). Im Sommer kam ich gut damit durch. Draußen fiel niemandem auf, dass ich Straßenturnschuhe trug. In der Halle aber hinterließen sie dunkle Streifen, und etwa alle drei Wochen stellte Georgi mich zur Rede. Dann duckte ich mich unter seinem verdrossen schwerlidrigen Blick hinweg und murmelte vage Zusicherungen. Dabei wussten wir beide, dass ich, wäre ich jemals in den Besitz einer so außerordentlichen Summe wie achtzig Mark gelangt, sie niemals für Tennisschuhe ausgegeben hätte.
Einmal tauchte ich in der Halle auf, nachdem ich am Vortag im Wald gewesen war. Wenn ich Caro nachmittags lange genug bei ihren Telefongesprächen belauscht hatte und mich langweilte, ging ich in den Wald und stellte mir vor, in einer postapokalyptischen Welt zu leben, in der meine einzigen Freunde mutierte Eichhörnchen waren sowie eine Handvoll anderer Überlebender, die sich von mutierten Eichhörnchen ernährten, weil ihnen nichts anderes übrig blieb. Erst in der Umkleidekabine bemerkte ich, dass meine Schuhe noch erdverkrustet vom Waldboden waren. Inga war noch nicht da und auch nicht das andere Mädchen, das wir Tori nannten, weil wir der Meinung waren, sie sähe aus wie die Schauspielerin Tori Spelling aus Beverly Hills.
Schwarze Streifen, wusste ich, waren eine Sache, Erdplacken eine andere. In kopfloser Verzweiflung fing ich an, die Turnschuhe gegen die gekachelte Wand zu schlagen, bis sich die Klumpen aus dem Profil lösten. Damit war ich eine ganze Weile beschäftigt gewesen, als sich die Tür öffnete und Georgi hereinkam. Der Lärm musste ihn angelockt haben; ich hatte unterschätzt, wie laut ich war.
Er starrte mich an, ich starrte zurück.
Weil mir die schmutzigen Sohlen erst aufgefallen waren, als ich mich bereits aus meiner Jeans geschält hatte, stand ich in Unterhose und Hoodie vor ihm. Ich war sicher, dass er sich bei meinem Anblick umdrehen und aus der Umkleide fliehen würde. Es war offensichtlich, dass er sie nie hätte betreten dürfen. Aber er drehte sich nicht um, und er floh auch nicht. Er stand bloß weiter in der Tür, ein großer Mann, das war er ja schon immer gewesen, aber es fiel mir erst jetzt so richtig auf, hier in der Mädchenumkleide, als wäre diese nicht ein Raum wie jeder andere auch, sondern speziell für Mädchenkörper gemacht.
Georgi deutete auf meine Schuhe, und ich konnte sehen, wie seine Hand dabei zitterte. Ich hörte, dass er sprach, auf mich einredete, aber ich verstand nicht richtig, was er sagte, ich war mit den Gedanken bei seiner zitternden Hand und bei dem Raum und bei mir selbst, und nur einzelne Worte drangen bis zu mir vor. Obwohl er zu schimpfen schien, klang er eher enttäuscht als wütend.
»So was macht man nicht«, sagte er dann. »So was darf man doch nicht einfach so machen.« Die Zitterhand deutete auf die bröcklige Erde auf den Bodenfliesen, und er schüttelte den Kopf. »Das geht doch nicht, das ist verboten.«
Er ermahnte mich wegen des Lärms und wegen der Dreckspuren, und die ganze Zeit über stand ich in Unterhose vor ihm, und ich wusste nicht mehr, ob tatsächlich bloß die Sohlen schmutzig waren oder ob nicht auch ich irgendwie schmutzig war, ob mir der Wald mit seiner schwarzen Erde, seinen Würmern, seinen mutierten Eichhörnchen, seinem Geruch nach Moos und Moder nicht noch irgendwie anhaftete und sehr viel besser zu mir passte als weiße Tennisschuhe. Ich war keine Dame, ich war Amerikanerin, ich war Überlebende einer postapokalyptischen Welt. Zur Not würde ich mich von Eichhörnchen ernähren.
Während ich mich weiter an den Schuhen festhielt, spürte ich, dass eine große Verfehlung begangen worden war oder noch begangen wurde, ohne dass ich hätte sagen können, ob ich die Übeltäterin war oder Georgi.
3. Zuhause
Inga und ich trafen uns fast immer bei den Stroms, weil sie in der Nähe des Tennisclubs wohnten und wir mit dem Fahrrad in zehn Minuten dort waren. Für Ingas Zuhause sprachen außerdem der Pool, die Beverly Hills-Treppe, dass es immer Snacks gab, dass wir in ihrem Zimmer fernsehen konnten, und am wichtigsten: dass Ingas Eltern nie da waren. Wie in einem dieser Filme, in denen Kinder den ganzen Tag auf Fahrrädern herumfahren und von Clowns gefressen werden und man die Erwachsenen, die Eltern, überhaupt nie zu Gesicht bekommt. Gab es sie überhaupt? Ingas Vater jedenfalls sah ich so selten, dass ich ihn aus einer größeren Menge schnauzbärtiger Anzugträger nicht hätte herauspicken können. Alles, was ich wusste, war, dass er von früh bis spät in seinem Büromöbel-Imperium schuftete. Dabei war mir nicht einmal klar, ob er die Möbel selbst baute oder bloß verkaufte. Es interessierte mich irgendwie, aber nicht genug, dass ich nachgefragt hätte. Ingas Vater war schließlich nicht Ingas Mutter. In ihrem Fall hätte ich es ganz sicher wissen wollen, denn ich liebte Mütter. Immer wollte ich sie beeindrucken mit meiner Wortgewandtheit, meiner Belesenheit und Imagination und träumte davon, dass sie mir eines Tages einen verschwörerischen Blick zuwerfen und mich so wissen lassen würden, dass sie mich ein klitzekleines bisschen mehr liebten als ihre eigenen Kinder. Dieser Wunsch rührte wohl daher, dass es unmöglich war, meine eigene Mutter zu beeindrucken, und im Grunde standen meine Chancen bei Frau Strom nicht besser, aber ich liebte Herausforderungen und hoffte also, es würde mir – zu unser beider Überraschung – doch gelingen.
Wenn ich vermutete, dass Frau Strom in Hörweite war, sprach ich beiläufig über Autoren, die ich gelesen hatte, Hermann Hesse und Jane Austen, über Bücher, von denen ich wusste, dass sie Literatur waren und also eher etwas für Erwachsene. Wenn Frau Strom hören würde, wie sehr mich das Schicksal Hans Giebenraths bewegt und dass ich beim Lesen von Unterm Rad geweint hatte, musste sie ja wohl aufhorchen. Dass ich erstaunlich erwachsen sei für mein Alter, würde sie denken und nicht im Traum vermuten, dass ich noch immer kleine Löcher in Caros T-Shirts schnitt und meiner Mutter regelmäßig Münzen aus der 50-Pfennig-Sammeldose klaute.
Doch falls Frau Strom mich je über die bewegende Freundschaft von Hans und Hermann schwärmen gehört und dies ihren Blick auf mich grundsätzlich geändert haben sollte, ließ sie es sich nicht anmerken. Sie sah mich weiterhin ganz genau so an, wie als ich das erste Mal in ihr Haus geschlendert war – als wüsste sie von meinen Verbrechen, allen Verbrechen, auch denen, die ich noch gar nicht begangen hatte. Diese wogen schwerer als der Diebstahl von ein paar 50-Pfennig-Stücken.
Ingas Mutter hasst mich, schrieb ich bitter in mein Tagebuch. Eigentlich war es die Art von Geständnis, das ich Inga gerne nach langem Hin und Her am Telefon machte. In diesem Fall aber traute ich mich nicht. Was, wenn sie meinen Verdacht bestätigte? Niemand möchte gehasst werden. Oder etwa doch? Eigentlich fühlte es sich ja ganz gut an. Irgendwie bedeutungsvoll. Ich stellte mir vor, wie Frau Strom sich in ihrem kehligen Schwedisch über mich beschwerte, malte mir aus, wie sie nachmittags die Beverly Hills-Treppe hinabschritt, um dann auf einer der unteren Stufen innezuhalten, eine Hand auf dem Geländer, weil sie meinen Tennisschläger neben dem von Inga erspäht hatte und wusste, dass ihre Nemesis im Haus war.
»Die denkt nie über dich nach. Wahrscheinlich weiß sie nicht mal, wie du heißt«, sagte Caro achselzuckend, nachdem sie Mutter und mich beim Spekulieren über Frau Strom belauscht hatte.
»Tja, wenn du meinst …«, antwortete ich in möglichst geheimnisvollem Ton. Aber in dem Moment fiel mir siedend heiß ein, dass Frau Strom mich tatsächlich nie mit Namen angesprochen oder mir auch nur eine einzige Frage gestellt hatte. Ich hatte ihre Tochter heimgesucht wie eine ungefährliche, aber irgendwie peinliche Krankheit: Läuse, ein Ausschlag, ein entzündeter Pickel mitten auf der Stirn. Vermutlich sagte sie sich: Was von alleine kommt, wird auch von alleine gehen.
Frau Strom arbeitete nicht. Warum war sie dann so selten zu Hause? Vielleicht war sie mit ihren Hobbys beschäftigt. Nur welche Hobbys? Sie sammelte nichts, sie informierte sich über nichts, sie strickte nicht, sie nähte nicht, filzte nicht, marmorierte nicht, malte nicht. Manchmal lag sie im Garten auf einem weißen Liegestuhl, aber auch der Garten schien sie nicht besonders zu interessieren. Um Blumen und Beete kümmerte sich ein Gärtner.
»Wofür interessiert sich deine Mutter eigentlich?«, fragte ich Inga einmal beiläufig.
Ich hatte vergessen, dass man sich nach Eltern nicht beiläufig erkundigen kann. Nach Eltern zu fragen, war immer auffällig und ein wenig merkwürdig.
Inga warf mir einen langen, prüfenden Blick zu. »Wie meinst du?«
»Na, hat sie Hobbys?«
»Ach so. Keine Ahnung. Design vielleicht. Design und Einrichtung.«
Design? Wie passte das zu den ganzen hässlichen Möbeln im Haus der Stroms? Und wie konnte Design einen überhaupt beschäftigen? Im Jahr zuvor hatte ich einen Comic-Zeichenkurs an der Volkshochschule gemacht und stellte mir jetzt Frau Strom in einem Design-VHS-Kurs vor. Wie sie mit anderen Frauen an Schultischen herumsaß und sie einander erzählten, wie toll sie Design fanden. In der letzten Viertelstunde dann designten sie vielleicht selbst noch etwas, einen Blumentopf oder eine Kaffeetasse.
»Und wenn sie nachmittags nicht da ist – also heute –, dann designt sie, oder …?«
»Nee, heute ist sie shoppen.«
Klar. Wenn ich so viel Geld wie Frau Strom gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch immer shoppen gegangen.
Aber auch wenn Ingas Mutter einmal zu Hause war, bekamen wir nichts von ihr mit. Sie verschwand einfach. Irgendwie beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es im unteren Teil des Hauses bloß die riesige weiße Halle, einen kleinen Vorraum, die Küche und eine Kammer gab. Ich lief ihr nie über den Weg. Vielleicht war das ihr wahres Hobby, mehr noch als Design. Vielleicht gab sie sich Punkte oder goldene Sterne, wenn sie es schaffte, mir während meiner mehrstündigen Besuche kein einziges Mal zu begegnen. Manchmal, wenn Inga und ich gerade diäteten, fernsehschauten oder snackten und ich mich dabei etwas langweilte, stellte ich mir vor, wie Frau Strom leichenstill im Schimmelpool trieb, alleine und traurig schwankend im Partykeller stand oder in der dunklen Sauna saß, während sie darauf lauschte, wie wir die Beverly Hills-Treppe hinauf- und hinuntertrampelten.
So praktisch es war, dass wir vom Tennisclub innerhalb weniger Minuten bei Inga waren, so beschwerlich war die Reise, wenn ich sie von zu Hause aus antrat. Ich fuhr überall mit dem Fahrrad hin. Zum einen, weil ich abnehmen wollte, zum anderen, weil meine Eltern weder Lust noch Zeit hatten, mich überall hinzukutschieren, und ich das Geld, das ich für meine Schülermonatskarte bekam, für andere Dinge ausgab.
Inga wohnte am anderen Ende Hanaus, und der Weg dorthin war unvorstellbar hässlich, besonders im frühen Frühjahr, im Herbst und im Winter. Auf einer ewig langen Landstraße radelte ich vorbei an struppig wirkenden Feldern, auf denen immer irgendetwas brannte oder vor sich hin moderte – Kühlschränke, Matratzen, braune Plastiktüten, über deren Inhalt man lieber nicht nachdenken wollte. Auf halber Strecke erreichte ich das Kraftwerk, das trist in den Himmel schmutzte, dahinter lag der Bahnübergang, neben dem mich noch mehr verdächtige Tüten, fleckige Laken und Essensreste im gelb verdorrten Gras erwarteten. Ich hielt dort immer Ausschau nach Leichen oder Außerirdischen.
Im Radio hieß es, ein Jahrhundertsommer stehe bevor, und bald spürte ich das auch auf meinen Radtouren. Ich hatte immer weniger Lust, beinahe jeden Nachmittag am Kraftwerk vorbeizuradeln. Die Hoffnung auf Außerirdische hatte ich irgendwann aufgegeben, vor Leichenfunden aber fürchtete ich mich noch immer. Für Inga, meine beste Freundin – meine bff –, wäre ich bereit gewesen, alles zu tun, aber schwitzen wollte ich nicht dabei.
Wir könnten uns zur Abwechslung doch auch mal bei mir treffen, schlug ich ihr schließlich vor. Doch Inga gestand nach einigem Herumdrucksen: »Ich habe einfach so Angst vor deiner Schwester. Ich glaube, die ist immer noch sauer.«
Ich wusste, wovon Inga sprach, tat aber so, als müsste ich erst nachdenken, bevor ich behauptete: »Ach Quatsch, das hat die längst vergessen.«
Tatsächlich vergaß Caro nie etwas. Neben unserer Mutter und mir selbst war meine Schwester der nachtragendste Mensch, den ich kannte. Ein paar Wochen zuvor hatte ich Inga überredet, mir bei der Suche nach Caros Tagebuch zu helfen. Caros Tagebuch war Excalibur, das Goldene Vlies, mein Atlantis, und ich war seit Monaten mit der mythischen Quest beschäftigt, es zu finden.
Wohl immer, wenn Caro das Gefühl bekam, meine Hingabe würde nachlassen, stachelte sie mich mit dunklen Andeutungen an: »Gestern ist so was Krasses passiert, ich hab versprochen, nichts zu erzählen, aber in meinem Tagebuch steht alles.« Dabei zog sie ein Gesicht, das ich nicht zu deuten wusste. Caro hatte einen schiefen Mund und eine schiefe Nase, deswegen konnte man nie sicher sein, ob sie herablassend oder bloß belustigt, herausfordernd oder gleichgültig dreinschaute.
Eine ganze Weile hatte ich nicht sonderlich viel über meine Schwester und ihr Tagebuch nachgedacht, aber dann war es zum Eklat zwischen Caro und ihrer besten Freundin Janina gekommen. Warum die beiden überhaupt bffs gewesen waren, hatte ich nie verstanden, schließlich hatten sie noch weniger gemeinsam als Inga und ich: Janina war sehr dünn, meine Schwester nicht, Caro hatte Humor, Janina nicht. Caro trug Dockers, Janina Buffalos, Janina war in den Sportreferendar Nils verliebt, meine Schwester verachtete ihn so wie alle Lehrer. Der Grund für den Bruch der beiden musste aber ein anderer sein, und weil Caro drei Jahre älter war als ich und in anderen Kreisen verkehrte, beobachtete ich sie und die anderen Sechzehnjährigen gebannt aus der unvorstellbaren Ferne des anderen Schulhofendes. Sie erinnerten mich immer ein wenig an Giraffen, wunderschöne Giraffen mit ihrem goldenen Haar und ihren langen Armen und Beinen, wie sie ihre eleganten Hälse verschränkten, Stirnen auf Schultern sinken ließen und schluchzten oder flüsterten. Was ging dort drüben vor? Warum legt Noelle Caro tröstend einen Arm um die Schulter, warum reichte Nora Janine kopfschüttelnd ihre Zigarette?
Aus Melrose Place und Beverly Hills wusste ich, dass es bei uns jungen Leuten immer nur aus zwei Gründen zu Zerwürfnissen kam: Drogen/kriminelle Aktivitäten oder Leidenschaft. Leidenschaft konnte ich ausschließen, Caro war so leidenschaftlich wie eine Scheibe Graubrot. Aber kriminelle Aktivitäten? Drogen? Dieser Gedanke machte mir Angst. Oft wünschte ich Caro die Pest oder andere, zeitgemäßere Krankheiten an den Hals (eine Bindehautentzündung zum Beispiel, Akne oder Herpes), aber wenn ich einmal dachte, ihr könne wirklich etwas passiert sein – so wie, als sie einmal erst mitten in der Nacht nach Hause gekommen war, weil ihr Rad einen Platten hatte –, dann fuhr mir das als Schreck direkt in die Knochen, so, als hätte ich bei einer Treppe die letzte Stufe übersehen, als wäre ich gestolpert und gestürzt. Es war kein Schrecken in Gedanken; sondern ein körperlicher, der wohl mit Liebe zu tun hatte.
Jetzt war Caro also in Schwierigkeiten. Ich malte mir aus, wie ich meine Eltern mit ernstem Gesicht zum Familienrat bat. Vielleicht würden sie mich nicht gleich verstehen; schließlich hatten wir noch nie einen Familienrat abgehalten. »Wir müssen über Caro reden«, würde ich sagen, und dann würde ich ihnen eröffnen, dass ihre erstgeborene Tochter mit Koks dealte/ein Goldarmband geklaut hatte/dem Chemielehrer verfallen war.
Aber um eine solch erschütternde Botschaft zu überbringen, musste ich ihr Geheimnis ja erst einmal herausfinden. Kein Weg führte daran vorbei: Ich brauchte das Tagebuch.
Ich hatte genug Folgen Akte X geschaut, um zu wissen, dass man bei komplizierteren Missionen die größten Erfolgschancen hatte, wenn man als Duo ermittelte. Inga war nicht nur meine beste, sondern auch meine einzige Freundin, somit fiel meine Wahl auf sie, obwohl sie mir noch nie bei irgendetwas eine gute Komplizin gewesen war. Ihr fehlt jedes Talent zur Intrige, und immer wenn ich es geschafft hatte, sie zu etwas Verbotenem zu überreden, verbrachte ich weite Teile des Unterfangens damit, ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. So war es gewesen, als wir Whiskey aus der Hausbar ihrer Eltern getrunken, als wir den Schreibtisch ihres Vaters durchsucht und als wir den Schmuck ihrer Mutter anprobiert hatten. Wenn ich Inga dazu bringen wollte, etwas zu tun, bei dem von vornherein feststand, dass sie es bereuen würde, musste ich einen besonders eindringlichen Ton anschlagen, als ginge es um Leben und Tod und nicht bloß darum, etwas zu klauen oder herumzuschnüffeln.
»Wir müssen das Tagebuch finden«, sagte ich also. »Caro ist vielleicht in Lebensgefahr.«
»Ja, aber … Vielleicht redest du lieber einfach mit deinen Eltern?«, schlug Inga vor.
»Auf gar keinen Fall? Spinnst du! Wenn die rauskriegen, dass Caro irgendwas mit Drogen zu tun hat. Die stecken sie ins Heim.« Jetzt erschrak ich selbst ein wenig. Der Ernst der Lage wurde mir plötzlich bewusst. »Wir machen es Mittwoch Nachmittag, da ist sie nicht da.«
Mittwochnachmittag traf sich Caro mit ihren langhalsigen Freundinnen und ein paar Jungs aus ihrem Jahrgang auf dem Parkplatz vor dem Penny-Markt, um zu klauen oder Basketball zu spielen oder bloß auf dem Bordstein zu sitzen und dramatisch zu sein. Der Parkplatz lag direkt neben der Hochhaussiedlung, in der wir wohnten. Außer den Sechzehnjährigen hingen dort vor allem die Schnaps-Opas herum, laut Caro eine Art rivalisierende Gang aus alten Männern, die ebenfalls in den Hochhäusern oder in den Büschen wohnten. Eine explosive Mischung, und tatsächlich kam es oft zu Konflikten.
»Wir machen unseren Einkauf in Zukunft woanders«, drohte unsere Mutter wiederholt. Der nächste Supermarkt lag allerdings vier Straßen weiter, und außerdem hatte auch der einen dramatischen Parkplatz.
Im Austausch für ihre Mithilfe hatte ich Inga versprechen müssen, in der Woche drauf mit ihr ins Tierheim zu gehen, um dort einen lahmenden, halb blinden Dackel namens Mogli zu besuchen. Anders als Inga ließ ich mich eigentlich nie zu etwas überreden, und zunächst hatte sie wohl das Gefühl, einen großen und unwahrscheinlichen Sieg davongetragen zu haben. Mit dem Triumphgefühl war es aber spätestens vorbei, als wir uns in Caros Zimmer durch Boxen voller Make-up, Snickers-Papieren und Pom-Bär-Tüten sowie Schachteln mit Briefen und Zeitschriften wühlten.
»Ich glaube, das Tagebuch ist nicht hier«, flüsterte Inga, als ich gerade eine weitere große Box aus dem Kleiderschrank auf den Teppich wuchtete.
»Du musst nicht flüstern, es ist keiner da außer uns«, flüsterte ich zurück und hob den Deckel an. Die Kiste war randvoll mit Tüchern. Meine Schwester liebte Tücher, weil sie genau wie ich Fashion und Shopping liebte. Genau wie ich hatte Caro aber nie genug Geld und außerdem jene birnenförmige Figur, die wir auf keine uns bekannte Vorfahrin zurückführen konnten. Statt Fashion kaufte ich also winzige, an Briefumschläge erinnernde Taschen, in die nichts hineinpasste, und Caro Tücher, die sie in dieser Tuchtruhe verwahrte, in der vergeblichen Hoffnung, dass irgendwann ein besonderer Anlass anstünde, bei dem man ein elegantes Tuch tragen musste.
Wenn Caro beim Penny-Markt war, kam sie nie vor vier nach Hause, das war ein absolut verlässliches Gesetz. An diesem Nachmittag jedoch war alles anders. Es musste ein sechster Sinn sein, der Caro entweder mit mir oder mit ihrem Zimmer verband und der es sie wissen ließ, wenn die Grenze zu ihrem Hoheitsgebiet überschritten wurde. Vielleicht hörte sie ein Glöckchen klingeln, oder der Himmel über ihr färbte sich zornesrot, ultraviolett, giftgrün. Jedenfalls steckten wir gerade bis zu den Ellbogen in einer ihrer Kisten, als die Tür aufflog und meine Schwester hereinstürmte. Es war ein beeindruckender Auftritt, der noch mehr hergemacht hätte, wenn sie nicht über den Schuhkarton voller Briefe gestolpert wäre, den wir neben der Tuchkiste ausgeleert hatten. Caro legte sich lang, und einer ihrer Dockers flog durch den Raum, was so komisch aussah, dass ich lachen musste. Ich lachte nur sehr kurz, dann quiekte ich erschrocken, und Inga quiekte mit mir, und wir sprangen beide auf, hasteten aus dem Raum, halb auf allen vieren, halb rannten wir.
»Ihr Pissköpfe!«, schrie Caro uns hinterher. »Ihr verschissenen Kackbratzen. Ich krieg euch!«
Sie jagte uns durch die Wohnung, durchs Treppenhaus, raus auf die Straße, bis auf den großen Parkplatz. Erst dort gelang es uns, sie abzuschütteln. Das zumindest war es, was wir uns gegenseitig in den nächsten Tagen und Wochen erzählten. »Aber dann haben wir sie doch noch abgehängt«, endete ich den Bericht stets, wenn wir das Ganze Revue passieren ließen, und Inga nickte, ja, ja, so war es gewesen. Gut möglich, dass ich es oft genug gesagt hatte, damit Inga es glaubte, ich selbst wusste es besser: Wir hatten meine Schwester nicht abgehängt, sie hatte alles, was ich nicht hatte: Kondition, Körperintelligenz, kräftige Wadenmuskeln. Die Wahrheit war: Caro hatte plötzlich aufgegeben, weil ihre Wut auf uns zwar groß war, ihre Faulheit jedoch viel größer. Außerdem hatte sie ihre Dockers-Schuhe getragen, die hinten offen waren und in denen sie kaum von der Stelle kam.
Immer wenn Inga und ich über diesen Nachmittag sprachen – was wir oft taten, es passierte ja sonst nicht viel –, dann fragte sie mich früher oder später: »Was hätte Caro mit uns gemacht, wenn sie uns erwischt hätte?«
»Ach, die! Gar nichts!«, antwortete ich leichthin, in einem unbekümmert höhnischen Ton. Tatsächlich hatte ich keine Ahnung. Die Hälfte der Zeit war meine Schwester bereits so erwachsen, dass sie bloß die Nase rümpfte, wenn ich sie mit Kaugummipapieren bewarf oder mich ihr an den Hals hängte, weil ich huckepack getragen werden wollte. Die andere Hälfte aber war sie unberechenbar, kniff und kratzte und biss. Am schlimmsten war es, wenn sie sich mein Ohr packte und daran drehte.
Ein paar Monate später und nach einem besonders heftigen Streit, bei dem Caro eine meiner Akte X-Videokassetten über einer Feuerzeugflamme angeschmort hatte, machte sie mir als Geste der Reue ein unerwartet großzügiges Geschenk und gestand, dass es nie ein Tagebuch gegeben hatte. Wir lachten darüber, bis uns die Bäuche schmerzten. Ich kannte die Tricks meiner Schwester und wusste außerdem, wie schreibfaul sie war. Dass ich auf sie hereingefallen war, verblüffte mich selbst ein wenig.