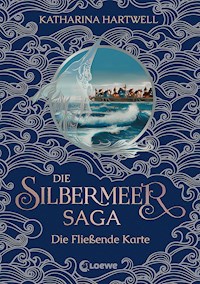
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Silbermeer-Saga
- Sprache: Deutsch
"Manche von uns müssen durch die Angst gehen, um zu werden, wer sie sind." Hoch oben im nördlichen Teermeer vermutet Edda ihren kleinen Bruder Tobin, der vom Krähenkönig entführt worden ist. Um ihn zu finden, braucht sie ein Schiff. Und die Fließende Karte. Denn die Lage der Inseln in der Silbersee verändert sich ständig und die Reise in den Norden ist weit und gefährlich. Edda findet heraus, dass die kostbare Karte beim Volk der Irsu auf den Regen-Inseln aufbewahrt wird. Voller Hoffnung bricht sie dorthin auf. Und findet in Pantemin einen Gefährten, der sie fasziniert – und gleichzeitig von ihrem Jugendfreund Teofin entfremdet. Ein sagenhaftes Inselreich hoch im Norden, eine Welt voller fantastischer Wesen und eine starke Heldin bilden den Mittelpunkt von Katharina Hartwells hinreißender und sprachgewaltiger Nordic-Fantasy-Trilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 815
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Die Geschichte der Heiligen Schwestern
Prolog
Mit Schrecken und Verwunderung
Kaum eine Zunge
Das Herz
Bella Soot
Edda Valt hat die Ehre
Bela-Haven auf Bela-Haven
Dakon
Die Diebin
Ein Umweg
Edda Knochenbrecher
Geständnisse
Nach dem Angriff
Gewählte Erste
Verluste auf beiden Seiten
Indrid
Im Schädelkreis
Abene
Das Mädchen
Fall und Aufstieg der kleinen Schwester
Blaue Lichter
Im Haus des Roten Pfuhls
Din Moia
Halbtot
Ein Junge kauft ein Messer
Die Schönheit und der Schrecken
Ein dunkleres Blau
Der Preis
Gant
Der Norden, die See, der große Schlund
Neue Namen
Meeresstürmer
Hurd Norden
Agnosh und Agnoshka
Für alle, die unterwegs sind
Die Schwestern wurden unter einer Blutsonne geboren, und dies, so erzählte man sich im Dorf, war das erste Zeichen. Ihre Mutter nannte sich Inge und hatte ihr ganzes Leben in Colm verbracht. Es war ein Leben voller harter Arbeit und ohne besondere Ereignisse. Bis zu jenem Sommertag, in dem Inge nicht bloß ein, sondern gleich zwei Kinder zur Welt brachte. Die Erstgeborene nannte sie Agatha, und die Zweitgeborene nannte sie Lor. Während Agatha kräftig war und schrie, dass man es noch in Maunland hören konnte, schien Lor zunächst mehr tot als lebendig. Niemand im Dorf glaubte, dass sie leben würde. Doch als die Nacht kam, stahl sich Farbe in ihr Gesicht, und sie stieß Schreie aus, die laut waren wie die ihrer Schwester.
Im großen Festsaal des Fischhauses feierte man bald ein Fest zu Ehren von Inges Töchtern. Zwei Kinder auf einen Schlag! Dies musste ein gutes Zeichen sein. Doch auf die hellen Tage folgten dunkle, und bald hatte man Freuden und Feste vergessen, denn ein harter Winter suchte die Küste heim. Auch das Frühjahr brachte kaum Erleichterung. Morgens fuhren die Fischer zur See, und abends kehrten sie mit leeren Netzen zurück. Weder fingen sie solche Fische, die man verzehren, noch solche, deren Schuppen man zu Colminbrei stampfen und teuer an die Händler verkaufen hätte können. Ohne Handel gab es keinen Reis und keine Linsen und also nur wenig zu essen.
In Colm lebte eine alte Frau namens Solve. Manche sagten, sie sei eine Hexe, und andere sagten, sie sei bloß ein gehässiges Weib. In jener Zeit der großen Not begann sie, dunkle Wahrheiten im Dorf zu verbreiten. Laut Solve waren die Blutsonne und die Hungersnot bloß erste Boten und kündeten von einem noch größeren Unglück: Eine Flut würde über die Küste hinweggehen und alle Häuser, Tiere und Menschen mit sich reißen. Jeder wisse, erklärte Solve, dass Zwillingskinder die Schatten und das Unglück anzögen. Um die See zu besänftigen, müsse man ihr ein Opfer bringen und die Mädchen ins Meer schicken.
Aber die Mädchen könnten nicht schwimmen!, warf einer ein.
Die Mädchen sollten auch nicht schwimmen!, zischte Solve zurück. Ihre Lungen sollten sich mit Wasser füllen und ihre Körper schwer dem Meeresgrund entgegensinken. So würden sie der See gehören, und die See würde die Küste verschonen.
Auch Inge hörte Solves Reden und sprach ihnen Tag und Nacht entgegen. Solve sei schon immer niederträchtig gewesen und von schwarzem Herzen, rief Inge, und die Bewohner Colms stimmten ihr zu. »Lass Solve reden«, sagte einer. »Die alte Hexe garbelt bloß wieder mit gedrehter Zunge«, sagte ein anderer.
Doch ein harter Winter reihte sich an den nächsten, und Solves Zunge stand nicht still. Die beiden Schwestern saßen der Alten wie ein Dorn in der Ferse. Wer kann heute noch sagen, warum. Vielleicht, weil die Schwestern jung waren und feines blondes Haar und klare blaue Augen hatten. Vielleicht, weil sie nie einsam waren und immer einander hatten. Vielleicht, weil sie von Mutter und Vater geliebt wurden. Vielleicht, weil da etwas in ihren Adern kreiste, das auch Solve spürte, nur dass es längst nicht so schnell und kräftig floss. Auch eine Hexe ist vor Eifersucht nicht gefeit, und in Solve wütete sie wie ein schwarzes Gift.
Jahr um Jahr sprach Solve in die Ohren der Fischer und ihrer Frauen, wisperte und flüsterte, fragte und beantwortete im gleichen Atemzug selbst. Wann hatte die erste Hungersnot das Dorf heimgesucht? Im selben Jahr, in dem Agatha und Lor geboren worden waren! Welche Farbe hatten die Augen der Schwestern? Silberseegrau! Was war in der Woche nach ihrer Geburt geschehen? Es hatte ein Gewitter gegeben! Zeichen, allesamt!
Und während Solve sprach, blieben die Fische aus, und die Menschen Colms aßen nichts als dünne Suppe und bittere Blätter, und sie waren bald ganz schwach in ihren Bäuchen, und dann in ihren Köpfen, und dann in ihren Herzen. »Solve ist alt und weise«, murmelte erst der eine. »Hört auf die Worte der Hexe, sie wird es wissen«, behauptete ein anderer.
Als die Dorfbewohner schon so abgemagert waren, dass sie ihre Rippen unter der Haut zählen konnten und ihnen die Haare in Büscheln ausfielen und sie nachts von nichts anderem mehr träumten als dem Reisbrei, den sie früher oft leid gewesen waren, beschlossen sie, eine Versammlung abzuhalten.
»Wer von euch glaubt, wir sollten die Schwestern in die See schicken?«, fragte Gunnar Bragnor, und beinahe jeder Mann und beinahe jede Frau hob die Hand, und Inge ging ohne ein Wort aus dem Fischhaus.
Als der Tag kam, da man die Mädchen hinunter zum Strand führen wollte, färbte man zunächst ihre Kleider rot. Rot sei eine heilige Farbe und werde sie schützen, erklärte man ihnen. In Wahrheit aber fürchtete man bloß, dass die See die Schwestern früher oder später wieder ausspucken würde. Ihre Leiber sollten fortgeschafft werden, bevor Inge oder ihre Schwester Solfried sie fanden.
Beinahe das ganze Dorf geleitete die Mädchen hinunter zum Strand. Die Schwestern hielten einander an den Händen, als sie in die weiß schäumende Gischt traten. Hinter sich hörten sie die Mutter weinen. Gleich zwei Männer mussten Inge an den Armen halten, damit sie den Töchtern nicht nachlief.
Kalt war das Wasser, das Agathas und Lors Schuhe tränkte. Bald ging es ihnen bis zu den Knien, den Hüften, bis zur Brust, zum Kinn, zur Nase. Und die Schwestern fühlten, wie die See sie packte und davontrug, fort von der Küste, fort von Colm, von Solve und ihrer Mutter Inge, die sich noch immer den Armen der Fischer zu entwinden suchte und schrie, bis ihr die Stimme heiser wurde.
Die Schwestern wussten, dass es ihr Schicksal war, zu sinken wie Steine, und dass sie in den graukalten Meerestiefen den Tod finden würden. Sie zappelten und strampelten nicht. Doch statt sie auf ihren Grund hinabzuziehen, nahm die See die Schwestern bloß mit sich, trug sie hinaus zu den ersten Inseln des Archipels.
Die See war groß und gab wenig auf die Weissagungen einer Hexe. Die See wollte keine Opfer. Was sollte sie mit Opfern, wenn sie sich nehmen konnte, was immer sie begehrte? Behutsam legte sie die Mädchen am Ufer einer Insel ab, die den Namen Ootland trug. Auf ihr lebte eine Frau zusammen mit einer Wolfshündin, und diese Frau hieß Felma.
Felma zog die beiden Mädchen groß. Sie lehrte sie das Wissen über die Blumen und Gräser und Bäume, aber sie unterrichtete sie auch in Hexendingen, weil sie den Mädchen ansehen konnte, dass sie mit einem Fuß in der Welt der Menschen und mit dem anderen in der Welt der Sprachzauber standen.
Wie die meisten Hexen liebte auch Felma die Stille und brauchte keine andere Gesellschaft als die ihrer Wolfshündin. Als sie den Mädchen das ein oder andere Alte Wort beigebracht und ihnen gezeigt hatte, wie man in den Knochen las und eine Nachricht in ihnen versteckte, und als die Mädchen im Grunde keine Mädchen mehr waren, sondern junge Frauen, da schickte Felma sie fort.
Agatha und Lor mussten nicht lange suchen, bis sie eine Insel fanden, die ihnen gut gefiel. Sie nannten sie Horvig und von hier an ihr Zuhause. Auf Horvig gab es nicht viel: karges, steiniges Land und spärlich wachsendes Gras und genau in der Mitte einen Hügel. Hier errichteten die beiden Schwestern einen Turm. Sie bauten ihn aus Steinen und Alten Worten, und wenn sich ein Reisender der Insel näherte, dann sah er einen großen Baum oder einen steil aufragenden Felsen, aber nie einen Turm.
Die Schwestern führten ein ruhiges Leben auf Horvig. Manchmal dachten sie an ihre Mutter, aber sie wussten, dass sie niemals nach Colm zurückkehren konnten.
Wenn den Schwestern nach Abenteuern und Abwechslung gewesen wäre, hätten sie jederzeit auf Reisen gehen können, aber sie gaben nichts auf Reisen.
Wenn ihnen nach Besuch gewesen wäre, hätten sie jederzeit Reisende anlocken können, aber sie gaben nichts auf Besucher.
So verstrichen die Jahre, und ein Jahrzehnt reihte sich ans nächste, und die Haare der Schwestern färbten sich grau und ihre Haut wurde rau und gegerbt von der Sonne. Sonst aber geschah wenig. Keine Gefahren und keine Wunder, und den Schwestern war es recht so, denn sie hatten genug von Gefahren und Wundern. Und hätte man Agatha gesagt, dass sie nie wieder mit jemand anderem als Lor sprechen würde, so wäre es gut gewesen. Und hätte man Lor gesagt, dass sie nie wieder mit jemand anderem als Agatha sprechen würde, so wäre es gut gewesen.
Doch es kam anders.
Eines Morgens, nachdem ein großer Sturm durchs Inselreich gegangen war, schaute Lor im höchsten Zimmer des Turms aus dem Fenster und sah, dass ein Boot in der Brandung lag. Sie rief ihre Schwester, und zusammen gingen sie hinunter zum Wasser.
In dem Boot lag ein Junge. Er hatte die Augen geschlossen. Auf seiner Stirn prangte eine blutige Wunde, und er rührte sich nicht, seine Brust aber hob und senkte sich noch.
»Zurück ins Wasser oder hinauf in den Turm?«, fragte Lor ihre Schwester, denn es war immer Agatha, die Ältere, die wichtige Entscheidungen traf.
Agatha wiegte den Kopf. Für einen Jungen hatten die Schwestern so viel Verwendung wie für einen Wassermann oder eine Königskrake. Es wäre ein Leichtes gewesen, das Boot zurück in die Brandung zu schieben und die See darum zu bitten, ihn fortzuschaffen. Aber die See hatte ihnen den Jungen schließlich überhaupt erst gebracht. Und Agatha erinnerte sich, wie Lor und sie einst an einer Insel angespült worden waren und wie Felma sich ihrer angenommen hatte. Vielleicht war es an der Zeit, eine Schuld zu begleichen. Sie kniete sich neben das Boot in den Sand, fuhr dem Jungen übers Haar und griff sich eine Strähne. Der Junge roch nach Blut und Rost, er roch nach etwas Verborgenem, einem Geheimnis, von dem er selbst nichts wusste.
Agatha seufzte schwer und ließ sich von ihrer Schwester aufhelfen. Hier unten am Wasser konnte sie die Jahre fühlen, die sie in sich trug, in den Knochen, im Schädel, im Herzen. Sie schaute auf den Jungen hinab.
»Hinauf in den Turm.«
Wie der Zufall, das Schicksal, der allwissende Kraken Hager oder die bisweilen durchtriebenen Wassergeister Ood, Bingin und Geki es so wollten, stammte der Junge, den die beiden Schwestern an jenem Morgen fanden, aus ihrer Heimat Colm. Er hatte das Licht der Welt erblickt gut ein halbes Jahrhundert, nachdem die Schwestern in die See und in den Tod geschickt worden waren. Seine Eltern gaben ihm den Namen Teofin, und zunächst schien ihnen nichts fehl an ihrem Kind. Es hatte die richtige Anzahl an Fingern und Zehen, es hatte wache, klare Augen und einen feinen Flaum auf seinem Kopf. Auch seine weichen Glieder waren wohlgeformt. Doch die Jahre verstrichen, und als der Junge längst hätte laufen sollen, da lief er noch immer nicht, und der Apotheker und seine Frau lachten nicht mehr über seinen stolpernden, taumelnden, wankenden Gang. Gleich wie sehr sich der Junge anstrengte, sein Bein gerade zu halten, es stand krumm und schief, und die Schmerzen lehrten ihn früh, sich vor der Welt in Acht zu nehmen. Doch gab es auch vieles, wofür er den Heiligen Schwestern jeden Abend dankte: Seine Mutter war fürsorglicher und nachsichtiger als die anderen Mütter. Sein Vater nahm sich die Zeit, ihm das Lesen und Schreiben beizubringen. Und auch wenn die anderen Jungen ihn oft durchs halbe Dorf jagten, hatte er eine Freundin, Edda, die ihm nah war wie eine Schwester. An eine Zeit vor Edda konnte er sich nicht erinnern.
Genau wie seine Mutter, sein Vater, die Sonne und die See schien sie schon immer da gewesen zu sein. Die Wahrheit aber war eine andere: Anders als er selbst, als Hans Piel und Ilsa und Hensy Moot und alle anderen Kinder Colms waren Edda und ihr Bruder Tobin nicht in Colm geboren, sondern eines Nachts von dem Fischer Ruben Valt auf dem Dorfplatz gefunden worden.
Die Sommer waren oft anstrengend und voller Arbeit und die Winter bedrückend und voller Kälte. Beides wusste Teofin zu ertragen. Es war das Frühjahr, vor dem ihm graute. Denn jedes Jahr zur Zeit der Kaltwochen, wenn der Winter noch einmal aufbegehrte, wurde dem Fischerdorf ein Kind genommen. Niemand hätte sagen können, wer es sich holte und zu welchem Zweck. Obwohl man sich an den Bottichen hinter dem Fischhaus viele Geschichten erzählte, gab es keinen, der etwas bemerkt hätte. Keine zwielichtige Gestalt, kein meerfernes Geschöpf war in den Gassen des Dorfes gesichtet worden. Bald erzählte man sich darum, dass es die See selbst sein müsse, die sich die Kinder geholt hatte. Den Bewohnern Colms blieb nur ein einziger Trost: In jedem Jahr war es nur ein Kind, das verschwand.
In dem Frühjahr, bevor Teofin an der Küste Horvigs angespült wurde, traf es Hensy Moot, und wie in jedem Jahr kam eine große Trauer über das Dorf, gefolgt von einer noch größeren Erleichterung. Hensy war fort, den anderen Kindern würde nichts geschehen. Doch in diesem Jahr war etwas anders als in all den Jahren zuvor. Ein Fremder war nach Colm gekommen, ein Mann mit weißem Haar und milchig blauen Augen, der sich Talin Brand nannte. Kurz nach seiner Ankunft verschwand Hensy, und obwohl der letzte Schnee noch nicht gefallen war, hielt man das Feuerfest ab – viel zu früh und beinahe so, als wolle man die See herausfordern. Und tatsächlich, wenige Tage später verschwand ein weiterer Junge – nicht irgendeiner, sondern Eddas Bruder, Tobin Valt.
In den Jahren zuvor war es immer das Gleiche gewesen: Nachdem das Gefürchtete eingetreten, ein Junge oder ein Mädchen von der Nacht, dem Wind oder der See davongetragen war, suchte man nach ihnen, ohne Hoffnung, sie zu finden. Man fand sie nicht.
Die ohnehin schon schweigsamen Väter wurden noch ein wenig schweigsamer. Die Mütter legten ihre schwarzen Trauerkleider an und zogen sich in ihre Häuser zurück, um am Ende ihrer Trauerwoche ein wenig älter, gebeugter, grauer wieder hervorzukommen. Sie schrien und sie weinten nicht, weil es nicht die Art der Menschen Colms war, aber sie trauerten um ihre Töchter und Söhne, und ihre Trauer war groß. Wie es kam, dass nicht einer von ihnen sich auf die Suche nach den verschwundenen Kindern machte? Nun, die Fischer und ihre Frauen fürchteten die Welt jenseits ihres Dorfs, das Land genau wie die See. Sie sagten sich: Wenn die See sich die Kinder geholt hatte, dann waren sie verloren. Wenn die Wassermänner in der See sich die Kinder geholt hatten, dann waren sie verloren. Wenn jemand aus dem Inselreich sie zu sich geholt hatte, dann waren sie erst recht verloren, denn das Inselreich war der gefährlichste Ort der Welt, und die Menschen der Küste, einfache Menschen, ehrliche Menschen, konnten unmöglich zu Hexen und Seegespenstern und sprechenden Echsen und Wassermännern hinausfahren. Pelle hatte nicht fahren können, als Hensy verschwunden war. Bogard hatte nicht fahren können, als Klaas verschwunden war. Der dünne Ulf hatte nicht fahren können, als Jonas verschwunden war.
Nur Edda, Edda Valt, Edda Knochenbrecher konnte fahren.
Und sie fuhr.
Später, als Edda die Küste längst verlassen hatte, zusammen mit Talin Brand ins Inselreich aufgebrochen war, fragte Teofin sich oft, wann er gewusst hatte, dass sie gehen würde.
Vielleicht an dem Tag, als sie begonnen hatte, sich nach dem Mann ohne Farben zu erkundigen.
Vielleicht an dem Tag, als sie darauf bestanden hatte, die Hexe Maron in ihrer Höhle im Fels aufzusuchen. Vielleicht als sie der Hexe die schwarze Krähenfeder aus Tobins Zimmer gezeigt hatte.
Vielleicht auch, als Ilsa Bragnor im Fischhaus zum ersten Mal vom König der Krähen sprach, einem Gefiederten, halb Mann, halb Vogel, der angeblich die Kinder Colms zu sich ins Inselreich holte.
Sicher sagen konnte Teofin es nicht, aber als Edda eines Abends zu ihm kam, um Abschied zu nehmen, da war er nicht überrascht, zumindest nicht, bis er verstand, dass sie hoffte, er würde mit ihr kommen. Er, Teofin Bornholm, mit dem krummen Bein und dem Mauseherzen! Wusste sie denn nicht, dass er so wenig ins Inselreich fahren konnte, wie er fliegen oder zum Meeresgrund hätte tauchen können?
Sie musste es wissen, und trotzdem zwang sie ihn, die Worte zu sagen. Ich wünschte, aber ich kann nicht. Es waren ja einfache Worte, weder dunkel noch alt, und trotzdem wirkten sie wie ein Zauber. Ließen ihn schrumpfen. Edda hatte geglaubt, dass er trotz der Angst, trotz seines krummen nutzlosen Beines mit ihr kommen würde. Sie, die ihn besser kannte als jeder andere, hatte ihn für mehr gehalten, als er war.
Teofin musste neben Ruben und der Hexe Maron einer der Ersten im Dorf gewesen sein, der gewusst hatte, dass Edda Colm verlassen würde, und doch war er einer der Letzten, der es verstand. In den Wochen nach ihrem Verschwinden hielt er in den Gassen noch immer Ausschau nach ihr. Stand wie ein Tumbtaumler im langen Flur des Fischhauses und starrte die Tür an, überzeugt, dass sie jeden Moment hindurchtreten würde. Auf dem Weg nach Hause meinte er zu hören, wie sie seinen Namen rief. Und immer wieder ertappte er sich dabei, ihr dieses oder jenes erzählen zu wollen. Seine Mutter hatte einen Kuchen mit Äpfeln gebacken! Ilsa hatte im Festsaal einen Holzlöffel nach ihrer Mutter geworfen.
Edda erfuhr so wenig von dem Apfelkuchen wie von dem geworfenen Löffel. Was immer nun in Colm geschah, es hatte nichts mehr mit ihr zu tun. Und umgekehrt wusste er nichts von dem, was sie erlebte. Ob sie bereits Marons Schwester Felma gefunden hatte, ob Talin Brand noch an ihrer Seite war. Ob sie in Gefahr war. Ob sie in Gefahr war, gerade in diesem Augenblick, da seine Mutter ihm einen Teller mit Reisplätzchen reichte. Zehn Jahre lang war kaum ein Tag verstrichen, an dem er nicht um ihre Sorgen, ihre Hoffnungen und Gedanken gewusst hatte. Und nun, nun war sie so weit weg, dass sie genauso gut tot sein könnte. Sie könnte tot sein.
Eines Nachts schließlich schreckte Teofin auf; das Herz hämmerte ihm, als sei er von etwas im Zimmer geweckt worden, aber es war totenstill. Er starrte ins Dunkel, wartete darauf, einen Finstertentakel unter dem Bett hervorkriechen oder Talin Brand aus den Schatten treten zu sehen.
Da war nichts, da war niemand. Er war allein.
Auch in der nächsten Nacht erwachte er und in der danach. Der Schlaf spuckte ihn aus und wollte ihn nicht wieder zurücknehmen. Teofin kannte diesen Druck, diese wabernde Angst. Etwa weil Hans Piel angekündigt hatte, sich ihn am nächsten Tag vorzunehmen, oder weil die Kaltwochen angebrochen waren. Aber nun stand ihm nichts bevor, das Schlimmste war schließlich bereits eingetreten. Er hatte Edda und Tobin, die einzigen Freunde, die er je gehabt hatte, verloren. Somit gab es für ihn jeden Grund, traurig zu sein, aber keinen, sich zu fürchten. Die Schrecken lagen draußen in der See, im Reich der Inseln, an Orten, die er nie je betreten, die er nie mit eigenen Augen sehen würde. Warum lag er dann Nacht um Nacht wach und ängstigte sich vor Wassermännern und Hexen, vor Finstertentakeln und Seegespenstern?
Er würde Colm nie verlassen, das stand fest.
Er würde die Küste nie verlassen, das stand fest.
Er würde niemals hinaus ins Inselreich fahren! Was auch immer geschah, niemals würde er dort hinausfahren.
Viele Wochen später, als Teofin Edda gefunden hatte und sie einander im Akobaner Quartier des Händlers Nevin Goldzahn gegenübersaßen, da wollte Edda von ihm wissen, warum er die Küste erst hatte verlassen können, als sie bereits gegangen war, und nicht, als sie ihn darum gebeten hatte.
Er wollte ihr antworten, aber wie sollte man einer, die gegangen war, erklären, was es bedeutete zu bleiben? Dass es manchmal nicht damit getan war, den Schrecken aus dem Weg zu gehen, weil sich die Schrecken dann bloß auf den Weg zu einem machten. Dass man manche Entscheidungen gar nicht selbst traf.
Eines Abends hatte Teofin sich dabei ertappt, wie er die Treppe im Haus seiner Eltern hinunterschlich. Mit Schrecken und Verwunderung hatte er beobachtet, wie er durch die verlassenen Gassen zum Strand und weiter zu Marons Hütte lief, mit Schrecken und Verwunderung hatte er gelauscht, wie er Maron um Hilfe bat, behauptete, Edda ins Inselreich folgen zu wollen. Und dann war es, als habe er etwas in Gang gesetzt, das sich von ihm so wenig aufhalten ließ wie ein Sturm oder eine Flut. Plötzlich saß er nicht mehr in der Höhle der Hexe, sondern in der Stube von Eddas Ziehvater Ruben. Hörte verwundert zu, wie Ruben davon sprach, dass er Teofin das Segeln beibringen wolle. Und weil all das wie im Traum geschah, nahm er keinen Abschied von seinen Eltern. Sollte er zu seiner Mutter die Worte sprechen – Ich muss ins Inselreich fahren, um Edda zu finden –, würde er aufwachen. Also schrieb er die Worte bloß in einen Brief, spät eines Nachts, als seine Eltern bereits schliefen. Sie sollten sich nicht um ihn sorgen, er würde Edda finden und zurück nach Colm bringen. Und noch während er schrieb, wusste er, dass er log. Seine Eltern hatten allen Grund, sich Sorgen zu machen, vermutlich würde er Edda weder bald noch überhaupt irgendwann finden, und selbst wenn, würde Edda Valt, Edda Knochenbrecher sich weder von ihm noch einem dreiköpfigen Riesen zurück an die Küste bringen lassen.
Sein ganzes Leben lang hatte Teofin sich vorgestellt, die Silbersee müsse überlaufen vor Ungeheuern, vor Wassermännern, Drachenrochen, Finstertentakeln und Seegespenstern. Während seiner ersten Tage draußen auf See schien es ihm allerdings, als sei er die einzige lebende Kreatur im ganzen Archipel, und als nach Tagen ereignislosen Segelns ein Sturm aufzog, da war er beinahe dankbar, dass endlich etwas geschah. Mit Stürmen schließlich war er aufgewachsen und glaubte, sie gut zu kennen. Doch ein Sturm auf See hatte wenig gemein mit einem Sturm an Land. Sicher hatte Teofin die Fischer von wogenden, tosenden Wellen sprechen hören und harschen Winden, welche die eigenen Knochen zum Klappern brachten. Er hatte von den Massen an Wasser gehört, Tropfen Wasser, dünne Fäden Wasser, endlose Felder Wasser, Wasser über einem, unter einem, Wasser auf der eigenen Haut, in den Ohren und den Augen und den Schuhen, doch nichts davon hatte ihn auf diese Gewalten, die Winde und hochschlagenden Wellen vorbereitet.
Die Wellen ließen das Boot scheuen wie ein bockiges Pferd. Der Bug hob sich steil in den dunklen Himmel und senkte sich so scharf ab, dass Teofin taumelte, stolperte, stürzte. Rasch rappelte er sich wieder auf, stürzte erneut und schlug mit der Stirn gegen den Mast. Er brachte seine Hände vors Gesicht. Kurz sah er noch Blut zwischen den Fingern hindurchrinnen, dann sickerte ihm die Schwärze des Gewitterhimmels in den Kopf.
***
Als er erwachte, lag er in einem Bett, an dessen Fußende zwei Frauen saßen. Die eine sah ihn aufmerksam an, die andere – sie musste alt wie das Meer sein – schaute ins Leere, ein milchiger Schleier auf ihren Augen. Teofin versuchte, sich aufzurichten, aber sein Schädel ruhte wie eine Eisenkugel auf dem Kissen, und schon dämmerte er wieder fort. Er schlief, wachte wieder auf, schlief, wachte auf, und immer saß zumindest eine der beiden Frauen an seinem Bett. Sie führten Löffel mit heißer Brühe oder Becher mit kaltem Wasser an seine Lippen. Irgendwann brachte er erste Worte hervor: Wo war er?
Auf Horvig, antwortete ihm die Frau mit den klaren Augen. Ihr Name sei Lor und der ihrer Schwester Agatha.
Teofin nickte und lächelte und schloss die Augen, weil er wusste, dass er sich noch immer in den Wirren eines sonderbaren Traums befand.
Aber auch als er das nächste Mal zu sich kam, bestanden die beiden Frauen darauf, dass ihre Namen Agatha und Lor seien.
»Agatha und Lor wie die Heiligen Schwestern?«, fragte Teofin, und die Frauen zuckten die Achseln. Sicher, sie waren Schwestern und sie stammten aus Colm, aber sie waren so wenig heilig wie diese Stechmücke dort drüben auf dem Fensterbrett. Sie erzählten ihm von ihrer Mutter Inge und der großen Hungersnot, von Solve und wie sie die Dorfbewohner dazu gebracht hatte, die Schwestern in den Tod zu schicken.
Ihre Worte klapperten und rappelten hinter Teofins Stirn. Diese grauhaarigen Alten mit den sehnigen Armen und tiefen Stimmen sollten die beiden steinernen Mädchen im Heiligen Haus sein? Aber daran, dass sie aus Colm stammten, konnte kein Zweifel bestehen. Lor etwa kannte die Namen von Gunnar Bragnor, der Bent Bragnors Großvater gewesen war, und von Bore Bornholm, der Teofins Urgroßvater gewesen war.
Die Schwestern schien es nicht im Geringsten zu verwundern, dass einer aus ihrer Heimat an ihrer Insel angespült worden war. Zeigten sich weder erfreut, einen aus Colm zu sehen, noch verärgert darüber, dass er ein Sohn jenes Dorfes war, das sie einst in den Tod geschickt hatte.
Drei Mal am Tag brachten sie ihm Schalen, gefüllt mit schwarzem Reis und Meerestieren, und Tassen mit bitterem Tee. Auf seinen Dank gaben sie so wenig wie auf seine Gesellschaft. Agatha, mehr noch als ihre Schwester, machte keinen Hehl daraus, dass ihr der ungebetene Besuch eine Last war. Sie richtete kaum je das Wort an ihn, seufzte bloß schwer oder verzog missbilligend den Mund, wenn er seinen Reis nicht aß.
Zunächst war er zu schwach, um seine Kammer zu verlassen. Von seinem Bett aus beobachtete er durch ein Fenster die Möwen am Himmel. Er sah die Sonne unter- und auf- und unter- und aufgehen, bevor er sich kräftig genug fühlte, um sich zu der kreisrunden Öffnung im Boden zu schleppen, die zu einer Wendeltreppe führte. Bei dem Anblick sank ihm das Herz. Selbst an guten Tagen tat er sich mit Treppen schwer. Den Blick starr auf seine Stiefel gerichtet, schob er sich an der Wand entlang, wagte erst, den Blick zu heben, als er unten angelangt war. Er stand in einer großen Wohnstube. Auf dem Boden lagen Flickenteppiche, hinter einem breiten Tisch befanden sich eine Feuerstelle sowie eine Anrichte, überladen mit getrockneten Kräutern, Baumfrüchten und Seealgen, Flaschen mit trüben Tränken, Silberdosen und aufwendig verzierten Holzschatullen. Agatha hielt eine Suppenkelle in der Hand und Lor einen Besen, und beide starrten ihn an. Teofin sah zu Boden, die Wangen brannten ihm. Er hasste es, daran erinnert zu werden, wie andere ihn sahen, sein krummes Bein, seinen ungelenken Gang. So schnell er konnte, hastete er durch den Raum, schlug draußen den nächstbesten Pfad ein. Allmählich blies ihm der Wind die Hitze aus dem Schädel, und er wurde der Insel gewahr. Horvig erinnerte an die karge Ostküste, die Landschaft steinig grau und nur spärlich bewachsen. Ein paar Bäume standen zwischen gelblichen Gräsern und Büschen, die vertrocknete Beeren trugen; große flache Felsen säumten das Ufer. Nach kurzer Zeit fand er Rubens Boot. Die beiden Frauen hatten es mit einem dicken Seil an einem Baum festgemacht. Er kletterte hinein, stützte die Arme auf den Knien auf und starrte eine Weile den Mast an, den dunklen Abdruck auf dem Holz, dort, wo er mit der Stirn aufgeschlagen war.
Später am Abend, als er sich längst wieder die gewundene Treppe hinaufgeschleppt hatte, tauchte Lor in der Kammer auf. Nachdem sie ihm eine Schale mit schwarzem Reis und einem traurig aussehenden Häufchen grüner Blätter gereicht hatte, ließ sie sich auf einem Schemel neben seinem Bett nieder. »Meine Schwester und ich, wir können dir helfen«, behauptete sie. »Wir können die Schmerzen aus deinem Bein nehmen.«
Obwohl Teofin keinen Hunger hatte, begann er hastig zu essen. Musste seine Hände irgendwie beschäftigen. Der Reis, klebrig auf seiner Zunge, schmeckte nach nichts. Die Schmerzen aus seinem Bein nehmen? Teofin lebte mit den Schmerzen, seitdem er vor gut fünfzehn Jahren an den Händen seiner Mutter die ersten wackligen Schritte getan hatte. Es gab kein Heilmittel, sonst hätte sein Vater, der Apotheker, oder seine Mutter mit ihrem Kräuterwissen es längst gefunden.
»Ich will nichts mit der Alten Sprache zu tun haben«, sagte er.
»Es braucht keine Alten Worte, um die Schmerzen aus deinem Bein zu nehmen. Bloß zwei geschickte Hände.«
Er verzog die Lippen zu einem abfälligen Grinsen. Lor musste ihn für einen Tumbtaumler halten. Keine gewöhnlichen Hände – und seien sie auch noch so geschickt – würden sein Bein heilen können. Man würde es schon aus dem Gelenk drehen und neu festschrauben müssen. Er senkte den Kopf, um die schwarzen Reiskörner in der Schale zu zählen.
»So schlimm ist es nicht«, murmelte er.
»Schlimm genug, um dich wie einen alten Mann laufen zu lassen«, stellte Lor gleichgültig fest, drehte sich um und glitt geräuschlos die gewundene Treppe hinunter.
Er lag lange wach in dieser Nacht. Die Schmerzen aus dem Bein nehmen. Wie einen Dorn, den man aus der Wunde zog, wie eine Scherbe, einen Splitter, der lange und tief im Fleisch gesessen hatte. Er presste eine Hand gegen das Bein, das elende Bein, versuchte, nicht an Lors Worte zu denken, und dachte an Lors Worte. Geschickte Hände, ha. Wohl eher schwarze Zungen. Die Hexe log, ganz sicher. Er lockerte den Druck seiner Faust. Aber hatte Lor einen Grund zu lügen? Tagelang hatte er hilflos in ihrem Bett gelegen. In dieser Zeit hätten die Schwestern ihm so viele Alte Worte ins Ohr flüstern können, wie sie in sich trugen. Hexen durfte man nicht trauen, das wusste jeder. Aber hatten ihm die Schwestern nicht das Leben gerettet? Draußen vor dem Fenster kreischte eine Möwe. Ob sie ihm zustimmte oder widersprach – er wusste es nicht.
Am nächsten Morgen schleppte Teofin sich die gewundene Treppe hinunter. Das Herz schlug ihm schnell, und seine Handflächen auf dem Geländer waren feucht. Er wusste genau, was er zu Lor sagen würde, die Worte lagen ihm bereits auf der Zungenspitze, als er von der untersten Stufe in die Wohnstube trat und Agatha auf einem Schemel hocken sah. Sie pulte runzlige braune Früchte aus länglichen Schoten derselben Farbe. Von ihrer Schwester war nichts zu sehen.
»Sprich, Junge«, sagte sie, ohne von ihren Schoten aufzusehen.
»Ich … Lor … sie hat gesagt, Ihr wüsstet, wie man die Schmerzen aus meinem … meinem Bein nimmt«, stammelte er.
Agatha nickte knapp und deutete mit dem Kinn auf einen Schemel. Das nächste Stundenviertel lang waren keine anderen Geräusche im Raum zu hören als das Knistern der Schoten in Agathas Händen und der dumpfe Aufschlag, wenn sie die Früchte in die Schale fallen ließ. Sie stand erst auf, als Lor kurze Zeit später die Stube betrat, und gemeinsam schoben die beiden Frauen Schemel und Stühle beiseite. Agatha befahl Teofin, seine Hose auszuziehen und sich auf den Tisch zu legen, und ihr Ton war so bestimmt, dass er mit zittrigen Händen und glühenden Wangen gehorchte. Auf der kühlen Holzplatte lag er dann wie ein Drachenrochen: bereit zum Ausweiden.
Die Schwestern tasteten sein Bein mit knochigen, kräftigen Händen ab, so als würden sie nach etwas unter der Haut suchen, und tatsächlich, er spürte den Moment, als sie es fanden, einen Knoten knapp oberhalb seines Knies. Mit sanftem Druck schob Agatha ihren Daumen ins Fleisch, und Teofin keuchte. Er kannte diesen Schmerz, hatte ihn schon unzählige Male empfunden, wann immer er seinen Fuß mit zu viel Schwung und ohne große Vorsicht aufgesetzt hatte. Es war ein Schmerz, der ihm allein gehörte, wie seine Träume, seine Erinnerungen, nur dass hier alles Schlechte, Faule, Dunkle saß, und die Hexe tastete daran. Teofin bäumte sich auf, und Lor drückte ihn zurück auf die Tischplatte.
»Halt es aus«, sagte sie, »halt es aus, oder es hat keinen Wert.«
Teofin biss die Zähne zusammen. Agathas Daumen hatte sich ihm als glühender Haken ins Bein geschlagen. Es gelang ihm gerade so, das Bein stillzuhalten, aber der Rest seines Körpers wand sich wie ein sterbender Fisch. Ohne sein Zutun bog sich ihm der Kopf in den Nacken, ballten sich seine Hände zu Fäusten, bleckten sich seine Zähne, und dann, von einem Wimpernschlag auf den anderen war der Schmerz verschwunden.
Teofin hob den Kopf. Agathas Daumen lag an genau derselben Stelle wie zuvor, gut zwei Fingerbreit über seiner Kniescheibe. Nicht ihr Daumen hatte sich gelöst, sondern der schwarze faule Punkt in seinem Bein. Er hatte sich zersetzt, war zerbröckelt oder zersprungen.
»Der Schmerz ist fort?«, fragte Agatha, und erst als er nickte, nahm sie ihre Hand von seinem Bein.
Teofin schloss die Augen. Das Haar klebte ihm an der Stirn. Sein Kiefer schmerzte, so fest hatte er die Zähne aufeinandergebissen. Er wollte sich aufrichten, als Lor ihn erneut zurück auf die Tischplatte drückte.
»Es war bloß der erste Knoten, Junge«, sagte sie.
Teofin starrte zu ihr auf. Der erste Knoten? Der erste Knoten? Vor seinen Augen tanzten leuchtende Flugwürmchen. »Nein, halt, ich brauche eine Pause, ich brauche …«
Doch Agathas Finger waren bereits seinen Oberschenkel hinaufgewandert. Die Worte starben ihm in der Kehle, als sich ihr Daumen ein weiteres Mal in sein Fleisch bohrte. Der Schmerz war grell, erleuchtete die Welt wie ein Blitz den Himmel, und dann stand bloß noch sein Bein in Flammen. Drei Hände hielten ihn unten, während die vierte sich noch immer mit glühenden Haken, mit gewetzten Messern, mit Feuerkrallen in ihn hineinschlug. Er würde den Verstand verlieren. Noch einen Wimpernschlag länger, und er würde den Verstand verlieren, er würde … Und wieder verschwand der Schmerz, so plötzlich, als hätte Agatha ihren Daumen fortgenommen, und wieder hob Teofin den Kopf, um festzustellen, dass er noch an der gleichen Stelle saß. Ein drittes, ein viertes, ein fünftes und ein sechstes Mal wiederholte sich das Spiel. Immer wieder nahmen die Schmerzen ab und schwollen wieder an wie eine schreckliche Musik. Er hörte sich wimmern, und die kläglichen Laute waren unaufhaltsam wie die Tränen, die ihm übers Gesicht liefen. Die Schmerzen waren ja auch Erinnerungen, an jeden einzelnen Schritt und die Qualen, die er Teofin gebracht hatte. Er, Teofin Bornholm, war seine Schmerzen. Mehr noch als er der Sohn des Apothekers oder Edda Valts bester Freund war. Aber was würde dann von ihm bleiben, wenn Agatha ihm seine Schmerzen nahm? Eine wilde Angst schoss ihm in die Glieder, und er wollte hochfahren, Agatha von sich stoßen, wollte ihr zurufen, dass sie ihn mit ihren verdammten Hexenfingern in Ruhe lassen sollte. Aber er war zu schwach, um auch nur die Hand zu heben oder ein einziges Wort zu sagen.
Irgendwann traten Agatha und Lor vom Tisch zurück, und statt aufzuspringen, wie er es sich die ganze Zeit über vorgestellt hatte, lag er reglos. Ließ sich von Lor das Gesicht mit einem feuchten Lappen abtupfen, das Haar aus der Stirn streichen. Blinzelte langsam und dachte, dass ihm sein Körper nicht mehr gehörte, dass er nicht mehr sicher war, wie man ihn bewegte.
Lor half ihm auf, und er rang nach Luft, als er sein Bein sah. Aber … es sah schlimmer aus als zuvor! Nicht länger bloß krumm und schief, sondern rotfleckig und geschwollen.
»Steh auf«, sagte Lor so gleichmütig, als hätte sie sein Entsetzen nicht bemerkt. Sie streckte ihm die Hände entgegen, und Teofin ließ sich benommen vom Tisch ziehen. Er kam auf die Füße und japste wie ein Fisch an Land. Er fühlte den Widerstand des Steinbodens, er fühlte eine große Schwäche in seinen Beinen, er fühlte ein Zittern in allen Gliedern. In dem Teil seines Körpers aber, den er nur als Schmerz kannte, war eine große Ruhe eingekehrt. Dort, wo immer etwas geschrien, gefaucht und gekeift hatte, war es still.
Als Teofin am nächsten Tag erwachte, stand die Sonne bereits hoch am Himmel, und die Möwen riefen vor seinem Fenster. Er fürchtete sich davor aufzustehen, fürchtete sich so sehr, dass er warten musste, bis er die Furcht nicht mehr aushalten konnte. Dann erst stand er auf, nicht zaghaft, nicht vorsichtig, sondern mit einem Ruck. Er wollte keine falsche Hoffnung und keine Verzögerung, er wollte, dass ihm der Schmerz gleißend, kreischend, laut und heiß von den Zehenspitzen bis hinauf ins Rückgrat schoss.
Doch wie am Abend zuvor blieb es still. Nachdem er einige vorsichtige Runden in seiner Kammer gedreht hatte, wagte er sich an die Treppe, und auch auf der Treppe fanden ihn die Schmerzen nicht. In der Wohnstube nickte er den Schwestern zu, und sie nickten gleichmütig zurück.
Den Rest des Vormittags und den ganzen Nachmittag über lief er die schmal gewundenen Pfade Horvigs hinauf und hinunter. Er rannte, bis ihm die Luft in den Lungen brannte, sich seine Rippen zusammenzogen und er husten musste. Sein Körper wusste nichts vom Rennen. Bald musste er gehen, und als er auch nicht mehr gehen konnte, stand er. Nur sitzen wollte er nicht. Auch als er am frühen Abend in den Turm zurückkehrte, zögerte er, an dem großen Tisch Platz zu nehmen, den die Schwestern bereits gedeckt hatten. Lor, der nichts je entging, nickte.
»Sie werden wiederkommen. Nicht heute und nicht morgen, aber irgendwann sicher.«
»Was zurückkommt, kann auch wieder fortgeschickt werden«, bemerkte Agatha, ohne von ihrer Schüssel aufzusehen. »Es braucht nicht mehr als ein bestimmtes Wissen und kräftige Hände. Du wirst dir eine Hexe suchen oder selbst lernen müssen, was zu tun ist, aber an deine Schmerzen bist du so wenig gebunden wie an deine Angst.«
Teofin schwieg. Er hatte den Schwestern längst gedankt für das, was sie für ihn getan hatten, aber die Worte waren ihm seltsam verschämt über die Lippen gegangen, und obwohl Agatha ihm geholfen hatte, wie ihm wohl kein Mensch zuvor geholfen hatte, war seine Abneigung ihr gegenüber nicht schwächer geworden. Im Gegenteil. Ihn schauderte, wenn sein Blick auf ihre knochigen Hände fiel.
Nachdem sie schweigend ihren Reis gegessen hatten, holte Agatha eine Pfeife hervor, stopfte sie mit schwarzem Kraut und zündete es an.
»Morgen ist es an der Zeit für dich aufzubrechen«, erklärte sie.
»Das hatte ich ohnehin vor«, murmelte er. »Wenn Ihr mir nur verraten könntet, wo im Inselreich …«
»Bei gutem Wind brauchst du zwei Wochen bis nach Akoban. Dort wirst du finden, was du suchst«, sagte Agatha.
Teofin richtete sich auf. Er hatte den Schwestern nie verraten, dass er nach Akoban unterwegs war. Und wenn er selbst die Worte nicht gesprochen hatte, hieß dies nichts anderes, als …
»Habt Ihr … habt Ihr in meinen Gedanken gelesen?«
Einen Moment war es vollkommen still, dann brachen die Schwestern in ein heiseres Gelächter aus, das Teofin auf einen Schlag den Schrecken aus den Gliedern und die Hitze ins Gesicht trieb.
»Du sprichst im Schlaf«, sagte Lor schließlich. »Hast die ersten Tage von nichts anderem geredet als von Akoban und deiner Freundin Edda.«
»Und was würden wir mit deinen Gedanken anstellen, wenn wir erst in deinem Kopf wären?«, fragte Agatha. »Dich durch einen Sprachzauber dazu zwingen, alle Zimmer in unserem Turm zu fegen?« Sie deutete mit ihrer Pfeife auf ihn. »Deine Angst macht dich nebelig im Schädel. Hör lieber auf deine Vernunft. Was glaubst du, was passiert, wenn du ein Altes Wort hörst? Glaubst du, deine kostbaren kleinen Ohren fallen dir ab? Du fürchtest dich vor deinem eigenen Schatten, Junge. Und es hat keinen Wert. Hör zu.«
Bevor er wusste, wie ihm geschah, bevor er die Hände schützend auf die Ohren hätte pressen können, sprach Agatha ein Wort. Es schnitt durch die Luft wie ein rostiges Messer, es kratzte und scheuerte, und gleichzeitig war es schön. Schöner als alles, was er je gehört, was er je gesehen hatte. Denn er sah es. Sah, wie es Agathas Mund verließ, gleich einem dunklen Nachtfalter durch die Luft schwebte. Die einzelnen Silben flatterten wie zarte Flügel. Teofin musste an sich halten, um nicht aufzuspringen und danach zu greifen, es fest in der geschlossenen Faust zu halten. Er wollte es essen, trinken, einatmen. Er wollte dieses Wort, in seinem Schädel, unter seiner Zunge, wo ein Platz war, gerade groß genug dafür. Plötzlich hatte er vergessen, wie man blinzelte. Erst als der Schimmer verblasste, senkten und hoben seine Lider sich wieder, und ihm war, als sei er einem großen Grauen, einer schrecklichen Schönheit entkommen.
Agatha blies eine Rauchwolke durch den Raum und auf Teofin zu.
»Kaum eine Zunge ist für die Alte Sprache gemacht, aber deine ist es. Kaum ein Paar Ohren und kaum ein Paar Augen sind für die Alte Sprache gemacht, aber deine sind es.«
Teofin sprang so hastig von seinem Stuhl auf, dass er ihn umwarf. Das Poltern drang wie aus weiter Ferne zu ihm. Er fuhr herum und stürmte die gewundene Treppe hinauf.
In der runden Kammer rannte er zur Waschschüssel, schöpfte kaltes Wasser mit beiden Händen, schrubbte sein Gesicht, wusch sich den Mund aus und die Ohren, wusch sich sogar die Augen, bis sie brannten. Aber Agathas Wort klebte ihm noch immer im Schädel. Warum hatte er nicht rechtzeitig die Augen geschlossen? Nicht rechtzeitig die Hände auf die Ohren gepresst? Kaum ein Paar Ohren und kaum ein Paar Augen sind für die Alte Sprache gemacht … Agatha hatte bloß mit gedrehter Zunge gesprochen! Um ihn zu ärgern, um ihn zu verunsichern, um … um … Aber er hatte das Wort gehört, er hatte es gesehen, und es hatte sonderbar vertraut geklungen, wie »Maunland« oder »Centria«, wie ein Ort, an dem er nie selbst gewesen war, von dem er aber sein ganzes Leben gehört hatte. Er taumelte zum Bett, setzte sich und fuhr gleich wieder hoch, sicher, dass er einen rußschwarzen Abdruck auf dem Laken hinterlassen hatte. Aber da war nichts, keine Spuren, keine Rückstände. Was immer er nun in sich trug, niemand anderes als Agatha und Lor wussten davon. Und er würde sicher nie jemandem davon erzählen. Nicht Edda, falls er sie fand, nicht seinen Eltern, falls er zu ihnen zurückkehrte.
Als Lor am oberen Ende der Treppe erschien, presste er die Lippen zusammen und drehte den Kopf von ihr fort, sah sie auch dann nicht an, als sie sich neben ihn aufs Bett setzte.
»Meine Schwester hätte das Wort nicht sprechen dürfen«, sagte sie. »Es stand ihr nicht zu. Aber sie will dir ganz sicher nichts Böses, und es gibt keinen Grund für uns, dir anderes als die Wahrheit zu sagen. Schau, wir haben für dich in den Knochen gelesen.«
Zum zweiten Mal an diesem Abend spürte Teofin, wie sein Herz sich gegen die Rippen warf, als wollte es hervorbrechen.
»Aber das … Ich habe Euch nicht darum gebeten …«
»Meine Schwester und ich tun die Dinge, die wir tun, auch nicht, weil du uns darum bittest. Nun, da es geschehen ist, willst du wissen, was die Knochen über dich sagen?«
Teofin drehte den Kopf, starrte Lor an. Konnte nicht antworten. Brachte weder ein einfaches Nein noch ein einfaches Ja zustande. Natürlich wollte er es wissen. Auf keinen Fall wollte er es wissen. Er schwieg, und sein Schweigen war die beste Antwort, die er Lor geben konnte.
»Die Knochen sagen, dass du nach Telomaar gehen musst.«
Telomaar. Eine Insel? Eine Stadt?
»Ist Edda nicht mehr auf Akoban?«, fragte er.
»Telomaar liegt weit im Nordosten des Archipels«, fuhr Lor fort, als hätte sie seine Frage nicht gehört. »Es ist die Insel der Sprachgelehrten. Der einzige Ort, an dem einer wie du lernen kann, umzugehen mit dem, was er in sich trägt.«
»Ich trage überhaupt nichts …«
»Meine Schwester kann rau sprechen, aber das macht ihre Worte nicht weniger wahr: Da ist etwas in dir, und du kannst sagen, es sei ein Geschenk, und du kannst sagen, es sei eine Last. Aber es ist in deinem Blut, und man tut nie gut daran, sich vor dem zu fürchten, was man im eigenen Blut hat.«
Teofin schüttelte schwach den Kopf. »Ich bin nur aus einem Grund ins Inselreich gefahren. Ich muss meine Freundin Edda finden. Und wenn ich sie gefunden habe, dann werden wir ihren Bruder suchen, und dann gehen wir alle zurück an die Küste und …«
»Edda Valt wird nie wieder einen Fuß an die Küste setzen«, erklärte Lor, und ihr Ton war so bestimmt wie teilnahmslos. »Ihr Weg ist nicht dein Weg. Und es ist auch nicht an dir, den Jungen zu finden. Edda Valt muss hoch hinauf in den Norden. Du musst nach Telomaar.«
Teofin rutschte auf dem Bett zurück, bis er an die Wand in seinem Rücken stieß. Die Hexe wusste nicht, wovon sie sprach. Die Schwestern kannten ihn nicht. Er war Teofin Bornholm, der Junge, der sich fürchtete, der so wenig Abenteuerlust in sich trug wie eine Maus, der nachts wach lag, weil er Angst hatte vor Finstertentakeln und Seegespenstern, weil er Angst hatte vor Hexen mit ihren gedrehten Zungen, Angst hatte vor der Alten Sprache.
»Ich will bloß meine Freundin Edda finden«, sagte er schwach.
Lor zuckte die Achseln. »Sie ist noch immer auf der Händlerinsel Akoban. Wenn du morgen aufbrichst, wirst du sie dort antreffen. Aber glaub mir, es ist bloß ein Umweg. Eure Wege werden sich trennen. Das sagen die Knochen, und wenn die Knochen es sagen, dann wird es geschehen.« Sie erhob sich. »Manche von uns müssen durch die Angst hindurchgehen, um zu werden, wer sie sind. Das ist wahr für meine Schwester und mich, es ist wahr für deine Freundin Edda, und es ist wahr für dich.«
Sie blickte auf ihn hinab, und die Art, auf die sie ihn ansah, erinnerte ihn ganz sonderbar an seine Mutter. Jeder andere in Teofins Leben, selbst sein Vater, selbst Edda, hatten ihn immer angesehen, als sei er der Junge, der am Rand stand. Als sei er bloß der, der zuhörte und zusah, sich duckte und in den Schatten versteckte, so lange mitlief, bis er eben zurückfiel. Nur unter diesem besonderen Blick war es möglich, anderes zu denken.
Teofin verließ Horvig am nächsten Tag. Agatha und Lor schnürten ihm ein Päckchen mit Proviant und Heilkräutern für die Reise. Agatha zeigte ihm, was er selbst tun konnte, wenn der Schmerz zu ihm zurückkehrte, wo er seine Finger auflegen, wie er Druck ausüben musste, und Lor zeichnete ihm eine ungefähre Karte der Mittleren Inseln.
Die Schwestern begleiteten ihn hinunter zum Strand, und zusammen mit Lor schob er das Boot ins Wasser. Als er schon ein Stück hinausgekurbelt war, drehte er sich noch einmal zu ihnen um. Die Schwestern winkten, und er winkte zurück. Er war erleichtert, als die Insel in seinem Rücken kleiner und kleiner wurde. Konnte es nicht abwarten, in den Wind zu schicken, was die Hexen zu ihm gesagt hatten, über Wege, die sich trennten, über Alte Worte im Blut und eine Insel namens Telomaar. Im Grunde hatte er es ja schon vergessen.
Wenn er sich nur nicht so gut erinnern könnte, an das dunkel funkelnde Wort, das Agatha zu ihm gesprochen hatte. Wenn es nur nicht noch immer singen würde, in seinem Blut.
Edda Valt war die Erste an Bord der Staubsprenkel, die es bemerkte, als das Wasser seine Farbe änderte. Ähnliches hatte sie schon einmal gesehen, hoch oben im Norden, wo das Teermeer begann und sich die See beinahe von einem Wimpernschlag auf den anderen schwarz färbte. Hier unten, im Süden ging der Wandel schleichender voran. Das trübe Grau der See wurde allmählich von einem klaren Grünton abgedrängt. Aber der Anblick des Wassers war trügerisch, ließ Kühle vermuten, wo keine zu finden war. Schon in den frühen Morgenstunden senkte sich eine drückende Hitze auf die Besatzung der Staubsprenkel hinab. Die Luft selbst schien zu schwitzen. Tag und Nacht klebten ihnen die Haare am Schädel und die Kleider am Leib, als ginge ununterbrochen ein feiner Regen auf sie hinab. Anders als die Mannschaft der Staubsprenkel waren Goldzahn, Edda und Teofin die Südluft nicht gewöhnt und schleppten sich wie benommen über das Schiff. Es brauchte nicht mehr als ein paar Schritte, damit sie keuchend innehielten und nach Luft rangen. In den späten Nachmittagsstunden, wenn die Hitze ihren Höhepunkt erreichte, ertappte Edda sich dabei, wie sie an der Reling stand, in das eisgrüne Wasser starrte und darüber nachdachte, einfach kopfüber hineinzuspringen. So sehr sehnte sie sich danach, sich den juckenden Schweiß und die winzigen Stechmücken vom Körper zu waschen, dass es sie ins Wasser zog, obwohl sie nicht schwimmen konnte und die See womöglich voller Wassermänner war.
»Bella Soot«, hörte sie Goldzahn eines Nachmittags ergeben murmeln, während er einen Stich betrachtete, der seine Hand auf die doppelte Größe hatte anschwellen lassen.
Bella Soot?
Bella Soot, erklärte Goldzahn, nannte man den Süden in Tevelin, einem Dialekt, der nur auf Vin-Lu gesprochen wurde. Bella Soot hieß nichts anderes als »der schöne Süden«, und auch wenn Goldzahn den Namen in bitterem Spaß gesprochen hatte, verstand Edda, dass er ganz aufrichtig gewählt worden sein musste. Der Süden war schön. Schöner als der karge Westen und der dunkle Norden, schöner als die geschäftigen Inseln der Mitte. Die See hier unten erinnerte nicht länger an trübes Putzwasser, und die Sonne malte beinahe zu jeder Stunde feine goldene Netze in das klare Grün. Über die Inseln konnte Edda nicht viel sagen. Sie sah bloß ihre Umrisse, aus einiger Entfernung und durch die runde Öffnung des Fernrohrs. Wie kleine Wälder hoben sie sich aus der See und ihre Ufer waren von weißen Sandstreifen gesäumt.
»Hast du schon einmal so merkwürdige Bäume gesehen?«, fragte Teofin sie eines Nachmittags. Edda nickte. Wer hätte gedacht, dass der Tag kommen würde, an dem sie Fragen beantwortete, statt sie zu stellen. Die Bäume mit ihren auffällig langen und spitzen Blättern waren ihr schon in Trom Gondenbergs Garten in den Hohen Gassen begegnet.
»Das sind Palmen. Ich wüsste gern …«
Aber sie war sich selbst nicht sicher, was es war, das sie gern wüsste. Vielleicht wollte sie wissen, was in den grünen Herzen dieser fremden Inseln vor sich ging. Aber sie musste Goldzahn gar nicht danach fragen, ob sie an einer der Inseln anlegen könnten. Sie hatten allen Proviant, den sie brauchten, und schon auf Akoban hatte Goldzahn erklärt, dass sie auf dem unmittelbarsten und schnellsten Weg zu den Regen-Inseln fahren würden. Keine Umwege, keine Landgänge. Im Süden, behauptete der Händler, war man ohnehin von Gefahren umgeben. Es gab keinen Grund, sich auch noch auf die Suche nach ihnen zu machen. Laut Goldzahn ließen die Wassermänner sie überhaupt nur in Frieden, weil die Staubsprenkel mit ihrem Haupt-, Zwischen- und Unterdeck eine Festung war, und die Wassermänner in der Silbersee sehr viel leichtere Beute fanden, als dass sie sich die Mühe hätten machen müssen, die hohen Bootswände zu erklimmen.
Goldzahn hatte keinen Grund zu lügen, Edda vor Wassermännern zu warnen, wo es keine gab, aber es war schwer, sich vor etwas zu fürchten, das man nicht sehen konnte. Dies galt auch für die zweite große Gefahr des Südens, die Tiefen Ströme. Auch hier musste Edda sich auf Goldzahns Wort verlassen, denn jener kräftige Zug, der wie ein Wind durchs Wasser ging, angeblich schwere Sechsmaster genau wie einfache Kutter packte und mit sich zog, um sie an den Klippen Boorneys oder einer anderen der Bracke-Inseln zerschellen zu lassen, war ebenfalls fürs Auge unsichtbar. Wollte man die Tiefen Ströme umschiffen, musste man wissen, wo sie waren. Goldzahn wusste es nicht, Edda und Teofin wussten es noch viel weniger. Und es war ihr Glück, dass die Verantwortung, die Staubsprenkel sicher durch die hinterhältigen Gewässer des Südens zu lenken, nicht auf ihnen lastete, sondern auf dem Kapitän, einem wortkargen Mann namens Robben, und seiner ebenfalls wortkargen Besatzung aus zwanzig Männern. Sie alle stammten aus dem Süden, kamen genau wie Meister Gorm, der einflussreiche Händler, der Edda das Schiff überlassen hatte, von den Bracke-Inseln. Kein Tag verstrich, an dem Edda den Heiligen Schwestern nicht für Robben und seine Männer dankte, und kein Tag verstrich, an dem sie sich nicht ausmalte, wie sich ein Trupp Wassermänner an Bord schlich und jeden Einzelnen von ihnen über die Reling und bis tief hinab auf den Meeresgrund zog. Sie war dem Kapitän und seiner Mannschaft an jenem Morgen, da sie die Händlerinsel verlassen hatten, zum ersten Mal begegnet. Etwas an Robben, vielleicht sein verschlossenes Gesicht, vielleicht sein wortkarges Auftreten oder auch nur sein Name, hatte sie an ihren Ziehvater erinnert, und auch die restlichen Männer schienen solche vom Schlag der Fischer von Colm zu sein. Sie war mehr als bereit gewesen, den geschwätzigen Händlern Akobans den Rücken zu kehren und sich wieder unter ihresgleichen zu bewegen.
Es brauchte weniger als einen Tag draußen auf See, um sie ihren Irrtum verstehen zu lassen. Robbens Männer waren so wenig ihresgleichen wie die geschwätzigen Akobaner Händler. Ihr Schweigen war nicht gleichgültig, sondern herablassend, feindselig. Wenn Edda sich ihnen näherte, verstummten die Männer, als gälte es, vor ihren aufdringlichen Ohren zu schützen, was immer sie miteinander besprachen. Wenn sie auf dem Zwischendeck an den geschlossenen Türen der Schlafkammern vorbeieilte, hörte sie die Männer manchmal leise lachen und Worte sprechen, die wenig Gutes verhießen: Hinkebein, Münzküsser, Hexenbalg. Für Robben und seine Männer spielte es keine Rolle, dass in Eddas Kabine ein Papier lag, welches besagte, dass die Staubsprenkel ihr gehörte. Sie hätten eher mit einem Wassermann Schwarztee getrunken als mit Edda über ihre geplanten Routen, die umliegenden Inseln, mögliche Hindernisse oder Gefahren zu sprechen. Wie Goldzahn zu bedenken gab, hatte es auch wenig Wert, ausgerechnet Edda zu fragen, ob sie südlich oder westlich der Zwillingsinseln segeln, Bela-Haven oder Parsen ansteuern sollten. Eine Wahrheit, die Edda kaum bestreiten konnte, trotzdem stieß sie sich daran, dass Robben und seine Männer sie für kaum verlässlicher oder nützlicher zu halten schienen als das Peki-Äffchen auf Goldzahns Schulter. Ihre misstrauischen Blicke folgten ihr, gleich wo auf dem Deck sie sich befand.
Weil Teofin sich unter den Männern nicht wohler fühlte als Edda, verbrachten sie bald einen entscheidenden Teil der Reise unter Deck, und das, obwohl es dort heiß und stickig wie in einem Ofen war. Sie wählten Eddas Kammer für ihre Treffen, weil diese geräumiger war als Teofins und außerdem weiter von Robbens entfernt lag. Es gab Stühle, und das Bett war eine abenteuerliche Vorrichtung: ein etwa türgroßes Brett, das mit zwei Ketten an der Wand befestigt war und je nach Bedarf auf- und zugeklappt werden konnte. Hier kauerten die beiden im schwachen Schein der Blausteinlampe und erzählten sich von ihren Reisen, den Orten, die sie gesehen hatten, den Menschen, denen sie begegnet waren. Zunächst war es vor allem Edda, die erzählte. Sie sprach von den Fischern von Halv, von Kurtz mit seinem narbigen Mund und den Käfigen in seinem Keller. Sie sprach von der Silberechse und dann schnell, in atemlosem Flüstern von Tamsin. Und weiter erzählte sie von Akoban. Davon, wie Infried sie auf den Straßen aufgelesen und ihr beigebracht hatte, wie man als Dachfreie überlebte. Sie erzählte von ihrem Handel mit Gondenberg und wie sie beide aufeinander hereingefallen waren: Gondenberg hatte ihr die Fließende Karte versprochen, obwohl er sie nicht besaß, und Edda hatte ihm nicht die eigene Tochter aus dem Teermeer zurückgebracht, sondern ihren dunklen Zwilling, die Teerschwester.
Teofin unterbrach sie nicht, und er stellte auch keine Fragen, aber er blinzelte oder verzog den Mund, und Edda wusste, dass es ihm nicht entging, wenn sie in ihrer Geschichte besonders schnell sprach, um Lücken und Sprünge zu überdecken. Sie verlor kein Wort über den Pfau in Gondenbergs Garten oder darüber, wie sie ihn allein durch ihren Blick dazu gebracht hatte, ein Rad zu schlagen. Sie sprach nicht davon, wie Goldzahn sie unter den Händlern der Hohen Gassen als Tochter der Hoch-Insel Pallandor ausgegeben hatte, oder davon, dass auch die Carpaunen oben im Teermeer sie Inseltochter genannt hatten. Doch als sie am siebten Tag ihrer Reise bei dem Inselfieber angelangt war und erzählte, wie ausgerechnet in diesen dunklen Stunden der Gorm, der zweiteinflussreichste Händler Akobans, aus den Schatten getreten war, um ihr die Staubsprenkel zu schenken, verlor Teofin die Geduld.
»Aber Edda, warum schenkt dir irgendein Mann, mit dem du dich einen Abend lang unterhalten hast, ein Schiff?«
Statt gleich zu antworten, tastete Edda nach der Krähenfeder, die sie immer in ihrer Hosentasche bei sich trug. Ihr Daumen suchte und fand das spitze Ende des Kiels.
»Wahrscheinlich hat es etwas mit einer Geschichte zu tun, die Goldzahn unter den Händlern Akobans erzählt hat. Es war … schwierig, einen Mann wie Gondenberg überhaupt dazu zu bringen, mich zu empfangen. Deswegen hat Goldzahn herumerzählt, ich sei auf Pallandor, einer der Hoch-Inseln geboren worden. Sie … sie halten mich für hochgeboren in Akoban.«
Teofin runzelte die Stirn. »Also darf niemand wissen, dass du eigentlich von der Küste stammst?«
Edda presste das Kielende ein wenig tiefer in ihren Daumen. Kaum zehn Tage zuvor hatte sie bereits ein ganz ähnliches Gespräch mit Goldzahn führen müssen. Wenn sie sich schon davor gefürchtet hatte, dem Händler zu eröffnen, dass sie nicht die war, für die er sie hielt, wie würde es sich erst anfühlen, ihrem ältesten Freund diese Botschaft zu überbringen? Sie wusste, dass sie Teofin ansehen sollte, während sie sprach, stattdessen aber richtete sie den Blick starr geradeaus.
»Teofin, bevor ich die Küste verließ, erzählte mir Ruben, dass es Maron gewesen war, die Tobin und mich damals nach Colm gebracht hatte. Und vor Maron waren wir bei ihrer Schwester Felma gewesen. Sie hatte sich unserer wohl angenommen, um jemandem einen Gefallen zu tun.«
Ihr war nur zu bewusst, dass sie die entscheidenden Worte nicht gesprochen hatte. Aber Teofins Schweigen ließ sie verstehen, dass sie genau dies würde tun müssen.
»Tobin und ich wurden beide hier draußen geboren, Teofin. Ich weiß nicht, auf welcher Insel, und ich weiß nicht, warum Maron uns an die Küste brachte, aber ich weiß, dass ich nicht ursprünglich von dort komme.«
Teofins Hände lagen ihm ruhig im Schoß. Anders als Edda war er keiner, der sie ständig bewegen und beschäftigen musste, nur weil etwas in ihm arbeitete. Ob er gerade all die Teile neu zusammenrückte, aus denen Edda sich für ihn zusammensetzte, alle Erinnerungen, alles, was er je über sie gewusst hatte oder geglaubt hatte zu wissen?
»Und Brand … er hat davon gewusst?«
»Brand?« Sie sprach seinen Namen überrascht und gleichzeitig ein wenig lahm, als hätte sie Schwierigkeiten sich an ihn zu erinnern, wüsste eigentlich gar nicht mehr genau, wer er war.
»Ich meine, weil er dich Makri nannte, schon als wir noch an der Küste waren.«
Edda schnippte gegen den Federkiel in ihrer Hosentasche. Sie wollte nicht über den Vogel nachdenken, den sie im Akobaner Hafen gesehen hatten, den Makri, das Wahrzeichen der Hoch-Inseln, ein Vogel, der tief in die See tauchte und bei seinem Aufstieg aus den Fluten die Farbe seines Gefieders änderte. Sie wollte nicht über Talin Brand nachdenken oder über die Möglichkeit, dass er Dinge über sie wusste, die ihr selbst noch verborgen waren.
»Ich glaube nicht, dass es etwas zu bedeuten hatte«, sagte sie rasch. »Es war bloß einer seiner Scherze. Du weißt schon, weil ich weder tauchen noch fliegen kann.«
Sie fröstelte. Zögernd streckte Teofin eine Hand aus und legte sie auf Eddas. Die Berührung kam so unerwartet, dass sie die Hand im ersten Moment beinahe unter seiner fortgezogen hätte.
»Edda, es macht keinen Unterschied, was Brand oder irgendein anderer glaubt, über dich zu wissen. Wir beide, wir kennen die Wahrheit. Du bist Edda. Edda Valt aus Colm.«
»Aber Teofin, ich bin nicht wirklich Edda Valt aus Colm. Bevor ich Edda war, hatte ich einen anderen Namen. Und bevor ich in Colm lebte, war ich an einem anderen Ort. Die Wahrheit ist doch, dass wir gar nicht wissen, wer ich bin.«
»Gut, es gibt einen Teil von dir, über den wir nichts wissen«, räumte Teofin ein. »Aber jeder hat Geheimnisse. In uns allen ist etwas Verborgenes, etwas, das wir vielleicht selbst nicht verstehen.«


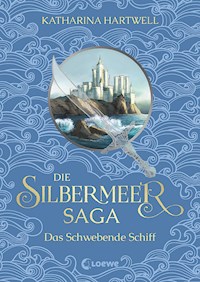
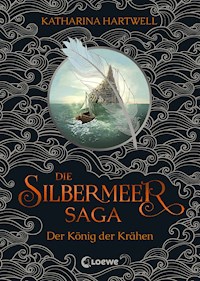














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










