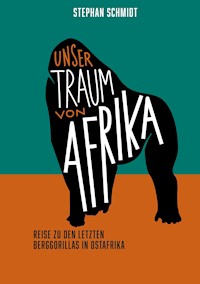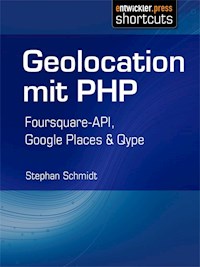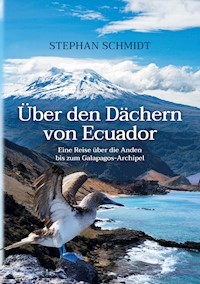9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
September 2021. In Shanghai tagt das Internationale Olympische Komitee, um die nächsten Sommerspiele zu vergeben. Kurz vor der entscheidenden Abstimmung geschieht ein Verbrechen: Der mosambikanische IOC-Funktionär Charles Murandi wird ermordet in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Aufnahmen einer Sicherheitskamera belegen, dass sich der Journalist Thomas Gärtner zuletzt im Zimmer des Opfers aufgehalten und beim Verlassen Dokumente mitgeführt hat. Im Verhör will er sich an nichts erinnern können. Für die junge Konsularbeamtin Lena Hechfellner ein heikler Fall: Sie weiß von Gärtners Bekanntschaft mit Murandi, und sie glaubt zu wissen, was in den Dokumenten steht, aber erfahren darf das niemand. So werden alle Beteiligten zu Figuren eines Spiels, dessen Regeln sie nicht kennen. Die angereiste Bundeskanzlerin befürchtet das Schlimmste, ein zweiter Journalist wittert seine große Chance, und Lena selbst wird von den chinesischen Behörden observiert. Erst nach und nach wird klar, dass der Schlüssel zur Lösung des Falls tief in der Vergangenheit liegt: in einer Zeit, da ein mosambikanischer Vertragsarbeiter in der DDR um seine Zukunft betrogen wurde und an der falschen Person Rache nahm. Stephan Schmidt hat einen meisterhaften Roman geschrieben, der weit in die Ferne und zugleich tief in die deutsche Geschichte führt: hochaktuell, fesselnd und faktenreich. »Hier geht es nicht um einen Mord. Hier geht es um das Individuum und das System.« WDR5 Scala
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
September 2021. In Shanghai tagt das Internationale Olympische Komitee, um die nächsten Sommerspiele zu vergeben. Kurz vor der entscheidenden Abstimmung geschieht ein Verbrechen: Der mosambikanische IOC-Funktionär Charles Murandi wird ermordet in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Aufnahmen einer Sicherheitskamera belegen, dass sich der Journalist Thomas Gärtner zuletzt im Zimmer des Opfers aufgehalten und beim Verlassen unbekannte Dokumente mitgeführt hat.
Im Verhör will er sich an nichts erinnern können. Für die junge Konsularbeamtin Lena Hechfellner ein brisanter Fall: Sie weiß von Gärtners Bekanntschaft mit Murandi, und sie glaubt zu wissen, was in den Dokumenten steht, aber erfahren darf das niemand. So werden alle Beteiligten zu Figuren eines Spiels, dessen Regeln sie nicht kennen. Die angereiste Bundeskanzlerin befürchtet das Schlimmste, ein zweiter Journalist wittert seine große Chance, und Lena gerät plötzlich selbst ins Visier der chinesischen Behörden. Erst ganz allmählich wird klar, dass der Schlüssel zur Lösung des Falls tief in der Vergangenheit liegt: in einer Zeit, da ein Vertragsarbeiter in der DDR um seine Zukunft betrogen wurde und an der falschen Person Rache nahm.
Stephan Schmidt hat einen meisterhaften Roman geschrieben, der weit in die Ferne und zugleich tief in die deutsche Geschichte führt: hochaktuell, fesselnd und faktenreich.
© Niklas Berg
Stephan Schmidt wurde 1972 im hessischen Biedenkopf geboren. Bereits als Student zog es ihn für je ein Jahr nach China, Taiwan und Japan. Nach der Promotion im Fach Philosophie folgte ein längerer Aufenthalt als Mitarbeiter an verschiedenen Forschungseinrichtungen in Taipeh. Unter anderem Namen hat er bereits fünf Romane veröffentlicht, von denen drei auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis sowie der SPIEGEL-Bestsellerliste standen. Stephan Schmidt lebt mit seiner taiwanischen Frau in Taipeh, wo er derzeit an einem Sachbuch zum Konflikt zwischen China und Taiwan arbeitet.
STEPHAN SCHMIDT
DIE SPIELE
KRIMINALROMAN
E-Book 2024
© 2023 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Krzysztof Kotkowicz/unsplash
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1006-3
www.dumont-buchverlag.de
PROLOG
Mosambik 1994
Auf den ersten Blick sah es nach einer gewöhnlichen kleinen Demonstration aus: Kaum dreihundert Personen, hauptsächlich Männer, zogen mit geballter Faust durch die Innenstadt von Maputo und skandierten Parolen. Einige hatten Trommeln dabei, andere schlugen im Gehen auf ausgediente Benzinkanister ein. Passanten schenkten dem Aufmarsch keine Beachtung, nur ein paar Autofahrer riefen im Vorbeifahren etwas, das für Thomas Gärtner nach bösen Worten klang, aber leider verstand er kein Portugiesisch. Es war sein erster Besuch in Mosambik, die Zeitung hatte ihn geschickt, um über die auslaufende UN-Friedensmission zu berichten. Von den Protesten der sogenannten Madgermanes hatte er erst am Vorabend und durch puren Zufall erfahren.
Um zehn Uhr vormittags lag bereits drückende Hitze über der Stadt. Nach den jahrelangen Kämpfen waren viele Straßen in katastrophalem Zustand, außerhalb der Innenstadt gingen sie in Sandpisten über, auf denen Halbwüchsige fauliges Obst oder Bündel von Brennholz verkauften. Kein Vergleich zu Kapstadt, wo Gärtner seit sechs Monaten das komfortable Leben eines Korrespondenten mit üppigem Budget für Reisen und Recherchen führte. Ein Traumjob, den er überraschend ergattert hatte; nun war er bemüht, sich seiner würdig zu erweisen. Wie schwer konnte das sein auf einem Kontinent voller Geschichten, die zu Hause keiner kannte? Selbst für ein Greenhorn wie ihn.
Nach einer halben Stunde hatte er zwei Rollen Film verschossen und holte die dritte aus der Fototasche. Sein kurzärmeliges Hemd klebte ihm am Körper.
Warum man die Männer Madgermanes nannte, konnte er nur mutmaßen, aber ihre Geschichte fand er interessanter als den Auftrag, der ihn hergeführt hatte. Als sogenannte Vertragsarbeiter waren sie jahrelang in der DDR gewesen und sowohl von ihrer Regierung als auch von der in Ost-Berlin übers Ohr gehauen worden. Einen großen Teil ihres Lohns hatte man einbehalten und dazu verwendet, die mosambikanischen Staatsschulden beim sozialistischen Bruder zu tilgen. Statt zu Hause ein Startkapital für die Zukunft vorzufinden, hatten die Männer nach der Rückkehr feststellen müssen, dass sie gar nichts besaßen. Ausgenutzt, abgeschoben und betrogen – wie von selbst formten sich Gärtners Gedanken zu Schlagzeilen, während er dem bizarren Demonstrationszug folgte. Teilnehmer trugen die Trikots verschiedener deutscher Fußballclubs, schwenkten schwarz-rot-goldene Fahnen mal mit, mal ohne Hammer und Sichel und machten einen gewaltigen Lärm, der trotzdem vom Verkehr übertönt wurde. Am Kopf des Zuges marschierte ein hünenhafter Mann, der als Anführer der Gruppe galt und Deutsch mit sächsischem Zungenschlag sprach, wie Gärtner seit gestern Abend wusste. Wie gesagt, purer Zufall. Erschöpft und genervt vom Interview mit einem Regierungssprecher, der zwei Stunden lang hohle Phrasen gedroschen hatte, war er am Jardim 28 do Maio vorbeigekommen, als er plötzlich eine Männerstimme auf Deutsch sagen hörte: »Sie haben uns gefickt, also ficken wir sie. Ganz einfach.«
Ein breitschultriger Typ, über zwei Meter groß und um die dreißig Jahre alt, sprach zu einem halben Dutzend Männer, die vor ihm auf dem Boden hockten. Auch er trug ein Fußballtrikot, das Gärtner erst im Näherkommen identifizieren konnte: Lokomotive Leipzig. Mit ihm ins Gespräch zu kommen erwies sich als leicht.
»Kapstadt, hm?«, sagte der Mann mit spöttischem Unterton, nachdem Gärtner sich vorgestellt hatte. »Wenn schon Afrika, dann First Class.«
»Die Flugverbindungen sind gut.«
»Vor allem nach Europa. Was bringt dich hierher?«
»ONUMOZ.« Das sperrige Akronym der UN-Mission, die das vom Bürgerkrieg zerrüttete Land stabilisieren sollte. In ihrem Gefolge tummelte sich ein Heer von NGOs und Experten mit Taschen voller Dollars, die sich schnell leerten, und klugen Köpfen voller Pläne, deren Scheitern kaum mehr Zeit brauchte. Der Mann machte eine wegwerfende Handbewegung. »Sie füttern ein korruptes System mit Geld, und siehe da, heraus kommt ein noch korrupteres.«
»Das euch gefickt hat?«, fragte Gärtner interessiert. »Wie das? Erzähl mir davon.«
Eine knappe Viertelstunde brauchte der Mann, um einen Abriss seines Lebens der letzten zehn Jahre zu geben. Sieben davon hatte er als Hilfsarbeiter in den Leuna-Werken unweit von Leipzig verbracht, nach dem Mauerfall war er entlassen und kurz vor der Wiedervereinigung abgeschoben worden. Seitdem versuchte er vergebens, seinen zuvor leichtgläubig in die Heimat transferierten Lohn zurückzubekommen. Oder wenigstens einen Teil davon.
»Woran scheitert es?«, wollte Gärtner wissen und erhielt die Antwort, die er in den letzten Tagen so oft gehört hatte, dass er sie auch auf Portugiesisch verstand:
»É complicado, amigo.«
»Warum wendet ihr euch nicht an die deutsche Regierung?«
»An welche?«
»Meines Wissens gibt es nur noch eine.«
»Eben. Für uns war die andere zuständig.«
»Das mag ja sein, aber wenn du heute mit Fans vom VfB Leipzig sprichst, behaupten die auch, sie hätten ’87 um ein Haar den Europapokal gewonnen. Verstehst du, was ich meine? Der Nachfolger erbt alles, den Ruhm und den Ärger.« Es war keine überzeugende Analogie, aber sie erfüllte ihren Zweck. Augenblicklich legte der Hüne seine skeptische Miene ab und streckte ihm die Hand hin. »Charles Murandi.«
»Freut mich.« Kurz fühlte es sich an, als steckten Gärtners Finger in einem Schraubstock.
»Beim Halbfinale gegen Bordeaux war ich im Stadion.«
»Angeblich sollen über hunderttausend dabei gewesen sein.«
»Beste Nacht meines Lebens. Du bist auch ein Ossi?«
Beinahe hätte er Ja gesagt, so gut gefiel ihm das ›auch‹ aus dem Mund eines Schwarzafrikaners. »Nein, bin ich nicht. Um aber noch mal auf euer Anliegen zurückzukommen …«
So schnell jedoch wollte Murandi das Thema Fußball nicht abhaken. Die Reihenfolge der Schützen beim Elfmeterschießen rezitierte er wie ein Gedicht. Nicht nur auffallend groß, sondern auch wortgewandt und witzig, klang er trotz seiner derben Sprüche nicht wie ein Hilfsarbeiter. Beim Reden legte er Gärtner eine Hand auf die Schulter, als würden sie einander seit Jahren kennen. Alkohol gab es auch, hauptsächlich Dosenbier und Wodka. Um sie herum bildete sich ein Kreis von Zuhörern, und als er zwei Stunden später aufbrach, versprach Gärtner, am nächsten Morgen zur Demonstration zu kommen.
So hatte es angefangen. Auf die besten Geschichten, sagte er sich jetzt und legte die dritte Filmrolle ein, stießen Reporter ja oft eher zufällig.
Als der Zug zwei Stunden später zu seinem Ausgangspunkt im Park zurückkehrte, stand die Sonne hoch am Himmel. Im Volksmund hieß die Anlage inzwischen Jardim do Madgermanes. Deren Proteste gingen bereits ins vierte Jahr, hatte Gärtner unterwegs gelernt, und um mehr zu erfahren, lud er Murandi in ein Straßencafé am alten Markt ein. Während sie Huhn in Piri-Piri-Soße aßen und Bier tranken, zog sein Gesprächspartner eine ernüchternde Bilanz. Weder interessierte sich der Rest der Gesellschaft für den Fall, noch wussten die Demonstranten, wie sie ihren Forderungen Nachdruck verleihen sollten. »Wir sind Ausgestoßene«, sagte er. »Schräge Vögel, Fremde im eigenen Land. Niemanden kümmert es, was sie mit uns gemacht haben.«
»Auf Dauer reicht es nicht, nur Lärm zu machen. Ihr müsst klarer sagen, wer ihr seid und was ihr wollt. Madgermanes, was bedeutet das denn nun genau?«
Ursprünglich hätten andere ihnen den Namen gegeben, erklärte Murandi, als Ausdruck von Spott. »Die in Deutschland waren, im Sinne von: die Penner, die wieder dorthin verschwinden sollten.« Das Wort kam aus den Bantu-Sprachen, aber das S am Ende schien portugiesisch zu sein, und was es mit dem D in der Mitte auf sich hatte, wusste niemand. »Ein Wort, das es eigentlich nicht gibt«, schloss er mit vollem Mund. »Genauso wenig, wie es uns geben sollte.«
»Kannst du mir sagen, warum ein Typ wie du Hilfsarbeiter in einem Chemiewerk geworden ist?«
»Statt Millionär zu werden, meinst du?«
»Zum Beispiel. Oder Lehrer, Ingenieur, Arzt.«
Murandi leckte sich Öl von den Fingerspitzen. »Willkommen in Afrika, Amigo.«
»Schon klar, aber … Zur Schule bist du jedenfalls gegangen.«
»Fünf Jahre, immerhin. Bei den portugiesischen Padres oben in Beira.«
»Und dann?«
»Habe ich Karriere gemacht: Bettler, Straßenverkäufer, Minenarbeiter. Bis mir jemand von der Möglichkeit erzählt hat, in der DDR zu arbeiten. Das klang besser, als im Bürgerkrieg zu kämpfen. In Leuna meinten alle, dass ich dankbar sein soll für meine Stelle, und das war ich auch. Nach dem Mauerfall meinten sie dann, ich soll mich verpissen.« Mit einem langen Schluck leerte er sein Bier.
»Noch eins?«
»Jetzt überlege ich, Journalist zu werden«, nickte Murandi. »Scheint ein angenehmes Leben zu sein. Du kannst das wirklich alles als Spesen abrechnen?«
Es wurde eine der interessantesten Unterhaltungen, die Thomas Gärtner je geführt hatte. Von den Skatkumpeln in Leuna und den Besuchen im Zentralstadion erzählte sein Gesprächspartner, als hätte er nie woanders gelebt, dann sprang er zu seinen früheren Kohlekumpeln in Tete, die barfuß gearbeitet und auf die Frage nach ihrem Alter geantwortet hätten »ungefähr vierzig« oder »wahrscheinlich über dreißig«. Eine eigene Familie behauptete er, nie gehabt zu haben. Sein bester Freund in Beira sei der Sohn eines chinesischen Ladenbesitzers gewesen, in den Erzählungen aus der DDR kam eine Frau namens Christa vor, aber ob sie eine feste Freundin oder eine flüchtige Geliebte gewesen war, fand Gärtner nicht heraus. Unliebsame Fragen überhörte Murandi wie ein gewiefter Politiker. Als die Hitze nachließ, gingen sie gemeinsam zur Strandpromenade von Maputo, wo es nach gegrillten Langusten roch, und Gärtner beschloss, dass er nach Afrika gekommen war, um solche Leute zu treffen. »Vielleicht würde es eurer Sache helfen«, sagte er, »in Deutschland öffentlichen Druck zu erzeugen. Auf die Bundesregierung, meine ich.«
»Vielleicht, ja.«
»Du traust mir nicht, oder?«
»Journalisten kommen, schreiben ihre Berichte und gehen wieder. Das ist ihr Job.«
»Abwarten, Amigo. Ich bin anders.« Nach vier oder fünf Bier kamen ihm vollmundige Versprechen leicht über die Lippen, trotzdem meinte er es ernst. In Kapstadt traf er sich seit Kurzem mit einer jungen Frau halbindischer Abstammung, deren dunkle Augen ihn bezauberten, aber was er sonst von ihr wollte oder sie von ihm … Als Student hatte er den Kontinent bereist und später eine Magisterarbeit zur Kolonialgeschichte geschrieben – wenn er ehrlich war, wusste er nichts. »Wie schaffst du es eigentlich, nicht vor Wut durchzudrehen?«, fragte er, als sie auf einer brüchigen Bank am Rand der Avenida Marginal saßen und auf den Ozean schauten. »Ich meine, nach allem, was sie euch angetan haben.«
»Wenn mir kurz nach der Rückkehr einer von denen in die Hände gefallen wäre, die uns beschissen haben, hätte ich ihn umgebracht.«
»Verstehe. Gut, dass dir niemand in die Hände gefallen ist, was?«
»Wie man’s nimmt«, sagte Murandi leise. »Noch besser wäre es gewesen, ich hätte den Richtigen erwischt.«
In der Abendbrise schwankten die Palmen am Ufer hin und her. Eine innere Stimme riet Gärtner davon ab nachzufragen. Fast eine Minute verging, ehe sein Nebenmann in lautes Lachen ausbrach und sagte: »Quatsch, Mann, war nur ein Witz. Für einen Journalisten bist du zu leichtgläubig, weißt du das?«
»Unterschätz mich nicht. Irgendwann finde ich die Wahrheit heraus.«
»Und dann?«
»Erzähle ich allen davon«, sagte er. Am Horizont verschwamm die Linie zwischen Wasser und Himmel, und in seinem betrunkenen Kopf hallte das Rauschen der Wellen nach wie ein Echo. Es war der Beginn von etwas Neuem, das spürte er. Das erste Treffen, an das er eines Tages zurückdenken und sich fragen würde, wie sein Leben andernfalls verlaufen wäre.
Ohne den rätselhaften Mann neben ihm.
AM TAG NACH DEM MORD
Shanghai, Hauptquartier der Städtischen Polizei Bezirk Jing’an, Wuning South Rd. 128, OG 7 Donnerstag, 2.September 2021 – 10:37Uhr Ortszeit
Auf dem Video der Überwachungskamera ist Folgendes zu sehen: Zuerst ein leerer Hotelflur mit Strahlern entlang der Wand, die sogar in Schwarz-Weiß einen angenehm warmen Schimmer verbreiten. Als die Zeitanzeige am oberen Bildrand auf 23:57Uhr springt, nähert sich von den Aufzügen her ein Mann mittleren Alters. Er trägt Straßenkleidung, Jeans und T-Shirt, aber an den Füßen die Hausschuhe des Hotels. Den Blick auf die Reihe der Zimmertüren gerichtet, geht er mit zielsicheren Schritten den Flur entlang und bleibt vor Zimmer 2516 stehen. (Die Nummern sind auf dem Video nicht zu erkennen, aber die vier Männer, die es betrachten, wissen Bescheid.) Mit einer Hand greift er sich an den Hals, als lockerte er einen Krawattenknoten. Nachdem er geklopft hat, verstreichen einige Sekunden, ohne dass etwas geschieht. Die nach vorn gebeugte Haltung des Mannes deutet auf gespanntes Horchen, ansonsten wirkt er ungeduldig und scheint nur mit Mühe stillstehen zu können. Ist er betrunken? Als offenbar von drinnen keine Antwort kommt, klopft er noch einmal, macht einen Schritt zurück und schaut auf die Uhr. Schließlich geht die Tür auf, ohne dass die zweite Person ins Bild tritt, und der Mann stutzt, als hätte er jemand anderen erwartet. Kurz dreht er den Kopf, blickt genau in die Kamera, und für einen Moment ist es – jetzt, da Thomas Gärtner das Video anschaut und sich in einem fort die malträtierten Handgelenke massiert, links, rechts, in nervöser Gleichmäßigkeit –, als sähe er sich selbst ins Gesicht. Mitten heraus aus diesem körnigen Schwarz-Weiß, das auf perverse Weise die Funktion seines Gedächtnisses übernommen hat. Vergeblich hofft er, der Mann auf dem Band werde den Flur wieder hinabgehen und verschwinden, aber in dem Fall wäre er jetzt nicht hier, sondern würde in seinem eigenen Zimmer (Nummer 407) auf einen Anruf von Sascha Daniels warten. Weiß die Polizei bereits, warum er in Shanghai ist? Bringt es noch etwas, so zu tun, als wäre er kein Journalist? Chinesische Behörden haben bekanntlich wenig Respekt vor seinem Berufsstand, und früher oder später wird es ohnehin herauskommen.
Die Luft in dem kleinen Verhörzimmer ist stickig trotz der Klimaanlage. Hinter heruntergelassenen Lamellen brodelt die Stadt, auf deren Straßen man sich im Spätsommer fühlt wie im Dampfbad. Er hätte nicht herkommen dürfen, das ist die einzige Gewissheit, über die er an diesem Morgen verfügt. Eine Akkreditierung für den Kongress besitzt er sowieso nicht. Was zum Teufel hat ihn geritten, trotzdem das Flugzeug zu besteigen und nach Shanghai zu fliegen?
»Ich muss dringend telefonieren«, sagt er zum dritten oder vierten Mal.
»Sie müssen sich dringend das da anschauen«, sagt der Beamte, der sich als Kommissar Frank Luo vorgestellt hat. Sein Englisch klingt merkwürdig, weil er die Vokale unnötig dehnt, außerdem spricht er im Tonfall eines Mannes, der sich ungern wiederholt. Seine Worte begleitet er mit einer Bewegung des Kinns, die dem Bildschirm gilt. Der Mann im Hotelflur zögert, so als hätte ihn eine plötzliche Ahnung befallen, dass er dabei ist, die Linie in ein anderes Leben zu überschreiten – eines, in dem die Shanghaier Polizei ihn verdächtigen wird, einen Mord begangen zu haben; an einem Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees, das bekannt war für seinen Charme, seine Bestechlichkeit und ausgesprochen gute Kontakte zur Kommunistischen Partei Chinas.
Bloß, wie um alles in der Welt hätte er so etwas vorausahnen können?
Schließlich betritt der Mann auf dem Bildschirm das Hotelzimmer. Der Flur ist wieder leer. Gegen seinen Willen entringt sich Gärtners trockener Kehle ein krächzender Laut.
Frank Luo sagt etwas auf Chinesisch zu dem Kollegen, der am Schreibtisch sitzt und die Hand ausstreckt, um das Video vorlaufen zu lassen. Ein dritter Beamter steht breitbeinig vor der geschlossenen Tür. In der kurzen Pause versucht Gärtner, seine Erinnerungen zu ordnen und einen klaren Gedanken zu fassen. Vor anderthalb Stunden hat ihn jemand roh an der Schulter gerüttelt, und als er sich die Augen rieb und einen stechenden Schmerz zwischen den Schläfen spürte, hielt ihm die Person einen Ausweis unter die Nase, sagte etwas von Verhaftung und befahl ihm, aufzustehen und mitzukommen. Get up and come with us – alles mit diesen gedehnten Vokalen eines als Englisch verkleideten Chinesischs. Fünf oder sechs Polizisten in Uniform waren im Zimmer, die ihn keines Blickes würdigten, während sie in seinen Sachen wühlten und alles in durchsichtige Plastiktüten steckten, was ihr Interesse erregte.
Kurz darauf das kühle Metall von Handschellen an seinen Gelenken. Außerdem fällt ihm ein, dass sein Chefredakteur bisher nicht weiß, dass er in Shanghai ist. Er befindet sich auf einem seiner typischen Alleingänge, die Röhrig regelmäßig zur Weißglut treiben.
Woran sonst erinnert er sich? An die Ankunft am Flughafen, die Müdigkeit nach dem langen Flug und die willkommene Kühle der Hotellobby. Sein Zimmer war eines der billigsten im Haus, im vierten Stock und mit Blick auf den Hinterhof … Für einen Moment ist es, als wollten ihm weitere Details einfallen, sein ganzer Körper spannt sich unter der Anstrengung, den eben erhaschten Faden nicht abreißen zu lassen (der Vorlauf ist unterdessen beendet, aber der Flur auf dem Bildschirm so leer wie zuvor). Dass er Whiskey getrunken hat, ist schon keine Erinnerung mehr, sondern der schale Rest eines Geschmacks in seiner Kehle. Nein, er kann sich auf seinem Stuhl winden, wie er will, mehr gibt sein schmerzender Kopf nicht her. Mehr ist da nicht.
»Ich hätte gerne ein Glas Wasser.«
Frank Luo erteilt einen zweisilbigen Befehl, und der Beamte geht von der Tür zu einem kürbisgroßen Wasserspender in der Zimmerecke. Ein winziger Plastikbecher wird vor Gärtner abgestellt, den er mit beiden Händen fassen muss, so stark zittern sie.
»Action!«, knurrt der Kommissar.
Auf der Zeitanzeige sind sieben Minuten vergangen. Die Tür von Suite 2516 öffnet sich und heraus tritt Thomas Gärtner. Unter dem rechten Arm trägt er etwas, das wie ein Dossier oder eine Schreibmappe aussieht. Er macht zwei eilige Schritte in den Flur hinein, so wie Kinder die Straße überqueren, dann wendet er sich um, schließt die Zimmertür und geht leicht schwankend in Richtung der Aufzüge. Definitiv betrunken.
»The End«, sagt Frank Luo. Der zweite Beamte klickt das Video weg, und für einen Moment kommt es Gärtner vor, als verschwinde damit auch der letzte Rest seiner Erinnerung. »Sieben Minuten reichen aus, um einen Menschen zu töten. Stimmen Sie mir zu?« Mit verschränkten Armen geht der Kommissar um ihn herum und setzt sich auf die Kante des Schreibtischs.
»Ich möchte jemanden vom hiesigen Konsulat sprechen.«
»Erst sprechen Sie mit mir.«
»Ich habe ein Recht darauf«, beharrt er, obwohl der Satz unglaubwürdig klingt, wie ein rhetorischer Notbehelf gegen die Angst. In China hat man keine Rechte, sondern muss hoffen, dass sie einem gewährt werden.
»Das Konsulat ist verständigt, MrGardner. Wir entscheiden nicht, wann die jemanden schicken. Vielleicht beantworten Sie in der Zwischenzeit meine Fragen.«
»Ich habe Ihnen gesagt: Ich kann mich an nichts erinnern.«
»Niemand kann sich an nichts erinnern.«
Er bemüht sich, seiner Stimme einen festen Klang zu geben. »Gestern Abend um halb sechs bin ich am Flughafen gelandet. Ich habe erst die Magnetschwebebahn in die Stadt genommen und dann die U-Bahn zum Plaza Hotel.«
»Ungewöhnlich. Gäste in Luxushotels benutzen ja selten öffentliche Verkehrsmittel.«
»Dort habe ich mein nicht sehr luxuriöses Zimmer bezogen. Habe einen Drink genommen und … dann muss ich schnell eingeschlafen sein. Geweckt wurde ich von Ihnen.«
Daraufhin ist es eine Weile unbehaglich still, nur die Klimaanlage summt, und die Metalllamellen vor den Fenstern bewegen sich sachte hin und her. Erst jetzt bemerkt Gärtner den Ventilator, der sich über seinem Kopf dreht.
»Ihre Ankunft in Shanghai war vor drei Tagen.« Frank Luos schwarze Augen sind völlig reglos, er blinzelt nicht einmal. »Interessant, oder?«
Reflexartig wendet sich Gärtner dem leeren Bildschirm zu. Auf der Datumsanzeige neben der Uhrzeit stand das gestrige Datum, oder nicht? Doch, natürlich, der Mord war ja gestern, aber es dauert eine Weile, bis er die Information verarbeitet hat: Seinem Gedächtnis fehlen nicht ein paar Stunden, sondern drei Tage.
»Verstehen Sie mich?«, fragt Luo.
»Ja und nein.«
»Bleiben Sie bei Ihrer Aussage, dass das Letzte, woran Sie sich erinnern, der Abend Ihrer Ankunft in Shanghai ist?«
Er nickt und hat augenblicklich das Gefühl, dass das nicht stimmt. Die Ankunft im Zimmer, der Drink … Dann hat er mit Lena telefoniert, oder? Ist Taxi gefahren, um sie zu treffen. Gleich am ersten Abend? Durch seinen Kopf schwirren Bilder ohne feste Sequenz, wie ein vor vielen Monaten gesehener Film. Außerdem fällt ihm auf, dass niemand Protokoll führt. Er wird vernommen, aber niemand schreibt mit, ein Aufnahmegerät sieht er auch nicht. Über den chinesischen Überwachungsstaat hat er dies und das gelesen, ohne sich wirklich dafür zu interessieren. Vielleicht sind Mikrofone in die Wände eingebaut oder der Computer vor ihm schneidet automatisch alles mit.
»Gut«, sagt Frank Luo in einem Tonfall, der das Gegenteil signalisiert. »Sie haben gesehen, dass Sie beim Verlassen des Zimmers etwas unter dem Arm halten. Auf einem anderen Video ist zu erkennen, dass es sich um ein schwarzes Dossier handelt, nicht sehr dick, einige wenige Blätter. In Ihrem Zimmer konnten wir nichts davon finden. Ihren Pass übrigens auch nicht. Irgendeine Erklärung?«
»Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen«, sagt Gärtner. »Was ist mit meinem Anwalt, also den Leuten vom Konsulat? Ich bin deutscher Staatsbürger und …« Selbst für seine eigenen Ohren klingt er jetzt ausgesprochen jämmerlich. Das hättest du dir früher überlegen müssen!
»Weshalb sind Sie nach Shanghai gekommen, MrGardner? Was machen Sie hier? Wieso wohnen Sie in einem Fünf-Sterne-Hotel und fahren mit der U-Bahn?«
»Zu viele Fragen auf einmal.«
»Was sind Sie von Beruf?«
»Journalist«, antwortet er, weil es sinnlos wäre zu lügen. Von dem falschen Visum weiß die Polizei vielleicht schon, jedenfalls wirkt der Kommissar nicht überrascht.
»Kennen Sie den Toten? Sind Sie seinetwegen hier?«
»Wir kennen einander seit vielen Jahren. Ich habe früher lange in Afrika gearbeitet, auch in Mosambik.«
»Tatsächlich. Nun wohnen Sie in Shanghai im selben Hotel wie er, obwohl es eigentlich zu teuer ist für Sie. Warum?«
Schon oft hat er sich gefragt, wieso Politiker, die in einen Skandal verstrickt sind, auch dann noch ihre Schuld bestreiten, wenn sie längst feststeht. Jetzt spürt er genau denselben Drang: irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen Ausflüchte vorzubringen. Es scheint kein rationales Verhalten zu sein, sondern ein Instinkt. Frank Luo verzieht derweil keine Miene, sondern sitzt mit immer noch verschränkten Armen auf der Schreibtischkante und sieht ihn an. Unmöglich, sein Alter zu schätzen, irgendwas zwischen vierzig und siebzig.
»Woran ist MrMurandi gestorben?«, fragt Gärtner.
»Das wird erst die Obduktion ergeben. Noch ist unklar, wessen Zustimmung wir dafür brauchen. Die mosambikanische Botschaft ist eingeschaltet, das IOC ebenso, man muss die Familie konsultieren …« Zum ersten Mal zeigt Kommissar Luo die Andeutung eines Lächelns. »Vermutlich wird CNN viel Geld bieten, um die Obduktion live im Fernsehen zu übertragen.«
Charles Murandi hat keine Familie, will Gärtner sagen und entscheidet sich dagegen. »Sie wissen also nicht, woran er gestorben ist.«
»Es gab eine gewisse Hoffnung, Sie würden es uns sagen.«
»Dann können Sie auch nicht wissen, dass es Mord war.«
»Aber es könnte einer gewesen sein. Sollte sich das bestätigen, sind wir in der komfortablen Situation, bereits einen Verdächtigen zu haben. Dass die Angelegenheit international für Schlagzeilen sorgen wird, ist Ihnen klar. So kurz vor der Vergabe der Olympischen Spiele … Wie viele Ihrer Kollegen würden spontan auf einen Herzinfarkt tippen, was meinen Sie? Außerdem muss ich gestehen, dass Sie bisher keinen überzeugenden Eindruck auf mich machen. Wissen Sie wirklich nicht, was mit diesem Dossier passiert ist?«
»Nein.«
»Sind Sie homosexuell?«
»Was?«
»Der Tote war nackt, außerdem wurden Speichelspuren auf seiner Stirn gefunden. Ungewöhnlich, oder? Die DNA werten wir noch aus.«
Gärtners Gedanken beginnen zu schwimmen. »Ich bin nicht schwul, und ich werde kein Wort mehr sagen ohne konsularischen Beistand.«
»Vielleicht bisexuell? Mal so, mal so. Scheint im Westen in Mode zu sein.«
»Fragen Sie nach Lena Hechfellner, sie arbeitet im Rechts- und Konsularreferat. Soll ich den Namen buchstabieren?«
»Sie kennen einander?«, fragt Luo und lässt es eher wie eine Feststellung klingen. »Ich sagte doch, das Konsulat ist verständigt. Wir haben nicht vor, Ihnen etwas in die Schuhe zu schieben, MrGardner. Noch stehen Sie nicht unter Anklage. Wir haben lediglich einen Toten und gewisse Indizien, die auf Mord hindeuten. Auf einem Sicherheitsvideo ist der Mann zu sehen, der Mu-lan-di entweder zuletzt lebendig oder zuerst tot gesehen hat – oder beides. Dieser Mann behauptet, sich weder an seinen Besuch im Zimmer des Verstorbenen zu erinnern noch an das Dossier, das er von dort mitgenommen hat.« Luo hält inne, als erwartete er Gärtners Einspruch. »Sagen Sie selbst: Es wäre unverantwortlich von uns, würden wir uns nicht ein bisschen für Sie interessieren.«
Danach füllt Schweigen den Raum, bis ein weiterer Beamter den Kopf hereinsteckt und Kommissar Luo ihm nach draußen folgt.
Die Uhr neben der Tür zeigt genau zehn vor elf.
Shanghai International Convention Center Bezirk Lujiazui, 2727 Binjiang Avenue 11:29Uhr Ortszeit
Die Nachricht schlägt nicht ein wie eine Bombe; die Art, wie sie Konferenz- und Presseräume, Lounges und Flure, Vorder- und Hinterzimmer erobert, gleicht eher dem Einfall einer Horde Termiten, deren Arbeit im Verborgenen geschieht. Genauer gesagt gibt es gar keine Nachricht, nur eine plötzlich um sich greifende Unruhe. Menschen geraten in Bewegung, die Frequenz der Telefonate erhöht sich wie ein Pulsschlag unter Stress, von einer Minute auf die andere ist die Presseabteilung des IOC nicht mehr zu erreichen. An den Erfrischungstheken herrscht größerer Andrang als sonst. Man rührt in seinem Kaffee, hält Ausschau nach Leuten, die etwas wissen könnten, und kämpft mit der Angst, es könnte bereits zu spät sein. Für was genau, weiß niemand, aber alle wollen darüber reden. Dringend!
Als endlich der Name Charles Murandi fällt, bricht die Anspannung kurz in sich zusammen und ist gleich darauf größer als zuvor. Geht es also um Korruption? Das Wort Skandal macht die Runde, eine Hülle ohne Inhalt. Obwohl das IOC keine Pressekonferenz angekündigt hat, wird sie innerhalb der nächsten Stunde erwartet. Oder der übernächsten. Nichts geschieht.
Als auf Thomas Gärtners Handy zum dritten Mal nur die Voicemail anspringt, wird auch Sascha Daniels nervös. Dem Kollegen ist zwar vieles zuzutrauen, aber nicht, dass er an diesem Vormittag sein Telefon ausgeschaltet lässt. Außerdem haben sie eine Abmachung. Eine Weile steht Daniels unschlüssig im lichtdurchfluteten Atrium, wo man nicht weiß, ob die Glasfassaden dreckig sind oder der Himmel über Shanghai eben so aussieht. Bei Tageslicht wirkt sogar der Bund auf der anderen Seite des Wassers unscheinbar und grau. Fünf Jahre lang hat Daniels für das Handelsblatt aus China berichtet, an Kontakten mangelt es ihm nicht, jetzt starrt er auf das Display seines nagelneuen Xiaomi-Telefons – das iPhone hat er sicherheitshalber in Deutschland gelassen – und überlegt, wen er anrufen soll. Dass die Pressekonferenz innerhalb der nächsten zwei Stunden stattfinden wird, glaubt er nicht. Das IOC ist ein verschwiegener Verein, und sollte der Fall wirklich so sensationell sein, wie um ihn herum alle zu erwarten scheinen … Ausgerechnet Charles Murandi! Hat Gärtner ihn übers Ohr gehauen und jemand anderen gefunden, über den er besser an Informationen kommt? Oder ist das Ganze doch eine Ente, die Autosuggestion gelangweilter Presseleute?
»Lena Hechfellner«, murmelt er, noch bevor er den entsprechenden Entschluss gefasst hat. Ein neuer Kontakt. Vor vier Tagen sind sie einander am Rand eines Empfangs der Industrie- und Handelskammer begegnet, und wenn er ehrlich ist, sucht er seitdem einen Vorwand, um sich bei ihr zu melden. Ende dreißig, genauso alt wie er, außerdem sportlich, schlagfertig und geschieden. Squash spielt sie, hat er einer beiläufigen Bemerkung entnommen und keine Mühe gehabt, sie sich dabei vorzustellen.
Eilig zieht er sich in eine stille Ecke bei den Seiteneingängen zurück, sucht ihre Visitenkarte aus dem Portemonnaie und tippt. Dass Gärtner ihn hintergangen hat, kann er sich nicht vorstellen. Der Mann ist verrückt und besessen, aber auf seine Art eine ehrliche Haut. Erstklassiger Reporter sowieso. Draußen ergießen sich Wasserfälle in grünlich ausgeleuchtete Marmorbecken und sorgen für ein beständiges hartes Plätschern. Den weitgehend verblassten Glanz des alten Shanghai mag Daniels, die neueren Gebäude tendieren zu einer Mischung aus Bombast und Kitsch. Nach fünf Jahren hat er das Land seinerzeit nicht ungern verlassen. Bloß der erhoffte Karrieresprung lässt weiterhin auf sich warten.
»Hechfellner.«
»Hallo, Sascha Daniels hier.« Er weiß nicht mehr, ob sie einander am Ende des IHK-Abends geduzt haben oder nicht.
»Hallo Sascha.« Umso besser. Rasch fingert er einen zerknitterten Notizblock aus der Brusttasche seines Hemds.
»Wollte mich nur mal kurz melden. Fragen, ob du Zeit für einen Kaffee hast. Ich komme hier um vor Langeweile.«
»Nichts los beim IOC?«
»Die Abstimmung ist erst morgen, heute kursieren nur Gerüchte.«
»Verstehe.« Lena Hechfellner, das hat er schon vor vier Tagen festgestellt, sagt selten, was andere an ihrer Stelle sagen würden, zum Beispiel: Aha, was für Gerüchte denn?
»Angeblich gibt es später eine Pressekonferenz.«
»Demnach hast du gar keine Zeit für einen Kaffee.«
»Das wird noch dauern. Weißt du, wie ich Thomas Gärtner erreichen kann?«
»Meine erste Wahl ist immer das Handy.«
»Er geht aber nicht ran.«
Darauf erwidert sie nichts, und Daniels hat, was er sein Reportergefühl nennt: die Ahnung, dass jemand anderes etwas weiß, das er auch gern wissen würde. Zwei ältere Männer in übertrieben aufwendigen Uniformen bewachen den nächsten Eingang, einer schaut gelangweilt zu ihm herüber. »Lena?«
»Du rufst die Rechtsabteilung des Konsulats an, weil jemand nicht an sein Handy geht?«
»Ich rufe dich an, weil du ihn kennst.«
»Schreib ihm eine SMS.«
»Habe ich schon. Hör zu, wir haben uns vor zwei Tagen getroffen, er und ich. Offenbar hat er für den Kongress keine Akkreditierung bekommen. Warum, wollte er nicht sagen, irgendwas sei schiefgelaufen. Also hat er mich gebeten, ihm zwischendurch ein paar Infos zukommen zu lassen, sozusagen live vom Ort des Geschehens. Tja, und jetzt geht hier das Gerücht um, dass etwas mit Charles Murandi passiert ist.«
»Mit wem?«
»Komm schon«, sagt er, obwohl ihm das etwas zu vertraulich erscheint. »Schwer vorstellbar, dass der Name in euren Gesprächen nie gefallen sein soll.«
»Du scheinst den Grad unserer Bekanntschaft zu überschätzen. Der illustre IOC-Typ?«
»Genau der.«
»Keine Ahnung, wie ich dir helfen soll. Außerdem bin ich gerade auf dem Sprung.«
»Nur um auszuschließen, dass Gärtner nicht rangeht, wenn ich anrufe: Würdest du kurz bei ihm durchklingen? Wenn er abnimmt, sag ihm, es ist dringend. Andernfalls sag mir Bescheid, ja?«
»Ich dachte, ihr seid eher Konkurrenten. Beruflich.«
»Hat er das behauptet?«
»Außerdem vermittele ich ungern zwischen anderen Parteien.«
»Du bist Diplomatin, das ist dein Job«, sagt er. »Wohin bist du denn auf dem Sprung? Wir könnten uns später in der Stadt treffen, meinetwegen in der Nähe des Konsulats.«
»Die Kanzlerin kommt, wie du weißt, hier sind alle am Rotieren.«
»Ruf ihn an, ja? Bitte!«
»Mal sehen. Bis dann.«
Anschließend geht er das Gespräch im Kopf noch einmal durch. Ihre erste Reaktion auf den Namen Thomas Gärtner war ein wenig … Das richtige Wort will ihm nicht einfallen, aber soweit er weiß, kennen sich die beiden zu gut, um von bloßer Bekanntschaft zu sprechen. Waren sie mal miteinander in der Kiste? Möglich, bloß würde sie damit genauso cool umgehen, wie sie ihn beim IHK-Treffen hat abblitzen lassen, und eben wirkte sie für einen Moment … angefasst, ohne es zeigen zu wollen. Und warum hat sie zuerst so getan, als sagte ihr der Name Murandi nichts? Von dem heißt es in Insider-Kreisen, er sei ein hohes Risiko eingegangen im Umgang mit den Chinesen. Überhaupt gilt er als Spieler. O jogador nennen sie ihn zu Hause.
Was nun?
Daniels’ Reportergefühl sagt ihm zwei Dinge: Erstens läuft hier was, womöglich etwas Großes, und zweitens liegt darin eine Chance für ihn. Das Handelsblatt hat er seinerzeit verlassen, weil er investigativ arbeiten wollte, aber bei den großen Blättern bestand kein Bedarf an seinen Diensten. Manche haben ihn mit vagen Andeutungen hingehalten: Melden Sie sich, wenn Sie was Interessantes haben. Jetzt ist es in Deutschland eigentlich noch zu früh für einen Anruf, aber echte Chefredakteure kennen keinen Schlaf. Das Spiegel-Büro in Peking ist seit Monaten unbesetzt, weil der frühere Leiter zu kritisch war und der künftige deshalb kein Visum erhält. Je weniger neugierige Langnasen im Land sind, desto besser – in diesem Fall auch für ihn. Im neuen Handy sind zwar keine Nummern gespeichert, aber die von Röhrig hat er in weiser Voraussicht notiert, und beim Tippen stellt Sascha Daniels fest, dass seine Finger ein wenig feucht sind. Entweder bringt er sich gleich um seine letzte Chance, oder er klopft genau im richtigen Moment an die richtige Tür.
Airbus A350-900, Flugbereitschaft der Bundeswehr Auf dem Weg nach Shanghai, irgendwo über Russland 05:14Uhr MESZ
Im vorderen Teil des Flugzeugs herrschen drangvolle Enge und gespannte Stille. Nur die Turbinen draußen produzieren das übliche Rauschen. Dr.Jens Kühn vom Koordinierungsstab des Kanzleramts hat seinen Bericht über die Vorgänge in Shanghai beendet, die Bundeskanzlerin hat mit unbewegter Miene zugehört und ab und zu auf ihr Handy geschaut, als vergleiche sie das Gesagte mit ihren eigenen Quellen. Um sie herum sitzen der für Sport, Bayern und den Koalitionsfrieden zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer, sein Staatssekretär Günter Renne, NOK-Präsident Steinbach, Hans-Peter Sinnhuber von der europäischen Olympia-Koordinierungsstelle und Steffen Seibert. Einem neutralen Beobachter würde auffallen, dass alle Männer denselben Gesichtsausdruck zeigen: ernst und ein wenig ratlos. Der kleine rote Olympia-Anstecker, den Sinnhuber der Kanzlerin kurz vor dem Abflug ausgehändigt hat, ruht wie vergessen auf einer kaffeefleckigen Untertasse. Alle anderen tragen ihren am Jackettaufschlag. Das Gerücht, die scheidende Regierungschefin stehe dem historischen Projekt einer gemeinsamen europäischen Olympiabewerbung skeptisch gegenüber, ist so alt wie die Idee selbst.
Hinten im Passagierraum sitzt die Presse und brummt vor Ungeduld. Schon so weit über Russland, und noch immer lässt man sie auf die obligatorische Fragerunde warten.
Weil für einen Moment niemand spricht, blickt die Kanzlerin aus dem Fenster. Unter ihr die Monotonie der sibirischen Taiga. Oder sollte es womöglich die Tundra sein? Ihr letzter offizieller Besuch in China wurde ein wenig hastig anberaumt, weil lange unklar war, wer die europäische Bewerbung vor Ort repräsentieren darf. Wäre die Disziplin Hauen und Stechen olympisch, wüsste sie ein paar Medaillenkandidaten. Paris hat schon die Spiele 2024, trotzdem will man 2032 unbedingt die Leichtathletik und Handball. Irgendwie wäre das gut gegen Le Pen, außerdem seien die Deutschen doch so versiert im Dressurreiten. Als letzter Konkurrent stehen ausgerechnet drei ostafrikanische Städte im Ring, die sich ebenfalls zu einem historischen Projekt – oder einem aberwitzigen, das kommt auf die Perspektive an – zusammengeschlossen haben: Addis Abeba, Nairobi und Daressalam. Europa gegen Afrika. Was man in den USA›the optics‹ nennt, gefällt der Kanzlerin gar nicht, und dass hinter der afrikanischen Bewerbung die Chinesen stehen, die all die Stadien, Flughäfen und Hotels bauen wollen, die eine Olympiade erfordert, macht die Sache zusätzlich kompliziert. In den Medien hat das Ganze längst einen geopolitischen Duellcharakter angenommen, der die Emotionen auf völlig unnötige Weise anheizt. Je größer der Einsatz, desto schmutziger die Mittel.
Und jetzt das! Glaubt jemand allen Ernstes, dass ein Spiegel-Journalist ein mosambikanisches IOC-Mitglied ermordet hat? In dessen Hotelzimmer in Shanghai! Die Geschichte klingt so abwegig, dass sich der Gedanke, es müsse mehr dahinterstecken, wie von selbst aufdrängt. Bloß was? Seit einiger Zeit macht das Gerücht die Runde, China sei gar nicht so versessen darauf, die Spiele tatsächlich nach Afrika zu holen, dem Regime gehe es vorrangig um den guten Willen, den sein Engagement erzeugt. Dass der Westen den afrikanischen Traum vereitelt hat, wird sich, wenn es so kommen sollte, zu einem Narrativ formen lassen, das im globalen Süden gut ankommt. ›Alles nur ein Spiel?‹ hat der Spiegel neulich getitelt, vielleicht war das ja dieser Thomas Gärtner. Der Name sagt ihr nichts. Zwischen den afrikanischen Staaten soll es ebenfalls knirschen, angeblich will Mosambik die Unruhen in Äthiopien nutzen, um die eigene Hauptstadt als Alternative zu Addis Abeba ins Spiel zu bringen. Vor der mosambikanischen Küste lagern bekanntlich riesige Ölvorkommen, China will unabhängiger werden vom Nachschub aus dem Persischen Golf … Nicht nur zu viele Emotionen sind hier im Spiel, sondern auch knallharte Machtpolitik – genau genommen die einzige Politik, die es gibt.
Unauffällig schaut die Kanzlerin in die Runde. In Erwartung einer Reihe von PR-Terminen hat sie den größten Teil ihres Stabs zu Hause gelassen und beginnt zu fürchten, das könnte ein Fehler gewesen sein. Dieser Herr Gärtner wurde am frühen Morgen festgenommen. In Deutschland wird niemand an seine Schuld glauben, und was sie gegenwärtig an Hypothesen erwägt, dürfte morgen in Form von Behauptungen weltweit durch die Nachrichten geistern: Eine deutsche Geisel, zum Beispiel, um Berlins Unterstützung für die europäischen Spiele zu schwächen. Die Verhaftung der beiden Kanadier hatte seinerzeit zwar andere Gründe, aber auf freiem Fuß sind sie immer noch nicht. Staatsterrorismus nennen es manche; würde sie sich das Wort zu eigen machen, könnte sie den Piloten gleich bitten, wieder umzukehren. Direkt hier, über diesen … Von irgendwo zieht der Ausdruck ›boreale Nadelwälder‹ durch ihren Kopf, und sie lässt ihn passieren.
China. In keinem anderen Land wünscht sie sich so sehr, einmal hinter die Fassade zu blicken, obwohl sie gleichzeitig befürchtet, dass sie gar nichts erkennen würde. Die chinesische Sicht der Dinge scheint in einer Geschichte zu wurzeln, von der man außerhalb des Landes einfach zu wenig weiß. In jedem Gespräch mit dem Staatschef oder dem Ministerpräsidenten beträgt ihr Redeanteil allenfalls ein Drittel, eher weniger. Einmal hat sie Obama gefragt, ob es bei ihm auch so sei; der nickte und meinte: One third is a lot. Chinesische Führer neigen zu weitschweifigen historischen Exkursen, das geht jedes Mal im neunzehnten Jahrhundert los, und erst mit der Zeit hat sie verstanden, dass das gar keine Exkurse sind, im Gegenteil: In ihren Augen benennen sie den Kern des Problems. Sobald man den Rahmen nämlich weit genug stellt, hat China plötzlich recht. Die nähern sich Russland nicht an, zum Beispiel, um den Westen zu schwächen, sondern gehen großzügig über das Unrecht hinweg, das ihnen einst vom Zarenreich angetan wurde. Riesige Gebiete in der Mandschurei, die ihnen kaltblütig geraubt wurden – Schwamm drüber. In alle Richtungen strecken Chinesen die Hand aus, vergeben Unrecht, vergeben Aufträge, verteilen Noten im Fach Folgsamkeit. Wer ihnen niedere Motive unterstellt, leidet an typisch amerikanischer Paranoia. Davon müsse sich die EU unbedingt freimachen, hört die Kanzlerin bei jedem Besuch. Unbedingt! Schwer zu sagen, ob sie flehen, drohen oder bloß nüchtern empfehlen. Die Tonlage des Staatschefs jedenfalls bleibt immer gleich.
»Von wem beziehen wir unsere Informationen«, fragt sie schließlich, weil alle auf ein Wort von ihr zu warten scheinen. »Ich meine, wenn die chinesischen Behörden nichts preisgeben?«
»Das Konsulat in Shanghai soll angeblich rasch Zugang zum Verhafteten erhalten. Solange ein solcher nicht besteht, sind wir außen vor.« Der Kuli, den Dr.Kühn die ganze Zeit über in der Hand gehalten hat, wandert zurück in die Innentasche seines Jacketts.
»Sitzt hinten jemand vom Spiegel?«
Seibert nickt. »Herr Neuenkirchen. Soll ich ihn holen?«
»Einen Augenblick noch. Können wir ausschließen, dass es hier um etwas anderes geht? Braucht die chinesische Seite ein Druckmittel? Wenn ja, wofür und gegen wen? Uns? Ich reise nicht gern in ein Land, ohne zu wissen, was mich dort erwartet.« Obwohl sie genau dieses Gefühl eigentlich auf jeder Chinareise hat.
Die Herren werfen einander unsichere Blicke zu. Für einen Moment beginnt die Maschine zu vibrieren, das Geschirr auf dem Tisch produziert ein leises Klirren. Boreale Nadelwälder gibt es nur auf der Nordhalbkugel, fällt ihr ein, gut zu wissen. Am Horizont zeigt sich eine riesige Wasserfläche. Dann herrscht wieder Ruhe.
Noch etwa vier Stunden bis zur Landung.
Shanghai, Hauptquartier der Städtischen Polizei, Bezirk Jing’an, Wuning South Rd. 128, OG 7, 11:34Uhr Ortszeit
Einstweilen lässt man sie warten. Plastikstühle reihen sich zu beiden Seiten eines dämmerigen Flurs, dessen Türen allesamt verschlossen sind. Mit dem Chef hat sie vereinbart, dass sie den Verhafteten zunächst allein aufsuchen soll, was zwar ungewöhnlich ist, aber im Konsulat herrscht Hektik wegen des Besuchs der Kanzlerin. Nicht einmal ein Dolmetscher war auf die Schnelle frei, weshalb Dr.Hirsch das Betreuungsbüro der Stadtregierung bitten musste, jemanden zu schicken. Eine junge Frau, die problemlos als Studentin durchgehen würde, mit kurzen Haaren und einem Gesichtsausdruck, den Lena als abweisend bis feindselig empfindet. Das blaue Halstuch über der weißen Bluse passt zum Eindruck einer Jungpionierin, die ihre erste Bewährungsprobe erwartet. Außer dem Namen hat sie sich bisher nichts entlocken lassen. Jun Pei. Klang wie ein Pistolenschuss.
Machen Sie sich erst einmal ein Bild, lautet ihr Auftrag, vom Stand der Ermittlungen wie vom Zustand des Verhafteten. Nach drei Jahren im Deutschen Konsulat kennt Lena Hechfellner den Drill und weiß, dass eine halbe Stunde Wartezeit in China quasi zum Protokoll gehört. Auch wenn eigentlich alle bereit sind. Mit solchen Machtspielchen unterstreicht man, wer der Herr im Haus ist, und die korrekte Rollenverteilung genießt hier höchste Priorität. Jeder kennt seinen Part. Reglos sitzt die Statistin Jun Pei auf ihrem Platz und inszeniert das Schweigen wie einen einstudierten Text. Zweifellos wird ihr nachher verfasster Einsatzbericht vermerken, dass sich die Deutsche zwischendurch ein paar Schritte entfernt habe, um einen Anruf entgegenzunehmen.
Ob das wichtig oder unwichtig ist, entscheiden andere.
Bevor sie ihr Handy wieder einsteckt, wirft Lena einen unauffälligen Blick aufs Display: Genau dreiundzwanzig Minuten wartet sie jetzt. Hätte sie Sascha Daniels verraten sollen, wo sie sich befindet? Neulich beim IHK-Treffen fand sie ihn zwar nicht direkt sympathisch, aber anders als die grau melierten Expats, die ihr sonst nachstellen, wirkte er wenigstens nicht schmierig. Trotzdem hat sie gerade am Telefon ihrem Instinkt gehorcht und dichtgehalten; nur der Versuch, bei der Nennung von Murandis Namen ahnungslos zu tun, ging irgendwie daneben. Wenn sie zu Thomas vorgelassen wird, muss sie vorsichtiger sein.
Herr Gärtner, ermahnt sie sich zum wiederholten Mal. Im Konsulat weiß nicht einmal der Chef, dass sie den Verhafteten kennt. Aus ihrer Tasche nimmt sie einen gelben Post-it-Zettel, schreibt darauf WIR WERDEN ABGEHÖRT und klebt ihn verkehrt herum aufs obere Ende der mitgeführten Dokumentenmappe. Weil Jun Peis Blick sofort bohrend wird, verdeckt Lena den Zettel mit der Hand und hofft, dass die Übersetzerin ihre Nervosität nicht bemerkt. Seit einigen Tagen lebt sie in einem merkwürdigen Zustand des Staunens über sich selbst. Letzte Nacht hat sie von ihrem Vater geträumt, ohne sein Gesicht zu sehen, nur die Stimme klang ihr mit tröstlicher Klarheit im Ohr. Dass manche Kollegen im Konsulat sie meiden, mag daher kommen, dass sie andere ungern an sich heranlässt. Ihrem Ex-Mann zufolge hat sie damit alles kaputt gemacht. »Deine Fähigkeit, Dinge einfach auszublenden, innerlich beinahe nicht da zu sein …« Als sich am Ende des Flurs eine Tür öffnet, versucht Lena die peinigende Erinnerung abzuschütteln. Manchmal kämpft sie abends beim Wein gegen den Wunsch an, Martin anzurufen und ihm zu erklären, dass sie in Wahrheit überhaupt nichts ausblendet. Kann sie gar nicht. Genau die Fähigkeit, die er ihr beharrlich unterstellt hat, fehlt ihr am meisten. Daran ist die Ehe zerbrochen und noch einiges mehr.
Kurz darauf erklingen Schritte im Gang, aber Lena unterlässt es, in die entsprechende Richtung zu sehen. Nur keine Ungeduld zeigen. Erst als Jun Pei von ihrem Platz aufspringt, erlaubt auch sie sich, den Beamten zu bemerken, der sie von Weitem mustert und schließlich zwei Meter vor ihr stehen bleibt. Ein zerknitterter Anzug über einem zerknitterten Hemd, nur das Gesicht ist frei von Falten. Alterslos auf asiatische Weise, aus reiner Verlegenheit schätzt man dann immer: um die fünfzig. »Miss Häckfellner, isn’t it?«
»Yes«, sagt sie, überrascht, dass er sofort Englisch spricht.
»Frank Luo.« Es klingt wie eine Feststellung, die mit ihm nichts zu tun hat. »You are alone?«
Den Hinweis darauf, dass im Konsulat wegen des hohen Besuchs aus Berlin alle beschäftigt sind, scheint er bereits als überflüssige Erklärung zu empfinden. »This is Miss Jun Pei from the Municipal Government’s Foreign Affairs Office«, fügt Lena hinzu, weil der Kommissar die junge Frau keines Blickes würdigt. »Here to interpret for us.«
»We need her?«, fragt er kühl.
»… Don’t we?« Das Protokoll verlangt zwingend nach dem Gebrauch der Muttersprache und professioneller Übersetzung, schließlich wird ein Bundesbürger des Mordes verdächtigt. Gleichzeitig spürt Lena die Abneigung des Kommissars gegenüber der Dolmetscherin, die eine andere Behörde vertritt und in deren Bericht auch er vorkommen wird. Was tun? Dr.Hirsch würde jetzt so jovial wie möglich sagen »Let’s stick with the rules«, aber Lena befürchtet, dass sich der Kommissar in Jun Peis Beisein nur das Nötigste entlocken lassen wird, vielleicht nicht einmal das. Sein Englisch scheint auch okay zu sein, also lässt sie sich darauf ein. »If that’s what you prefer …«
»Follow me«, ist alles, was er darauf erwidert. Keine Handbewegung begleitet den Satz, er geht einfach los und überlässt es ihr, die junge Frau zu bitten, hier auf sie zu warten. »Nachdem ich mit dem Gefangenen gesprochen habe, werde ich Sie vielleicht doch noch brauchen.«
Jun Pei nickt wortlos. Ihr Blick erscheint Lena etwas weicher als zuvor, so als hätte ihre Feindseligkeit ein besseres Objekt gefunden.
Frank nennt er sich nur im Umgang mit Ausländern. Im Ausweis steht Luo Hongda, aber er mag den kompakten Klang seines englischen Vornamens und die Tatsache, dass er auch als Adjektiv funktioniert: Let’s be frank here. Eine Aufforderung, die er berufsbedingt häufiger ausspricht, als dass er ihr Folge leistet. Wenn Ausländer involviert sind, kann man als Polizist gar nicht vorsichtig genug sein. Erst recht, wenn das Betreuungsbüro die jüngste Garde schickt, die ideologisch so gefestigt ist, dass sie einem regelrecht imprägniert vorkommt. Was nicht ins Weltbild passt, perlt an diesen jungen Leuten einfach ab. Er selbst hat als Jugendlicher ein Jahr in den USA verbracht, in der Nähe von Pittsburgh, und sich erst einmal orientieren müssen in dieser unübersichtlichen Welt. Dass der amerikanische Traum eine Erfindung der dortigen Filmindustrie ist, wurde ihm schnell klar, in dieser Hinsicht findet er sein Land ehrlicher: Den chinesischen Traum, der seit einigen Jahren überall plakatiert wird, träumt die Partei, und das Volk hat ihn zu erfüllen. Frank Luo, sechsundfünfzig Jahre alt und seit etwa dreißig Jahren frei von Illusionen, hasst die Politik von ganzem Herzen, aber Parteimitglied ist er trotzdem, das geht in seinem Job nicht anders. Im Übrigen freut er sich, dass die Deutschen eine Frau geschickt haben. Mit den Männern wird es doch immer ein Hahnenkampf.
»Sie haben eine halbe Stunde«, sagt er auf Chinesisch, um zu sehen, wie sie reagiert.
»Verstanden«, kommt es in passablem Putonghua zurück. Ihr Dossier konnte er in der Eile nur überfliegen, sie scheint eine Art Rising Star des Konsulats zu sein. Ende dreißig und schon die Nummer drei im Haus. Trotzdem hat er bei diesem Fall mit größerem Tamtam gerechnet, mit mehr Leuten, höheren Rängen, und zwar auf beiden Seiten. Vor dem Gebäude werden Absperrgitter aufgestellt für den Fall, dass die ausländische Presse den Aufenthaltsort des Verhafteten erfährt, aber er hat bisher lediglich zwei Anrufe mit eher vagen Instruktionen erhalten. Fakten sammeln, was sonst. Im Büro eins wollten sie nicht einmal das Video aus dem Hotel sehen, und dass die Deutschen bloß eine Person schicken – Besuch aus Berlin hin oder her –, bedeutet wohl, dass die wichtigen Gespräche auf anderer Ebene stattfinden. Er und die Frau, die beharrlich zwei Schritte hinter ihm bleibt, machen nur die obligatorischen ersten Züge.
»Wann genau ist die Festnahme erfolgt?«, fragt sie und wechselt zurück ins Englische.
»Am Vormittag gegen neun Uhr.«
»Aus welchem Grund genau?«
»Seine Anwesenheit im Zimmer des Toten. Als womöglich letzte Person vor der Tat.«
»Womöglich.«
»Die Spuren werden noch ausgewertet. Er behauptet, sich an nichts zu erinnern.« Vor dem Verhörzimmer bleibt Luo abrupt stehen und erhascht einen Hauch ihres Parfüms. Blumig und teuer. Wäre mal wieder Zeit für ein Geschenk, meinte Yating beim letzten Treffen. Statt sie zu umgarnen wie ein echter Liebhaber, legt er abends immer häufiger die Beine hoch und klagt über den Job. Viele Überstunden, wenig Kohle. Zum Superintendenten wurde er trotz seiner Erfahrung nicht befördert, die Preise steigen schneller als sein Gehalt, und die Feierabende verbringt er mit ideologischen Schulungen, die einer höchst zweifelhaften Maxime folgen: Um Plattitüden zu Weisheiten zu machen, muss man sie nur oft genug wiederholen.
Bloß, was soll er sonst tun in seinem Alter? Neulich hat ihm ein Kollege erzählt, dass es in Shanghai 200000Millionäre gibt und folglich ebenso viele Ehefrauen, die (genau wie seine) ihren Mann der Untreue verdächtigen und (anders als seine) genug Geld haben, um jemanden mit der Wahrheitsfindung zu beauftragen. Zwar existiert der Beruf des Privatdetektivs in China nicht, erst müsste es eine Privatsphäre geben, aber wie wäre es mit einem ›Büro für persönliche Recherchen‹? Noch sei es kein Plan, meinte der Kollege, er solle in Ruhe darüber nachdenken. Vielleicht ist es besser als die andere Option, die Luo gelegentlich erwägt: dem Angebot seines älteren Bruders zu folgen und in Afrika – wo genau, hat er vergessen – die Security von dessen Firma zu leiten. Sich nebenher sein eigenes Business aufzubauen und innerhalb von drei bis fünf Jahren steinreich zu werden, genau wie der Bruder.
»Gibt es sonst noch etwas, was ich wissen muss?«, fragt die Frau mit dem unaussprechlichen Namen und reißt ihn aus seinen Gedanken. Etwas zu lang hat er den Blick auf ihr und seine Hand auf der Türklinke ruhen lassen. Jetzt schüttelt er den Kopf und öffnet. Von drinnen weht ihm säuerlicher Schweißgeruch entgegen. »Dreißig Minuten.«
»Das hatte ich schon verstanden. Es ist ein Gespräch unter vier Augen, ja?«
»Natürlich«, sagt er, ohne eine Miene zu verziehen. »Wir sind schließlich ein Rechtsstaat.« Absichtlich bleibt er in der offenen Tür stehen, sodass sie sich an ihm vorbeizwängen muss. Eigentlich hätte ihr das eine seitliche Körperdrehung abverlangt, aber sie ruft den Namen des Verhafteten und streift beim Eintreten seine, Luos, Schulter, ohne es zu bemerken. Auf einmal liegt eine unterdrückte Hast in ihren Bewegungen. Statt dem Mann die Hand zu geben, hält sie ihm ihre Mappe entgegen wie einen Ausweis. Einen Moment lang hört Frank Luo ihrem deutschen Wortschwall zu, dann schließt er die Tür und spielt die Szene noch einmal im Kopf durch. Von dem, was die beiden besprechen, braucht er so schnell wie möglich eine Übersetzung, aber bei einer halben Stunde kommen bestimmt sieben, acht Seiten zusammen, das wird dauern. Warum sprechen sie nicht alle Englisch, Scheiß-Ausländer!
Seine Laune ist so wie immer, wenn er versucht, sich das Rauchen abzugewöhnen.
In der nächsten halben Stunde lässt er sich von seinen beiden Assistenten auf den neuesten Stand der Spurenauswertung bringen. Aus ermittlungstechnischer Sicht sind Hotelzimmer ein Albtraum. In beiden, dem von Murandi wie dem von Gärtner, wurden Fingerabdrücke von mehr als einem Dutzend Personen gefunden. Putzfrauen wischen zwar die Armaturen im Bad, aber das Zimmertelefon, die Fenstergriffe, Kleiderbügel … Die Abdrücke des Deutschen zieren ein Glas in Murandis Suite, auf einen Gegenbesuch im anderen Zimmer deutet bisher nichts, aber der heikelste Fund sind zwei Schamhaare auf Murandis Matratze, die, so viel steht auch ohne DNA-Abgleich zu vermuten, nicht von ihm stammen.
»Eher glatt, würde ich sagen.« Assistenz-Kommissar Chen hält die kleine Plastiktüte gegen das Fensterlicht. Draußen verschwinden die Hochhäuser der Stadt im weißlichen Dunst. »Die von Afrikanern sind gekräuselt, oder?«
»Seine auf jeden Fall, wir haben ihn ja nackt gefunden.« Kollege Song klickt sich durch die Fotos vom Tatort. »Hier. Schwer zu erkennen, aber ich würde sagen … ja, gekräuselt.«
»Was ist mit Weißen?«, fragt Luo.
»Soweit ich sehe, hatte er nur schwarze.«
»Weiße Frauen! Oder meinetwegen Männer, wie der Verhaftete. Sind sie unten glatt oder gekräuselt?«
»Ah.« Offenbar überfragt, wendet sich Song an den noch unverheirateten Kollegen Chen, der gelegentlich behauptet, ein abwechslungsreiches Privatleben zu führen.
Jetzt allerdings schüttelt auch er den Kopf. »Woher soll ich das wissen? Die Russinnen in Shanghai nehmen sechs- bis siebentausend Yuan pro Nacht, außerdem sind sie sowieso rasiert.«
Für einen Moment hängt jeder seinen eigenen Gedanken nach und versucht, sich deren Inhalt nicht anmerken zu lassen. Ob es ihn scharfmachen würde, hat Yating neulich aus heiterem Himmel gefragt, wenn sie sich die Muschi rasiert. Er war so überrascht, dass er ihr die Antwort schuldig geblieben ist, und sich irgendwie auch. Fest steht, dass er in letzter Zeit sowieso oft zu müde ist. Dann bestellt Yating etwas zu essen, und sie trinken vor dem Fernseher billigen Rotwein, der ihm den Kopf noch schwerer macht. Sechstausend Yuan für eine Nacht, fick die Schwiegermutter! Und offenbar kein Mangel an Kunden, die sich das leisten können. Im Übrigen betreiben sie hier so angeregt vergleichende Schamhaarforschung, weil alle ahnen, dass diese zwei von einer Chinesin stammen. Zwar arbeiten in den großen Hotels nicht mehr so viele Prostituierte wie früher, aber das Geschäft ist immer noch zu lukrativ, um darauf zu verzichten. Dass auf dem Sicherheitsvideo aus der Todesnacht keine Frau auftaucht, heißt gar nichts, das könnte manipuliert worden sein. In so einem Fall, der international hohe Wellen schlagen wird, dürfen Prostituierte keine Rolle spielen, offiziell gibt es schließlich keine; schon gar nicht da, wo die hohen Herren vom IOC absteigen. Kommissar Luo hält es sogar für möglich, dass der Mann eines quasi natürlichen Todes gestorben ist, Herzversagen zum Beispiel, wenn man seine Grenzen nicht kennt, kann das durchaus passieren. Aber selbst darauf würde die Öffentlichkeit ungehalten reagieren, und in der Stadtregierung müssten Köpfe rollen. Also ist Diskretion gefragt. Früher, als es noch Videobänder gab, konnte man Beweismaterial einfach verschwinden lassen, so wie unliebsame Zeugen. Heute muss man nicht nur erfinderischer sein, sondern vor allem vorsichtiger.
Wer die Unbekannte ist, wüsste er trotzdem gern.
Rasch sieht er auf die Uhr. Damit die Übersetzung nicht zu aufwendig wird, beschließt er, den beiden Deutschen nur zwanzig Minuten zu gewähren. Noch einmal ruft er sich ihre Begrüßung ins Gedächtnis und überlegt, was ihn daran irritiert. Die Frau hat so schnell zu sprechen begonnen, als hätte sie Angst, der Mann könnte ihr zuvorkommen und etwas Falsches sagen. Aber was? Soweit er weiß, ist sie auf dem üblichen Weg benachrichtigt worden, also nicht sie persönlich, sondern das Deutsche Konsulat. Ihr Dossier vom Betreuungsbüro enthält keinen Hinweis auf geheimdienstliche Tätigkeiten, aber es soll ja schon Spione gegeben haben, die sich tarnen. Ihr nachzuschnüffeln, kommt leider nicht infrage, das würde die falsche Art von Aufmerksamkeit erregen. In einem Fall wie diesem ist sein Aktionsradius noch enger begrenzt als sonst. Am liebsten wäre es ihm, jemand würde ihn anrufen und verkünden, dass sich eine andere Abteilung der Sache annimmt. Dann könnte er seinen Bericht schreiben und Yating ausnahmsweise schon am frühen Abend treffen. Eine Geliebte, mit der man ein eheähnliches Verhältnis führt – mehr Streit als Sex –, provoziert die Frage, warum man überhaupt eine hat. Unter dem alten Superintendenten gehörte es zum guten Ton, wer wollte abends schon als Einziger nach Hause gehen, aber inzwischen hat sich auch das geändert. Gewisse Schwächen zu haben ist weniger menschlich als gefährlich.
Nichts entgeht dem aufmerksamen Blick der Partei. Alles kann zum Strick werden, an dem sie dich eines Tages aufhängt.
ZWEI TAGE VOR DER TAT
Shanghai, Pudong International Airport Montag, 30.August 2021, früher Abend
Mit drei Dingen im Gepäck traf er in Shanghai ein: einem noch unbenutzten Handy, dem unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erworbenen Visum und dem Wissen, dass dieser Besuch seine letzte Chance war. Wenn er in einem Monat keine Story ablieferte, würde Röhrig ihn fallen lassen. Einfach nicht mehr hinnehmbar sei das, hatte der Chefredakteur angesichts immer neuer Ausreden gesagt, die ihn statt druckfertiger Texte erreichten, und sollte er von einer Chinareise hinter seinem Rücken erfahren, wäre sowieso alles vorbei. Dabei ging es hier um viel mehr als um eine Story. Was Thomas Gärtner über drei Kontinente verfolgte und irgendwie nicht zu fassen bekam, war genau genommen die Geschichte seines Lebens.
Trotz der klimatisierten Luft erkannte er die Schwüle wieder, die ihm schon bei seinem ersten und bisher einzigen Besuch im Land zugesetzt hatte. Vor zwei Jahren war er im Süden gewesen, um die Diaspora afrikanischer Kleinhändler zu erkunden, die in Guangzhou containerweise Billigklamotten, gefälschte Luxusuhren und Gucci-Handtaschen kauften, die sie zu Hause für das Dreifache wieder absetzten. Kongolesen, Kenianer, sogar einem seiner Madgermanes aus Maputo war er dort über den Weg gelaufen. Wer das Falsche einkaufte oder vom Richtigen zu viel, riskierte den Ruin. China selbst hatte ihn seinerzeit kaum interessiert, aber inzwischen hing alles mit allem zusammen, in der Welt wie in seinem Kopf. Falls er sich übernommen hatte, und dafür sprach einiges, war es für diese Einsicht längst zu spät.
Bei der Passkontrolle und beim Zoll ging alles glatt. Um eine SIM-Karte zu bekommen, musste er sein Gesicht scannen lassen! Als er wenig später in der Magnetschwebebahn saß, die ihn mit 400km/h in die Stadt beamte, überfiel ihn eine plötzliche Euphorie. Shanghai glitzerte verheißungsvoll in der Dämmerung, die Spitzen der Hochhäuser verloren sich im Dunst. Mit der Nachricht an Lena beschloss er zu warten, bis er sich im Hotel dieser scheißengen Strümpfe entledigt hatte, die er neuerdings auf Langstreckenflügen tragen musste. Um ihn herum telefonierende Chinesen. Auch wenn er es ungern zugab, beschwor der Anblick Erinnerungen und Bilder herauf, die ihn irritierten. In Afrika waren sie inzwischen die selbst ernannten Herren des Kontinents. Unter ihrer Regie entstanden überall neue Häfen, Autobahnen und Staudämme, chinesische Konzerne exportierten Rohstoffe, derweil die Märkte mit Billigwaren made in China überflutet wurden. Multipolare Weltordnung nannte Peking das. Am Anfang, vor den neuerlichen Unruhen in Äthiopien, hatte Gärtner die gemeinsame Olympia-Bewerbung dreier afrikanischer Städte für visionär gehalten, inzwischen sah er das Projekt als Teil des chinesischen Bemühens, sich den Kontinent Stück für Stück unter den Nagel zu reißen. Die Folgen für die beteiligten Länder waren auch deshalb unabsehbar, weil vom Kleingedruckten der geheimen Verträge nichts durchsickerte – wie also darüber schreiben? Zwei Artikel hatte Röhrig bereits als zu spekulativ abgelehnt. Nach Weltherrschaft strebten die Bösewichter in James-Bond-Filmen.
Die auch, ja, allerdings am Ende erfolglos, weil sie anders als die Chinesen allein agierten.
Entweder bekam er auf dieser Reise etwas in die Finger, das sein Chefredakteur als Beweis akzeptieren würde, oder … Über die große Preisfrage, was Charles Murandi diesmal im Schilde führte, hatte Gärtner so oft nachgedacht, dass er sie jetzt einfach beiseiteschob. An der Station Longyang Road stieg er aus, und weil er kein Taxi fand, nahm er für die restliche Strecke die total überfüllte U-Bahn. Eine Stunde später betrat er mit einem Seufzer der Erleichterung sein Hotelzimmer. Die vom Säuseln der Klimaanlage untermalte Stille tat ihm geradezu körperlich wohl. Zuerst streifte er die orthopädischen Strümpfe ab, dann entnahm er seiner Reisetasche eine Flasche Laphroaig aus dem Duty-free-Shop und musste sich zwingen, sie nicht direkt an die Lippen zu setzen. Lena war vermutlich schon zu Hause. Mit welchen Gefühlen sie dem Wiedersehen entgegenblickte, wusste er nicht.
Und er?
WhatsApp ließ sich nicht öffnen, der großen Firewall sei Dank. »Arschlöcher«, murmelte er. Auf dem Laptop hatte er ein VPN installiert, das zu funktionieren schien, trotzdem rief er sie schließlich einfach mit dem neuen Handy an. Nach dem dritten Läuten war sie dran.
»Ich bin’s«, sagte er. »Für die nächsten Tage ist das hier meine Nummer.«
»Willkommen in Shanghai.« Zuletzt gesehen hatten sie einander vor zweieinhalb Jahren in Berlin, zuletzt miteinander geschlafen vor zehn Jahren ebendort. Ein One-Night-Stand wenige Monate nach ihrer Scheidung. Am nächsten Morgen hatte sie zwar das Wort Fehler vermieden, aber auch alles, was ein Mann in seiner Lage als Ermutigung hätte deuten können. Seitdem waren sie, wie man so sagte, befreundet.
»Wo bist du«, fragte er. »Noch im Konsulat?«
»Auf dem Sprung nach Hause.«
»Und später?«
»Wir können essen, wenn du willst. Wonach ist dir?«
Auf Zwischentöne zu achten erbrachte in ihrem Fall keinen Aufschluss. Für sich nannte er es ihren Schweizer Tonfall, vollkommen neutral. »Entscheide du«, sagte er. »Irgendwo, wo es nicht zugeht wie in einem Bienenstock.«
»Benutzt du auf deinem hiesigen Handy auch WeChat