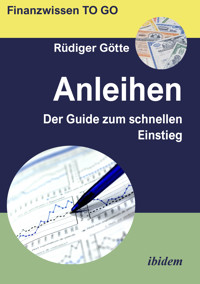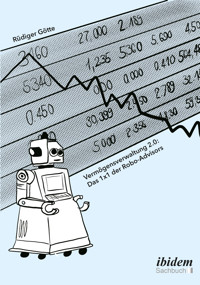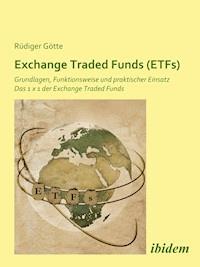16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ganz selbstverständlich bezahlen wir jeden Tag unsere Einkäufe mit Papiergeld oder mit der EC-Karte. Kaum machen wir uns Gedanken darüber, wie es sein kann, dass Banknoten oder virtuelles Geld, das auf dem Girokonto verbucht wird, tatsächlich etwas wert sind. Ebenso wenig denken wir darüber nach, dass unsere Währung nicht stabil sein muss und unsere Ersparnisse morgen schon deutlich weniger wert sein könnten als heute – auch ohne dass wir in spekulative oder risikoreiche Aktien investiert haben. Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie schnell ganze Volkswirtschaften zusammenbrechen können, wenn das Geld seinen Wert verliert. Rüdiger Götte beschreibt anhand der Geschichte von John Law – einem der Väter des Papiergelds – die Entstehung und Entwicklung unseres heutigen Geldes, des Euro. Kundig und detailliert erläutert der Finanzexperte zentrale Begriffe wie Inflation und Deflation, Geldmenge, Fiatgeld oder die Funktion von Notenbanken. Dabei weist Götte auf erstaunliche Parallelen zwischen der aktuellen Eurokrise und der Finanzkrise hin, die schon Mitte des 18. Jahrhunderts John Law um sein Vermögen brachte und Frankreich in eine schwere Wirtschaftskrise und fast in den Staatsbankrott führte. Ganz nach der Devise „Wissen ist Macht“ gibt das vorliegende Buch dem Leser Instrumente an die Hand, um staatliche Maßnahmen der Geldmarktpolitik besser bewerten zu können und sich und sein Vermögen zu schützen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Einleitung
3. Zurück in die Vergangenheit – die Grundlagen des Geldes
3.1. Wer war John Law?
3.2. John Law, der Ökonom
3.3. Zeitenwende
3.4. Die Bank: Banque Générale
3.5. Mississippi-Kompanie
3.6. Das große Spiel
3.6.1. Ein Gigant entsteht – der Aufstieg der Mississippi-Kompanie (bis Juli 1719)
3.6.2. Das Mississippi-Fieber (August – Oktober 1719)
3.6.3. Der erste Millionär – der Höhepunkt des Mississippi-Fiebers (November 1719 bis Januar 1720)
3.6.4. Der Höchstkurs
3.7. Der Abpfiff
3.7.1. Die dunkle Bedrohung (Ende Januar – März 1720)
3.7.2. Der Sturm bricht los (April – Mai 1720)
3.7.3. Eine neue Hoffnung (Juni 1720)
3.7.4. Das Ende (Juli – Dezember 1720)
3.8. Ein Held ist gefallen – Laws Lebensabend
3.9. Was wir mitnehmen sollten – die Grundlagen des Geldes
4. Das moderne Notenbanksystem
4.1. Die verschiedenen Arten von Geld
4.1.1. Das Bargeld
4.1.2. Das Buchgeld
4.1.3. Zentralbankgeld
4.2. Wie unser heutiges Geld entsteht – die Geldschöpfung
4.2.1. Die Entstehung des Zentralbankgeldes
4.2.2. Die Entstehung des Buch- bzw. Giralgeldes
4.2.3. Wie viel ist der Euro wert?
4.2.4. Messung der Geldmenge
4.2.5. Inflation und Deflation
4.3. Europäische Notenbank – das Eurosystem
4.3.1. Aufbau der Europäischen Notenbank (EZB)
4.3.2. Aufgabe der EZB – Preisstabilität
4.3.3. Durchsetzung geldpolitischer Ziele
5. Der Kreis schließt sich – handeln die heutigen Notenbanker ähnlich wie einst John Law?
5.1. Laws Maßnahmen aus heutiger Sicht
5.2. Das Krisenmanagement der Notenbanker
5.3. Die verborgene Gefahr: Vermögenspreisinflation
5.4. Fazit
6. Schlusswort
7. Literaturverzeichnis
Impressum
1. Vorwort
Häufig werde ich von Menschen gefragt: „Was ist Geld?“ oder „Woher kommt der Euro?“ Tag für Tag greifen wir in unser Portemonnaie und nutzen die in verschiedenen Farben gedruckten Euro-Geldscheine zur Zahlung unserer Einkäufe – ohne darüber nachzudenken. Das Bezahlen mit dem Euro, mit Kreditkarten oder per Online-Banking ist heute gang und gäbe. Wir bewegen uns ganz selbstverständlich in unserem Geldsystem und hinterfragen nicht, ob unsere Bank den Betrag, der auf unseren Kontoauszügen zu sehen ist, auch in Münzen und Scheinen herausgeben könnte. Das scheint einfach selbstverständlich. Wirklich?
In diesem Buch wird Ihnen ohne Fachchinesisch und Verschwörungstheorien das Wesen des Geldes erläutert. Hierzu wird zunächst das Grundlagenwissen über Geld anhand seiner Geschichte erklärt. Sie werden sehen: Es war ein harter Kampf, bis unser heutiges Geld das Licht der Welt erblickte. Ihn führten Männer wie John Law.
Anschließend werfen wir einen Blick auf die Gegenwart, indem wir uns ansehen, wie die Europäische Notenbank funktioniert.
Zum Abschluss des Buches schlagen wir eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart und gehen einer wichtigen Frage nach: Hat man in unserem heutigen Geldsystem aus den Fehlern von John Law gelernt?
Nach der Lektüre dieses Buches werden Sie ein umfangreiches Wissen über den Euro erlangt haben und unter anderem die folgenden Fragen beantworten können.
Welche Arten von Geld gibt es?
Was sind Inflation und Deflation?
Was ist die Quantitative Lockerung?
Wie entstand der Euro?
Welchen Wert hat der Euro?
Ist der Euro krisenfest?
Sie werden sich besser in der Welt des Geldes zurechtfinden und mit einem kühlen Kopf finanzielle Entscheidungen treffen können.
Für die freundliche Unterstützung bei dieser Arbeit möchte ich Diplom-Ingenieur Hans-Jürgen Götte danken.
In diesem Buch werden teilweise Bezeichnungen verwendet, die eingetragene Warenzeichen sind; diese unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen. Sämtliche Daten, Formeln und Ausführungen in dem vorliegenden Buch wurden mit größter Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt. Dennoch können sich weder Verlag noch Autor für deren Richtigkeit verbürgen; jegliche Haftung seitens Verlag oder Autor für die Richtigkeit der in diesem Buch gemachten Angaben ist daher ausgeschlossen.
2. Einleitung
Geld begegnet uns überall im täglichen Leben. Woran denken Sie bei dem Wort „Geld“? Die meisten werden wohl zunächst an Münzen und Banknoten denken. Wir sprechen täglich davon, Geld zu verdienen oder es auszugeben. Bei größeren Anschaffungen reden wir davon, dass wir uns Geld leihen müssen, also einen Kredit aufnehmen. Wie Sie sehen, verwenden wir den Begriff „Geld“ in verschiedenen Situationen: Es ist unter anderem Einkommen, Zahlungsmittel, Vermögen und Kredit. Hier spiegelt sich die universelle Rolle, die Geld in unseren Leben spielt, wider.
Dennoch fehlt vielen ein umfassendes Wissen über Geld. Sie können Fragen wie „Was ist Geld?“, „Wie kommt das Geld in die Wirtschaft?“ oder „Wer achtet darauf, dass nicht zu viel Geld geschaffen wird?“ nur schwer beantworten. Mit diesem Buch möchte ich dazu beitragen, dass mehr Menschen die Grundlagen der Geldwirtschaft verstehen. Letztlich soll das Buch das Geldwesen erklären, und zwar vor allem in Bezug auf die heutige Situation.
Die Geschichte des Geldes enthält viele faszinierende Elemente. Vieles in ihr beleuchtet, wie wohl kaum etwas anderes, die Vernunft und Unvernunft der Menschen. Geld fiel nicht einfach vom Himmel herab. Um sich das Wesen des Geldes zu erschließen, muss man zunächst seine Grundlagen verstehen. Um diese möglichst anschaulich und spannend zu erklären, habe ich mich entschlossen, die wichtigsten Grundlagen der Geldwirtschaft anhand ihrer Geschichte zu verdeutlichen. Wir wenden uns einer Epoche zu, in der die Vorläufer unseres heutigen Geldes das Leben erblickten – dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Dort veränderte ein Mann namens John Law die Welt. Er war ein begnadeter Glücksspieler, ein zum Tode verurteilter Mörder und ein genialer Mathematiker. Erst rettete er Frankreich vor dem Staatsbankrott, um es anschließend fast gänzlich zu ruinieren. Er war der reichste Mann der Welt, wenn nicht sogar der reichste Mann aller Zeiten. Zunächst liebten und verehrten die Franzosen ihn, doch wenig später entging er nur knapp der Lynchjustiz eines aufgebrachten Mobs. Große Geister wie Johann Wolfgang von Goethe philosophierten über ihn. Goethe schrieb die Idee, die John Law berühmt machen sollte, sogar dem Teufel zu. So flüstert im zweiten Teil von Goethes Faust der Teufel dem bankrotten Kaiser die Lösung zu, welche die Welt aus den Angeln heben sollte: Papiergeld. John Law machte das Papiergeld in Europa salonfähig. Kurze Zeit konnte er seinen Traum verwirklichen und ein münzfreies Frankreich um 1720 bewirken, bis alles spektakulär zusammenbrach. Dennoch enthielten John Laws Theorien brillante Ideen, die noch heute Nachhall in unserem Geldsystem finden. So zeigte er auf, wie Geld entsteht, wie man es in Umlauf bringt oder durch welche Werte es besichert ist. Auch findet sich bereits hier die Frage danach, welche Gefahren dem Geld – damals wie heute – drohen.
Nachdem die Grundlagen des Geldes anhand der Geschichte aufgezeigt wurden, wenden wir uns der Gegenwart zu. Und damit unserem heutigen Geld – dem Euro. Mit nüchternem Verstand betrachten wir u.a. folgende Fragen: Wie kann es sein, dass wir mit Papiergeld einen nahezu wertlosen Stoff als Zahlungsmittel für Häuser, Autos und andere Investitionen akzeptieren? Wer hat das bestimmt? Woher kommt der Wert des Euros? Wer steht für dieses Geld gerade?
Um diese Fragen beantworten zu können, müssen wir die verschiedenen Arten des Geldes aufspüren. Wir werden uns ansehen, wie sie entstehen, und daraus ableiten, wie viel der Euro wert ist und was hinter dem Euro steckt. Wir werden sehen, dass der Wert des Euros durch zwei Phänomene bestimmt wird: Inflation und Deflation. Um den Wert des Euros zu schützen, wurde die Europäische Zentralbank (kurz EZB) gegründet. Sie ist die Hüterin des Euros. Deshalb sehen wir uns ihren Aufbau und ihre Aufgaben an. Ferner werfen wir einen Blick in den Werkzeugkasten der EZB und betrachten, mit welchen Werkzeugen sie den Euro stabil hält. Hier begegnen wir den Begriffen Leitzins, Mindestreserve, Offenmarktgeschäft, ständige Fazilitäten oder Quantitative Lockerung. So erlangen Sie ein umfassendes Wissen über den Euro. Sie werden die geldpolitischen Entscheidungen der europäischen Notenbank nachvollziehen können.
Die Vergangenheit ist nicht tot. Sie lehrt uns etwas für die Zukunft. Deswegen schlagen wir zum Abschluss einen Bogen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Dazu fragen wir uns abschließend: Begeht das Eurosystem ähnliche Fehler wie einst John Law? Ist der Euro krisenfest? Welche Gefahren drohen ihm?
Gehen Sie also mit mir auf eine spannende Reise durch die Geschichte und Gegenwart des Geldes. Werden Sie von einem Unwissenden in Sachen Geld zu einem Wissenden.
3. Zurück in die Vergangenheit – die Grundlagen des Geldes
Begeben wir uns nun auf eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit, um uns die Grundlagen des Geldes zu erschließen. Damit wir nicht blindlings durch die Vergangenheit stolpern, lassen wir uns anhand der Biographie einer historischen Person durch die Welt des Geldes führen. Einer der schillerndsten Kämpfer für den Vorläufer unseres Geldes war John Law. Sein Aufstieg und Fall offenbart einem alle Facetten, die Papiergeld bietet; seine Vorteile, aber auch seine Gefahren.
Abbildung 1: John Law als Direktor der Banque Royal
(Quelle: Wikipedia Commons. Gemeinfrei)
Wer war also dieser Mann? Der bedeutende Dichter und Philosoph Voltaire beantwortete diese Frage mit einer Gegenfrage: „Ist Law ein Gott, ein Schurke oder ein Scharlatan?“1 Joseph Schumpeter, ein bedeutender Ökonom, antwortete, Law sei einer der „ersten Geldtheoretiker“2gewesen. Tatsächlich war John Law nicht nur Geldtheoretiker, sondern auch der erste Notenbanker. Außerdem war er Frauenheld, Kartenspieler und ein genialer Mathematiker – eine Figur wie aus einen Hollywood-Film. Also werfen wir einen Blick auf John Law und die Zeit, in der er zu einem Ökonomen heranwuchs. Denn in dieser Zeit wurden viele Grundlagen für unser heutiges Geld geschaffen.
3.1. Wer war John Law?
John Law wurde als Sohn von William und Jean Law im April 1671 in Edinburgh geboren.3 John Laws Vater William war Goldschmied. Im späten siebzehnten Jahrhundert genoss der Beruf des Goldschmiedes ein hohes Ansehen. Viele Goldschmiede der damaligen Zeit stellten nicht nur Schmuck oder wertvolle Haushaltsgegenstände her, sondern gingen nebenher noch dem lukrativeren und einflussreicheren Gewerbe des Geldverleihs nach. So berichtet Sir John Clapham Folgendes über die Entwicklung der Goldschmiede zu Bankiers:
„In jenen frühen Jahren der Restauration trieben die Londoner Goldschmiede-Bankiers alle Arten von Kreditgeschäften. Sie nahmen Einlagen gegen Zinsen an – der übliche Satz betrug 6 Prozent –, stellten Quittungen aus, gegen deren Vorlage die Rückzahlung erfolgte, … gaben das Versprechen ab, an den Einleger oder seinen Beauftragten zu zahlen, und so gelangten ihre Scheine oder Noten durch die Einleger oder Inhaber in Umlauf …“4
Kaufleute lagerten bei den Goldschmieden ihr Münzgeld5 ein und bekamen dafür die handlichen Goldsmiths’ Notes oder Bankers Notes, eine fälschungssichere Quittung über die eingelagerte Summe an Münzgeld.6 In der Regel hatten die Goldsmiths’ Notes denselben Nennwert wie die eingezahlten Metallmünzen. Tauschte man 100 Pfund in Metallmünzen ein, so bekam man Bankers Notes im Wert von 100 Pfund. Um möglichst einfach den Handel mit Goldsmiths’ Notes durchzuführen, hatten diese dieselben Einheiten wie das Münzgeld, also Pfund, Penny usw. Anfänglich misstrauten viele Menschen diesen Scheinen, weil diese im Gegensatz zu Gold- oder Silbermünzen keinen Materialwert hatten – es war ja einfach nur Papier.
Um die Glaubwürdigkeit der Bankers Notes herzustellen, sicherten die Goldschmiede zu, sie jederzeit in Münzgeld eintauschen zu können (Einlösegarantie). Um dies zu gewährleisten, wurden von den einzelnen Goldschmieden zunächst nur Bankers Notes in der Höhe des tatsächlich in ihren Kellern gelagerten Münzgeldes vergeben. So konnten sie jederzeit die ausgegebenen Bankers Notes in Münzgeld umtauschen. Letztlich setzten sich die Bankers Notes durch, weil den Kaufleuten das Transportieren von großen Mengen an Münzen und das aufwändige Zählen bei der Übergabe zu beschwerlich wurde; das Papiergeld erleichterte das Begleichen von größeren Summen merklich. Da immer mehr Menschen den Goldsmiths’ Notes vertrauten, verbreiteten sie sich schnell und wurden genutzt wie Geld. Schon bald merkten die Goldschmiede, dass sie über einen erheblichen Goldbestand in ihren Kellern verfügten, der niemals beansprucht wurde. Dies lag daran, dass die Goldsmiths’ Notes immer seltener in Münzen eingetauscht wurden. So kamen die Goldschmiede auf die Idee, Münzen und Gold auszuleihen. Dazu gaben sie den Leuten, die Geldbedarf hatten, ganz einfach Goldsmiths’ Notes, ohne dass diese etwas dafür hinterlegen mussten. Damit war die Kreditschöpfung durch die Ausgabe von ungedeckten Banknoten erfunden. Man bezeichnet solch ungedecktes Geld deswegen auch als Kreditgeld.7
Natürlich folgten William Law und die Edinburgher Goldschmiede dem Beispiel ihrer Londoner Kollegen, indem sie fortan auch Bankgeschäfte abwickelten. So soll William Law einer der bedeutendsten Finanziers des schottischen Viehhandels gewesen sein.
William Law nahm eine herausragende Stellung innerhalb der Zunft der Goldschmiede ein: Er wurde zum Münzprüfer von Edinburgh ernannt. Er untersuchte die Gold- und Silberobjekte, die innerhalb der Grenzen der Stadt gefertigt worden waren, und versah sie mit dem „Hallmark“, dem Feingehaltsstempel der Edinburgher Innung. Zudem wurde William Law Innungsmeister. Obendrein entwickelte er auch Ehrgeiz in Bezug auf seine Kinder. Er war entschlossen, seinen Sohn John Law auf ein chancenreiches Leben vorzubereiten. So erhielt John Law die Erziehung und Ausbildung eines Gentlemans. Seinen ersten Unterricht erhielt er wahrscheinlich in den Fächern Religion, Mathematik und Latein. Daneben wurde er auch in Griechisch und Französisch unterrichtet.
Als der Bruder des Königs, James, der Duke of York, zum schottischen Vizekönig ernannt wurde, erlebte die Stadt Edinburgh eine Phase der Modernisierung. So wurden u.a. die Merchant Company (eine Handelsorganisation) und Straßenbeleuchtungen errichtet. Im Zuge dieser Entwicklungen florierte der Geldverleih von William Law. Hiervon bekam der Junge John Law natürlich auch etwas mit. Denn William Law nahm seinen Sohn John gelegentlich zu Verhandlungen mit. Anschließend soll William seinem Sohn genauestens erklärt haben, warum er dieses oder jenes gesagt oder verschwiegen hatte.
1683, als John Law zwölf Jahre alt war, kaufte sein Vater das Anwesen Lauriston, welches heute in einem Vorort von Edinburgh liegt. Doch die Jahre harter Arbeit forderten ihren Tribut. William Law klagte über starke Schmerzen im Unterleib, man diagnostizierte Blasensteine. Zur Behandlung reiste er nach Paris. Doch die Operation zur Entfernung der Blasensteine schlug fehl und William Law verstarb. Seine Frau Jean Law musste sich nun durch die komplexen Bestimmungen im Testament ihres Mannes arbeiten. So gab es ausstehende Forderungen, Darlehen in Höhe von über 25.000 Pfund. Die Namen der Schuldner füllten viele Seiten, unter ihnen befanden sich die nobelsten schottischen Familien. Außerdem sah das Testament vor, dass das gerade erworbene Anwesen Lauriston und dessen Pachteinnahmen an Williams zwölfjährigen Sohn John Law gehen sollten. Somit konnte John Law den Titel „of Lauriston“ für sich beanspruchen. Da William Law befürchtete, sein Sohn könnte den Verlockungen Edinburghs erliegen, beschloss er kurz vor seiner Erkrankung, dass John in ein Internat in einem abgelegen Winkel von Schottland, nach Eaglesham, geschickt werden solle. Dort sollte John bei Reverend James Woodrow, einem Verwandten der Laws, der dort eine höhere Schule betrieb, studieren. Über Laws Schulbildung ist wenig bekannt. Man berichtet aber, dass John Law eine „herrliche“ Begabung, einen scharfen Verstand und ein großes Rechentalent hatte. Außerdem soll Law sehr sportlich gewesen zu sein. Ansonsten ist über die Jugendzeit von Law wenig bekannt. Er reifte zu einem charismatischen schottischen Gentleman mit feinen Gesichtszügen und edlen Manieren heran, der zahlreiche Frauenherzen brach. Schon in seiner Heimatstadt Edinburgh lernte er Spielsalons kennen. Das waren exklusive Clubs für die Adligen und Vermögenden. Dort verkehrten auch die schönsten Frauen der Stadt. John Law war begeistert von diesem Ambiente. Er spielte die verschiedensten Karten- und Würfelspiele. Besonders beliebt war damals das Kartenspiel Pharao, eine Art Vorläufer des Roulettes.8 Als John Law um die zwanzig Jahre alt war, waren für ihn alle Genüsse seiner Vaterstadt erschöpft. Ihn packte die Reiselust. Um 1691 verließ er Edinburgh und ging nach London.
In London inszenierte sich John Law als Lebemann, worauf sein Spitzname „Beau Law“ hindeutet. Einen Einblick in die Welt der Beau (Lebemänner) gab Mary Astell:
„Der Beau ist ein Ausbund an Eitelkeit, bestehend aus Ignoranz, Stolz, Torheit und Ausschweifung: ein dummer, ärgerlicher Kerl, drei Teile Blender und der Rest Möchtegernhektor – eine Art wandelnder Tuchladen, der heute den einen und morgen den anderen Stoff zur Schau stellt und dessen Wert sich allein nach dem Preis seiner Anzüge und dem Können seines Schneiders bemisst–ein Spross des Adels, der die Laster seiner Vorfahren ererbt hat und der Nachwelt aller Wahrscheinlichkeit nach nichts weiter hinterlässt als Niedertracht und Siechtum.“9
Dieser Beschreibung kam John Law sehr nahe. Untadelig gekleidet präsentierte er sich als Lebemann in London. Er benahm sich wie ein alter Fuchs, der alle Gepflogenheiten und gesellschaftlichen Verhaltensregeln spielend beherrschte. So besuchte er Schauspielhäuser wie das Drury Lane Theater, aß in berühmten Tavernen wie dem Half Moon oder Locket, trank Kaffee in berühmten Kaffeehäusern wie dem Will’s. Daneben traf man ihn an den Spieltischen von London. Law war von dieser hektischen, riskanten Lebensweise wie hypnotisiert. Er mischte sich unter Aristokraten und Glücksritter und nahm an Hasardspielen wie Brag, Primero und Basset teil, sah sich jedoch vom Pech verfolgt. Sein Missgeschick beim Spiel und sein Missgriff bezüglich der Gesellschaft, in der er sich vornehmlich aufhielt, führten dazu, dass er Anfang 1692 mit einundzwanzig Jahren nicht nur sein ererbtes Vermögen verprasst, sondern auch noch einen Berg Schulden angehäuft hatte. Er musste fürchten, in das Schuldgefängnis geworfen zu werden. Er beschloss, seiner Mutter das Anwesen Lauriston gegen eine Barzahlung zu übertragen.
Diese Erfahrung veränderte John Law grundlegend. Er musste seinen Lebensstil ändern. Sein Ehrgeiz hielt ihn an, wieder in der vornehmen Gesellschaft Fuß zu fassen. Dazu musste er sich ein Netzwerk aus wohlhabenden Freunden aufbauen. Den Zugang zu diesen Menschen fand man zur damaligen Zeit am leichtesten am Spieltisch, weil das Kartenspiel der Zeitvertreib der gehobenen Gesellschaft war. In den Salons wurden Kontakte geknüpft und Geschäfte abgeschlossen. Es war wichtig, dass man sich zeigte, um gesehen zu werden und im Gedächtnis zu bleiben. Nur so konnte man Kontakte zu hochrangigen Persönlichkeiten knüpfen. Dies gelang allerdings nur, wenn man am Spieltisch bestehen konnte. Um das Risiko des Scheiterns zu mindern, begann Law nach Methoden zu suchen, mit denen er seine Erfolgschancen zu seinen Gunsten verlagern konnte. Hierzu gewöhnte er sich zunächst eine umsichtige Spielweise an. Zudem studierte er verschiedene Bücher10, in denen die Wahrscheinlichkeitstheorie ausführlich dargelegt wurde. Laws überragende mathematische Begabung muss es ihm leicht gemacht haben, diese Wissenschaft vom Zufall nachzuvollziehen. So erlernte Law, beim Würfel- und Kartenspiel zu berechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit war, dass eine bestimmte Zahlenfolge erschien oder dass eine bestimmte Karte aus einem Pack ausgeteilt wurde.11 Law wusste, dass zu Beginn des Spiels alle Karten die gleiche Wahrscheinlichkeit hatten, gezogen zu werden. Mit jeder Runde veränderte sich die Wahrscheinlichkeit zugunsten von einzelnen Karten. Diese galt es zu berechnen – und zwar schnell. Die Gabe der schnellen Berechnung machte Law zu einer kleinen Berühmtheit, so sagte Gray, ein Bekannter von Law und sein erster Biograf:
„Niemand verstand mehr von Zahlen und Berechnungen als Law. Er war der erste Mensch in England, der sich überhaupt die Mühe machte, herauszufinden, warum die Chancen bei sieben zu vier oder zehn stets zwei zu eins, bei sieben zu acht immer sechs zu fünf betrugen und so fort mit allen anderen von ihm nachgewiesenen Konstellationen des Würfels. Auf diese Weise fand er Anerkennung bei den berühmtesten Spielern und brachte es zu hohem Ansehen.“12
Für Law wichtiger als die Anerkennung durch andere Spieler war, dass sich seine neue Vorgehensweise auszahlte. Er wandelte sich vom stereotypen zwanghaften Spieler, der süchtig nach dem Glücksrausch gierte, den ein Gewinn ihm bereitete, zu einem kühl berechnenden Spieler. Außerdem beherrschte er jetzt die Kunst, das Risiko eines Zuges zu kalkulieren, ähnlich wie ein Buchmacher Quoten zu berechnen vermochte. Geld zu wetten wurde für Law nun ein ernsthaftes Geschäft.
Dennoch stand Law schnell in dem Verdacht, zu betrügen oder sich einen anderen Vorteil zu verschaffen. Die Menschen verstanden nicht, dass jemand so große Summen gewinnen konnte und so selten verlor. In Wirklichkeit waren seine Spielerfolge nicht das Ergebnis von Glück, sondern wohl eher von Gerissenheit: John Law machte in dem Spiel Pharao seine größten Gewinne, wenn es ihm gelang, die Rolle des Bankhalters zu übernehmen, und so die Gewinnchancen massiv auf seiner Seite lagen.13 Musste er dagegen als pointeur gegen den Bankhalter spielen, war er zumeist vorsichtiger und beschloss, keine hohen Summen zu setzen. Um seinem Glück noch weiter auf die Sprünge zu helfen, entwickelte er auch eigene Glückspiele, die noch bessere Gewinnchancen für ihn boten. Seine zunehmende Berühmtheit ermöglichte es ihm auch, an den sogenannten Schaupartien für Reiche teilzunehmen. Diese Schauspiele waren für Law in finanzieller Hinsicht äußerst lohnend und er konnte vielfältige Kontakte zu einflussreichen Persönlichkeiten knüpfen. Letztlich konnte er so zu vielen vornehmen und mächtigen Leuten Freundschaften aufbauen.
In seiner Freizeit widmete sich John Law der neuen Obsession der Zeit – der Nationalökonomie. Sie wurde immer mehr zu einem Gesprächsthema in den Salons. Es wurde eine regelrechte Flut an Schriften veröffentlicht, in denen über monetäre Theorien und Währungen diskutiert wurde. Sie stammten aus der Feder von Sir William Petty, Nicholas Barbon oder Hugh Chamberlen. Eine Grundfrage vieler Schriften war, wie man den gewaltigen Mangel an Bargeld, an dem England zu jener Zeit litt, beheben oder diesen zumindest erklären konnte. Es wurden aber auch Methoden vorgeschlagen, wie man dem Land zu einem wirtschaftlichen Aufschwung verhelfen konnte. Dies war dringend notwendig. William III. war verzweifelt darum bemüht, Geld aufzutreiben, um seinen Krieg in Europa fortsetzen zu können. Die englischen Könige standen in dem Ruf, ihre Darlehen nicht zurückzuzahlen. Daher waren die Goldschmiede und Geldverleiher Londons nicht bereit, William III. Geld zu leihen. Thomas Neale, königlicher Münzmeister und Kammerherr, hatte dann aber 1694 eine rettende Idee. Er führte eine staatliche Lotterie ein, die die Krone für die nächsten sechzehn Jahre mit Darlehen versorgen sollte. Dazu verkaufte er Anteilsscheine im Wert von je zehn Pfund und zahlte einen Jahreszins von zehn Prozent. Zusätzlich berechtigte man den Inhaber der Anteilsscheine, an einer jährlichen Ziehung teilzunehmen, die ihm die Chance gab, ein Gesamtpreisgeld von 40.000 Pfund zu gewinnen. Die Lotterie beflügelte die Fantasie der Londoner. Es gingen Geschichten von großen Gewinnen um, sodass viele Anteilsscheine verkauft wurden, aber es konnte auf diese Weise dennoch nicht die benötigte Summe von einer Million Pfund erreicht werden. Die Lotterie war im Prinzip nichts anderes als ein Tropfen auf den heißen Stein.
Verschlimmert wurde die Lage noch dadurch, dass das Prägeverfahren für Münzen seit dem Mittelalter so gut wie unverändert geblieben war. Viele Münzen waren über ein Jahrhundert alt. Außerdem variierten die Münzen stark in Gewicht und Größe, weil Silber- oder Goldspäne über die Jahre hinweg von ihren Rändern abgehobelt wurden. Die Metallspäne des sogenannten Stutzens wurden dann benutzt, um Falschgeld herzustellen. Letztlich führte dies dazu, dass im späten sechszehnten Jahrhundert Englands Münzen weniger als die Hälfte des Silbers oder Goldes enthielten, das sie nach ihrem Nennwert hätten haben müssen. Das Vertrauen in das Münzgeld sank immer weiter. Das führte dazu, dass die Händler zum Tauschhandel zurückkehrten oder hohe Preise forderten, um den zweifelhaften Wert der verfügbaren Münzen aufzuwiegen. Es kam zu einem Aufruhr in der Bevölkerung.
Um Abhilfe zu schaffen, wurden neue Geldstücke eingeführt, deren Metallgehalt wieder ihrem Nennwert entsprach. Zusätzlich wurde das Design der Münzen gerändert: Der Münzrand wies kleine Kerben oder Einschnitte auf, sodass das Stutzen nicht mehr möglich war.14 Das Schatzamt verbreitete die neuen Münzen, ohne die alten einzuschmelzen. Die Lage verschlimmerte sich nun weiter, weil die Menschen die neuen Münzen horteten und versuchten, weiter mit den alten Münzen zu bezahlen. Es trat die sogenannte Greshamsche Regel in Kraft: Minderwertiges Geld verdrängt das wertvollere aus dem Umlauf. John Law beobachtete diese Entwicklung, ihm wurde etwas äußerst Wichtiges bewusst: Gesundes Geld ist essenziell, damit ein Land seinen politischen Status behalten und gedeihen kann.
Für den englischen König William III. wurde die Lage immer schlimmer. Er brauchte dringend Geld, um seine Soldaten bezahlen zu können, sie mit Lebensmitteln zu versorgen und für den Kampf gegen die Franzosen auszurüsten. Sein Ausweg bestand darin, eines der vielen originellen Projekte zur Geldbeschaffung zu genehmigen, die viele Theoretiker beim Schatzamt eingereicht hatten. Der Monarch entschied sich schließlich für den Plan des Schotten William Paterson. Dieser ließ sich von den höchst erfolgreichen Nationalbanken von Amsterdam und Venedig inspirieren. Er schlug vor, man solle das Geld für den König durch die Gründung einer Bank, deren Stammkapital von einer großen Zahl von Privatinvestoren aufgebracht wurde, beschaffen lassen. Jeder Investor sollte Anteilsscheine für einen bestimmten Geldbetrag zeichnen dürfen, bis die Gesamtsumme von 1.200.000 Pfund angehäuft war. Dieser Betrag sollte dem König dann zu acht Prozent Zinsen für einen Zeitraum von acht Jahren geliehen werden. Am 21. Juni 1694 wurde die Zeichnungsliste für die Bank of England eröffnet. Nach nur zwölf Tagen waren so viele Investoren gefunden, dass die gewünschte Geldsumme zusammengetragen wurde.
Der Zeichnungserfolg resultierte daraus, dass es der Bank of England gestattet wurde, das Geld der Bevölkerung zur Aufbewahrung entgegenzunehmen, zu verzinsen und wiederum an andere auszuleihen. Doch was viele Investoren besonders überzeugte, war, dass die Bank of England Banknoten ausgeben durfte. Mit der Auflage, dass die Bank of England über eine Gold- bzw. Münzgeldreserve verfügte, die über eine Emission von Aktien der Bank of England gebildet wurde, sollte garantiert werden, dass die ausgegebenen Banknoten auf Verlangen als Gold bzw. Münzgeld ausgezahlt werden können.15 Deshalb hatten die Banknoten der Bank of England denselben Nennwert wie das Münzgeld oder zumindest einen davon abgeleiteten.16 Das besondere an diesen Banknoten war, dass sie nicht personengebunden waren, sondern an Dritte und Vierte weitergereicht werden durften. Ohne diese Übertragbarkeit war der Handel über Banknoten sehr aufwendig. Wenn beispielsweise ein Kunde seinen Einkauf bei einem Händler im Wert von einhundert Pfund bezahlen wollte, konnte er die Hunderter-Banknote in Gold einlösen und dem Händler geben. Der Händler brachte nun das Gold wieder zurück zur Bank of England und bekam seinerseits eine entsprechende Hunderter-Note. Viel einfacher war es, wenn der Kunde dem Händler gleich seine Hunderter-Banknote weiterreichte und der Händler darauf vertrauen konnte, dass sich diese Banknote jederzeit in Gold einlösen ließe. Das Gold blieb so bei der Bank of England und nur die Banknote wanderte von Hand zu Hand. Erst so erfüllt die Banknote die Funktion eines Zahlungsmittels.
Je mehr sich das Vertrauen in die Einlösegarantie – Banknote gegen Gold – der Bank of England festigte, umso weniger wurde selbige in Anspruch genommen. Es wurden immer mehr Zahlungsvorgänge über die Weitergabe der Banknoten abgewickelt. Um die Glaubwürdigkeit der Banknoten zu erhöhen, wurden sie mit dem Porträt des Königs und seiner Unterschrift versehen. Hierdurch wurde der Eindruck erweckt, es handle sich um staatliches Geld.17
Abbildung 2: Ein-Pfund-Note von 1797
(Quelle: [email protected])
Als Folge dieser Maßnahme wurde durchschnittlich maximal ein Drittel der Banknoten eingelöst. Folglich hatte die Bank of England noch zwei Drittel des hinterlegten Goldes als Überschussreserve in Gold, das sie zur Sicherung eingelagert hatte. Es lag sozusagen nutzlos in ihren Kellern herum. Somit war die Versuchung groß, diese Überschussreserve anderweitig zu verwenden. Sie wurde als Grundlage für die Schöpfung weiterer Banknoten eingesetzt. Das funktionierte wie folgt: Brachte ein Kaufmann einhundert Pfund in Goldmünzen zur Bank of England, bekam er dafür Banknoten im Wert von einhundert Pfund. Die Bank ging davon aus, dass der Kaufmann diese Banknoten wie Geld einsetzen würde. Auf Grundlage ihrer Erfahrung rechnete die Bank damit, dass maximal ein Drittel, also 33,33 Pfund, davon wieder in Goldmünzen eingetauscht würden. Folglich hatte die Bank eine Überschussreserve von 66,66 Pfund. Mit dieser Überschussreserve konnte die Bank of England zwei weitere Hunderter-Banknoten drucken und in Umlauf bringen – unter der Annahme, dass auch diese nur maximal jeweils zu einem Drittel zurückgetauscht würden. So konnte die Bank of England aus Gold im Wert von 100 Pfund insgesamt drei Hunderter-Banknoten ausgeben, von denen die zwei neu geschöpften Banknoten als Kredit (mit Zinsen, Tilgung und Sicherheit) in Umlauf gebracht wurden. Das aus dem Nichts geschöpfte Geld, das sich äußerlich nicht von der durch Gold gedeckten Hunderter-Banknote unterschied, war in Wirklichkeit nur eine Forderung der Bank gegenüber einem Kreditnehmer. Diese wurde erbarmungslos eingetrieben, bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners auch durch eine Zwangsvollstreckung seines beliehenen Eigentums. Dieses harte Vorgehen war notwendig, denn wenn zu viele Kreditnehmer ihre Schulden nicht zurückbezahlen konnten, drohte das ganze System zusammenzubrechen.18 Denn obwohl die zweite und dritte Hunderter-Banknote einen völlig anderen Ursprung und Charakter hatten als die erste, gedeckte Hunderter-Banknote, sahen alle drei Banknoten gleich aus. Sie konnten nicht voneinander unterschieden werden. Die aus dem Nichts geschöpften Banknoten erzeugten nur den Schein, durch Gold gedecktes Geld zu sein.19
Durch den Kredit der Bank of England hatte der König nun genug Geld, um seinen Krieg fortzusetzen, und durch die Ausgabe von Banknoten, die schnell als Tauschmittel akzeptiert wurden, wurde der Mangel an Geld deutlich reduziert.
John Law konnte nicht in die Bank of England investieren, obwohl er das Geld dazu hatte, weil er inzwischen im Gefängnis saß. Denn am 9. April 1694 trug John Law auf dem Bloomsbury Square ein Duell mit einem stadtbekannten Londoner Schönling namens Edward Beau Wilson aus. Wilson wurde dabei von Law getötet. Duelle waren verboten, so musste der Sieger bei tödlichem Ausgang mit einer Anklage wegen Mordes rechnen. Nach seiner Verhaftung eilten Laws wohlhabenden Freunde herbei und boten ihre Hilfe an. Sie halfen ihm mit Geld und Rat aus und trugen so dazu bei, dass sein Aufenthalt im Gefängnis erträglicher wurde. So konnte man sich beispielsweise für eine kleine Gebühr eine Kammer im „King’s Block“ im Gefängnis von Newgate kaufen, weit weg von den schlimmsten Auswüchsen des Gefängnisdaseins.
Wie damals bei Strafprozessen üblich, hatte John Law als Angeklagter keinen Anspruch auf einen Verteidiger und auch nicht darauf, selbst auszusagen oder Zeugen aufzurufen. Er konnte zu seiner Verteidigung lediglich eine nicht beeidigte Mitschrift seiner Aussage ins Feld führen, die vor Gericht verlesen wurde. Darin behauptete er:
„Die Begegnung mit Mr. Wilson in Bloomsbury war bloßer Zufall, wobei Mr. Wilson dann als erster sein Schwert zog, sodass er sich wehren musste. Damit geschah das Unglück lediglich infolge einer plötzlichen Aufwallung von Leidenschaft und nicht auf Grund irgendeiner bösartigen Absicht.“20
Dennoch kamen nach einer dreitägigen Verhandlung im Old Bailey die Geschworenen zu dem Schluss, dass John Law und Mr. Wilson ein Duell ausgetragen hatten.21 Daraufhin wurde John Law zum Tod durch den Strang verurteilt.
Law hatte einen Kreis reicher Freunde und Bekannter, an die er sich wenden konnte. Er hoffte, mit ihrer Hilfe eine Begnadigung zu erreichen. Tatsächlich griffen mehrere Edelmänner aus Schottland ein und sprachen bei König William III. vor, um eine Begnadigung zu bewirken. Sie argumentierten, dass Duelle insgeheim als etwas durchaus Respektables angesehen würden. Zwar müssten die Überlebenden vor Gericht erscheinen, sie würden aber nie wegen ihres Verbrechens hingerichtet. So berichtete ein Freund von John Law, James Johnston, der Earl of Warriston:
„Ich habe nie zuvor gehört, dass die Tötung eines Gegners in einem fairen Duell als Mord beurteilt wurde.“22
Law hoffte in seiner Zelle in Newgate auf einen Freispruch. Sein Optimismus war verfrüht. Wilsons Verwandte – die Townsends, Ashs und Windhams – brannten darauf, den Tod ihres Verwandten zu rächen. Da allesamt einflussreiche Höflinge waren, nahmen sie den König gegen John Law ein. Sie bedrängten den Monarchen förmlich mit Gegenanträgen. Sie sagten aus, in diesem besonders brutalen Duell habe Law sich als Mann ohne Ehre offenbart. So befand sich der König inmitten eines Ränkespiels.
Laws Freund Warriston erkannte, dass er Hilfe brauchen würde, um die Feindseligkeit des Königs zu überwinden. Darum sicherte er sich die Unterstützung des englischen Duke of Shrewsbury, der damals mehr Einfluss beim König besaß als irgendjemand sonst. Zunächst riet Shrewsbury, Warriston solle versuchen, Zeit zu gewinnen, und abwarten, bis sich der Zorn des Königs wieder gelegt habe. Warriston sollte außerdem Beweise dafür ausfindig machen, dass es bei dem Duell nicht um Geld gegangen sei, wie die Verwandten Wilsons behaupteten. Warriston stellte Kontakt zu einem Mann her, über den Law seine Geldgeschäfte abwickelte. Dieser sagte aus, dass Law kurz vor dem Duell 400 Pfund per Anweisung aus Schottland bekommen habe, dies konnte er anhand seiner Bücher belegen. Somit habe Law keinen Anlass gehabt, sich Geld durch Erpressung zu beschaffen. Mit diesem Beweis versuchten Warriston und Shrewsbury den König dazu zu bewegen, Law zu begnadigen. Doch der König stand vor einem Dilemma. Einerseits wollte er Law begnadigen, um die Angelegenheit beilegen zu können, andererseits hatte er Wilsons Verwandten versprochen, Law nicht gegen ihren Willen gehen zu lassen. Also wählte der König den goldenen Mittelweg: Das Todesurteil sollte aufgehoben werden, aber Law musste weiterhin inhaftiert bleiben, bis man wusste, wie die Verwandten von Wilson reagierten. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Sie legten einen appeal of murder (Einspruch wegen Mordes) ein. Dies war ein altes Rechtsmittel, dass es den Hinterbliebenen eines Mordopfers ermöglichte, sich gegen eine königliche Begnadigung zur Wehr zu setzen. Wenn die Angehörigen des Mordopfers mit ihrem Einspruch Erfolg hatten, konnte der König nicht mehr auf den Ausgang des Verfahrens einwirken.
Da es sich jetzt um einen Zivilrechtsfall handelte, oblag die Rechtsprechung dem Court of King’s Bench. Das Gericht kam in der Westminster Hall zusammen. John Law wurde von Newgate in das King’s-Bench-Gefängnis in Southwark verlegt, um dort die Eröffnung des zweiten Prozesses abzuwarten. Am 22. Juni 1694 begann der Prozess. Der Anwalt der Wilson-Fraktion, Sir Bartholomew Shower, erklärte vor dem Gericht, Law habe brutal, schurkisch, arglistig und vorsätzlich einen Mord begangen. Deshalb müsse das Todesurteil aufrecht erhalten bleiben. In dem Zivilprozess war Law nun berechtigt, sich verteidigen zu lassen. Dazu verschaffte er sich die Dienste der angesehenen Anwälte Sir William Thompson, Creswell Levinz sowie ihres Juniorpartners Thomas Carthew. Sie versuchten, den Einspruch der Wilson-Fraktion wegen kleinerer, formaler Unstimmigkeiten abzuwehren. Ihr schwerwiegendster Einwand war
„die Anklage gegen Law sei indirekter Art, und es gebe daher keine Notwendigkeit, noch sei er (Law, da Schotte) durch das Gesetz des Landes gebunden.“23
Dieses Argument verschaffte Law und seinen Verteidigern Zeit. Die Verhandlung sollte um eine Woche ausgesetzt werden. Da die Sommersitzungsperiode des Gerichts Ende Juni kurz vor ihrem Ende stand, beschloss das Gericht, die weitere Anhörung bis in den Herbst zu verschieben. Somit sah Law sich mit der wenig angenehmen Aussicht konfrontiert, mehrere Monate im King’s-Bench-Gefängnis verbringen zu müssen. Dieses Gefängnis war für seine mangelnde Sicherheit bekannt. Laws Freunde drängten ihn daher zu einem Fluchtversuch. Doch Law war noch immer davon überzeugt, dass ein Freispruch möglich sei. Umso überraschter war er, als der Richter entschied, dass die im Namen von Law vorgebrachten Einwände nicht stichhaltig seien. Somit musste sich Law dem von Wilsons Verwandten eingelegten Einspruch im neuen Jahr stellen.
Law erkannte, dass die Chance, auf einem legalen Weg dem Todesurteil zu entkommen, immer geringer wurde. Die Flucht schien sein einziger Ausweg. Wieder griffen Laws mächtige Freunde ein. Sie erreichten, dass der König wohlwollend ein Auge zudrückte, wenn man Law entkommen ließe. Also bestachen Laws Freunde Wächter, damit Law entkommen konnte. Ein Wächter ließ die Tür zu Laws Zelle unverschlossen und stellte sich schlafend. Law verließ ohne Gegenwehr Zelle und Gefängnis. Kurz nach seiner Flucht am 7. Januar 1695 erschien in der London Gazette ein Steckbrief mit der Beschreibung des Schotten Captain John Law, zuletzt Häftling im King’s Bench, angeklagt wegen Mordes. Ausgesetzt wurde eine Belohnung von 50 Pfund für die Ergreifung. Die Beschreibung war sehr detailliert: Law sei 26 Jahre alt, habe Pockennarben im Gesicht und sei etwa sechs Fuß groß. Dies entsprach in keiner Weise seinem wahren Aussehen! Auch hier zeigt sich, dass die Flucht von höchster Stelle begünstigt wurde.
Was Law nach seiner Flucht tat, ist nicht bekannt. Es scheint, als hätte er versucht, sich von seiner Vergangenheit zu lösen. Er hinterließ in den folgenden zwei Jahrzehnten nur wenige urkundliche Belege darüber, wie und wo er lebte. Diese sind zudem noch über halb Europa verstreut. Er hielt sich in Spielsalons in Paris auf, lebte für einige Zeit in Amsterdam und stattete verschiedenen italienischen Städten einen Besuch ab. Gleichgültig wo Law hinging, sein Leben folgte im Prinzip immer dem gleichen Muster: Es war von Glücksspiel und riskanten Liebschaften geprägt. Die Ziele seiner Reisen waren kühl kalkuliert, „er fand dort genügend Dumme, denen er das Geld abnehmen konnte.“24
Zugleich gibt es aber auch Anzeichen dafür, dass John Law die Verlockungen der Spieltische nicht mehr vollkommen vereinnahmten. Zunehmend entwickelte er eine Begeisterung für die Wirtschaftslehre. So war er fasziniert von Amsterdam, weil die Stadt das wichtigste Geschäfts- und Handelszentrum Europas war. In seiner Freizeit studierte Law, wie es der Bank von Amsterdam inmitten einer Zeit des monetären Durcheinanders gelungen war, den Niederlanden eine ökonomische Stabilität zu bescheren. Die Niederlande schaffte es, zur führenden Handelsmacht in der Welt aufzusteigen, deren Handel und Gewerbe aufblühte. Dabei waren die Leitprinzipien der 1609 gegründeten Bank recht einfach. Ähnlich wie in England stellten auch auf dem europäischen Festland Münzen, die verfälscht worden waren, ein Problem dar. Ein weiteres Problem war, dass eine Vielzahl verschiedener Münzen in Umlauf war. Man schätzt, dass mehr als achthundert verschiedene Gold- und Silbermünzen von unterschiedlichem Nennwert kursierten. Zwar konnte man in jeder Stadt Europas Geld in die jeweilige Währung wechseln, die Bank von Amsterdam ging jedoch noch einen Schritt weiter: Sie nahm Einlagen in lokaler wie auch auswärtiger Währung an. John Law befragte dazu einen Banker nach dem eigentlichen Wert einer Münze und dieser antwortete, es handele sich dabei um den Wert des Metalls, das in der Münze stecke. Die eingereichten Münzen würden gewogen und auf ihre Reinheit überprüft (es zählte nur noch der Feingehalt der Münzen). Nur dafür würden dann Kreditscheine (im Volksmund auch Bankgeld genannt) ausgegeben. Der Nennwert der Kreditscheine entsprach somit nicht dem Nennwert der eingelagerten Münzen, sondern dem Wert des Metalls der deponierten Münzen. Ferner übernahm die Bank eine Garantie für die Kreditscheine und war ihrerseits rückversichert durch den Staat. Da der Wert der Kreditscheine auf diese Weise verbürgt war, zogen die Menschen sie den herkömmlichen Münzen vor. Es war üblich, dass die Kreditscheine den Besitzer für mehr als ihren nominellen Wert wechselten. John Law erkannte die Vorteile der Kreditscheine und sagte dazu:
„Von der Annehmlichkeit leichterer und schnellerer Zahlungen abgesehen …, vermeidet die Bank die Ausgaben für Kassier, die Ausgaben für Säcke und Fuhrwerke sowie Verluste durch wertloses Geld, und das Geld ist sicherer verwahrt als in den Häusern der Kaufleute, da es weniger durch Feuer oder Diebstahl gefährdet ist.“25
Ein Jahrhundert lang wickelte die Bank von Amsterdam ihre Geschäfte korrekt und erfolgreich ab; Einlagen waren Einlagen. So nahm die Bank zunächst das Edelmetall für den Eigentümer in Verwahrung, bis dieser anderweitig darüber verfügen wollte. Kein Geld wurde ausgeliehen. Als sich im Jahr 1672 die Armeen Ludwigs XIV. Amsterdam näherten, brach Panik bei den Menschen aus. Sie belagerten die Bank, weil sie fürchteten, ihr Vermögen sei gefährdet. Alle wollten ihr Bankgeld in klingende Münzen umtauschen. Alle, die ihr Geld zurückhaben wollten, wurden von der Bank von Amsterdam ausgezahlt. Als dies bekannt wurde, ließ der Ansturm nach. Es ließ sich eine interessante Beobachtung machen: Wenn die Menschen ihr ganzes Geld von einer Bank abheben wollen und merken, dass sie es jederzeit haben können, passiert das Paradoxe, dass sie es sich gar nicht mehr auszahlen lassen wollen. Sie haben Vertrauen.
Eine Frage beschäftigte John Law besonders: Warum funktionierte die Einführung von Papiergeld in Amsterdam, aber anderswo nicht? Eine Konstante in der Geschichte des Geldes sollte ihm dann am Beispiel Schwedens auffallen: Jedes Heilmittel trägt die Wurzel zu seinem Missbrauch bereits in sich.
So gewährte Schweden 1656 Johan Palmstruch das königliche Privileg, eine Privatbank zu eröffnen – unter der Bedingung, dass die Hälfte des Gewinns an die Krone abgeführt würde. Zu dieser Zeit verfügte Schweden über große Kupfervorkommen, sodass die Währung aus massiven Kupferplatten bestand, deren Wert sich an Silbermünzen orientierte. Da Kupfer aber wesentlich günstiger war als Silber oder Gold, wogen die Kupferplatten nicht selten mehr als fünfzehn Kilogramm. Deswegen trugen die Menschen die Kupferplatten auf dem Rücken oder brauchten gar ein Pferdefuhrwerk, wenn sie größere Summen bezahlen mussten. 1661 schaffte Palmstruch mit seiner Stockholm Banco diese Unannehmlichkeit ab, indem er Papiergeld mit der Bezeichnung „Credityf-Zedel“ druckte. Palmstruch versprach, dass jeder Einreicher des Scheins einen Anspruch auf die Auszahlung des angegebenen Nennwerts in Münzgeld hatte. Dieser Anspruch wurde mit auf dem Schein befindlichen Unterschriften und einem Siegel beglaubigt.26
Abbildung 3: Credityf-Zedel. Mit dem Text: Der Inhaber dieses Kreditzettels von der Stockholms Banco unter der Nummer 388 erhält 10 Taler in Silbermünzen, was von uns, dem Bankdirektor, dem Kommissar, Buchhalter und Kassier mit eigenhändiger Unterschrift und Siegel bestätigt wird. (Quelle: Wikimedia Commons. Gemeinfrei)
Die Idee von Palmstruch war, dass dieses Papiergeld, ähnlich wie die Kupferplatten, von Hand zu Hand wanderten. Sie sollten zirkulieren wie das rare Münzgeld in Schweden. Um dies zu ermöglichen, lauteten die „Credityf-Zedel“ anfangs auf vier verschiedene Währungseinheiten – Dukaten, Riksdaler Specie, Daler Silbermünze und Daler Kupfermünze – mit über 24 verschiedenen Nennwerten. Die Nennwerte begannen bei 100 und steigerten sich dann in Fünfzigerschritten bis zum höchsten Wert von 1000. Da dieses System in der Praxis sehr aufwendig war, wurde diese Vielfalt wenige Jahre später durch eine einzige Währungseinheit mit vier Nennwerten ersetzt. Die Schweden erkannten schnell, dass Papiergeld bequemer zu transportieren war. Auch das Bezahlen wurde einfacher, weil man bei größeren Anschaffungen nicht mehr mit Pferdefuhrwerken Kupferplatten zum Händler bringen musste. Deswegen nutzten die Leute begeistert dieses neue Papiergeld. Die Bank florierte.
Der wesentliche Unterschied zum Münzgeld war die Möglichkeit der Vermehrung des Papiergeldes. So hing die Vermehrung beim Münzgeld von der vorhandenen Metallmenge im jeweiligen Land ab, wohingegen sich das Papiergeld ohne große Schwierigkeiten und Kosten in beliebiger Menge herstellen ließ. Dieser Vorteil barg jedoch ein eigenes Risiko. Palmstruch überschritt bei der Vergabe von Krediten und der damit verbundenen Notenausgabe das vertretbare Maß, sodass schließlich zu wenig Barmittel für die Einlösung der Kreditscheine zur Verfügung standen. Dies war ein großes Problem, schließlich beruhte der Wert der Banknoten ja darauf, dass sie jederzeit einlösbar waren. Ließ sich dieser Anspruch nicht mehr realisieren, war das Papier in dem Moment wertlos, in dem die Schweden das Vertrauen in das Papiergeld verloren. Die Bank musste 1668 in die Hände des Staates überführt und die Notenausgabe eingestellt werden. Palmstruch wurde inhaftiert.
Law wurde bewusst, dass die Einführung von Papiergeld kein Selbstläufer war. Was haben also die Amsterdamer Bankleute anders gemacht, dass ihr Papiergeld schon so lange existierte? Der Hauptgrund war, dass jedermann der Bank von Amsterdam vertraute.
„Fremde deponieren hier den Teil ihres Geldes, den sie herschaffen konnten, und von dem sie nicht wissen, wie sie ihn daheim sicher verwahren können.“27
Investoren aus allen Ländern Europas nahmen die Dienste der Bank von Amsterdam in Anspruch. Dabei wurden ihre Einlagen mit einem geringeren Zinssatz verzinst, als die Amsterdamer Bankleute gleichzeitig an Zinsen für die Kredite nahmen. Zudem vergaben sie Kredite nur dann, wenn die Kreditnehmer zuvor entsprechende Sicherheiten in Gold und Silber bei ihnen deponiert hatten. In der Regel verlangten sie je nach Risiko, das dem Kredit innewohnte, zwischen 10 und 50% der Kreditsumme als Sicherheit. Hierdurch konnte bei Ausfall der Schaden für die Bank deutlich reduziert werden. Außerdem wurden die Kredite nicht in Münzen ausgezahlt, sondern in Form von Kreditscheinen, mit denen dann die Kreditnehmer ihre Rechnungen bei anderen Händlern bezahlten, da die Kreditscheine allgemein akzeptiert wurden. Zudem achteten die Amsterdamer Bankleute mit Argusaugen darauf, dass nicht zu viele Kredite gewährt wurden. Dadurch wurde der Umlauf von Banknoten, die nicht durch Gold- oder Silbermünzen gedeckt waren, beschränkt. Man schätzt, dass die Bank von Amsterdam eine Reserve von 30 bis 40% an Münzen vorrätig hatte, um auf verlangen die Kreditscheine in Münzgeld umtauschen zu können. Im Durchschnitt wurden, wegen des Vertrauens in die Bank von Amsterdam, aber nur 5 bis 10% der ausgegebenen Kreditscheine in Münzen umgetauscht. Letztlich hatte das Vertrauen in die Bank bewirkt, dass die ganze Nation aufblühte. So konnte der Bau ganzer Handelsflotten finanziert werden und der Handel erlebte eine große Blüte.28
John Law studierte in Amsterdam das Börsenwesen. Dort gab es eine offizielle Börse für den Handel mit Aktien der Dutch East India oder der West India Company. Sie war ebenso wie die heutigen Börsen unterteilt in verschiedene Sektionen (Säle). Es ist sehr wahrscheinlich, dass Law im Zuge seines Studiums das Buch Confusion de confusiones von Joseph de la Vegas über die Schilderung des Börsenalltags aus dem Jahr 1688 gelesen hat. Dort wird der Börsenhandel so beschrieben:
„Dieses rätselhafte Geschäft ist zugleich das fairste und betrügerischste von ganz Europa ... nämlich sowohl die Quintessenz der akademischen Gelehrsamkeit als auch der Inbegriff der Gaunerei.“29
Auch die heute noch üblichen Ausdrücke wie Bulle und Bär waren schon Joseph de la Vegas bekannt.
„Die nervösen Bären werden gänzlich von Furcht und Zittern beherrscht. Sie machen aus jeder Mücke einen Elefanten, blähen Wirtshausschlägereien zu Rebellionen auf, und schemenhafte Schatten erscheinen ihnen als Vorboten des Chaos.“30
Joseph de la Vegas erkannte also, dass eine leichte Unsicherheit durch Gerüchte die Kurse in die eine oder andere Richtung treiben konnte. Markterwartungen bilden den Schlüssel zur Bestimmung der Kursbewegungen.
„Die Erwartung eines bestimmten Ereignisses macht auf die Börse einen viel tieferen Eindruck als das Ereignis selbst. Werden hohe Dividenden oder satte Importe erwartet, so steigen die Kurse der Aktien; wird jedoch aus der Erwartung eine Realität, so fallen sie dagegen oft. Denn die Freude über die günstige Entwicklung und der Jubel über einen glücklichen Zufall haben sich inzwischen wieder gelegt.“31
1697 legte sich mit dem Vertrag von Rijswijk vorübergehend Frieden über Europa. Er zog einen Schlussstrich unter den Pfälzer Erbfolgekrieg, der zwischen Frankreich, Österreich, Holland, England, Spanien, Schweden und Savoyen ausgetragen wurde. Damit wurden Reisen nach Frankreich leichter, vermutlich stattete John Law um diese Zeit Paris seinen ersten Besuch ab.
Paris muss Law fasziniert haben. Die Hauptstadt Frankreichs stieg in den zurückliegenden vierzig Herrschaftsjahren von Louis XIV. zu einer der schönsten und prächtigsten Städte Europas auf. Nachdem John Law sich in Paris niedergelassen und eingewöhnt hatte, zog es ihn zum Hof des einstigen englischen Königs James II. Dieser war aus England exiliert. Er lebte in recht eingeschränkten Verhältnissen in St.-Germain-en-Laye, einem Schloss außerhalb von Paris. Von den Jakobiten wurden unzählige Geheimpläne ausgeheckt, mit denen sie zurück auf den englischen Thron kommen wollten. Es ist nicht bekannt, ob John Law für diese Pläne Sympathie hegte. Wahrscheinlicher ist es, dass er dort andere Schotten treffen und Zugang zu der französischen Gesellschaft finden wollte. Die leichteste Möglichkeit, Angehörige der obersten Gesellschaftsschicht zu treffen, war beim Glücksspiel. So ist es nicht verwunderlich, dass Law einen Großteil seiner Zeit in den mondänen Salons verbrachte, wo er mit der Crème de la Crème zusammenkam. Dort erwarb er sich mit seinem Charme und seinen untadeligen Manieren ihr Vertrauen, bevor er ihnen beim Pharao oder Basset ihr Geld abnahm. Da bei diesen beiden Spielen die größten Gewinnchancen ganz eindeutig auf Seiten des Bankhalters lagen, soll Law sogar die Gastgeber der Salons bezahlt haben, damit sie ihm das Privileg des Bankhalters einräumten. So hatte bei dem von Law favorisierten Basset der Bankhalter die erste und letzte Karte zur freien Verfügung und weitere erhebliche Vorrechte beim Austeilen auf seiner Seite, sodass er zweifellos bessere Chancen auf Gewinne hatte als seine Mitspieler. Ebenso gut standen die Chancen für den Bankhalter bei dem Kartenspiel Pharao, das Law ebenfalls bevorzugte. Der Bankhalter war beim Pharao oder Basset ebenso wenig ein Glückspieler wie ein modernes Wettunternehmen. Unter der Voraussetzung, dass er über genügend Kapital verfügte und die zu seinen Gunsten stehenden Chancen nutzte, konnte er eigentlich nur als Gewinner den Spieltisch verlassen. Man kann sogar sagen, der Bankhalter spielt nicht, sondern fungiert als eine Art Buchhalter. So sagte ein Beobachter des Spiels von John Law, dass dieser
„mit zwei Säcken voller Gold im Wert von 100.000 Livre32(etwa 6.000 Pfund) bei den Kartentischen von Poisson in der Rue Dauphine oder im Hotel de Cevres in der Rue des Poulies ankam. Um die Handhabung hoher Einsätze zu erleichtern, ließ er sogar eigene Goldspielmarken im Wert von je 18 Louis d‘or prägen.“33
Vielleicht geschah es nach einem Abend am Spieltisch, dass er Madame Katherine Seigneur, geborene Knowles, vorgestellt wurde, einer Exilantin und Außenseiterin am Hof St.-Germain-en-Laye. Sie war unglücklich verheiratet34 und ihr Bruder war der Earl of Banbury. Ihre Art faszinierte John Law. Er war es gewöhnt, Frauenherzen mit Leichtigkeit zu erobern; Katherines hochmütige Art empfand er als Herausforderung. So beschloss er, sich ihr voller Entschlossenheit zu nähern. Da sie unglücklich war, muss sie nach einiger Zeit auf seine Avancen angesprochen haben. Sie sollte Laws ständige Begleiterin und Lebensgefährtin werden.35
Wie gewohnt auf seinen Reisen durch Europa hatten seine meisterhaften Fähigkeiten beim Würfel- und Kartenspiel unglückliche, aber keineswegs unerwartete Konsequenzen. Laws Triumphe brachten ihm nicht nur Gewinne, sondern auch Feinde ein. Hinter vorgehaltener Hand wurde über seine Gerissenheit beim Spiel getuschelt und es dauerte nicht lange, bis die Behörden auf ihn aufmerksam wurden. Es wurde für Law Zeit, weiterzuziehen. Sein Ziel war Italien, dort sollte er sich ein Vermögen erspielen.
Auf seinen Reisen beschäftige sich Law nicht nur mit dem Glücksspiel, sondern auch mit Fragen des Finanzwesens. Die großen italischen Geldhäuser wurden bereits im Mittelalter gegründet, um Kreuzzüge, Kriege und den Handel zu finanzieren. So operierten die venezianischen Staatsbanken – die Banco di Rialto und die Banco del Giro – im Wesentlichen so, wie die Bank von Amsterdam: Die Banken nahmen Einlagen in Münzen (auch verfälschte oder minderwertige) an und gaben dafür Bankgeld aus. Diese Scheine wurden vom Staat Venedig garantiert, d.h. die Rückeinlösung in Münzen war staatlich versichert. Neben dem Papiergeld boten diese Banken aber auch sogenanntes Buchgeld an. Geld also, das nur in Büchern der Banken zirkulierte. Dazu eröffneten die Kaufleute bei den Banken Konten, über die sie dann mittels Scheck oder Überweisung verfügen konnten. Waren wurden bezahlt, indem Geld von einen zum andern Konto floss. Ebenso lernte John Law in Venedig den Handel mit fremden Währungen kennen. So wird berichtet:
„John Law ging immer zum Rialto zur Geldwechselzeit … und er beobachtete, zu welchen Raten Geld der ganzen Welt getauscht wurde, wie Wechsel an der Bank diskontiert wurden und stellte fest, wie überaus nützlich papierene Kreditscheine waren, wie gern die Leute ihr Münzgeld für Scheine hergaben und wie den Besitzern aus diesen Scheinen Profite erwuchsen.“36
Zusätzlich schaute sich Law in Genua bei der Banco della Piazza del Rialto um. Diese Bank war etwas Besonderes. Sie war nicht einfach eine Bank, bei der Gläubiger Münzen deponierten und dafür eine Gutschrift auf Papier bekamen, sondern sie verwaltete die gesamten Einnahmen der Republik. Weiterhin besaß sie Kolonien und Ländereien, unterhielt Armeen und Flotten. Diese Bank war ein sehr mächtiges Handelsunternehmen. Sie diente John Law vermutlich als Vorbild für die Mississippi Company (wie wir später sehen werden).
Sein Streifzeug durch Italien hatte ihm zahlreiche Türen geöffnet. So konnte er zu seinen Freunden den Duc de Vendome und den Duca di Savoia zählen. Dennoch war er unzufrieden – trotz eines Vermögens von 20.000 Pfund. Nach zehn Jahren nationalökonomischer Forschungen37 hatte Law ein beeindruckendes Wissen angehäuft. Er wollte dieses Wissen einsetzen, denn er erkannte, dass seine Fertigkeiten auf ökonomische Zusammenhänge angewendet auch sein Vermögen mehren konnten.38 Seine Reisen führten ihm vor Augen, welche Macht und Dynamik hinter dem Börsen- und Bankiersgewerbe steckten.39 Man musste nur das Parlament oder den Monarchen mit neuen Ideen erreichen, wie dies z.B. Paterson und seine Direktorenkollegen mit der Gründung der Bank of England geschafft hatten. So war es nicht verwunderlich, dass viele der klugen Köpfe der damaligen Zeit wie z.B. Nicholas Asgill, John Briscoe und Hugh Chamberlen immer neue Modelle für Banken ausarbeiteten. Es gab also Gelegenheiten zuhauf für einen klugen Mann, seine Ideen zu formulieren und sie den Regierungen vorzustellen. Und Law wollte einer von ihnen sein.
Hierzu wollte John Law nach Schottland zurückkehren und von dort aus seine Pläne vorstellen. In Schottland hatte er besonders viele einflussreiche Freunde, die ihm helfen konnten, seine Pläne durchzusetzen. Zunächst machte sich Law Sorgen, dass der gegen ihn noch immer gültige Haftbefehl wegen Mordes vollstreckt werden könnte. Ein schottischer Freund erklärte ihm, dass Schottland zwar von demselben Monarchen regiert würde, aber eine eigene Regierung hatte. Deswegen könne Law nicht wegen eines Verbrechens, das er in London begangen hatte, verhaftet werden. Darüber hinaus gelang es Freunden Laws, dass die Familie Wilson den Einspruch wegen Mordes annullierte. So trat er 1704 die lange Heimreise nach Schottland an. Er wohnte vermutlich in dem Anwesen seiner Mutter in Edinburgh. Das häusliche Ambiente ermöglichte es Law, sich neuen Projekten zu widmen. Er entschied sich, seine Kenntnisse zunächst der englischen Krone auf traditionelle Art und Weise vorzutragen. Dazu unterbreitete er einen schriftlichen Vorschlag.
3.2. John Law, der Ökonom
Um Gehör am englischen Königshof zu finden, musste John Law eine Abhandlung einreichen. Dies geschah 1704 mit der Abhandlung Essay on a Land Bank