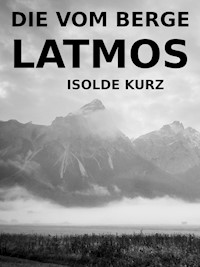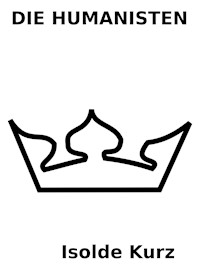Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Isolde Kurz ist auch heute noch eine ambivalente Schriftstellerin. Schon in jungen Jahren selbstständig als Autorin und Übersetzerin, war sie eine Seltenheit im wilhelminischen Deutschland. Später jedoch geriet sie wegen ihres Schweigens im Dritten Reich und ihrer altmodischen Sprache in Kritik. Hervorzuheben sind ihre Werke "Vanadis" und "Florentiner Novellen". Isolde Kurz wuchs in einem liberalen und an Kunst und Literatur interessierten Haushalt auf. Anfang der 1890er Jahre errang sie erste literarische Erfolge mit Gedicht- und Erzählbänden. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isolde Kurz
Die Stadt des Lebens
Schilderungen aus der Florentinischen Renaissance
Isolde Kurz
Die Stadt des Lebens
Schilderungen aus der Florentinischen Renaissance
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962812-15-7
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Lorenzo il Magnifico
Der mediceische Musenhof
La Bella Simonetta
Der Brutus der Mediceer
Bianca Cappello
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Lorenzo il Magnifico
Bisweilen gefällt es der Natur, ihre eignen Grenzen zu erweitern und eine einzelne Persönlichkeit mit so überschwenglichen Gaben auszustatten, dass alle Kräfte ihres Zeitalters in ihr versammelt erscheinen. Einer dieser Hochbegünstigten war Lorenzo de’ Medici, genannt il Magnifico. Beiläufig sei hier bemerkt, dass dieser Zuname erst von der Nachwelt auf Lorenzos Hochsinn, Prachtliebe und königliche Freigebigkeit bezogen wurde, ursprünglich war Magnificenz die Anrede an das nicht gefürstete Staatsoberhaupt, die schon den Vorgängern Lorenzos zukam.
Es ist bekannt, aus welch bescheidenen Anfängen die Familie Medici zu ihrer beispiellosen Größe emporgestiegen ist. Sie waren bürgerlicher Abstammung, ursprünglich Ärzte und Apotheker, wie der Name besagt; die goldenen Kugeln (Palle) ihres Wappens werden als Arzneipillen gedeutet. Im Handel reich geworden, traten sie bei dem Emporkommen der unteren Klassen mit wachsendem Ansehen und mit immer bedeutenderen persönlichen Zügen in den Vordergrund.
Goethes Wort, dass eine Familie nicht gleich das Vollkommene im Guten oder Bösen hervorbringt, sondern erst durch eine Reihe gesteigerter Persönlichkeiten hindurch gehen muss, um endlich die »Wonne« oder »das Entsetzen der Welt« zu erzeugen, bewährt sich nirgends so augenfällig, wie an dem Geschlechte der Medici.
Der Stammvater des Hauses, Giovanni di Averardo dei Medici, gemeinhin Giovanni di Bicci genannt, war noch völlig Privatmann, ein reicher Großhändler und Bankier, durch dessen Hände alle Geldgeschäfte Italiens gingen, vom größten Einfluss im Staate, ohne sich vorzudrängen, ein Freund des Volks, ein Vermittler und Wohltäter. Im großen Gang der Uffizien zu Florenz ist sein Bildnis aufgehängt: ein ernstes eckiges Bauerngesicht mit dem Ausdruck von Klugheit und zugleich von Redlichkeit. Hätte er in Bankos Zauberspiegel die Reihe seiner glorreichen Nachkommen vorüberziehen sehen, er würde die Fundamente, auf denen die künftige Größe des Hauses sich erheben sollte, nicht umsichtiger und dauerhafter haben ausmauern können. So sammelt die Arbeitsbiene aus Naturtrieb das Wachs und baut die Zelle für die königliche Puppe, deren Ausschlüpfen sie selbst nicht mehr erleben soll. In dem warmen Interesse für die Fortschritte der Kunst, die er durch seine reichen Mittel unterstützte, tritt schon der Familienzug hervor, der den unsterblichen Ruhm der Mediceer begründet hat.
In Cosimo wiederholen sich die Eigenschaften des Vaters, aber ins Großartige gesteigert und schon von dem bürgerlichen Hintergrunde abgelöst. Er spann ein Netz von Banken über die ganze abendländische Welt, die er von Florenz aus mit der Sicherheit eines heutigen Börsenkönigs, dem der elektrische Funke dienstbar ist, leitete. Durch Vorschüsse, die er nie zurückverlangte, machte er einen großen Teil seiner Mitbürger zu heimlichen Klienten der Medici. Die florentinischen Zustände waren derart, dass ein Mann von Cosimos Bedeutung seiner Existenz nicht sicher war, wenn er nicht die Hand am Steuer hatte. Cosimo brachte seine Anhänger in den Regierungspalast und ließ durch sie Gesetze geben. Nach Sturz und Verbannung kehrte er noch mächtiger zurück, denn Florenz hatte eingesehen, dass es seiner nicht mehr entraten konnte. Er wurde öffentlich mit dem Ehrentitel eines Pater patriae begrüßt und übte bis zu seinem Tode eine fast unumschränkte Gewalt. Doch wahrte er sein Leben lang ängstlich den Schein des Privatmannes und vermied in seinem Auftreten alles, was das Gleichheitsgefühl seiner Mitbürger verletzen konnte. Von seinem ungeheuren Vermögen macht man sich einen Begriff, wenn man hört, dass Cosimo, als Venedig und Neapel gegen Florenz rüsteten, die feindlichen Staaten lahmlegte, indem er seine dort kursierenden Gelder zurückzog und so durch eine einfache merkantile Maßregel den Frieden erzwang.
Obgleich durch und durch Kaufmann und ganz in weitblickenden Unternehmungen lebend, hatte er doch die geistigen Güter als die höchsten erkannt und legte den Grund zu der berühmten mediceischen Kunst- und Büchersammlung. Selber ungelehrt, fand er im Umgang mit Gelehrten und Künstlern seine glücklichsten Stunden. Durch Begründung der »platonischen Akademie« gab er kräftigen Anstoß zur Belebung der klassischen Studien, die Hand in Hand mit den Künsten gehend, dem ganzen Jahrhundert seine wundersame Doppelphysiognomie von Gelehrtentum und jugendfrischer Schöpferkraft aufgeprägt haben.
Cosimo stärkte jedes Talent und förderte jede Kunst, doch entsprach seiner gebietenden Persönlichkeit am meisten die Architektur, die Lieblingskunst der Herrscher, die sich vor allen anderen im Raume behauptet und die den Triumph des Willens und Geistes über die Masse darstellt. Mit Brunellesco und Michelozzo, den beiden großen Baumeistern seiner Tage, lebte er in naher persönlicher Freundschaft, und ein großer Teil der herrlichsten Bauten in und außerhalb Florenz ist eine Schöpfung Cosimos; auch ins Ausland, bis Paris, ja bis Jerusalem erstreckte sich seine Baulust. Der kolossale Aufwand, den er dafür machte, erregte seines noch großartigeren Enkels Lorenzo staunende Billigung.
Aber erst in diesem Enkel erscheint die Absicht der Natur erreicht und die Höhe erklommen.
Seine Vorgänger hatten sich mit zähen Wurzeln in dem heimischen Boden festgesaugt, nun kam Lorenzo und breitete tausend Äste aus, aus denen sich die ganze Frühlingspracht der Renaissance mit ihrem berauschendsten Blumenduft und Vogelgeschmetter entfalten konnte.
Er wurde am 1. Januar 1449 als Sohn des tüchtigen, aber durch körperliche Gebrechen hintangehaltenen Piero de’ Medici und der geistvollen Lucrezia Tornabuoni geboren. Er erhielt eine gelehrte Erziehung, die ihn zum Gebildetsten unter den damals hochgebildeten Herrschern Italiens machte. Zugleich wurde er früh auf die Regentenlaufbahn vorbereitet und erwarb sich in den Geschäften des Hauses und des Staates den sicheren Weltblick und die praktische Erfahrung. Die Gefährlichkeit des Lebens und die hohe Verantwortung, zu der jene außerordentlichen Menschen herangezogen wurden, kürzten die Kindheit ab, und so ist es nicht auffallend, dass Lorenzo schon mit siebzehn Jahren als Abgesandter seines Vaters beim Papste und anderen Souveränen die Interessen der Republik vertrat.
Auch an körperlichen Vorzügen fehlte es ihm nicht ganz. Er war über Mittelgröße, geschmeidig und kräftig, in den Waffen gewandt, ein ausgezeichneter Reiter und geschickter Jäger. Dagegen hatte er eine unschöne Gesichtsbildung und auffallend dunkle Hautfarbe, welch letztere indes kaum für einen Fehler galt; sagt er doch selbst in seinem Corinto: un uom che non è brun che vale? Auch über die Kurzsichtigkeit, die Leo X. von ihm erbte, wusste er sich zu trösten, wenigstens trumpfte er den sienesischen Gesandten, der ihm gegenüber bedauerte, dass die florentinische Luft den Augen schade, durch die Antwort ab, dass sie dennoch der sienesischen vorzuziehen sei, weil diese das Hirn schwäche. Seine Bildnisse werden ihm zum größten Teile nicht gerecht, nur ein in der Kirche Santa Trinita befindliches Fresko von Domenico Ghirlandajo gibt den Zauber wieder, den nach dem Zeugnis aller, die ihn kannten, Lorenzos unmittelbare Gegenwart ausströmte. Auf diesem Bilde ist die charakteristische geistreiche Hässlichkeit seines Gesichts von solcher Majestät und geistigen Anmut durchleuchtet, dass selbst die Versicherung eines seiner Dichtergenossen: bello è Lorenzo nicht mehr als absurde Schmeichelei erscheint. Ohnehin wurde durch die damalige Erziehung, die der äußeren Erscheinung so vorteilhaft war, jeder Vorzug gehoben und jeder Mangel gemildert.
Nach dem Tode Pieros trat er als Einundzwanzigjähriger die Regierung an, ohne fürstliche Auszeichnung, doch als geborener Fürst und Herrscher. Wer auf seine Jugend gerechnet hatte, um durch ihn zu regieren, sah sich in der Erwartung getäuscht, denn Lorenzo nahm die Zügel fest in eigene Hände. Schon bei Pieros Lebzeiten hatte er Proben seiner Entschlossenheit gegeben, als er einen Handstreich der Gegenpartei, die auf den Untergang seiner Familie abzielte, durch rasches Eingreifen vereitelte. Unähnlich seinem Vater und Großvater, die sich vor allem bestrebt hatten, den Neid zu entwaffnen, trat er überall mit seiner Person in den Vordergrund, und während er dem Namen nach nur der erste Bürger von Florenz war, verkehrte er auf gleichem Fuße mit den Potentaten Europas. Die fremden Fürstlichkeiten, die er als seine Gäste empfing, staunten über den Luxus edelster Art, über die unermesslichen Schätze an Statuen, Gemälden, Vasen, Gemmen, Mosaiken, Miniaturen, Manuskripten, den Resten antiker Kunst, durch viele Jahre mit ungeheuren Kosten gesammelt, und den Werken der großen zeitgenössischen Meister, mit denen der Mediceische Palast in der Via larga (heutigen Via Cavour) angefüllt war. Daneben schmeichelte er dem Schönheits- und Prachtsinn seiner Mitbürger durch Feste, Turniere und öffentliche Schaustellungen, deren Schilderungen wie die Märchen aus Tausend und Einer Nacht anmuten.
Neben ihm stand Giuliano, sein um fünf Jahre jüngerer Bruder, mit dem ihn herzliche Neigung verband und der, wenn er sich an Vielseitigkeit der Begabung nicht mit Lorenzo messen konnte, ihn dagegen an Glanz der Erscheinung und an körperlichen Fertigkeiten übertraf. Was in Florenz durch Bildung und Geist, was durch Rang und Reichtum glänzte, sammelte sich um das mediceische Brüderpaar als um den natürlichen Mittelpunkt. Ohne die alten republikanischen Formen anzutasten, nur durch leise Umgestaltung im Innern zog Lorenzo die verwickelten Fäden der Verwaltung in wenige ihm ganz ergebene Hände zusammen und machte das ganze Staatsleben von seiner Person abhängig.
Solche Machtstellung, wie sie nie ein florentinischer Bürger besessen hatte, erregte Groll und Neid. Man beschuldigte ihn, dass er der Tyrannis zustrebe; schon seine Heirat mit der Römerin Clarice Orsini aus dem mächtigen Baronengeschlecht hatte Anstoß gegeben. Lorenzo musste sich vorsehen und, indem er sich auf die niederen Klassen stützte, drückte er die großen Geschlechter, von denen ihm Gefahr drohte, zur völligen Einflusslosigkeit herab. Seine Anhänger überhäufte er mit Wohltaten und Auszeichnungen, indem er zugleich dafür sorgte, dass ihm keiner über den Kopf wuchs. Den Ehrgeiz demütigte er durch geflissentliche Zurücksetzung und steigerte so die Unzufriedenheit, die in ihrem Schoß eine furchtbare Katastrophe zeitigte.
Unter den reichen Familien, die von Alters her mit den Medici an Macht und Ansehen rivalisierten, war die der Pazzi eine der hervorragendsten. Der alte Menschenkenner Cosimo hatte den drohenden Konflikt vorausgesehen und ihn zu verhüten gesucht, indem er seine Enkelin Bianca, Lorenzos Schwester, mit Guglielmo de’ Pazzi vermählte. Aber dieses Band war nicht stark genug, die Interessen der beiden Familien fest zu verknüpfen. Lorenzo verkehrte zwar mit Guglielmo und dessen Brüdern ganz auf verwandtschaftlichem Fuße, aber er gönnte ihnen keinen Anteil an den Staatsgeschäften, zu denen sich jeder vornehme Florentiner durch die Geburt berufen glaubte. Die Pazzi zahlten ihm mit gleicher Münze zurück und durchkreuzten, wo sie konnten, seine politischen Pläne. Vergeblich redete Giuliano, der die rechtlichere und versöhnlichere Gemütsart des Vaters geerbt hatte, zum Guten, Lorenzo goss nur Öl ins Feuer, indem er ein ungerechtes Erbschaftsgesetz durchgehen ließ, das die Pazzi um ein großes ihnen zufallendes Vermögen verkürzte.
Guglielmos Bruder, der ehrgeizige und heißblütige Francesco de’ Pazzi hielt sich in Folge dieser ihm unleidlichen Verhältnisse von der Vaterstadt ferne und trat in Rom, wo er das große Zweiggeschäft der Pazzischen Bank leitete, in nahe Beziehungen zu dem päpstlichen Nepoten, dem Grafen Riario. Dieser, durch den Papst mit den Herrschaften von Imola und Forli beschenkt, hegte seit lange Grenzerweiterungsgelüste, sah sich aber durch Lorenzos politisches Gleichgewichtssystem auf allen Seiten im Schach gehalten. Deshalb sann er darauf, die Herrschaft der Medici in Florenz zu stürzen und fand an Francesco de’ Pazzi einen willigen Helfer. Ihnen schloss sich ein anderer erbitterter Gegner Lorenzos an, Francesco Salviati, der vom Papste gegen den Willen der Florentiner zum Erzbischof von Pisa ernannt, aber von diesen drei Jahre lang an der Ausübung seines Amtes verhindert worden war. Auch er saß grollend in Rom und wartete nur auf eine Gelegenheit, um sich an Lorenzo, in dem er die Verkörperung der florentinischen Politik erblickte, zu rächen.
Zunächst galt es, sich der Zustimmung des Papstes zu dem Attentat zu versichern. Dem turbulenten Sixtus IV., der immer bemüht war, aus den kleinen schutzlosen Staaten der Romagna unabhängige Fürstentümer für seine Nepoten zurecht zu schneiden, konnte ein Nachbar wie Lorenzo nicht behagen, dessen Vorsicht ihm allenthalben Riegel vorschob. Persönliche Zerwürfnisse waren noch in den letzten Jahren hinzugetreten und hatten den Papst, der anfangs ein Gönner der Medici gewesen, so gegen Lorenzo in Harnisch gebracht, dass Graf Riario leichtes Spiel mit ihm hatte. Augenscheinlich hoffte man nach Beseitigung Lorenzos sich vermittelst der Pazzi der florentinischen Republik zu bemächtigen und von da aus halb Italien zu unterwerfen. König Ferrante von Neapel scheint gleichfalls um den Plan gewusst zu haben und hätte vermutlich, falls er gelang, die andere Hälfte Italiens an sich gerissen.
Der Hauptmann Giovanbattista da Montesecco, päpstlicher Condottiere und dem Grafen völlig ergeben, wurde ins Vertrauen gezogen und ihm die Ausführung des Handstreichs übertragen. Dieser, ein ruhiger und wohlgesinnter Mann, erhob Bedenken, aber Graf Riario wusste ihm Lorenzo als einen gefährlichen Feind des Papsttums hinzustellen, durch dessen Ränke er selbst an Besitz und Leben bedroht sei. Francesco de’ Pazzi und der Erzbischof versicherten ihm überdies, das Regiment der Medici sei in Florenz verhasst und ihr eigener Anhang dort so mächtig, dass die ganze Stadt mit Jubel beistimmen werde, wenn der Streich gefallen sei.
Um das Gewissen des Bedenklichen vollends zu beschwichtigen, führten ihn der Graf und der Erzbischof zu den Füßen des heiligen Vaters, und nun spielte sich im Vatikan eine Szene ab, bei der das Haupt der Christenheit eine sehr fragwürdige Rolle spielte. Der Papst wollte die Vollstreckung der Tat, wünschte aber zugleich den Schein zu retten. Deshalb forderte er zwar von dem Hauptmann die Beseitigung der Brüder Medici, stellte aber zugleich im Hinweis auf sein heiliges Amt die Bedingung, dass kein Blut vergossen werden dürfe, und als man ihm entgegenhielt, dass das eine nicht ohne das andere möglich sei, fuhr er zornig auf und wiederholte nur immer den Befehl zusamt der Klausel, so den Vollstreckern die Verantwortung für den Ausgang überlassend. Die Verschworenen, die den Wink verstanden, versprachen ihr bestes zu tun und nahmen das Steuer nun in eigene Hände.
Dass Lorenzo nicht der Mann war, sich lebend die Gewalt entreißen zu lassen, lag auf der Hand, und sein Tod war sonach von Anfang an eine beschlossene Sache. Aber auch in dem jüngeren Bruder, so sehr er freiwillig hinter Lorenzo zurücktrat, lebte der starke Geist seines Hauses, außerdem war er besonders beliebt, und man durfte erwarten, dass bei Lorenzos Tode das Volk sich alsbald um Giuliano als seinen Erben und Nachfolger scharen würde. Also kamen die Verschworenen beim Fortgang ihrer Beratungen zu dem Schluss, dass auch Giuliano fallen müsse.
Die Brüder zu treffen, schien ihnen nicht schwer, da beide gewohnt waren, unbegleitet und arglos unter ihren Mitbürgern umherzugehen. Aber der zu erwartende Aufruhr im Volke machte militärische Unterstützung nötig, deshalb sollte Montesecco nebst zwei anderen päpstlichen Condottieren eine ansehnliche Truppenmacht an den Grenzen der Romagna zusammen ziehen, um auf den ersten Wink Florenz von drei Seiten überfallen zu können.
Diese Bewegungen zu maskieren und die militärischen Dispositionen in der Stadt vorzubereiten, begab sich Montesecco im April des Jahres 1478 nach Florenz. Ein Auftrag des Grafen führte ihn in die persönliche Gegenwart Lorenzos, mit dem er auf dessen Villa Casagiolo über einen simulierten Kriegszug in der Romagna unterhandeln sollte. Der wahre Zweck war, Ort und Persönlichkeiten in Augenschein zu nehmen. Lorenzo, der sonst so Scharfblickende, ließ sich völlig täuschen und mit einer Courtoisie, die den Abgesandten überraschte, stellte er aufs entgegenkommendste dem Grafen Riario seine Dienste zur Verfügung. Montesecco konnte in dem Manne, der ihn so wohlwollend empfing, den feindseligen Ränkeschmied, der ihm geschildert worden war, nicht erkennen, und Lorenzos leutselige Umgangsformen, sein persönlicher Zauber, dem sich niemand entzog, machten einen so tiefen Eindruck auf den ehrlichen Kriegsmann, dass er fortan, wie es scheint, nur noch mit halbem Herzen bei der Sache war und ungern die weitere Verständigung unter den Verschworenen vermittelte.
Gleichzeitig war Francesco de’ Pazzi nach Florenz gereist, um seinen Oheim Messer Jacopo, das Haupt der Familie, für den Plan zu gewinnen. Der alte Herr hatte sich anfangs entschieden ablehnend verhalten und sträubte sich auch jetzt noch lange; erst als ihm durch Montesecco bestätigt wurde, dass der Papst selber hinter der Verschwörung stand, stieg auch ihm der Taumel zu Kopfe, und er ließ sich in einen Anschlag verstricken, in dem für seine grauen Haare wenig Ehre zu holen war. Sein Beitritt zog den Rest der Familie Pazzi mit dem ganzen Anhang nach, ausgenommen Renato de’ Pazzi, einen stillen Gelehrten, der das Attentat missbilligte, und Guglielmo, Lorenzos Schwager, der gar nicht eingeweiht wurde.
Mittlerweile tauschte Graf Riario mit Lorenzo freundschaftliche Briefe und suchte ihn durch die Aussicht auf eine Versöhnung mit dem Papste nach Rom zu locken. Dort hätte er leichter mit ihm aufgeräumt, und die Mitverschworenen hätten freie Hand bekommen, sich in Florenz Giulianos zu entledigen. Aber Lorenzo zögerte zu kommen, und im nutzlosen Warten verstrich die Zeit. Schon wurde der Papst ungeduldig und klagte, sich mit eitlen Schwätzern eingelassen zu haben. Lange durfte nicht mehr zugesehen werden, denn die Verschwörung hatte unterdessen eine so große Ausdehnung angenommen, dass das Geheimnis nicht mehr sicher war, und eben so wenig konnte man erwarten, dass sich Lorenzo auf die Länge über die Rüstungen an der Grenze werde Sand in die Augen streuen lassen.
Endlich schien die Gelegenheit günstig. Der Papst hatte einem sechzehnjährigen Neffen des Grafen Riario, der in Pisa studierte, den Purpur verliehen. Diesen, der den Befehl hatte, sich ganz von dem Erzbischof leiten zu lassen, holten die Verschworenen pomphaft nach Florenz und quartierten ihn in Messer Jacopos Landsitz auf Montughi, einem vor der Stadt gelegenen Hügel, ein. In seinem glänzenden Gefolge konnten sie ihre Leute und ihre Anstalten bergen; außerdem musste der Gast, der als Cardinal und als päpstlicher Nepote Anspruch auf Beachtung hatte, den Verkehr mit dem Hause Medici vermitteln.
Die Brüder luden ihn gleich zu einem festlichen Empfang auf ihre Villa bei Fiesole, und dort sollte der Verabredung gemäß der Streich fallen, aber Giuliano, durch Unwohlsein verhindert, hielt sich ferne. So fiel der Anschlag ins Wasser, denn die Verschworenen wagten nicht, die Brüder gesondert anzugreifen, sie glaubten nur sicher zu gehen, wenn sie beide an einem Ort und in einer Stunde treffen konnten.
Nun wurde der 26. April als der Sonntag vor dem Himmelfahrtsfest zur Ausführung anberaumt. Der Kardinal, ein willenloses Werkzeug, musste den Brüdern ankündigen, dass er sie an diesem Tage in der Stadt besuchen und im Dom die Messe hören werde.
Im Palazzo Medici wurde zu einem großen Festmahl gerüstet, das die glänzendste Gesellschaft von Florenz vereinigen sollte. Diesmal hofften die Verschwörer bestimmt, sich beider Brüder auf einmal zu versichern, und demgemäß wurden die Rollen ausgeteilt: Montesecco sollte den Streich gegen Lorenzo führen, der kräftigere Giuliano wurde Francesco de’ Pazzi und Bernardo Bandini, einem ruinierten Lebemann, der sich mit Leib und Seele den Pazzi verschworen hatte, zugeteilt, während der Erzbischof den Regierungspalast mit Bewaffneten überfallen und Jacopo de’ Pazzi mit den Seinigen durch die Straßen sprengen sollte, um das Volk zur Freiheit aufzurufen.
Aber es war, als ob ein Vorgefühl den arglosen Giuliano in diesen Tagen begleitete. Als alles zum Schlage bereit war, ließ er sein Erscheinen bei Tafel absagen mit der Entschuldigung, dass er unpässlich sei; in der Kirche jedoch beim Hochamt hoffe er nicht zu fehlen.
Die Nachricht, die Francesco am Vorabend den Verschworenen überbrachte, änderte abermals den ganzen Plan. Man saß noch tief in der Nacht beisammen und ratschlagte. Statt beim Gastmahl sollten die Brüder nun in der Kirche fallen, und der feierliche Moment der Wandlung wurde zum Signal gewählt. Diesen Anlass ergriff Montesecco, um sich zurückzuziehen: er war, seit er Lorenzo persönlich kennen gelernt hatte, ohnehin nur noch mit halbem Herzen bei der Sache; als er nun zum Verrat noch die Tempelschändung fügen sollte, ward ihm des Greuels zu viel und er verweigerte seinen Arm. Zwei Priester traten an seine Stelle: Antonio Maffei aus Volterra und Stefano da Bagnona, der letztere ein Hauslehrer der Pazzi. Diese waren der Kirchenluft gewohnt und »deshalb«, wie die alten Berichte sagen, »ohne Scheu vor dem Heiligen«, aber sie hatten keine Übung im Waffenhandwerk, und der Rollenwechsel kam den Verschworenen teuer zu stehen.
Schon hatte Lorenzo den Kardinal an seinen Platz im Chor der Kirche unter der Kuppel Brunellescos geleitet, und das Hochamt begann, als die Mörder sich nach Giuliano umsahen. Abermals scheint den Unglücklichen sein guter Genius gewarnt zu haben: er war auch von der Messe weggeblieben. Da machten Francesco de’ Pazzi und Bernardo Bandini sich nach dem Palazzo Medici auf, um ihn zu holen. Unter freundschaftlich-dringlichen Bitten und Neckereien nahmen sie ihn in ihre Mitte und unterhielten ihn eifrig den ganzen Weg. Francesco, die Rechte der Verwandtschaft benützend, umschlang ihn mit den Armen, um zu untersuchen, ob er keinen Panzer unter dem Wams trage. Giuliano, der sich noch immer unpässlich fühlte, war gänzlich unbewehrt, selbst den Dolch, den er sonst bei sich zu tragen pflegte, hatte er zu Hause gelassen, so fern lag ihm der Gedanke an Gefahr.
Beide Brüder standen getrennt in der menschenüberfüllten, musikdurchrauschten Kirche; in dem Gedränge konnten die Mörder sich dicht an ihrer Seite halten. Das Glöcklein klingelte, der Priester erhob den Kelch, die Medici mit allem Volke beugten sich tief, da fuhr Bernardo Bandinis Schwert Giuliano in die Brust. Der Getroffene machte noch einen Schritt und stürzte dann zu Boden. Nun versetzte Francesco de’ Pazzi dem Gefallenen Stoß auf Stoß mit solcher Wut, dass er sich selbst mit dem Dolche tief in den Schenkel traf.
Gleichzeitig wehrte sich Lorenzo gegen die beiden Priester, die dem Blutgeschäfte nicht gewachsen waren. Antonio Maffei hatte ihn mit der einen Hand an der Schulter gefasst, um mit der anderen sicherer zu treffen, als Lorenzo blitzschnell auffahrend seinen Mantel abriss, womit er den linken Arm umwand und die Stöße parierte, während er mit der Rechten den Dolch schwang. So schlug er sich durch seine Angreifer durch und suchte am Altar vorbei durch den Chor die Neue Sakristei zu erreichen. Da sah ihn Bandini und mit dem Schwert, das noch vom Blut Giulianos troff, wollte er sich auf Lorenzo stürzen, aber Francesco Nori, ein Freund der Medici, sprang dazwischen und empfing statt seiner den tödlichen Streich. Unterdessen wurde Lorenzo von seinen Freunden umringt und in die Sakristei gerissen. Der Dichter Angelo Poliziano schlug die feste broncene Türe vor den Verfolgern zu, die, von Piero de’ Medici einst gestiftet, jetzt dem Sohn das Leben rettete. Lorenzo blutete aus einer leichten Halswunde, die von einem der Anwesenden aus Furcht, dass sie vergiftet sei, ausgesogen wurde.
Ein ungeheurer Lärm füllte das Gotteshaus, man sah Bewaffnete dahin und dorthin rennen, aber nur die Zunächststehenden wussten, was geschehen war. Draußen glaubte man, Brunellescos Riesenkuppel wanke. Innen war alles Geschrei und Verwirrung, die Verschworenen flohen, Guglielmo de’ Pazzi versicherte laut jammernd, dass er unschuldig sei, der Kardinal Riario klammerte sich leichenfahl am Altare fest und konnte nur mit Mühe von den Priestern nach der Alten Sakristei geflüchtet werden – er soll nach jenem Schreckenstag nie wieder die natürliche Gesichtsfarbe zurückerhalten haben.
Sobald aber die Bluttat bekannt wurde, griff die ganze Stadt zu den Waffen, die Freunde der Medici drangen geschlossen in die Kirche und holten Lorenzo aus der Sakristei nach seiner Wohnung. Erst dort erfuhr er seines Bruders Tod; man hatte ihn in einem weiten Bogen an dem blutüberströmten Leichnam vorbeigeführt.
Unterdessen war auch die zweite Hälfte des frevlerischen Anschlags gescheitert.
Der Erzbischof hatte sich unter der Domtüre von Lorenzo verabschiedet und war dann mit einer starken Begleitung nach dem Regierungspalast geeilt, wo die Signoria eben bei der Tafel saß. Einen Teil seiner Leute ließ er unten, mit der Weisung, beim ersten Lärm das Thor zu besetzen, die anderen nahm er mit in den Palast und hieß sie in einem Nebengelass warten, während er selbst zu der geforderten Unterredung bei dem Gonfaloniere eingeführt wurde. Aber die Aufregung und das seltsame Betragen des Bischofs, der etwas verwirrtes von einem päpstlichen Auftrag an die Signoria daher redete und dabei unruhig nach der Tür blickte, als ob er jemand erwartete, machten den Gonfaloniere stutzig. Er eilte rasch zum Ausgang, da stieß er auf einen der Verschworenen, der eben herein wollte, warf diesen an den Haaren zu Boden und rief die Wache zusammen. Die im Nebenzimmer versteckten Begleiter wollten herausbrechen, allein sie saßen in einer Falle fest, denn die Tür, die hinter ihnen zugeschlagen war, hatte ein Geheimschloss, das nur die Beamten zu öffnen verstanden. Sie wurden samt dem Erzbischof, der zu entfliehen versuchte, festgenommen, und da die außen stationierte Mannschaft in den Palast eindrang, verteidigte die Signoria das obere Stockwerk mit Steinen und was ihnen zur Hand kam; selbst das Küchengeschirr musste als Waffe dienen.
Francesco de’ Pazzi hatte sich mit seiner schweren selbst geschlagenen Wunde nach Hause geschleppt und versuchte noch, zu Pferde zu steigen, um den Aufruhr in der Stadt zu leiten. Doch er war so erschöpft vom Blutverlust, dass er sich entkleidet aufs Bette werfen musste. Statt seiner eilte der alte Messer Jacopo mit etwa hundert Mann auf die Piazza, um dem Erzbischof zu Hilfe zu kommen. Aber die Sache der Pazzi war schon verloren. Als er das Volk zur Befreiung von der mediceischen Herrschaft aufrufen wollte, wurde er mit Steinwürfen und mit dem Ruf: Palle! Palle! Nieder mit den Verrätern! empfangen. In allen Straßen rottete sich die Menge zusammen; das kleine Häuflein, das den Palast berannte, musste weichen, und viele wurden auf der Flucht erschlagen.
Jetzt erst erfuhr die Signoria Giulianos Tod und Lorenzos Verwundung, und nun gab es auch drinnen keine Schonung mehr. Man hieb die Gefangenen und wessen man sonst von den Eindringlingen habhaft wurde, nieder oder stürzte sie durch die Fenster auf die Piazza hinab. Der Erzbischof mit seinem Bruder und anderen Häuptern der Verschwörung wurde an den hohen Fenstern des Palastes aufgeknüpft; man ließ ihm nicht einmal Zeit, sich des geistlichen Ornats zu entkleiden. Gleichzeitig erlitt Francesco de’ Pazzi, den man nackt aus dem Bette gerissen und unter dem Wutgeschrei des Volks nach dem Palast geführt hatte, an der Seite des Erzbischofs dieselbe Strafe. Auf alle Schmähungen, mit denen er überhäuft wurde, antwortete er nur durch finstere Blicke und tiefe Seufzer, und der wilde Trotz verließ ihn auch im Tode nicht. Von dem Erzbischof wird erzählt, dass er im Augenblick des Sterbens sich wütend mit den Zähnen in Francescos nackte Brust verbissen habe.
Draußen hatte unterdessen die Volksjustiz ihr grausiges Werk begonnen. Man sah zerstückte menschliche Glieder durch die Straßen schleifen, die beiden Priester, die Lorenzo angegriffen hatten, wurden von der Menge aus ihrem Klosterversteck herausgezerrt, verstümmelt und getötet, auch die Personen aus dem Gefolge des Kardinals mussten bluten, dieser selbst saß gefangen im Regierungspalast und dankte nur der Verwendung Lorenzos das Leben. Die wildeste Jagd galt den Gliedern des Hauses Pazzi. Der alte Jacopo wurde auf der Flucht in den Casentiner Bergen von den Bauern festgenommen, denn die Kunde von den Vorgängen in Florenz war schon bis dorthin gedrungen, und trotz eines hohen Lohnes, den er ihnen anbot, damit sie ihn unterwegs töteten, schleppten sie ihn schmachvoll nach der Stadt, wo er das Los seines Neffen teilte. Er hatte übrigens sein tragisches Ende geahnt und noch am Samstag, der jenem blutigen Sonntag voranging, alle seine Schulden bezahlt, auch was er an fremden Waren zu Hause und auf dem Zollamt liegen hatte, mit auffallender Geschwindigkeit den Eigentümern zugestellt, um keine Unbeteiligten in seinen Ruin zu verwickeln. Die scheußlichen Beschimpfungen, die noch Wochen später dem Leichnam des Unseligen von der vertierten Menge zugefügt wurden, gehören zu den widerlichsten Flecken, mit denen das florentinische Volk sich in jenen Schreckenstagen beschmutzt hat. Der völlig schuldlose Renato ward gleichfalls aufgegriffen und büßte mit dem Tode, dass er Pazzi hieß. Mehrere Tage dauerte das Würgen, bei dem gegen achtzig Personen ihr Leben verloren. Nur Guglielmo konnte sich mit Hilfe seiner Gattin in Lorenzos eigenem Hause bergen.
Gleich nach dem Attentat strömte das Volk unter dem Palazzo Medici zusammen, ein blutiges Haupt auf einer Pike tragend, und verlangte den Geretteten zu sehen. Lorenzo erschien, den Hals von einer Binde umwickelt, und wurde mit stürmischem Zuruf begrüßt. Er dankte dem Volke, dass es sich zum Schutz um ihn geschart habe, und bat dringend um Mäßigung. Die tobenden Freunde, sagte er, flößten ihm mehr Besorgnis ein, als selbst die Tücke seiner Feinde; er beschwöre sie, der guten Sache nicht durch Ausschreitungen zu schaden, sondern ihren Zorn für die äußeren Gegner aufzusparen und die Bestrafung der schuldigen Mitbürger den Gerichten zu überlassen. Diese Anrede, seine wunderbare Rettung, die klüglich bewiesene Mäßigung, das alles wirkte so unbedingt und mächtig, dass die gesamte Bürgerschaft mit Gut und Blut sich ihm zu eigen schwur, und Lorenzo durfte sich sagen, dass der Schlag, der ihn vernichten sollte, ihm vielmehr den Weg zur unbeschränkten Herrschaft geebnet hatte.
Als die Volkswut beschwichtigt war, fuhren die Gerichte fort, ihn seiner Feinde zu entledigen. Keine Stimme erhob sich um Gnade, denn der versöhnliche Giuliano war gefallen, und Lorenzo, der ihn zu rächen hatte, ließ der Justiz ihren Lauf. Was vom Hause Pazzi noch übrig war, wurde eingekerkert oder verbannt, auch Guglielmo, Lorenzos Schwager inbegriffen, ihre Vorrechte, ihre Wappen, ihr Name selber sollten verschwinden. Montesecco wurde nach einem umfassenden Geständnis, das den Papst schwer kompromittierte, enthauptet. Nur Bernardo Bandini, Giulianos Mörder, hatte sich zu verbergen gewusst und war glücklich nach Konstantinopel entkommen, aber der Sultan, um Lorenzo zu ehren, sandte ihn in Ketten nach Florenz zurück, wo er noch ein Jahr später öffentlich in seinen Türkenkleidern hingerichtet wurde. Damals befand sich auch der jugendliche Leonardo unter den Zuschauern, denn eine Bleistiftzeichnung von seiner Hand hat den schaurigen Anblick festgehalten: es zeigt den Gehenkten in seiner fantastischen morgenländischen Tracht, deren Farben mit winziger Schrift am Rande notiert sind. – Zum ewigen Gedächtnis der Schreckenstage ließ man alle Teilnehmer der Verschwörung mit dem Strick um den Hals auf die Außenmauern des Palazzo del Podestà (des heutigen Nationalmuseums) malen, als Hochverräter mit dem Kopf nach unten. Botticelli, der Schöpfer der holden Primavera, tat diesen künstlerischen Henkersdienst.
Andere Künstler eiferten, den Geretteten zu feiern. Lebensgroße, sprechend ähnliche Wachsbildnisse von Lorenzo, zu denen Verrocchio die Zeichnung gemacht hatte, wurden in Kirchen aufgestellt; eines davon trug die Kleider, in denen Lorenzo verwundet worden war. A. Pollajuolo schlug eine noch jetzt vorhandene Medaille mit den Köpfen der Brüder Medici, deren eine Seite die Rettung Lorenzos, die andere den Tod Giulianos vor dem Chor der Kirche – mit den Umschriften Salus publica und Luctus publicus – darstellt. Angelo Poliziano öffnete den liedersüßen Mund und ergoss in lateinischen Epigrammen einen Strom wohllautender Schmähungen über die Besiegten.
Vier Tage nach dem blutigen Ereignis wurde Giuliano mit neunzehn Wunden zu Grabe getragen. Das Leid um ihn war aufrichtig und allgemein; die florentinische Jugend, deren Liebling er gewesen, legte Trauerkleider an. Wie er durch seine glänzende Erscheinung, sein freundliches Wesen und seine offenen Hände die Herzen der Mitlebenden gewonnen hatte, so steht er auch im Gedächtnis der Nachwelt als eine ergreifende, durch unverschuldetes tragisches Geschick verklärte Jünglingsgestalt.