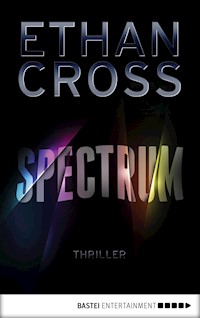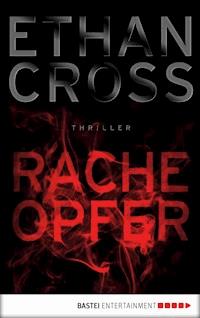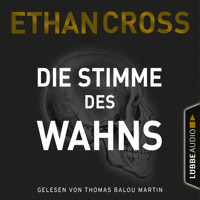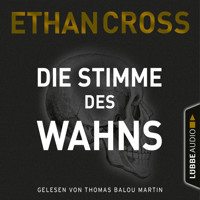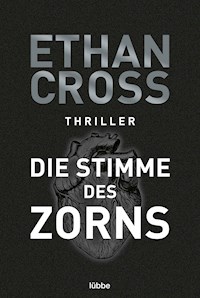
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Ackerman & Shirazi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Den Geschmack an Schmerzen und Qual hat Francis Ackerman jr. nicht verloren. Aber er lebt seine Lust an Gewalt nur noch an grausamen Verbrechern und Mördern aus.
In seinem ersten Fall als Sonderermittler des FBI trifft Ackerman auf einen Täter, der seinesgleichen sucht: Das sogenannte "Alien" hinterlässt sezierte Leichen in Kornkreisen und hat gerade eine Expertin für Außerirdische entführt. Ackermann gibt alles, um das Alien zu fangen, bevor auch dieses Opfer tot in einem Kornkreis endet. Aber das ist leichter gesagt, als getan. Hat Ackerman endlich einen würdigen Gegner gefunden?
Band 1 einer neuen Serie rund um Francis Ackerman jr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber den AutorTitelImpressumERSTER TEILPROLOG123456789101112131415161718192021222324252627ZWEITER TEIL28293031323334353637383940414243444546474849505152DRITTER TEIL53545556575859606162636465666768697071727374757677Über den Autor
Ethan Cross ist das Pseudonym eines amerikanischen Thriller-Autors, der mit seiner Frau, drei Kindern und zwei Shih Tzus in Illinois lebt. Nach einer Zeit als Musiker nahm Ethan Cross sich vor, die Welt fiktiver Serienkiller um ein besonderes Exemplar zu bereichern. Francis Ackerman junior bringt seitdem zahlreiche Leser um ihren Schlaf und geistert durch ihre Alpträume. Neben der Schriftstellerei verbringt Ethan Cross viel Zeit damit, sich sozial zu engagieren, wobei ihm vor allem das Thema Autismus sehr am Herzen liegt.
ETHAN
CROSS
DIE STIMME
DES
ZORNS
THRILLER
Aus dem amerikanischen Englisch vonDietmar Schmidt
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2019 by Aaron Brown
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Man Without Fear«
Published in agreement with the author, c/o BAROR INTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Wolfgang Neuhaus
Titelillustration: © Hein Nouwens / shutterstock
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-7801-6
luebbe.de
lesejury.de
ERSTER TEIL
Psychiatrische Analyse betr. Francis Ackerman jr. (eidesstattliche Aussage von Dr. Stuart Kendrick)
Die nachfolgende eidesstattliche Aussage wurde aufgenommen am 23. Juli 2018 von Maria Nelson, United States Deputy Attorney General, Justizministerium der Vereinigten Staaten. Gegenstand sind die Befunde des Dr. Stuart Kendrick bezüglich Francis Ackerman jr., um dem FBI eine Entscheidungshilfe betr. der Übernahme Ackermans in die Behavioral Analysis Unit des FBI in Quantico, Virginia, zu geben.
Maria Nelson, US Deputy Attorney General: Welchen Eindruck erhielten Sie bei Ihren Untersuchungen von Mr. Ackerman?
Dr. Stuart Kendrick: Ich erhielt den Eindruck, dass Mr. Ackerman hochintelligent und auf einer Vielzahl von Gebieten sehr belesen ist. Auf der anderen Seite entziehen sich grundlegende Regeln und Prinzipien des menschlichen Zusammenlebens völlig seinem Verständnis. Für Ackerman ist alles nur ein Spiel.
Nelson: Sie haben Mr. Ackerman als hochintelligent bezeichnet. Könnten Sie das näher erläutern?
Kendrick: Ja, sicher. Es sind etliche Versuche unternommen worden, Ackermans IQ zu bestimmen. Jeder dieser Versuche blieb ohne eindeutiges Ergebnis.
Nelson: Ohne eindeutiges Ergebnis? Wie ist das zu verstehen?
Kendrick: Es bedeutet, dass Ackerman jeden Test auf irgendeine Weise sabotiert. Allerdings ergibt sich aus einem Abgleich verschiedener Datenquellen ein Schätzwert, was Ackermans IQ betrifft.
Nelson: Und wie hoch liegt dieser Wert?
Kendrick: Bei 165.
Nelson: Können Sie zu Vergleichszwecken bekannte historische Persönlichkeiten nennen, die einen ähnlich hohen IQ hatten?
Kendrick: Nun ja, die Quellen sind unterschiedlich, aber Isaac Newton beispielsweise, Charles Darwin und Wolfgang Amadeus Mozart werden auf einen IQ von etwa 165 geschätzt.
Nelson: Und wo liegt, sagen wir, Albert Einstein?
Kendrick: Bei Einstein vermutet man einen IQ von 160.
Nelson: Würden Sie sagen, dass Mr. Ackerman die Intelligenz eines Genies besitzt?
Kendrick (trinkt einen Schluck Wasser): Ja, das würde ich sagen.
Nelson: Würden Sie ihn außerdem als Gefahr für sich und andere beschreiben?
Kendrick: Definitiv.
Nelson: Könnten Sie das näher ausführen?
Kendrick: Ackerman hat nur wenig Kontrolle über seine Impulse. In Verbindung mit seiner Intelligenz ist das eine höllische Mischung. Und er zeigt niemals auch nur einen Hauch von Furcht, nicht einmal vor dem eigenen Tod.
Nelson: Sie schreiben auf Seite 5 der Anlage 15: »Während einige Scans von Ackermans Hirn kein eindeutiges Ergebnis liefern, ist auf anderen Aufnahmen eine Schädigung der Amygdala zu erkennen. In diesem auch Mandelkern genannten Teil des Gehirns werden Empfindungen wie Furcht oder auch der Fluchtreflex erzeugt. Ist bei einem Primaten die Amygdala geschädigt, attackiert er Menschen, sogar Raubtiere. Diese Beobachtung ist ein wesentlicher Schritt zum Verständnis, weshalb Ackerman so ist, wie er ist.« Zitat Ende. Können Sie uns mehr über die Schädigungen von Ackermans Gehirn erzählen und wie sie sein Verhalten beeinflussen oder beeinträchtigen?
Kendrick: Ich will es versuchen. Wie bereits erwähnt, ist die Amygdala jener Teil des Gehirns, der die Angst steuert. Außerdem ist sie der Sitz einer Vielzahl weiterer primitiver Instinkte, die wir noch nicht vollständig verstehen. In einer Studie, die Forscher der University of Iowa in Current Biology veröffentlicht haben, ging es um eine Frau mit geschädigter Amygdala, die nicht die geringste Furcht empfand, sondern im Gegenteil von Aktivitäten und Situationen angezogen wurde, die äußerst gefährlich waren. Genauso ist es bei Ackerman. Sein Vater hat komplexe Eingriffe an der Amygdala seines Sohnes vorgenommen und chirurgisch jene Bereiche des Gehirns verstümmelt, in denen die Angst und die primitive Kampf-oder-Flucht-Reaktion entstehen.
Nelson: Dann ist Mr. Ackerman ein Mann ohne Furcht?
Kendrick: Meiner professionellen Einschätzung nach kann Ackerman das, was wir alle als Furcht bezeichnen, zwar nachempfinden, aber nicht auf gleiche Weise erfahren wie ein durchschnittlicher Mensch. Ganz im Gegenteil veranlasst die Schädigung seines Gehirns ihn immer wieder dazu, sich in Situationen zu begeben, die extreme Gefahren für ihn und andere heraufbeschwören. Oft führt er solche Situationen sogar ganz bewusst herbei.
Nelson: Trifft es zu, dass Mr. Ackerman unter »Schmerzsucht« leidet, wie Sie es auf Seite 3 der Anlage 15 bezeichnen?
Kendrick: Francis Ackermans steckbrieflich gesuchter Vater, von dem man allerdings annimmt, dass Ackerman selbst ihn getötet hat, muss ein wahres Ungeheuer gewesen sein. Er hat seinen Sohn jahrelang psychischer und physischer Folter schlimmster Sorte unterzogen. Er zwang ihn, die gleichen Situationen zu durchleben und die gleichen extremen Belastungen zu ertragen wie die schlimmsten bekannten Serienmörder der Geschichte. Er hat Francis als Versuchskaninchen benutzt, um seine eigene perverse Neugierde zu befriedigen. In der psychiatrischen Fachwelt ist es eine unbewiesene Annahme, dass Ackermans Vater als Teil seiner Experimente das Gehirn seines Sohnes mit voller Absicht und gezielt geschädigt hat. Aufgrund der unfassbaren Torturen, die Francis durchleiden musste, halte ich es für wahrscheinlich, dass sich bei ihm eine extreme Abweichung herausgebildet hat.
Nelson: Wie meinen Sie das?
Kendrick: Man könnte sagen, dass Ackerman sich nur dann lebendig fühlt, wenn er Schmerzen erlebt oder verursacht.
Nelson: Lassen Sie mich kurz rekapitulieren. Sie beschreiben Ackerman als einen Menschen ohne Furcht, als eine Person, die eine extreme Gefahr für sich und andere darstellt, schon aufgrund seiner Schmerzsucht, wie Sie es nennen. Obendrein liegt sein Intelligenzquotient fünf Punkte höher als der eines Genies wie Albert Einstein.
Kendrick: Das trifft zu.
Nelson: Aber Sie beschreiben ihn als vollkommen furchtloses, schmerzsüchtiges Genie, das eine extreme Gefahr für sich und andere darstellt. Weshalb sollte das Justizministerium angesichts dieser Tatsachen erlauben, dass Ackerman dem FBI überstellt wird?
Kendrick: Gewiss, Ackerman ist gefährlich, aber auch eine Waffe von einer Wirksamkeit, wie das FBI sie niemals angeboten bekam. Außerdem wurden Vorkehrungen getroffen, dass Mr. Ackerman im Fall eines völligen Kontrollverlusts eliminiert wird. Ich glaube aber aufrichtig, dass er ein Gewinn für das Bureau im Allgemeinen und Quantico im Besonderen sein wird. Das FBI sollte sich eine solche Chance nicht entgehen lassen.
ERSUCHENUMÜBERSTELLUNGDESFRANCISACKERMANJR. ZURVERHALTENSANALYSEEINHEITDESFBIINQUANTICO, VIRGINIA
Unter der Maßgabe strengster Geheimhaltung
Stattgegeben
Maria Nelson, Justizministerium der Vereinigten Staaten
PROLOG
Francis Ackerman jr. schlenderte durch das gut besuchte Restaurant wie ein Mann, der keine Sorgen kennt – trotz der Splitterhandgranate in seiner Jackentasche, die bei jedem Schritt mit leisem Klicken gegen das Springmesser schlug.
Er war froh, dass seine Zielperson des heutigen Abends zu der geschlossenen Gesellschaft im hinteren Teil des Restaurants gehörte, statt vorn im großen Speisesaal zu sitzen. Im Gianni’s Pizza & Italian Ristorante wimmelte es vor Kellnern, die Fettuccine und Spaghetti servierten, Steaks und einen undefinierbaren Weißfisch, bei dem Ackerman den Verdacht hatte, er stamme aus einem Pappkarton. In der Luft hing der Geruch nach Knoblauch, Parmesan und frischem Brot. Ackerman fragte sich, ob sich bald der metallische Geruch von Blut in diese Melange mischen würde.
Er trat auf einen der Ober zu, ein junger Mann mit langen braunen Haaren, die zu einem Dutt hochgesteckt waren, legte ihm eine Visitenkarte aufs Tablett und raunte ihm zu: »Sie oder Ihr Manager müssen den Detective anrufen, dessen Nummer auf der Karte hier steht.«
Der junge Mann machte ein verdutztes Gesicht. »Und was sollen wir ihm sagen?«
»Dass sich der gesuchte Killer im Gesellschaftsraum Ihres Restaurants aufhält.«
Der junge Ober musterte Ackerman verwirrt. »Weiß dieser Detective denn, von wem Sie reden?«
Ackerman zuckte mit den Schultern. »Sagen Sie ihm, es geht um den Kerl, der seinen Opfern bei lebendigem Leib die Augen herausschneidet und als Trophäen aufbewahrt.«
Der junge Ober wechselte die Farbe. »Mein Gott.«
»Oh nein, mein Freund.« Ackerman schüttelte den Kopf. »Gott hat nichts damit zu tun, eher schon die Gegenseite.«
»Also … also gut.« Der Ober schluckte schwer. »Was soll ich tun?«
»Nachdem Sie oder Ihr Chef mit dem Detective gesprochen haben, sollten Sie Ihre Gäste aus dem Lokal schaffen – so schnell wie möglich. Und bringen Sie auch die Belegschaft in Sicherheit.«
Der Kellner schürzte die Lippen. Seine Gesichtsmuskeln zuckten. Er kniff die Augen zusammen und musterte Ackerman, als wollte er ergründen, wie ernst es dem hart aussehenden Fremden war.
Ackerman wies mit einer Kopfbewegung auf die Tür zur Küche. »Da lang. Ich würde mich beeilen.«
Der Ober riss sich aus seiner Erstarrung und rannte in die Restaurantküche, wo er direkt auf den Manager zuhielt.
»Na also«, murmelte Ackerman und ging langsam weiter in einen anderen Teil des Restaurants, an einem Billardtisch und einer Reihe einarmiger Banditen vorbei. Dabei zog er mit links sein Bowiemesser mit dem Knochengriff aus der Scheide, die er im Kreuz trug, verbarg die Klinge hinter seinem Unterarm und schob das schwere Messer in die tiefe Tasche der schwarzen Lederjacke, die ihm sein Bruder Marcus vermacht hatte. Die andere Hand steckte er in die rechte Tasche der Jacke und schloss die Finger um die Splitterhandgranate.
Irgendwo im Hintergrund, vermischt mit den Geräuschen aus der Küche, dem Lärm der Kellner und dem Stimmengewirr der Gäste, hörte Ackerman die Stimme Patsy Clines:
I’m crazy for feeling so lonely
I’m crazy
Crazy for feeling so blue
Verrückt? Ackerman schmunzelte. Er war nie verrückt gewesen. Einsam? Vielleicht. Deprimiert? Ja, schon. Aber verrückt? Nein. Verrücktheit war eine Illusion. Im Grunde ging es nur um den Unterschied zwischen jenen Menschen, die sich an soziale Regeln hielten, und denen, die es nicht taten – so wie er, Francis Ackerman junior. Und so wie er wurden Menschen, die sich nicht regelkonform verhielten, von der Gesellschaft zu einer oft gnadenlosen Neuausrichtung gezwungen. Ackerman hatte diese Art der Umerziehung aus erster Hand erlebt, sowohl von der Geber- als auch der Nehmerseite. Er bevorzugte es, auf der Geberseite zu stehen.
Speziell bei einer Bestie wie Joseph Lowery, seiner Zielperson an diesem Abend.
Ackerman musste sich eingestehen, dass er die bevorstehende Begegnung in vollen Zügen genießen würde, obwohl er wusste, dass es in zivilisierter Umgebung als unschicklich galt, wenn man es genoss, anderen Schmerz zuzufügen. Einen Mann wie ihn, der süchtig danach war, physische und psychische Qual in all ihren Ausprägungen nicht nur zu erdulden, sondern auch auszuüben, brachten solche Konventionen immer wieder in die Zwickmühle.
Im Gesellschaftsraum des Restaurants herrschte Feierstimmung. Als Ackerman eintrat, bemerkte er einen Tisch voller Geschenkpakete, daneben einen zweiten mit einem Blechkuchen, auf dem erloschene Kerzen die Zahl 50 bildeten. Wachstränen waren an ihnen heruntergelaufen; vermutlich hatte das Geburtstagskind sie ausgepustet. Der Kuchen wartete noch darauf, zerschnitten und an die Gäste verteilt zu werden.
Aus einem anderen Lautsprecher in der Ecke des Gesellschaftszimmers erklang wieder Patsy Clines Stimme: Why do I let myself worry? Sorgen? Francis Ackerman jr. schüttelte den Kopf. Sorge war die Bettgenossin der Furcht. Er aber kannte keine Furcht – das Ergebnis der Manipulationen an seinem Gehirn, die sein Vater vorgenommen hatte.
Danke, Dad, ging es ihm durch den Kopf. Du verfluchtes Monster.
Nein, Ackerman kannte keine Sorgen. Wenn sich an diesem Abend jemand Sorgen machen musste, dann Joseph Lowery, dem es so unendlich viel Spaß machte, seinen Opfern mit einem scharfen Messer die Augäpfel herauszuschneiden.
Die Geburtstagsgäste im Gesellschaftsraum des Restaurants setzten sich vor allem aus älteren Semestern zusammen; es waren aber auch ein paar junge Männer dabei, darunter ein tätowierter Hüne, ein Ungetüm von einem Mann, der wie ein Profiwrestler aussah, sowie die beiden Söhne Lowerys.
In diesem Moment hob Lowery den Kopf und entdeckte Ackerman. Er riss die Augen auf, ehe ein Ausdruck greller Wut auf seinem Gesicht erschien.
Ackerman grinste und winkte ihm.
Lowery, der am heutigen Tag fünfzig wurde, hatte struppiges schwarzes Haar, in dem sich die ersten grauen Strähnen zeigten. Sein schmales Menjou-Bärtchen war sorgfältig gepflegt. Er war ein unscheinbarer Mann, klein und schmächtig. Vermutlich war das der Grund dafür, dass er seine Opfer zuerst mit einem Schrotgeschoss aus einer nichttödlichen Beanbag-Pistole kampfunfähig machte, um sie dann mit einer hohen Dosis Rohypnol zu betäuben, bevor er sich an seine blutige Arbeit machte.
Ackerman, die Hände noch immer in den Taschen der Lederjacke, die Finger um seine Waffen geschlossen, trat an den Kopf des Tisches, wo Lowery sein halb blutiges Steak zur Hälfte gegessen hatte. Der ältere Sohn des Geburtstagskindes, ein kräftiger Bursche Mitte zwanzig, beäugte Ackerman angriffslustig.
Ackerman hielt den Blick auf Lowery gerichtet und musterte das Gesicht des Mannes. »Schickes Bärtchen«, sagte er. »Sie sehen aus wie ein Eintänzer.«
Lowery schnappte nach Luft.
»Ihr Sprössling sitzt auf meinem Platz«, fuhr Ackerman fort und wies auf den jüngeren Sohn. »Er soll ihn räumen.«
»Was soll das?«, fuhr Lowery auf. »Haben Sie den Verstand verloren?«
»Wer ist der Typ, Dad?«, fragte sein jüngerer Sohn.
Lowery beachtete ihn gar nicht. »Ich hatte Ihnen und Ihrem blonden Kollegen doch schon gesagt, dass ich Ihnen bei den Ermittlungen nicht helfen kann. Und jetzt verschwinden Sie!«
Ackerman verdrehte die Augen und richtete seinen grauen Laserstrahlblick auf den Sohn. »Du sitzt auf meinem Platz, Junior. Du kannst vom Stuhl aufstehen, oder du kannst vom Stuhl fliegen. Also?«
Der Sohn grinste überheblich, legte die Hände auf das weiße Tischtuch und wollte sich hochstemmen – mit der offenkundigen Absicht, Ackerman aus dem Saal zu prügeln.
Noch ehe der Junge auf den Beinen war, bog Ackerman ihm den linken Arm auf den Rücken; dann drückte er den Oberkörper des Jungen nach hinten und schlug ihm die Handkante genau auf den Punkt zwischen Oberlippe und Nase. Lowery junior erschlaffte.
Ackerman zog ihn rückwärts vom Stuhl, wobei das Sitzmöbel polternd umfiel, drehte den Kopf des Jungen so, dass dieser auf den umgekippten Stuhl starrte, und holte ihn mit ein paar behutsamen Schlägen auf die Wangen aus der Bewusstlosigkeit. »Wer sitzt hier?«, fragte er.
Lowery junior erwies sich als gelehrig. »Sie …«, keuchte er.
»Na geht doch«, sagte Ackerman.
Alles war so schnell gegangen, dass Joseph Lowery und die Mitglieder seines Familienclans die Szene fassungslos verfolgt hatten.
»He, du Penner!« Der ältere Sohn des Geburtstagskindes, einen Kopf größer als sein jüngerer Bruder, riss sich als Erster aus der Erstarrung und trat vor.
»Lass es lieber.« Ackerman verstärkte wieder den Druck auf den Arm des Jungen. »Wenn du nicht artig bist, breche ich deinem Bruderherz den Arm. Anschließend bist du an der Reihe.« Seine Drohung erstickte weitere Interventionsversuche im Keim. Schließlich ließ er Lowery junior frei und trat einen Schritt zurück.
»Heb meinen Stuhl auf«, verlangte er von dem Jungen.
Lowery junior, zerknirscht und gedemütigt, wusste genau, dass er alles nur noch schlimmer machen würde, wenn er nicht gehorchte, also befolgte er Ackermans Befehl.
Nachdem der Stuhl wieder stand und an seinen Platz am Tisch zurückgeschoben worden war, wandte Ackerman sich wieder Lowery zu, der mit hochrotem Gesicht am Kopf der Tafel stand und Messer und Gabel mit den Fäusten umklammerte, als würde er Ackerman am liebsten zerteilen wie ein Steak.
Ackerman breitete die Arme aus und zeigte auf die Gäste. »Sind Sie sicher, dass Sie diese Geisterbahn dabeihaben wollen, Joe? Sie wollen doch nicht, dass die ganze Bande mit Ihnen zusammen zur Hölle fährt?«
Lowerys Gesicht lief noch röter an.
Ackerman ließ sich auf den Stuhl neben dem Geburtstagskind sinken und ergriff Messer und Gabel, die Lowery junior zurückgelassen hatte. Er schnitt ein Stück vom Steak ab und schob es sich in den Mund. Beim Kauen schloss er die Augen, genoss die Zartheit des Fleisches. »Ein bisschen zu sehr durch.« Er grinste Lowery an und raunte ihm zu: »Ich mag es gern blutig. Apropos blutig – wieso schneiden Sie Ihren Opfern die Augen raus? Ist es eine Botschaft an die Welt, dass man Sie niemals als den sehen wird, der Sie wirklich sind?«
Lowery erkannte, dass eine Konfrontation unausweichlich war. Er starrte seinen gedemütigten Sprössling an und presste hervor: »Schaff die Familie hier raus. Mach schon!«
Die Gäste rückten polternd die Stühle vom Tisch. Der ältere Lowery-Sprössling rief Ackerman zu. »Wir sehen uns noch, Dreckskerl!«
»Ich kann es kaum erwarten«, erwiderte Ackerman und aß seelenruhig ein weiteres Stück vom Rib-Eye-Steak, wobei er beobachtete, wie die Lowery-Sippe widerwillig abrückte. »Eine hübsch-hässliche Clique haben Sie«, sagt er kauend zu Lowery. »Da vergeht einem glatt der Appetit. Apropos – soll ich Ihnen mal was verraten? Ich hatte daran gedacht, auf Vegetarier umzusatteln, aber Steaks wie das hier rufen mir die Freuden der karnivoren Lebensweise in Erinnerung.«
Lowery funkelte Ackerman hasserfüllt an. »Das kostet Sie Ihre Dienstmarke!«
Ackerman lachte auf. »Dienstmarke? Für wen halten Sie mich? Ich bin kein Detective, kein Cop, kein Bundesagent – ich bin nicht mal Staatsbediensteter. Ich bin Freiberufler. Ein Spezialist aus der Welt der Schmerzen und Albträume, in die Sie gleich geraten werden. Sie können Ihre Haut nur dadurch retten, indem Sie mir sagen, wo sich Agent Westlake befindet.«
Der Anflug eines Lächelns erschien auf Lowerys Gesicht. Ackerman sah die Augen des Mannes boshaft funkeln, als Westlakes Name fiel. »Sie meinen den blonden jungen Kerl, der Sie begleitet hat, als Sie mich in meinem Büro aufgesucht haben? Ich habe keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Es ist mir auch egal, für wen Sie sich halten oder was Sie mir unterstellen. Ich bin Anwalt. Ich werde Sie vor Gericht zerren, Mister!«
Ackerman schnitt ein weiteres Stück vom Steak ab. »Ich habe Ihre Sammlung gefunden.«
Lowery spielte den Verwirrten. »Welche Sammlung?«
»Die Augen. Ihre Trophäen. In dem versteckten Minikühlschrank mit dem Vorhängeschloss, in dem Sie Ihre Kostbarkeiten aufbewahren. Nun ja, jeder braucht ein Hobby. Manche Leute singen im Kirchenchor.«
»Ich weiß nicht, was Sie da reden! Selbst wenn ich so etwas Ekelhaftes hätte – Ihnen fehlt eine gerichtliche Vollmacht, mein Eigentum zu …«
Er verstummte, als Ackerman Messer und Gabel laut klirrend auf den Teller fallen ließ. »Bei dem Gefasel vergeht mir der Appetit. Sie führen sich auf, als wäre ich irgendein Officer, der Sie verhaften will, oder ein drittklassiger Staatsanwalt, den Sie aufs Kreuz legen können. Aber ich bin nichts dergleichen.«
»Sondern?«, fragte Lowery höhnisch.
»Nennen Sie es eine höhere Gewalt. Ein Erdbeben, gegen das kein Kraut gewachsen ist, erst recht kein Worteverdrehen, wie ihr Anwälte es so gut draufhabt. Tja, mein Freund, Sie bekommen gleich den Arschtritt des Jahrhunderts – noch ehe Sie mit Ihrer kleinen Geburtstagsüberraschung für Bombenstimmung sorgen können.«
Ackerman sah, wie der Killer erbleichte, als ihm klar wurde, dass der hart aussehende, narbige Mann sein Ass im Ärmel kannte.
»Ah!« Ackerman lächelte. »Wie ich sehe, haben sogar Sie es begriffen. Ja, Kumpel, ich habe Ihr Bombenbaumaterial entdeckt. Wenn ich es richtig sehe, haben Sie sich aus Apex und Lagerkugeln eine Art Selbstmordattentäterweste gebastelt. Wie nett. War die Weste eine letzte Rettung für den Fall, dass Sie in die Ecke gedrängt werden? Oder hatten Sie von vornherein die Absicht, diese Party mit einem Big Bang abzuschließen und Ihren Kadaver hier im Saal zu verteilen?«
»Was faseln Sie da?«
Ackerman streckte die Hand nach Lowery aus. »Schauen wir doch einfach mal unter Ihr Jackett.«
Lowery wich zurück, riss die linke Hand hoch und ließ den Zünder seiner Sprengstoffweste sichtbar werden. Es war ein Druckschalter für den Daumen mit einem Kabel, das den Ärmel hinauf zur Sprengladung führte. Eine primitive, aber effektive Konstruktion, direkt aus dem Handbuch eines Terroristen oder Anarchisten.
Ackerman kicherte. »Todschick. Trägt man das jetzt in Anwaltskreisen?«
Lowery versuchte gar nicht mehr, das Raubtier in seinem Inneren zurückzuhalten. Er leckte sich die Lippen, lächelte verzerrt. »Tja, Mister, wie es aussieht, sind Sie mein letztes Opfer.«
Er schloss die Augen, breitete die Arme aus und drückte triumphierend auf den Knopf, der seine Selbstmordweste zündete.
Ackerman schaute seelenruhig zu. Seine Aufmerksamkeit galt allerdings eher der Frage, ob Lowerys Rib-Eye blutiger war als das seines Sohnes. Schließlich gab er der Versuchung nach, ergriff Messer und Gabel und machte sich über das Stück Fleisch her. Ackerman hörte, wie Lowery fassungslos nach Luft schnappte.
»Klappt was nicht?«, fragte er zwischen zwei Bissen.
Ein paar Sekunden verstrichen, ehe Lowery die Augen aufriss und Ackerman mit einem beinahe lächerlichen Ausdruck der Verwirrung anstarrte.
Ackerman, einen Bissen Fleisch zwischen den Zähnen, fragte kauend: »Kann ich vielleicht helfen?«
Lowerys Blick zuckte zwischen Weste und Zünder hin und her. »Ich … ich verstehe das nicht!«
»Glaubst du ernsthaft, Kumpel, ich hätte dir gestattet, mit einem solchen Ding um den Bauch ein voll besetztes Restaurant zu betreten? Man stelle sich vor, deine flambierten Überreste wären auf den Tellern der Gäste gelandet. Bon appetit.«
»Aber wie …« Lowery starrte ihn fassungslos an.
»Ich habe heute Morgen deine Witterung aufgenommen. Seitdem folge ich dir. Als du unter der Dusche gestanden hast, habe ich deine hübsche Sammlung und deine Werkstatt entdeckt. Von da an war es ein Leichtes, deine Sprengstoffweste unbrauchbar zu machen und deinen Plan den Bach runtergehen zu lassen. Du hast ins Klo gegriffen, Kumpel.«
Lowerys Hand verschwand in einer Tasche seines Jacketts und kam mit einem schwarzen Colt 1911 wieder zum Vorschein. Triumphierend richtete er die Waffe auf Ackerman. Er sagte nichts, drohte nicht, verzog keine Miene. Er drückte nur mehrmals rasch hintereinander den Abzug.
Klick. Klick. Klick.
Nichts geschah.
»Netter Versuch.« Ackerman schob sich einen weiteren Bissen in den Mund. »Aber ohne Schlagbolzen wird das nichts. Hör zu, Mann, es wird leichter für dich, wenn du meine Überlegenheit anerkennst. Ich bin dir zehn Schritte voraus. Ich weiß, dass du dich als erfinderisches Individuum betrachtest, nachdem du deine dunklen Sehnsüchte so viele Jahre lang unbemerkt befriedigen und dich unter den Normalos verbergen konntest. Du bist zweifellos schlau genug, um ein paar Detectives zu überlisten, aber du musst endlich einsehen, dass ich auf einem Niveau arbeite, das du nicht mal ansatzweise erfassen kannst. Also sei so nett und sag mir, wo Agent Westlake steckt, dann kommst du vielleicht mit heiler Haut davon.«
Lowery starrte ihn hämisch an. »Sie kommen zu spät!«
Ackerman schüttelte den Kopf. »Dass die Leute mir immer sagen, ich käme zu spät! Okay, was Westlake angeht – welches Schicksal ihn auch ereilt hat, er verdankt es dem Umstand, dass er kein Vertrauen in meinen Rat und meine Fähigkeiten hatte und stattdessen auf eigene Faust losgezogen ist. Auf der anderen Seite bin ich entschlossen, die Unantastbarkeit des Lebens zu schützen, selbst wenn es um das Leben arroganter junger FBI-Schnösel geht. Also, wo steckt der Junge?«
Auf Lowerys Gesicht erschien ein süffisantes Lächeln. Er lehnte sich zurück, verschränkte die Arme vor der Brust. Der Ausdruck arroganter Selbstsicherheit auf dem Gesicht des Killers sprach Bände.
In diesem Moment erkannte Ackerman die bittere Wahrheit. Westlake war tot und hatte vermutlich auch seine Augen schon eingebüßt.
Verdammt, Westlake, du dummer Junge. Warum hast du auf eigene Faust gehandelt, statt auf mich zu hören?
»Sie haben begriffen, wie ich sehe«, höhnte Lowery.
Ackerman zuckte kaum merklich die Achseln, obwohl er den Wunsch verspürte, den Killer für alle diese Unannehmlichkeiten zur Rechenschaft zu ziehen. Doch er hatte nicht die Absicht, gegen Sitte und Anstand zu verstoßen, indem er Lowery hier im Restaurant in Stücke schnitt.
In diesem Moment flog die Tür auf der gegenüberliegenden Seite des Saales krachend auf. Der ältere Sohn Lowerys und der hünenhafte, tätowierte Mann, der wie ein Wrestler aussah, kamen zum Tisch gestürmt, die Waffen im Anschlag.
»Leg ihn um!«, brüllte der ältere Lowery-Sohn.
Einem normalen Mann wäre in diesen Augenblicken Adrenalin in die Adern geschossen. Atmung und Pulsfrequenz hätten sich beschleunigt. Nicht so bei Ackerman. Was das anging, war er kein normaler Mann.
Ohne Vorwarnung rissen Lowery junior und der Wrestler ihre Waffen hoch und feuerten, bis die Magazine leer waren. Die Schüsse wetterten überlaut durch den leeren Saal.
Aber ihr Gegner war längst nicht mehr dort, wo er Sekundenbruchteile zuvor noch gestanden hatte.
Lowery junior schrie gellend, als Ackerman so schnell und lautlos wie ein Schatten heranglitt und ihm zwischen die Beine trat. Juniors Waffe flog durch die Luft. Er ging in die Knie, die rechte Hand auf seine Weichteile gepresst, und wälzte sich wimmernd am Boden.
»Jetzt bist du dran, Hurensohn!« Der Wrestler duckte sich und breitete die Arme aus wie ein Sumoringer.
Okay, dachte Ackerman. Dann zeig mal, was du draufhast, Godzilla.
Wie ein Stier stürmte der tätowierte Riese heran, die muskulösen Arme weit ausgebreitet, doch Ackerman wich ihm geschmeidig aus und schlug aus der Drehung heraus zu. Die Faust traf den Hünen mitten ins Gesicht, ein präziser Schlag genau auf die Nase. Aber der Koloss war hart im Nehmen. Er schüttelte seinen massigen Schädel, um die Benommenheit loszuwerden, und ging sofort wieder brüllend auf Ackerman los. Diesmal gelang es ihm, die muskelbepackten Arme um die Hüften des Gegners zu schlingen. Offenbar hatte er die Absicht, seinen Widersacher zu erdrücken. Ackerman drosch ihm kurzerhand die flachen Hände auf die Ohren. Der Riese schrie auf, löste seine Umklammerung und ging taumelnd zu Boden. Ackerman drückte den Kopf des Wrestlers herunter, schmetterte ihm die Handkante in den Stiernacken, riss das rechte Knie hoch und rammte es dem Gegner ans Kinn, was diesen mehrere Zähne kostete, ehe die Wucht des Kniestoßes ihn auf den Rücken schleuderte. Ackerman beugte sich über ihn und versetzte ihm einen präzisen Schlag an die Schläfe. Der Wrestler zuckte und lag dann still.
Ackerman drehte sich um.
Sein Atem ging kein bisschen schneller. Es schien ihn nicht die geringste Anstrengung gekostet zu haben, die beiden Gegner auszuschalten.
»Ach ja.« Er grinste. »Du bist ja auch noch da!«
Vor ihm stand Lowery.
Hass loderte in den Augen des Mannes. Seine Hände zitterten, als er versuchte, die Waffe seines Sohnes, die er vom Boden aufgeklaubt hatte, mit Patronen nachzuladen, die er aus den Tiefen seines Jacketts zum Vorschein brachte.
Er war nicht schnell genug – bei Weitem nicht. Ackerman war mit zwei gleitenden Schritten bei ihm und schmetterte ihm den Ellbogen in den Rücken. Lowery brüllte vor Wut und Schmerz, wankte zurück und versuchte, in seinem wilden Hass mit einer Faust nach dem Gegner zu schlagen. Ackerman fing die vorschnellende Faust lässig ab. Mit einem kräftigen Ruck verdrehte er Lowerys Gelenk und drückte die Finger des Killers nach hinten. Der Knochen barst krachend und drang durch Fleisch und Haut. Sofort riss Ackerman den Arm des Gegners herum und stieß ihm den bleichen Knochen, der aus der Wunde ragte, in den Unterleib.
Lowery kreischte schrill.
Ackerman sagte kalt: »Deine Opfer haben auch so geschrien, jede Wette. Auge um Auge, Kumpel.«
Ein wuchtiger Schlag auf Lowerys Waffe, und sie flog davon und landete klirrend in den Weiten des Saales. Ackerman packte den Unterarm des Gegners und stieß das Knie gegen Lowerys Ellbogen. Wieder krachte es laut, als der Knochen brach. Wimmernd vor Schmerz sank der Killer auf die Knie. Blut lief ihm übers Gesicht.
Ackerman krallte die Faust in das struppige schwarze Haar des Mannes und zog ihn hoch. »Gehen wir. Die Party ist zu Ende.«
»Ich kann nicht gehen!«
»Ist mir scheißegal.«
»Aber …«
»Komm, beweg deinen Hintern.« Ackerman zerrte den besiegten Gegner aus dem Saal und zückte mit der freien Hand sein Mobiltelefon.
»Ja?«, meldete sich eine harte Männerstimme.
»Ich bin’s«, sagte Ackerman. »Schickt ein Aufräumkommando zu Gianni’s Pizza.«
»Was ist mit Lowery?«
»Mr. Lowery hat soeben seine Anwaltskarriere an den Nagel gehängt.« Ackerman lachte auf. »Er war sowieso ein drittklassiger Winkeladvokat.«
1
Calvin Twitty war auf einer Farm knapp außerhalb von Roswell in New Mexico geboren und aufgewachsen.
Seit drei Generationen baute seine Familie Chilischoten und Luzernen an. Wer die Gegend besuchte, bemerkte beim Anflug auf das Roswell International Air Center, dem wichtigsten Verkehrsflughafen in New Mexico, oft eigenartige Gebilde in den Feldern, die als »Kornkreise« bezeichnet wurden. Jedes Mal, wenn Calvin von Touristen oder von Leuten, die auf Google Earth »Skysurfing« betrieben, einen Kommentar über diese merkwürdigen Gebilde hörte, musste er lachen. Schließlich hatte Calvin fast sein ganzes Leben neben einem dieser Kornkreise verbracht, und niemals war dem Gebilde etwas Geheimnisvolles oder auch nur Interessantes entstiegen.
Die Neuankömmlinge kannten Roswell eben nicht und auch nicht Wind und Wetter im Südwesten der USA. Die kreisrunden Muster in den Kornfeldern waren im Wüstenklima vollkommen normal, also auch hier. Statt die Äcker quadratisch anzulegen und das Muster der Feldwege wiederzugeben, wie überall sonst, wurde hier die Kreisform verwendet, und zwar aus Gründen der Bewässerung: Die Wasserversorgung erfolgte von einer zentralen Nabe entlang der Speichen eines Rades, und genau darum waren die Äcker kreisförmig. Folglich wuchsen auch die Feldpflanzen – in der Gegend um Roswell meist Chilischoten und Luzernen – im Kreis, weil die Ecken eines Quadrats nicht mit Wasser versorgt worden wären. Calvin konnte sich gut vorstellen, wie fremdartig es Leuten erscheinen musste, die sich Roswell aus der Luft näherten, einer Stadt, die für das Geheimnisvolle berühmt war.
Auf längere Sicht aber würde es ohnehin keine Rolle mehr spielen, welche Form die Felder hatten. Den großen Konzernen war es gleichgültig – und es würde nicht mehr lange dauern, bis ihnen jede Farm in Roswell, in New Mexico, ja im ganzen verdammten Land gehörte. Alte Familienbetriebe gingen den Bach runter. Farmer in zweiter Generation, sogar noch länger ansässige Farmer wie die Twittys, würden bald der Vergangenheit angehören. Jeder, der nicht verkaufen oder sich einer Genossenschaft anschließen wollte, musste früher oder später aufgeben. Viele Läden und Handwerksbetriebe in der Gegend saßen im selben Boot wie die Farmer. Die einzige Möglichkeit, zu überleben und Geld zu verdienen, bestand darin, sich zusammenzuschließen.
Doch Calvin Twitty gehörte nicht zu denen, die sich mit jemandem zusammenschließen und Teil eines Konzernschwarmbewusstseins mit Besprechungssälen und Verhaltensregeln wurden. Das war nie seine Welt gewesen. Calvin zog es vor, auf seinem Motorrad mit hundertsechzig Sachen über einsame Highways zu brettern, ohne ein Auto weit und breit, und den Wind im Gesicht zu spüren. Früher hatte ihm ein kleiner Motorradladen in Roswell gehört, und er hatte in der Stadt gewohnt – damals, nach dem Tod seiner Eltern. Zu der Zeit war Calvin noch verheiratet gewesen und hatte geglaubt, in näherer Zukunft eine Familie zu haben. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit ihm gehabt.
Als Kind war ihm das Leben auf der Farm verhasst gewesen; es war ihm wie ein Triumph erschienen, als er sein eigenes Geschäft gegründet hatte und in die Stadt gezogen war. Umso schlimmer hatte es ihn getroffen, als seine Träume sich wie Rauch im Wind verflüchtigten. Anfangs lief es mit dem Motorradgeschäft ganz gut; dann aber sprachen ihn die Bosse eines in der Gegend ansässigen Motorradclubs an – eine Clique, die in Calvins Augen kaum besser war als eine Verbrechergang. Aber es hatte nicht an den skrupellosen Mitgliedern des Motorradclubs gelegen, dass Calvin die Biker abgewiesen hatte, sondern daran, dass die großen Motorradclubs im Grunde nichts anderes waren als Unternehmen – Firmen, die außerhalb des Gesetzes standen. Aber auch sie hatten Besprechungsräume, Hierarchien und Geschäftsordnungen wie beim organisierten Verbrechen.
Das Verbrechen selbst allerdings störte Calvin nicht. Er stieß sich an der Organisation und der damit verbundenen Notwendigkeit, sich in eine festgefügte, hierarchische Struktur einfügen zu müssen. Das war nicht sein Ding.
Leider hatte es Calvins Träumen den Todesstoß versetzt, als er den Rockern eine Abfuhr erteilte. Er musste Konkurs anmelden und den Motorradladen schließen, als die Biker ihn mieden und seine Geschäfte den Bach runtergingen. Obendrein stellte sich nun heraus, dass seine Frau mehr wegen des Geldes als der Liebe wegen bei ihm gewesen war. Zusammen mit seiner letzten Barschaft verschwand sie aus seinem Haus und seinem Leben.
Und als wäre das alles noch nicht genug, hatte Calvin sich eine Herde von einem Dutzend Ziegen gekauft. Jemand hatte ihm gesagt, die Milch dieser Tiere sei so gut wie Kuhmilch, und in Anbetracht der begrenzten Mittel Calvins hatte das gar nicht so schlecht geklungen. Außerdem, so der Verkäufer, eigneten Ziegen sich gut dafür, das Unkraut und die hartnäckigen Steppensträucher auf natürlichem Weg zu beseitigen und obendrein als Futter zu verwerten. Calvin brachte seine Ziegen, die er laut, hässlich und nervtötend fand, neben der Scheune unter, die nur einen Steinwurf weit vom Haus entfernt war. Sie bot Platz für seinen Traktor, ein paar andere Maschinen und eine Werkbank. Ein kleiner Anbau beherbergte die Ziegen, ein paar Kaninchen und ein Gänsepaar.
An diesem Abend stellte er überrascht fest, wie früh es jetzt schon wieder dunkel wurde. Er hörte die Ziegen in ihrem Pferch rumoren und verzog das Gesicht. Die Viecher kosteten ihn nur Zeit, Geld und Nerven.
Neben Calvin trottete Silas über den hartgebackenen Boden, der Golden Retriever. Verwundert sah Calvin, wie der Hund plötzlich die Zähne bleckte und das Fell sträubte.
»Was ist, Alter?«, fragte Calvin, der noch nie erlebt hatte, dass Silas sich so verhielt, nicht einmal, wenn ein Kojote oder ein anderes Raubtier in der Nähe war. Fürchtete der Hund sich vor irgendetwas?
In diesem Augenblick hörte Calvin das Geräusch. Aus dem Luzernenfeld drang ein leises Surren. Wegen der zunehmenden Dunkelheit, die nur vom Licht des Mondes aufgehellt wurde, konnte Calvin kaum etwas sehen, aber die seltsamen Geräusche waren nicht zu überhören.
Silas knurrte bedrohlich.
»Ruhig, Alter«, sagte Calvin, näherte sich dem Kornfeld mit langsamen Schritten und versuchte angestrengt, im silbrigen Mondlicht, das auf den wogenden Luzernen schimmerte, etwas zu erkennen. Nachdem seine Augen sich besser an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah er verdutzt, wie über einem Teil des Feldes Nebelschwaden aufstiegen. Oder war es Rauch?
Ein Schwelbrand?
Calvin unterdrückte einen Fluch, biss die Zähne zusammen und ballte die Fäuste. Das Bewässerungssystem musste eine Störung haben. Noch eine Panne, die er sofort beheben musste, damit sie ihn nicht einen Haufen Geld kostete, das er nicht besaß. Ein weiterer Tritt in den Hintern, den das Leben ihm versetzte.
Leise fluchend stapfte Calvin zu dem kleinen Ranchhaus zurück, in dem er aufgewachsen war, und riss die Tür des Abstellraums auf. Wütend schnappte er sich eine Taschenlampe und die alte doppelläufige 12er-Flinte seines Vaters. Silas hielt sich die ganze Zeit dicht an Calvins Seite, winselte leise und schaute immer wieder zu ihm hoch, als wollte er ihn vor irgendetwas warnen.
Doch Calvin hatte nicht die Absicht, aufgrund eines Lecks der Bewässerungsanlage das bisschen Geld zu verlieren, das ihm geblieben war. Er ging in die Hocke, tätschelte dem Hund den Kopf und kraulte ihn hinter den Ohren. »Ich weiß, Silas«, sagte er leise. »Wir wohnen hier am Arsch der Welt und sind auf uns allein gestellt.«
Calvin hatte es immer gehasst, auf dem Land aufzuwachsen. Die Abgeschiedenheit, die Isolation und der Gedanke, dass der nächste Nachbar meilenweit entfernt war, trugen nicht gerade zur Beruhigung bei. Sicher, man konnte die Polizei rufen, aber wer konnte schon sagen, wann sie kam? Als Junge hatte sich Calvin oft in den bedrückend stillen, stockdunklen Nächten gefürchtet; immer wenn er Geräusche hörte oder irgendwelche Lichterscheinungen zu sehen glaubte, hatte er an die Gruselgeschichten über die Aliens von Roswell gedacht, die man sich erzählte.
Andererseits hatte er nie ein Ufo zu Gesicht bekommen.
Die Spukgeschichte jedoch, die Calvin als Jungen am meisten geängstigt hatte, kannte er von einem Onkel – einem unglückseligen Mann, der später dem Alkohol verfallen war und von dem Calvin jahrelang nichts mehr gehört hatte. Doch ehe der Mann zum Säufer geworden war, hatte er seinem Neffen jene Geschichte erzählt, die für den jungen Calvin die Welt auf den Kopf gestellt hatte.
Eines Nachts war Calvins Onkel mit Freunden unterwegs gewesen, um Kojoten zu schießen, als über der Jagdgesellschaft plötzlich ein grelles Licht erstrahlte. Die anderen Männer flohen zurück zum Pick-up, mit dem sie hierher in die Einsamkeit gekommen waren. Calvins Onkel jedoch lief nicht davon. Er versteckte sich in einem Dornbusch, um zu beobachten, was vor sich ging. Eine Sekunde später hatte ihn der Lichtstrahl gepackt und vom Boden hochgerissen.
Und dann …
Calvin schauderte und versuchte, nicht an die grässlichen Details zu denken. Es waren Abscheulichkeiten, die er auch aus anderen Geschichten kannte, Geschichten von grauhäutigen Außerirdischen mit toten schwarzen Augen, von Telepathie, von schmerzhaften Experimenten, von blutigen Sektionen und Sondierungen am lebenden Körper. Seltsamerweise berichteten andere angeblich Entführte aus allen Teilen der Welt das Gleiche wie das, was Calvin damals von seinem Onkel erfuhr.
Nachdem er die Geschichte als Junge zum ersten Mal gehört hatte, konnte er monatelang nicht schlafen. Aber jetzt war er ein Mann. Er hatte keine Zeit, sich unter dem Bett zu verstecken. Er musste sein Eigentum verteidigen und seinen Lebensunterhalt verdienen.
Calvin prüfte die beiden Patronen in der Flinte, tätschelte Silas ein letztes Mal und stapfte zu dem Feld zurück, in der einen Hand die Taschenlampe, in der anderen die Waffe.
Silas hielt sich an der Seite, immer noch ängstlich winselnd.
Als Calvin den Rand des Feldes erreichte, sah er hoch und stutzte. Der Himmel wirkte auf seltsame Weise heller, und die Umgebung leuchtete geisterhaft, als hätte sich eine Wolkenlücke gebildet, die das gesamte Licht des Mondes durchließ.
In diesem Moment machte Calvin eine Entdeckung. Er war sich nicht ganz sicher, was es war, aber es sah aus wie ein dunkler Fleck vor dem Hintergrund des seltsam leuchtenden Himmels. Als schwebte dort ein Schwarzes Loch aus den Tiefen des Universums über dem Acker.
Calvin kniff die Augen zusammen.
Ja, da war etwas. Irgendetwas, das sich ruckartig am Himmel zu bewegen schien.
Eine Sekunde später sah er es ganz deutlich.
Bewegungslos schwebte ein untertassenförmiges Objekt hoch über seinem Acker in der Luft.
In diesem Augenblick waren Calvins Kindheitsängste wahr geworden.
Mit einem Mal zitterten ihm die Knie. Am ganzen Körper brach ihm kalter Schweiß aus. Weg hier!, schrie es in ihm, doch er konnte sich vor Entsetzen nicht vom Fleck rühren.
Im nächsten Moment übernahm der kühle, von der Vernunft geprägte Teil seines Verstandes das Kommando.
Du Schwachkopf, rief ihm eine innere Stimme zu. Nur weil du glaubst, am Himmel einen Schatten gesehen zu haben, bedeutete das noch lange nicht, dass sich ein Sternenschiff voller kleiner grauer Aliens plötzlich für deine Luzernen interessiert.
Dennoch beschloss Calvin, nachdem er sich aus seiner Starre gelöst hatte, auf dem Weg zum Bewässerungssystem einen Bogen zu schlagen, der sich nicht mit dem merkwürdigen Schatten am Himmel kreuzte. Nur zur Sicherheit.
Calvin wusste nicht, dass der wahre Schrecken ihm erst noch bevorstand.
Er blickte zur Nabe des Bewässerungssystems und setzte sich langsam in Bewegung. Dank des Mondlichts und des aufgehellten Himmels konnte er auf die Taschenlampe weitgehend verzichten.
Er war vielleicht zwanzig Meter weit gekommen, als er einen merkwürdigen Laut hörte, der Silas ein tiefes, leises Grollen entlockte. Das Geräusch erinnerte Calvin an das Brutzeln von bratendem Speck oder an das Prasseln, wenn im Nebenzimmer jemand unter der Dusche stand.
Er schloss die Augen, lauschte und versuchte, sich darüber klar zu werden, was er wegen des Geräuschs unternehmen sollte, als ihm der Geruch in die Nase stieg. Es war ein Gestank wie der, wenn jemand Popcorn zu heiß werden ließ und die Maiskörner verbrannten.
War es wieder diese Ufo-Erscheinung?
Die Flinte fest im Griff, nahm Calvin allen Mut zusammen und schaute zum Himmel in der Erwartung, dort wieder den untertassenförmigen Schatten zu sehen.
Zu Calvins unendlicher Erleichterung war der Schatten verschwunden. Die Anomalie am Nachthimmel hatte entweder nie existiert oder sich wie eine Rauchwolke verzogen.
Siehst du?, sagte sich Calvin. Alles nur Einbildung.
Erleichtert atmete er auf.
In diesem Moment geschah es. Silas bellte wie verrückt und rannte los, flitzte in das Luzernenfeld und hielt schnurstracks auf die Stelle zu, über der die untertassenförmige Silhouette geschwebt hatte.
Calvin rief den Hund zurück, doch Silas hörte nicht auf ihn.
Die Flinte in der linken Armbeuge, den rechten Zeigefinger über dem Abzug, folgte Calvin dem Hund durch die fast hüfthoch stehenden Luzernen. Wäre es ein Maisfeld gewesen, hätte er den Hund nicht sehen können und wäre praktisch blind gewesen. Im Luzernenfeld hingegen konnte er im Mondlicht mehr als fünfzig Meter einsehen. Er beobachtete, wie Silas abrupt innehielt, als er eine Lücke zwischen den dicht stehenden Luzernen erreichte.
Was ist das?
Calvin schlug das Herz bis zum Hals, als er beim Näherkommen einen kreisrunden Abdruck inmitten der Pflanzen entdeckte. Dann wurde ihm klar, dass es sich um ein kompliziertes Muster handelte, das sich nur aus der Luft erkennen ließ. Calvin kannte solche Kornkreise; es gab sie überall auf der Welt, besonders in Großbritannien. Sie waren auch hier, im Südwesten der USA, nicht unbekannt, aber sehr viel seltener, was mit der Art der Feldfrüchte zu tun hatte.
Dennoch konnte Calvin Twitty jetzt nicht mehr behaupten, es gäbe keine Außerirdischen.
Nicht, nachdem eine Gruppe von Aliens ihm gerade ihre Unterschrift mitten aufs Luzernenfeld gesetzt hatte.
Als er sich der Stelle näherte, an der die Pflanzen umgeknickt waren, bemerkte er noch etwas und schauderte vor Entsetzen: Mitten im Kornkreis hatten die Besucher die verkohlten Überreste eines Menschen zurückgelassen. Der Leichnam rauchte noch. Calvin musste an das Geräusch von bratendem Speck denken, das er vorhin gehört hatte, und hätte sich beinahe übergeben.
Silas war zum Glück nicht weitergelaufen. Offenbar hatte er mit dem Instinkt des Tieres gespürt, dass inmitten der umgeknickten Pflanzen etwas Grauenhaftes lauerte.
Calvin wich von dem Kreis zurück. Er hatte genug gesehen. Außerdem wollte er keine Spuren zerstören. Und mehr als alles andere wollte er rein gar nichts mit der Sache zu tun haben. Er dachte an die rauchenden menschlichen Überreste, an den Gestank des verkohlten Leichnams.
Diesmal schaffte er es nicht, die Übelkeit niederzukämpfen.
Er beugte sich vor und erbrach sich.
2
Der strömende Regen hinter den Fensterscheiben des geliehenen VW Beetle passte zu Nadias Stimmung.
Nadia Shirazi hatte einen Aufpreis bezahlt, damit sie in dem Cabrio von New York nach Virginia fahren konnte – geradewegs von der Cybercrime Division des FBI, der sie angehörte, zu einem Geheimtreffen in Quantico, am Sitz der FBI-Akademie.
Nadia hatte gehofft, mit dem Cabrio die Herbstluft des Indian Summer und den Anblick des leuchtend gelben und roten Laubes genießen zu können. Im Iran, ihrem Heimatland, galten Bäume als heilig, und sie hatte sich den stillen Riesen stets verbunden gefühlt. Doch statt aus den dunklen Büros von Cybercrime, in denen IT-Spezialisten gegen die um sich greifende Internetkriminalität kämpften, in die Schönheit der Natur zu entkommen, war Nadia mit weißen Knöcheln am Lenkrad bei Sichtweite null durch ein Unwetter gefahren. Und als wäre das nicht schlimm genug, trommelte der Regen so laut auf das Faltdach des Cabrios, dass sie keinen klaren Gedanken fassen oder auch nur Radio hören konnte.
Nach drei Stunden hatte sie endlich ihr Ziel erreicht. Quantico, Virginia. Sitz der FBI-Akademie und der Behavioral Analysis Unit, kurz BAU, der fast schon legendären Verhaltensanalyseabteilung des FBI, deren genaue Lage nicht bekanntgegeben wurde.
Nadia hätte die Einladung als Streich und Zeitverschwendung betrachtet, wäre sie ihr nicht vom Chef bei Cybercrime persönlich überreicht worden. Nadias Anweisung lautete, an einem Seiteneingang der FBI-Akademie zu warten – vor einer Tür, die sonst ausschließlich von Lieferanten benutzt zu werden schien. Um Punkt drei Uhr früh sollte sie sich vor dieser Tür einfinden und auf weitere Anweisungen warten.
Was hat das zu bedeuten?, fragte sie sich. Ist vielleicht die Chance gekommen, auf die ich gewartet habe?
Vielleicht wurde sie in die Verhaltensanalyseabteilung versetzt, um eine echte Profilerin zu werden. Schließlich war das der Grund gewesen, weshalb sie überhaupt zum FBI gegangen war. Die erforderliche Qualifikation besaß Nadia. Sie hatte einen Master in Psychologie; ihre Abschlussarbeit befasste sich mit einem der berüchtigtsten Serienmörder der Welt.
Francis Ackerman junior.
Vielleicht stand ihr großer Durchbruch bevor. Sie hätte zufrieden, ja glücklich sein sollen, aber irgendetwas stimmte an der Sache nicht. Und das hatte nichts mit Nebensächlichkeiten zu tun wie der, dass sie sich eine Stunde lang die Haare gemacht hatte und nun gezwungen war, im strömenden Regen zu stehen.
Nein, es war irgendetwas anderes, das Nadia ein ungutes Gefühl vermittelte. Etwas, das sie nicht greifen konnte.
Sie hatte an einer Stelle geparkt, von der aus sie den Seiteneingang beobachten konnte. Nun beobachtete sie, wie die anderen Bewerber sich um Punkt drei Uhr anstellten. Sie selbst wollte warten, bis die Tür sich öffnete, um dann am Ende der Schlange ohne lange Wartezeit ins Gebäude zu gelangen. Doch als die Zeit verging, fragte sie sich, ob sich die Tür vielleicht erst dann öffnete, wenn sämtliche Bewerber anstanden. Gehörte das zum Auswahlverfahren? War es eine Art Test?
Um 3.10 Uhr gab sie nach und stellte sich zu den anderen in den Regen.
Genau fünf Minuten später traten zwei Männer aus dem Seiteneingang. Der eine war ein kleiner, bebrillter Typ im Trainingsanzug eines Akademieschülers. Der andere trug eine dunkle Tarnhose und ein enges, langärmeliges schwarzes Shirt aus einem Dri-Fit-Material. Er war groß, geschmeidig und auf raue Art attraktiv. Er erinnerte Nadia an die Actionfiguren von Masters of the Universe, mit denen ihr Bruder Jahangir gegen den Wunsch ihres Vaters gespielt hatte – damals, als sie noch Kinder in Maschhad im Nordosten des Iran gewesen waren.
Nadia wurde aus ihren Gedanken gerissen, als der hochgewachsene, muskulöse Mann mit kräftiger Stimme rief: »Okay, Leute, vortreten! Und nennt eure Namen!«
3
Jillian Delacruz behauptete allen Ernstes, von Außerirdischen entführt worden zu sein.
Es war eine Lüge. Jillian hatte noch nie ein Ufo gesehen, hatte nie eine Nahbegegnung der dritten Art erlebt, und es gab auch keine Erinnerungslücken, für die sie keine Erklärung besaß. Dennoch hatte Jillian zu genau diesen Themen mehr als zwanzig Sachbuchbestseller verfasst, indem sie Interviews, die sie geführt hatte, ausschmückte und als eigene Erlebnisse ausgab. In Wahrheit waren es für Jillian nur mehr oder weniger gut erfundene Geschichten.
Das bedeutete aber keineswegs, dass Jillian nicht an Außerirdische glaubte. Sie hatte mehr als genug Menschen interviewt, genügend Videos und Fotos gesehen, um sicher sein zu können, dass es im irdischen Luftraum Ufos gab, unidentifizierte Flugobjekte. Und sie hatte etliche glaubwürdige Personen kennengelernt, die behaupteten, von Außerirdischen entführt worden zu sein.
Jillian sehnte sich danach, selbst ein solches Abenteuer zu erleben; andererseits ließ ihr die bloße Vorstellung, fremdartigen Wesen ausgeliefert zu sein, einen kalten Schauder der Angst über den Rücken laufen.
Doch viel mehr noch als eine Begegnung mit interstellaren Schreckgespenstern ängstigte sie der Gedanke, entlarvt zu werden und als Lügnerin und Hochstaplerin dazustehen. Sie lebte gut davon, eine weltbekannte Stimme innerhalb der Ufo-Gemeinde zu sein, eine Expertin für das Fantastische. Immer wieder beruhigte sie sich mit dem Gedanken, dass es unmöglich sei, bloßgestellt zu werden.
Es sei denn, ging es ihr durch den Kopf, es kommt tatsächlich zu einem Kontakt mit Aliens, und die verkünden dann vor aller Welt, nie von mir gehört zu haben.
Jillian saß vor einem Schminktisch, den Greg, ihr Mann, eigenhändig für sie gezimmert hatte, fuhr sich durch ihre langen roten Haarsträhnen und zupfte vorsichtig daran, um die Wurzeln betrachten zu können. Ihr Haar musste dringend gefärbt werden, denn wie fast alles an Jillian war auch ihre rote Mähne nicht echt. Sie hieß nicht einmal Jillian Delacruz, sondern Julie Rosenkrantz.
Als Jillian ihre rot gefärbten Haare betrachtete, hatte sie einmal mehr das seltsame Gefühl, dass alles um sie herum sich auflöste. Diese neue Furcht war entstanden, als Rory Keegan, ein millionenschwerer Geschäftsmann und Stadtrat von Roswell, sie gebeten hatte, bei einem Kongress, den er für sein neu erbautes Roswell Stadium and Convention Center plante, als eine von drei Hauptrednern zu fungieren. Der Kongress sollte »TruthFest« heißen und der Auftakt zu einer Kampagne sein, mit der Keegan die Stadt Roswell zum Mekka der Verschwörungstheoretiker machen wollte, indem er neue Museen, Parks und Attraktionen zu einschlägigen Themen eröffnete, von Bigfoot bis hin zu den Illuminaten. Roswell beherbergte schon jetzt das International Ufo Museum; Keegan hoffte, das Touristikgeschäft zusätzlich anzukurbeln, wenn er mehr als diese eine Attraktion anbot.
Jillian stand zu hundert Prozent hinter dieser Idee, und als langjährige Unterstützerin von Roswell freute sie sich über alles, was der Stadt helfen konnte.
Wäre nur der Name des Festivals nicht gewesen. TruthFest. Ein Festival der Wahrheit, bei dem das Aufdecken von Geheimnissen im Mittelpunkt stand. Dieser Gedanke gemahnte Jillian stets daran, dass ihr Leben zum größten Teil eine Lüge war.
In diesem Moment flog krachend die Hintertür zu.
Jillian zuckte heftig zusammen. Der Knall ließ das Geschirr klirren. Jillian hörte, wie in der Küche Nippessachen zu Boden fielen und auf den Fliesen zerschellten.
War jemand ins Haus eingedrungen?
Jillian schnappte nach Luft. Ihre moralischen Sorgen erschienen ihr mit einem Mal unbedeutend, denn jetzt stand sie einer sehr realen Bedrohung gegenüber.
Jillian sprang auf und warf dabei den kleinen Hocker vor ihrem Schminktisch um. Jemand war im Haus, und sie war allein und ungeschützt. Was war mit der Alarmanlage? Das Ding war eingeschaltet, da war sie ganz sicher. Greg war auf Geschäftsreise. Und außer ihnen beiden kannte niemand den Code, mit dem man die Alarmanlage deaktivierte.
Jillian lauschte, wartete auf ein weiteres Geräusch, hörte aber nichts. War es nur das Knarren und Ächzen des Hauses gewesen? Hatte sie sich das alles nur eingebildet? Ihrer Fantasie gingen öfters die Zügel durch.
Sie erstarrte, als sie unten im Haus ein leises Rumoren hörte.
O Gott, da ist jemand!
Jillian dachte an die hässliche kleine Pistole, die Greg mit einem Magnetclip an ihrem Bettgestell befestigt hatte. Die Waffe enthielt zwei Schrotpatronen vom Kaliber .410 und sah aus wie die größere Schwester eines Derringers aus dem Wilden Westen. Greg hatte versucht, ihr den Umgang mit der Waffe beizubringen, doch Jillian hasste Schusswaffen. Sie flößten ihr Angst ein. Sie hatte überhaupt keine Waffen im Haus gewollt, und dafür gab es einen guten Grund. Jillian hatte ihrem Mann nie von dem schrecklichen Anblick im Zimmer ihres Adoptivvaters erzählt, nachdem der sich in den Kopf geschossen hatte. Auch sonst wusste keine Menschenseele davon. Jillian hatte nur mit dem Therapeuten darüber gesprochen – damals, als sie ein kleines Mädchen gewesen war.
Aber jetzt, ohne Greg und mit einem Einbrecher im Haus, zog die kleine Pistole sie beinahe magisch an.
In dem Moment, als Jillian sich in Bewegung setzte, ertönte am Schlafzimmerfenster ein lauter Knall, der durch das ganze Haus wetterte.
Jillian erstarrte.
Das war nicht das Knacken und Stöhnen des Hauses oder ihre überreizte Fantasie. Da war irgendetwas mit voller Wucht gegen das Fenster geprallt.
Vielleicht ein Vogel oder eine Fledermaus …
Peng!
Wieder der gewehrschussartige Knall.
Nein, das war kein Vogel.
Ein merkwürdiges Summen ertönte hinter der Glasscheibe. Wegen der geschlossenen Jalousien konnte Jillian nichts sehen, aber sie spürte, dass dort, auf der anderen Seite der zerbrechlichen Barriere, jemand war.
Oder etwas.
4
Ackerman stand neben der stählernen Seitentür, die zur südlich gelegenen Ausbildungseinrichtung in Quantico führte, und ließ den Blick über die Schlange der Anwärter schweifen.
»Okay, Leute, vortreten!«, rief er. »Und nennt eure Namen!«
Während er beobachtete, wie sich die Reihe der Aspiranten in Bewegung setzte, schlug er seinem Assistenten für diese Nacht so kräftig auf den Rücken, dass der sich beinahe überschlagen hätte. Der junge Mann war irgendein Rekrut der Akademie, den Ackerman für diesen Anlass offenbar aus dem Bett gezerrt hatte, denn der Junge trug nur seinen FBI-Trainingsanzug unter einem Regenponcho und hielt einen Tabletcomputer, der in einem wasserdichten Gehäuse steckte, in den Händen.
Der Erste in der Reihe, ein eifriger junger Latino, der sich militärisch gerade hielt, trat vor, nannte seinen Namen und bedankte sich mit weitschweifigen, blumigen Worten für die Gelegenheit, die ihm geboten wurde, ehe er seinen Lebenslauf herunterrasselte.
Ackerman hörte zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr zu. Er hob die Hand, um dem Wortschwall Einhalt zu gebieten. »Das ist aber ein langer Name.«
»Aber nein, Sir.« Der Anwärter lächelte. »Das ist mein Lebenslauf.«
»Ich hatte aber nur um deinen Namen gebeten.«
»Oh, ja, sicher, Sir. Bitte um Verzeihung. Mein Name ist …«
»Bist du vertraut mit der Schlacht von Cannae?«, fiel Ackerman ihm ins Wort.
Der junge Mann musterte ihn verdutzt. »Ich glaube schon, Sir. Es gibt da eine Eselsbrücke, wissen Sie.«
»Dann lass mal hören«, forderte Ackerman ihn auf.
»Drei, drei, drei, bei Cannae Keilerei.«
Ackerman nickte. »Das war die Schlacht, in der Julius Cäsar die Truppen des Papstes besiegt hat, stimmt’s?«
Der Anwärter stutzte, nickte dann aber zögernd. »Ich bin mir ziemlich sicher, Sir.«
Ackerman seufzte tief. »Ich glaube, du verwechselst da was. Du kannst gehen, Mann mit dem langen Namen. Da sieht man’s mal wieder – Länge ist nicht alles. Nächster!«
Ackerman hob den Kopf zum Himmel, öffnete den Mund und ließ sich Regen in die Kehle laufen. Er mochte den Geschmack des Regens in Virginia: reine Luft und ein Hauch von Meer. Frisch aus dem Ökosystem, ging es ihm durch den Kopf. Beinahe so, als käme es geradewegs vom Busen der Natur.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: