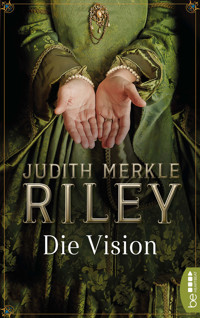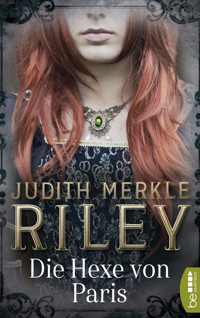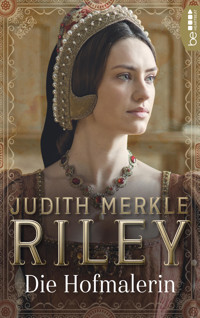4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Margaret-von-Ashbury-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Eine Frau folgt Gottes Plan: Margaret von Ashbury und ihre Vision
England, 1355. Die Hebamme und Heilerin Margaret von Ashbury will ein Buch über ihr Leben schreiben - ein äußerst ungewöhnliches Vorhaben für eine Frau im Mittelalter. Als Analphabetin sucht sie sich einen Schreiber: Bruder Gregory, der Frauen für naturgegeben dumm hält und dies auch gerne kundtut - aber dringend Geld braucht.
Doch was Margaret zu erzählen hat, berührt den Mönch: Ihr Glaube, Humor und ein Hang zu Pragmatismus haben ihr geholfen, die Große Pest und die Hexenverfolgung zu überleben. Und vor allem: Sie schreibt dieses Buch, weil Gott es ihr aufgetragen hat. Trotz seiner anfänglichen Ablehnung beginnt Bruder Gregory sich zu fragen: Ist es möglich, dass Gott, dessen Stimme er bislang vergeblich zu hören versucht, zu dieser Frau spricht?
Humorvoll, authentisch und fesselnd geschrieben: Dieser historische Roman bildet den Auftakt der beliebten Trilogie über die fiktive Heldin Margaret von Ashbury und ihr faszinierendes Leben im Spätmittelalter. Von Judith Merkle Riley, Autorin des Bestsellers "Die Hexe von Paris".
Die Margaret-von-Ashbury-Trilogie: Die Stimme. * Die Vision. * Die Zauberquelle.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 815
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Über dieses Buch
Eine Frau folgt Gottes Plan: Margaret von Ashbury und ihre Vision
England, 1355. Die Hebamme und Heilerin Margaret von Ashbury will ein Buch über ihr Leben schreiben – ein äußerst ungewöhnliches Vorhaben für eine Frau im Mittelalter. Als Analphabetin sucht sie sich einen Schreiber: Bruder Gregory, der Frauen für naturgegeben dumm hält und dies auch gerne kundtut – aber dringend Geld braucht. Doch was Margaret zu erzählen hat, berührt den Mönch: Ihr Glaube, Humor und ein Hang zu Pragmatismus haben ihr geholfen, die Große Pest und die Hexenverfolgung zu überleben. Und vor allem: Sie schreibt dieses Buch, weil Gott es ihr aufgetragen hat. Trotz seiner anfänglichen Ablehnung beginnt Bruder Gregory sich zu fragen: Ist es möglich, dass Gott, dessen Stimme er bislang vergeblich zu hören versucht, zu dieser Frau spricht?
Über die Autorin
Judith Merkle Riley (1942-2010) promovierte an der University of California in Berkeley in Philosophie und war Dozentin für Politikwissenschaft in Claremont, California. Von 1988 bis 2007 schrieb sie sechs historische Romane, die allesamt zu Weltbestsellern avancierten.
Judith Merkle Riley
Die Stimme
Aus dem amerikanischen Englisch von Dorothee Asendorf
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1989 by Judith Merkle Riley
Translated from the English language: VISION OF LIGHT
First published in the United States by Delacorte Press
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 1989 by Ullstein Buchverlage GmbH, München
Erschienen im List Verlag
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung eines Motives © Arcangel: Stephen Mulcahey
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3720-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
Im Jahr des Herrn 1355, drei Tage nach Epiphanias, gab Gott mir ein, dass ich ein Buch schreiben müsste.
»Ich bin doch nur eine Frau«, sagte ich zu meiner inneren Stimme. »Ich kann weder lesen noch schreiben, und Latein kann ich auch nicht. Wie soll ich wohl ein Buch schreiben und was hineinschreiben, da ich doch nie große Werke vollbracht habe?«
Die Stimme antwortete:
»Schreib hinein, was du gesehen hast. Es macht nichts, dass du eine Frau bist und dich mit Alltagsdingen abgibst. Manchmal können geringe Werke von großen Ideen künden. Und was das Schreiben angeht, so mach es wie die anderen: Such dir jemand, der alles für dich aufschreibt.«
»Stimme«, sagte ich, »woher weiß ich, dass du von Gott kommst und nicht vom Teufel, der mich zu Narreteien verleiten will?«
»Margaret«, gab die Stimme zurück, »ist das etwa keine gute Idee? Wie sollte Gott wohl schlechte eingeben?«
Mir kam die Idee auch gut vor. Je länger ich darüber nachdachte, desto besser gefiel sie mir. Ich bekomme gern Bücher vorgelesen, dachte ich, aber nie ist ein Buch über Frauen darunter. Manchmal liest mein Mann dem Haushalt aus einem Buch über Reisen vor, das von den Wunderdingen ferner Gegenden handelt. Manchmal lassen wir uns von einem Priester zur Erbauung der Seele erhabene Gedanken und treffliche Meditationen vortragen. Aus einem Buch wie dem, von dem die Stimme gesprochen hat, würde ich gern vorgelesen bekommen.
Ich erzählte meinem Mann, dass eine innere Stimme, die ganz entschieden von Gott kam, mir gesagt habe, ich solle ein Buch schreiben. Er gab mir zur Antwort:
»Wieder einmal eine Stimme, äh? Na ja, wozu ist mein ganzes Geld nutze, wenn ich damit nicht mein süßes Püppchen verwöhnen kann? Wenn du dir ein Buch wünschst, dann sollst du es meinetwegen haben. Aber ich sage dir gleich, es wird nicht leicht sein, einen Priester aufzutreiben, der es für dich schreibt.«
Mein Mann kennt sich sehr gut aus in der Welt, denn er ist schon viel länger auf ihr als ich. Was die Schwierigkeiten anging, so hatte er sich nicht getäuscht. Der erste Priester, den ich fragte, wurde zornig und weigerte sich, selbst für Geld eine solche Arbeit anzunehmen. Er blickte mich durchdringend an und sagte:
»Wer hat Euch das eingegeben, der Teufel etwa? Der flößt Frauen oftmals unziemliche Gelüste ein. Es gibt für Frauen keine Veranlassung, überhaupt etwas zu schreiben. Sie haben keinen Anteil an großen Werken, und zu erhabenen Gedanken sind sie auch nicht fähig. Und das sind die beiden einzigen Gründe, aus denen es sich ziemt, Bücher zu schreiben. Alles Übrige ist nichts als Eitelkeit und will andere zur Sünde verleiten. Geht heim und dient Eurem Eheherrn und dankt Gott, dass Er Euch demütig gemacht hat.«
Ich war sehr entmutigt.
»Stimme«, sagte ich, »du hast mir eine Strafpredigt eingetragen, und nun bin ich traurig.«
Die Stimme sagte: »Nicht lockerlassen, Margaret. Ich hätte nicht gedacht, dass du so leicht aufgibst.«
»Dieses Mal ist es wirklich zu viel für mich. Dauernd erzählen mir alle, was nicht geht, und vielleicht haben sie ausnahmsweise sogar einmal recht. Kein Mann will aufschreiben, was eine Frau zu sagen hat.«
»Du hast nur noch nicht den richtigen gefunden«, sagte die Stimme. »Halt weiter Ausschau.«
Kapitel I
Im Westende des großen, normannischen Mittelschiffs der St. Paul’s Cathedral in der City of London lungerte eine hochgewachsene, knochige, in ein unauffälliges, fadenscheiniges, altes graues Gewand gehüllte Gestalt in der Nähe eines Pfeilers herum und beobachtete aufmerksam das Gewimmel von Kaufleuten, frommen Damen, Dienstboten und Klerikern, die hier ihren Geschäften nachgingen. St. Paul’s eignete sich gut für die Arbeitssuche: An einem Pfeiler standen die arbeitslosen Dienstboten und warteten auf Angebote, während Priester am Si-quis-Nordportal das Gleiche taten, nur eben diskreter. Dort hefteten sie säuberlich geschriebene Zettelchen an, die kundtaten, dass sie für jede freie Stelle zur Verfügung stünden. Hier, am Westende, saßen zwölf Schreiber der Kathedrale an Schreibtischen und schrieben Briefe für jedermann oder erstellten Urkunden; und genau hier hatte Bruder Gregory die letzten Tage auf der Lauer gelegen und darauf gewartet, dass vom Tisch der Reichen unbeobachtet ein Brocken zum Kopieren für ihn herabfiele. Vor zwei Tagen hatte er für eine alte Frau einen Brief an ihren Sohn in Calais geschrieben, doch seither hatte sich nichts mehr getan, und Bruder Gregory wurde bereits von anstößigen Träumen über Würstchen und Kalbsfüße heimgesucht.
Merkwürdig, wie die Stimmen widerhallten und sich im Mittelschiff verloren. Von weither perlte eine zarte Melodie herab, die jedoch vom Stimmengebrabbel aus einer der nahe gelegenen Fensternischen zerrissen wurde. Ein Ritter war durchs Hauptportal eingetreten und hatte vergessen, seine Sporen abzunehmen. Um ihn herum schnatterte und flatterte es, während Sängerknaben in weißen Chorhemden ihren gewohnten Tribut forderten. Bruder Gregory, der die Schreibtische nicht aus dem Auge ließ, bemerkte eine junge, offenbar verheiratete Frau mit einer Magd im Gefolge, welche auf den ersten Schreibtisch zuging, doch der Klang ihrer Unterhaltung, obwohl sie ganz in der Nähe stattfand, entschwebte und verlor sich. Er beobachtete, wie sie der Reihe nach an jeden der Tische trat. Als sie beim zweiten anhielt, lachte der erste Schreiber hinter vorgehaltener Hand, während der zweite hochnäsig und naserümpfend auf sie herabsah, so als röche sie nach fauligem Fisch. Als sie sich abwandte, um zum nächsten Schreibtisch zu gehen, konnte Bruder Gregory ihr Profil sehen. Sie hatte trotzig das Kinn vorgestreckt.
»Eine halsstarrige Frau«, dachte Bruder Gregory und beobachtete, wie sie sich hinter einem alten Mann anstellte, der am dritten Tisch wartete. »Halsstarrigkeit steht einer Frau nicht wohl an.«
Dann stand sie vor dem nächsten Schreiber, einem fetten Kleriker mit geröteten Hängebacken, der sie einfach auslachte. Darauf beugte er sich mit Verschwörermiene zu seinem Kollegen auf der anderen Seite und tuschelte hinter der vorgehaltenen Hand. Der wiederum tuschelte mit seinem Kollegen auf der nächsten Seite, und als sie schließlich vor dessen hohem Schreibtisch stand, deutete dieser in Bruder Gregorys Richtung. Jäh wandte sie sich um und starrte Bruder Gregory fast über die halbe Breite des Kirchenschiffs hinweg an, wie er da an seinem Pfeiler stand. Sie wirkte verwirrt und enttäuscht, doch dann kam sie auf ihn zu.
Sie war doch nicht so alt, wie er zunächst angenommen hatte. Kaum ein, zwei Lenze über zwanzig, dachte er. Ein dunkelblauer Umhang, dessen Kapuze sie sich übergeworfen hatte, bedeckte ihr Kleid gänzlich und gab nichts als die Kanten vom weißen Gebende und der Rise frei. Sie machte einen wohlhabenden Eindruck: der Umhang war mit dichtem Pelz gefüttert und wurde von einer goldenen Filigranschließe zusammengehalten. Sie war zu Fuß durch den Frühlingsmatsch gekommen und trug noch die hölzernen Stelzenschuhe unter die bestickten Opanken aus Saffianleder gebunden. Sie war mittelgroß, doch sogar auf den hohen, geschnitzten Stelzenschuhen wirkte sie kleiner, als sie in Wirklichkeit war, denn sie war schlank und zartknochig. Bruder Gregory fand, sie sähe irgendwie verloren aus, doch einige Frauen scheinen immer einen leicht verwirrten Eindruck zu machen. Schließlich sind viele nicht in der Lage, sich in der Welt der Männer zurechtzufinden, und man sollte ihnen wirklich nicht gestatten, das Haus allein zu verlassen. Kann nicht weit her sein mit der Arbeit, die sie gemacht haben will, wenn alle Schreiber der Kathedrale das für einen Witz halten, überlegte Bruder Gregory bei sich. Aber immer noch besser wenig Arbeit als gar keine. Diese unangenehmen Träume hatten seine Meditationen gestört; vielleicht schlug er ja eine gute Mahlzeit aus dieser Frau heraus. Dann könnte er ungestört mit seiner Gottsuche weitermachen.
Die Frau zögerte einen Augenblick, musterte Bruder Gregory von Kopf bis Fuß und sagte dann mit fester Stimme:
»Ich brauche einen Schreiber, der schreiben kann.«
»Das versteht sich von selbst«, erwiderte Bruder Gregory und betrachtete sie genauer. Reich, sehr reich, folgerte er. Und eigensinnig obendrein.
»Ich meine schreiben, richtig schreiben.« Sie haben mir einen Streich gespielt, diese Schreiber, dachte Margaret. Der Mann ist ja ein Bettler – einer von diesen diebischen Vaganten, die sich als Mönch verkleiden, um an Geld zu kommen. Wahrscheinlich kann er überhaupt nicht lesen und schreiben. Er wird sich eine ganze Weile furchtbar aufspielen, jedenfalls bis er sein Geld hat. Dann verschwindet er und lässt mich mit Seiten voll sinnlosem Gekritzel sitzen, und alle lachen sich tot über meine Dummheit. Und ich kann noch von Glück sagen, wenn er nicht auch noch die Silberlöffel mitgehen lässt. Diese grässliche, grässliche Stimme! Warum behelligte sie nicht jemand anders?
»Ich kann schreiben«, sagte Bruder Gregory mit gelassener Arroganz. »Ich kann Latein, Französisch und gewöhnliches Englisch schreiben. Deutsch allerdings nicht; das ist eine barbarische Zunge, bei der einem die Tinte gerinnt.«
Er spricht gepflegt, dachte Margaret. Nicht wie ein Bauer oder ein Ausländer. Ich probiere es mit ihm. Und so wagte sie sich weiter vor.
»Ich brauche jemanden, der ein ganzes Buch schreiben kann.«
»Einen Kopisten, der ein Gebetbuch abschreibt? Das kann ich.«
»Nein – ein Buch, ein Buch über Frauen. Ein Buch über mich.«
Bruder Gregory war entgeistert. Zudem war er sich verschwommen bewusst, dass es an den Schreibtischen in einigen Augenpaaren amüsiert funkelte, während diese die Unterhaltung aus der Ferne beobachteten. Bruder Gregory blickte die Frau böse an. Bodenlos verwöhnt. Welcher närrische, reiche Mann frönte wohl solch irrwitzigen Phantastereien? Offensichtlich dachte sie, dass man für Geld alles kaufen könne, selbst die Integrität eines Mannes. Er war so zuvorkommend, wie es ihm unter den gegebenen Umständen möglich war, schickte sie jedoch so schnell es ging fort, denn die Schreiber der Kathedrale hatten ihn scharf im Auge.
Im Weggehen warf ihm Margaret einen durchdringenden Blick zu, und ein schlauer, berechnender Ausdruck huschte über ihr Gesicht. Ausgerechnet seine Arroganz hatte sie aufmerken lassen. So sind sie alle, die wirklich lesen und schreiben können, dachte sie. Es war ihrem scharfen Blick nicht entgangen, dass Bruder Gregory sich zu voller Größe aufrichtete und von oben herab hochnäsig auf sie herabsah, so als warteten mindestens hundert Mahlzeiten auf ihn und als interessierte ihn ihre Arbeit nicht im Mindesten. Ihre Augen folgten ihm, als er sich abwandte und nach einem anderen Auftrag Ausschau hielt.
Am Spätnachmittag aber war das Glück Bruder Gregory immer noch nicht hold gewesen, und so wanderte er niedergeschlagen hinaus auf den matschigen Kirchhof. Er hatte ein ziemlich hohles Gefühl im Magen, und es kam ihm vor, als ob sich die kahlen Äste und der Teil der Kirchenmauer über seinem Kopf emporhöben und auf äußerst ungewöhnliche Weise herumwirbelten. Gerade hatte er einen Augenblick angehalten, um sich an der Kirchhofmauer anzulehnen, da war wieder diese Frau da, schien aus dem Nichts aufzutauchen, zupfte an seinem abgewetzten Ärmel, und die Magd stand immer noch hinter ihr. Er blickte auf sie herunter, während ihr Gesicht redete und redete, und folgte ihr durch einen Irrgarten von Gässchen zu einer kleinen Garküche in Cheapside, wo sie wohl ihrer Meinung nach ihr Vorhaben ungestörter besprechen konnten. Hier hieß sie Bruder Gregory sich in eine Ecke setzen, bestellte allerlei Essen, jedenfalls mehr als sie brauchte, und schob es ihm hin. Bruder Gregory aß sehr bedächtig, bis die rauchige Decke der Garküche aufhörte, sich hin und her zu bewegen; und die ganze Zeit über bat und bettelte sie außerordentlich demütig und unaufdringlich. Eigentlich gar nicht so verkehrt, ihr Anliegen, insbesondere wenn man bedachte, dass es ihr eine Stimme eingegeben hatte. Man musste es nur im rechten Licht sehen, dann war es gar nicht so arg, wirklich nicht so arg. Und so erklärte sich Bruder Gregory denn bereit, den nächsten Tag ins Haus ihres Ehemannes an der Themse zu kommen und mit der Arbeit zu beginnen.
Und schon am nächsten Morgen bahnte sich Bruder Gregory einen Weg durch die Lastesel, die Berittenen und die Kaufleute auf der Thames Street und folgte auf der Suche nach Roger Kendalls Haus den Windungen der Straße längs des Flussufers. An dieser Straße ließen sich vorzugsweise Kaufleute nieder, die mit Gütern aus dem Ausland handelten: Ein paar Türen weiter machte Bruder Gregory das Haus eines bekannten Weinhändlers aus. Dann stand er einen Augenblick vor dem eindrucksvollen, dreistöckigen Haus still, welches die richtige Adresse zu sein schien, und musterte es von oben bis unten. Auf der Vorderseite kreuzte sich kunstvoll geschnitztes und in leuchtenden Farben bemaltes Ständerwerk, und von den Ecken, wo die Balken aufeinandertrafen, starrten wunderlich geschnitzte und vergoldete Engel- und Tiergesichter herab, während sich unter dem hohen, spitzen Dachvorsprung längs der Traufe gemalte Eulengesichter verbargen. Die bleiernen Dachrinnen am Ende des Dachvorsprungs waren mit einem Paar eigenartig geformter Wasserspeier aus Blei geziert, aus deren offenen Mäulern der Regen abfließen konnte.
Selbst von der Straße aus fiel Roger Kendalls Vorliebe für die Annehmlichkeiten des Lebens ins Auge, und Bruder Gregory verstand unschwer, warum diese Frau so verwöhnt war. Die Fenster waren ungewöhnlich für ein Wohnhaus. Zwischen leuchtend grün und rot bemalten, geschnitzten Läden gab es richtige Fensterscheiben aus mit Blei gefassten, dicken, runden Butzenscheiben, die man zusammengesetzt hatte. Auf dem großen Balkon über der Haustür stand zwischen zwei tief eingelassenen Kreuzen unter einer Darstellung von Kendalls Wappen der Wahlspruch des Hauses geschnitzt: Dextra Domini Exultavit Me.
Bruder Gregory musterte das Wappen über dem Wahlspruch: ja, es war die richtige Adresse, ganz gewiss. Wenn das nicht wie das Wappen eines Handelsherrn aussah! Ein Löwe war nicht vorhanden, und wahrscheinlich war es nicht einmal offiziell eingetragen. Drei Schafe, eine Waage und eine Seeschlange. Der Mann machte ganz entschieden klar, wie er zu seinem Geld gekommen war. Bruder Gregory hob den schweren Türklopfer aus Messing. Es währte nur Minuten, und schon führte man ihn herein und hieß ihn in der großen Diele warten. Während er auf einer Bank saß und sich das gemalte Wappen auf dem Schornstein über der großen Feuerstelle ansah, neben sich seinen verfilzten Schaffellumhang, da überlegte er, wie lange es wohl dauern würde, bis sie des Vorhabens überdrüssig wurde. Wie viel konnte eine Frau auch schließlich zu sagen haben? Ein paar Tage nur, vielleicht eine Woche, und sie hatte etwas Neues gefunden, womit sie spielen konnte, und er würde sich in Ruhe wieder seinen Meditationen widmen können. Die Holzklötze glühten in den Flammen; auf der großen Diele war es behaglich und warm. Von der Küche her, hinter dem breiten Wandschirm am Ende der Diele, drang Essensduft und stieg ihm in die Nase. Ja, mit ein bisschen Glück konnte er wohl auf ein paar Tage hoffen, ehe er sich frisch gestärkt wieder auf seine Gottsuche machte.
»Wo wollt Ihr anfangen?«, fragte Bruder Gregory.
»Beim Anfang, als ich klein war«, antwortete Margaret.
»Mithin habt Ihr seit Eurer Kindheit Stimmen gehört?« Bruder Gregorys eigene Stimme klang gedankenverloren.
»Oh nein, als ich klein war, da war ich genau wie alle anderen. Die einzigen Stimmen, die ich gehört habe, waren die von Vater und Mutter. Es gefiel ihnen nicht, wie ich mich entwickelte. Aber so geht das Eltern eben. Nicht alle Kinder geraten gleich gut. Darum dachte ich mir, wir beginnen da – bei meiner Familie und wie alles so ganz anders anfing, als es endete.«
»Sehr gut, man fängt am besten immer am Anfang an«, sagte Bruder Gregory mit einer gewissen Ironie und spitzte einen Federkiel mit seinem Messer an. Margaret fiel an dieser Bemerkung überhaupt nichts auf. Sie fand sie ganz angebracht.
Vermutlich war es zwei Sommer nach dem Tod unserer Mutter, dass unser Leben eine neue Wende nahm und unseren Fuß auf eben die so ganz anderen Pfade setzte, die wir jetzt wandeln. Mit »uns« meine ich natürlich meinen Bruder Daniel und mich. Ich war ein kleines Mädchen, sieben, vielleicht auch sechs Lenze, wenn ich mich recht erinnere. David und ich hingen aneinander wie Zwillinge, obwohl er ein Jahr jünger war als ich. Wir machten alles zusammen. Am liebsten saßen wir in unserem Apfelbaum, aßen Äpfel und spuckten die Kerne auf die Erde, und zur Zeit der Aussaat rannten wir über die Felder und kreischten und fuchtelten mit den Armen, um die Vögel von den Saaten zu verscheuchen. Alle sagten, wir machten unsere Sache sehr gut. Da Mutter tot war, kümmerte sich Vater nicht viel um uns, und so strolchten wir umher wie die Wilden und redeten in einer seltsamen, ausgedachten Sprache miteinander, die niemand außer uns verstehen konnte. Obwohl er ein Junge war und ich ein Mädchen, dachten wir, es müsste ewig so weitergehen.
Aber nichts geht ewig so weiter, auch wenn es zuweilen den Anschein hat. Man denke beispielsweise nur an unser Dorf. Es war so alt wie Gottes Fußabdrücke im Garten Eden, und doch ist es jetzt verschwunden. Die Pest hat es in eine Schafweide verwandelt. Nur noch in meiner Erinnerung ist es so wie damals. Immer noch sehe ich die kahlen Berge des Nordens vor meinem inneren Auge, wie sie sich schartig hinter den flachen, bestellten Feldern im Tal erheben, und auch den Bach, wie er gleichsam als tiefer, schmaler Einschnitt dahinfließt und Kirche, Dorfanger und die größeren Häuser von den Katen der Hintersassen auf der anderen Seite der Steinbrücke trennt.
Damals war Ashbury das Geringste der Dörfer, die zur großen Abtei von St. Matthew’s gehörten, aber es war an der Landstraße gelegen und nahm dadurch wohl eine herausragende Stellung ein. Von unserer Haustür aus konnte man hinter den Bäumen den Quader des normannischen Kirchturms erblicken, und die Biegung der Landstraße vor unserem Haus führte geradewegs zum Kirchhof hin. Dadurch gewann unser Haus irgendwie an Bedeutung, auch wenn es nicht groß war. Wir waren aber auch durch Vater anders. Er war freigeboren und bewirtschaftete eigenes Land. Dazu war er noch der beste Bogenschütze auf dem Krongut und auch der beste Dudelsackpfeifer und der beste Trinker von Ashbury, und das will auf dem Land immer etwas heißen.
Der Tag, von dem hier die Rede ist, war also jener Tag, an dem sich alles änderte. Danach war nichts wieder, wie es gewesen war, selbst nicht zwischen David und mir – obwohl mir das alles erst später aufging. Es war warm und sommerlich, und David und ich hockten vor unserer Tür im Staub der Straße. Zwei Türen weiter saß die Gevatterin Sarah mit ihren Klatschbasen auch in der Sonne; sie schwatzten und kämmten sich gegenseitig abwechselnd mit einem feinzinkigen Kamm das Haar. David und ich spielten ein Spiel: Wir zählten nach, wer sich am schnellsten die meisten Flöhe abgesucht hatte. Ich hatte mir den Rock hochgeschoben, die Schienbeine über den nackten Füßen entblößt, wo ich drei prächtige Tierchen fand, die gemächlich an meinem Bein hochkrabbelten. Blitzschnell fing ich eines, doch die beiden anderen hüpften im Staub davon.
»Du bist viel zu langsam, Margaret; du hast zwei entwischen lassen«, sagte David in dem überheblichen Ton, den er manchmal an sich hatte, und knackte die beiden, die er zwischen den Fingern hielt. Keiner von uns beiden blickte dabei auf, und so merkten wir auch nicht, wie sich die Gestalt unseres Pfarrers Hochwürden Ambrose auf der staubigen Landstraße zu unserem Haus hinmühte.
»Das kommt, weil ich so starkes Blut habe. Das macht meine Flöhe schneller als deine«, antwortete ich hochnäsig.
»Ja, aber das weiß man doch nur, wenn es erst bewiesen ist«, antwortete David und machte sich daran, mit seinem Zeh einen Kreis in den Staub zu ziehen.
»Da«, sagte er. »Jetzt setzt du zwei von deinen Flöhen in die Mitte und ich zwei von meinen, und dann sehen wir ja, welche am schnellsten weghüpfen.«
Gesagt, getan, und seine Flöhe sprangen mit einem einzigen großen Satz aus dem Kreis, während meine jämmerlich im Staub davonkrabbelten.
»Na also!«, frohlockte er. »Da hast du’s.« Manchmal kann einen selbst ein Bruder in den Harnisch bringen. Besonders dann, wenn er jünger ist und ewig beweisen will, dass er alles besser kann. Ich war so erbost, dass ich nicht einmal hörte, wie die Klatschbasen Vater Ambrose begrüßten.
»Also, wenn meine nicht schnell sein können, dann will ich gar keine Flöhe mehr haben«, sagte ich. David bohrte seine Zehen in den Staub. Er hatte keine Bruch und keine Schuhe, nur einen Kittel mit Gürtel. Er besaß kein Unterhemd, und ich noch viel weniger. Vielleicht hatte jemand im Dorf eines, aber gesehen hatten wir dergleichen noch nie.
»Ha! Das schaffst du nicht. Jeder hat Flöhe!«, freute er sich hämisch.
»Ich wohl, ich wasch sie ab!«
»Ätsch, und dann springen sie dich gleich wieder an«, meinte er gar nicht so dumm.
»Und ich wasche sie einfach wieder ab!«
»Du Dummerchen, dann müsstest du ja ewig baden. Wie oft meinst du wohl, dass du das machen musst?«
»Ach, ich – ich mache das jede Woche! Jeden Tag, wenn es sein muss!«, rief ich, ohne nachzudenken.
»Dann wäschst du dir die Haut ab und gehst tot«, sagte er. »Das weiß doch jeder.«
Über unseren Kreis fiel der Schatten von Vater Ambrose, der uns überrascht hatte. Ich blickte hoch und merkte, dass er uns mit seinen scharfen blauen Augen anstarrte. Sein runzliges Gesicht mit den Bartstoppeln sah missbilligend und argwöhnisch aus.
»Sieh dich vor, kleines Mädchen, du hast ein loses Mundwerk, das sind nichts als Eitelkeiten«, dröhnte seine tiefe Stimme.
»Guten Tag auch, Hochwürden Ambrose!« David richtete die wunderbaren blauen Augen auf den Priester. »Habt Ihr heute viele Besuche zu machen?«
»Ja, gewiss, David«, sagte er, und seine Miene heiterte sich beim Anblick von Davids klugem, hübschem Gesicht auf. David hatte das schmale, ovale Antlitz unserer Mutter, ihre schneeweiße Haut und einen Schopf großer, dunkler Locken, die nur von Vater stammen konnten.
»Ich bin erst am Anfang meiner heutigen Besuche«, sagte der Priester und ging in die Hocke, damit er von Angesicht zu Angesicht mit David reden konnte. »Zunächst einmal habe ich die alte Gevatterin Agnes besucht, die es in den Gelenken hat, und ihr die Hostie gebracht, weil sie das Bett hüten muss. Danach muss ich die Gevatterin Alice besuchen, denn sie möchte ihren Kochtopf gesegnet haben. Sie behauptet, es sitzt ein Dämon darin, der macht, dass ihr das ganze Essen anbrennt, und ihr Mann droht, sie zu verlassen, wenn der Dämon noch mehr Mahlzeiten verdirbt. Aber im Augenblick, kleiner Mann, habe ich geschäftlich mit deinem Vater zu tun.«
»Mit Vater?«, fragte ich.
Er stand da und musterte mich sehr eingehend, so als wolle er sich jeden Gesichtszug einprägen. Das passierte mir öfter, und gewöhnlich lief es darauf hinaus, dass die Leute kopfschüttelnd sagten: »Du siehst genauso aus wie deine Mutter«, so als ob irgendetwas auszusetzen wäre. »Zu blass«, sagten sie dann wohl, »und dann diese Augen – nussbraun bringt kein Glück. Und in diesem Licht sehen sie gelb wie Katzenaugen aus. Ein Jammer, dass sie nicht blau sind.« Ich wurde unter dem prüfenden Blick des Priesters immer verlegener und hätte gern ein besseres Kleid angehabt. Wenn es nicht aus Mutters geschneidert und am Saum dreimal eingeschlagen gewesen wäre, damit es mitwachsen konnte – oder wenn es blau gewesen wäre statt so gewöhnlich rostbraun, vielleicht würde er mich dann leiden mögen wie David. Stattdessen richtete er immer noch seinen scharfen, harten Blick auf mich und sagte zu mir:
»Ja, ich habe geschäftlich mit deinem Vater zu tun, denn es wird allerhöchste Zeit, dass er in den Schoß der Mutter Kirche zurückkehrt. Und du, kleines Mädchen, hüte dich, dass du aus lauter Eitelkeit nicht in seine Fußstapfen trittst. Ein wahrer Christ vernachlässigt den Leib zugunsten des geistigen Lebens; zu viel Waschen und äußerliche Zier sind ein Zeichen, dass unchristliche Gedanken am Werke sind, und führen ins Verderben.«
Er schien sich für dieses Thema zu erwärmen, denn er fuhr fort:
»Ja, eben dieses übermäßige Baden schwächte unseren verstorbenen, unseligen König Edward den Zweiten (Gott hab ihn selig)« – und hier bekreuzigte sich Vater Ambrose – »so sehr, dass er in der Schlacht unterlag und von seiner eigenen Gemahlin abgesetzt wurde. Dergestalt führte das Waschen zu seinem Tode, und du schlage dieses von Gott gesetzte Beispiel nicht in den Wind.« Hochwürden Ambrose wirkte sehr zufrieden mit sich, wie immer, wenn er eine Predigt gehalten hatte und diese als besonders gelungen betrachtete. Ich musterte ihn eingehend: Die grauen Haare an seinen Schläfen waren schweißverklebt; ich sah, wie etwas Kleines, Dunkles ihm aus dem Kragen den Hals hochkrabbelte. Doch vor allem seine Fingernägel ließen erkennen, dass er ein sehr heiliger Mann sein musste. Aber das war ja das Problem: Hieß das etwa, dass der alte William, der Pflüger, nach einem Tag Dungaufladen sogar noch heiliger war? Gott sei Dank hielt ich den Mund. Mit derlei Fragen habe ich mir mein Leben lang viel Ärger eingehandelt.
»Kinder, ist euer Vater im Haus? Ich habe ihn heute noch nicht bei der Arbeit gesehen, er soll wohl krank sein.«
»Ja, er ist drinnen und krank«, erzählte ich dem Priester.
»Krank vom Ale, Vater«, zwitscherte David, der manchmal ein richtiger alter, kleiner Pharisäer sein konnte.
»Ach, ihr armen Kinder! Das dachte ich mir schon. Man kann diesen infernalischen Beerdigungsbesäufnissen einfach keinen Einhalt gebieten. Ein Mann, der so lange gesungen, den Dudelsack gespielt und so viel getrunken hat wie er, der dürfte zweifellos – äh – ›krank‹ sein.«
Der Priester trat ein, ohne anzuklopfen, und wir hörten Stimmen, das heißt eine Stimme, der im verdunkelten Haus Stöhnen antwortete. Als die Stimmen lauter wurden, konnten wir hören, was gesagt wurde.
»Kein Mann scheißt in seinen Hut und setzt ihn dann auf.«
»Du hast sie schon eine Zeit lang fleischlich gekannt, und nun musst du entweder heiraten oder vor Gericht.«
»Eine Buße zahlen? Ich habe kein Geld, und das wisst Ihr.«
»Hast du die große Mitgift, die deine Frau mit in die Ehe gebracht hat, schon vergeudet?«
»Die habe ich angelegt, Vater.«
»Angelegt? Fürwahr, angelegt in Sünde! Schämst du dich denn gar nicht, dass ihre Kinder draußen im Schmutz sitzen und müßig Flöhe zählen und du sie seit vierzehn Tagen nicht mehr in die Kirche gebracht hast?«
»Kinder sind eine große Plage. Man kann von einem Mann nicht erwarten, dass er Kinder aufzieht.«
»Dann heirate die Witwe, Mann! Die wird die Kinder schon aufziehen.«
»Sie ist zu fett.«
»Nicht so fett, als dass du nicht mit ihr geschlafen hättest.«
»Sie ist zu alt und hat eine laute Stimme.«
»Sie ist wohlhabend und hat zwei große, starke Söhne, die dir auf dem Feld zur Hand gehen können.«
»Zwei große Mäuler mit noch größeren Bäuchen, meint Ihr wohl?«
»Gesprochen wie ein Hintersasse, oder bist du etwa nicht freigeboren?«
»Ich bin ein freier Mann, frei und ledig, und das gedenke ich auch zu bleiben.«
»Und ich sage dir, du elender Sünder, wenn du nicht nächste Woche das Aufgebot bestellst, dann werde ich dafür sorgen, dass man dich einsperrt, bis du bereust!«
Ein Stöhnen und dann ein Krachen, als der Hingelümmelte sich im Bett umdrehte.
»Dann bestellt es und Fluch über Euch.«
»Ich bestelle es, und Heil über dich, du gemeines, gotteslästerliches Stück fauligen Fleisches!«
Und schon kam Hochwürden Ambrose zornigen, schnellen Schrittes aus der Tür. Wir saßen so unschuldig da, als hätten wir nichts gehört. Als der Priester auf die Schwelle trat, erblickte er uns und wischte alle Anzeichen von Wut aus seinem Gesicht. Er musterte David noch einmal und säuselte dann:
»Bist du ein lieber, kleiner Junge?«
David nickte.
»Lügst nicht, stiehlst kein Obst?«
»Nein, Vater.«
»Kleiner David, ich brauche einen ganz lieben, kleinen Jungen als Messdiener. Wenn du mir helfen willst, wirst du das Weihrauchgefäß schwenken und die heiligen Worte ganz aus der Nähe hören. Und wenn du ganz, ganz lieb bist, wirst du unzählige Engel erblicken, die sich jedes Mal im Allerheiligsten versammeln, wenn die heilige Messe gelesen wird.«
Davids Augen wurden groß. Wie war der Priester nur dahintergekommen, dass wir schon stundenlang in den Himmel gestarrt und gehofft hatten, hinter den Wolken einen Blick auf die Engel zu erhaschen? Aber ich wusste, was Hochwürden Ambrose in Wahrheit bewegte. Als ich sah, wie er David von Kopf bis Fuß musterte, da war mir klar, dass er sich dieses liebliche Antlitz schon über einem weißen Kragen vorstellte und im Geiste Davids strahlenden, hellen Diskant auf Latein singen hörte! Jedem kamen bei Davids Anblick solche Gedanken. Selbst schmutzig sah er danach aus.
»Ich wäre gern Euer Messdiener, Hochwürden Ambrose«, sagte David so steif und förmlich, wie er nur konnte.
»Also gut. Komm heute nach der Vesper zu mir, dann werde ich dir alles Weitere erklären.«
Als Vater Ambrose sich wieder auf den Weg zum baumbeschatteten Portal der alten, steinernen Kirche machte, hörte ich ihn vor sich hin brummeln:
»In dem Haus gibt es noch Seelen zu retten.«
Und so geschah es, dass nur ein paar Wochen später die neue Mutter bei uns einzog; sie kam oben auf ihrem Bettzeug und den Kochtöpfen in einem großen Karren angefahren, der von zwei Ochsen gezogen wurde. Hinten war eine Milchkuh angebunden, und daneben liefen zwei stämmige Jungen, unsere neuen Stiefbrüder, Rob und Will, welche die Ochsen an der Leine führten. Ein paar unscheinbare Hunde rannten vor dem Karren her, die hielten sich die neuen Brüder für ihren Lieblingssport: Hundekämpfe. In Körben, außen am Karren befestigt, fuhren vier Gänse, etliche Hennen und zwei prachtvolle Kampfhähne mit. Schon aus der Ferne konnte man den Gestank einer Frettchenkiste riechen. Die neue Mutter war wohl auch Jägerin.
Ihre Basen im Dorf hatten erzählt, sie sei reich und hochfahrend. Von Anbeginn an war klar, dass sie recht hatten. Sie besaß eine viereckige Lade, in der sie ein halbes Dutzend Laken, einen Satz geschnitzter Holzlöffel, ihre Nadeln und ihre Kunkel, vier gute, scharfe Messer und sogar ein Säckchen mit Silbermünzen aufbewahrte. Sie tat vornehm, weil sie direkt aus St. Matthew’s stammte, jener Stadt, die sich zu Füßen der Abtei hinschmiegte. Als der Karren unsere Dorfstraße entlangrumpelte, erwiderte sie die Grüße der Gassenjungen mit einem kalten Nicken, rümpfte die Nase beim Anblick der Dorfkirche und murmelte beim dörflichen Fischteich: »Der von der Abtei ist viel größer.« Beim Dorfanger mit seinem kleinen Kreuz aus Marktständen und dem Stock, an dem nicht ein einziger Irregeleiteter von Bedeutung am Pranger stand, schürzte sie die Lippen.
»Gib Acht, wenn du die Lade da herunterhebst!«, rief sie schrill, als Vater herbeikam, um ihre Besitztümer abzuladen. Mit einem Blick ihrer blassen blauen Fischaugen erfasste sie wortlos unser unordentliches Haus, den verwilderten Kräutergarten meiner Mutter und die Rosen, die ungebärdig die Mauern entlangwucherten. Als sie alles in sich aufgenommen und ihre Kuh losgebunden, ihre Frettchen im Haus untergebracht und ihr Geflügel freigelassen hatte, da sagte sie kurz angebunden zu Vater:
»Hugh, hier muss aufgeräumt werden.«
Ei, und sie räumte auf: Sie fegte die Hundeknochen und die Abfälle zur Hintertür hinaus, legte die Decken zum Lüften in die Fenster, fachte das schwelende Feuer an und setzte in ihren Töpfen Essen auf. Dann packte sie mich beim Ohr und sagte, dass sie jetzt ein richtiges kleines Mädchen aus mir machen würde, und nickte ingrimmig, als sich herausstellte, dass ich nicht spinnen konnte. Als Rob und Will, ihre beiden großen Lümmel, darüber grinsten, wie sie mit mir umging, fuhr sie herum und zog ihnen eins über den Kopf mit einem Stock, den sie irgendwie immer zur Hand zu haben schien. Sie heulten auf, flohen und taten es David nach, der sich wohl schon beim ersten Anblick des herannahenden Karrens aus dem Staub gemacht hatte.
Je länger ich meine neue Mutter betrachtete, desto weniger mochte ich sie. An das Gesicht meiner eigenen Mutter konnte ich mich nicht mehr erinnern, aber ich war überzeugt, es war viel schöner gewesen – und eines wusste ich ganz sicher, meine eigene Mutter hatte sehr viel besser gesprochen. Es gibt Menschen, die sind gänzlich säuerlich: im Aussehen, in ihrer Rede und in ihrem Geruch, und so war meine neue Mutter. Meine richtige Mutter konnte lieblich singen, und ich weiß noch ganz genau, dass sie weiche Hände hatte. Die Menschen starrten sie denn auch an und redeten immer noch von ihr, obwohl sie doch schon bei den Engeln war. Sie hatte irgendetwas Geheimnisvolles an sich, dass selbst der Priester, der doch immer so streng mit Frauen war, ihr Achtung entgegenbrachte. Wenn ich doch nur wüsste, was das gewesen ist. Jetzt sahen wir mit an, wie die neue Mutter im Haus herumwatschelte, das farblose, strähnige Haar unter ein fettiges Kopftuch gestopft, und auf alles und jedes einschlug, was sie ärgerte, und sich schrill beklagte. Dann fragte ich mich, wie Vater sich wohl mit ihr einlassen konnte, wo er doch einmal mit Mutter verheiratet gewesen war. Kann sein, es war das Geld.
Zu Petri Kettenfeier heiratete mein Vater die neue Mutter vor dem Kirchenportal, und so begann unser neues Leben. Doch nur ein paar Wochen nach der Hochzeit war für jedermann, der Augen im Kopf hatte, offenkundig, dass Mutter Annes Beleibtheit nicht allein von der Fressgier herrührte und dass das Kind schon bald kommen würde. Zu Martini, nachdem das Dorfvieh geschlachtet und gepökelt war und Vater dabei war, unser eigenes Schwein zu schlachten, kam sie in die Wochen. Auf einem großen Feuer sotten draußen in großen Töpfen Roggen und Hafer für den Blutpudding; die Gewürze für die Wurst standen schon bereit, als ein merkwürdiger Ausdruck über ihr Gesicht huschte.
»Margaret, hol mir Gevatterin Agnes und mach schnell, meine Zeit ist gekommen.« Inzwischen hatten Vater und meine Brüder das grässlich quiekende Schwein an den Hinterläufen hochgehoben. Während sie die große Holzschüssel hielt, stieß Vater dem Schwein sein scharfes Messer tief in die Kehle. Mutter Annes Gesicht glänzte schweißnass, als sie den Blutstrom auffing, der aus dem Hals des Schweins hervorsprudelte. Erschrocken rannte ich den ganzen Weg zu der kleinen, runden Hütte der Wehmutter und trug ihr auf dem Rückweg den Korb, während die alte Frau langsam hinter mir her humpelte.
Noch ehe wir bei unserer Haustür angelangt waren, hörte ich Mutter Anne drinnen schreien. Vater war seelenruhig dabei, das Schwein bis ins Letzte zu zerlegen; die Speckseiten waren schon herausgeschnitten, und auf dem Block thronte der große, blutleere Kopf mit eingesunkenen und glasigen Schweinsäuglein und heraushängender Zunge. Ein paar gutherzige Nachbarinnen hatten sich eingefunden, die Mutters angefangene Arbeiten zu Ende brachten, denn keine davon hatte Zeit bis morgen. Eine goss ausgelassenes Fett in eine Blase, eine andere hatte Därme ausgewaschen und band nun die Würste zu, und die dritte, die beim Rühren des Blutpuddings eine Pause eingelegt hatte, war hineingegangen, um Mutter die Hand zu halten. Als ihr Gestöhn und Geschrei dann auf einmal aufhörten, tätschelte sie ihr die Hand, ließ sie fallen und kehrte an ihre Arbeit zurück. Mutter, über deren Gesicht der Schweiß nur so lief, erwiderte kaum den Gruß der Wehmutter. Sie saß auf dem niedrigen Gebärstuhl, stützte sich mit dem Rücken gegen die Wand und war ganz bei der Sache.
Gevatterin Agnes tat sehr geschäftig. »Margaret«, sagte sie, »mach Wasser in einem Zuber warm, damit wir das Kind baden können, wenn sich im Haus überhaupt noch ein Zuber anfindet. Hier gibt es viel zu tun.«
Einen Zuber hatten wir nicht, also rannte ich zum Nachbarn und lieh mir einen aus, der es wohl tun würde. Als ich zurückkam, hielt Gevatterin Agnes Mutters Hand und sang mit ihrer brüchigen Stimme dreimal hintereinander: »Lazarus tritt herfür«, um die Wehen zu beschleunigen. Tränen rannen Mutter aus den Augen, und ihr Gesicht war rot. Dann stießen beide Frauen einen Schrei aus, als nämlich der Kopf geboren wurde. Gevatterin Agnes kniete sich zwischen Mutters hochgezogene Knie und half erst dem Kopf, dann dem Rumpf und den Gliedmaßen auf die Welt.
»Ein Junge!«, rief Gevatterin Agnes, und Mutter wiederholte die Worte flüsternd. Als der Säugling anfing zu greinen, wechselte seine Farbe von blau zu rosig. Mutter starrte ihn erschöpft an, während Gevatterin Agnes die Nachgeburt holte und die Nabelschnur durchtrennte. Die Nachbarinnen hatten eine Pause eingelegt, damit sie den großen Augenblick nicht verpassten, und drängten sich jetzt auf die Schwelle. Ein Neugeborenes wirkt auf Frauen unwiderstehlich, und die hier bildeten keine Ausnahme. Von jetzt an hatte es Gevatterin Agnes leicht, denn sie wuschen und windelten es und standen dann drum herum und gurrten und girrten. Während sie immer wieder laut sein Aussehen bestaunten, holte Gevatterin Agnes Vater, dass er es taufen ließe. David wurde losgeschickt, die Paten aufzuschreiben, während Vater, Mutters Klatschbasen und die Wehmutter das Kind im Triumph zur Kirche trugen. Ich wartete bei Mutter Anne, die schrecklich in Sorge war. Was, wenn der Säugling nun am Taufstein nicht schrie? Das würde doch bedeuten, das Weihwasser hatte den Teufel nicht ausgetrieben. Ein schlimmes Vorzeichen wäre das. Ihre beiden älteren Söhne hatten ihre Taufe friedlich verschlafen.
Doch schon bald brachte man ihn Mutter Anne ganz rotgesichtig zurück, dass sie ihn an ihre großen Brüste anlegte. Während Vater Gevatterin Agnes in Speck ausbezahlte und sie ihren Korb wieder packte, wussten Mutters Klatschbasen voller Freude zu berichten, das Kind hätte furchtbar gebrüllt, als das Weihwasser es berührte. Jetzt hatte Mutter das Kind wohlbehalten im Arm, und so verabschiedeten sich ihre Nachbarinnen und beredeten fröhlich, was sie zum Dankgottesdienst für die Wöchnerin an Gerichten mitbringen wollten.
Mir kam an jenem Tag noch ein anderer Gedanke, und den bin ich seither nicht mehr losgeworden. Ein Fest ist etwas sehr Schönes, und ich habe seit jenem Tag einige ungemein prächtige Dankfeste für Wöchnerinnen mitgefeiert. Aber warum muss eine Frau eigentlich vor dem Kirchenportal knien, weil sie nach der Geburt eines Kindes unrein ist? Heißt das etwa, ein Kind zu bekommen ist gottloser, als wenn man tötet wie ein Soldat oder wie Vater das Schwein? Müsste nicht eigentlich auch Vater vor dem Kirchenportal knien? Es will mir nicht in den Kopf, warum Gott Frauen für schlecht hält, wenn sie Kinder bekommen, aber Männer nicht, wenn sie Würste machen – oder Leichen.
Wenn ich jedoch an jenen Tag zurückdenke und wie erschrocken ich damals war und wie wenig ich mitbekam, so habe ich keine Ahnung, woher ich überhaupt das Zeug zu einer guten Wehmutter hatte oder warum die Ausübung dieser Kunst eines Tages für mein Leben von so großer Bedeutung sein würde.
»Ihr seht mir nicht wie eine Wehmutter aus«, fiel Bruder Gregory ihr ins Wort und pustete dabei auf die Seite, dass sie trocknete. Er hatte das Gesicht abgewandt, um seinen Ekel zu verbergen. Man darf zwar die Geburt, sagen wir, der Jungfrau Maria im Beisein von Engeln beschreiben, doch diese Frau wusste einfach nicht, was Diskretion war.
»Ich bin keine mehr«, erwiderte Margaret und blickte ihn kalt an.
»Das versteht sich von selbst; es ist eine Kunst, die nicht von Frauen in achtbaren Lebensumständen ausgeübt wird«, sagte Bruder Gregory und blickte sich dabei um.
»Es sollte der achtbarste Beruf auf der ganzen Welt sein – Wehmütter sind Zeuge, wie Gott die Welt neu erschafft«, sagte Margaret so zähneknirschend, dass Bruder Gregory klar wurde, er hatte zwischen seinem literarischen Geschmack und seinem Essen in der Küche zu wählen.
»Sie sind Zeuge, wie die Frucht der Sünde herabfällt«, knurrte er in sich hinein.
»Was war das?« Sie blickte ihn an.
»Gott möchte uns durch die Art unserer Entstehung demütigen«, sagte er laut – und vornehmlich mich, dachte er bei sich, als ihm der Duft aus der Küche wieder einfiel.
»Freut mich, dass Ihr es seht wie ich«, sagte Margaret. »Also, diesen neuen Absatz könnt Ihr oben auf die Seite setzen, dorthin. Schreibt groß, das sieht so hübsch aus.«
Aber ich wollte doch aufgeschrieben haben, wie die Ereignisse von damals Fortunas Rad in Bewegung setzten, sodass David und ich für immer getrennt wurden, und das will ich auch.
Die neue Mutter und die neuen Brüder und der neue Säugling trieben David immer öfter ins Pfarrhaus.
»Was machst du denn die ganze Zeit bei Vater Ambrose, David?«, fragte ich ihn, als er eines Abends zurückkehrte.
»Ach, er zeigt mir und Robert, dem Jungen vom Gerber, alle möglichen herrlichen Dinge. Den Jungen vom Küfer hat er rausgeworfen, weil er gelogen hat, aber er sagt, wir sind lieb und lernen gut.«
»Was lernst du denn noch außer Messgehilfe?«
»Ach, viele Dinge. Da, sieh mal, Schwester!« Und er zog mit einem Zweig mehrere Buchstaben in den Staub. »Das ist mein Name! David!«, sagte er triumphierend.
»Ach, das sieht aber hübsch aus, David. Kannst du auch ›Margaret‹ schreiben?«
Er machte ein betrübtes Gesicht.
»Es ist ein ›M‹ drin, so viel weiß ich, aber er ist schrecklich lang. Vielleicht kann Vater Ambrose mir das zeigen, und dann zeige ich es dir.«
»Ehrenwort?«
»Ehrenwort, ich verspreche es hoch und heilig.«
»Dann zeig mir das ›M‹ jetzt, damit ich es erkenne.«
»Vielleicht sollte ich zuerst Vater Ambrose fragen. Er sagt, es gibt ein paar Dinge, die sind richtig geheim und ziemen sich nicht für Frauen ...«
»Aber ein ›M‹ ist doch kein Geheimnis. Du hast mir schon davon erzählt, also ist es gar nicht mehr geheim, kein kleines bisschen. Und dann bin ich auch keine Frau, sondern deine Schwester.«
David sorgte sich so sehr, dass er ein ganz betrübtes Gesicht machte. »Na gut. Pass auf, ich zeig’s dir.«
Und auf diese Weise lernte ich den Buchstaben »M«, mit dem ich unterzeichne anstelle des Kreuzes, wie es andere Leute machen.
»Was tust du da, Margaret, Maulaffen feilhalten?« Aus dem Haus drang Mutter Annes schrille Stimme, begleitet von dem immer lauteren Gebrüll des Säuglings.
»Ich spinne, Mutter, ich spinne und unterhalte mich dabei mit David.« Doch es stimmte nicht, denn die Kunkel hatte geruht, seit ich David auf der Straße erblickt hatte.
»Mit David?« Sie streckte den Kopf zur Tür heraus, und das Kind an ihrer Brust machte gierige Schlürfgeräusche.
»Komm herein, Kind, komm herein – draußen ist es kalt, und zum Abendessen gibt es einen guten Eintopf. Was sind denn das für Zeichen? Schrift? Wie furchtbar klug du doch bist! Ja, du könntest doch Priester sein!« Sie strahlte David an. Mutter eines Priesters, so sahen die herrlichen Träume aus, in denen sie sich wiegte. Welch großartige Stellung ihr das verschaffen würde! Wie man sich verneigen würde, wenn sie sich zusammen mit ihrem Sohn, dem Priester, zeigte! Genoss doch bereits die Mutter eines Knaben mit rein gar nichts als der ersten Tonsur Achtung. Und angenommen, er bekam eines Tages eine Pfarre und würde »Hochwürden David« genannt? Dann erblickte sie die jämmerlichen Spinnversuche auf meinem Schoß.
»Und du, Margaret, was ist denn das für ein Durcheinander auf deinem Schoß? Das nennst du spinnen? Solche Knoten und Knäuel, wie du sie machst, das ist die reine Verschwendung von guter Wolle. Wenn Müßiggang und Schwatzen sich so ungut auf deine Arbeit auswirken, dann musst du dir mehr Mühe geben und das Reden unterlassen. Nun kommt schnell herein, sonst verbrennen mir noch die Pfannkuchen in der Pfanne.« Wir beeilten uns, dass wir uns zu unserem Vater, den beiden Großen und dem Knecht zum Abendessen setzten.
An jenen kalten Adventtagen wurde es früh dunkel, und so lagen wir bald im Bett, und nur die trübe Glut des mit Asche abgedeckten Feuers spendete ein schwaches Licht. Damals, ehe wir anbauten, bestand das Haus aus einem einzigen Raum mit dem Herdfeuer in der Mitte und einer Art Abtrennung an einem Ende, wo man das Vieh zur Nacht unterstellen konnte. Dort hinten, wo die Ochsen und Knechte schliefen, gab es massenhaft gutes Stroh. Rings um das Feuer in der Mitte lagen flache Steine, darüber hing der Kochtopf. Eine runde, flache Pfanne für Pfannkuchen und ein paar kleinere Töpfe standen daneben. Der Rauch stieg zum geschwärzten Dachstroh hoch, wo er die Schinken und Speckseiten räucherte, welche von den Sparren herabhingen, ehe er durch die Rauchluke abzog.
Wir schliefen alle zusammen in einem großen Bett vorn im Haus, der Kleine in seiner Wiege, damit wir ihn nicht platt drückten. Doch selbst wenn die großen Jungen sich nicht hin und her warfen, fand man so leicht keinen Schlaf, denn das neue Kind, auf den Namen Martin getauft, kränkelte nach dem vielversprechenden Anfang. Das kalte Wetter machte ihn gereizt und weinerlich, des Nachts rollte er mit dem Kopf hin und her, und Stillen half auch nichts. Seine Nase lief Tag und Nacht. Manchmal lagen David und ich stundenlang wach und horchten auf das Kindergebrüll. Will und Rob stopften sich Wolle in die Ohren. Nichts konnte jedoch den Knecht stören, denn der war nicht nur zahnlos, sondern auch taub. Aber Mutters Gesicht wurde immer hagerer, und unter ihren Augen bildeten sich dunkle Schatten. Manchmal nickte sie am helllichten Tag beim Essenrühren ein. Vater wurde von Tag zu Tag gereizter, denn wie er sagte:
»Jemand, der bei Tage so hart arbeitet wie ich, verdient nachts ein bisschen Ruhe.«
In jener Nacht schlief Mutter so tief, dass sie das erste Geplärre des Kleinen nicht hörte. Dann wurde das schniefende Gegreine zu einem dünnen, auf- und absteigenden Gewimmer und weckte David neben mir aus dem Schlaf. Ich war schon wach.
»Hol dich der Teufel, du kleiner Bastard«, brummte eine schlaftrunkene Stimme unter der Decke an Vaters Platz. »Halt dein kleines Maul.«
»JiiiiIIIIIiiiiiIIIIIiii!«, ertönte es aus der Wiege.
»Anne, Anne.« Er puffte Mutter an die Schulter. »Stell was mit deinem Kind da an.« Mutter stöhnte und drehte sich um, aber sie wurde nicht wach.
»Sei still, sei still, du kleines Ungeheuer«, knurrte Vater, stand auf und redete auf die Wiege ein. »Dir werd ich zeigen, dass man einen arbeitenden Menschen nicht aufweckt!« Und er hob das gewindelte Kind hoch und schüttelte es kräftig durch. Das Gegreine hörte auf.
»Da, dir hab ich’s gezeigt. Jetzt hast du wohl etwas mehr Achtung, was?« Er legte Martin wieder hin und stieg ins Bett zurück, wo er sich die Bettdecke über die Ohren zog.
Die Stille vermochte, was der Lärm nicht geschafft hatte: Mutter Anne wachte auf. Schlaftrunken fühlte sie im Dunkeln nach der Wiege. Sie merkte, dass der Säugling anders lag, tastete noch einmal und machte die Augen auf, damit sie ihn mit beiden Händen hochheben konnte. Sein Kopf rollte unnatürlich zur Seite. Sie blickte ihn genauer an: Vor den weißen Lippen des Kindes stand dünner, blutiger Schaum. Sie berührte ihn mit den Fingern und befühlte noch einmal seinen Hals.
»Heilige Jungfrau Maria und all ihr Heiligen!« Sie stieß einen Schrei aus. »Was hast du getan? Was hast du getan?«
»Gott steh mir bei, Weib, halt den Mund! Zuerst macht der eine Krach, dann der andere. Ein Mann braucht seinen Schlaf!«
»Hugh, der Kleine ist tot!«
»Nicht tot, er schläft endlich, und lass mich in Ruhe.«
»Ich sag doch, er ist tot, er ist tot, und du bist schuld!«, zischte sie. Das machte Vater richtig wach. In der Dunkelheit glänzten Davids Augen riesig. Wir lagen totenstill da aus Furcht, Vater würde uns bemerken und mit uns ebenso verfahren. Mittlerweile war er hellwach, und nun dämmerte ihm auch endlich, was geschehen war. Mutter traten vor Entsetzen die Augen aus dem Kopf, während sie den schlaffen, kleinen Körper anblickte, der sich inzwischen grau verfärbt hatte. Dann warf sie Vater einen Blick so voller Abneigung und Abscheu zu, wie ich ihn mein Lebtag nicht wieder gesehen habe.
»Da sieh, ja, sieh nur, was du deinem eigenen Sohn angetan hast!« In diesem Augenblick geschah etwas Merkwürdiges. Vaters Gesicht gab nach, es fiel einfach in sich zusammen, und er sagte mit weinerlicher Stimme:
»Aber das habe ich nicht gewollt, ich habe es wirklich nicht gewollt!«
Stumm streckte ihm Mutter das Kind mit dem baumelnden Kopf hin.
»Ich schwöre bei allen Heiligen, dass ich das wirklich nicht gewollt habe. Versteh doch, Anne, ich habe es nicht gewollt.« Kläglich und kleinlaut fummelte und zupfte er an der Bettdecke herum.
Von diesem Augenblick an änderte sich aber auch alles bei uns zu Haus, denn nun führte Mutter das Regiment. Sie brauchte nur zu sagen: »Und wo ist Martin?«, oder: »Gib mir meinen Sohn wieder«, und schon hörte Vater auf zu poltern, sah betreten drein und stimmte allem zu, was sie auch immer vorschlug. Der kleine Martin bekam ein Leichentuch aus einer Leinwand, wie man sie so fein noch nie im Dorf gesehen hatte, aber abgesehen davon wurde nicht weiter darüber geklatscht, denn zur Winterszeit begräbt man viele Säuglinge.
In jenem Frühling entschloss sich Mutter dann auch, das Brauen aufzunehmen, eine Kunst, auf die sie sich gut verstand. Vater war allmählich immer weniger zu gebrauchen, und so meinte sie, hiermit sei Geld zu verdienen. Und Vater ließ sie jetzt in allem gewähren. Es war nicht nur, dass er sich ihr nicht mehr widersetzen konnte, er hatte ohnedies nur noch einen Gedanken im Kopf: Ale. Und so sagte ihm die Idee, einen großen Vorrat davon im eigenen Haus zu haben, natürlich sehr zu. Der Küfer machte Mutter ein paar ordentliche, große Fässer, und als die erste Portion fertig war, hing sie vor dem Haus das Ale-Aushängeschild mit dem Burschen auf, was anzeigte, dass hier ausgeschenkt wurde, und nannte sich von Stund an ›Anne, die Brauerin‹.
Und ihr Ruf verbreitete sich so schnell, dass der Abt den Ale-Verkoster schickte, um die Qualität ihrer Braukunst zu prüfen. Nach einem ausgiebigen Rülpser sagte der treffliche Mann, besseres Ale hätte er in den letzten zwölf Monaten nicht zu kosten bekommen, und verbrachte den Rest des Tages dabei. Und Mutter schenkte das Maß so voll, dass es überfloss. Sie gehörte nicht zu jenen unehrlichen Brauern, die es ja geben soll und die man gleich neben ihren Maßen mit dem falschen Boden in den Stock legt. Mutter Anne verdiente bald so gut, dass wir bauen konnten: das große Vorderzimmer mit Bänken für die Kundschaft, im schiefen Winkel daran angebaut einen anderen Raum hinten am Haus, dazu noch ein Dachboden über dem Hauptraum, auf dem wir Kinder schliefen. Mit klug ausgewählten Geschenken und Schmeicheleien bekam sie sogar Vater Ambrose, welcher dergleichen Sündenpfuhl verabscheute, dahin, dass er widerstrebend zugestand, wenn es eine solche Stätte schon geben müsse, dann zumindest eine ehrliche.
Mir machte es Spaß, Mutter beim Brauen zu helfen, denn das ist eine große Kunst, für die es eines umsichtigen und achtsamen Charakters bedarf, aber allerhand Glück gehört auch dazu. Während sie arbeitete, war Mutter zu beschäftigt, um sich zu ärgern, und manchmal summte sie sogar tonlos vor sich hin.
Im zweiten Sommer, nachdem sie das Brauen aufgenommen hatte, waren wir gerade dabei, in mehreren großen Töpfen Maische anzusetzen, als Hochwürden Ambrose uns einen Besuch zu Hause abstattete.
»Ich bin auf der Suche nach Eurem Mann, Gevatterin, denn ich muss ihn geschäftlich sprechen«, rief der Priester. »Auf dem Feld habe ich ihn nicht angetroffen, daher suche ich ihn hier.«
»Ja, er ist drinnen, Vater. Er liegt wieder einmal krank danieder«, erwiderte sie liebenswürdig. »Aber bei der Hitze mögt Ihr doch sicher ein Ale.«
Und Hochwürden Ambrose, dem der Schweiß unter dem breitkrempigen Hut herunterlief, antwortete:
»Danke für die freundliche Einladung, Mutter Anne, heute will ich sie Euch nicht abschlagen.«
Während sie mir die Töpfe anvertraute, erklärte sie zu Vaters Rechtfertigung:
»Die Jungen sind alle im Heu, aber die Hitze hat ihm mächtig zugesetzt. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, Vater.« Ihre Stimme verklang im Haus. Als sich die Gelegenheit bot, ließ ich Arbeit Arbeit sein und spähte durchs niedrige, offene Fenster. Ich konnte sie beide an dem breiten, durchhängenden Bett stehen sehen, auf dem Vater sich rekelte.
»Hmm, wahrhaftig, die Hitze hat ihm mächtig zugesetzt«, sagte Vater Ambrose und rümpfte die Nase über den schalen Biergeruch, den Vater ausdünstete.
»Wach auf, komm zu dir, guter Hausvater, Hochwürden Ambrose ist in Geschäften zu dir gekommen«, sagte Mutter und überspielte ihre Verlegenheit, indem sie mit fahrigen Bewegungen so tat, als müsste sie etwas im Haushalt beschicken. Vater stöhnte und setzte sich im Bett auf.
»Ich bin in wichtigen Geschäften hier, Geschäften, die Euch mit großem Stolz und mit Freude erfüllen sollten.« Hochwürden Ambrose sprach ein wenig laut, so als wäre Vater taub. Der zuckte zusammen.
»Freude?«, murmelte er und versuchte sich zurechtzufinden.
»Und Stolz«, half Mutter nach, denn sie ahnte allmählich genau wie ich, um was es sich bei diesen Geschäften handelte.
»Gevatter Hugh, Euer Sohn David ist ein begabter Junge, womöglich hochbegabt.«
»Ach?« Vater kratzte sich und blinzelte.
»Ich habe ihm alles beigebracht, was ich weiß. Er trinkt die Gelehrsamkeit auf wie ein Schwamm.«
»Er trinkt? Wie das?«
»Er trinkt Gelehrsamkeit, trinkt Gelehrsamkeit, Hausvater, du Guter«, half Mutter nach.
»Ich schlage deshalb vor, ihn auf die Klosterschule in St. Matthew’s zu schicken. Ich werde ihn persönlich empfehlen.«
»Schule, kostet die nicht Geld?«, knurrte Vater.
»Das Schulgeld ist nicht hoch. Und nicht zu vergessen, Unterkunft und Verpflegung sind eingeschlossen. Also ist es noch weniger, denn zu Hause müsste er ja auch essen. Nicht alle Jungen können so gut lernen. Ihr dürft ihm seine vielversprechende Zukunft nicht verbauen.« Wenn einer ein begabter Schmeichler war, dann Hochwürden Ambrose, falls es die Umstände erforderten.
»Bezahlen, dafür, dass wir ihn wegschicken? Die Mönche da sollten lieber mir etwas für ihn bezahlen. Ich brauche ihn hier. Es gibt allerlei Arbeit, für die ich ihn brauche.« Vater wirkte ärgerlich, während er bierumnebelt die Nasenspitze des Priesters anstarrte.
»Denk doch nur die Ehre, Hausvater!«
»Er eignet sich zu höherer Gelehrsamkeit, wenn das in Euren Kopf hineingeht«, sagte Hochwürden Ambrose in herablassendem Ton.
»Gelehrsamkeit?«, begehrte Vater auf. »Ich werde ihn was lehren!«
»Nicht die Landwirtschaft, mein Sohn; ich meine die höhere Gelehrsamkeit.« Vater Ambrose wurde langsam aufgebracht.
»Höhere Gelehrsamkeit? Höhere Gelehrsamkeit?«, höhnte Vater.
»Der Vorschlag von Hochwürden Ambrose ist doch herrlich. Überlege es dir gut.« Mutter legte Vater beschwichtigend die Hand auf die Schulter.
»Hach, was verstehst denn du schon davon?«, fuhr Vater Mutter zornig an.
»Ja, aber sie ist doch – höher, ja, das ist sie, und höher ist besser.«
»Besser als was, besser als sein alter Vater? Ich werde ihn was höher lehren! Etwa höher als ein Priester, so ein alter Eunuch, der sich am Zehnten mästet!« Hochwürden Ambrose sah wütend aus und wollte gehen. Doch ehe er den Mund aufmachen konnte, hatte Mutter ihn schon beim Ärmel gepackt und flehte ihn an:
»Oh, bitte, bitte, ehrwürdiger Vater, bedenkt, was das für David bedeutet! Lasst es ihm in Eurem Zorn nicht entgelten. Kommt morgen, nein, lieber schicke ich Euch meinen Mann mit seiner Antwort morgen zur Kirche. Ach, denkt doch an den Jungen und nicht an seinen Vater!«
Das besänftigte den Priester, und er sah sie mit einem durchdringenden Blick an.
»Morgen also«, sagte er. »Ich warte bis Komplet, doch nicht länger«, und entfernte sich gemessenen Schrittes.
Ich musste zum Braukessel zurück, und während ich mich wieder an die Arbeit machte, hörte ich Mutter durchs offene Fenster keifen:
»Und ich sage dir, ich will es! Wäre Martin noch am Leben, er hätte es noch viel weiter gebracht!« Und so besuchte David in diesem Winter die Klosterschule, und Mutters ausgezeichnetes Bier zahlte dafür.
Bruder Gregory hörte auf und seufzte. Er musste es taktvoll anfangen.
»Der Text da ist sehr lang«, sagte er. Stumm ließ er die düsteren, intelligenten, dunklen Augen über die sauberen Reihen der kleinen Buchstaben auf der letzten Seite wandern. Es war gutes italienisches Papier, und das Ganze machte einen gefälligen Eindruck. Doch Bruder Gregory bewunderte nicht etwa seine Arbeit. Er hoffte inständig, dass niemand seine Handschrift erkennen würde.
»Macht Ihr Euch Sorgen wegen der Kosten? Wir haben mehr Papier, und davon haben wir auch noch mehr.« Margaret nahm einen Federkiel in die Hand und befühlte seine abgeflachte, ausgefaserte Spitze. Dann legte sie den Kopf schief und starrte das Geschriebene mit dem schlauen Blick eines Menschen an, der des Schreibens nicht kundig, aber entschlossen ist, sich nicht hinters Licht führen zu lassen.
»Lest mir die letzte Stelle noch einmal vor, ich möchte hören, wie sie klingt«, sagte sie so bestimmt, als feilschte sie auf dem Markt um einen Ochsenschwanz.
Bruder Gregory las mit feierlicher Stimme. Seine ernsthafte Miene mit dem leichten Anflug von Gereiztheit ließ ihn älter wirken, als er in Wirklichkeit war. Dieser Eindruck wurde noch durch das formlose, schäbige, knöchellange graue Gewand verstärkt, das er trug und das bei Margaret die vage Vorstellung erweckt hatte, er könnte ein Franziskaner sein. An den Ellbogen und am Gesäß war es ganz fadenscheinig, das sind jene beiden Stellen, die am Rock eines Gelehrten am ehesten abnutzen. An einem abgewetzten Ledergürtel trug er eine Börse, einen Federkasten, ein tragbares Tintenhorn und ein Messer in einer schlichten Scheide. An kalten Tagen wie diesem stopfte er ein Paar zerfledderte Beinlinge in seine Sandalen und warf sich einen Schaffellumhang über sein Gewand, das verfilzte Fell nach außen gewendet. Da Rasieren eine kostspielige Angewohnheit war, begannen Tonsur und Bart bei ihm auszuwuchern, und so waren denn seine finsteren, dunklen Augenbrauen von einem ungebärdigen schwarzen Lockenschopf überschattet.
Margaret nickte, als sie ihn vorlesen hörte, was sie gesagt hatte, und stellte dabei fest, dass sie am Überlegen war, wie alt er wohl sein mochte. Sehr alt, vielleicht dreißig. Nein, womöglich doch nicht so alt. Kann sein, gar nicht viel älter als sie selbst. Das machte der ernste Blick, denn er war beim Schreiben ganz bei der Sache, und das ließ ihn alt wirken. Margaret hatte sich angewöhnt, Bruder Gregory bei der Arbeit sehr eingehend im Auge zu behalten. Zunächst war da die Sache mit den Löffeln. Und dann ging es um das Geschriebene, das Seite um Seite bedeckte. Es schien echt zu sein; das heißt, alles sah unterschiedlich und dazu noch sauber und klein aus. Margaret beobachtete die eigenartig zierlichen Bewegungen, mit denen Bruder Gregorys Pranken die verschlungenen Linien aus Tinte über das Papier zogen. Von ihrer eigenen Näharbeit her wusste sie, dass so anmutige Bewegungen wie diese nur das Ergebnis langer Übung sein konnten. Und doch überprüfte sie den Fortgang stets nach ein paar Seiten, indem sie ihn eine Stelle noch einmal laut vorlesen ließ. Und jedes Mal hörte sie zu ihrer Erleichterung genau das, was sie gesagt hatte.
Das Licht des späten Nachmittags drang durch das dicke, runde, bleigefasste Glas, aus dem sich die kleine Fensterscheibe zusammensetzte, und zeichnete eine leuchtende Spur über den Eichenschreibtisch. Geklapper und Geklirr aus der Küche deuteten an, dass es bald Abendessen geben würde. Dem Lärm schriller Stimmen folgten ein Türklappern und eilende Schritte.
»Mistress Margaret, Mistress Margaret, die Mädchen zanken sich schon wieder! Es geht um rein gar nichts, bloß um ein Puppenkleid. Ich hätte sie gern beide durchgeschüttelt, weil sie Euch stören, aber Ihr habt gesagt, dass sie niemand als Ihr selbst anrühren darf, und da bin ich!« Die alte Kinderfrau schüttelte den Kopf und murmelte mehr zu sich: »Zankteufel, Zankteufel, eine wie die andere! Ohne die Rute hören sie doch nicht! Wie oft muss ich das noch sagen?«
»Bring sie herein, ich rede mit ihnen.«
»Reden? Reden? Wie Ihr wünscht, Mistress.« Und die alte Frau watschelte kopfschüttelnd aus dem Zimmer, sie war überzeugt, dass sie einer Irren diente, die man um jeden Preis gewähren lassen musste.