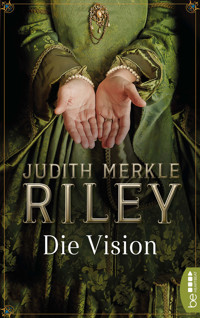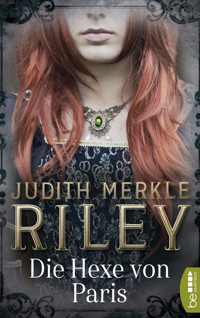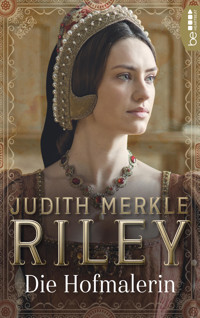4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Historisch, humorvoll, magisch - Merkle Riley!
Im Paris des 16. Jahrhunderts blüht das Geschäft der Wahrsager, Alchimisten und Giftmischer. Auch Königin Katharina von Medici hat sich der Schwarzen Magie verschrieben und möchte mithilfe des Herrn der Wünsche ihre Rivalin, die Mätresse des Königs, loswerden.
Doch das Kästchen fällt der jungen Dichterin Sibille Artaud de la Roque in die Hände. Sie hat ihre eigenen Wünsche - doch statt Glück gibt es Unheil und Verderben. Und nur der große Nostradamus weiß, wie der Fluch der geheimnisvollen Schatulle zu brechen ist ...
Dieser historische Roman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Die geheime Mission des Nostradamus" erschienen. Von Judith Merkle Riley, Autorin der erfolgreichen "Margaret von Ashbury"-Trilogie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Epilog
Über dieses Buch
Im Paris des 16. Jahrhunderts blüht das Geschäft der Wahrsager, Alchimisten und Giftmischer. Auch Königin Katharina von Medici hat sich der Schwarzen Magie verschrieben und möchte mithilfe des Herrn der Wünsche ihre Rivalin, die Mätresse des Königs, loswerden.
Doch das Kästchen fällt der jungen Dichterin Sibille Artaud de la Roque in die Hände. Sie hat ihre eigenen Wünsche – doch statt Glück gibt es Unheil und Verderben. Und nur der große Nostradamus weiß, wie der Fluch der geheimnisvollen Schatulle zu brechen ist ...
Über die Autorin
Judith Merkle Riley (1942-2010) promovierte an der University of California in Berkeley in Philosophie und war Dozentin für Politikwissenschaft in Claremont, California. Von 1988 bis 2007 schrieb sie sechs historische Romane, die allesamt zu Weltbestsellern avancierten.
Judith Merkle Riley
Die Dichterin
Aus dem amerikanischen Englisch von Dorothee Asendorf
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1999 by Judtih Merkle Riley
Translated from the English language: MASTER OF ALL DESIRES
First published in the United States by: Viking Penguin
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 1999 by Ullstein Buchverlage GmbH, München
Erschienen im List Verlag unter dem Titel »Die geheime Mission des Nostradamus«
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung eines Motives © istockphoto: Studio-Annika
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3724-2
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
»Das hier ist die Stelle«, flüsterte die Königin von Frankreich auf Italienisch. Sie deutete auf eine fast unsichtbare Ritze im Fußboden des vergoldeten Raumes. Der flackernde Schein einer einzigen Kerze warf verzerrte Schatten an die Wände. Die sommerliche Nachtluft war drückend heiß. Die Steinsäle und leeren Kamine des Sommers rochen nach Urin und Feuchtigkeit, Schimmel und Sommerfieber. Der Hof verweilte schon zu lange in Saint-Germain, daher die üblen Gerüche in den Zimmern des Palastes. In ein, zwei Monaten würde der König den Umzug in ein luftigeres Schloss befehlen. Eines, in dem das Wild im Park noch nicht durch zweimal wöchentliches Jagen knapp geworden war. »Ich habe den Tischler zwei unsichtbare Löcher in den Fußboden sägen lassen«, wisperte die Königin. »Dieser Raum liegt über ihrem Schlafzimmer. Heute Abend werden wir erfahren, mit welchem Hexenzauber diese alte Frau mir die Liebe meines Gemahls stiehlt.«
»Sie ist zwanzig Jahre älter als Ihr beide. Wenn Ihr eine Jüngere, Schönere und Euch Ergebene fändet, könntet Ihr ihre Macht gewiss brechen und ...«, antwortete die dame d’honneur der Königin ebenfalls im Flüsterton und in der Sprache Katharinas von Medici, die in den Gemächern der altehrwürdigen Festung klang wie das Zischeln fremdländischer Verschwörer.
»Meint Ihr, ich hätte es nicht versucht? Ein kurzer Augenblick, und er ist wieder bei ihr, stellt sich mit der steinalten Hure überall zur Schau und versteckt mich, als ob ich die Mätresse wäre. Ich will ihren Einfluss auf ihn für immer brechen. Sie muss mir weichen.«
»Madame, Ihr seid die Königin ...«
»Und es darf nie herauskommen, dass ich dabei die Hand im Spiel hatte. Solange er sie liebt, wird er sich an mir rächen, falls ihr etwas zustößt. Aber wenn er sie nicht mehr liebt ...«
»Also müsst Ihr herausfinden, welchen Hexenzaubers sie sich bedient.« Ihre Begleiterin nickte zustimmend.
»Genau.« Katharina von Medici, Königin von Frankreich, in deren Augen ein lange und tief verborgener Groll schwelte, fasste nach dem Zaubermedaillon an ihrem Hals, das aus menschlichem Blut gegossen war. »Sie hat einen mächtigen Hexer gefunden. Aber wo? Nur die Ruggieri besitzen solche Macht, und die gehören mir. Falls Cosmo mich verraten hat, dann bei Gott ...«
»Gewiss nicht, Majestät. Es gibt noch andere Zauberer im Königreich. Cosmo Ruggieri ist mit uns aus Florenz gekommen. Sein Vater hat Eurem Vater gedient. Diese Person würde sich kaum an einen Untergebenen wenden, oder? Er könnte sie verraten.«
»Oder auch nicht. Man sollte die Verschlagenheit der Ruggieri nicht unterschätzen. Sie sind so hinterhältig wie eine Schlangenbrut ... Oh, wie ich sie kenne. Ich werde ihren Zauber ausfindig machen, und Cosmo muss ihn brechen. Die Zeit ist reif: Ich habe lange genug im Schatten dieser alten Frau gestanden. Sie macht mein ganzes Glück zu Staub.«
»Gewiss kann es nur der Ring sein, Majestät«, raunte Lucrèce Cavalcanti, Madame d’Elbène. »Der ganze Hof tuschelt darüber, dass er aus dem Blut eines ungetauften Kindes gegossen wurde. Es ist der Ring, der ihn versklavt. Heute Abend werdet Ihr sehen, dass es sich so verhält.« Sie beugte sich vor und hielt die Kerze dichter an die Stelle, während sich Katharina von Medici hinkniete und nach dem Verschluss tastete, mit dem man die Diele lösen konnte. »Löscht die Kerze«, flüsterte die Königin ihrer Hofdame zu. »Sie könnte uns verraten.« Nichts als ein matter Sternenschimmer erhellte den Raum, während die beiden Frauen auf dem Fußboden lagen und in das hell erleuchtete Schlafzimmer unter sich spähten.
Die Mätresse des Königs lag nackt auf dem Bett mit dem Baldachin und den schweren Vorhängen, hatte die Arme unter den Kopf gelegt und ihr ergrauendes Haar auf einem Berg reich bestickter Seidenkissen ausgebreitet. Ihr blasser Körper bildete einen starken Gegensatz zum dunklen Grün der samtenen Tagesdecke. Ihre schwarzen Augen funkelten im Kerzenschein, und ihre schmalen, geschminkten Lippen lächelten triumphierend, als der König, ein kräftiger, schwarzhaariger Mann, zwanzig Jahre jünger als sie, seine robe de chambre abwarf. Fast hatte es den Anschein, als ob sie wüsste, dass es an diesem Abend Augenzeugen ihrer Macht gab.
Diana von Poitiers’ Gesicht war nicht mehr jung und voll winziger Fältchen. Doch die beiden Beobachterinnen mussten einen erstaunten Ausruf unterdrücken, als sie den Körper der Älteren erblickten. Er war weiß, schlank und behänd wie der einer Zwanzigjährigen. Mit eiserner Disziplin hatte sich die kinderlose Mätresse diesen bleichen Abglanz einer jüngeren Gestalt bewahrt, während die Königin trotz des engen Schnürleibs mit Stahlstäben und juwelenbesetzten Kleidern ihren von jährlichen Schwangerschaften entstellten formlosen Leib nicht verbergen konnte. Du Intrigantin, du Ungeheuer, dachte die Königin. Wenn ich dich erst los bin, mache ich mich auch schön. Ich lasse Masseure kommen, lasse Liebestränke zubereiten. Dann reite ich bei großen Auftritten an der Seite des Königs, und bei jedem Turnier trägt er meine Farben und mein Motto, statt mich zu verstecken wie ein schmähliches Geheimnis. Heute schämt er sich bei meinem Anblick. Aber morgen wird er mich lieben.
Im vergoldeten Bett unter dem Guckloch verbanden sich die beiden beweglichen Leiber, der eine etwas dunkel behaart, der andere so weiß wie Milch, zu immer neuen phantasievollen Figuren. Die beiden Zuschauerinnen hatten solch ein Liebesspiel nie zuvor gesehen. Die Königin dort oben im Dunkel machte große Augen und rang leise nach Luft. Jetzt hatten die Liebenden eine neue Position eingenommen, die Mätresse bewegte sich lustvoll stöhnend auf dem König, der diese neue Variante ebenfalls zu genießen schien. Nie im Leben wäre die Königin auf die Idee gekommen, dass es solch leidenschaftliche Umarmungen, solch liebevolle Zärtlichkeiten gab. Warum wusste sie nichts davon? Warum hatte er sie nicht die Kunst der Liebe gelehrt? Standen ihr weder Leidenschaft noch Achtung zu? In vollendeter Harmonie hatten sich die beiden zur Seite gerollt, und dann glitten sie unter einem Schwall von Bettlaken zu Boden, als hätten sie diese graziöse Bewegung einstudiert. Dort, auf den kühlen, harten Fliesen des Fußbodens erlangten der König und seine Mätresse gemeinsam den Höhepunkt. Der leidenschaftliche Aufschrei Heinrichs II. hallte noch im Raum darüber wider, als seine Frau die Diele wieder an Ort und Stelle legte. Zornestränen, die im Dunkeln niemand sah, liefen ihr über das Gesicht.
»In all den Jahren, die wir jetzt verheiratet sind«, flüsterte sie, »hat er mich kein einziges Mal so berührt. Mein Haar – es war schön –, nie hat er es so gestreichelt, zehn Kinder, und er hat mich noch nie geküsst. Er kommt im Dunkeln und geht ohne eine Kerze. Wer bin ich, dass er mich wie eine Kuh behandelt und sie wie eine Frau?«
»Aber Majestät, Ihr seid die wahre Königin. Sie ist schließlich nur eine Königshure.«
»Ja, ich bin die Königin«, sagte die pummelige kleine Frau. »Ich bin die Königin, und sie ist es nicht.« Sie richtete sich auf und glättete ihre zerdrückten, staubigen Röcke. »Sieht er denn nicht, wie alt sie ist? Ich war vierzehn, als ich zu ihm gekommen bin. Mein Onkel, der Papst, hat mich in aller Pracht, in einer vergoldeten Galeere mit Sklaven in silbernen Ketten geschickt. Und wer war sie? Ein Niemand. Es muss der Ring sein, der ihn so blind macht. Der Ring, den sie ihm geschenkt hat. Dieser Ring muss von seiner Hand entfernt werden.« Und dann soll mir Cosmo einen Liebestrank brauen, dachte sie. Ich will endlich haben, was mir zusteht, statt mich mit den kalten Resten von der Reichen Tafel zu begnügen.
»Man muss lediglich den richtigen Augenblick abpassen«, meinte Madame d’Elbène.
»Wenn einer Warten gelernt hat, dann ich«, sagte die Königin und ordnete ihre kunstvoll gezwirbelten Locken. »Ich habe auf vieles gewartet. Dennoch ...«
»Ja, Majestät?«
»Als ich jung war, hat man mich eine Schönheit genannt. Warum hat mich der König, mein Gemahl, nie so geliebt?«
Kapitel I
Paris, 1556
Gestrigen Tages Orléans verlassen. Gasthof Zu den drei Königen. Vermaledeites Gemäuer. Gasthof Zu den drei Räubern wäre ein ehrlicherer Name. Betten abscheulich. Frühstück, drei Sous. Ungenießbar. Hat mir die Eingeweide verknäuelt. Die Stadt selbst wird stark überbewertet. Griesgrämige Menschen. Hohe Preise. Zu viele Ketzer. Ein Horoskop für den Bischof erstellt. Habe den doppelten Preis genommen.
Paris durch die Porte St. Jacques betreten. Unweit der Rue de la Bûcherie blockierte mir eine unleidliche Studentenhorde von der medizinischen Fakultät den Weg. Wurden unhöflich, als ich sie aufforderte, die Straße freizugeben. Beschimpften meine Robe, die nicht die ihrer Fakultät war. Rufe, ich sei ein fremdländischer Kurpfuscher, Angebote für einen kostenlosen Aderlass und andere Dinge, die zu derb sind, um sie hier zu erwähnen. Wie immer sieht Paris rot beim Anblick von Roben studierter Doktores, nämlich denen unserer medizinischen Fakultät in Montpellier. Kriecher. Speichellecker von der theologischen Fakultät. Können doch nichts weiter als zur Ader lassen und abführen. Und die wagen es, den großen Paracelsus schlechtzumachen! Wir im Süden würden einen Absolventen dieser elenden Pariser Fakultät niemals herumpraktizieren lassen.
León soll meine Doktorrobe reinigen lassen.
Gasthof Saint-Michel in Paris. Mein Name. Ein gutes Omen für einen Gasthof. Saubere Bettwäsche. Abendessen, fünf Sous. Das Ragout passabel, der Wein verdient den Namen Essig.
Muss eine neue Ausgabe von Scaliger auftreiben. Und es mit Barbe Renault versuchen. Zweifellos überbewertet. Morel erzählt mir, dass Simeonis neue Weissagung vom Ende der Menschheit in einer großen Flut im Jahre 1957 zurzeit die große Mode sei. Simeoni ist ein Esel. Könnte nicht einmal das Ende des Monats vorhersagen. Wie lange dauert es noch, bis er bei der Königin in Ungnade fällt? Habe León zum Louvre geschickt, damit er dem Oberhofmeister der Königin meine Ankunft meldet.
Hier will man anscheinend einen Vorschuss auf meine Rechnung haben. Hat etwas mit fremdländischen Doktores zu tun, die bei Nacht und Nebel verschwinden. Morel angehen, ob er mir fünfzig Nobel leiht.
Gestern auf dem Weg seltsame Zeichen. Eine Schlange mit zwei Köpfen, die sich auf einem Stein sonnte. Wahrlich, die zweiköpfigen Kreaturen belagern mich. Das zweiköpfige Kind von Aurons, das zweiköpfige Kind von Senas. Die Zeit der blutigen Kirchenspaltung naht. Später am selben Tag Begegnung mit einer jungen Dame vom Lande in Trauer. Reiste mit einem hässlichen Hund in die entgegengesetzte Richtung. Albern, aufgeblasen, starrköpfig. Aber eine sonderbare Aura. Habe die schreckliche Vorahnung, dass sie für kurze Zeit die Zukunft Frankreichs in Händen halten wird. Grässliche Vorstellung. Schlecht geträumt. Mit Anael überprüfen.
Das geheime Tagebuch des Nostradamus
»Ihr«, so sagte der Fremde in der Robe eines Doktors mit viereckigem Hut, während er mich von Kopf bis Fuß musterte, »Ihr schreibt schlechte Gedichte.« Sein Blick war aufreizend, sein langer, grauer Bart von der Art, die Krümel fängt. Für eine Antwort war ich mir zu schade. Woher mochte er Kenntnis von meinen kleinen Seelenergüssen haben?, fragte ich mich, doch eine Unterhaltung mit diesem ungehobelten Klotz in aller Öffentlichkeit, das war weit unter meiner Würde. »Ihr klimpert auf der Laute, schreibt banale Etüden für das Spinett und verfasst ärgerliche Abhandlungen über die Natur«, fuhr er fort. »Eine Pfuscherin auf allen Gebieten, die der Versuchung nicht widerstehen kann, ihre Nase in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken.«
»Wir sind einander nicht vorgestellt worden«, entgegnete ich so schneidend wie möglich, während ich den Becher mit dem übel schmeckenden Apfelwein neben mich auf die rustikale Bank stellte. Über uns in den Bäumen, in deren Schatten die Bänke standen, zwitscherten die Vögel. Hinter uns die Schänke am Wegesrand, eine strohgedeckte Bauernkate, die kaum von einem riesigen Heuhaufen zu unterscheiden war. Nur der Besen über der Tür kennzeichnete sie als Stätte der Rast. Selbiges trug sich im Sommer des Jahres 1556 zu, dem zweiundzwanzigsten Jahr meines Lebens und somit in einer Zeit, in welcher die Frische der Jugend schwindet, um den mageren Jahren einer möglicherweise langen Jungfernschaft zu weichen. Der Bauernjunge, der den Zügel meines Pferdes führte, tränkte das Tier am Trog und war zu weit entfernt, als dass ich ihn hätte rufen können. Gargantua, mein gescheckter Jagdhundwelpe, lag zu meinen Füßen, japste vor Hitze und ließ die lange, rosige Zunge aus dem Maul hängen. Ein nutzloser Hund, der selbst zum Bellen zu faul war. Wie sollte ich nur diesen irre redenden, alten Mann loswerden?
»Wir müssen einander nicht vorgestellt werden«, erwiderte der Fremde und musterte mich unter buschigen, weißen Brauen. »Ich kenne Euch bereits. Ich bin gekommen, um Euch zu beschwören, kehrt heim und lebt bei Eurer Familie, wie es sich für eine ehrbare Frau geziemt. Beide, Ihr und das Königreich, werden dabei besser fahren.«
»Ich habe keineswegs die Absicht«, sagte ich. »Außerdem ist es nicht möglich. Ich muss Orléans erreichen, ehe man die Tore vor Sonnenuntergang schließt.«
»Was Ihr getan habt, könnt Ihr nicht ungeschehen machen, aber es liegt in Eurer Macht, Kommendes abzuwenden. Kehrt heim, sage ich.« Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Angenommen, er redete nicht irre? Angenommen, er war ein Spitzel? Hatte er irgendwie den Grund für meine übereilte Flucht vom elterlichen Gut herausgefunden? Ich erhob mich jäh – allzu jäh –, wollte vor ihm fliehen, stieß jedoch den Becher um und verschüttete die Neige des Apfelweins auf den Saum meines Trauerkleides. Hastig bückte ich mich, um die Tropfen von der dunklen Wolle wegzuwischen und den Becher aus dem Staub zu heben. Mir war, als hörte ich ihn stillvergnügt lachen.
So wie die Spitzel, ehe sie zum bailli gehen, dachte ich. Sie lachen über ihre Opfer. Wirklich, es war nicht meine Schuld, dass ich Thibauld Villasse erschossen habe. Zugegeben, ich kannte sein Gesicht sehr wohl, schließlich war ich endlose Monate mit ihm verlobt gewesen, aber man bedenke, es war dunkel, und er war maskiert. Außerdem haben meine poetischen Bestrebungen und dazu noch feine Stickarbeiten kürzlich eine gewisse Kurzsichtigkeit bei mir bewirkt. Was hätte ich denn anderes tun sollen?
Ich muss jedoch gestehen, dass ich flüchtig Gewissensbisse verspürte, als sich der Rauch verzogen hatte und ich merkte, dass das Gesicht an der Fensterbank verschwunden war. Was für ein schrecklicher Sturz, o weh, hinunter auf den mondbeschienenen Hof, und das mir, die ich von Natur aus so ungemein zartbesaitet bin. Ei, ich kann nicht einmal einen Vogel aus dem Nest fallen sehen, ohne ihn wieder hineinzuheben. Außerdem trug ich Trauer um ihn, was der Welt zeigte, dass mir das Ganze leidtat. Es war eindeutig nicht ich, die Vaters arquebuse abgefeuert hatte, sondern die Hand des Schicksals. Und Schicksal kann man nicht ungeschehen machen.
Genau das sagte ich auch dem alten Doktor: »Man kann das Schicksal nicht ändern.«
»Demoiselle, ich habe diese ganze lange, ermüdende Reise nur unternommen, weil ich das Schicksal ändern will, und dem Reich zuliebe flehe ich Euch an, Ihr müsst heimkehren.«
»Und mir zuliebe muss ich weiterreisen. Ändert das Schicksal auf andere Weise.« Das Gesicht des Fremden lief hochrot an, er schnaubte vor Wut.
»Ihr eingebildete Jungfer, so wisset, dass mich große Könige für einen einzigen guten Rat mit Börsen voller Gold entlohnten.« Ich jedoch bin eine Artaud de la Roque, Beleidigungen vermochten es noch nie, mich umzustimmen. Ich blickte ihn also von oben herab an, eine meiner erfolgreichsten Übungen in Missachtung, da ich höher gewachsen bin als gewöhnliche Menschen.
»Dann geht hin und beratet sie. Ich tue, was mir beliebt.« Als ich mich zum Gehen wandte, wirkte er so niedergeschlagen, dass dieser aufgeblasene, alte Schaumschläger beinahe mein Mitleid erregte. Dem Akzent nach ein Mann aus dem Süden. Allesamt Aufschneider, diese Leute aus dem Süden. Der Doktor hier hatte ganz offenkundig zu viele Arzneien eigener Herstellung geschluckt, Könige, dass ich nicht lache.
»Bleibt, wartet ...«, bat er, und ich hielt inne. Er musterte mich vom Scheitel bis zur Sohle mit abschätzendem Blick. »Dennoch ... ja ... es könnte klappen. Doch hört auf meine Warnung: Hütet Euch vor der Königin der Schwerter.«
»Ich habe keine Ahnung, wovon die Rede ist«, entgegnete ich.
»O doch, das habt Ihr«, sagte er, als ihm sein Diener sein Reittier zuführte. »Damen wie Ihr legen doch ständig tarocchi.« Sein Diener trat herzu, und ich bemerkte, dass er nicht etwa einen Maulesel brachte, was für einen Doktor angemessen wäre, sondern königliche Postpferde. Der seltsame, alte Mann war in Geschäften der Krone unterwegs. O je, also musste er doch eine bedeutende Persönlichkeit sein. War ich zu unhöflich gewesen? Kannte er mein fürchterliches Geheimnis? Als wollte er meine unausgesprochene Frage beantworten, drehte sich der wunderliche Doktor um, mit einem Fuß bereits im Steigbügel. »Trauer, pah! Ihr solltet Euch schämen.« Mir blieb fast das Herz stehen.
Die Besitzerin in schlampiger Schürze und Haube ging mit mehreren Bechern ihres ekelhaften Gebräus an mir vorbei. »Gute Frau«, sagte ich (so macht die Höflichkeit allesamt Lügner aus uns), »sagt an, kennt Ihr den Namen jenes ältlichen Burschen mit dem langen Bart und der Doktorrobe?«
»Von dem da? Aber gewiss doch. Aus der Provence in Geschäften der Königin unterwegs. Sein Diener scheint seinen Namen für sehr bedeutend zu halten. Doktor Michel de Nostredame, ha. Mir sind hier schon vornehmere untergekommen, das könnt Ihr mir glauben.«
Nostradamus. Das Gesprächsthema in jedem Salon und modischen cénacle seit dem Erscheinen seines Büchleins mit Prophezeiungen in Versform. Also kein Spitzel des öffentlichen Anklägers, sondern ein Weissager, der die Zukunft auslegte. Allein schon beim Klang seines Namens spürte ich, wie mich ein kalter Schauer durchrann. Das Schicksal und ich, wir waren uns soeben auf der Straße nach Orléans begegnet.
Aber was hatte er mit seiner Bemerkung über das Königreich gemeint?
Kapitel II
Der Morgen dämmerte herauf, jedoch so stickig und warm, dass er keine Erleichterung mit sich brachte und einen schwülen, unerträglichen Nachmittag verhieß. Diana von Poitiers hatte ein kaltes Bad genommen, und zwei Zofen mit Tüchern standen bereit, um sie trockenzureiben. Der Palast war erwacht; in den Küchen klapperten Töpfe, in den Ställen wurden Pferde gestriegelt und gesattelt, die beiden prächtigsten für Diana und den König. In dem ein oder anderen Zimmer stand ein Zecher, der verschlafen hatte, torkelnd auf, reckte und streckte sich, pinkelte in den Kamin und rief nach etwas zu trinken. In einem Schlafgemach hielt die Königin ihr levée, und die Herzogin von Nevers reichte ihr das Hemd. In einem anderen ließ sich der König, dessen langes, oft grämliches Gesicht heute eigenartig zufrieden wirkte, von einem Kammerdiener die Nesteln zumachen, während er den Höflingen ringsum Befehle erteilte. Er dachte über einen Umzug nach Fontainebleau nach, wo die Luft frischer war, ehe man im Louvre in Paris überwinterte. Na schön, vielleicht nicht nur im Louvre. Vielleicht auch in Anet, einem Kleinod von einem Schloss, das er seiner Mätresse geschenkt hatte. Sie hatte davon gesprochen, dass sie zu Weihnachten für den gesamten Hof prächtige Lustbarkeiten plane. Ein Höfling trat mit einer Botschaft zu ihm. Ach, wie lästig – die Botschafter der Republik Venedig, und schon so früh? Die müssen noch einen Tag warten, ehe ich sie empfangen kann. Der Kronrat muss noch über die neueste Unverschämtheit des Königs von Spanien beraten. Ja, Spanien wird zu mächtig. Nein, falls die Ketzer weiter ihrer calvinistischen Lehre anhängen, müssen sie zum Wohle des Staates hingerichtet werden. Für Rechtsbruch gibt es keine Entschuldigung.
An ebendiesem Morgen gab Diana von Poitiers, le Grand Sénéchal und Herzogin von Valentinois, Hüterin der Kronjuwelen, Räuberin von Ländereien und Mittelpunkt von Günstlingswirtschaft und Korruption, eine Audienz. Mehrere Dichter hatten als Bezahlung für Werke, die ihre Schönheit und Klugheit priesen, um königliche Zuwendung gebeten; ein Bildhauer war einbestellt worden und sollte den Auftrag erhalten, ein Halbrelief zu schaffen, das Diana in idealisiertem, unbekleidetem Zustand als Göttin der Jagd in inniger Umschlingung mit einem Hirsch zeigte. In Wahrheit hatte sie nichts für die Jagd übrig, doch als Symbol gefiel ihr die ewig jungfräuliche und jugendliche Göttin Diana durchaus. Schließlich gilt nur, was die Menschen von einem denken, nicht, wie man ist, sagte sich Diana, als sich der Bildhauer entfernt hatte. Alle Welt preist meine unvergängliche Schönheit, wie könnte es der König da wagen, anders darüber zu denken? Ich habe aus einem langweiligen, verdrießlichen kleinen Jungen einen legendären Liebhaber gemacht. Welcher Mann verzichtet absichtlich auf solch einen Titel? Und falls er sich nicht sieht, wie er ist, wird er auch mich nicht sehen, wie ich bin. Ein eisiges, schmales Lächeln huschte über ihr stark geschminktes Gesicht.
Nach den Künstlern stellten sich mehrere entfernte Verwandte ein, denen es nach Ämtern und Kirchenpfründen gelüstete; sie gingen nicht unverrichteter Dinge, obwohl keiner von ihnen auch nur ein Fünkchen Sachkenntnis besaß. Es folgte ein Buchhalter, der ihr über den Besitz berichtete, den man bei hingerichteten Ketzern beschlagnahmt hatte, denn in einem schwachen Augenblick hatte ihr der König das Recht daran geschenkt. So ausnehmend wenig? Aber Ketzerei musste es doch wohl auch in höherstehenden Kreisen geben. Vielleicht sollte man mehr Spitzel einsetzen und weniger Nachsicht mit großen Namen üben. Schließlich würden die Lustbarkeiten in Anet teuer werden ... Diana stand auf und wollte gehen, als eine ihrer getreuen Hofdamen einen katzbuckelnden Tischler hereinführte. Diana kniff erfreut die Augen zusammen, während sie ihn ausfragte.
»Zwei Löcher? In der Decke meines Schlafgemaches sagst du? Wie nett, mich darüber zu informieren. Du sollst diesen Raum nicht als armer Mann verlassen. Und verabsäume nicht, mir auch von anderen kleinen Diensten zu berichten, mit denen die Königin dich beauftragt.« Als der Tischler sich unter Bücklingen rückwärts entfernte und Gott und die schöne, gnädige Herzogin pries, da lächelte Diana insgeheim. Auch gut, dachte sie, man muss diese erbärmliche Tochter eines italienischen Kaufmanns daran erinnern, wer hier regiert und warum – und dass sie nicht die allerkleinste Aussicht auf Erfolg hat.
In diesem Teil der Stadt der wässrigen Straßen waren die Häuser viel höher, zählten drei oder vier Stockwerke und standen aus Platzmangel dicht an dicht, die Zimmer waren niedrig und beengt, die unteren Stockwerke ohne Sonne. Wäsche hing über den schmalen Seitenkanälen, und der faulige Gestank des Wassers vermischte sich mit dem Geruch nach ärmlicher Küche: Knoblauch, Kohl und Zwiebeln. Als der letzte Sonnenstrahl die Fassaden der reichen Palazzi am Canal Grande vergoldete, lagen die Schatten schon dunkel in den schmalen Gassen des Ghettos von Venedig. In einem Zimmer im obersten Stockwerk eines dieser uralten Gebäude durchsuchte ein junger Mann mit glattem braunem Haar gierig die Borde eines großen, geöffneten Schrankes mit geschnitzten Füßen. Hinter ihm öffnete sich leise die Tür, und ein alter Mann trat geräuschlos ein. Er hatte einen langen, weißen Bart, trug ein Scheitelkäppchen und eine knöchellange Robe. Sein Gesicht war tief gefurcht und wies Narben von früheren Verwundungen auf.
»Endlich bist du gekommen. Ich habe dich erwartet.« Der junge Mann fuhr herum und stand mit gezücktem Messer vor ihm.
»Lass das«, sagte der alte Mann und musste husten. Er drückte ein Tuch an den Mund und zog es blutbefleckt zurück. »Was du suchst, befindet sich in der Truhe unter dem Fenster.« Der junge Mann ging rückwärts zum Fenster, denn er wollte den alten Mann nicht aus den Augen lassen, falls dieser es mit einem Trick versuchen sollte. »Die Sterne haben mir gesagt, dass du heute Abend kommst«, hauchte der Alte. Über sein Gesicht huschte ein schmales, ironisches Lächeln. Sterne, dachte der Jüngere. Das muss ein Trick sein, irgendein Zaubertrick. Erneut misstrauisch geworden, blickte er sich im Zimmer um. Es war vollgestellt mit fremdartigen Gegenständen: ein Astrolabium, eine Armillarsphäre, Instrumente aus Messing und Knochen, von deren Verwendung er keine Vorstellung hatte. Bringen bei einem Pfandleiher doch ein wenig ein, dachte er. Vielleicht sollte ich den alten Kerl umlegen und den ganzen Plunder mitnehmen.
»Lass es«, sagte der alte Mann. »Es gibt in der ganzen Stadt keinen Händler, der nicht mein Zeichen kennt.« Der Jüngere fuhr zusammen. Der widerliche Alte kann ja Gedanken lesen. Gott weiß, welchen Betrug er sich jetzt ausdenkt.
»Keinen Betrug«, sagte dieser. Wieder ein Hustenanfall. »Du kannst alles haben. Los, sag mir, wie du hereingekommen bist?«
»Über das Dach, durch das Fenster. Ihr solltet Eure Fensterläden schließen.« Er schob sich zur Truhe und hob den schweren Deckel vorsichtig mit der freien Hand hoch, denn sein Messer wollte er nicht loslassen.
»Er ist in dem versilberten Kasten, der mit den eingravierten Zeichen und dem Ding im Streitwagen mitten auf dem Deckel«, erläuterte der alte Mann. Der junge Mann mit dem glatten Haar holte den Kasten heraus und musterte ihn erstaunt. »Nimm ihn«, sagte der Alte. »Mir ist damit eine große Last von der Seele.« Jählings setzte er sich auf eine Bank an der Wand, beugte sich vornüber, hustete sich die Seele aus dem Leib und drückte dabei das Tuch an den Mund.
»Er ist ... er ist sehr ... kostbar. Wie kommt es, dass Ihr ihn so einfach hergebt?« Der Kasten hatte etwas Unheimliches, auch wenn er noch so erlesen gefertigt war. Rührte das vom Deckel mit dem Abbild einer schlangenfüßigen, hahnenköpfigen Gottheit im Streitwagen zwischen Sonne und Mond? Von den darunter eingravierten seltsamen Buchstaben? Von dem schweren Schloss, das aus einem fremdartigen Metall war, das glänzte wie eine Toledaner Schwertklinge?
»Du kannst mir glauben, die Last, die Versuchung, sie haben mich erschöpft und verbraucht. Mit mir ist er jetzt fertig; er hat mich zerstört und weiß, dass ich bald sterbe. Nimm ihn, und das wenige, das mir noch an Leben bleibt, wird zumindest von ihm befreit sein. Bedauern, der vergebliche Versuch einer Wiedergutmachung – die Hölle auf Erden vor der Hölle in der nächsten Welt –, mehr hat er mir nicht gelassen. Aber ich warne dich: Um deiner Seelen Seligkeit willen, sieh nicht hinein.«
»Woher weiß ich, dass Ihr mich nicht mit einem leeren Kasten narrt?«
»Glaube mir, es wäre weitaus besser für dich, wenn er leer wäre. Aber das ist er nicht. Er enthält ... die Antwort auf jeden Wunsch, den du je hattest, und, o gerechter Gott, das grässlichste Geheimnis schlechthin – das Geheimnis des ewigen Lebens. Das ist das letzte Geschenk, das der Kasten anbietet, nachdem er dir ebendieses Leben zur Qual gemacht hat. Zur unendlichen Qual. Zumindest dieses Geschenk habe ich abgelehnt.« Dem jungen Mann fiel auf, dass der Alte auf seiner Bank einen eigenartigen Verwesungsgeruch ausströmte. Wie eklig. Als er sich von einem weiteren Hustenanfall erholt hatte, blickte er auf und sagte: »Da du mir Zeit gelassen hast, mich auf mein Lebensende vorzubereiten, zum Lohn eine Warnung! Wenn dir deine Seele lieb ist, öffne den Kasten mit dem Herrn aller Wünsche nicht.« Doch die Miene des alten Mannes zeigte bei diesen Worten eine seltsame Mischung aus Bitterkeit, Resignation und Bosheit, so als wüsste er, dass keine Macht der Welt den Jüngeren davon abhalten würde, früher oder später einen Blick in den Kasten zu werfen. Der junge Mann verzehrte sich vor Neugier, legte sein Messer beiseite und öffnete den Kasten. Es krachte und blitzte im Zimmer wie bei einem Gewitter.
»O mein Gott, wie grausig! Das verfolgt mich bis in meine Alpträume!« Entsetzt schlug er den Deckel zu, kaum dass er ihn aufgemacht hatte.
»O weh, wie schade. Aber ich habe dich gewarnt. Jetzt gehört er dir – du wirst ihn nicht mehr los. Bis er mit dir fertig ist, wird er immer wieder in deinem Leben auftauchen, selbst wenn du ihn im tiefsten Ozean versenkst. Wie ein Liebender wirst du immer wieder von ihm angezogen werden, bis er dir durch Erfüllung deiner Wünsche alles geraubt hat. Tod und Verderben folgen ihm allüberall. Siehst du? Schon denkst du, dass der, für den du ihn stiehlst, es nicht wert ist, ihn zu besitzen. Wer hat dich dafür bezahlt? Wer ist es, dass er solch einen Schatz verdient?«
»Maestro Simeoni«, flüsterte der Jüngere.
»Simeoni? Dieser drittklassige Scharlatan? Der kann doch noch nicht einmal den Vollmond voraussagen. Was für ein Witz! Simeoni will ihn haben!« Der alte Mann warf den Kopf zurück und lachte, doch das Gelächter endete in Würgen und Husten. Bei dem Gelächter blickte der junge Mann auf einmal ganz irre.
»Maestro Simeoni hat gesagt, er würde ihm ein Vermögen einbringen. Warum sollte ich mich mit einem Anteil zufriedengeben, wenn ich alles haben kann?«
»Ein Vermögen? Dann will ihn am Ende doch nicht Simeoni haben. Er will sich damit lieb Kind bei einem Höhergestellten machen.«
»Warum sollte er ihn nicht haben wollen? Warum solltet Ihr ihn nicht haben wollen?«
»Ach, junger Mann, bedenke, dass auch ich einst jung und töricht war. Und bedenke auch, dass die Göttin der Weisheit oftmals einen grausamen Preis fordert. O ja. Und grüße sie bitte von mir.«
»Wen?«, fragte der junge Mann spöttisch, während er den Kasten zum Bündel schnürte, das er sich über den Rücken warf. »Die Göttin der Weisheit?«
»Nein«, sagte der alte Mann. »Die, die willens ist, für diesen bösen Kasten einen hohen Preis zu zahlen.«
Doch der Jüngere war schon aus dem Fenster geklettert, hangelte sich an einem dort baumelnden Seil hinab und hörte die letzten Worte nicht mehr.
Dort unten in der Dunkelheit wartete eine unbeleuchtete Gondel mit zugezogenen Vorhängen. »Hast du ihn?«, wisperte eine Stimme hinter den Vorhängen.
»Ja«, flüsterte der Dieb.
»Gut, steig ein.« Fast geräuschlos glitt die Gondel in einen größeren Kanal, fast geräuschlos bohrte sich der Dolch in den Körper des Diebes, und fast geräuschlos rutschte die noch warme und mit Gewichten beschwerte Leiche ins schwarze Wasser.
Am nächsten Tag bestieg ein Mann mit dunklem lockigem Bart und Ohrring eine Galeere in Richtung Marseille. In seinem Gepäck befand sich ein versilberter Kasten mit Elfenbein, der für die Reise in wasserdichtes Zeltleinen eingenäht worden war und die Anschrift trug: An Maestro Cosmo Ruggieri im Hause von Lorenzo Ruggieri, Zum Roten Hahn, Rue de la Tisseranderie, Paris.
Kapitel III
Das kommt alles nur davon, dachte ich, wenn man statt eines schmucken Damenpferdchens einen kleinen, braunen roussin reitet, fast eine Schindmähre, und keinen livrierten Lakaien bei sich hat. Er hat mich für die Tochter eines hobereau gehalten, die zusammen mit den Tagelöhnern ihres Vaters Weizen drischt und mit Pfeil und Bogen auf Kaninchenjagd geht. Darum ist er so unhöflich gewesen. Der weiß doch gar nichts. Nein, ganz und gar nichts. Falls er wirklich so viel sehen kann, hätte er auch bemerkt, dass das Wappen meines Vaters sechzehn Felder hat, und hätte mir die Achtung entgegengebracht, die einem Menschen gebührt, dessen Stammbaum bis in die Zeit vor den Kreuzzügen zurückreicht. Schließlich bin ich zwei Jahre lang im Kloster Saint-Esprit erzogen worden, wo ich Italienisch, Musik, Sticken, Literatur und die Kunst der eleganten Konversation erlernt habe. Ich bin daran gewöhnt, in besseren Kreisen, mit erleuchteten, hehren Geistern zu verkehren. So wurde auch mein höheres, spirituelles Selbst herausgebildet, welches Personen mit einem schwerfälligen Geist einfach nicht begreifen können. Seine Grobheit ist offenkundig eine Marotte, die er sich zugelegt hat, weil er Unwissenden weismachen will, er könne aufgrund einer geheimen Macht Gedanken lesen und die Zukunft vorhersagen. Ein Scharlatan. Genau das ist er. Ein Scharlatan, dessen Geschäft das Einschüchtern von Menschen ist. Und was die Zukunft angeht, so erhebe ich mich einfach darüber, indem ich mich geistig höheren Dingen widme.
Die Straße war mir wohlbekannt, jede Biegung, jeder Baum und jeder Stein, und dabei war ich lange nicht auf ihr gereist. Früher waren wir jeden Sommer aus unserem Stadthaus innerhalb der Mauern aufs Gut gezogen und nach der Ernte wieder zurück, doch die Zeiten waren lange dahin, desgleichen das weitläufige alte Haus meines Großvaters in der Rue de Bourgogne. Doch der Anblick der sanft gewellten Matten, auf denen hier und da weiße Schafe weideten, der vertrauten Felder und Wäldchen weckte heftige und lange vergessene Erinnerungen, die an meiner Seele zerrten. Vor meinem inneren Auge erhob sich ein Haus – nicht unseres, doch Tante Paulines unweit des Domplatzes –, und darin sah ich wieder das Zimmer mit den Gobelins, in dem das Licht golden durch die Fenster fiel und auf dem hellen Silber einer muschelförmigen Schale funkelte. Die Schale, das wusste ich noch – so wenig trügt die Erinnerung –, ist voll kleiner Bonbons, die nach Fenchel schmecken.
»Na mach schon, nimm dir eins«, sagt die Tante meiner Erinnerung. Mir kommt sie wie eine Märchenkönigin vor. Unter der eckigen Leinenhaube lugen dunkelbraune Locken hervor, die von einem schimmernden grünen Seidennetz gehalten werden. Eine hohe Halbkrause umrahmt ihr Gesicht, und über ihrem Tageskleid trägt sie ein langes, fließendes, ärmelloses Überkleid aus Brokat. Sie ist schön; alles an ihr raschelt, funkelt und duftet nach getrockneten Rosen und Maiglöckchenessenz. Die hellroten Falten ihres Unterkleides mit dem breiten Saum faszinieren mich – auf der Oberseite schimmern sie nämlich in einer anderen Farbe als in den tieferen Lagen. Ein Zaubergewand. Ich greife in die Schale, und Mutter wirft mir einen vorwurfsvollen Blick zu. Sie ist wieder einmal schwanger, ihr Kleid aus dunkelgrauer Wolle ist verblichen, die Ellenbogen ihrer Überärmel sind abgewetzt. Ich bin sechs und die Älteste. Eine Magd hat meine kleine Schwester Laurette auf dem Arm, ein rundgesichtiges Kleinkind mit rosigen Wangen und goldenen Löckchen. Mutter hat Annibal, meinen vierjährigen Bruder, an der Hand. Auch er trägt noch Röcke und hat lange hellbraune Locken. Und Hamsterbäckchen, weil er sich den Mund mit Bonbons vollgestopft hat.
»Man sollte sie nicht verwöhnen«, meint Mutter.
»Sie sieht nicht aus wie die anderen«, sagt Tante Pauline.
»Sie ähnelt ihnen von Tag zu Tag weniger«, pflichtet ihr Mutter mit mattem Ausdruck bei. »Da, sieh sie dir an. Sie hat sich selbst das Lesen beigebracht und läuft umher, statt wie gewöhnliche Kinder zu spielen – sie behauptet, dass sie Feen sucht. Was soll ich nur machen, Pauline?« Die Erwachsenen sagen so komische Sachen. Die Großen sind so langsam, so aufgeblasen und langweilig. Ich möchte, glaube ich, nie erwachsen werden.
»Hat er einen Verdacht?«
»Noch nicht.« Tante Pauline beugt sich im Stuhl vor. Der hat Beine, die wie Löwentatzen geschnitzt sind. Ich möchte unter dem Stuhl nachsehen, ob er da auch einen Löwenbauch hat, aber Tante Paulines Kleid ist zu bauschig.
»Gib sie mir«, sagt Tante Pauline mit funkelndem Blick. »Gib sie mir. Wozu ist mir dieser ganze Reichtum nutze? Ich bin unfruchtbar. Tausche einen Teil deines Reichtums gegen meinen.«
»Aber, mein Gatte – Hercule – sagt ...«
»Ich kenne meinen Bruder. Für ihn sind Mädchen nur eine Last. Du hast einen Sohn und ein schönes kleines Mädchen, und die hier mag er nicht einmal. Monsieur Tournet würde es ihm gut vergelten ...«
Daheim ein Unwetter. Eines von vielen. Ich verstecke mich unter dem Tisch.
»Und ich sage dir, diese Genugtuung gönne ich Pauline nicht!« Das Geräusch von Schlägen und Schluchzen über meinem Versteck. Der Deckel des Kessels, der im Küchenkamin hängt, hüpft und klappert unbeaufsichtigt. Blut von einem aufgeteilten Huhn tropft vor meiner Nasenspitze von der Tischplatte. Ein Paar schwere Stiefel stehen gleich hinter meinem Rocksaum. »Und du, du kommst da heraus, du kleine Ratte. Ich sag’s ja, du wirst mit jedem Tag widernatürlicher. Du wirst noch einmal irre, und dann sperrt man dich für immer ein. Ich schließe dich in eine Truhe ein, und da kommst du nie mehr heraus, wenn du nicht mit diesem Unsinn aufhörst!« Eine große Hand langt unter den Tisch, ich rutsche in den tiefsten Winkel. »Was hat meine Schwester ihr gegeben? Ich weiß, dass sie ihr hinter meinem Rücken etwas gegeben hat ...« Die großen Hände haben mich geschnappt und zerren mich hervor. Meine Füße berühren den Boden nicht mehr. »Ich schüttele es aus dir heraus, so wahr ich lebe ...« Mein Kopf fliegt hin und her, mein Hals fühlt sich an, als ob er gleich bricht. Das geschenkte Taschentuch mit meinem Monogramm, in das ich ein paar Bonbons gewickelt habe, fällt aus seinem Versteck in meinem Ärmel und zu Boden. Die schweren Stiefel zertrampeln und zertreten die Bonbons auf den strohbedeckten Küchenfliesen zu klebrigem Matsch.
»Vater!«, schreie ich auf, doch das scheint von weit her zu kommen, nicht aus meinem Mund.
»Ich erlaube nicht, dass dich dieses Weib verdirbt, lass dir das gesagt sein. Lieber sehe ich dich tot!«
»Hercule, nein, nicht die Reitpeitsche. Sie ist doch noch so klein ...«
»Du – siehst – sie – niemals – wieder – ich – verbiete – es.« Die Schläge hageln im Rhythmus seiner schrecklichen Worte herunter. Was stimmt nicht mit mir? Warum liebt mich Vater nicht?
»Ich ... ich will auch ganz artig sein ...«, schluchze ich.
Doch jetzt bin ich erwachsen, und ich bin gar nicht artig, dachte ich, während ich beim langsamen Klipp-klapp der Hufe meiner kleinen Stute über diese Erinnerungen nachgrübelte. Denn ich war unterwegs zu Tante Pauline. Und ich hatte vor, ihr alles zu erzählen.
Es gab eine Zeit im Kloster, kurz nachdem ich mein feinsinniges, spirituelles Naturell entdeckt hatte, da wollte ich mein Leben Gott weihen. Doch leider kann man nicht ewig in Luftschlössern leben. Ein neuerlicher finanzieller Engpass meines Vaters führte dazu, dass man meine zartbesaitete Seele gar roh aus ihrer wahren spirituellen Heimat riss und zu einer endgültigen Abmachung zwang, der zufolge ich endlich mit einem benachbarten Edelmann namens Thibauld Villasse, Monsieur de La Tourette, verbunden werden sollte. Als ich sechzehn Lenze zählte, hatte Monsieur Villasse zum ersten Mal um mich angehalten, doch damals hatte mein Vater noch ein größeres Vermögen und wies ihn wegen eines fehlenden uralten Stammbaums schnöde ab. Fürwahr, der Mann hatte überhaupt keine Wappenfelder, sondern lediglich ein großes, fragwürdiges Vermögen, das er durch Katzbuckeln bei einem königlichen Günstling, dem Maréchal St. Andre, und durch Kauf eines Salzmonopols erworben hatte. Seinem Titel fehlte das geheiligte Gütesiegel geadelter Tradition; mit einem Wort, er hatte seine Ländereien erst kurz nach meiner Geburt erstanden.
Wohlgemerkt, Monsieur Villasse wäre ohnedies nie für mich in Frage gekommen, weil er fast fünfzig und ganz verschrumpelt war und weil sich in seinem schütteren braunen Haar und seinem rötlichen Bart weiße Fäden zeigten. Und er hatte so einen Ausdruck in seinen kalten grünen Augen. Das Leben einer Braut Christi, auch wenn es noch so eingeschränkt war, erschien mir in der Tat wünschenswerter als der Bund mit einem solchen Mann. Aber – eine Demoiselle muss heiraten, wie es ihr Vater wünscht. Es ging dabei, glaube ich, um einen Weinberg, den mir mein Großvater mütterlicherseits als Mitgift vermacht hatte und der im Süden an Villasse’ Ländereien grenzte, zu denen kein einziger Weinberg gehörte. Es hatte auch etwas mit verschiedenen Schuldverschreibungen zu tun, die dann null und nichtig wurden, während andere Anleihen verlängert wurden, wenn der Weinberg und meine Person (die man zu Monsieur Villasse’ Ärger nicht voneinander trennen konnte) in seinen Besitz übergegangen wären. Doch ich habe noch nie behauptet, ich verstünde etwas von Geld. Dieses Thema schickt sich nicht für eine Dame, und eine Dame sollte sich tunlichst nicht darum kümmern.
Und dennoch zwingt uns Geld, auch wenn es noch so vulgär ist, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Man stelle sich beispielsweise mein Erstaunen vor, als ich – begleitet von berittenen Bediensteten – meinem geliebten Saint-Esprit den Rücken kehren musste und ich, als wir in Richtung unseres ländlichen Herrenhauses in La Roque-aux-Bois ritten, entdeckte, dass unser vornehmer und geräumiger Familienwohnsitz innerhalb der Stadtmauern an einen aufstrebenden italienischen Kaufmann verpachtet worden war! Das Stadthaus meines Großvaters, die Galerien, durch die meine Mutter als Kind getobt war, ausgerechnet die Räume, die mein erstes kindliches Geplapper gehört hatten, jetzt widerhallend von brabbelnden fremdländischen Stimmen, dem Klirren von Geld und dem Feilschen der Käufer! Warum nicht gleich an einen Pfandleiher oder ein Hurenhaus vermieten? Tiefer konnte man kaum sinken.
Doch einem feinsinnigen Gemüt bieten sich selbst unter veränderten Bedingungen stets neue Gelegenheiten, auch wenn das bedeutete, jahrein, jahraus auf einem Gut zu wohnen, das sich eher für einen angenehmen Aufenthalt während der Sommermonate eignete. Ein Zyklus von Naturlyrik, dachte ich, den jeweiligen Jahreszeiten zugeordnet. Und ich könnte eine botanische Sammlung anlegen und einheimische Kräuter zeichnen. Statt meinen durch meine Abgeschiedenheit geschmälerten gesellschaftlichen Pflichten nachzutrauern, könnte ich die Fäden meines ungemein erbaulichen, wenn auch nicht vollendeten Projektes wiederaufnehmen, eines Werkes mit dem Titel Ein Dialog der Tugenden, in welchem die Überlegenheit wahrer Enthaltsamkeit, demütiger Hingabe und die Vortrefflichkeit des christlichen Glaubens in seiner Gänze von einer Dame dargelegt werden. Natürlich hatte ich nicht vor, meinen Namen auf diesem Manuskript preiszugeben, denn eine Dame aus guter Familie muss stets anonym bleiben, wenn sie zur Feder greift, wie Schwester Céleste uns zu ermahnen pflegte. Ich hatte jedoch gar nicht vor, anstößig zu handeln und es tatsächlich drucken zu lassen. Nein, der Erfolg einer privaten Lesung, der rauschende Beifall eines ausgesuchten cénacle würden mir völlig genügen ...
Und während ich meine Gedanken in diese Richtung schweifen ließ, ritt ich bereits durch das große Tor unter dem Taubenschlag auf unseren Gutshof, der von nun an unser Ganzjahresdomizil sein würde. Beim Absitzen kam mir der Gedanke, wieviel schöner doch der cour d’honneur sein könnte, wenn man die Hühner entfernen und vom Eingang bis zum hinteren Ende des staubigen Hofes Pflaster legen würde. Doch kaum trat ich durch die Haustür in die salle, da konfrontierten mich auch schon Vater und Monsieur Villasse am Tisch unter dem hinteren Fenster mit den Verlobungsdokumenten, die meiner Unterschrift harrten. Mutter, meine Schwestern und das Hausgesinde drängten sich stumm hinten in der Diele, so als wohnten sie einer Beerdigung bei.
Villasse wirkte etwas größer, als ich ihn in Erinnerung hatte, sein Gesicht war noch faltiger, seine kalten grünen Augen noch berechnender. Ich muss gestehen, dass mich eine kurze Beklemmung überfiel: Seine Ländereien waren so abgelegen, und es fehlte ihnen bekanntermaßen an den kleinen kultivierten Annehmlichkeiten, wie sie einer Dame meines zarten und empfindsamen Naturells gebühren. Außerdem gingen Gerüchte über den Tod seiner zweiten Gattin um, die ich zuerst von Matheline, meiner Base zweiten Grades, gehört hatte, die ihren Mangel an geistigen Gaben durch eine eindeutig weltliche Vorliebe für Klatsch und Tanz wettmacht. Nein, Villasse hatte zwar den Titel Monsieur de La Tourette erworben und war daher ein annehmbarer Ehemann, aber dennoch wirkte er nicht wie ein Mann, den man möglicherweise lieben lernte.
»Worauf wartest du noch? Unterschreibe. Da liegt die Feder«, befahl mein Vater im brüsken Ton eines capitaine der leichten Kavallerie im Ruhestand, der das Befehlen gewohnt war. Doch von uns Frauen, die wir nicht im Heer gedient haben, kann niemand verlangen, dass wir unsere zartbesaiteten Seelen einer barschen, ungehobelten Sprache beugen.
»Hier steht nichts über das Datum der Vermählung«, entgegnete ich.
»Die findet auf der Stelle statt; das Aufgebot ist bereits ausgehängt«, sagte mein Vater.
»Oh, das dürfte nicht möglich sein; da bleibt ja kaum Zeit, mir ein Schlafgemach in La Tourette einzurichten, ganz zu schweigen von all den kleinen Annehmlichkeiten, die eine Dame von Stand braucht.«
Villasse’ Augen wurden ein wenig schmal, doch er fragte ausnehmend höflich: »Und wieviel Zeit würdet Ihr dazu benötigen, Demoiselle Sibille?«
»Oh, dafür so gut wie gar keine. Ich hoffe doch, das wird hier aufgeschrieben. Auch mir ist es sehr unlieb, den freudigen Augenblick hinauszuzögern; doch man muss auch an unser künftiges Glück denken. Darauf gilt es sich vorzubereiten.«
»Vorbereiten? Wie lange?«
»Also, ich muss meine Aussteuer, mein Brautkleid bestellen. Und dann die Bettvorhänge und die Bettwäsche. Und ich muss Eure Bibliothek durchsehen und mir jene Werke religiösen Trostes schicken lassen, die das weibliche Geschlecht nicht missen kann. Sechs Monate mindestens, bedenkt man die Zeit, die das Heranschaffen der Bücher erfordert.«
»Religiöse Bücher?«, fragte Villasse, und an dem Faltenwurf seines Gesichtes waren die vielfältigsten Gefühle abzulesen. Ich warf meiner Mutter einen Blick zu, doch diese verharrte steif, bleich und stumm. Ich meinte jedoch, in ihren Augen ein Funkeln zu sehen.
»Ich habe Euch doch gesagt, dass sie gebildet ist«, meinte mein Vater.
»Ein Fehler. Glücklicherweise ist er Euch bei Euren anderen Töchtern nicht noch einmal unterlaufen.«
»Eine Marotte meiner Schwester. Sie schien besser fürs Kloster geeignet.« So drückte mein Vater in der Regel aus, dass er mich zu hässlich zum Heiraten fand. Und natürlich können die Jüngeren nicht heiraten, ehe die Älteste nicht unter der Haube ist. Als meine Tante Pauline, meine Patin, anbot, für meine Ausbildung zu zahlen, ergriff Vater die Gelegenheit, mich loszuwerden, mit beiden Händen. Ich spürte, wie sich mein jungfräuliches Antlitz rosig verfärbte. Nur weil der Geber aller guten Gaben der Meinung war, dass ein Übermaß an kühnem Schöpfergeist in meinem Fall einen gewissen Mangel an körperlichen Reizen wettmachte, hieß das noch lange nicht, dass man das an diesem bedeutsamen Tag in meinem Leben auch laut äußerte. Es stimmt schon, dass mich Mädchen, die auf meine Größe und knochige Statur anspielen wollten, gelegentlich ›Staubwedel‹ nannten; aber die waren schlicht neidisch auf meinen üppigen Schopf lockiger, wenn auch zuweilen widerspenstiger Haare, auf meine ausnehmend großen dunklen Augen und vor allem auf meine wunderschöne Singstimme. Außerdem war ich gewisslich hübsch genug für eine dritte Frau von Thibauld Villasse, dem es, wie ich schon sagte, nicht nur an Jugend und männlicher Schönheit, sondern auch an geistiger Bildung mangelte.
»Aha, du weigerst dich zu unterschreiben?«, sagte mein Vater jetzt etwas drohend. Ich meinte zu hören, wie meine Schwester Laurette die Luft anhielt, konnte sie jedoch nicht sehen, weil sie im Schutz des riesigen geschnitzten Schrankes stand.
»Oh, um keinen Preis der Welt. Ich will nicht mehr, als Euch glücklich zu wissen, und sehne den freudigen Tag meiner Vermählung herbei. Aber ich weiß, dass es Monsieur Villasse danach verlangt, mich willkommen zu heißen, wie es sich für einen Mann seines Ranges geziemt, genau so wie es mich nach nichts Anderem verlangt, als sein Haus und seine Person glücklich zu machen.« Mein Vater verdrehte die Augen, als wollte er sagen, was zum Teufel soll das nun wieder heißen, und ich lächelte ein zufriedenes Lächeln.
Als Villasse dieses Lächeln sah, strahlte er mich an und säuselte: »Fürwahr, lassen wir den Advokaten einen Nachtrag erstellen mit der Bedingung, dass Ihr das Datum unserer Vereinigung jederzeit beschleunigen könnt, falls es Euch so beliebt.«
»Ihr gebt nach? Dickköpfige Mädchen sollten die Peitsche zu spüren bekommen, sage ich. Und es gibt kein dickköpfigeres und launischeres als Sibille. Ein schlechter Anfang, Monsieur Villasse.«
»Meine Braut verdient jeden Respekt. Demoiselle, wenn die frommen Bücher eingetroffen sind, mögt Ihr mir in Euren Mußestunden daraus vorlesen.« In Vaters Blick lag Entsetzen, während Villasse ihm ein strahlendes Lächeln schenkte. Der Advokat kratzte etwas. Ich unterschrieb. »Wein zur Feier unseres Bundes«, sagte mein Verlobter mit seidenweicher Stimme, und Mutter nickte und lächelte ein blasses Lächeln. Während ich ein Schlückchen trank und die anderen sich zuprosteten, gab ich mich den herrlichsten Illusionen hin.
In sechs Monaten kann sich unendlich viel ereignen, dachte ich, als ich den Giardino dei Pensieri auf dem großen Himmelbett auslegte, das ich mit meinen Schwestern teilte. Ach, hätte ich doch wie Penelope eine unendliche Tapisserie, die ich nächtens wieder aufräufeln könnte, seufzte ich innerlich, während ich die Karten auslegte. Lass sehen, dachte ich, der Mai ist fast dahin, bleiben noch Juni, Juli, August, September, Oktober. Das ist eine ganze Ewigkeit. Außerdem machte nicht nur meine botanische Sammlung gute Fortschritte, sondern auch meine Zeichnungen von Flügelknochen verschiedener Vögel, mittels derer ich das Geheimnis des Fliegens entschlüsseln wollte.
»Aha, das bist du, Laurette. Die Münzen-Vier. Das bedeutet Geld – mit etwas Geduld –, da bin ich mir sicher. Das müssen wir nicht einmal nachschlagen, das weiß ich aus dem Buch.« Unter dem Bett kaute und knirschte es genüsslich. Gargantua, groß von Körper, jedoch klein von Hirn, verspeiste einen Ochsenknochen. Als Jagdhund wie auch als Wachhund nutzlos, war er zum Schoßhündchen geboren, doch leider fraß und wuchs er unentwegt. Niemand wusste, wann er aufhören würde. Doch er war ein treu ergebenes Geschöpf, daher erlaubte Mutter nicht, dass Vater ihn abschaffte.
»Ach, wie schön ist es, gebildet zu sein«, seufzte Françoise, die gerade erst zehn geworden war.
»Haben dir die Nonnen das Kartenlegen beigebracht?«, fragte Isabelle, sie war zwölf und hielt nichts von Nonnen.
»O nein, Nonnen glauben nicht an Karten. Die sind im Kloster streng verboten. Aber schließlich wissen sie nicht alles, oder? Kuchen und Schoßkätzchen und Karten, alles findet den Weg ins Kloster.« Ich griff nach dem Kartenbuch und blätterte darin. »Dominique hat mir ihr Spiel geschenkt, als sie der Welt entsagte. Und Base Matheline hat mir letztes Jahr ihr Buch überlassen, als sie sich verheiratete. Ihr Mann hat nichts für Kartenlegen übrig.«
»Ich habe sie zwei Tage vor unserem Umzug auf dem Weg zur Kathedrale gesehen«, verkündete Laurette, die mit ihren achtzehn Jahren die schönste unter uns Töchtern war. »Sie hat ein weißes, schmuckes Pferdchen geritten, und hinter ihr kam ein Stallbursche in Seidenlivree. Sie soll sich sehr reich verheiratet haben.«
»Eine Dame redet niemals über Geld«, erwiderte ich. »Das zeugt von niedrigem Geist.«
»Also wirklich, Schwesterlein, du hast einfach keinen Sinn für die Wirklichkeit«, widersprach Laurette. »Was kannst du schon ohne Geld anfangen: nicht einmal rumsitzen und in den Tag hinein träumen oder Verse kritzeln, was dir ja das Liebste ist. Was mich betrifft, so bekenne ich mich lieber zu einem niedrigen Geist und verzichte auf die hehren Gefühle. Sag mir lieber, dass ich reich und Herrin eines großen Hauses sein werde, in dem ich zwei, nein, besser drei Bälle die Woche gebe. Und ich möchte Schmuck und Pferde haben, die mir ganz allein gehören.« Ich seufzte. Nicht nur, dass ich anders aussehe als meine Schwestern, ich will nicht einmal die gleichen Dinge haben. Schmuck ist hart und kalt, doch die Dichtkunst wärmt das Herz. Lieber möchte ich die Flamme der Inspiration in meinem Busen verspüren, als mit dem König höchstpersönlich zu tanzen.
Man kann schwerlich die Qualen einer feinsinnigen Seele beschreiben, die in die völlig falsche Familie hineingeboren wurde. Und dabei hätte der Allmächtige durchaus Gewinn davon gehabt, wenn er mich in einer vornehmeren und mir entsprechenden Umgebung untergebracht hätte. Gern hätte ich meinen Platz als Älteste – Weinberg hin Weinberg her – geopfert, wenn ich als einzige Tochter eines adligen Philosophen oder eines Doktors der Theologie aus gutem Hause auf die Welt gekommen wäre, statt in der ausufernden Familie eines patriotischen Kriegers eine von vielen zu sein. Ja, die Gottheit war so großzügig hinsichtlich Verwandtschaft gewesen, dass die Ländereien meines Großvaters väterlicherseits unter so vielen aufgeteilt wurden, dass keiner davon so leben konnte, wie es die Ehre und unser altehrwürdiger Name erforderten. Von dieser Seite hatte nur Tante Pauline Geld, und das war erheiratet, sie hatte Rang und Glück dafür geopfert. Seither war sie für Vater gestorben, doch erachtete er ihre milden Gaben aus dem »Grabe« weniger gering als ihre Person.
Bei uns war Mutter die Erbin gewesen, und sie hatte meinem Vater mehrere Güter, einen Weinberg mit einer Quelle und einem verfallenen Turm sowie das Stadthaus meiner Großeltern eingebracht. Doch ihre üppige Mitgift, abgesehen von La Roque-aux-Bois, fiel Vaters Verschwendungssucht zum Opfer. Nur dank Großvaters weiser Voraussicht war der Weinberg mir, dem ersten Kind – ganz gleich ob männlichen oder weiblichen Geschlechtes – vermacht worden, während ich noch im Schoße meiner Mutter ruhte. Vermutlich dachte er, Mutter würde die Geburt nicht überleben oder zumindest keine Kinder mehr bekommen, da sie unter einer Krankheit litt, die bereits ihren Bruder dahingerafft hatte. Großvater hatte das kleine Erbe rechtlich so gut abgesichert, dass es nicht von meiner Person zu trennen war. Ein eigenartiges Geschenk, eines, das mich nun von meiner wahren Berufung als Dichterin abhalten und mir stattdessen die Verlobung mit einem ungehobelten Klotz mit gekauftem Titel einbringen sollte!
Doch das Geschrei von Fremden und das Geräusch von Pferdehufen auf dem Hof störten mich in meinen Betrachtungen über die Wege des Schicksals. Sogar Träumen und Nachdenken muss man in einem Haushalt voller Barbaren hintanstellen.
»Sieh mal, wer da auf dem Hof ist.«
»Annibal! Er ist zurück und hat Gäste mitgebracht!«
»Die Pferde, Sibille. Sind die schön. Komm, sieh dir das an!«
Wir drängten uns am Fenster im ersten Stock, und unten bot sich ein prächtiger Anblick. Sechs bewaffnete Fußsoldaten begleiteten ein riesiges graugeschecktes Schlachtross, das zwei Pferdeknechte am silberverzierten Zügel führten. Seine Ohren waren im militärischen Stil gestutzt, seine Mähne war abrasiert, und es war gut drei Handspannen größer als alle anderen Reitpferde des Trupps. Le Vaillant – so hieß das Schlachtross, wie wir später erfuhren – wurde gefolgt von einem berittenen Pferdeknecht, seinem Ausbilder, und an der Spitze des Zuges ritten zwei Offiziere: Annibal in seinem kurzen bestickten Umhang, mit flachem Barett, Feder und hohen Stiefeln, und ein Fremder, dessen Pferd sogar noch prachtvoller und dessen Kleidung noch eindrucksvoller war als Annibals.
»Annibal, Annibal!«, riefen die kleine Renée und Françoise, und da blickte er hoch und winkte. Der Fremde tat es ihm nach. Noch nie hatte ich einen so ritterlichen Mann gesehen: Sein Gesicht war schmal, zartknochig und aristokratisch; ein prächtiger dunkler Schnurrbart betonte seine selbstsichere Haltung und elegante Erscheinung. Sein Blick war der eines Adlers.
»Oh, wer ist denn das?«, seufzte Isabelle.
»Ah, ich habe mich schon fast in ihn verliebt«, sagte Laurette.
Was mich anging, so war ich eine verlobte Frau und gestattete mir nicht, überhaupt etwas zu denken.
»Und als Monsieur de Damville hörte, dass Le Vaillant zum Verkauf stünde, hat er uns mit dem Kauf für seinen Vater, den Konnetabel, beauftragt.« Annibal stieß sein Messer in die Taubenpastete und schnitt sich noch ein Stück ab. »Hmm, schmeckt köstlich, es geht doch nichts über Hausmannskost.«
»Annibal, warum hast du mir nie erzählt, dass deine Schwestern allesamt Schönheiten sind?« Der Fremde hob seinen Weinbecher und warf Laurette einen so vielsagenden Blick zu, dass sie errötete.
»Monsieur d’Estouville, falls Ihr noch ein paar Tage bleibt, werdet Ihr die Jagd in der Gegend hier hervorragend finden ...«, sagte Vater, der milde gestimmt war.
»Annibal, bleib doch ein wenig länger«, bat Mutter. »Dieser Tage bekommen wir dich kaum noch zu sehen.«
»Annibal, seiner Mutter sollte man keine Bitte abschlagen«, sagte sein Freund und bedachte erst Mutter, dann Vater mit einem Lächeln. »Das ist aber mal ein schönes Stück da an der Wand. Italienisch, nicht wahr?«
»Aus der Schlacht von Landriano. Habe sie einem Spanier abgenommen.«
»Das waren noch Zeiten, erzählt man. Und mit einem neuen Radschloss. Eine große Verbesserung. Mein Vater hat mir immer erzählt, wie die Arkebusiere ihre Hakenbüchsen auf Ständer gelegt, die Zündschnur angezündet und sich dann abgewandt haben aus Angst, die Dinger könnten explodieren, statt auf den Feind zu schießen.«
»Ein guter Mechanismus, aber heikel. Die Arkebuse da muss mindestens einmal im Monat gesäubert werden, vor allem bei feuchtem Wetter, und das würde ich keinem meiner Diener anvertrauen.«
Gewehre, Jagd. Die langweiligen Beschäftigungen eines barbarischen Gemüts, dachte ich. Fehlen nur noch Hunde oder Falken.
»Eure Bulldogge da ... Eine so große habe ich mein Lebtag nicht gesehen. Habt Ihr sie schon einmal auf Bären angesetzt?«
»Gargantua und Bärenjagd? Er ist das nutzloseste Geschöpf, das Gott je erschaffen hat. Tut nichts Anderes als fressen und wachsen. Ihr könnt mir glauben, der würde sogar vor einem Kaninchen Reißaus nehmen, ganz zu schweigen von einem Bären. Ich hätte ihn schon längst ertränkt, wenn meine Töchter nicht heulen und wehklagen würden.«
»Oh, wer möchte diese reizenden Demoiselles auch nur einen einzigen Augenblick unglücklich machen.« Der charmante Fremde warf uns ein gewinnendes Lächeln zu.
»Wir können wirklich nicht noch länger bleiben«, warf Annibal ein.
»Ich habe einen neuen Wanderfalken, den ich auf Enten ansetzen möchte. Mögt Ihr die Falkenjagd, Monsieur d’Estouville?«
»Das könnte mich locken. Schließlich dürfen wir Le Vaillant nicht durch Gewaltmärsche ermüden, oder? Ein weiterer Tag. Sagt, welches Federspiel verwendet man in dieser Gegend des Landes?«
»Für die Falkenjagd am Bach? Wildentenflügel, nichts als Wildentenflügel. So haben es schon mein Vater und mein Großvater gehalten.«
»Ausgezeichnet! Also, Annibal, dein Vater hat mich in Versuchung geführt, noch einen Tag zu bleiben. Die Enten – und dann dieser herrliche Wein. Woher stammt er, sagt Ihr?«
»Von meinem Weinberg, südlich von Orléans gelegen – in Wirklichkeit gar nicht so weit von Blois. Bester Boden.«
»O ja, den Boden kann man immer herausschmecken.«
»Und die Sonne. Das Wetter ist in diesem Jahr prächtig für Trauben gewesen. Sicherlich ein außergewöhnlicher Jahrgang. Ich freue mich schon darauf, wenn der Großteil erst hier im Keller ist ...«
»Dank Sibille«, sagte Annibal und lachte.
»Und ihrer religiösen Inbrunst. Nein, das ist ein Familienwitz. Sagt, welcher Vogel lässt sich nutzbringender ausbilden, einer mit gutem Körperbau und schlechtem Gefieder oder einer mit schlechtem Körperbau und gutem Gefieder?«
»Es gibt Leute, die lassen sich durch das Gefieder täuschen, aber ich würde den Vogel mit dem guten Körperbau vorziehen. Er hat mehr Standvermögen.«
»Ich hatte einmal einen, der hat Enten schlicht verweigert. Sah zudem auch nicht gerade gut aus. Den habe ich einem Nachbarn verkauft, der mit ihm geliebäugelt hat und dachte, er könnte ihn ausbilden. Beim ersten Mal blieb er hocken; beim zweiten Mal ist er abgezischt und nie zurückgekehrt. Das war Monsieur de La Tourette, habt Ihr schon von ihm gehört?«
»La Tourette? Liegt das in der Grafschaft? Wie lautet der Familienname?«
»Villasse.«
»Villasse. O ja, ähem ...«
Meine üppig blühende Phantasie malte sich den kleinen Wanderfalken aus, wie er über Villasse kreiste und kreiste, und der saß auf seinem Pferd und befahl den Vogel zuerst mit dem Handschuh zurück, dann brüllte er wutentbrannt, während der Vogel merkte, dass ihn nichts mehr zurückhielt und selig in die Freiheit entfloh. Den Rest der Unterhaltung hörte ich nicht mehr, bis Annibal sagte: »Sibille, Sibille, du kommst doch mit, ja?«
»Was? O ja«, antwortete ich gedankenverloren.
»Wie schön, dass uns die Damen begleiten wollen«, sagte d’Estouville und schenkte mir ein ausnehmend hinreißendes Lächeln. Ich tat die ganze Nacht kein Auge zu.
Wir waren noch auf der Jagd, als Villasse’ Brief bei Mutter abgegeben wurde. Ich stellte mir vor, wie sie die Hand aufs Herz legte, als er eintraf, und ein wenig blass wurde. Doch da platschten wir gerade im leichten Galopp durch die Binsen am Teich und erschreckten die Enten, dass sie aufstoben, wo die bereits freigelassenen Falken auf sie warteten und munter kreisten, bis ihnen die Beute zugetrieben wurde. Funkelndes Wasser spritzte nach allen Seiten, Laurette lachte und bekam rosige Wangen, und Annibal zeigte in den hellblauen Himmel über uns.
»Seht mal, er hat eine.« Vaters Wanderfalke stürzte jählings hinab, packte eine Wildente mit den Krallen, und beide schlugen unter Gequake und Flügelschlagen im Wasser auf.
»Habe ich nicht gesagt, dass er kühn ist«, sagte Vater und ritt ins Wasser, um den Wanderfalken zu retten, der die noch lebende Ente nicht loslassen wollte.
Sonnenschein glitzerte auf den Blättern der Bäume jenseits des binsenumstandenen Teiches. Die Enten kehrten bereits zum Wasser zurück, jedoch weit entfernt von unseren Pferden, wo sie vor den Wanderfalken sicher waren. Wie im Traum sah ich Annibal seinen Vogel aufnehmen, der unter Federgestöber und schnellem Flügelschlag eine Ente zur Erde geholt hatte, die sich mit aller Kraft wehrte.
»Das ist aber mal ein lieber kleiner Vogel«, sagte der Fremde und holte mit mir auf, während seine Augen mir einen schrägen, vielsagenden Blick zuwarfen. Irgendwie kam es mir so vor, als redete er gar nicht über Vögel. Ich senkte den Blick, und mein Gesicht glühte. »Sie steigen auf und treffen auf Gewalt, und der Schwächere wird in einem Kampf auf Leben und Tod zur Erde gezwungen, seine schönen Federn werden zerrupft und verteilen sich mit dem Lebensblut auf dem Wasser.« Da empfand ich eine gewisse Bangigkeit. »Der Tod hat etwas Sinnliches, findet Ihr nicht auch?«, sagte er. Seine Stimme war sanft und einschmeichelnd. Er war so dicht aufgeritten, dass ich seinen Duft wahrnahm, der sich mit Pferdeschweiß und Leder vermischte. Dabei wurde mir bange ums Herz. Etwas in meinem Inneren erzitterte.