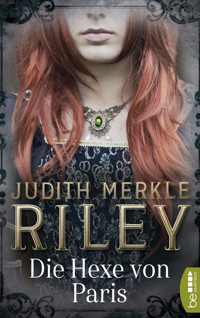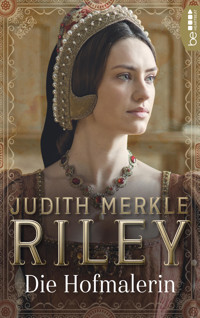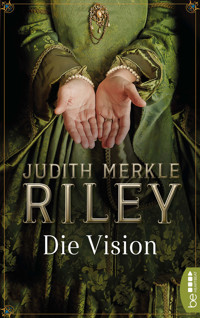
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Margaret-von-Ashbury-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Eine Frau kämpft um ihren Mann: Margaret von Ashbury in Frankreich
England, 1358. Der Chronist Gilbert de Vilers gerät im Hundertjährigen Krieg in französische Kriegsgefangenschaft. Margaret von Ashbury, seine Frau macht sich kurzerhand auf, ihn zu befreien - schwanger und mittellos. Doch sie muss nicht alleine reisen, denn findige Freunde stehen ihr zur Seite: Mutter Hilde und Malachi. Der junge Alchimist sucht nach dem Stein der Weisen und ist überzeugt, damit genug Gold für das Lösegeld für Gilbert herstellen zu können.
So führt ihre Mission Margaret und ihre ungleichen Gefährten von der Papststadt Avignon über die Klöster Burgunds bis in die Pyrenäen, immer auf der Suche nach dem Stein der Weisen - und ihrem geliebten Gilbert ...
Der zweite historische Roman um Margaret von Ashbury und ihre Abenteuer im Spätmittelalter, von Bestsellerautorin Judith Merkle Riley.
Die Margaret-von-Ashbury-Trilogie: Die Stimme. * Die Vision. * Die Zauberquelle.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 811
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Dank
Prolog
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Über dieses Buch
Eine Frau kämpft um ihren Mann: Margaret von Ashbury in Frankreich
England, 1358. Der Chronist Gilbert de Vilers gerät im Hundertjährigen Krieg in französische Kriegsgefangenschaft. Margaret von Ashbury, seine Frau macht sich kurzerhand auf, ihn zu befreien – schwanger und mittellos. Doch sie muss nicht alleine reisen, denn findige Freunde stehen ihr zur Seite: Mutter Hilde und Malachi. Der junge Alchimist sucht nach dem Stein der Weisen und ist überzeugt, damit genug Gold für das Lösegeld für Gilbert herstellen zu können.
So führt ihre Mission Margaret und ihre ungleichen Gefährten von der Papststadt Avignon über die Klöster Burgunds bis in die Pyrenäen, immer auf der Suche nach dem Stein der Weisen – und ihrem geliebten Gilbert …
Über die Autorin
Judith Merkle Riley (1942 – 2010) promovierte an der University of California in Berkeley in Philosophie und war Dozentin für Politikwissenschaft in Claremont, California. Von 1988 bis 2007 schrieb sie sechs historische Romane, die allesamt zu Weltbestsellern avancierten.
Judith Merkle Riley
Die Vision
Aus dem amerikanischen Englisch von Dorothee Asendorf
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1990 by Judith Merkle Riley
Translated from the English language: IN PURSUIT OF THE GREEN LION
First published in the United States by Delacorte Press
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 1989 by Ullstein Buchverlage GmbH, München
Erschienen im List Verlag
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung eines Motives © Arcangel: Stephen Mulcahey
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3721-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Marlow in Liebe
Dank
Ich danke meinem Mann Parkes und meinem Sohn Marlow für ihre liebevolle Unterstützung sowie meiner Tochter Elizabeth, die das Manuskript gelesen und mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Desgleichen gilt mein Dank meiner intelligenten, verständnisvollen Lektorin Carole Baron wie auch meiner Agentin Jean Naggar, die mir eine große Hilfe war.
Die vielen Stunden, die man in prächtigen Bibliotheken zubringt, wenn man an einem Buch arbeitet, für das man eine Vielzahl historischer Quellen lesen muss, waren wie immer ein großer Gewinn für mich. Diesen verdanke ich insbesondere dem hervorragenden, mittelalterlichen Quellenmaterial der Henry E. Huntington Library von San Marino, Kalifornien, wo ich einen großen Teil der Hintergrundrecherchen erledigen konnte. Außerdem danke ich der Honold Library des Claremont College und der Pomona Foundation Library, denn aus den Seiten ihrer alchimistischen Sammlung sprang mir eines sonnigen Herbstmorgens der Grüne Löwe entgegen.
Prolog
Es war Sommerzeit und im Jahre des Herrn 1358, genau zwei Tage vor dem Tag des hl. Barnabas, da sprach eine Stimme aus dem Himmel in meinem Ohr.
»Margaret«, sagte die Stimme, »was genau tust du da?« Meine Feder hielt inne, und ich blickte auf.
»Als ob Du das nicht wüsstest«, sagte ich zu der stillen Luft.
»Natürlich weiß Ich das, aber Ich will es von dir hören, denn das ist etwas ganz anderes«, antwortete die Stimme.
Wenn ich aber bei der richtigen Stelle anfangen soll, so muss ich damit anfangen, dass Gott mich mit Töchtern gesegnet oder eher geschlagen hat, denn die sind für Mütter Strafe und Prüfung zugleich. Und wenn wir uns einst am Tag des Jüngsten Gerichts für all unser Tun verantworten müssen, was werden wir sagen, wenn sich unsere Töchter als zu störrisch und ungeduldig zum Handarbeiten erwiesen haben? So stellt Gott uns auf die Probe und straft uns gleichermaßen für unsere Eitelkeit, denn Mütter von unlenkbaren Kindern müssen stets demütig sein.
Der Tag jedoch, an dem die Stimme zu mir sprach, war rundherum schön und warm, und alles grünte und blühte. Wieder einmal waren wir für den Sommer mit dem gesamten Haushalt von London aufs Land gezogen; in den Küchen des Herrenhauses von Withill konnte man endlich wieder wirtschaften, und so störte nur noch das stetige Gehämmere der Zimmerleute, welche die niedergebrannten Ställe und Nebengebäude neu errichteten. Die Luft war so frisch, und die grüne Flur so einladend, dass nur ein Einfaltspinsel auf den Gedanken kommen konnte, zwei so eigensinnige, kleine Mädchen wie Cecily und Alison würden sich an ihre Pflichten erinnern. Und nur ein Obereinfaltspinsel mochte wähnen, dass zwei Mädchen, so listig wie die Schlangen, nicht auch noch ihre Kinderfrau herumbekommen könnten. Doch als ich die lange Außenstiege hochkletterte, um rasch einen Blick in die Kemenate unter dem Dachgesims zu werfen, da ahnte ich noch nicht, was ich vorfinden würde. Leer! Mir war sofort klar, was sich hier abgespielt hatte – unter dem Stickrahmen standen zwei paar kleine Schuhe herum, die Arbeit von Monaten wies ein paar Dutzend schlampige Stiche mehr auf, und auf dem Fensterbrett lag verlassen Mutter Sarahs Kunkel.
»Sie ist um keinen Deut besser als die beiden! Wie konnte sie nur?« Ich rief aus dem Fenster: »Cecily! Alison!«, und mich dünkte, ich hörte in der Ferne als Antwort schrilles Kindergelächter. Oh, schon wieder nicht bestanden, dachte ich trübsinnig. Wie soll ich aus ihnen jemals Damen machen? Und beim Jüngsten Gericht sagt Gott dann wohl: »Margaret, du hast zugelassen, dass deine Töchter verwildern. Ihre französischen Knoten halten nicht. Und die Gänseblümchen da? Pfui. Haargenau wie Pilze. Zu meiner Linken, du Unwürdige.«
Die Stille in der verlassenen Kemenate war jedoch so einladend, dass ich auf einmal wusste, solch eine herrliche Gelegenheit zum Schreiben würde sich so schnell nicht wieder bieten. Mein, alles mein, jauchzte mein sorgloses Herz. Raum, Ruhe und Stille! Und ehe ich wusste, wie, hatte ich schon Feder und Papier aus der Truhe geholt und meine Aufzeichnungen über Hauswirtschaft rings um mich ausgebreitet.
Dazu muss ich sagen, dass ich vor langer Zeit den Plan fasste, alles aufzuschreiben, was mich Mutter Hilde gelehrt hat, damit nichts davon verloren geht. Und nach mir soll dieses Wissen auf meine Mädchen kommen, damit sie einmal berühmt für ihre Kunstfertigkeit im Heilen, Kochen und der Hauswirtschaft werden. Daher ist es sehr gut, wenn das Ganze zu Papier gebracht wird, auch wenn wirklich alles Geheimnisse sind, denn falls mir etwas zustößt – wie kämen sie dann wohl zurecht? Denn das muss man ihnen lassen: Mit der Nadel sind sie zwar langsam, aber in der Kunst des Lesens zeigen sie eine rasche Auffassungsgabe, und das findet man bei Frauen äußerst selten.
Ich setzte die Feder an der Stelle an, wo ich aufgehört hatte. »Wer keine Motten in seinen Wollsachen haben will –« hatte ich vor vielen, vielen Monden in London geschrieben. Was hatte sich seitdem nicht alles zugetragen! Ihr Vater tot, die ganzen Veränderungen dann. Ein heller Sonnenstrahl kam von dem kleinen Fenster und fiel als warme Lichtlache auf das Papier. Motten. Wie kann Mottenbekämpfung meine Mädchen glücklich machen?
»Zum Kuckuck mit den Motten! Was sollen mir Motten? Was ist nur in mich gefahren, dass ich überhaupt über Motten geschrieben habe?«
»Gewiss nicht Ich, Margaret.« Die Stimme klang warm und freundlich, so als wäre sie irgendwie mitten im Sonnenstrahl. Ich blickte vom Papier auf und musterte ihn eingehend. Aber ich konnte nur Tausende von tanzenden Staubkörnchen sehen, die allesamt golden schimmerten.
»Damals hielt ich es für eine gute Idee«, sagte ich zu dem Sonnenstrahl. »Aber jetzt besteht das Ganze nur noch aus Motten und Fischrezepten. Und dabei mag ich Fisch nicht einmal.«
»Warum schreibst du dann darüber?«
»Ich dachte, es geziemt sich so.«
»Bleib bei dem, wovon du am meisten verstehst, Margaret, denn das geziemt sich.«
Jetzt war natürlich alles klar. Gott sei Dank, ich musste nun doch nicht über Fisch und Motten schreiben. Es ging um weitaus Wichtigeres. Und noch dazu um etwas, worüber meine Mädchen Bescheid wissen sollten, denn von der Welt bekommen sie nichts als Lügen aufgetischt und bleiben vollkommen nichtsahnend.
»Warum so geschäftig und so tintenklecksig?«, fragte mein Herr Gemahl an eben diesem Abend. »Hast du dich wieder an dein Rezeptbuch gemacht? Vergiss ja nicht das Rezept für deine leckeren Fruchttörtchen aus Blätterteig – die wären wirklich ein Verlust für die Menschheit. Oh, wie werden mich meine künftigen Schwiegersöhne preisen.«
»Ich schreibe eine Liebesgeschichte.«
»Noch so eine Erzählung über höfische Minne, auf dass Lug und Trug in der Welt weiter zunehmen? Damit führst du die Menschheit nur auf Abwege. Bleib du schön bei deinen Kuchen.«
»Nein, über dieses falsche, blumige Zeug wie Turniere und Liebespfänder und Lautenspiel in rosenüberrankten Liebeslauben will ich nicht schreiben. Ich schreibe über den Teil ›Und sie lebten glücklich bis an ihr seliges Ende‹. Ich schreibe über wahre Liebe.«
»Wahre Liebe? Oh, noch viel schlimmer, Margaret. Kein Mensch schreibt über dergleichen. Zum einen gehört es sich nicht. Zum anderen ist es unsäglich langweilig. Nein, wenn du über die Liebe schreiben willst, musst du dich schon an die Konventionen halten. Interessant ist doch nur, wie man sie erringt, nicht, wie man sie lebt. Sieh dir Tristan an! Und Lancelot! Was für eine Liebesgeschichte hätte das wohl abgegeben, hätten sie bekommen, wonach sie begehrten. Tristan ehelicht Isolde, und dann setzen sie ein Dutzend mondgesichtiger Bälger in die Welt! Lancelot und Ginevra brennen durch und gründen einen Hausstand, und sie schimpft mit ihm, weil er Schmutz ins Haus schleppt! Was hat das noch mit ritterlicher Minne zu tun? Nichts, gar nichts! Daraus lässt sich keine Liebesgeschichte machen. Darum hören die Geschichten der trouvères, die im Gegensatz zu dir wissen, dass Eheleute nur noch Fett ansetzen, immer vor der Hochzeit auf. Blick den Tatsachen ins Auge, Margaret. Du hast nicht die geringste Ahnung, wie man Liebesgeschichten schreibt. Bleib du bei Rezepten.«
Natürlich machte ich mich auf der Stelle an die Arbeit. Auch wenn sich mein Herr Gemahl, der eine Reihe von Gedichten zu diesem Thema geschrieben hat, für eine Autorität in Sachen Liebe hält, ich, ja, ich habe weitaus mehr geliebt.
Kapitel I
Die meisten Liebesgeschichten beginnen bei Maiensonnenschein mit verstohlenen Blicken beim Tanz oder auf einem Fest oder mit einem heimlichen Stelldichein in einem verwunschenen Garten. Meine jedoch beginnt zur Winterszeit mit einem Begräbnis, als man nämlich meinen Herzallerliebsten zu Grabe trug. Nur die Pflicht hielt mich davon ab, Master Kendall in diesen langen Schlaf zu folgen. Nichts als die Tränen der beiden kleinen Töchter, die er mir hinterließ, fesselten meine widerstrebende Seele an diese Erde. Ich beschloss, Cecily und Alison zuliebe noch ein Weilchen zu bleiben, mich jedoch nur ihrer Erziehung zu widmen, mir aber niemals einen anderen Ehemann zu nehmen. Schließlich war ich mit Master Kendall verheiratet gewesen, da kam kein Geringerer infrage. Möglich, dass es Männer von edlerer Abkunft gab, aber wer besaß wohl eine edlere Seele als Roger Kendall, Tuchhändler zu London? Und wer konnte es an Güte oder Großherzigkeit mit ihm aufnehmen? Ich hielt sein Andenken in Ehren, und das half mir, mich gegen die stetig wachsende Schar von Freiern zu wehren, die allesamt hofften, durch die Heirat mit seiner Wittib an sein Vermögen heranzukommen.
Doch was der Mensch nicht durch Schmeichelei oder Schläue erreichen kann, das nimmt er sich mit Gewalt. Kaum war Master Kendalls Gedenktafel in die Kirchenmauer von St. Botolphe eingelassen, da entführte mich auch schon die schamloseste Familie von Mitgiftjägern im gesamten Königreich England aus einem Haus, das vom Blut unterlegener Freier und Möchtegernerben troff, und das war die verarmte, händelsüchtige, anmaßende Sippschaft der de Vilers. Und das Schlimmste daran: Ich hatte, dumm wie ich war, den ersten dieser Sippe in mein Haus gelassen, diesen jüngeren Sohn und Tunichtgut, diesen gescheiterten Mönch und Dichterling, der sich unter dem Namen Bruder Gregory in der Stadt herumtrieb. Mir, nur mir verdankte er es, dass mein Mann ihn als Schreiber beschäftigte. Und jetzt wusste ich nicht, was stärker war, Gram und Selbstmitleid oder die Wut über meine eigene Torheit, denn da stand ich nun in der Hauskapelle seines Vaters und wurde ohne Ehevertrag und Aufgebot mit ihm vermählt.
Es war einer dieser grauen, nieselnden Tage im Vorfrühling, wenn Himmel und Erde fast eins zu sein scheinen. An vielen Stellen war zwischen den kümmerlichen, mit blankem Eis überkrusteten Schneehaufen schon ein Fleckchen abgestorbenes Gras oder gefrorener Morast zu sehen. Auf einem zerfurchten Weg, der sich über eine vereiste Koppel und durch ein Dorf mit strohgedeckten Katen schlängelte, näherte sich ein Reitertrupp seinem Ziel, dem Herrenhaus von Brokesford, einem wehrhaften Haus im alten, normannischen Stil, das sich am Ende einer mit kahlen Bäumen gesäumten Auffahrt halb hinter einer verfallenen Mauer duckte. Im Dorf war ein Dutzend Bauern zusammengelaufen und stand barfuß im eisigen Matsch am Wegesrand, während Kinder aus den Fenstern lugten, um sich an dem Spektakel zu ergötzen. Es war Mitte Februar im Jahre des Herrn 1356, und der Sieur de Vilers kehrte von einem Abenteuer heim, zu dem er kaum eine Woche zuvor in gestrecktem Galopp, gefolgt von seinen Söhnen, Knappen, Stallknechten und waffenbeladenen Packpferden, aufgebrochen war.
Ein Murmeln durchlief die Schar der Gaffer, als der Trupp sich näherte. Das war nicht mehr die Gruppe, die aufgebrochen war. Zugegeben, an der Spitze ritt wie üblich der alte Sir Hubert aufrecht und eingebildet auf seinem großen Fuchs, gefolgt von seinem ältesten Sohn Sir Hugo auf dem Braunen. Ihnen folgte ein Stallknecht, der die Packpferde führte. Aber – danach – was war das? Robert und Damien, die beiden Knappen, hatten noch jemanden vor sich auf dem Pferd, zwei kleine Gestalten, Kinder. Mädchen dem Aussehen nach, obwohl sie ziemlich dick eingehüllt waren. Hinter ihnen ritt Sir Huberts jüngerer Sohn in formlosem Gewand und Schaffellmantel, derjenige, den früher ein religiöser Wahn gepackt hatte, sodass er sich wer weiß wie viele Jahre herumgetrieben und seinem Vater unsäglichen Kummer bereitet hatte. Und hinter sich, nein, welch ein Skandal, hinter sich auf dem Sattelkissen hatte er eine junge, hübsche Frau sitzen. Eine zerbrechlich wirkende, blasse Frau mit rot geränderten, verweinten Augen, die in einen prächtigen, tiefschwarzen Umhang und ein gleichfarbenes Übergewand gekleidet war. Noch bevor die Stallknechte am Ende des Trupps durchs Tor geritten waren, hatte sich schon die Kunde verbreitet, dass die Frau eine wohlhabende Wittib sei, eine echte Erbin aus der City von London, und dass die kühnen Herren von Brokesford sie vor dem sicheren Tod bewahrt hatten.
Das Beste daran war jedoch – und über den Grund wurden an allen Herdfeuern des Dorfes hämische Vermutungen angestellt –, das Beste war, dass sie schnurstracks und ohne Aufgebot verheiratet werden sollte. Und nicht etwa mit dem alten Sir Hubert, der schon lange Witwer war, und auch nicht mit Sir Hugo, der allmählich legitime Erben zeugen sollte, nein, mit Gilbert, diesem Irren, der zu nichts weiter taugte, als die Nase in Bücher zu stecken. Wie hatte der sie überhaupt aufgetrieben? Vielleicht kam Gilbert ja doch mehr auf seinen Vater, als man dachte. Nicht auszudenken, was für Gelegenheiten sich einem Geistlichen boten, der sich durch die Hintertür ins Haus verheirateter Frauen einschleichen konnte. Genauso wie der schurkische Mönch aus der Ballade! Schließlich wusste jeder: Die Frauen in London waren sittenlos. Man denke nur, sich als Mönch in einer Stadt voller schamloser Frauenzimmer herumzutreiben! Da hatten nun der alte Lord und sein Ältester auf der ganzen Strecke von Cinque Ports bis zur schottischen Grenze zusammen mindestens zwanzig Bastarde gezeugt, die sie nicht anerkannten. Und jetzt, welch ein Spaß, jetzt hatte doch das kleinste Ferkel aus dem Wurf seinen Vater und seinen älteren Bruder noch übertroffen.
Im Trubel der Heimkehr jedoch schien man die Wittib vergessen zu haben. Sie hatte sich geziert, mit ihren modischen Pantoffeln in den Morast zu treten, also hatte man sie an der Treppe vom Pferd gehoben, bevor dieses durch den aufgewühlten Dreck im Hof zu den Ställen geführt wurde. Da stand sie nun wie ein schwarzes Bündel vor der niedrigen Rundbogentür, und ihre kleinen Mädchen klammerten sich an ihre Röcke.
Erst nachdem er die Pferde gut versorgt wusste und nach dem Kaplan geschickt hatte, fiel es dem alten Lord ein, ihr seinen Arm und die Gastfreundschaft seines Hauses anzubieten und sie schwungvoll in seinen sogenannten Rittersaal, den Palas, zu führen. Fröstelnd saß sie in ihrem feuchten Umhang auf einer Bank am Feuer, während die Knappen die blutbespritzten Brustharnische und Kettenhemden säuberten, sie nach oben brachten und wegräumten. Der alte Ritter rief nach etwas zu trinken, dann drehte er sich um und musterte seinen jüngeren Sohn von Kopf bis Fuß. Der junge Mann überragte ihn fast um Haupteslänge, hatte einen kräftigen Knochenbau, einen dunklen Schopf und geschwungene Brauen über dunklen Augen, die vor Intelligenz nur so funkelten. Mit einem schlauen, prüfenden Blick aus blauen Augen erfasste der alte Mann die Sandalen, in die der Sohn seine zerlumpten Beinlinge gestopft hatte, das abgetragene, knöchellange, graue Gewand mit den getrockneten Blutspritzern vorn und das grauenhafte, verfilzte Schaffell.
»In dem Ding da heiratest du mir nicht«, sagte der alte Mann.
»Was ist daran auszusetzen? Heiraten war doch deine Idee«, sagte der Jüngere.
»Unverschämt wie eh und je. Steht in keinem der Bücher, die du liest, dass man ›Vater und Mutter ehren soll‹? Ich sage es noch einmal, in dem Ding da heiratest du nicht. Du bist jetzt in meinem Haus. Vergiss das nicht und hör auf, dich danebenzubenehmen.«
Der junge Mann bekam einen aufsässigen Blick. Sein Vater befahl, in der Küche, welche hinter einem Wandschirm an den Palas angrenzte, ein Bad zu richten. Dann schickte er einen der herumlungernden Hausknechte nach Kleidung in den Söller hoch. Die Steinmauern des Palas waren zwölf Fuß dick und so feucht und kalt wie Höhlenmauern. Beim Sprechen kamen weiße Wölkchen aus dem Mund des alten Lords.
»Ich will kein Bad«.
»Das Stadtleben hat dich verweichlicht.« Der alte Mann strich um seinen Sohn herum und begutachtete ihn von allen Seiten, so als wollte er überprüfen, welche dieser Seiten am weichesten geworden wäre. Die Wittib wandte den Kopf und sah ihm dabei mit undurchdringlicher Miene zu.
»Ich brauche keines. Ich will keines. Heiraten sollte dir genügen.«
»Im Leben eines Mannes gibt es vier Anlässe, bei denen er sich waschen sollte – in deinem Falle drei. Bei seiner Geburt, wenn er zum Ritter geschlagen wird, wenn er stirbt und – WENN ER HEIRATET! Und wenn du jetzt immer noch nicht weißt, was deine Pflicht ist, rufe ich sechs Männer herein, die zeigen dir, wo es langgeht, selbst auf die Gefahr hin, dass sie dich ersäufen!« Die Stimme des alten Mannes klang gewittrig. Der Sohn richtete sich würdevoll und mit katzenartiger Geschmeidigkeit zu voller Größe auf.
»Deine logische Argumentation, Vater, überzeugt wie gewöhnlich.«
»Listig wie die Schlangen«, knurrte der alte Mann und folgte ihm in die Küche.
Die Wittib saß immer noch an der großen Feuerstelle mitten im Raum und blickte sich um. Sie hielt auch immer noch den Becher umklammert, den man ihr gereicht hatte, doch das Ale sah aus, als hätte sie es nicht angerührt. Sie hatte daran gerochen und die Nase gerümpft, aber zum Glück hatte es niemand gemerkt.
Hinter dem Wandschirm nahmen die Dinge in dem hohen Badezuber am Küchenfeuer ihren Lauf, so wie es der alte Mann befohlen hatte. Die Wittib hörte Geplätscher, als der Diener den im Zuber Stehenden mit kaltem Wasser übergoss. Der Wandschirm konnte die laute Stimme des alten Mannes auch nicht dämpfen.
»Wehe, du kehrst deinem Vater den Rücken zu – Dreh dich um und blick mir in die Augen. – Hmm, wer hat dir denn die da übergezogen? Hat aber eine ruhige Hand gehabt. Ein Priester? Daher also. – Wofür? Ein Buch? Hast du dich etwa hingesetzt und ein Buch geschrieben? Etwas Dümmeres ist dir wohl nicht eingefallen. Das kommt davon, wenn man die Nase in Bücher steckt. Und verbrannt haben sie es auch, sagst du? So wie ich dich kenne, war es wahrscheinlich das Beste, was dem Buch passieren konnte. Du hast doch noch nie einen vernünftigen Gedanken im Kopf gehabt. Wenn du auf mich gehört, dich wie ein guter Sohn aufgeführt hättest und im Heer geblieben wärst, statt dich auf diese lachhafte Gottessuche zu begeben und ein Federfuchser zu werden, dann hättest du die Narben jetzt vorn wie ein Ehrenmann und nicht auf dem Rücken ...«
Margaret seufzte, stellte den Becher hin und zog Cecily und Alison fester an sich. Kein sehr vielversprechender Anfang für eine Ehe, wollte ihr scheinen.
Die Fastenzeit hatte gerade begonnen. Am Vorabend des Festes des hl. Matthias und kaum vierzehn Tage nach meiner übereilten und trübseligen Hochzeit kam mir der Verdacht, dass mich etwas verfolgte, das – nun ja, nicht ganz von dieser Welt war. Gram und Einsamkeit können der Einbildung Streiche spielen. Und zuweilen tut Gott auch Wunder, um uns zu trösten, so wie es einst einem Freund von Robert le Tambourer geschah, der eine große Sünde begangen hatte. Dem erschien mitten im tiefen Jammertal der hl. Bartholomäus, und der maß volle fünfundzwanzig Fuß und leuchtete wie eine lodernde Flamme.
Doch diese Erscheinung war nicht von Gott gesandt; es war ein unheimliches, beunruhigendes Gefühl; es wollte mir vorkommen, als beobachtete mich jemand in einem leeren Zimmer. Es verfolgte mich bei Tage und lag des Nachts neben mir. Wenn ich im Bett hellwach neben der steifen, störrischen Gestalt meines schlafenden Ehegesponses saß, der sich aus Wut auf seinen Vater immer noch weigerte, die Ehe zu vollziehen, die der alte Lord angeordnet hatte, konnte ich ein eigenartiges Pfeifgeräusch hören, gleichsam als zöge es sacht vom Fenster her durch die nächtliche Stille des Zimmers. In meiner Not war mir, als hätte mich Satanas insgeheim im Auge, und so verdoppelte ich meine Gebete in der kalten, schlecht ausgestatteten kleinen Kapelle im Haus meines neuen Schwiegervaters. Um was betete ich, abgesehen von meiner Errettung? Vor allem um die Seele meines verstorbenen Mannes, des guten Master Roger Kendall, der so schnell gestorben war, dass er keine Absolution mehr erhalten konnte.
Die schreckliche Überwachung begann, als mein frischgebackener Ehemann und seine Sippe von ihrem ersten Ausritt nach London zurückkehrten, den sie nach unserer Hochzeit machten. Denn kaum waren wir vermählt, da brachen sie auch schon auf, um so schnell wie möglich den mir vermachten Besitz und die Mitgift meiner Töchter in die Finger zu bekommen. Außerdem waren sie noch in anderen Geschäften unterwegs: Sie mussten Advokaten aufsuchen und die Richter bestechen, die sich mit dem Mord an meinen Stiefsöhnen befassten, welchen sie selbst als Notwehr hinstellten. Vermutlich kam das der Wahrheit durchaus nahe, je nachdem, von welchem Standpunkt aus man die Sache betrachtete, denn meine Stiefsöhne hatten Streit angefangen, hatten ein Mitglied der De-Vilers-Familie umbringen wollen. Als Master Kendalls Söhne aus erster Ehe hatten sie selbstverständlich erwartet, alles zu erben, bis er dann auf seine alten Tage mich geheiratet und neue Kinder gezeugt hatte, die ihnen fortnahmen, was ihnen ihrer Meinung nach rechtens zukam.
Master Kendall jedoch hatte mich sehr lieb gehabt und war stets um meine Bildung bemüht gewesen, deshalb hatte er auch Madame als Französischlehrerin und Bruder Gregory als Schreiblehrer für mich eingestellt. Und schon nutzten sie die Gunst der Stunde. Anfangs versuchten sie, mich aus dem Weg zu räumen, indem sie ihm einflüsterten, dass ich seinem Namen mit Bruder Gregory Schande gemacht hätte. Aber Master Kendall lachte sie einfach aus und enterbte sie sodann für ihre Unverschämtheit. Jedermann im Hause wusste, dass Bruder Gregory für dergleichen viel zu prüde war; und weil sich seine Familie auf dem absteigenden Ast befand, war er ein Kräutlein Rührmichnichtan, und Frauen verabscheute er fast genauso wie Krämer, Wechsler, Advokaten, gekaufte Ritterwürden und gefälschte Stammbäume. Was er damals allerdings jedermann verschwieg: Er brauchte die Arbeit, weil ihn sein Abt wegen seiner unerträglichen Streitsucht hinausgeworfen hatte und er kein Bruder mehr war, und ein Gregory auch nicht, obwohl ich ihn immer noch so nenne, wenn ich nicht daran denke.
Doch als Master Kendall dann starb, verschworen sich seine Söhne gegen mich, und als Bruder Gregory die Verschwörung entdeckte und mir zu helfen versuchte, wäre es um uns beide geschehen gewesen, wenn seine Familie sie nicht umgebracht hätte. Woran man ersehen kann, dass ich Gilbert de Vilers zu meinen Freunden zählte, zumindest bis zu dem Tage, als seine Familie beschloss, ihr stünde für ihre Mühewaltung Master Kendalls Vermögen zu, und mich entführte wie die Braut aus einer Minneerzählung. Nach der Hochzeit wollte Gregory nicht mehr mit mir reden, und jeder seiner Blicke zeugte von seinem Groll über eine Ehe, zu der ihn sein Vater gezwungen hatte. Und was mich anging, je besser ich seine Familie kennenlernte, desto mehr zählte ich auch ihn dazu – diesen Heuchler, diesen schamlosen Grabschänder im falschen Mönchsgewand.
Mitten in dieser bitteren Zeit begann dann die Überwachung, wehte mich der eigenartige, kühle Hauch an, dass ich hinterher immer dachte, viel fehlt nicht mehr, und ich verliere den Verstand. Solches geschah eine Woche nach der Hochzeit – an dem Tag, als sie mit meinen Sachen aus London zurückkehrten –, das weiß ich noch ganz genau.
»Da, Schwester«, sagte Hugo und kam, gefolgt von zwei Flegeln, die eine Truhe trugen, ins Zimmer marschiert, »wir bringen Euch Eure Sachen aus der City. Vater sagt, er duldet keine junge Braut im Haus, die in schwarzen Kleidern Trübsal bläst, darum befiehlt er Euch, heute zum Abendessen etwas Farbenfrohes anzuziehen.«
Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich Hugo reizt. Ich weiß noch nicht recht, was mich mehr aufbringt, seine Dummheit oder seine Eitelkeit. Vielleicht kommt es auch daher, dass er sich in Bezug auf Frauen für unwiderstehlich hält. Wie auch immer, da stand er nun in seinen verdreckten Reisekleidern, die Hände in die Hüften gestemmt, und sein gemeines Schlächtermesser baumelte ihm im Gürtel. Wenn er mit Frauen redet, streichelt er den langen Griff und blickt sie anzüglich an. Kaum zu glauben, dass er und mein Mann Brüder sein sollen, so verschieden sind sie geartet. Gilbert ist dunkel und hochgewachsen, während Hugo mittelgroß und wie sein Vater ziemlich vierschrötig ist und genauso hellhaarig wie dieser. Mehr wie sein Vater einst war, denn dessen Haar und Bart sind jetzt schlohweiß. Doch wo sein Vater ein Wüterich mit buschigen weißen Brauen und stechend blauem Blick ist, wandelt Hugo in einer Aura aus Einbildung einher, welche meinen Mann fast genauso reizt, wie sie mich stört.
»Ich trage, was mir gefällt«, sagte ich.
»Wehe Euch, Ihr handelt mir zuwider, widerborstige, kleine Eselin«, antwortete er. Hugo war viel zu nahe herangetreten. Ich funkelte ihn böse an.
»Wenn Ihr mir gehörtet, ich hätte Euch schon gefügig gemacht«, sagte er und streichelte seinen langen, lederumhüllten Messergriff. »Ich würde Euch das Kleid da vom Leibe reißen und Euch prügeln, bis Ihr betteln würdet, das tragen zu dürfen, was ich Euch befehle. Gilbert ist ein Trottel. Nicht beschlafene Frauen werden allesamt Beißzangen.« Er blickte mich lüstern an, dann machte er auf dem Hacken kehrt. Man hatte die Truhe in der Ecke des Söllers abgestellt, und Cecily und Alison durchwühlten sie schon auf der Suche nach ihren Sachen. Auf einmal stieß Cecily einen Schrei aus und hielt ihre Bernsteinkette hoch. Ich konnte nicht anders; als ich sie sah, musste ich an ihren Vater denken, wie er sie ihr an jenem letzten, wunderschönen Weihnachtsfest geschenkt hatte, und schon fing ich an zu weinen. Dann fing auch Alison an zu heulen, schließlich ist sie noch so klein, und Cecily stimmte mit in den Jammer ein.
Ich hörte Hugo »Frauen! Zum Totlachen!« sagen, als er die enge, steinerne Wendeltreppe zum Palas hinunterpolterte, wobei er keine der beiden Türen an der Treppe hinter sich zumachte. Die Treppe ist nicht etwa zur Bequemlichkeit gedacht, sondern zur Verteidigung des oberen Stockwerks – die ausgetretenen Stufen gleich unter den Scharten kann man nur im Gänsemarsch hinaufsteigen, und die schweren Eichentüren oben und am Fuß der Treppe können einer Streitaxt standhalten. Doch wenn die Türen offen stehen, steigen die Geräusche aus dem Palas hoch wie Rauch im Kamin, und man kann am Leben und Treiben unten teilnehmen, als wäre man selbst dabei.
Da kniete ich nun in den verfilzten Binsen, ging meine Truhe durch und konnte hören, wie der Streit unten an Lautstärke zunahm. »Du VERDAMMTER Narr! Das sage ich dir, wenn die da oben herausfinden, dass die Ehe nicht vollzogen ist, werden sie versuchen, sie zu annullieren! Und wie stehe ich dann da?«
»Mittellos.«
»Mittellos dir zuliebe, du elendiges Balg! Bestechungen für die Richter, Bestechungen für den Bischof, eine ganze Sippschaft von Advokaten und Gott weiß, wer sonst noch die Hand aufhält! Woher sollte ich wohl wissen, dass er ihr so viel vermacht hat, dass halb London mir dafür am liebsten die Kehle durchschneiden würde?«
»Du hättest sie fragen können, ehe du sie entführt hast.«
»Das hast doch du gewollt. Es war alles nur dir zuliebe.«
»Mir zuliebe? MIR zuliebe? Wer wollte denn sein Dach ausbessern? Du hast Geld gerochen und sie dir geschnappt! Ich war ZUFRIEDEN mit meinem Leben! Aber DU musstest dich ja unbedingt einmischen, und deinetwegen sitzen wir jetzt in der Tinte!«
»Tinte? Wir säßen nicht in der Tinte, wenn du deine Pflicht tun und diesem Frauenzimmer ein Kind machen würdest. Was ist überhaupt los mit dir? Hugo kann jeder Frau Zwillinge machen! Sieh ihn dir an – Bastarde, überall Bastarde! DAS ist mir ein Mann! DER verdreht nicht die Augen gen Himmel und brabbelt unentwegt von Gott!« Man hörte Schläge, bis sich dann Hugos Stimme fröhlich über dem Getümmel vernehmen ließ.
»Lass ab, Vater, der bringt ja nichts mehr zustande, wenn du weiter so auf ihn eindrischst.«
»Dann – soll – er – mir gefälligst verraten«, sagte der alte Sir Hubert und rang dabei nach Atem, »welche Ausrede er dieses Mal hat.«
»Es ist Fastenzeit. Und obendrein Freitag.« Das war Gregorys Stimme. Sie klang prüde und selbstgerecht. Ich kannte ihn gut. Jetzt trug er gewisslich die Nase hoch und sah mit diesem tugendhaften Blick auf seinen Vater herab, der den alten Mann schier um den Verstand bringt. Allein schon bei dem Gedanken musste ich lächeln. Ich hockte mich auf die Fersen, damit ich besser lauschen konnte. Da kannte ich Gregory, den Sauertopf, nun schon eine geraume Weile, aber ich hätte nie gedacht, dass er solch eine Familie hat. Das ist das Dumme an der Ehe: Man heiratet nicht einfach einen Menschen, nein, man heiratet eine ganze Familie.
»Und was hat das damit zu tun, dass du deine Familie im Stich lässt?«
»Alle kirchlichen Autoritäten stimmen darin überein, dass ein Mann, an den der Ruf ergangen ist und der dennoch heiraten muss, sich an Weihetagen der fleischlichen Beziehungen enthalten sollte.«
»Und was sind das für Weihetage, du geweihtes Mondkalb?«, kam es als leises Knurren die Stiege hoch. Unten in den Binsen war ein Krachen und Rascheln zu hören, so als wäre jemand zur Seite gesprungen, um einem Schlag auszuweichen. Ich konnte Hugo lachen hören.
»Fastenzeit, Advent, Sonntage, Vorabende von Festtagen, mittwochs und – auch – (wieder krachte und raschelte es, dann klang es, als flöge eine Bank gegen die Wand) – freitags.«
»Mama, sie zerschlagen die Möbel«, flüsterte Alison mit großen Augen.
»Wehe, ihr geht hinunter, Cecily, komm sofort von der Treppe weg.« Als ich sah, dass sie widerstrebend den roten Wuschelkopf aus der Türöffnung zog, blickte ich wieder in meine Truhe. Unter einem Paar Schühchen und den Falten meines langen, blauen Wollkleides lugte ein Buchrücken hervor. Freude durchfuhr mich. Das musste Gregory hineingeschmuggelt haben, als sie mein Haus in London durchstöbert hatten. Ich holte das Buch heraus und fuhr mit der Hand über das Monogramm auf dem Einband. M. K. – Margaret Kendall. Mein Psalter. Vielleicht hatte Gott mich ja doch nicht verlassen. Stimmen schallten die Stiege hoch.
»Und ich sage dir, Vater, ich habe die Absicht, Gott zu sehen, ganz gleich, ob ich nun in Witham bin oder nicht, und du wirst mich nicht davon abhalten.«
»Gott sehen? GOTT SEHEN? Hat der Abt dir diesen Gedanken nicht ein für alle Mal mit der Rute ausgetrieben? Wie kommst du auf die Idee, dass Gott ausgerechnet dich sehen will? Gott ist ein viel beschäftigter Mann! Der hat keine Zeit für jüngere Söhne, die ihrem Vater nicht gehorchen! Und ich sage dir, kümmere du dich um deine familiären Angelegenheiten, dann kümmert sich Gott auch um dich!«
»Du kannst machen, was du willst, ich lasse mich durch dich nicht davon abbringen. Mein Gewissen gehört immer noch mir, und ich habe vor –«
»Deine Zeit damit zuzubringen, auf Stimmen in der Luft zu hören? Mach endlich Schluss mit dem Unfug und sei ein Mann, sonst verspreche ich dir, dass ich dir Striemen überziehe, gegen die sich die von deinem Abt wie ein Kinderspiel ausnehmen ...«
Ich schlug das Buch auf und zog mit dem Finger die säuberlich geschriebenen Zeilen nach, die mit einem roten Großbuchstaben gekennzeichnet waren. Alles Englisch. Darunter, wo die Zeile mit einem blauen Großbuchstaben begann, stand Latein, das mir aber ein Buch mit sieben Siegeln war. Mein guter, seliger Mann hatte die Idee zu dem Buch gehabt und Gregory damit beauftragt, die Übersetzung anzufertigen, denn, so hatte er gesagt, einen erstklassigen Gelehrten erkennt man sofort, auch wenn er so kratzbürstig ist wie ein ganzer Korb Brennnesseln. Niemand hat mich so geliebt wie Master Kendall, sonst hätte er sich nicht ein Geschenk ausgedacht, das mein Ein und Alles wurde. Und genau in diesem Augenblick spürte ich Augen, die mich beobachteten, und es hauchte mir kalt in den Nacken.
»Wer ist da?« In panischer Angst fuhr ich herum, aber da war keine Menschenseele. Abgesehen von den beiden Mädchen, die jetzt auf Zehenspitzen an einem Ende der langen Fensterbank standen und versuchten, aus dem Fenster zu sehen, war niemand im Zimmer. Es war ein großer Raum, er umfasste das ganze obere Geschoss über der Küche, der Speisekammer und dem Anrichteraum und war nur dem Namen nach ein ›Söller‹, denn viel Sonne drang nicht herein. Die Wände maßen acht Fuß, waren aus massivem Stein und durchbrochen von hohen, schmalen, unverglasten Fenstern ohne Fensterläden, die bei gutem Wetter einen dünnen Strahl bleiches Sonnenlicht hereinließen. Im rechten Winkel zur Wand waren lange Fensterbänke aus Stein in die Mauerdurchlässe eingebaut, die unbequem waren und keine Kissen hatten. Dort konnte sich niemand verbergen. Lauerte etwa jemand in den Schatten? Mein Blick wanderte die Wand entlang und musterte die Ecken. Auf den langen Kleiderhaken an den Wänden über den Betten hingen Kleidungsstücke, Kettenhemden und Langschwerter in der Scheide. Neben dem Bett der Knappen machte ein Falke mit dem Kopf unter den Flügeln ein Nickerchen, während ein anderer auf der Stange neben seinem Gefährten hin- und hertrippelte und seine Glöckchen klingeln ließ.
Vielleicht war es ein Mensch, jemand, der sich unter den Betten versteckte. Na gut, aber mich würde er nicht überrumpeln. Ich stand auf, holte mir das schwere Langschwert und stocherte damit unter dem Bett herum, das mir am nächsten stand. »Raus da«, zischte ich wütend. Nichts unter dem Bett, in dem die Knappen schliefen. Nichts unter dem zerwühlten Strohsack, auf dem ihre Diener schliefen – denn der lag direkt auf dem Fußboden. Die Truhen standen an der Wand, und hinter ihnen hatte niemand Platz. An der gegenüberliegenden Wand war das durchgelegene kleine Bett, wo einst die Pagen geschlafen hatten, als es noch Pagen im Haus gab. Jetzt gehörte es Cecily und Alison. Angenommen, er versteckte sich darunter? Rasch durchmaß ich das Zimmer mit dem schweren Schwert in beiden Händen. Hinter mir jedoch hörte ich so etwas wie körperlose Schritte durch die Binsen rascheln, genau hinter meinen.
»Raus da!«, sagte ich und stocherte wie wild unter dem kleinen Bett herum. Keine Menschenseele darunter. Ich setzte mich zum Nachdenken aufs Bett. Die große Tür, die vom Söller zum Turm führte, war geschlossen – auf diesem Wege konnte niemand entwischt sein. Die Stiegentür stand zwar offen, aber niemand war hereingekommen. Blieb nur noch das große Bett, Sir Huberts zweitbestes, das an der Wand stand. Unser Brautlager sozusagen. Die herabbaumelnden Vorhänge waren aufgezogen, also konnte sich niemand dahinter verstecken. Doch darunter – nun ja, darunter war viel Platz. Zu viel, als dass ich jede Ecke mit dem Schwert hätte erreichen können. Das bedeutete, ich musste einen Blick darunterwerfen, ganz gleich, wie sehr ich mich fürchtete. Leise schlich ich mich auf das Bett zu, bekreuzigte mich, schlug die Bettdecken hoch und kniete mich hin, um darunter nachzusehen. Du musst jetzt stark sein, redete ich mir gut zu. Denk an deine Mädchen, du darfst nicht zulassen, dass ihnen ein Leides geschieht. Ich spähte in das modrige Dunkel und erwartete halb und halb, im Dämmer in ein Paar hell leuchtende, böse Augen zu blicken.
»Raus da, auf der Stelle, oder ich rufe die Männer hoch und lasse Euch töten«, zischte ich und machte mit dem Schwert einen Halbkreis, so weit mein Arm reichte. Hinter meinem Ohr vermeinte ich, einen leisen Seufzer zu hören.
»Zwecklos«, besagte der. Und da wusste ich mit Gewissheit, dass es sich nicht um einen Menschen handelte. Ich drehte mich um und lehnte mich immer noch kniend an das Bett, und meine Hand umklammerte das Kreuz, welches ich stets um den Hals trage. Es ist ein berühmter Talisman, vielleicht nicht so berühmt wie das Kreuz von Rouen, welches Stückchen von Christi Leichentuch birgt und Tote lebendig machen soll, doch beinahe so berühmt. Es hat mich beschützt, seit es in meinen Besitz gelangte, obschon ich im Augenblick nicht die Zeit habe zu erzählen, wie sich das zutrug. »Im Namen Gottes, weiche von mir und belästige mich nicht länger«, flüsterte ich, denn die Kinder sollten mich nicht hören. Doch die einzige Antwort war ein eisiger Windstoß, der mir durch und durch ging und mir das Blut in den Adern gerinnen ließ.
Unten war der Streit noch in vollem Gange, doch er interessierte mich nicht mehr. Ich hörte Hugos Stimme verkünden: »Also, wenn ich einmal heirate, dann gewisslich keine magere, scharfzüngige, eingebildete Wittib aus London. Ich nehme es dir wirklich nicht übel, Gilbert. Die hat zu viel Jahre auf dem Buckel, da beißt keiner mehr an. Nimm also ruhig ihr Geld und spiel den Heiligen. Ich finde schon noch eine Frische und Unverbrauchte, die mir viele Söhne austrägt.« Es krachte, denn schon wieder flogen Möbel durch die Gegend. Ich spürte, wie mir die Tränen übers Gesicht liefen. Alt, alt. Das also war es. Ich war alt. Nicht mehr jung und unverbraucht. Dreiundzwanzig Lenze und müde von der ganzen Plackerei und zu alt, um noch einmal wahre Liebe zu erfahren.
»Oh Master Kendall, warum musstet Ihr sterben?«, rief ich. »Ihr habt mich stets geliebt und wart gut zu mir. Und so alt wart Ihr nun auch wieder nicht – warum habt Ihr nicht länger gelebt und mir das hier erspart?« Ich spürte, wie sich das kalte Ding gleichsam wie ein Umschlagtuch um meine Schultern legte, doch ich war zu traurig, um auch nur zu frösteln. Die Mädchen waren es leid, auf den Fensterbänken herumzuklettern, und da sie mich so bekümmert sahen, kamen sie herbei, setzten sich auf meinen Schoß und wollten mich trösten. In der Luft hinter uns war ein leiser Laut zu hören – er klang traurig und wie ein Seufzer.
Bald jedoch war es Zeit zum Abendessen, anschließend folgte das Gelage, die Hauptlustbarkeit in diesem Haus, welches nicht einmal einen Spielmann hatte. Mitten in der Halle loderte als einzige Lichtquelle das große Feuer, hellrot beschien es die Gesichter an den Schragentischen. Am erhöhten Kopfende des Tisches wurde immer Französisch gesprochen, nur um alle Lauscher – Gott inbegriffen – daran zu gemahnen, dass die de Vilers eine sehr alte Familie waren und man ihnen keine Vermischung mit englischem Bauernblut nachsagen konnte. Zur Rechten erstreckte sich eine lange Wand mit einem Wald von Geweihen. Die Wand zur Linken des erhöhten Tisches zierten eroberte Lanzenfähnchen aus Sir Huberts letztem Feldzug gegen die Franzosen, dazu gesellten sich schottische und walisische Streitäxte und ein großer, verbeulter Schild mit einer arg abgeblätterten Abbildung des de Vilers’schen Wappens: drei Herzmuscheln und ein roter Löwe. Kein einziger Wandbehang. Die waren zu ›verweichlicht‹. Falls Sir Hubert einmal einen gehabt haben sollte, so hatte er ihn gewiss für ein Pferd eingetauscht.
»Mit Verlaub, trinkt, Frau Schwester«, sagte Hugo und reichte mir den Becher mit Ale. »Ihr stochert ja nur im Essen herum und werdet von Tag zu Tag dürrer. Ihr braucht Fleisch auf den Rippen, wenn Ihr meinem Bruder gefallen wollt.« Ritterlichkeit, pah, nichts als Gemeinheit im prächtigen Gewand, dachte ich.
»Habt Dank, lieber Bruder, dass Ihr Euch um mich sorgt, aber ich bin nicht durstig«, gab ich auf Französisch zurück. In einem Hause, in welchem man das Wasser zum Ale-Brauen aus eben dem Burggraben holt, in den man auch den Abfall wirft, kann man schwerlich Durst bekommen. Und dabei biss ich mir noch auf die Zunge, denn das Ale, das ich früher gebraut hatte, war zehnmal besser als ihres hier. Ich nehme dazu ausschließlich frisches Quellwasser; das ist eines meiner Geheimnisse. Das andere ist ein besonderes Gebet, das ich beim Gären spreche, aber das schreibe ich nicht auf, sonst könnte ja alle Welt davon Gebrauch machen. Mein Bier hat Master Kendall immer sehr gut gemundet, und Gregory auch – einer der Gründe, warum er so viel im Haus herumlungerte und auf theologische Dispute mit Master Kendall aus war.
»Ha, hört ihr diesen näselnden Akzent? Im Kloster erzogen, jede Wette«, sagte der alte Sir Hubert und wischte sich den Bart im Tischtuch. Gregory, der mehr über meine Familie weiß, als guttut, setzte eine ironische Miene auf. Die am niedrigen Tisch in Englisch ausgetauschten Witze und Anzüglichkeiten wurden immer derber. Sir Hubert leerte den Becher. Ale, selbst dieses, stimmte ihn gnädiger – nur eben nicht gnädig genug. Ich musterte die Gesichter der am Tisch Sitzenden und überlegte, ob Gregory auch einmal so unmöglich wie sein Vater werden würde. Der alte Mann rülpste und wischte sich einen Tropfen Bratensoße mit dem Tischtuch aus dem zerrupften, weißen Bart. Er trug sich mit einer gewissen schäbigen Überheblichkeit in einem ziemlich abgetragenen, altmodischen Rittergewand aus schwerer Wolle, das ihm bis zur Wade reichte, darüber hatte er einen langen, braunen, bestickten Überrock mit einem Futter aus Fehpelz. Auf dem Ehrenplatz neben ihm saß Sir Hugo, dessen Ritterschlag das Familienvermögen erschöpft hatte. Der ist sogar noch schlimmer, dachte ich und sah zu, wie er den Becher an den Mund setzte. Und überhaupt sieht Gregory viel besser aus.
Sir Huberts jüngerer Sohn überragte seinen Vater und seinen älteren Bruder mindestens um Haupteslänge, hatte einen wilden, braunen Lockenschopf, dunkle Augen und finstere Brauen, die er gern ironisch-abweisend wölbte, seine Lieblingsmiene vor allem im Familienkreis, unter Fremden und Einfaltspinseln. Wenn sich jemand damit auskannte, dann ich, hatte er sie doch in der ersten Zeit unserer Bekanntschaft oft genug aufgesetzt. Und im Gegensatz zum Rest seiner Familie, hatte er einen hellen Kopf. Er konnte in drei Sprachen Gedichte machen und so gut theologisch disputieren, dass es einen Bischof zu Tränen rührte, doch das alles zählte nicht unter dem Dach seines Vaters. Hier am väterlichen Herd stockte ihm die witzige, boshafte Zunge, und die ewig übellaunige Zornesmiene entstellte seine gut geschnittenen Züge. Ich war der Köder, mit dem sein Vater ihn zur Heimkehr gezwungen hatte, und das trug er mir nach.
Doch Sir Hubert hatte gemerkt, dass ich sie musterte. Als sein Knappe sich hinkniete und ihm das nächste Gericht darbot, stellte er den Becher hin und richtete das Wort an mich: »Madame und Frau Schwiegertochter, was haltet Ihr von unserem altehrwürdigen Familiensitz?« Er hob eine weiße Braue und sah mich an, als ob mir eine Laus den Hals hochkrabbelte. Gute Tischmanieren ade, ich bin es leid, dachte ich. Was habe ich schon von euch als eine Atempause in dem ganzen Gebrüll. Im höflichsten Hoffranzösisch gab ich zurück: »Hochverehrtester Herr und Schwiegervater, Euer geschätztes Haus hat stets etwas Neues zu bieten und ist für mich von unermesslichem Interesse, denn früher musste ich mich mit dem einfachen Leben in der Stadt begnügen.«
Leise knurrend erwiderte er: »Macht mir die große Freude und zählt mir all das Neue, das Euch so interessiert, einmal auf.« Bereits als er das sagte, war mir klar, dass es unklug gewesen wäre, wenn ich auf nüchternen Magen getrunken hätte.
»Es ist meine Pflicht, Euch in allem zu gehorchen«, sagte ich und blickte betrübt auf das dunkelgrüne Überkleid, das ich über mein schwarzes Unterkleid gezogen hatte. »So wisset denn, dass Euer bezauberndes Heim Ratten in den Binsen, Flöhe in allen Betten und eine Weiße Dame in der Kapelle hat.« Ich sah, wie er vor Zorn zusammenzuckte und seine Hand zur Hundepeitsche fuhr, welche immer in seinem Gürtel steckte, wenn er daheim war. Die Jagdhunde unter dem Tisch rührten sich und knurrten. Ich reckte das Kinn. Soll er nur gegen die guten Tischsitten verstoßen.
Doch auf einmal lehnte er sich zurück und sagte lächelnd auf Englisch: »Eine spitze Zunge, doch zumindest habt Ihr Rückgrat. Nicht schlecht – das hier ist kein Haus für schwache Frauenzimmer.« Er beugte sich zu mir. »Ihr habt vermutlich mit dem Kaplan geschwatzt, und der hat Euch von der Weißen Dame erzählt. Wisst Ihr denn nicht, dass Ihr einem Lügenmärchen aufgesessen seid? Er benutzt sie als Ausrede dafür, dass er betrunken die Messe liest.«
»Nein«, gab ich zurück, »für ein Schwätzchen ist er nie nüchtern genug. Es ist in der Tat ein Wunder, dass er den Hochzeitsgottesdienst durchgestanden hat, ohne umzufallen. Die Weiße Dame habe ich selbst gehört.«
»Ihr selbst? Ei, das ist mir ja eine hübsche Geschichte. Mit Verlaub, erzählt, worüber sie sich grämt.«
»Das habe ich ein Weilchen auch nicht gewusst, aber da ich ziemlich viel allein in der Kapelle bete, höre ich sie recht häufig weinen. Eines Abends, gerade vor der Vesper, habe ich Worte aus dem Weinen herausgehört. Sie hat geschluchzt: ›Alle meine Kinder, alle tot‹, und dann hat sie noch eine Weile vor sich hin geweint, ehe sie verschwunden ist.« Hugo fuhr zusammen und bekreuzigte sich, und Gilbert wirkte ernst und ruhig.
Doch der alte Mann donnerte mit der Faust auf den Tisch und brüllte: »Als ob ich es nicht gewusst hätte! Erst stirbt sie, und dann findet sie Mittel und Wege, wie sie mich weiter ärgern kann! Gerade als ich dachte, jetzt wäre endlich Schluss! Frauen! Eine Plage für jeden Mann!« Seine Stimme war so laut, dass die Leute an den niedrigen Tischen aufhorchten, weil sie wissen wollten, was an unserem vor sich ging. Doch als der Abend zu Ende war und sich alles nach oben verzog, packte Sir Hubert seinen Ältesten beim Ärmel.
»Bleib hier, Hugo. Ich will mich heute Abend volllaufen lassen«, sagte er, und dann setzten sich Vater und Sohn und all ihre flegelhaften Gefolgsleute an den festen Tisch inmitten des Wirrwarrs von abgebauten Schragen und schlafenden Hunden und machten ein neues Fass Ale auf.
Ihr trübseliges Gesinge war noch zu hören, als ich auf dem Bett saß, meinen Schleier abnahm und mir die Zöpfe auskämmte. Nicht einmal eine Magd hatten sie für mich aufgetrieben und eine Kinderfrau auch nicht. Sie hatten einfach keine Vorstellung davon, wie Frauen sich ankleideten, und die Mühe nachzufragen, die hatten sie sich auch nicht gemacht. Und falls sie auf den abwegigen Gedanken gekommen wären, so hätten sie mir nicht zugehört. Gregory hatte sich wie gewohnt bis auf die Unterhose entkleidet und kniete vor seinem Kruzifix, das er neben dem Bett aufgehängt hatte. Mönchische Gewohnheiten sind schwer abzulegen. In den Locken auf seinem Hinterkopf konnte man immer noch eine kleine Delle erkennen, dort wo seine Tonsur ausgewachsen war. Es erboste ihn, dass ihm sein Vater nicht erlaubte, sich diese wieder zu rasieren, zumindest die Gelehrtentonsur, auf die er ein Anrecht hatte. Und sein langes Gewand hatte er auch verbrannt. Wenn ich ihn mir jetzt ansah, dann fand ich ihn so eigentlich hübscher. Als wir uns kennenlernten, war mir gar nicht aufgefallen, wie anziehend seine widerspenstigen, dunklen Locken waren. Und wer hätte geahnt, was für eine gute Figur sich unter dem formlosen, alten Gewand verbarg? Doch sein härenes Hemd hatte er behalten. Das trug er nun jeden Tag unter dem zweitbesten Jagdrock seines Vaters, so als wollte er sich dafür bestrafen, dass er heimgekehrt war.
Zuweilen wünschte ich mir so sehr, dass alles wie früher wäre: ich seine Schülerin und er wieder Bruder Gregory. Wie viel leichter war es, als er für mich nur ein gelehrter Kopf, jedoch kein Mann war. Ich weiß um den Klatsch, wir hätten hässliche Dinge miteinander getrieben, doch daran ist kein wahres Wort. Gerade darum war alles doch so schön. Zuvörderst liebte ich Master Kendall und dann erst die Bildung. Und Bruder Gregory war zwar unleidlich, aber er erschloss mir die Welt der Gelehrsamkeit und führte mich ins helle Licht der Erkenntnis. Wer hätte ihn dafür wohl nicht bewundert? Was für ein unschuldiger Zeitvertreib, seine Launen, Anfälle und Anwandlungen zu beobachten, so wie man dahinziehende Wolken betrachtet, wenn sie am Himmel immer neue Formen bilden.
Bis auf den heutigen Tag habe ich nicht vergessen, wie seine muskulösen Hände aussahen, wenn sie so eigenartig anmutig den Griffel hielten, wie elegant sie die Lettern in das Wachs zogen, damit ich sie nachziehen konnte, und wie sauertöpfisch seine Miene wurde, wenn sich mein alter Hund unter dem Schreibtisch zu seinen Füßen hinlegte, einschlief und laut vor sich hin schnarchte, gerade wenn er mir erklären wollte, was Aristoteles über Ästhetik gesagt hat. Oder seine ständige Zankerei mit dem Vogel der Köchin, der ihn rau ankreischte, wenn er unangemeldet die Küche betrat. Und wenn Master Kendall ihm liebenswürdig und gut gelaunt Essen und ein neues Gewand anbot, dann scharte sich der gesamte Haushalt um die beiden und hatte seinen Spaß an den widerstreitenden Empfindungen auf dem Gesicht des Lehrers, der nun entscheiden musste, ob er solch ein Angebot von einem Mann annehmen konnte, der sein Geld als Kaufmann verdiente. Bruder Gregory war meines Wissens der einzige Mensch, der seinen Lohn entgegennahm, als würde er einem damit einen Gefallen tun.
So war ich natürlich zutiefst erstaunt – und dankbar –, als er am Tag nach dem Begräbnis mit dem Schwert in der Hand auftauchte und mich vor meinen mordlüsternen, erwachsenen Stiefsöhnen errettete. Doch danach wurde alles gallenbitter. Er war für die Ehe nicht geschaffen und ich nicht für eine neue Ehe.
Ohne mich auch nur anzusehen, legte er das härene Hemd neben mich auf das Bett und suchte in dem Bündel, das er sich von der Truhe geholt hatte, nach seiner Peitsche. Je öfter ich diesen grässlichen, kleinen Stock mit den scharfen Lederriemen sah, desto mehr verabscheute ich ihn. Kann sein, ich bin von schlichter Gemütsart, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Selbstkasteiungen Gott wohlgefällig sein sollen. Und jeden Abend das Gleiche. Dachte er, selbst ein höfliches ›Gute Nacht‹ wäre für mich noch zu schade? War ich zu unansehnlich, zu niedrig geboren, um einen Blick oder ein nettes Wort zu verdienen, jetzt, wo wir verheiratet waren?
Beim Anblick von Gregory, der sich wieder einmal für seine Andachtsübungen bereit machte, wurde ich immer wütender – so wütend, dass mir die Hitze ins Gesicht schoss und mein Herz immer heftiger hämmerte. War ich so alt, so hässlich, dass ich solches verdiente? Er hatte sich mit dem Gesicht zur Wand gestellt und kniete sich jetzt stumm vor das Kruzifix, das neben dem Bett hing. Ich sah mein Hemd an, das mir fast bis auf die bloßen Füße reichte. Es hatte einen hübschen, gestickten Saum. Nicht das Gewand einer Schlampe, dachte ich, und darunter steckt auch kein altes Weib. Ich nahm eine der langen, hellbraunen Locken in die Hand, die mir in Wellen bis zur Mitte herabfielen. Was ist daran nicht in Ordnung? Sie sind noch hübsch, auch wenn sie nicht blond sind. Ich legte den Kamm hin. Er hielt inne, und als ihm das Blut den Rücken hinunterrann, hörte ich ihn sagen: »Gelobt sei Gott –« Gott, ha! Sagt Gott nicht, dass Männer, die heiraten, ihren Frauen gegenüber Pflichten haben? Was stimmte nicht mit mir, dass er sich benahm, als wäre ich unsichtbar?
Ich wurde noch wütender. Da hatte ich zwei Kinder geboren, kräftige, lebensfähige Kinder, und nur ein einziger kleiner Schwangerschaftsstreifen war zu sehen. Manch einer würde sich glücklich schätzen, wenn er mich zur Frau hätte. Und Geld hatte ich auch mit in die Ehe gebracht, damit konnte er ganz nach seinen Neigungen leben – es sogar seiner eingebildeten, habgierigen Familie in den Rachen werfen. Und kein einziges freundliches Wort, obwohl ich hier ganz allein unter Fremden war. Was Gott wohl dazu sagte?
Die Wut stieg in mir hoch und blieb mir wie ein Kloß in der Kehle stecken. Ich war so überaus wütend, dass ich nicht mehr denken konnte. Meine Augen stachen. Auf einmal ging es einfach mit mir durch. Ich schnappte mir das härene Hemd vom Bett, und ehe er überhaupt begriff, was ich getan hatte, war ich schon aufgesprungen, hatte ihm die Peitsche entrissen und war wie eine Irre zur Tür gerannt. Ich flog so schnell die Treppe hinunter, dass ich nicht einmal die Steine unter den Füßen spürte. Ich hörte nicht auf seinen Wutschrei, als er mich verfolgte, noch auf das trunkene Beifallsgebrüll der Männer unten. Ich rannte mit nichts als dem Hemd bekleidet zum Feuer. Bebend vor Zorn und mit rotem, erhitztem Gesicht warf ich sein härenes Hemd und die Peitsche in die Flammen, ergriff den Schürhaken und schob sie an die heißeste Stelle, wo sie fröhlich aufflammten. Einhelliges, brüllendes Gelächter, als den Zechern aufging, was ich da verbrannte.
Dann fühlte ich, wie eine schwere Hand mich umdrehte – mit der anderen hielt er seine Unterhose fest, deren nicht zugeknöpfte Klappe hinter ihm herflatterte.
»Was hast du GETAN, du schamlose, feile – Metze!«, brüllte er mich an.
»Ich habe sie verbrannt, und das geschieht Euch ganz recht!«, brüllte ich zurück und vergaß das Feuer, das gefährlich nahe an meinem aufgelösten Haar tanzte.
»Bei Gott, was für eine Frau!«, hörte ich seinen Vater ausrufen. Gilbert wandte den Kopf, und da sah er, wie sich der alte Mann über den Tisch gebeugt hatte und ihn mit der Faust bearbeitete, während ihm die Lachtränen über das erhitzte Gesicht liefen.
»Wenn Ihr sie nicht wollt, ich nehme sie jederzeit!«, rief eine betrunkene Stimme.
Wütend wandte sich Gregory wieder mir zu, und zu meinem Glück hatte er nur eine Hand frei, sonst hätte er mich wohl erwürgt.
»Da siehst du, was du angerichtet hast! Blamiert hast du mich. Du hast mich vor aller Augen blamiert.« Es galt mir gleichviel, ob ich starb. Sollte er mich doch ins Feuer stoßen.
»Na los, bringt mich doch um! Ich habe Euch satt, so satt!«, kreischte ich.
Gregorys Vater hielt sich jetzt nicht mehr die Seiten, sondern stand neben ihm. Schweigend zog er die Hundepeitsche aus dem Gürtel und reichte sie seinem Sohn. »Höchste Zeit, dass du sie gefügig machst«, sagte er ruhig.
»Wehe, Ihr schlagt mich, wehe, Ihr fasst mich an!«, schrie ich und blickte ganz außer mir in die Runde der grinsenden, roten Gesichter, die sich an der Szene ergötzten. Gregory sah sie auch. Lieber Gott, das nimmt kein gutes Ende, dachte ich. Man kann ihm nichts Schlimmeres antun, als ihn zu blamieren.
Gregory ließ meine Schulter los und griff wortlos nach der Peitsche. Er blickte seine andere Hand an, und dann sagte er mit der ganzen Würde, die er unter diesen Umständen aufbieten konnte, zu seinem Vater: »Aber nicht hier unten, vor allen Leuten. Lasst mich nur machen, sie kommt mit nach oben, und da besorge ich es ihr richtig.«
»Natürlich«, sagte sein Vater.
»Wenn Ihr mich anrührt, stürze ich mich aus dem Fenster«, fauchte ich ihn an. Wie ich sie allesamt hasste, diese herzlosen, widerwärtigen Männer.
»Margaret«, sagte er mit harter Stimme, »du bist zu weit gegangen, es wird Zeit, dass du dafür zahlst. Nach oben mit dir, es gibt hier unten nämlich genug Männer, die mir liebend gern helfen würden.« Alles schwieg, und die, welche sich noch auf den Beinen halten konnten, hatten sich um uns geschart. Es gab kein Entrinnen.
Als er hinter mir die Treppe hochging, hörte ich jemanden hicksen: »Genau wie ich immer sage, Frauen brauchen eine anständige Tracht Prügel.« Meine Augen brannten. Kaum war ich oben angelangt, da drehte ich mich um. Seine Miene war grimmig.
»Bringt mich um Gottes willen nicht um. Denkt an meine kleinen Kinder. Bitte.« Doch seine Miene veränderte sich nicht. Mit einer einzigen schroffen Bewegung warf er mich aufs Bett. Mit einem Ruck zog er den Bettvorhang hinter sich zu, kletterte zu mir hinein, und ich schrie und barg das Gesicht schützend in den Händen, als ich sah, wie er die Peitsche hoch über meinem Kopf hob. Ein fürchterliches ›Klatsch‹, doch ich spürte keinen Hieb. Hatte ich vor Angst den Verstand verloren? Ich lugte durch die Finger und machte große Augen. Er hatte nicht getroffen; er hatte das Kissen geschlagen.
»Margaret, schrei um Himmels willen weiter, sonst kommen sie hoch und machen Ernst«, zischte er. Ich zitterte am ganzen Leibe.
»Dann – dann wollt Ihr – mich nicht ...?«
»Hast du wirklich so gering von mir gedacht? Weißt du denn nicht, dass ich dir nie ein Leides tun könnte? Willst du mir mit diesem angsterfüllten Blick das Herz brechen?« Er biss sich auf die Lippen, dann hob er wieder die Peitsche. »Die da unten hasse ich, ich hasse sie!«, und damit schlug er auf das Kissen ein.
»O Gott, brecht mir nicht die Knochen!«, kreischte ich, denn langsam erwärmte ich mich für meine Rolle.
»Weib, ich breche dir alle Knochen im Leib; das ist mein gutes Recht!«, donnerte er. »Wehe, du gehorchst von jetzt an nicht!« Wir hörten, wie man ihn von unten anfeuerte. Ich schrie furchtbar. Irgendwie tat das gut – warum, weiß ich auch nicht. Dann schrie auch er. Noch ein paar Hiebe, und das Kissen platzte. Eine Federwolke stob auf, und ich musste husten. Es hörte sich genauso an wie Schluchzen. Von unten kamen weitere Anfeuerungsrufe und ein immer lauteres Gejammer aus dem Bett der Kinder.
»Einen Augenblick«, sagte ich und schlüpfte durch die Vorhänge, denn ich musste die Kinder beruhigen. »Mama geht es gut«, sagte ich. »Ihr habt einen bösen Traum gehabt.«
»Ziemlich lauter Traum«, sagte Cecily und setzte sich auf.
»Träume mag ich nicht. Dürfen wir in dein Bett, Mama?«, fragte Alison, die nur halb wach war.
»Nein, das geht nicht. Wir spielen ein Spiel. Den Krach machen doch wir, und ihr seid jetzt mucksmäuschenstill und schlaft wieder ein, und – morgen dürft ihr auf dem Esel reiten.« Ich deckte sie wieder zu.
»Den ganzen Tag?«, flüsterte Cecily.
»Den ganzen Tag, aber nur, wenn ihr sofort wieder einschlaft, und nicht mogeln.« Sie gaben sich alle Mühe, so zu tun, doch wie das bei Kindern so geht, wurde aus der Verstellung schon bald Wirklichkeit. Und schon atmeten sie sanft, hielten sich umschlungen und schliefen tief und fest.
Ich drehte mich um, und da saß ein missmutiger Gilbert auf dem Bett, und die Hundepeitsche baumelte in seiner Hand. Durchs Fenster schien der Vollmond und sandte einen Lichtstrahl zu der Stelle hin, wo er saß. Sein Haar und Bart waren voller Federn. Ich setzte mich neben ihn.
»Ihr seid ganz voller Federn«, flüsterte ich.
»Du auch«, gab er flüsternd zurück. Unten sangen sie schon wieder. Etwas über einen alten Mann, der seine keifende Frau mit Schlägen durch die ganze Stadt trieb.
»Sehe ich so albern aus wie Ihr?«, fragte ich.
»Noch alberner«, sagte er und blies eine Feder fort, die gerade auf meiner Nase landen wollte. Ich zog die Füße hoch und er den Vorhang zu.
»Es war grässlich«, sagte er. »Ich habe gedacht, du magst mich nicht mehr – du bist so bissig gewesen.«
»Und ich habe gedacht, Ihr möchtet mich nicht mehr«, sagte ich. »Kein einziges freundliches Wort – kein einziger Blick. Ihr habt mich nicht einmal mehr über Aristoteles belehrt wie in früheren Zeiten.«
»Alles Vaters Schuld«, seufzte Gilbert. »Er macht mich wahnsinnig. Und jetzt stecke ich seinetwegen bis zu den Ohren in Rechtsstreitigkeiten wegen deines Landbesitzes – deine Ländereien sind nämlich in einem heillosen Wirrwarr, und es gibt mindestens ein halbes Dutzend Anwärter, die kein Recht darauf haben – ich habe keinen einzigen Augenblick mehr für mich allein.«
»Früher, wenn Ihr davon erzählt habt, konnte ich das mit Eurem Vater einfach nicht begreifen«, flüsterte ich ins Dunkel. »Aber jetzt weiß ich, dass Worte zu armselig sind, ihn zu beschreiben.«
»Ach, wie wahr.« Er seufzte wieder. »Der Grund ist, ich sollte immer genau wie Hugo sein. Bewunderst du Hugo auch? So wie die meisten Frauen?«
»Nein, ich finde ihn grässlich. Am Kopf kommt er mir vor wie ein gerupftes Huhn, und der Schlaueste ist er auch nicht gerade.«