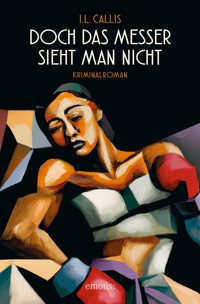6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wien, das Jahr der Europawahlen. Rechtspopulistische Organisationen aus Österreich und Frankreich verbünden sich, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Ein Attentat auf eine weltweit bekannte Persönlichkeit ist nur der Anfang ihrer perfiden Strategie. Der Berliner Anwalt Viktor Hellberg reist mit seiner sechzehnjährigen Tochter Marie nach Wien, wo seine Mutter, eine ehemalige Presse- und Kriegsfotografin, überraschend gestorben ist. Kurz nach ihrer Ankunft wird Marie Opfer von skrupellosen Entführern. Um ihr Leben zu retten, soll Hellberg ihnen Dokumente aus dem Nachlass seiner Mutter aushändigen. Doch er hat keine Ahnung, warum seine Mutter in Wien war und welche Dokumente er unbedingt finden muss. Es beginnt ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit. Im Strudel der Ereignisse wird Viktor Hellberg klar: Nicht nur das Leben seiner Tochter steht auf dem Spiel. Ein packender Thriller und eine erschreckend aktuelle Warnung vor den Gefahren, die die Demokratie in Europa bedrohen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
I. L. Callis
Die Stunde der Wölfe
Thriller
Für meinen Vater Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire. Jean Jaurès
In the nightmare of the darkAll the dogs of Europe bark,And the living nations wait, Each sequestered in its hate.Intellectual disgraceStares from every human face,And the seas of pity lieLocked and frozen in each eye. W. H. Auden, »In Memory of W. B. Yeats«
Mögest du in interessanten Zeiten leben!Chinesischer Fluch
And if all others accepted the lie which the Party imposed –if all records told the same tale –then the lie passed into history and became truth.George Orwell, »1984«
Prolog
Angola, 1975
Das Feuer begann sich zu regen, es zuckte und züngelte. Wie Irrlichter schwebten kleine Flammen über dem Kohlenbett. Funken wirbelten empor und hingen sekundenlang als glühender Schleier in der Luft, ehe sie vergingen.
Ein Soldat hockte vor der Glut, die in einem Ring aus Steinen auf dem festgestampften Lehmboden der Hütte schwelte, und wedelte mit einem Fächer über die glühenden Kohlen, um die Hitze weiter zu entfachen. Der Rücken seines Uniformhemdes hatte dunkle Flecke.
Rote Lichter huschten über die Gesichter der drei Offiziere und der jungen Frau im Tropenhemd, die hinter ihm standen und sein Tun beobachteten. Einer der Uniformierten, kleiner und zarter als die anderen Männer, rauchte. Immer wenn er einen tiefen Zug nahm, leuchtete die Spitze seiner Zigarette auf und zeigte sein von scharfen Falten gezeichnetes Gesicht, das, dreieckig und mit ausdruckslosen Augen und Strichmund, unangenehm an ein Reptil erinnerte. Eine feine Narbe schlängelte sich über seine Kehle und verschwand hinter seinem linken Ohr.
Gedankenverloren zupfte sich der zweite Offizier am Ohrläppchen. Der Feuerschein färbte seinen glatt rasierten Schädel rot, tanzte auf dem Metall seiner Kalaschnikow und spiegelte sich in den Brillengläsern des dritten Militärs, der, die Hände auf dem Rücken, ein wenig abseitsstand. Die Frau hielt sich die Hand vor den Mund, während sie immer wieder gegen einen würgenden Husten ankämpfte. Rauch und der Geruch nach Schweiß und Angst erfüllten die Hütte.
Die Bewegungen des Soldaten wurden schneller, der Rhythmus des Fächers steigerte sich zu einem wirbelnden Tanz. Das Feuer loderte und beleuchtete die beiden nackten Männer, die, die dunkle Haut mit Blut und Staub verkrustet und die Gesichter verschwollen, mit auf dem Rücken gefesselten Händen in einer Ecke knieten.
Endlich hob der Soldat am Feuer den Kopf, wandte sich um und schaute die anderen Uniformierten fragend an. Der Raucher nahm noch einen letzten Zug, dann trat er vor und warf seine Zigarette auf die knisternde Glut. Er öffnete eine Schnalle neben dem Pistolenholster an seinem Gürtel, löste mit wenigen Griffen das Bajonett aus der Halterung und klappte es auf. Dann beugte er sich vor und reichte es seinem Untergebenen.
Vorsichtig, um sich nicht zu verletzen, nahm der Soldat die Stichwaffe entgegen, pflanzte sie auf einen rauchgeschwärzten Holzstock und stieß die Klinge zwischen die glühenden Kohlestücke, wobei die Sicherheit seiner Handbewegungen seine Routine erahnen ließ. Die beiden Gefangenen in der Ecke verfolgten jede Tätigkeit mit weit aufgerissenen Augen.
Der Offizier fuhr mit dem Zeigefinger gedankenverloren die Narbe an seinem Hals entlang, dann zog er eine zerdrückte Packung Gitanes aus der Tasche. Während er eine Zigarette halb aus der Schachtel klopfte und sie der Frau anbot, streifte sein Blick flüchtig die gefesselten Männer.
»Zigarette?«, fragte er freundlich.
Die Frau im Tropenhemd schüttelte den Kopf. Ihr Gesicht war blass, ihre braunen Locken klebten feucht an ihren Schläfen. Sie atmete schwer. Schwarze Flecke breiteten sich auf dem Stoff unter ihren Achseln aus.
»Nehmen Sie nur, das dauert immer.« Die Stimme des Offiziers klang leise, sanft, verständnisvoll. Es war unangenehm, aber nicht zu ändern.
»Nein, danke.« Die Frau schaute zum Eingang hinüber. Von draußen war Pferdegetrappel und Kriegsgeschrei zu hören. Reitermilizen. Schüsse peitschten durch die Luft, und die Frau begriff, dass sie die Hütte nicht verlassen konnte, ohne ihr Leben zu riskieren.
Der Offizier hatte sie nicht aus den Augen gelassen. Sein Finger fuhr über die Narbe, sein Blick glitt von ihrem angespannten Gesicht nach unten, blieb an ihrer Brust hängen, wanderte weiter. Sie bemerkte seine Aufmerksamkeit, trat einen Schritt zurück in Richtung Tür. Seine Mundwinkel zuckten, als hätte er ihre Fluchtgedanken gelesen und als wüsste er zugleich, dass es für sie kein Entrinnen gab. Nachdenklich knetete er die Zigarettenpackung zwischen Daumen und Zeigefinger, sodass das Zellophan wie das Feuer knisterte. Auf einmal wandte er sich abrupt von der Frau ab und dem Glatzkopf zu.
»Merde alors, Bébert«, zischte er. »Setz deinen verfaulten Kadaver in Bewegung. Wir ersticken hier noch.«
»Sofort, mon capitaine.« Der Mann hastete zum Eingang und stieß die Tür auf. Draußen herrschte gleißendes Tageslicht, aber die Sonne drang kaum in die Hütte vor. Die Pferdehufe hatten den Staub aufgewirbelt und nur der Wüstenwind fegte Lehmkrümel herein. In der Ferne verklang das Donnern von Hufen und Kriegsgeheul.
»So.« Der Soldat nahm den Holzstock aus dem Feuer und schwang ihn durch die Luft, sodass die weiß glühende Bajonettspitze einen Kometenschweif durch die Nacht in der Hütte zog. »Fertig.«
Der Offizier mit der Brille drehte sich um, ging an der Frau vorbei zur Tür und blieb mit dem Rücken zu den anderen stehen. Die Spitzen seiner Schnürstiefel berührten fast die Schwelle. Er verschränkte die Finger im Kreuz, legte den Kopf in den Nacken und starrte in die sich langsam auflösenden Staubwolken hinaus.
Der Blick des Soldaten wanderte zu dem jüngeren der beiden Gefangenen, der verzweifelt den Kopf schüttelte.
»Nein! Nicht ich … pas moi … ich weiß nichts! Gar nichts!« Er wand sich in seinen Fesseln. »Rien, rien!«
Der andere Gefangene wirkte jetzt ganz in sich gekehrt. Er schien weder seinen Schicksalsgenossen noch seine Peiniger wahrzunehmen. Nur das Zucken eines Muskels auf seiner Wange verriet seine innere Anspannung.
Der Soldat stand auf, trat vor und tippte mit der Bajonettspitze auf die Schulter des Jüngeren. Es zischte. Der Gefangene kreischte los, und Rauch stieg von seiner Schulter auf. Der Folterknecht hob die Lanze, stieß die Klinge zwischen die Rippen und zog sie blitzschnell wieder heraus. Der Mann riss die Augen auf, schnappte nach Atem und fing an zu schreien. Nun war die Luft erfüllt von Rauch und dem Gestank nach verbranntem Fleisch.
Die Frau gab ein würgendes Geräusch von sich.
»Aufhören, auf…« Die Stimme des Gemarterten überschlug sich. »Nein!«
Der Soldat holte aus und stach wieder zu. Diesmal traf er die Mitte seines Opfers, und der Unglückliche schrie und schrie und schrie. Sein Folterer wartete ein paar Augenblicke, ehe er die Waffe aus dem Fleisch zog. Nun war die Klinge nicht mehr weiß, sondern orange. Der Gefangene riss den Kopf in den Nacken, das Weiß seiner Augäpfel leuchtete im Feuerschein auf, dann sackte er zusammen und fiel auf die Seite. Schaum stand vor seinem Mund und wilde Zuckungen liefen durch seinen Körper. Aber er schrie nicht mehr, sondern stöhnte nur noch.
Der zweite Gefangene hatte die Augen geschlossen, bewegte die Lippen wie im Gebet, wiegte sich vor und zurück. Er schenkte den Anwesenden keine Beachtung, zeigte nicht die leiseste Regung von Angst vor dem Kommenden.
Der Folterknecht unterzog sein Instrument, dessen erkaltende Klinge sich langsam dunkelrot färbte, einer kritischen Musterung. »Hm …«
»Na los, worauf wartest du?« Die Stimme des schmächtigen Offiziers klang ungehalten. »Glaubst du, ich hab den ganzen Tag Zeit?«
Wieder fasste er die Frau ins Auge, diesmal schärfer.
Sie wirkte wie versteinert. Nur die Hand, mit der sie ihre Kehle umfasste, zitterte.
Ein schmales Lächeln erschien auf seinem Gesicht.
Der Soldat holte mit der Lanze aus und stieß sie dem Sterbenden am Boden in die Brust. Ein Röcheln des Mannes war die einzige Antwort, doch die unkontrollierten Muskelkontraktionen hörten auf. Dafür wurde das Murmeln seines Schicksalsgefährten lauter, der sich mit noch immer geschlossenen Augen schneller im Rhythmus seiner Worte bewegte und ganz in sein Gebet versunken wirkte.
Die Frau zerrte am Kragen ihres Tropenhemdes. »Er … er hat nichts verraten«, flüsterte sie und schien um Fassung zu ringen. »Warum haben Sie ihn …?« Ihre Stimme brach.
Der Offizier lächelte, nickte. »Der Erste war nur Anschauungsmaterial«, sagte er so sachlich, als erklärte er ihr eine einfache Regel des Kriegshandwerks. »C’est pour encourager l’autre.« Sein Ton war so freundlich, ja geradezu vertraulich wie unter Landsleuten üblich, denn sie waren beide Franzosen. Wieder musterte er die Frau, während er mit dem Finger erneut die schlangenförmige Narbe an seiner Kehle entlangstrich. Er wirkte etwas abgelenkt, schien nachzudenken oder etwas abzuwägen.
Der Soldat schob das Bajonett zwischen die rot glühenden Kohlen, sodass es zischte und stinkender Rauch aufstieg.
»Für unsere Zielperson«, fügte der Offizier hinzu, und es klang, als wäre nicht klar, wer jetzt die Zielperson war.
Die Frau ballte die Fäuste, ihre Füße in den Springerstiefeln suchten festen Stand, und in ihrem Gesicht malten sich widersprüchliche Gefühle. Ihr Instinkt schien sie zur Flucht zu drängen, denn seit ein paar Minuten waren die Schüsse vor der Hütte verklungen, doch sie rührte sich nicht von der Stelle. War es ihr Berufsethos, das sie zum Bleiben zwang – oder war es die Faszination des Grauens, die zu ihrer Arbeit gehörte so wie das Adrenalin in ihren Adern und das Ausblenden von Gefahr?
Der Offizier beobachtete ihr Mienenspiel, und ein schmales Lächeln erschien auf seinem Gesicht, als hätte er ihre Gefühle erkannt, ja vorausgesehen. Dann drehte er sich abrupt um und herrschte seinen Untergebenen an: »Wird das heute noch was, con?«
Der Glatzkopf, obwohl nicht angesprochen, holte hastig ein Notizbuch und einen Bleistiftstummel aus der Tasche seiner Uniformjacke. »Also ich, ich bin bereit«, sagte er.
Der Soldat zog die Klinge aus der Glut, umfasste den Stock mit festem Griff und wandte sich dem noch lebenden Gefangenen zu. Der hatte aufgehört zu beten und blickte seinem Peiniger jetzt kalt entgegen. Das Weiß seiner dunklen Augen leuchtete im Feuerschein rot. Er zog die Mundwinkel nach unten und spuckte seinen Folterern vor die Füße.
Nun drehte sich die Frau doch um und ging mit schnellen Schritten zur Tür, wo noch immer der Offizier mit der Brille stand. Er wandte sich ihr zu, streifte ihr Gesicht mit einem mitleidigen Blick, überließ ihr seinen Platz und kehrte in die Hütte zurück.
Die Frau verharrte vor der Tür, stützte die Hände in Schulterhöhe auf den Rahmen und starrte vor sich hin. Für kurze Zeit stand sie wie eine Gekreuzigte da, bevor sie über die Schwelle in den Sonnenschein hinausstolperte.
Der Wüstenwind blies ihr seinen heißen Atem ins Gesicht und Sandkörner trieben ihr Tränen in die Augen. Die Luft flirrte und das flache Buschland dehnte sich unter einer weißen Staubschicht. Neben der mit Steinen markierten Straße lag das Gerippe einer Kuh. Weit in der Ferne verschwammen die Umrisse rauchender Hüttenreste mit dem Horizont, als wollte sich die Erde mit dem Himmel vereinigen.
Markerschütternde Schreie erfüllten die Luft.
Auf der anderen Straßenseite parkte ein sandfarbener Pick-up, in dessen Kabine die Kameratasche der Frau und ihr schwarzes Moleskine-Notizbuch lagen. Von der Ladefläche hing eine dreckverkrustete Plastikplane herab und flatterte im Wind. Die Frau wankte auf den Wagen zu und legte die Hände auf die staubige Seitenwand. Dann kniff sie die Augen zusammen und ließ den Kopf zwischen die Arme sinken.
Aus der Hütte drang animalisches Gebrüll.
Die Frau im Tropenhemd erbrach sich.
Plötzlich verstummten die Schreie, und für ein paar Minuten herrschte Ruhe, ehe die unbeteiligte Stimme des Offiziers zu hören war. Er schien keine Befehle mehr zu geben, sondern nur noch ein paar abschließende Anweisungen. Dann schlug die Tür der Hütte zu.
Die Frau hob den Kopf, lauschte.
Feste Schritte näherten sich.
Sie spürte, wie ihr der Schweiß ausbrach. Der Wahnsinn der vergangenen Wochen war zu viel gewesen.
Jemand blieb dicht hinter ihr stehen, und der Geruch nach kaltem Zigarettenrauch stieg ihr in die Nase. Die Schweißperlen zwischen ihren Schulterblättern schienen zu Eissplittern zu gefrieren. Ihr Blick irrte verzweifelt über die flirrende Landschaft, suchte nach einem Ausweg, doch die Schreie und die Qual der letzten Stunde füllten ihren Kopf, verhinderten jeden klaren Gedanken. Sie fühlte den fordernden Druck seines Körpers an ihrem Rücken, seine kühle Wange an ihrem Hals, hörte seine geflüsterten Worte, deren Sinn zu erfassen ihr nicht gelang.
Der Mann war kaum größer als sie.
Aber sie konnte sich nicht wehren, konnte nicht fliehen, die Angst lähmte ihre Glieder. Als sie spürte, wie seine Finger um ihre Taille krochen und nach der Gürtelschnalle griffen, fing sie an zu weinen und senkte den Kopf.
1
Cayetano José Maria Rossi war kein Mörder.
Er war jetzt siebenunddreißig Jahre alt und hatte in zweiundzwanzig Arbeitsjahren dreihundertsechsundfünfzig Menschen getötet. Ihre Namen, die Umstände ihres Sterbens und die Summe, die er für ihre Beseitigung erhalten hatte, waren gewissenhaft in einem Kalender, seiner Buchhaltung des Todes, notiert. So wie der Name des Mannes, der als Nächster auf seiner Liste stand. Ein Südamerikaner mit italienischen Wurzeln wie er selbst. Auch das Datum und der Tatort und vor allem der Name seines Auftraggebers waren hier vermerkt.
Cayetano tötete nie aus Hass oder aus eigenem Antrieb oder um sich an seinem Opfer zu bereichern. Er brauchte nicht zu wissen, ob der Mann, den er töten sollte, ein guter oder schlechter Mensch war, ob er einen Nachbarn ärgerte oder einen Säugling vergewaltigt hatte. Ein moralisches Urteil stand ihm nicht zu. Gott allein war der Richter. Für Cayetano zählte nur, dass er im Voraus bezahlt wurde und seine Arbeit erledigte.
Cayetano war ein Pistoleiro.
Natürlich wusste er, dass Töten Sünde war.
Aber Gott verzieh alles. Das wurde der Priester in der Kirche, in die er regelmäßig ging, nie müde zu betonen. Und so wandte sich Cayetano an Gott, wie er sich früher bei kindlichen Vergehen an seinen Vater gewandt hatte, und bat den Allmächtigen, jedes Mal bevor er abdrückte, um Vergebung.
Nie vergaß er nach der Tat die Sühne.
Zehn Ave-Maria und zwanzig Vaterunser erlösten von allen Sünden, das wusste jeder. Nur manchmal musste er dieses Ritual mehrmals ausführen, ehe er sich reingewaschen fühlte und seine Nachtruhe nicht mehr gestört wurde.
Cayetano beherzigte den Ehrenkodex der Pistoleiros.
Töte keine Schwangere.
Töte keinen anderen Pistoleiro.
Töte nicht auf Kommission.
Töte niemanden im Schlaf.
Raube das Opfer nicht aus.
Noch nie hatte er jemanden verraten, und obwohl er schon Zeuge von furchtbaren Folterungen geworden war, wusste er, dass er eher sterben würde, als einen Verrat zu begehen. Verräter hatten nach dem ehernen Gesetz der Pistoleiros ihr Leben verwirkt. Wer je die Leiche eines Verräters gesehen hatte, hütete von da ab ohnehin seine Zunge.
Schon sein Vater war ein Pistoleiro gewesen und hatte das Militär im gerechten Kampf gegen die kommunistischen Guerilleros unterstützt. Wenn er in sein Heimatdorf mitten im Amazonaswald kam, trug er eine Polizeiuniform und brachte Lebensmittel für alle und Coca-Cola für Cayetano und seine kleine Schwester Lucía mit.
Pistoleiro war ein krisensicherer Beruf.
Mit fünfzehn Jahren hatte Cayetano seinen ersten Menschen getötet. Es sei ein wenig wie bei der Jagd, hatte sein Vater gesagt, und dass Cayetano ein guter Schütze sei und einfach auf das Herz zielen solle. Der Mann, der sterben solle, habe den Tod mehr als verdient.
Einen Menschen zu töten war dann aber doch noch mal was anderes gewesen, als ein Faultier oder einen Hirsch zu erlegen. Cayetano hatte gezielt, Gott um Vergebung gebeten und abgedrückt. Der Mann war sofort tot gewesen. Cayetano hatte die Leiche zur Abschreckung liegen lassen, so wie sein Vater es ihm befohlen hatte, und war durch den Urwald nach Hause gerannt. Sein Herz hatte bis zum Zerspringen geklopft und er hatte die ganze Strecke über geweint. Tief in seinem Innersten wusste Cayetano, dass sein Vater diesen Tod nicht von ihm hätte verlangen dürfen.
Der Vater hatte in der Hütte seelenruhig Reis und gebratenes Fleisch gegessen und so getan, als bemerkte er das tränenverschwollene Gesicht seines Sohnes nicht.
Und, Cayetano, hast du getan, was ich dir gesagt habe?
Ja, Vater, alles, was du gesagt hast.
Sehr schön, ab morgen kommst du mit mir in die Stadt.
Bevor er sich an diesem Abend zum Schlafen in seine Hängematte legte, hatte Cayetano sein Ritual mit den Gebeten unzählige Male wiederholen müssen. Die Worte »Und vergib uns unsere Schuld« hatte er mit besonderer Inbrunst gesprochen.
Sein Vater hatte Wort gehalten und ihn mitgenommen.
Eine Weile hatte Cayetano niemanden töten müssen, nur bei Verhören helfen und die Gefangenen festhalten, was er besonders hasste. Er ertrug ihre Bitten und Schreie nicht, und am Ende starben die Gefolterten meist ohnehin. Bei einem dieser Verhöre lernte er El Capitán und seine Methoden kennen. Obwohl man Cayetano gesagt hatte, dass die Guerilla nichts anderes vorhatte, als Brasilien zu zerstören, hatte er sich danach übergeben müssen. Und einmal flogen sie mit einem Hubschrauber über den Amazonaswald und stießen die kaum noch lebenden Rebellen aus der offenen Heckklappe. Cayetano hatte gehofft, dass unter dem dichten Blätterdach nicht die Hütten seines Heimatdorfes lagen.
Irgendwann starb sein Vater bei einem Auftrag.
Cayetano hatte insgeheim immer seine Kaltblütigkeit bewundert, mit der er ohne Reue und Bedauern seiner Arbeit nachgegangen war. Die Familie hatte von seinem Geld gelebt. Und obwohl Cayetano überzeugt davon war, dass ihn die Schuld an seinem ersten Mord für immer verfolgen würde, übernahm er ab da die Aufträge seines Vaters als Pistoleiro.
Eine Kugel – ein Tod.
Das war sein Motto, und bald war er berühmt.
Cayetano betrachtete sich als ehrlichen Arbeiter.
Seine Frau Angelina sah das anders.
Sie waren zusammen, seit sie Teenager waren, jeder Mann beneidete ihn um ihre Schönheit. Aber Cayetano wusste, dass seine Frau noch einen anderen Vorzug hatte als glänzende Augen und einen verführerischen Körper. Angelina hatte einen scharfen Verstand. Eine kluge Frau war für einen Mann einerseits schmeichelhaft – immerhin hatte sie ihn gewählt –, machte sein Leben aber andererseits nicht einfacher. Denn Angelina litt unter dem Elend seines Berufes.
Ich werde dich verlassen, warte nur.
Der Kerl stirbt sowieso, und wenn ich den Auftrag ablehne, macht ihn ein anderer.
Du denkst nie an deinen Sohn und deine Tochter.
Und das Schulgeld? Du willst doch ein Haus am Meer?
Das beendete die Diskussion jedes Mal.
Sie träumten beide von einem Haus am Meer, wo ihn niemand kannte und er sich zur Ruhe setzen konnte, und von einer guten Ausbildung für ihre Kinder. Dieser Auftrag, sein letzter, würde ihm so viel einbringen, dass ihr Traum Wirklichkeit wurde. Und Cayetano wurde nicht jünger.
El Capitán persönlich hatte ihm die Arbeit angeboten, doch zum ersten Mal in seiner Laufbahn als Pistoleiro hatte Cayetano sich Bedenkzeit erbeten.
Er war Katholik.
Er mischte sich nie in Politik ein.
Und vor allem – er hatte ein schlechtes Gefühl.
Ein guter Pistoleiro brauchte einen Instinkt wie ein Jaguar – ein untrügliches Gespür für die Beute, aber auch für den Jäger, der ihm selbst auf den Fersen war. Dieser Instinkt hatte Cayetano bisher bei seiner gefährlichen Arbeit erfolgreich gemacht. Und ihn am Leben gehalten.
Der Instinkt des Pistoleiros warnte Cayetano.
Am Ende hatte er mit Angelina gesprochen, das tat er immer. Wenn ein Mann seine Frau nicht achtete und nicht für seine Familie zu sterben bereit war, war er kein Mann. Cayetano schätzte Angelinas Rat, was nicht hieß, dass er ihn immer befolgte. Aber er half ihm bei seinen Entscheidungen.
Diesmal hatte er bis weit nach Mitternacht gewartet, als sie beide im Bett lagen und die Kinder schliefen. Bei geschlossenem Fenster hatte er ihr flüsternd von dem neuen Auftrag erzählt. Angelina hatte ihm schweigend zugehört. Lange Zeit war nur das leise Summen des Deckenventilators zu hören gewesen. Als er schon dachte, sie wäre eingeschlafen, hatte sie sich endlich zu seiner Frage geäußert.
Wenn du es nicht machst – wird El Capitán dich töten?
Ich bin doch kein Verräter.
Aber dieser Mann ist einer?
Er verrät uns Christen, sagt El Capitán.
Wenn Gott will, dass dieser Mann stirbt, wird ihn eine Kugel treffen oder er wird an einer Krankheit sterben. Wenn Gott das Leben dieses Mannes nicht will, wird er es nicht nehmen. Du musst tun, was du für richtig hältst.
Angelina hatte nicht über das Geld gesprochen, das ihnen die Ruhe garantieren würde, nach der sie sich beide sehnten. Sie hatte ihm die Verantwortung abgenommen und sie in die Hände des Allmächtigen gelegt.
Cayetanos Erleichterung war so groß gewesen, dass er Angelina mit seiner Umarmung fast erstickt hätte. Und dann hatten sie den besten Sex seit Langem gehabt.
Am nächsten Morgen war er zur Frühmesse gegangen, hatte die Beichte abgelegt und eine Kerze entzündet und Gott im Gebet angefleht, ihm ein Zeichen zu geben, wenn er diesen letzten Auftrag missbilligte.
Gott hatte geschwiegen.
Und deshalb hatte Cayetano den Instinkt des Pistoleiros zum Schweigen gebracht und El Capitán zugesagt.
Bald würde ihn sein Weg aus einer Kleinstadt im Norden von Brasilien zum ersten Mal in die Hauptstadt, über einen Ozean und auf einen fremden Kontinent führen – Europa.
2
Die Linienmaschine der Brussels Airlines ging planmäßig um zwölf Uhr vor der Küste Südfrankreichs in den Landeanflug über. Der Flughafen Marseille-Provence lag außerhalb der Stadt am Étang de Berre. Seine Landebahn reichte in den See hinaus, sodass für die Passagiere die Illusion entstand, über das blaue Mittelmeer hereinzuschweben.
Beim Anblick der in der Mittagssonne glitzernden Wasseroberfläche lehnte Sophie Wellendorff die Stirn an das vibrierende Bullauge und wünschte für einen flüchtigen Augenblick, sorglose Ferientage lägen vor ihr. Sie verreiste gern. Nizza, Cannes, Saint-Tropez waren die magischen Worte, die ihr durch den Kopf gingen. Aber man hatte ihr gesagt, dass das »Mas«, wie die provenzalischen Bauernhäuser genannt wurden, nicht an der Küste war, sondern zwischen Marseille und Aix-en-Provence im hügeligen Hinterland, dort, wo auf jeder Bergkuppe ein mittelalterliches Dorf stand und der Mistral durch die Pinienwälder strich.
Sophie war als Austauschschülerin ein Jahr in Avignon gewesen, sprach neben Englisch und ein wenig Spanisch fließend Französisch. Es war einer der Gründe, warum man sie entsandt hatte. Neben ihr waren keine heimlichen Absprachen möglich. Die anderen Gründe waren ihre gute Ausbildung und ihr analytischer Verstand.
»Wunderbares Wetter, Mademoiselle Wellendorff«, sagte ihr Sitznachbar, ein Franzose Mitte sechzig. Sein Gesicht unter den militärisch kurz geschnittenen eisengrauen Haaren war so braun gebrannt und faltendurchzogen, wie es für Menschen typisch war, die ihr Leben im Süden und im Freien verbrachten. Sein anthrazitfarbener Anzug und eine runde Goldrandbrille gaben ihm das intellektuelle Aussehen eines alternden Bibliothekars. Er war kaum mittelgroß, sein Körperbau athletisch. Doch beim Abflug in Brüssel hatte Sophie bemerkt, dass er das rechte Bein ein wenig nachzog. »Der Frühling ist die schönste Jahreszeit an der Côte.« Er war ein Abgesandter wie sie.
»Und der September«, sagte Sophie. Sie hatte die Morgenmaschine von Wien genommen. Bei der Zwischenlandung in Brüssel war ihr Nachbar wie verabredet zugestiegen. Seit ihrem Abflug vor eineinhalb Stunden unterhielt er sie mit Small Talk. Sie fragte sich, ob das zur Tarnung gehörte. Ein älterer Herr und eine blonde junge Frau in Businesskleidung, beide mit Aktentaschen. Geschäftsleute. »Finde ich.«
»Bien sûr.« Er lächelte. »Natürlich.«
Das Flugzeug landete, und als sich die Türen öffneten, empfing ein heftiger Windstoß, der ein Geruchsgemisch aus Kerosin und Meeresluft mit sich trug, die Ankommenden. Anfang April lagen in Wien noch Schneereste in den Gassen, an der Côte d’Azur herrschte bereits Frühling.
Zwanzig Minuten später verließen Sophie und ihr Begleiter die Ankunftshalle des Flughafens. Der Franzose führte sie direkt zu einem großen schwarzen Geländewagen, der bereits mit laufendem Motor wartete. Er ließ sie auf dem Rücksitz Platz nehmen und setzte sich selbst neben den Fahrer, einen jungen Mann mit verspiegelter Fliegerbrille und Schulterklappen auf dem Uniformhemd.
Sophie bemerkte, dass der Mann sie im Rückspiegel musterte, konnte seine Augen jedoch nicht erkennen. Sie starrte zurück, bis er das Gesicht abwandte und Gas gab.
Zunächst fuhren sie in Richtung Marseille, kamen trotz des Mittagsverkehrs gut voran. Die Fahrer in den anderen Autos rauchten oder telefonierten, alle hatten es eilig, niemand schenkte dem Geländewagen mit den dunklen Scheiben Beachtung. Am Straßenrand wiegten sich hohe Palmen im Wind und rechts von ihnen glitzerte das Mittelmeer. Am blauen Himmel hingen ovale Wolken. Mistral. Sophie wollte am späten Nachmittag zurückfliegen. Hoffentlich verzögerte sich der Abflug nicht wegen des aufkommenden Sturms.
»Wie lange dauert die Fahrt, Monsieur Mercier?«
Der Franzose drehte sich um. »Ab jetzt können wir uns duzen«, sagte er. »Ich bin Henri. Das Mas Boniface liegt in der Nähe von Grand Sud. Eine halbe Stunde etwa.«
Sophie nickte, lehnte sich zurück und schlug die langen Beine übereinander. Sie legte Wert auf einen korrekten Auftritt. Ihr ungeschminktes Gesicht wirkte durch die blaugrauen Augen und die hellblonden Haare etwas blass, aber ihre Größe von fast einem Meter achtzig und ihre androgyne Figur verliehen ihrem Auftritt Autorität. Für diesen Termin hatte sie sich für ein blaues Leinenkostüm, ein weißes Seidentop und flache Schuhe entschieden. Trotz ihrer achtundzwanzig Jahre besetzte sie bereits eine Schlüsselposition innerhalb der Bewegung.
»Sophie«, sagte sie freundlich zu Henri.
Bei Septèmes-les-Vallons wandten sie sich nach Norden. Etwa eine Viertelstunde später tauchten auf einer bewaldeten Hügelkuppe der Kirchturm und die grauen Häuser von Cabriès auf. Jetzt fuhren sie auf schmalen, von wildem Thymian gesäumten Landstraßen weiter.
An jenem Frühlingstag lag das karge Land noch nicht unter der brütenden Sommerhitze, das Licht entbehrte der gleißenden Schärfe und durch die Gassen der alten Bergdörfer flossen keine Touristenströme.
Nur sechs alte Männer, die auf einem Dorfplatz unter Platanen zwei Mannschaften bildeten und Pétanque spielten, hielten inne und beobachteten den Geländewagen, der zügig an ihnen vorüberfuhr und in Richtung Grand Sud verschwand.
»Hast du gesehen, Pierrot?«, rief einer der Männer vom Ende der Bahn. »Jean hat Besuch.«
»Ja, eine blonde Frau«, sagte Pierrot. »Keine Ahnung, wer das war.«
»Etwa eine Holländerin oder Deutsche? Merde alors.«
»Sah aus wie eine Maklerin.« Einer der Männer wog seine Boulekugel in der Hand. »Jean wird seinen Hof doch nicht an die boches verkaufen? Dreckige Ausländer.«
Pierrot holte aus und ließ seine Kugel die Bahn entlangrollen. Sie kam dicht vor der Zielkugel zum Stehen. »Jean ist ein echter Franzose, mon vieux«, sagte er zufrieden. »Der ist so ein Patriot wie wir alle hier.«
Allgemeines Nicken und beifälliges Gemurmel. Das Spiel wurde wieder aufgenommen, das Auto vergessen.
Kurze Zeit später hielt der schwarze Geländewagen vor einem großen Eisentor, das in eine lange, von alten Pinien überragte Natursteinmauer eingelassen war. Nur eine kleine steinerne Tafel verriet, dass hinter dem Tor das Mas Boniface lag. Zwei Videokameras auf hohen Masten überwachten die Einfahrt.
Aus einem Mauervorsprung trat ein junger Mann in grauer Uniform mit rotem Barett hervor. Auch auf seiner Nase saß eine verspiegelte Sonnenbrille, an seinem Gürtel hing gut sichtbar ein Pistolenhalfter. In der Hand hielt er ein großes Funkgerät. Als er an das Auto trat, glitten die Scheiben herab.
Der Uniformierte legte eine Hand auf das Autodach, beugte sich zum Fahrer hinab und spähte ins Innere.
»Parole?«, fragte er. Er war penibel rasiert, hatte ein junges Gesicht, breite Kiefer und ein Grübchen im Kinn. »Top Gun«. Aufmerksam musterte er Sophie im Fond.
Henri beugte sich vor. »Pour Dieu et la patrie.«
Der Wachmann hob das Funkgerät ans Ohr, trat vom Wagen zurück. Es knisterte und rauschte, er sagte schnell ein paar Worte und eine schnarrende Stimme antwortete ihm. Dann glitt das große Eisentor auseinander.
»Passez«, sagte der Wächter, und der Geländewagen fuhr an.
»Warum verlangt der Mann die Parole?«, fragte Sophie.
»Er muss wissen, ob alles in Ordnung ist«, antwortete Henri. »Bei Gefahr hätte ich einen Code verwendet.«
Sophie war beeindruckt. »Und dann?«
Henri lächelte, sah aus dem Fenster und schwieg.
Hinter dem Tor lag ein weitläufiges Grundstück.
Sophie hatte einen mediterranen Garten erwartet, mit blühenden Mandelbäumen und einem Teppich gelber Mimosen. Doch hier bewegten ausladende Pinien ihre Zweige im Wind und warfen blaue Schatten auf den mit Feldsteinen gepflasterten Weg, der sich zwischen Zypressen, halb verblühtem Lavendel und verholzten Rosmarinbüschen schlängelte. Graugrüner Salbei wucherte über Reste von Natursteinmauern. Nirgends gab es Blumenbeete oder grüne Rasenflächen, stattdessen dürre Sträucher und verkümmertes Gras.
Macchia, wohin das Auge blickte, Wüste statt Paradies.
Ein paar Kurven später tauchte das Mas Boniface auf.
Anders als der Name vermuten ließ, war es kein Bauernhaus, sondern eine von Lorbeerhecken umgebene terrakottafarbene Villa mit Türmen und Loggien, eines der prunkvollen Häuser, die reiche Ausländer im 19. Jahrhundert an der Côte d’Azur zur Sommerfrische gebaut hatten. Die türkisfarbenen Fensterläden waren geschlossen. An einem heißen Sommertag ein gewohnter Anblick im Midi, wirkte es um diese Jahreszeit seltsam abweisend. Schlichte, mit Oliven- und Zitronenbäumen bepflanzte Tontöpfe säumten einen Kiesweg, der um das Haus herumführte.
Der Wagen hatte das Ende des Vorplatzes noch nicht erreicht, als sich die Haustür öffnete und ein weiterer Uniformierter heraustrat. Breitbeinig, die Hände auf dem Rücken, postierte er sich auf der obersten Eingangsstufe. Auch er trug ein rotes Barett. Von dort oben behielt er die Ankommenden im Auge. Dann erschien ein Mann um die vierzig, wohl ein Hausangestellter, in grauer Hose und weißem, kurzärmeligem Hemd. Kaum war der Motor verstummt, stand er neben der Hintertür und riss sie auf.
»Willkommen auf Mas Boniface, Mademoiselle«, sagte er auf Englisch, aber mit starkem französischem Akzent. Sein Gesicht war braun gebrannt und von Narben gezeichnet. Er trug keine Waffe, aber in seinem linken Ohr saß ein Knopf. »Ich bin Antoine.«
Sophie stieg aus, streckte sich diskret nach der Fahrt über die engen Bergstraßen. Ein leiser Wind strich über ihre Haut, das Zirpen von Zikaden erfüllte die Luft.
»Monsieur le Marais ist auf der Terrasse«, sagte Antoine. »Ich darf vorangehen?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, führte er Sophie und Henri ums Haus. Einmal deutete er nach links und wies auf ein paar Agaven in Steintrögen, deren steife, sägeartige Blätter auf den Weg ragten.
»Attention, Mademoiselle«, warnte er Sophie.
Dann war außer ihren Schritten wieder nur noch das Zirpen der Zikaden zu hören.
Die Terrasse war einer von Weinlaub überwucherten Veranda vorgelagert. Hohe Zypressen umrahmten eine wie von Cézanne gemalte Aussicht, die weit nach Süden schweifte, über grüne Hügel und in eine dunstige Ferne, in der das Mittelmeer und die Küste Afrikas liegen mussten.
Sophie erkannte Jean le Marais sofort an seinem silbrig glänzenden Haar, der breiten Stirn und dem spitzen Kinn. Er sah genau wie auf dem Foto aus, das man ihr gezeigt hatte.
Marais saß mit dem Rücken zum spektakulären Panorama in einem von mehreren tiefen Sesseln, die sich um einen kleinen Tisch gruppierten, und telefonierte. Mit der freien Hand gestikulierte er, wobei die Zigarette, die er zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger hielt, kleine Rauchwirbel in der klaren Luft hinterließ. Beim Erscheinen seiner Gäste blickte er ihnen entgegen und hob in einer abwehrenden Bewegung den Arm.
Antoine blieb so abrupt stehen, dass Sophie fast auf ihn aufgelaufen wäre. Marais sagte noch ein paar Worte ins Telefon, legte es auf den Tisch und drückte die Zigarette in einem großen Aschenbecher aus, der neben einem Stapel Zeitschriften und einem Notebook stand. Dann erhob er sich, und Sophie bemerkte überrascht, wie klein er war – kaum über einen Meter siebzig. Marais hob das Kinn und sie setzten sich wieder in Bewegung. Sophie hatte den Eindruck, dass ihr eine Audienz gewährt wurde.
»Sophie«, sagte Marais und trat zwei Schritte hinter dem Tisch hervor. Ein weißes Polohemd hing locker über seine verblichenen Jeans. Seine Füße steckten in Espadrilles, die er an den Hacken heruntergetreten hatte, sodass sie wie Pantoffeln aussahen. »Bonjour, ma chère. Ich bin Jean.«
Marais sprach den Gruß »Bongjour« aus. Es war der Dialekt der Region, den Sophie aus Avignon kannte. Auch seine zarte Statur und die schwarzen Augen verrieten den geborenen Provenzalen. Dieser Mann gehörte in den Midi wie die Zypressen, die Zikaden und der Mistral. Auf den ersten Blick wirkte er wie Mitte sechzig, aber man hatte Sophie gut gebrieft. Der schlanke, durchtrainierte Körper täuschte. Jean le Marais ging auf die achtzig zu.
»Bonjour.« Sophie schüttelte seine Hand. »Danke, dass dieser Termin so schnell möglich war.«
»Es ist Zeit, sich zusammenzuschließen«, sagte Marais, »und gemeinsam zu marschieren.«
»Wir werden eine Kooperation prüfen«, sagte Sophie.
Marais musterte sie, als wollte er nicht nur ihre Person, sondern ihre ganze Persönlichkeit erfassen. Er schätzte sie ab. Man hatte Sophie gesagt, er sei ein Ex-Militär. Sicherheitspolitischer Berater. In den letzten Jahrzehnten hatte er für zahlreiche Regierungen rund um den Erdball gearbeitet. Sie hakte seinen inquisitorischen Blick als berufsbedingt ab. Déformation professionnelle. Umgekehrt ließ seine unbewegte Miene keine Rückschlüsse auf ihn zu.
Sophie hatte Politikwissenschaften in Harvard studiert. Jetzt fiel ihr ein Satz ein, den die ehemalige amerikanische Außenministerin Madeleine Albright nach dem Treffen mit einem der mächtigsten Staatschefs der Welt notiert hatte.
Er ist so kalt, dass er an eine Echse erinnert.
»Wie geht es Wien?«, fragte Marais. »Haben Sie Erfolg?«
Niemand von der Bewegung gab Auskünfte über das Headquarter. »Vielleicht sollten wir gleich anfangen?«, fragte Sophie und warf einen demonstrativen Blick auf die teure Herrenarmbanduhr an ihrem Handgelenk, das einzige Schmuckstück, das sie trug. Ihr Vater hatte ihr die Uhr nach ihrer Graduierung geschenkt. Sie war die Erste in der Familie hessischer Weinbauern, die Abitur gemacht hatte, alle waren entsprechend stolz auf sie und ihre Karriere. »Meine Maschine geht in vier Stunden.«
Marais’ schwarze Augen glitzerten, und auf einmal wusste Sophie, dass er ihr eine Falle gestellt hatte. Hätte sie auf seine Frage geantwortet – und sei es auch nur mit einer unverbindlichen Höflichkeitsfloskel –, wäre sie nicht verschwiegen genug und das Treffen damit beendet gewesen.
»Möchten Sie Kaffee? Perrier?«, erkundigte sich Marais. »Oder lieber einen Pastis?« Seine Stimme war keineswegs laut, klang aber befehlsgewohnt.
Sophie wusste, dass er der Führer einer Organisation war, die sich Gladius nannte – nach dem Schwert der römischen Gladiatoren.
»Kaffee ist wunderbar«, sagte Sophie.
»’toine.« Marais machte eine Handbewegung, als wollte er einen Diensthund voranschicken. »Beeil dich.«
»Oui, mon capitaine.« Antoine kehrte auf dem Absatz um und eilte zum Haus.
Marais bot Henri und Sophie die Sessel gegenüber dem seinen an und nahm selbst wieder Platz. Erst als Sophie sich in die tiefen weißen Polster sinken ließ, bemerkte sie, dass sie nun das gleißende Licht des frühen Nachmittags blendete. Auch der immer mehr auffrischende warme Wind war unangenehm.
Marais lächelte. »Bien.« Gut.
Er sagte »bieng«, und Sophie fragte sich, aus welchem Teil der Provence er wohl stammte, aus dem Hinterland oder von der Küste. Sein stolz zur Schau gestellter Reichtum ließ nicht auf eine noble Familie und altes Geld schließen. Aber sein Rücken war zu gerade für Feldarbeit, seine Hände waren zu unversehrt für Fischfang und seine Augen hatten einen wachsamen Ausdruck. Sophie folgerte daraus, dass er einem der Massenquartiere in Nizza oder Marseille entkommen war.
Marais, der entspannt mit dem Rücken zur Sonne saß, zündete sich eine Zigarette an und zog genussvoll daran. Bläulicher Rauch stieg auf und verschleierte seine Miene.
»Unsere Pläne sind Ihnen also bekannt«, sagte er.
»Nicht im Detail«, sagte Sophie.
»Gladius wird ein Attentat durchführen.« Er ließ Sophie nicht aus den Augen, wartete ihre Reaktion ab.
»Davon haben wir gehört«, sagte sie kühl.
Sophie war nach Frankreich entsandt worden, weil Gerüchte um ein unmittelbar bevorstehendes Attentat zu einer befreundeten Vereinigung nach Deutschland und von dort ins Headquarter nach Wien gedrungen waren. Der Zeitpunkt war denkbar ungünstig, die Wahlen zum Europäischen Parlament standen bevor, erhöhte Sensibilität war gefragt. Aber nähere Einzelheiten waren nicht zu erfahren gewesen. Der Informant aus Deutschland war inzwischen nicht mehr erreichbar, wurde vermisst. Sie hatten in einer internen Sitzung lange darüber diskutiert und dann entschieden, Kontakt mit Marais’ Organisation aufzunehmen. Marais hatte einem Treffen sofort zugestimmt, kannte natürlich die Bewegung in Wien.
Nun sollte Sophie die Gerüchte verifizieren, Details erfragen und eine Lageeinschätzung vornehmen. Es galt zu klären, ob man jeden weiteren Kontakt peinlichst vermeiden musste oder ob Marais’ Pläne sogar nützlich sein konnten.
Wieder schien es, als hätte Marais ihre Gedanken gelesen. »Unsere Zielperson ist einer der wichtigsten Männer der Welt«, sagte er, machte eine Pause, ließ seine Worte wirken. »Und einer der populärsten.« Er zog an seiner Zigarette und kniff die Augen gegen den Rauch zusammen.
Jetzt fiel Sophie auf, dass er sonst kaum zwinkerte. Es sah aus, als hätte er keinen Lidschlag, was seinem Blick tatsächlich das Starren einer Echse gab.
»Und wer soll das sein?«, fragte sie.
Marais beugte sich vor und drückte die Zigarette aus. Seine Hand war kaum größer als die eines Halbwüchsigen, jedoch sonnenverbrannt und muskulös. Am Handgelenk trug er einen klobigen stählernen Fliegerchronografen, einen von der Sorte, die bei Anzugträgern immer etwas lächerlich aussah. An ihm wirkte die Uhr authentisch.
»Das werden Sie gleich erfahren«, sagte er, stupfte den Zigarettenstummel länger in die kalte Asche, als es nötig gewesen wäre, um die Glut zu ersticken. Endlich ließ er ihn los, lehnte sich zurück und gab Henri ein Zeichen.
Henri beugte sich vor, drehte den Laptop zu Sophie und klappte ihn auf. »Sehen Sie gut so?«, fragte er fürsorglich, als wollte er ihr einen beliebigen Filmausschnitt zeigen.
In diesem Augenblick tauchte Antoine aus dem Schatten der Veranda auf, brachte ein Tablett mit einem türkisfarbenen Mosaikmuster, auf dem Espressotassen und ein Teller mit Marzipan standen. Er servierte den Kaffee, drückte das Tablett vor die Brust und blickte neugierig auf den noch dunklen Bildschirm des Computers.
»Démerde-toi«, zischte Marais. Verpiss dich.
Antoine fuhr zusammen und verschwand hastig.
Sophie notierte in Gedanken, dass ihr Gastgeber zur Unbeherrschtheit neigte, und vergab einen Minuspunkt. Dann richtete sie ihren Blick auf den Schirm und konzentrierte sich. Gleich würde sie den Mann sehen, über den das Todesurteil verhängt worden war.
Es war ein Video.
Kirchengesang setzte ein, die Kamera fuhr über die im frühen Morgenlicht rosa leuchtenden Dächer von Rom, erfasste die mächtige Kuppel des Petersdoms, senkte sich herab.
Der Vatikan.
Heiligenfiguren, grüne Gärten, Schweizergarde.
Papstaudienz.
Auf dem Petersplatz drängte sich eine fast unüberschaubare Menschenmenge. In einem im Schritttempo fahrenden Cabrio stand der Papst. Es sah aus, als wanderte er zwischen den Köpfen der Gläubigen. Mit einer Hand hielt er sich fest, mit der anderen grüßte er links und rechts. Er nickte, lächelte, die Pellegrina seiner weißen Soutane wehte.
»Mittwochs ist Generalaudienz«, sagte Henri leise.
Sophie gab keine Antwort.
Eine neue Einstellung zeigte den Wagen des Papstes von vorn in einer schmalen Gasse in der Menge. Er wurde von dunkel gekleideten Leibwächtern mit Headsets eskortiert, vor seinem Kühler bewegte sich ein Kameramann rückwärts, hielt Schritt mit dem Auto und filmte. Jemand hob ein Kleinkind hoch. Der Papst nahm es auf den Arm, küsste es, reichte es zurück.
Henri drückte auf die Stopptaste.
Sophie starrte auf das Standbild.
»Alles in Ordnung?«, fragte Henri.
Sophie hob den Blick.
Der Papst.
Marais fixierte sie über den Bildschirm hinweg. Dabei strich er mit dem Zeigefinger über eine dünne Linie, die sich über seine Kehle zog und hinter einem Ohr verschwand. Dann nahm er eine halb leere Packung Gitanes vom Tisch und hielt sie ihr mit der aufgerissenen Seite hin.
»Möchten Sie eine?«, fragte er. »Sie sehen so aus.«
Das Papier knisterte wie der Mistral im vertrockneten Strauchwerk neben dem Sitzplatz. Es klang, als würde das dürre Geäst gleich in Flammen aufgehen.
Der Papst.
»Ich rauche nicht«, sagte Sophie, hörte, dass ihre Stimme rau klang. Ein Gefühl der Unwirklichkeit hatte sie erfasst. Der Vatikan, das religiöse und politische Machtzentrum der katholischen Kirche. »Das ist Irrsinn.«
Der Papst.
Marais reagierte nicht gleich, die Packung schwebte sekundenlang zwischen ihnen, erst dann klopfte er eine neue Zigarette heraus und zündete sie an.
»Ich dachte, in Wien kennt man unser Vorhaben?«, fragte er und runzelte leicht die Stirn.
»Wir wussten nicht, dass es um die Person des Papstes geht«, sagte Sophie, die sich wieder gefasst hatte, scharf. Jeder Kampf verlangte Opfer. Aber sie selbst hatte nicht vor, sich die Hände schmutzig zu machen. Außerdem waren diese Pläne vollkommen weltfremd. Dann fiel ihr noch etwas ein. »So ein Attentat wäre kontraproduktiv. Der Papst ist immerhin das Oberhaupt der katholischen Kirche – das Symbol des Christentums.«
»Das Volk weiß, was von diesem Verräter zu halten ist.« Marais schwenkte seine Zigarette. »Dieser Papst respektiert das Menschenrecht der Europäer auf die Unversehrtheit ihrer eigenen Heimat nicht«, sagte er. »Auf den Erhalt der europäischen Kulturen – auf ein christliches Abendland.«
Henri nickte zustimmend.
Sophie blickte wieder auf den Bildschirm.
Der Papst, wie er lächelte, die Hände hob, auf die Menschen zuging – und die Massen jubelten ihm zu.
»Ihr Attentat würde ihn zum Heiligen machen«, sagte sie überzeugt. »Wie soll das unserer Bewegung nützen?«
Henri hielt sich die Faust vor den Mund, hüstelte.
Marais verzog seinen Mund zu einem dünnen Lächeln. »Und wenn der Stellvertreter Gottes nun von einem Moslem liquidiert wird?«, fragte er. »So ein Terroranschlag würde nicht nur Europa erschüttern, sondern die ganze Welt.«
Der Mann war tatsächlich verrückt.
»Arbeiten Sie etwa mit einer islamistischen Terrorbewegung zusammen?«, fragte Sophie.
Marais legte den Kopf zurück und lachte.
Die Narbe an seinem Hals begann mit einem Hautwulst, wohl eine schlecht behandelte Verletzung, wand sich um seine Kehle und wurde dünner, wo sie im Nacken verschwand.
Sophie war irritiert, ihre Frage legitim gewesen. Ohne Kenntnis aller Risiken würde sie keine Zusammenarbeit auch nur in Erwägung ziehen.
»Wir sind keine Terroristen«, sagte Marais. »Wir sind Demokraten. Es ist unsere Pflicht, unser Land zu schützen. Millionen Franzosen – Europäer – stehen hinter uns.«
»Ist der Papst nicht zu stark bewacht?«, fragte sie.
Marais schüttelte den Kopf. »Kein Leben ist so schwer zu schützen wie das des Papstes«, sagte er. »Einen Politiker oder einen Rockstar zu bewachen ist leicht. Aber ein Papst muss auf die Menschen zugehen.« Er machte eine Pause. »Vor dem Attentat auf Johannes Paul II. konnte sich keiner vorstellen, dass auf den Heiligen Vater ein Anschlag verübt wird. Heute bekommt der Vatikan jeden Tag Terrordrohungen. Trotzdem können sie dort nichts an den Abläufen ändern.« Er beugte sich vor und tippte auf den Bildschirm. »Da, sehen Sie?« Sein Finger zeigte auf den Mann, der mit der Kamera rückwärts vor dem weißen Wagen lief. »Francesco Sforza, der Fotograf des Papstes. Er hält alles fest, bewegt sich im exakt gleichen Tempo wie der Wagen. Er darf nicht stehen bleiben, nicht stolpern, keine schnellen Bewegungen machen. Er muss quasi unsichtbar sein.« Er lehnte sich wieder zurück. »Wir werden ihn sichtbar machen.«
»Was heißt das?«, fragte Sophie irritiert.
»Wir lassen ihn stolpern«, erklärte Marais. »Er stürzt – und alle Augen richten sich auf den Mann, den bis dahin niemand bemerkt hat. Das ist das Überraschungsmoment. Und der Wagen des Papstes muss abbremsen, wenn er den Fotografen nicht überfahren will.« Er machte eine wegwerfende Handbewegung. »Mehr, als wir für unsere Aufgabe brauchen.«
Eine Weile waren nur der Wind und die Zikaden zu hören.
»Was ist mit den Sicherheitskontrollen?«, fragte Sophie. »Es gibt doch bestimmt Kontrollen rund um den Petersplatz.« Warum suchte sie die Schwachstellen im Plan? Wollte sie Sicherheit für die Bewegung oder für das Leben des Papstes?
»Wir haben Freunde im Vatikan«, sagte Marais.
»Jemand aus den eigenen Reihen?«
»Ein Priester?« Marais lachte. »Das ist doch kein Auftrag für einen Amateur. Wir haben einen Profi. Er hat schon öfter für uns gearbeitet. Ein Mann mit Erfahrung.«
Henri räusperte sich. »Papst Franziskus’ PR-Masche ist die Bescheidenheit«, sagte er. »Nach seiner Wahl ist er nicht in den Apostolischen Palast gezogen – angeblich ist ihm der zu protzig. Er ist lieber im bequemen Gästehaus Santa Marta geblieben. Aber das ist öffentlich zugänglich.«
Sophie sah Marais an. »Warum dann der Petersplatz?«
»Weil sie in Santa Marta einen Wahnsinnsaufwand treiben müssen«, sagte Marais. »Die früheren Päpste sind im Apostolischen Palast an normalen Arbeitstagen ganz ohne Leibwächter ausgekommen. Franziskus braucht rund um die Uhr Dutzende von Sicherheitsbeamten – einen Riesenapparat.«
Henri grinste. »Was glauben Sie, wie die rotieren«, sagte er, »wenn sich der Papst mit dem Plastiktablett für seine Spaghetti Bolognese in der Mensa anstellt?«
Sophie dachte an die Bilder, die sie im Kopf hatte. Franziskus nach der Wahl beim Auschecken im Wohnheim Domus Paolo VI. bescheiden in der Warteschlange an der Rezeption, um seine Rechnung selbst zu begleichen. Der Papst, der nicht auf dem päpstlichen Thron in der Sixtinischen Kapelle Platz nahm, die traditionelle Huldigung der Kardinäle ablehnte und stattdessen die Gratulanten stehend empfing. Auf Augenhöhe. Dieses demonstrative Understatement, die medial geschickt gestreuten Gesten der Demut, für die Franziskus berühmt war, nötigten ihr Respekt ab. Den genauen Betrachter machten sie zwar stutzig. Aber so betrieb man heutzutage eben Meinungsmache. Die enormen Kosten, die diese öffentliche Bescheidenheit verursachte, waren nie ein Thema.
»Dann also der Petersplatz«, sagte sie.
»Unser Plan ist perfekt«, sagte Marais. »Es wird keine Hinweise auf uns geben, vertrauen Sie mir.« Er machte eine Pause. »Das letzte Attentat wurde auch nicht aufgeklärt.«
Beim Anschlag auf Johannes Paul II. war Sophie noch nicht auf der Welt gewesen. Jetzt ging sie schnell in Gedanken durch, was sie darüber gelesen hatte.
Der Attentäter, Ali Ağca, hatte nicht auf Kopf oder Brust des Papstes gezielt, sein Opfer nur angeschossen. Später fand sich sein Gesicht auf einem Foto aus dem engsten Umkreis des Papstes. Auch Ağca musste jemand Zutritt zur Vorbereitung des Anschlags verschafft haben – und später die Möglichkeit zur Flucht. Wer hatte schützend seine Hand über ihn gehalten? Schnell waren Spekulationen über die Auftraggeber laut geworden. Die CIA hatte sich bemüht, die Sowjetunion mit dem internationalen Terrorismus in Verbindung zu bringen, später wurde der KGB als Drahtzieher ausgeschlossen, wohingegen eine Spur in die USA führte. Der Klerus geriet ebenso in Verdacht wie die Freimaurer, das organisierte Verbrechen und Gladio, die Geheimorganisation der NATO, deren Mitglieder gegen Partisanen agierten.
»War es damals ein Geheimdienst?«, fragte sie.
»Gute Frage«, sagte Marais. »Der internationale Terrorismus ist ein Machtinstrument. Natürlich steuern und nutzen ihn die Geheimdienste. Also – durchaus möglich.«
Eine Spur hatte in die Türkei geführt. Zu den Grauen Wölfen, einer paramilitärischen rechtsextremen Bewegung, die mit Terror und Mordanschlägen Politik machte. Die Grauen Wölfe hatten jeden Zusammenhang mit Ağca abgestritten. Aber später war bekannt geworden, dass Ağca zwei Journalisten erschossen hatte und dann unter ungeklärten Umständen aus dem Gefängnis geflohen war. Wer hatte ihm geholfen? Der Staat? Ein westlicher Geheimdienst? Doch die Grauen Wölfe?
»Und die Grauen Wölfe?«, fragte Sophie.
In letzter Zeit mehrten sich die Hinweise auf deren Aktivitäten in Europa. Erst kürzlich hatte sich ein Mann auf einen Granitblock im Weiheraum der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers in Mauthausen gestellt, den linken Arm ausgestreckt und mit den Fingern ein symbolisches Wolfsgesicht gezeigt. In der türkischen Community verstand das jeder. So ein Verhalten war natürlich wenig hilfreich.
Marais zuckte die Schultern. »Das sind Idealisten«, sagte er. »So wie wir – und Ihre Bewegung natürlich auch.«
»Wenn ich mich recht erinnere«, sagte Sophie, »hat Ağca behauptet, von Prälaten beauftragt worden zu sein.«
»Ja, aber da konnte niemand Fragen stellen«, antwortete Marais. »Man hätte die Souveränität des Vatikans verletzt.«
»Ağca war also ein Auftragsmörder.« Sophie war nicht überzeugt. Es hatte damals zu viele Spuren gegeben, es würde auch heute welche geben. »Genau wie Ihr Profi.«
»Unser Killer ist in Europa ein unbeschriebenes Blatt«, sagte Marais. »Der Mann bekommt mehr Geld, als er sich jemals erträumt hätte – und danach ist er verbrannt.«
»Verbrannt? Was heißt das?«
Henri beugte sich vor und klappte das Notebook zu. »Der Mann wird nie wieder arbeiten können«, sagte er. »Das wäre zu gefährlich für uns alle.«
»Verstehe«, sagte Sophie. Die Pläne waren zu weit gediehen, das Attentat würde stattfinden. Sie musste sich damit abfinden und das Beste daraus machen. »Sagten Sie nicht, ein Moslem würde den Anschlag durchführen?«
»Das habe ich nie behauptet.«
»Sondern?«
»Wir legen nur eine Fährte in die richtige Richtung.«
»Man wird die Dokumente eines in Deutschland anerkannten Flüchtlings finden«, fügte Henri hinzu.
Sophie hätte fast laut gelacht. Stattdessen griff sie schnell nach ihrer Tasse und nahm einen Schluck von dem erkalteten Kaffee. In welchem Zeitalter lebten diese alten Männer? Über soziale Medien ließen sich schließlich auch Falschinformationen genau platzieren. Und oft genug wiederholt, wurde jede Lüge glaubhaft.
»Das ist viel zu demonstrativ«, sagte sie, um einen sachlichen Ton bemüht. »Wir werden stattdessen eine Desinformationskampagne starten und Ihre Falschmeldung ganz gezielt Empfängern zuspielen, die aufgrund ihres persönlichen Profils dafür empfänglich scheinen. Sollten wir uns zur Zusammenarbeit entschließen. Darüber entscheide jedoch nicht ich. Es wäre auf jeden Fall ein neuer Weg.«
Marais drückte die Zigarette aus. Er stützte die Ellenbogen auf die Armlehnen seines Sessels und verschränkte die Hände. »Wie sähe dieser Weg konkret aus?«, fragte er.
»Zunächst wird es ein neutrales Ereignis sein«, sagte Sophie. »Ein Ereignis, das jedoch die Welt erschüttert. Wir werden alle Informationen kontrollieren und die Emotionen in die richtigen Bahnen lenken. Nach dem ersten Entsetzen kommen die Durchhalteparolen. Wir stehen zusammen, lassen uns nicht unterkriegen – wir sind Papst.«
Marais’ Mundwinkel zuckten. »Weiter.«
Sophie redete sich warm, das war ihr Gebiet, sie liebte die Klaviatur der modernen Meinungsmache, wusste sie zu bedienen. »Dann streuen wir falsche Informationen, stiften Verwirrung, suchen im Netz Schuldige.« Sie breitete die Hände aus. »Zunächst wird es ein paar falsche Augenzeugen geben, die auf einen islamistischen Terroranschlag hindeuten, ein paar offensichtliche Spinner mischen wir darunter. Denen werden andere Nutzer vehement widersprechen – die Diskussion ist damit eröffnet. Im dritten Schritt greifen wir auf besonders wertvolle, sorgfältig aufgebaute Profile zurück. Diese Kommentatoren sind für ihre fundierten und kenntnisreichen Kommentare seit Langem im Netz bekannt. Sie diskutieren nun ganz sachlich und schließen sich endlich – nach Abwägung aller Berichte und Argumente – der ersten Gruppe an. Damit reißen sie alle anderen mit sich.« Sie blickte zwischen Marais und Henri hin und her. »So drehen wir die ganze Diskussion, bis alles in eine Richtung weist. Ein islamistischer Terroranschlag – wir gegen sie.«
Marais schwieg eine Weile, überlegte. Schließlich sagte er: »Wenn Ihre Bewegung das steuern kann …«
»Wahlen werden heute im Netz gewonnen«, sagte Sophie. »Die letzten US-Wahlen wurden fünf Tage vor dem Urnengang entschieden. Aber man muss Kanäle vorbereiten und passende Profile aufbauen. Also, wann ist der Stichtag?«
»Der siebzehnte April«, sagte Marais. »Das ist der Mittwoch vor Ostern, das letzte Mal, dass der Papst über den Petersplatz fährt. Bei Schlechtwetter findet der Empfang in einer Audienzhalle statt.«
»In der Aula Paolo VI.«, präzisierte Henri.
Sophie überschlug den Zeitplan im Kopf. »Mitte April – dann bleiben uns zwei Wochen. Das ist knapp, dürfte aber reichen.«
»Ihr Ziel sind die Europawahlen?«
»Unser Ziel ist Europa«, sagte sie. Die Wahlen waren ein Etappenziel, eine Schlacht, aber nicht der Krieg. »Die Menschen wollen ihr Land zurück. Und wir setzen uns dafür ein, dass es in einem neuen Europa wieder individuelle Nationalstaaten mit ihren eigenen Identitäten gibt. In ihren eigenen Grenzen. Weltoffenheit ist gut und schön, aber manchmal muss sich ein Volk abgrenzen, um zu überleben.« Sie sah Marais an. »Allein in Frankreich leben über sechs Millionen Menschen islamischen Glaubens – neun Prozent der Bevölkerung. Das werden niemals echte Franzosen werden.«
Marais nickte nachdenklich, griff nach der Packung Gitanes und zündete sich eine neue Zigarette an. »Sie sind gut informiert, Mademoiselle«, sagte er. »Bien, Gladius kämpft mit Ihrer Bewegung Seite an Seite für die Heimat.« Er lehnte sich wieder in seinem Sessel zurück, nahm einen tiefen Zug und blies den Rauch vor sich hin.
»Wir werden Details brauchen«, sagte Sophie.
Marais schüttelte den Kopf. »Non.«
»Wir müssen glaubhafte Augenzeugen aufbauen«, erklärte Sophie. Die Diskussion mit Laien war immer mühsam. »Ein paar voneinander unabhängige Quellen, die sich nach und nach zu Wort melden. Nur dann springen die Medien auf unseren Zug auf. Wie lange ist Ihr Mann in Italien? Wohnt er in einem Hotel oder privat? Fährt er Bus oder Vespa? So etwas.«
Marais ließ sich ihre Bitte durch den Kopf gehen. »Also gut«, sagte er schließlich. »Wir geben Ihnen ein paar Eckdaten, mit denen Sie operieren können.«
Henri stand auf und verschwand durch die weinüberrankte Veranda im Haus.
»Danke für Ihr Verständnis«, sagte Sophie.
Ein Lächeln huschte über Marais’ Gesicht. Er pflückte mit Daumen und Zeigefinger einen Tabakkrümel von seiner Zunge und schnippte ihn weg. »In meinem Metier braucht man kein Verständnis, nur ein Ziel«, sagte er. »Für Ihre … Bewegung sind wir sowieso die Mörder, die die Drecksarbeit machen, n’est-ce pas?« Er hatte sich keine Sekunde von ihrer diplomatischen Darbietung täuschen lassen.
Der Mistral wurde stärker, drehte von Nordwest auf Süd, trug den Geruch nach Salz und Meer heran.
Sophie fiel die Parole ein.
Pour Dieu et la patrie.
Für Gott und Vaterland.
Gar nicht so falsch, dachte sie und sagte: »Natürlich nicht, wir setzen uns doch alle für dasselbe Ziel ein.«
Marais fuhr wieder mit dem Finger über die Narbe an seinem Hals. Es schien ein Tick von ihm zu sein, der anfing, sie ernsthaft zu nerven.
»Sie sind so jung«, sagte er schließlich und nahm die Hand herunter. »Mademoiselle, wir – die Männer von Gladius – sind Ex-Legionäre. Wir haben schon für unser Land gekämpft, als Sie noch nicht geboren waren. Wissen Sie überhaupt, was das ist? Die Fremdenlegion?«
»Wer nicht?«, sagte Sophie. Es war eine Mördertruppe, aber man konnte sich seine Kampfgefährten nicht aussuchen.
Marais wandte das Gesicht nach Süden, ließ den heißen afrikanischen Wind über seine Haut streichen. »Wir hielten uns für die seigneurs de la guerre – die Herren des Krieges«, sagte er. »Eine Gemeinschaft bis in den Tod, in der jeder sein Leben für jeden aufs Spiel setzt.«
Sophie nickte. »Einer für alle, alle für einen«, sagte sie. »Anders funktioniert keine Bewegung.«
Die Zypressen hinter der Terrasse begannen sich unter den immer heftiger anbrandenden Windböen zu neigen, und ein Rauschen ging durch den Pinienwald, der den Garten zur Straße begrenzte. Wenn der Mistral weiter anhielt, würde er Sophies Maschine auf dem Rückflug ordentlich durchschütteln.
»Afrika.« Marais seufzte. »Wir waren romantisch, abenteuerlustig und sentimental. Wir haben für fünf Jahre unterschrieben, und als wir, die Überlebenden der Grundausbildung, in Sidi bel Abbès ankamen, stand über dem Kasernentor ein einziger Satz.« Er hob die Hand und fuhr damit durch die Luft, als zeichnete er einen Schriftzug nach. »›Légionnaires, vous êtes venus pour mourir‹ – Legionäre, ihr seid gekommen, um zu sterben.« Er grinste. »Wir haben uns in die Hosen geschissen.«
»Das kann ich mir nicht vorstellen«, sagte Sophie, die sich erneut Sorgen über diese Zusammenarbeit machte. Wenn bei diesem Attentat auch nur ein Fehler geschah, die Fährte in ihre Richtung wies, war der Schaden in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr gutzumachen. Sie würde die Zuverlässigkeit dieser Organisation mit einem Fragezeichen versehen. Am Ende waren die Leute von Gladius womöglich nur ein Haufen hitzköpfiger alter Haudegen.
Marais’ Augen verengten sich. »Sie haben mich nicht verstanden, Mademoiselle«, sagte er scharf. »Ein Legionär sollte kein Killer sein, wissen Sie, sondern nur ein Soldat, der sein Handwerk versteht.«
Sophie spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg. Und wieder hatte er sie durchschaut. Wenn sie geglaubt hatte, dass sie in diesem Gespräch auch nur eine Sekunde lang die Führung gehabt hatte, war sie naiv gewesen.
»Eine letzte Frage«, sagte sie. »Wie groß ist der Kreis der Eingeweihten? Wer weiß alles von Ihren Plänen?«
Darüber musste Marais erst nachdenken. Die Sekunden dehnten sich. Schließlich sagte er: »Unsere Organisation umfasst natürlich viele Mitglieder, sehr viele. Von unserem Plan wissen nur ich, Henri, unser Profi und jetzt Sie. Und natürlich unsere Kontaktpersonen in Rom.« Er machte eine Pause. »Dabei muss es bleiben. In jeder Organisation wimmelt es von Spitzeln. Informieren Sie nur Manhardt. Mehr Mitwisser wird es nicht geben.«
Wird – nicht »darf« oder »sollte«.
»Für uns lege ich die Hand ins Feuer«, sagte sie.
Marais beugte sich vor, fixierte sie. »Ich habe schon viele Hände brennen sehen«, sagte er. »Und Menschen auch.«
Sophie fragte sich, was passieren würde, wenn sie das Vertrauen der Männer von Gladius enttäuschte. Ihre Ankunft und der Torwächter fielen ihr wieder ein.
Warum verlangt der Mann die Parole?
Bei Gefahr hätte ich einen Code verwendet.
Und dann?
Sie hatte keine Antwort erhalten. Was war mit ihrem Informanten geschehen, den sie nicht mehr erreichen konnten? Ihr wurde kalt. »Vertrauen gegen Vertrauen«, sagte sie.
Marais schlug mit den Händen auf die Armlehnen seines Sessels und stand auf. »Dann auf gute Zusammenarbeit«, sagte er. »Grüßen Sie mir Wien – quelle belle ville.«
Was für eine schöne Stadt.
Sophie erhob sich ebenfalls.
Vom Haus her waren Schritte zu hören, gleich darauf gesellte sich Henri wieder zu ihnen. Sophie bemerkte Antoine, der mit auf dem Rücken verschränkten Händen im Schatten der Veranda stand und sie musterte. Hatte er die Runde die ganze Zeit beobachtet? Gab es ein verstecktes Mikrofon, das zu dem Knopf in seinem Ohr führte? War das Gespräch am Ende etwa mitgeschnitten worden? Das wäre ein Verstoß gegen die Abmachung – ein Beweis ihrer Anwesenheit auf Mas Boniface in den Händen dieser Söldnertruppe.
Marais gab Henri ein Zeichen und der überreichte Sophie ein braunes DIN-A5-Kuvert. Es war gepolstert, zugeklebt und überraschend leicht. Ein schmales weißes Etikett verschloss seine Rückseite. Der Umschlag war versiegelt.
»Ein paar vertrauliche Informationen«, sagte Marais. »Henri hat sie gerade für Sie zusammengestellt.«
Sophie zögerte, das Kuvert fühlte sich in ihren Händen nicht gut an. Es war eine Sache, theoretisch über einen Papstmord zu reden, und eine andere, mit konkreten Anschlagplänen durch halb Europa zu reisen. Sie wollte den Umschlag schon zurückgeben, als Henri sagte: »Niemand außer Ihnen kann damit etwas anfangen.«
Sophie steckte den Umschlag in ihre Aktentasche. Immerhin hatte sie jetzt auch etwas in der Hand.
»Au revoir, Mademoiselle«, sagte Marais. »Henri wird Sie zum Flughafen bringen. Wir bleiben in Kontakt.«
»Wir melden uns«, sagte Sophie. »Adieu.«
Die Fahrt zum Flughafen dauerte erheblich länger als die nach Grand Sud. Inzwischen war die Temperatur empfindlich gefallen und der Sturm hatte mit voller Wucht eingesetzt. Die langen Wedel der Palmen am Rand der E 714 peitschten die Luft, abgerissene Zweige und Papierfetzen wirbelten über die Fahrbahn und in Richtung Marignane ging es zeitweise nur noch im Schritttempo voran. Das Meer, nun auf der linken Seite, hatte die Farbe flüssigen Bleis angenommen. Schaumkronen tanzten auf den Wellenkämmen, und meterhohe Brecher schlugen ans Ufer, zerbarsten und sprühten Salzwasser auf die dahinschleichende Autokolonne.
Sophie ging das Gespräch mit Marais in Gedanken noch einmal durch. Das Attentat auf den Papst würde eine europaweite, wenn nicht weltweite Krise heraufbeschwören. Die Folgen waren vorhersehbar. Kriege und Terroranschläge bewirkten immer, dass sich die Öffentlichkeit um die Fahne scharte. Sophie hatte in Harvard studiert. Der USA PATRIOT Act, dem George W. Bush im Oktober 2001 mit seiner Unterschrift Gesetzeskraft verliehen hatte, war ihr ein Begriff. Das Gesetz wäre ohne die nur einen Monat zurückliegenden Terroranschläge niemals durch den Kongress gegangen. Doch nach dem 11. September 2001 hatte es die Mehrheit der Amerikaner für nötig gehalten, ein paar bürgerliche Freiheiten zu opfern – um den Terrorismus eindämmen zu können.
Sophie blickte nachdenklich aus dem Fenster.
Alle Kritiker wären auf einen Schlag zum Schweigen gebracht. Ein Attentat auf den Papst war ein Angriff auf das gesamte Abendland. Wer es wagte, die Stimme gegen notwendige Sicherheitsmaßnahmen zu erheben, begab sich in den Dunstkreis des Terrorismus, machte sich der Sympathie für die Mörder verdächtig. Die Idee von Gladius war genial.
Nach Pearl Harbour hatten sich die Amerikaner für die Ausweisung von Amerikanern japanischer Herkunft ausgesprochen. Noch Jahre später forderten viele deren Internierung. Man musste nur mit dem Finger auf den Schuldigen zeigen. Henris Worte fielen ihr wieder ein.
Man wird die Dokumente eines in Deutschland anerkannten Flüchtlings finden.
Sie hatte eine andere Vorgangsweise vorgeschlagen und das Gespräch hatte sich schnell in eine neue Richtung entwickelt. Jetzt fragte Sophie sich, wo man diese Dokumente überhaupt hätte finden sollen. Etwa auf dem Petersplatz? Marais’ ursprünglicher Plan musste einen Haken haben. Ihrem analytischen Verstand entgingen Ungereimtheiten nie.
Sophie wollte schon Henri fragen, der wieder vorne auf dem Beifahrersitz saß, aber in Gegenwart des Fahrers war das nicht möglich. Also tröstete sie sich damit, dass das Thema ohnehin vom Tisch war.
Sie dachte an den letzten Anblick, den Jean le Marais geboten hatte. Aufrecht und unbewegt, die Hände in den Hosentaschen und das silberne Haar ein Spiel des Windes. Im Hintergrund die schwankenden Zypressen und der sich verfinsternde Himmel über der Provence.
Ein Papstmord.
Jetzt schien ihr das Bild wie ein Symbol für die dunklen Gewitterwolken, die sich über Europa zusammenzogen.
3
Der Tag, an dem Viktor Hellbergs Leben aus seiner Bahn geworfen und in die Tiefen eines dunklen Universums katapultiert wurde, war Freitag, der zwölfte April.
In Berlin war ein sonniger Frühlingstag angebrochen, als Viktor wie jeden Morgen seinen Mercedes gegen acht Uhr auf seinem reservierten Parkplatz in der Tiefgarage abstellte. Sie lag unter einem jener Hochhäuser, die auf der ganzen Welt gleich aussahen. Moderne Architektur und verspiegelte Glasflächen zwischen Betonsäulen. Läden und Cafés im Erdgeschoss und Büros und Arztpraxen darüber.
Viktor fuhr im Außenlift in den achten Stock hinauf.