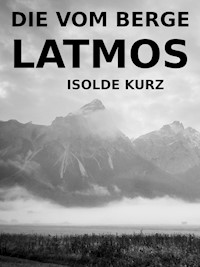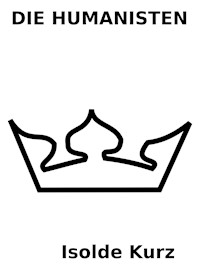Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Isolde Kurz ist auch heute noch eine ambivalente Schriftstellerin. Schon in jungen Jahren selbstständig als Autorin und Übersetzerin, war sie eine Seltenheit im wilhelminischen Deutschland. Später jedoch geriet sie wegen ihres Schweigens im Dritten Reich und ihrer altmodischen Sprache in Kritik. Hervorzuheben sind ihre Werke "Vanadis" und "Florentiner Novellen". Isolde Kurz wuchs in einem liberalen und an Kunst und Literatur interessierten Haushalt auf. Anfang der 1890er Jahre errang sie erste literarische Erfolge mit Gedicht- und Erzählbänden. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isolde Kurz
Die Stunde des Unsichtbaren
Seltsame Geschichten
Isolde Kurz
Die Stunde des Unsichtbaren
Seltsame Geschichten
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962812-18-8
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Die vom Berge Latmos
Fatum?
Der Iettatore – Eine vergessene Geschichte
Das Bildnis der Unbekannten
Der alte Schrank
Fluchgold
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Die vom Berge Latmos
Der Ingenieur Fritz Westerland, namhaft als Erbauer wichtiger Bahnstrecken in Kleinasien, wollte vor Antritt einer leitenden Stellung in China seine Jugendstadt wiedersehen, die er fast zwei Jahrzehnte grollend gemieden hatte. Um die Vergangenheit mächtiger zu seiner Seele reden zu lassen, verschmähte er es, das Städtchen vom Bahnhof aus zu betreten, wo er gewiss war, auf stimmungsraubende Neuerungen zu stoßen, sondern stieg an einer früheren Haltestelle aus, um über wohlbekannte Bergpfade den Rest der Entfernung zurückzulegen und durch das alte Tor seinen Einzug zu halten.
Nach mehrstündigem Steigen spaltete sich der Weg in zwei zu Anfang fast gleichlaufende Wege, die sich später in weitem Bogen voneinander trennten. Der Wanderer erinnerte sich genau der Stelle, wo es leicht war, sich zu verirren, und wählte mit Bedacht den seinigen. Auf sein Gedächtnis glaubte er sich verlassen zu dürfen, und sein Ortssinn war vorzüglich. Wenn er in der eingeschlagenen Richtung über einen waldigen Bergrücken weg einen flachen, mit Heide bewachsenen Vorsprung erreichte, musste er die Stadt im Tale mit Kirchturm und mittelalterlichen Mauerresten gerade unter sich sehen. Und eben dies war die Stelle, wohin es ihn am meisten zog, das Stück Heideland mit dem ansteigenden Buchenwald dahinter, war der Schauplatz unvergesslicher Jugendstunden.
›Unter der Linden an der Heide, wo ich mit meiner Trauten saß‹ – unbewusst sang er es vor sich hin, vom Zauber jener Tage wieder erfasst. – Aber eine Linde war es nicht, es war ein mächtiger Ulmenbaum, ein strenger alter Baumkönig, sagte er zu sich selbst, und nun sah er ihn so deutlich vor sich mit der Aussichtsbank darunter, dass er ihn hätte mit allen seinen Ästen zeichnen können. Auf wie viel Feste hatte der Alte herabgeschaut, stillverschwiegene Liebesfeste und tobenden Übermut, – zuletzt auf jenes Johannisfeuer – hier schlug die Erinnerung dem Wanderer eine Kralle ins Herz, dass er rascher ausschritt wie um den ätzenden Gedanken zu entgehen.
Der steinige Weg hob und senkte sich, mehr als einmal äffte ihn eine aufleuchtende Strecke von rotblühendem Heidekraut, aber der Ort, den er suchte, wollte nicht kommen. Hatte er sich in der Entfernung getäuscht oder wurde ihm das Steigen so viel schwerer als in den flügelleichten Tagen der Jugend? Neunzehn Jahre lagen zwischen dem Damals und dem Heut, neunzehn Jahre mit ihren Kämpfen und Erfolgen, auch mit mancher harten Schlappe, vor allem mit dem furchtbaren grundstürzenden Erleben des Krieges, dennoch hatte er sie nie als eine Last auf seinen Schultern gespürt. Er war fast schlanker und gestählter aus dem furchtbaren Ringen gekommen, und die grauenvollen Bilder waren ihm in den wenigen Friedensjahren schon zu einem wirren, von der Erinnerung gemiedenen Traum verblasst, über dem die Jugendgestalten wie liebe alte Sternbilder aufs neue emporstiegen. Er begriff nicht, woher ihm an diesem Abend die bleierne Müdigkeit kam, die allmählich das Weitersteigen als eine hoffnungslose Sache erscheinen ließ.
Vielleicht war es die nahe Verwirklichung des lange gewünschten und doch verschobenen Wiedersehens, die ihm lähmend in den Gliedern saß. Einmal musste ja der letzte Strich unter das Vergangene gemacht, einmal musste das große Fragezeichen seines Lebens ausgelöscht werden. Aber durch diesen letzten Strich wurde die Vergangenheit selbst getötet, mit dem noch immer peinigenden Fragezeichen verlöschte zugleich der beste Inhalt seiner Jugend, und das war es, was ihn bisher von der alten Heimat zurückgehalten hatte. Erst der Ruf nach China machte dem Zaudern ein Ende, jetzt musste dieses Letzte geschehen, ehe er in die fernste Ferne ging.
Thea! Thea! Thea! sagte er im Gehen vor sich hin und schlürfte begierig den Klang des Namens, den er seit neunzehn Jahren seinem Ohr nicht mehr gegönnt hatte. Denn seit die Trägerin sich von ihm schied, hatte er es vermieden, ihr auch nur im Munde der anderen wieder zu begegnen. Seitdem hatte er wohl mehr als einer Frau nahegestanden, aber keine hatte mehr so wie jene den ganzen Fritz Westerland besessen, sondern nur ein Stück von ihm. Der vielumworbene, erfolgreiche Mann, der sich keine Empfindsamkeit merken ließ und das Leben zu meistern schien, gehörte zu denen, die nur einmal lieben.
Auf dem altbekannten Pfade wandernd, legte er sich die wunderliche Frage vor: Wenn man all die Strecken, die unsere Füße gemeinsam durchschritten haben, zusammenlegen könnte, welche Meilenzahl das wohl ergeben würde? Nun tauchten alle die Berge und Täler, die sie in langjähriger Jugendneigung selbander durchstreift hatten, vor seinem Geiste wieder auf, mit allen gemeinsam genossenen Freuden, besonders der letzten und größten ihrer Freuden, der Fußreise über den Gotthard bis Italien hinunter, die schon wie ein Vorschmack der Hochzeitsreise war, denn wenn auch ein paar gute Kameraden teilnahmen, sie beide waren doch immer wie unter vier Augen gewesen. Wie hatten sie sich schweigend vor den Heiligtümern der Kunst verstanden, wenn den andern die oft verständnislose Rede überlief! – Dann aber, dann war das Unbegreifliche, Nieerklärte geschehen, Theas Abfall, dem kein Wink noch Zeichen voranging, der ihn wie ein brennender Meteorstein zu Boden schlug: erst die versäumte Zusammenkunft an der Bank unter der Ulme, die sie so oft beisammen gesehen hatte, dann die unbeantworteten Briefe, und der tödliche Schmerz, dass er ihre Vermählung zuerst durch Dritte erfuhr, ein verlegener Abschiedsgruß von ihr, den er nicht erwiderte, und als letztes Ende zwischen beiden: das tiefe, lebenslange Schweigen. Um dieses zu brechen, bevor es zum ewigen Schweigen wurde, war er nun gekommen, von einer versöhnten inneren Mahnung unwiderstehlich hergezogen. Doch bei der ungewohnten Müdigkeit, die alle Wanderlust aus seinen Gliedern nahm, überschlich es ihn mit wachsender Enttäuschung, als sei sein Kommen zwecklos und das Ziel, das er sich gesetzt hatte, die Aussprache mit ihr, doch nicht mehr zu erreichen.
Bei tiefgesunkenem Abend gelangte er endlich auf eine vom Waldgebirg übertürmte Hochfläche, aber der Ort, den er suchte, war es nicht: kein bebautes Tal öffnete sich in der Tiefe, vielmehr ging der Blick in lauter bewaldete Schluchten, worin schon Dunkelheit nistete. Wohl aber stand in der Nähe eines Steinkreuzes eine verwitterte Bank, die in solche Einsamkeit nicht zu passen schien, und die ganze Lichtung war von rotem Heidekraut freundlich und einladend wie die Stätte seiner Erinnerung überblümt. Von plötzlicher Schlafsucht bewältigt, ließ er sich auf die Bank sinken, und sein Kopf nickte vornüber. Gleichzeitig meinte er aus weiter Ferne einen Glockenton zu vernehmen. Er riss sich noch einmal in die Höhe und schaute umher: es war alles fremd wie zuvor, und er schloss aufs neue die Augen. Da traf ihn ein roter Strahl des aufgehenden Mondes durch den Lidspalt, dass er aufblickte. Doch er wurde so verwirrt wie einer, der sich schlafend im Bette umgedreht hat und beim Erwachen sich in seinem Zimmer nicht zurechtfinden kann, denn er war mit dem Bergwald im Rücken eingenickt und hatte jetzt den Mond im Gesicht, der über der Waldung aufstieg, dass er seine Umgebung nicht mehr erkannte. In dieser Benommenheit fiel ihm ein Baum am Waldrand in die Augen, an dem etwas Weißes wie ein Täfelchen glänzte. Auch schien dort ein Weg vom Berg herunter auf die Lichtung zu führen. Er hoffte also etwas wie einen Wegweiser zu finden, erhob sich noch halbtaumelnd und ging auf die Stelle zu. Im Mondschein, der jetzt Helle verbreitete, las er über einem Pfeil, der aufwärts zeigte, die Weisung: Zum Berge Latmos.
Die Fremdartigkeit des Wortes, das keine einheimische Ortsbezeichnung sein konnte, erweckte in dem Verirrten die Vorstellung einer nahen Unterkunft; vielleicht war es der Name einer Schutzhütte oder eines Bergasyls. Dazu gesellte sich der erfreuliche Anblick eines gepflegten Waldwegs, der auf die Nähe einer menschlichen Ansiedlung deutete. Unverzüglich schlug er die Richtung des Pfeiles ein, und schon nach wenigen Schritten wich der Waldboden einem schönen Wiesengrund mit Parkanlagen und fließendem Wasser, das von zwei Seiten über künstliche steinerne Treppen in ein edelgeformtes Becken rann.
Während er mit erstaunten Augen die unerwartete Feierlichkeit und Großheit des Parkeingangs in sich aufnahm, kam ihm von oben herab ein Mann in dunklem, kuttenartigem Gewand, barhäuptig und mit Füßen, die nackt in kräftigen Sandalen steckten, entgegen.
Friedrich Westerland? fragte der Begegnende in einem Tone, der die Bejahung vorausnahm. Du scheinst mich nicht zu kennen?
O ja, gewiss, jawohl, entgegnete der Ankömmling mit einer freudigen Betonung, die ihn selbst in Staunen versetzte, weil sie über die angenehme Empfindung, in der Bergwildnis einem Menschen zu begegnen, hinausging, und so peinlich ihm die falsche Lage war, in der er sich dabei fühlte, verhinderte ihn doch eine ihm ganz unbegreifliche Befangenheit, aufrichtig auszusprechen, dass ihm zwar die Persönlichkeit sehr bekannt erschien, dass er aber keineswegs wusste, wen er vor sich sah, und dass er nicht einmal ahnte, woher die Bekanntschaft sich schrieb.
Und wie kommst du zu so später Stunde in diese Einsamkeit? fragte der andere in gütigem Ton.
Fritz Westerland erklärte, indem er die unmittelbare Anrede mit dem ihm noch fremden Du vermied, dass er die Bahn nach X. auf einer der letzten Stationen verlassen habe, um über das Gebirg die Stadt zu Fuße zu erreichen, jetzt aber sehe, dass er verirrt sei.
Nach X. findest du diesen Abend nicht mehr, du bist gänzlich aus der Richte. Es bleibt dir für heute nichts übrig, als mit einem Nachtlager auf ›Berg Latmos‹ vorliebzunehmen.
O Sie sind – du bist sehr freundlich, lieber Freund. Aber was bedeutet nur die seltsame Bezeichnung ›Berg Latmos‹, die man zu verstehen glaubt und doch nicht versteht?
Jener lächelte eigen.
Erinnerst du dich nicht mehr aus der Mythologie der Griechen an den karischen Hirten am Berge Latmos, zu dessen Schlaf die Mondgöttin herunterstieg?
Fritz Westerland war in seinen Schuljahren ein schwacher Grieche gewesen; besonders die vielen Götter und Göttinnen mit ihren zahllosen Liebschaften konnte er nie so recht auseinanderhalten. Dennoch dämmerte ihm jetzt eine Erinnerung auf, und er sagte:
Endymion!
Siehst du, dein Gedächtnis ist besser, als du selber weißt, antwortete der Unbekannte auf den unausgesprochenen Gedanken des Gastes. Nun, und darum nennen wir uns: Die vom Berge Latmos.
Dieses ›Darum‹ war dem Frager vollkommen unverständlich, aber wenn er weiterfragte, geriet er in Gefahr, sich eine Blöße zu geben. Also schwieg er und dachte, wer die ›Wir‹ sein möchten, zu denen jener sich selber rechnete.
Vielleicht ist es ein Genesungsheim im Walde, sagte er sich, oder eine Erziehungsstätte, wie man sie neuerdings in die Einsamkeit zu verlegen liebt.
Je länger er neben dem gastlichen Begleiter hinschritt, desto bekannter erschien ihm dessen Gesicht und Wesen, das ein mit Scheu gemischtes Vertrauen einflößte. Er sah ihn mitunter forschend von der Seite an, bald wollte ihm dieser, bald jener Zug ein gemeinsames Erlebnis wecken, aber er fand den Faden nicht, der aus diesem Irrgarten führte. Der andere mochte im gleichen Lebensalter stehen wie er selbst, doch in seinen Schul- und Heimaterinnerungen kam dieses Gesicht nicht vor. Sie mussten sich also auf späteren Lebenswegen begegnet sein, aber diese liefen bei Fritz Westerland so verschlungen, dass jedes Suchen aussichtslos war, wenn ihm nicht eine plötzliche Erkenntnis vom Himmel fiel.
Durch sieben hängende Gärten geht der Weg ins Haus, erklärte sein Führer, während sie zusammen die breite steinerne Mitteltreppe hinanstiegen, wir haben sieben stufenförmige Erhöhungen des Berges dafür ausgenützt. Der erste ist der Garten der Verheißung, weil er zuerst den ruhesuchenden Wanderer aufnimmt und ihm ein sicheres Obdach verspricht. Dieser, den wir jetzt betreten haben, heißt der Garten des Gedenkens.
Eine hohe Mosaikwand, die bogenförmig in den Berg eingewölbt und von der höherführenden Treppe durchbrochen war, schloss die Plattform nach oben ab und stützte zugleich den nächsten darüberliegenden Garten. Sie hatte zur Rechten und Linken der steinernen Treppe Nischen von mäßiger Tiefe, worin männliche und weibliche Steinfiguren, bildnishaft und doch über das Menschliche hinaus erhoben, in idealer Gewandung standen. Dazwischen sickerte aus Löwenmäulern Wasser in schön geschweifte Becken. Schmälere Treppen führten in schöner Schwingung auf seitliche Gartenterrassen hinüber, die zwischen hochstämmigen Wunderpflanzen allerhand symbolisches Bildwerk aus grauem Sandstein trugen.
Mehr und mehr betroffen von der Erhabenheit und dem Reichtum dieser Anlagen, deren Besitzer er sich als einen menschenfreundlichen Nabob vorstellen musste, konnte der Wanderer sich der Frage nicht enthalten, wem denn der ›Berg Latmos‹ gehöre.
Nimm an, dass ›Berg Latmos‹ ebenso dir gehört wie irgendeinem andern, der hier Aufnahme sucht, war die Antwort. Wir, die das Haus bewohnen, sind nur seine Hüter.
Der Besucher schwieg beschämt, er meinte eine ungeheuerliche Dummheit gesagt zu haben.
Hier gedulde dich ein wenig, Friedrich Westerland, ich muss die Brüder auf dein Kommen vorbereiten.
Kaum dass der Führer dies gesprochen hatte, war er weg und nirgends mehr zu sehen. Der Gast betrachtete aufmerksam die Standbilder in den Nischen; sie erinnerten ihn, aber nur von ferne, an die Lenker und Lenkerinnen seiner Jugend, denen er, wie so manchen Späteren, den Dank für ihre Wohltaten schuldig geblieben war. Da der Bruder noch immer nicht zurückkam, setzte er sich auf den Rand eines Beckens, das der Vorderseite eines mit Blumen überschütteten offenen Säulenbaus vorgelagert war, die flache, vorspringende Stufe mit seinem dunklen Wasser bespülend. Ein silberner Strahl stieg darin auf, der sich in drei Strahlen teilte und beim Zurückfallen eine durchsichtig-weiße Geisterlilie bildete, vom Mondlicht gleißend beschienen. Als der Springquell für einen Augenblick versiegte und die Fläche sich glättete, war es dem Beschauer, als tauchte aus grüngoldener Dämmerung ein von triefendem Haar überflossenes Frauenhaupt empor und ein Oberkörper, der sich ihm entgegenreckte, aber kraftlos zurücksank. Dann stieg die Lilie wieder auf, und das wallende Wasser verlöschte das Bild. Es war nicht das Haupt, das er so lange geliebt hatte und um dessentwillen er ausgezogen war. Unsägliche Wehmut überwältigte ihn, und Tränen stürzten aus seinen Augen, sie galten seiner Ohnmacht, ein neues Glück, das ihn suchte, zu fassen und festzuhalten. Ein Vogel warf seinen kurzen Abendgesang wie eine Aufforderung in die tiefe Stille. Fritz Westerland stand auf und blickte sich nach dem Sänger um, der unter dem Säulendach zu nisten schien. Dabei entdeckte er im Innern des Tempelchens ein schön durchbrochenes Marmorgeländer, das ihm entgegenglänzte. Er fand eine Treppe im Boden, stieg mehrere Stufen hinunter, wobei er in einen dunklen Gang geriet, der sich nach abwärts senkte, an einer Ecke scharf umbog und in noch tieferer Finsternis weiterführte, bis an einer zweiten Ecke ein Strom von Licht hereinfiel und vor dem Erstaunten sich der Garten des Paradieses auftat: ein Wiesengrund mit tausend Blumen bestickt, der auf eine zauberische Frühlingslandschaft niedersah, weißstämmige Birken im ersten zarten Lenzesschmuck hügelan steigend wie junge Bräute, die zur Kirche gehen, und schön geordnete Beete von leuchtender Blumenfülle unter einem Himmel der Verklärung. Unmöglich, bei diesem Anblick nicht an Jugend und Liebe zu denken.
Ein Tönen wehte ihn an, worin Jubel und Weh zusammenklangen: Liebster!
Thea! Thea! Wo bist du? – rief er außer sich. – Hier bin ich, hier, antwortete es wie aus einer Äolsharfe. Er sah zwei Augen vor sich, und langsam bildeten sich seiner erschaffenden Sehnsucht aus der durchhellten Luft Züge und Gestalt der Einzigen.
Du! Du! Endlich! hauchte er mit versagendem Atem, ohne sich zu rühren.
Endlich! Endlich! kam es ebenso zurück.
Kein Wort weiter, kein Kuss, keine Umarmung, nur die Augen, die ineinander festhingen, durstig, unersättlich, wie um neunzehn Jahre der Entbehrung nachzuholen, ein endloses Gegenüber. Sie redeten nicht mit Lauten der Sprache zueinander, aber sie verstanden eines das andere.
Thea! Thea! Thea! – Friedrich! Mein, mein Friedrich!
Thea hatte nie die unter den Freunden bräuchliche Abkürzungsform seines Namens geliebt, weil ihr jeder Buchstabe kostbar war, denn in jedem webte es wie ein Teil von ihm. Fritz Westerland, den alle suchten, gehörte der Welt, ihr Friedrich gehörte nur seiner Thea.
Wie jung du geblieben bist, Thea, und wie schön!
Auch du bist jung, Friedrich, weißt du es nicht? Dies ist ja der Garten der Jugend.
Und doch sehe ich etwas Neues in deinen Zügen, Thea. Es steht dir schön, aber ich kannte es früher nicht.
Der Schmerz, Friedrich.
Leidest du Schmerzen, Thea?
Du kannst fragen, Friedrich? Verlorene Liebe, verlorenes Leben.
Ach warum, Thea, warum musste das geschehen? Liebtest du den anderen?
Niemals.
Und doch, Thea?
Du kennst das Mitleid nicht, das die tiefste Schwäche des Frauenherzens ist?
Mitleid habe ich für die Hilflosen, für die stammelnde Kindheit und das gebrechliche Alter; sonst kenne ich nur die Ehrfurcht vor der Kraft.
Aber das Unglück, Friedrich?
Von dem Unglück halte ich mich ferne, gleichfalls aus Ehrfurcht.
Das Herz der Frau empfindet anders, Friedrich. Wenn ein Eroberer ihr Kronen bringt und sie sieht den Bettelmann am Wege stehen, – Friedrich, er kann sie mit einem Blicke zwingen, in seine Kötze zu springen wie im Märchen, das wir zusammen lasen.
Thea! Thea! Ich kann dich so nicht reden hören. Lass mich lieber dich anschaun und das Geschehene vergessen.
Vergiss es, Geliebter.
Nur das eine musst du mir noch sagen, wann es geschehen ist, Thea, das Unbegreifliche. Ich ahnte ja nichts von allem.
Weißt du nicht mehr unsere letzte Johannisnacht?
Als ob ich die vergessen könnte!
Wir tanzten um den flammenden Holzstoß, die Mädchen mit langen farbigen Schleiern. Du warst ein wilder Tänzer an jenem Abend. Stierhörner trugst du auf dem Kopf und schwarzes Seidengewebe eng auf dem Leib, über das du einen roten Mantel geschlagen hattest. Ein junger Siegfried warst du. Alle Mädchen blickten dir nach, wenn du dich durch die Reihen schlangst.
Und ich selber sah nur die Eine.
Die Glut war noch kaum gesunken, da tratest du zu mir und botst mir die Hand, um als die ersten durch die Flamme zu springen. Mein blauer Schleier und dein roter Mantel fegten zusammen über das Feuer, dass uns ein langer Schreckensschrei der Zuschauer begleitete, aber mit einem Siegfriedssprung brachtest du mich heil hinüber, und kein Fäserchen meines Gewandes war versengt. Ich hatte nicht daran gezweifelt.
Weil du und ich wie die zwei Flügel eines Vogels waren.
Nein, die Geschicklichkeit war nur deine. Ein Rausch des Lebens hatte dich erfasst, du sprangst wieder und wieder, und immer trugst du einen der farbigen Schleier mit dir. Alle waren sie bereit, dir zu folgen, keine zögerte auch nur sekundenlang. Kaum dass die anderen jungen Männer sich gleichfalls zu dem Sprung entschlossen, da tratest du schon mit zwei Begleiterinnen vor, an jeder Hand eine, und trotz dem Warnungsruf der Alten sprangst du mit beiden heil durch die Flammen.
War es das, was dich verletzte, dass ich auch mit den andern sprang?
Nein, o nein, ich sah dir mit Stolz und Freude zu. Aber da war etwas, das mir zuraunte, dass du meiner nicht bedürfest, dass du der junge Siegfried seist, der Sonnensohn, dem alles zufällt und für den es nichts Versagtes gibt. Und im Dunkel der hohen Ulme, Friedrich, stand ein anderer, einer, der mein bedurfte, der wenigstens glaubte, meiner zu bedürfen, und der mir diesen Glauben beibrachte.
Der diabolische Geigenmann?
Du magst ihn so nennen. Du konntest seine Musik nicht lieben, du, der du nur Sonne und Klarheit liebst. Mir sprach sie von der Nachtseite des Lebens, wo der andere Teil meines Wesens wurzelt, von all den Dingen, von denen ich zu dir nicht sprechen durfte. Und von einem großen Leide, das auf ihm lag. Er geigte mir das Herz entzwei, er geigte sich in alle meine Träume. Seit Monden war es so, du sahst es nicht in deiner Sicherheit. Jener Abend sollte mich von dem Bann erlösen, ich suchte Schutz in deiner Nähe, aber gerade jener Abend riss uns voneinander.
Senta und der Holländer! sagte Friedrich bitter.
Er war ein großer Künstler, Friedrich, aber ein kranker Mensch.
Als einen großen Komödianten kannten ihn alle.
Er war kein Komödiant, nur ein Opfer seines Wahns. Aus den Tönen, die er formte, floss es in seine Einbildung hinüber und füllte sie mit dämonischen Schrecken oder mit wilder bacchantischer Lustigkeit. Und in mir war etwas, das dieses Rasen von Pol zu Pol verstand. So glaubte ich, seiner großen Kunst das Opfer meines Glückes bringen zu müssen.
Und an jenem Abend?
Du konntest dich vom Zauber des Feuers nicht trennen, ich war zu Hause erwartet, so brachte er mich allein durch den Wald. Und er sprach mir von dir, mein Friedrich.
Der Elende, er hat mich bei dir verleumdet.
Nie, o nimmermehr. Keiner hat jemals schöner von dir gesprochen. Du seist der Glücklichgeborene, sagte er, der den Rhythmus des Siegs schon in den Gliedern trage, der Mann der Tat, der Reiche in sich selbst, der keines andern bedürfe. Es waren meine eigenen Gedanken, die er mir zu hören gab. Hatte er sie mir, hatte ich sie ihm unwissend eingegeben? Dann sprach er vom Rechte des Unglücks und dass die große Kunst sich vom großen Schmerz nähre. Und er nannte mich das Schäfchen des armen Mannes. Da ward seine dunkle Gewalt mächtiger über mir. An jenem Abend, Friedrich, haben wir uns für immer verloren.
Aber warum kein Wort, kein Abschied, warum die versäumte Zusammenkunft?
Weil mein Herz gespalten war, weil ich dir nicht mehr ins Auge sehen konnte.
Und dann? Wie ward es dann?
Dann ward es wie es werden musste: ich war an einen Geisteskranken gefesselt, dessen Irresein ich vor der Welt verbergen musste und der mich selbst an die Grenze des Irrsinns trieb.
Arme, unglückliche Thea!
Ich war es durch zehn lange Jahre, ehe ich Witwe ward.
Und jetzt, Thea, jetzt?
Jetzt stehe ich am Ziel und bin glücklicher, als ich jemals noch zu hoffen wagte, denn ich habe dich und meine Jugend wiedergesehen.
Aufs neue blickten sie sich lange und schweigend in die Augen. Die blasse Gestalt wurde immer blässer. Am Ende fragte sie:
Du trägst keinen Ring, Geliebter?
Ich konnte mich nie mehr zu einem dauernden Bund entschließen.
Tu es, Friedrich. Dein Herz ist nicht geschaffen, um allein zu sein.
Der große Verlust hat mich für immer zum Einsamen gemacht.
Es gibt Bessere als mich, Friedrich, und Weisere. Ich weiß, dass du geliebt bist, und du wirst noch glücklich werden.
Er schüttelte leise das Haupt.
Was ist dieser Berg Latmos, wo wir uns gefunden haben, für ein Ort? Ist es ein Schloss? Ist es das deine? fragte er.
Ich kam hierher als Verirrte und wurde aufgenommen wie du.
Ist denn der Berg Latmos ein Asyl?
Für solche, die vom Leiden Erlösung suchen.
Also eine Heilstätte?
Er ist auch dieses.
Und die sieben Gärten, von denen mein Führer sprach?
Durch den Garten der Verheißung tratest du ein und den Garten des Gedenkens hast du durchwandert. Jetzt stehst du in dem der Jugend, der der schönste ist von allen, du hast dich noch kein einziges Mal nach seinem Rosenwald und Schwanenweiher umgeschaut.
Weil du mir alles bist, Jugend und Rosenwald und Schwanenweiher.
Jetzt aber, Friedrich, wird der Bruder kommen, der mich in den nächsten, in den des Schweigens, führt.
Wer ist der Bruder, sag’ es mir, Geliebte. Sein Angesicht scheint mir bekannt, und doch weiß ich mich nicht auf ihn zu besinnen.
So erscheint er allen, die er zu führen kommt.
Ist er Arzt? – Lehrer? – Priester?
Eine Vereinigung von allen dreien.
Wie heißen die Gärten, die auf den des Schweigens folgen?
Des Erwachens und des Erkennens. Der letzte, siebente, wird nicht genannt.
Wird der Bruder uns durch alle führen?
Das zu fragen ist uns nicht gestattet.
Noch nie hat mir ein Mensch so tiefes Vertrauen eingeflößt wie dieser Bruder.
Du darfst dich ihm ganz erschließen. Aber niemals wirst du ihm etwas von dir sagen können, was er nicht schon wüsste.
Die weiße Gestalt war jetzt so blass, dass ihre Umrisse kaum noch erkennbar blieben, und ihre Stimme klang wie eine hinsterbende Flöte. Als der Bruder zu ihnen trat, sank sie ohnmächtig in seine Arme.
Sie will jetzt einschlafen, lassen wir sie allein, sagte dieser.
Wird sie denn wieder aufwachen? fragte der Besucher angstvoll.
Sie wird, das ist ganz gewiss.
Friedrich wollte ihm helfen, die Hingesunkene zu tragen, die der Bruder leicht wie eine Feder aufhob, aber dieser wehrte ab:
Berühre sie nicht, du würdest sie erwecken. Sie braucht jetzt nichts anderes mehr als Ruhe.
Du hast uns beiden die tiefste Wohltat erwiesen, Bruder. Wie kann ich dir danken?
Danke mir nicht, denn zum Helfen sind wir da.
Der Bruder beschleunigte seinen Gang mit der ohnmächtigen Frau auf den Armen, aber Friedrich Westerland folgte ihm auf den Fersen eine neue Treppe hinan, bis sich eine bronzene Tür im Gestein öffnete, um den Bruder einzulassen.
Bleibe hier und ruhe auch du, sagte der Helfer, die Schwelle mit seiner Last betretend.
Friedrich haschte nach seinem entschwebenden Rockflügel.
Ist denn Hoffnung für sie, Doktor? fragte er.
Der andere wandte sich noch einmal um:
Unsere Hoffnung steht bei der besten Hoffnung, lächelte er geheimnisvoll.
Friedrich Westerland stand allein vor einer steinernen Mauer, über die Sinngrün und Myrten niederhingen. Von einer Tür war nichts mehr zu sehen. Und auch der Garten war kein Garten mehr, sondern ein hochgewölbter Kuppelsaal mit leuchtendem Deckengemälde, das den tiefblauen Nachthimmel mit den in Gold gemalten Gestalten des Tierkreises darstellte.
Wo habe ich solche Deckenbilder schon gesehen? grübelte er und konnte die Antwort nicht finden. Aber plötzlich sah er sich als Jüngling mit Thea und den andern Reisekameraden im Schlosse von Mantua, das er seitdem nicht wieder besucht hatte, und hörte Thea sagen: Eine solche Decke muss auch einmal über unserem Schlafzimmer sein – und vernahm seine eigene Stimme, die zur Antwort gab: Du sollst es nicht schlechter haben, als Isabella von Este.
Ein königliches Bett mit schweren, weit zurückgeschlagenen Falten stand nach herrschaftlichem Brauch, nur mit dem Kopfende die Wand berührend, frei im Raum, sonst war kein anderes Gerätstück vorhanden. Ehe er in den köstlichen seidenen Kissen versank, öffnete er noch einmal weit die Augen, denn oben fiel der Schein des Mondes auf ein wundervolles Gemälde, das er taghell erleuchtete. Es war die Mondgöttin, in weiße, durchsichtige Schleier gehüllt, wie sie mit der goldenen Sichel auf der Stirn, die eine Hand ausgestreckt, mit der anderen die Fackel haltend, aus dunkler Bläue zu dem schlafenden Hirten niederschwebte. Das ganze Gemälde war leicht wie eine Zeichnung auf die Wand gehaucht, die spinnwebdünnen Schleier der Selene, von zarten Goldfäden eingesäumt, ließen eine göttlich erhabene, übersinnlich keusche Nacktheit durchscheinen, vom Boden reckten sich geheimnisvolle tropische Blumen von traumhafter, aber durchsichtig zarter Farbenglut steil empor, um mit weit geöffneten Kelchen das Mondlicht zu trinken, der schöne Schläfer aber lag halbausgestreckt, mit einem Arm unter dem Kopf, auf roter Decke, und sein Hund mit gelblichem Zottelhaar bellte aufgeregt der Lichtgestalt entgegen. Wie von einem jähen Blitz innerlich erhellt, verstand Friedrich Westerland mit einemmal die Bedeutung der Sage, und seine Lippen murmelten: Im Traum enthüllt sich das Verborgene –, noch ehe er die Inschrift unter dem Bild gelesen hatte: Somnio patent occulta. Dann versank er in die Kissen, während ihm die Züge Theas mit denen der Mondgöttin verschmolzen.
Er erwachte an einem Lichtschein, der durch seinen Lidspalt fiel. Wie ist das möglich? dachte er, der Mond steigt über dem Wald empor, genau so wie im Augenblick, wo ich mich erhob, um den Berg Latmos zu betreten. Ich habe also eine Nacht und einen vollen Tag durchgeschlafen.
Die tiefe Erquickung, die er empfand, machte diese Annahme sehr wahrscheinlich. Aber da er sich nun im Bett aufstützte, griff er statt eines weichen Pfühls an hartes Holz. Als er sich vollende aufrichtete, fand er sich auf einer zermorschten Holzbank in der Nähe eines steinernen Kreuzes sitzend, und hinter ihm stand der entlaubte und halbverkohlte Stamm einer vom Blitz gespaltenen Ulme. Unten im Tale aber schwangen die Glocken wie im Augenblick seines ersten Einschlafens auf dieser Bank und verkündeten, eine um die andere, die zehnte Stunde. Der Mond hob, sobald er höher gestiegen war, ein Häusergebreite mit Kirchturm und Schlossruine aus der nächtlichen Ertrunkenheit.
*