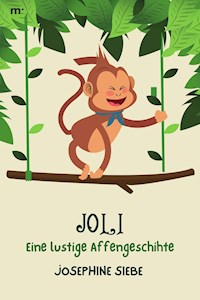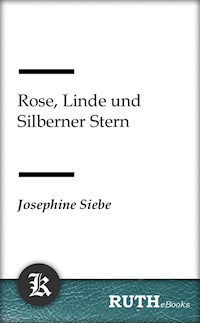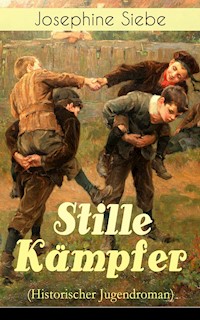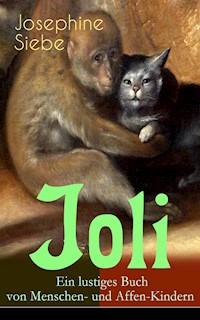Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Die Tasse des Königs" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. "Von den sieben Mädels sah nur Lotte Langmann flüchtig zu der einsamen Lauscherin hinüber: "Madame Busse hört uns," sagte sie, doch das behinderte die anderen wenig, am wenigsten Nettchen Dibelius. Die stand schlank und fein im zierlich geblümten Kleid inmitten ihrer Gefährtinnen, und ihre samtbraunen Augen strahlten in seliger Freude; ihre Stimme jauchzte wie die einer Lerche, "und ich darf Rosen streuen, lauter Rosen, von unseren Zentifolien an der Mauer, und Mutter gibt mir ihren neuen Schlüsselkorb und Tante Malve bindet rosa Schleifen daran, und auf der Treppe bei den Großeltern darf ich stehen, dort kommt der König vorbei!?" Josephine Siebe (1870-1941) war eine deutsche Redakteurin und Kinderbuchautorin. Sie verfasste zwischen 1900 und 1940 fast 70 Bücher für Kinder und heranwachsende Mädchen, daneben eine Vielzahl von Beiträgen in Jahres- und Sammelbänden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Tasse des Königs
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel Ein Streit auf dem Liebfrauenplatz
Der König soll kommen, und Madame Busse denkt an vergangene Zeiten. Warum Peter Hagemeister mit Wilhelm Tell in den Schweizer Bergen herumsteigt und frägt, ob das Kapitol errettet werden soll? Sieben Mädchen entrüsten sich. Nettchen Dibelius sagt etwas von Sitzenbleiben und Peter wird ihr Feind.
»Der König kommt, hurra!«
»In fünf Tagen kommt er!«
»Nein, in vier. Heute ist doch schon beinahe vorbei!«
»Und ich darf Blumen streuen.«
»Ich auch, ich auch.« Siebenfach tönte das Echo. Denn sieben Mädels waren es, die auf dem Liebfrauenplatz von Neustadt zusammen standen und eifrig von dem großen wundersamen Ereignis redeten, der König sollte kommen, Preußens König!
Der Liebfrauenplatz lag im Glanz der Nachmittagssonne. Er war ganz einsam, wie fast immer um diese Zeit. Die Häuser, die den Platz umstanden, sie hatten alle ein wohlhäbiges Aussehen, waren von großen Gärten begrenzt, und das Leben ihrer Bewohner spielte sich meist nach der Gartenseite hin ab. Nach vorn hinaus lagen die Staatsstuben, die nur an Besuchstagen geöffnet wurden, es störte darum nie jemand, wenn Kinder auf dem Platz lärmten. Allein die alte Frau Busse saß in ihrer Wohnstube, sie war bei sich auf Besuch, wie sie es nannte, und von ihrem Staatszimmer aus hörte sie dem Geschwätz der sieben Mädels zu. Sie lächelte darüber. Die können es gut, dachte sie, und es kam ihr in den Sinn, wie sie einst genau so mit ihren Freundinnen zusammen gestanden hatte, damals, als König Friedrich Wilhelm III. mit seiner schönen lieblichen Königin Luise hier durchgefahren war.
Vor vierzig Jahren ungefähr, so lange war das schon her. Lieber Himmel, dachte Frau Busse und ließ die bunte Wollstickerei sinken, was ist seitdem alles geschehen! Die ganze schlimme Franzosenzeit liegt dazwischen, die schweren Kriege und –
»Ach, wenn der König doch schon morgen käme, nein, heute, ich kann's ja gar nicht mehr erwarten, so freue ich mich!«
Ein hohes, helles Stimmlein schwang sich über die der anderen hinweg, da schwiegen die andern auf einmal und ließen die eine reden, denn so wie die konnte keine sich freuen. Die gute alte Frau Busse schaute noch einmal so freundlich drein, sie sagte halblaut zu sich selbst: »Natürlich, das ist Nettchen Dibelius, sie ist doch gerade wie ihre Großtante, die ging auch beinahe auseinander vor Freude über den Königsbesuch. Ja, ja, damals, und himmelblaue Kleider trugen wir beide. War das eine schöne Zeit!«
Von den sieben Mädels sah nur Lotte Langmann flüchtig zu der einsamen Lauscherin hinüber: »Madame Busse hört uns,« sagte sie, doch das behinderte die anderen wenig, am wenigsten Nettchen Dibelius. Die stand schlank und fein im zierlich geblümten Kleid inmitten ihrer Gefährtinnen, und ihre samtbraunen Augen strahlten in seliger Freude; ihre Stimme jauchzte wie die einer Lerche, »und ich darf Rosen streuen, lauter Rosen, von unseren Zentifolien an der Mauer, und Mutter gibt mir ihren neuen Schlüsselkorb und Tante Malve bindet rosa Schleifen daran, und auf der Treppe bei den Großeltern darf ich stehen, dort kommt der König vorbei!«
Einen Augenblick schwiegen alle sieben Mädels. Der Gedanke, daß der König an Justizrat Dibelius' Haus vorbeifahren, ja, dort halten würde, überwältigte sie fast. Dann konnten sie alle den König ganz nahe sehen, denn Nettchen würde schon dafür sorgen, daß ihre Freundinnen auch dort Platz fanden. Aber für langes Schweigen waren sie alle miteinander nicht, und ganz plötzlich fiel jeder etwas ein, was zu sagen äußerst eilig und wichtig war, und auf einmal schwatzten die sieben mitsammen los.
Die alte Frau Busse erschrak ordentlich. Nein, so laut hatten sie und ihre Freundinnen sich damals sicher nicht gefreut. Oder doch – hm, vielleicht! Jugend ist Jugend, dachte sie milde und lauschte wieder freundlich hinaus. Wie hübsch es doch aussah, wie die sieben Mädels da im Kreis zusammenstanden! Ihre hellen weiten Kleider, unter denen zierlich gefältelt und gestickt lang die weißen Höschen hervorkamen, flatterten in dem sanften Sommerwind, wie sieben große leuchtende Blumen erschienen sie der alten Frau. »Ein richtiger Kranz,« sagte die zu sich, aber das Röschen im Kranz, das ist und bleibt doch Nettchen Dibelius.
Über den heiteren Lärm, den die Mädelschar vollführte, dachte freilich nur Frau Busse so milde, einen gab es, der sich sogar kräftig darüber ärgerte. Den machte das Geschwätz und Gelächter fuchswild, denn es störte ihn in einem wundervollen, leider nur verbotenen Genuß. Im Gartenwinkel des Rektorhauses, das neben dem Gymnasium lag, saß, tief verborgen hinter dichtem Pfeifenkraut, Peter Hagemeister und las Wilhelm Tell. Er hatte sich die Erlaubnis dazu nicht eingeholt, denn die war ihm gar zu unsicher gewesen, weil sein Oheim, der Rektor Josua Hagemeister, lateinische Grammatiken und ähnliche Bücher lieber in seines Neffen Hand sah. Oh, diese bösen Lateinstunden, und daß es auch immer noch im Zeugnis stehen mußte, wie trübselig sie für Peter abliefen. In dieser sonnenheißen Nachmittagsstunde hatte Peter wieder alle Schulgedanken hübsch in der Mappe gelassen, und stieg in Lust und Leid mit seinem Helden in den Schweizer Bergen herum. Er hätte darum alle Ursache gehabt, sich fein still und bescheiden zu verhalten, doch dies vergaß er in seinem Ärger. Erst steckte er sich die Finger in die Ohren, doch die hellen Mädchenstimmen drangen auch durch diesen Verschluß, und zuletzt fuhr er wütend aus seinem Versteck heraus, schaute über die Mauer und schrie herausfordernd: »He, ihr da, wollt ihr vielleicht das Kapitol erretten?«
Unerhört, schändlich! Drei Herzschläge lang waren die Mädels sprachlos, dann gellte ein siebenfacher Entrüstungsschrei über den Liebfrauenplatz. Peter Hagemeister stimmte ein wildes Hohngelächter an, und je mehr er lachte, je entrüsteter schalten die sieben, bis Nettchen Dibelius ihre feine kleine Nase hochmütig in die Luft reckte und böse rief: »Bah, er ärgert sich nur, weil er beim Empfang nicht mit vorn stehen darf, aber das dürfen nur die Fleißigen, nicht wer sitzen geblieben ist!«
Das war ein schlimmes Widerwort. Keins hätte Peter Hagemeister schlimmer treffen können als dies, ihm stieg das Blut heiß ins Gesicht und er wurde so grob, daß sich selbst die freundliche Frau Busse in ihrer Staatsstube darob entsetzte. Obgleich Peter ihr besonderer Liebling war, öffnete sie doch geschwind ihr Fenster und mahnte: »Aber Peter, Peter, schäme dich doch!«
Doch der Gerufene hörte an der Mahnung vorbei und schalt weiter; er spielte förmlich Fangball mit bösen Worten und redete erbost von Putzaffen und Puten, aber die sieben Mädels verscheuchte er damit nicht, die wußten sich tapfer zu wehren, und es fielen ihnen allerlei Dinge ein, an die Peter nicht gern erinnert wurde.
Sieben Mädels gegen einen Jungen, leicht war das nicht.
Peter Hagemeister sah sich verstohlen nach Hilfe um, von seinen Freunden wohnten etliche in der Nähe, kam keiner über den Platz daher? Nicht Jochen Busse, nicht Ferdel Langmann, wo blieben die nur? Peter vergaß, daß er sie um des Tells willen schnöde im Stich gelassen hatte; immer ungeduldiger sah er nach ihnen aus.
Doch niemand und nichts ließ sich sehen, keine Bubenbeine trabten über den Platz, dagegen kamen die Mädchen dem Hause immer näher und näher. Wie zum Sturme rückten sie vor, schauten kampflustig drein, und Peter begann an einen Rückzug zu denken.
Erst pfiff er noch einmal, vielleicht hörten ihn die Kameraden doch noch, aber die mußten weit entfernt sein, kein Echo kam, und Lotte Langmann, die den Hilfepfiff wohl kannte, höhnte: »Er pfeift nach Hilfe, der mutige Römer.«
»Er pfeift, er will Hilfe haben!« wiederholten fünf Stimmen schadenfroh, nur Nettchen Dibelius rief nicht mit, ihr wurde der Streit zu laut und sie sagte einlenkend: »Laßt ihn doch, wir wollen gehen!«
Innen im Rektorhause klappte eine Tür, Peter hörte den dumpfen Fall, Stimmen tönten auf, und er erschrak; um diese Zeit pflegte sein Onkel auszugehen, wenn der ihn statt im Arbeitszimmer, hier im Streit mit der bösen Sieben traf. Nein, das wäre schlimm! Rasch noch ein letztes Wort, ein allerletztes, das sollte seine männliche Überlegenheit beweisen, und dieses Wort mußte Nettchen treffen, die ihn so bitter gekränkt hatte. Spöttisch, verächtlich rief er der zu: »Nettchen, mit dir wird sich der König wohl noch unterhalten, du – du – Mamsell Zieraffe du.« Noch hatte Nettchen Dibelius kaum das böse Wort verstanden, da war der Bösewicht auch schon jenseits der Mauer, im Pfeifenkrautwinkel verschwunden und nur die großen Blätter des Buschwerks zitterten leise.
»Er reißt aus, er reißt aus, er hat sich versteckt!« kreischten jenseits sechs Stimmen. Die siebente war verstummt. Nettchen war so tief erschrocken über den Zieraffen, daß sie wie erstarrt stand. Ihr Herz zitterte und Tränen traten ihr in die Augen; wie häßlich war doch dieser Streit, und dabei war doch eigentlich Peter Hagemeister ihr guter Freund, ihr bester Kamerad.
»Er reißt aus, er hat sich versteckt!« Die andern Mädels verstummten ganz und gar nicht, ihr Rufen wurde lauter, dringlicher, und Peter trampelte in seinem Versteck vor Ärger, er war gefangen, er konnte nicht mehr hinaus, denn durch den Garten kam wirklich sein gestrenger Oheim daher. Der ging langsam, die Hände auf dem Rücken, die hagere Gestalt steif aufgerichtet, wie das so seine Art war.
Peter seufzte tief; ihm lag Wilhelm Tell auf einmal so schwer wie ein Stein von Zwinguri auf dem Herzen. Denn um diese Stunde sollte er doch drinnen sitzen im kühlen kahlen Arbeitszimmer, das ihm immer wie eine Klosterzelle vorkam, und sollte versuchen, tief in die Geheimnisse der lateinischen Sprache einzudringen.
Und immer näher kam der Oheim. Wenn er auch langsam ging, der Garten war nicht so lang, wie ihn Peter sich in diesem Augenblick wünschte. Wenn draußen nur die schrecklichen Mädels ruhig gewesen wären, aber die wußten, daß er noch hinter der Mauer saß, und sie spotteten weiter, klinghell tönten ihre Stimmen: »Ausreißer, Ausreißer, er hat Angst vor uns!«
»Wer ist ein Ausreißer, wer hat Angst?« Der Herr Rektor Hagemeister öffnete die grüne Lattentür, die den Garten von der Straße schied, und seine Stimme dröhnte recht unvermutet in den lustigen Lärm hinein, »Wen nennt ihr Ausreißer?«
Lieber Himmel, der Herr Rektor selbst! Sechs Münder schlossen sich vor Schreck, und alle Mädels drängten sich auf ein Häuflein zusammen, nur Lotte Langmann, die allzeit zur Antwort Bereite, trat einen Schritt vor und wollte just etwas sagen, als Nettchen Dibelius sie heftig am Kleid zog. »Komm mit.«
Nettchen wandte sich zur Flucht, die anderen folgten, und sieben helle, große Sommervögel flatterten über den Liebfrauenplatz, und dann lag der auf einmal einsam in der Sonnenglut, und der Herr Rektor Hagemeister sah nicht minder überrascht drein wie drinnen Madame Busse in ihrer Staatsstube. So wild, nein, so wild waren wir damals nicht, dachte Madame Busse; sie treiben es heutzutage wirklich zu toll, und Nettchen Dibelius voran, unbegreiflich, ganz unbegreiflich!
Unbegreiflich, das war doch Nettchen Dibelius, dachte auch der Herr Rektor. Er schüttelte den Kopf, was sie nur vorhatten? Hm, hm! Er sah an seiner Gartenmauer entlang, die war wie sonst, und drinnen im Garten rührte und regte sich nichts. Der würdige Herr kehrte aber noch einmal um und rief in den Garten hinein: »Peter, Peter«, aber alles blieb still, kein Bubenbein, keine Bubennase war zu erblicken. Daß das Pfeifenkraut dicht und undurchdringlich, fast wie eine Dornröschenhecke, eine kleine Laube verbarg, das wußte der Rektor nicht, er wähnte darum seinen Neffen in der klosterstillen Arbeitsstube, und er ging beruhigt von dannen.
Peter in seinem Winkel hörte den verhallenden Schritt auf dem jetzt ganz stillen Platz und atmete befreit auf. Nun unternahm der Oheim seinen täglichen Spaziergang, also gab es eine ungestörte Stunde, und er holte das verborgene Buch wieder hervor, um eilfertig auf das Rütli zu laufen und den Schwur der Eidgenossen zu hören. Aber so geschwind ging diesmal die Reise aus dem Neustädter Rektorsgarten bis ins liebe Schweizerland nicht, fort und fort tönten ihm spottende, lachende Mädchenstimmen im Ohr. Die sieben waren Siegerinnen geblieben, das kränkte ihn bitter, aber am bittersten kränkte ihn doch das böse Wort vom Sitzenbleiben. »Ich zahl's ihr heim,« brummte Peter, »warte nur, Nettchen, jetzt bin ich dein Feind.«
Und während Peter schmollte und grollte, lief Nettchen Dibelius mit flinken Füßen die schmalen Gäßlein entlang, die den Liebfrauenplatz von dem Marktplatz trennten. Denn ihr war es eingefallen, daß die Großmutter sie erwartete. Sie ahnte nichts von der bitteren Feindschaft, die Peter ihr angelobt; kaum war der Streit verklungen, da hatte sie ihn auch schon wieder vergessen und in ihrem Herzen bimmelten unablässig die lustigen Freudenglocken: »Der König kommt, der König kommt!«
2. Kapitel Festliche Vorbereitungen
Warum Friedhold Gottlieb Sünder wünscht, der König möchte Wilhelm heißen. Mamsell Dibelius erzählt von anderen Königstagen, und Martine muß ihr Kupfer putzen. Nettchen nennt Wilhelm Tell einen dummen Jungen und zählt die Rosen in ihrem Garten.
Nettchens Großeltern wohnten am Markt. In dem stattlichen alten Haus, das ein wenig hochmütig seine kurzen, kleinen Nachbarn überragte, hatte die Familie Dibelius schon seit etwa hundert Jahren ihr Heim aufgeschlagen, und seitdem hatte auch immer ein Dibelius eine hervorragende Stelle in der Stadt bekleidet. Wenn jetzt der alte Justizrat Heinrich Dibelius von seinem Arbeitszimmer aus über den Marktplatz blickte, dann dachte er manchmal daran, daß da draußen einst sein Großvater den alten Fritz, den großen König, begrüßt hatte, und er streichelte wohl ehrfürchtig die Schnupftabaksdose, die der König einst dem Großvater geschenkt. Und er selbst hatte als junger Bursche seinen Vater da draußen vor König Friedrich Wilhelm III. stehen sehen, er freilich hatte nur Augen gehabt für die holdseligste aller Königinnen, Luise.
Von den Königsbesuchen vergangener Zeiten redeten die alte Justizrätin Dibelius und ihre Schwägerin Malve, just als Nettchen eiligst dahergelaufen kam. Die Frauen standen vor dem Hause, neben ihnen ein schmächtiger älterer Mann, der ein langes Kranzgewinde in den Händen hielt. »O, Sünderchen, liebes Sünderchen,« rief Nettchen jauchzend, »wird schon geschmückt?«
»Freilich, freilich,« antwortete Tante Malve, des Justizrats unverheiratete Schwester, ein wenig spöttisch; »wenn du nicht bald gekommen wärst, hätte Sünderchen schon das ganze Haus von oben bis unten behangen, Schornstein und Keller, alles.«
»Mamsell Dibelius spaßt mal wieder,« sagte der Schreiber Sünder behaglich. Der hatte das allersanfteste, allergutmütigste Gesicht von der Welt, und sein Vater hatte dies wohl einst vorausgesehn, als er ihm in der Taufe die Namen Friedhold Gottlieb gab. Holder dem Frieden und Gott liebender waren wenige als Sünder. Doch wie es so geht, mit den schönen frommen Namen wurde er nicht genannt, er hieß Sünder und blieb Sünder, nur die Kinder, die in dem Hause Dibelius heranwuchsen, hingen wohl zärtlich die Silbe »chen« an den schlimmen Namen. Damit zeigten sie gleich, du gehörst zu uns, und wirklich gehörte auch Friedhold Gottlieb Sünder in das Dibeliushaus seit der Zeit, da er als Schreiberlehrling das erstemal die Kanzlei betreten hatte. Er hatte Heimatrechte, Familienrechte darin, er gehörte zu der Familie Dibelius in Leid und Freuden.
Auch an der Freude des Königsbesuches nahm Sünder darum teil wie nur einer, und die Justizrätin erklärte Nettchen den Zweck des grünen Kranzgewindes. »Sünderchen will ein F. W. winden, das soll über der Haustür angebracht werden.«
»Vorläufig sieht das F. freilich wie ein Regenwurm aus bei Sonnenschein,« redete Fräulein Malve dazwischen.
»Oh, Mamsell Dibelius,« rief der alte Schreiber ein wenig betrübt, »so ein F. W. ist keine kleine Sache, aber für einen Regenwurm wird es unser allergnädigster König schon nicht halten. Ein W. allein wäre freilich leichter, schade, ewig schade, daß unser König nicht Wilhelm heißt.«
»Oder Otto, dann macht man einen länglichen Kranz und ist fertig,« spottete Fräulein Malve, »ja, die Namen, man gibt sie sich nicht, Sünder.«
»Da haben Sie recht, Mamsell Dibelius. Aber manchmal stimmt's auch, wie zum Beispiel bei Malve, was ein feiner sanfter Blumenname ist.« Der Schreiber schmunzelte vergnügt dabei, und das alte Fräulein wurde ein wenig verlegen, ein scharfes Wort kam ihr auf die Zunge, sie unterdrückte es aber und sagte heiter: »Sie sind ein Schelm, Sünder, und ein Dichter dazu, der gleich eine Blumenähnlichkeit findet, wo keine ist. Ich will aber versuchen, auch das F. mit verklärten Augen anzusehen und den Regenwurm vergessen.«
Die Justizrätin lachte. Zwischen ihrer Schwägerin und dem alten Nothelfer des Hauses gab es immer mal einen kleinen Streit, die hatten sich schon gestritten, als sie noch Spielkameraden gewesen waren, aber dabei waren sie im Grunde die allerbesten Freunde. Sie sagte: »Die Buchstaben und alles andere wird schon gut werden, und wenn's unser König so freundlich ansieht wie dazumal seine Eltern, können wir zufrieden sein.«
»Ja, ja,« bemerkte Sünder, »unsere Königin Luise selig sah aus wie'n leibhaftiger Sommertag. Wie schön die war, das werde ich nie vergessen.«
»Großmutter,« bat Nettchen, sich an die stattliche Frau anhuschelnd, »erzähle, wie's war, als der König kam.«
»Kind, das hast du doch schon oft genug gehört. Du denkst viel zu viel an den Königstag, du wirst vor lauter Aufregung noch krank werden und im Bett liegen müssen.«
»Oder du fällst die Treppe hinunter wie ich damals,« rief Tante Malve. »Das war eine schlimme Geschichte, ein Loch hatte ich im Kopf wie ein Gänseei groß, und Schelte habe ich bekommen, daß ich vier Wochen genug davon hatte; eingesperrt wurde ich obendrein.«
»Tante,« schrie Nettchen aufgeregt, in nachträglichem heißen Mitgefühl, »dann hast du wohl den König und die Königin gar nicht gesehen?«
»Doch, die habe ich gesehen, alle beide, und so deutlich und gut, daß es mir ist, als wäre es gestern gewesen.« Mamsell Malve lachte behaglich und nickte dem alten Schreiber zu. »Da war einer im Hause,« erzählte sie weiter, »der schloß mir heimlich die Türen auf, und dann habe ich unten gestanden und mitgesungen und mitgejauchzt, als hätte ich kein Loch im Kopf. Freilich, freilich, ohne den heimlichen Helfer hätte ich oben in der einsamen Bodenkammer sitzen müssen, und ich hätte vom Königsbesuch so wenig gehabt, wie die Großtante Ulricke-Sophie, als der alte Fritz hier durchkam.«
Ein Bild der Urgroßtante Ulricke-Sophie hing oben in der Staatsstube des alten Hauses, darauf sah die Tante sehr streng und feierlich drein, Nettchen hätte ihr nie einen übermütigen Streich zugetraut, und etwas zögernd fragte sie: »Ist die Urgroßtante auch die Treppe hinuntergefallen?«
»Bewahre, die hat's noch gescheiter gemacht. Zu fünf sind sie damals drüben in den Marktbrunnen gepurzelt, klitsch, klatsch, da lagen sie drin, und als sie wieder herauskamen und etwas sehen konnten, da war nichts mehr zu sehen. Der große König hatte den Vorhang in seinem Wagen zugezogen und fuhr davon, und die Tante Ulricke-Sophie hat nie in ihrem Leben einen König zu sehen bekommen.«
Nettchen lachte, es kam ihr zu wunderlich vor, daß die strengblickende feierliche Tante einstmals im Marktbrunnen gelegen hatte, sie versicherte fröhlich: »Ich falle nicht hinein, Tante Malve, bestimmt nicht.«
»Das kann vorher jeder sagen, und nachher liegt er drin.« Mamsell Dibelius wickelte sich fester in ihr großes weißes Umschlagtuch, das mit einer breiten bunten Kante verbrämt war. Langsam ging sie vor dem Hause auf und ab und weissagte ernsthaft: »Es gibt Regen, sicher gibt es Regen oder Sturm oder Hagel –«
»Oder Betteljungen fallen vom Himmel herunter,« rief die Justizrätin halb lachend, halb ärgerlich, »es wird schönes Wetter, Königswetter, verdirb doch dem Kind die Freude nicht.«