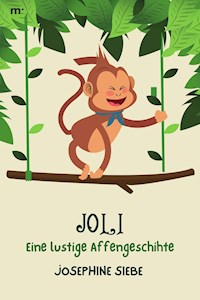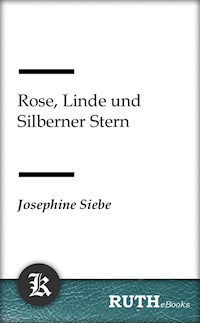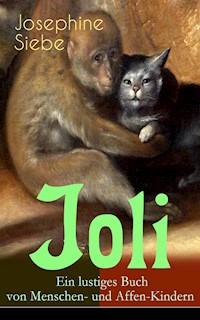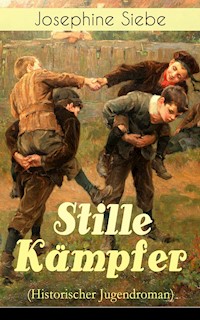
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Stille Kämpfer (Historischer Jugendroman)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Josephine Siebe (1870-1941) war eine deutsche Redakteurin und Kinderbuchautorin. Sie verfasste zwischen 1900 und 1940 fast 70 Bücher für Kinder und heranwachsende Mädchen, daneben eine Vielzahl von Beiträgen in Jahres- und Sammelbänden. Aus dem Buch: "Es war ein Frühsommertag. In ewig junger Schönheit hatte die Erde sich geschmückt. Michael Wisniewski, der seit wenigen Tagen aus dem Priesterseminar zu den Ferien heimgekehrt war, genoß mit frohem Herzen den Reiz der heimatlichen Erde. Wohl hatte er gelesen, daß es fremde Länder, andere Gegenden gäbe, die herrlicher anzuschauen wären; vielleicht wie das arme Aschenbrödel gegen juwelengeschmückte Königstöchter, verglich er, sich eines deutschen Märchens erinnernd, welches seine Mutter ihm einst erzählt hatte. Trotzdem aber dünkte ihm dies Stück flachen Landes schön, wie kein anderes, und in vollen Zügen atmete er die warme Sommerluft ein. Am Morgen hatte er in des Propstes Studierstube gestanden und den Worten des geistlichen Freundes gelauscht. In dem kühlen Zimmer mit den langen Bücherreihen an der Wand, die dem blöden Dorfjungen einst so gewaltigen Respekt eingeflößt hatten, bis sie ihre goldene Weisheit auch vor ihm aufthaten und er die stummen Freunde lieb gewann."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stille Kämpfer (Historischer Jugendroman)
Inhaltsverzeichnis
Weit hin dehnt sich das Land, kein Hügel, keine Berge hemmen den Blick. Wogende Felder, grüne Wiesen, Seen, die wie flüssiges Silber blinken und hin und wieder ein Stück Wald, darin die weißen Stämme der schlanken Birken hell hervorleuchten und das alles überspannt vom tiefblauen Himmel, überflutet von heißem Sonnenglanz.
Auf den Feldern sind die Leute beschäftigt, den goldenen Segen einzuernten. Der Vogt steht dabei und versucht die Leute mit kräftigen Fluchworten zu schnellerer Arbeit anzuspornen; nur manchmal hält er inne, um einen Schluck aus seiner Wudkiflasche zur Stärkung zu nehmen.
Wie Feuer durchrieselt es ihn, immer sengender wird die Glut, nirgends kühler Schatten, es flimmert und flirrt, tanzt und schwankt um ihn her. Immer kleiner werden die schwarzen Mongolenaugen, matter die Flüche von seinen Lippen, schließlich läßt er sich auf einem Feldsteine am Wege nieder, blinzelt noch ab und zu nach den Leuten hinüber, dann sinkt der Kopf tief auf die Brust und regelmäßige Atemzüge verraten bald den Schlaf des treuen Wächters.
»Er schläft,« raunen sich die Arbeiter zu und aufatmend lassen sie die Sensen sinken, die Frauen hören mit dem Zusammenbinden der Garben auf und beginnen halblaut mit einander zu schwatzen. —
Auf dem Wege, der dicht an dem Felde vorüber führt, kommt ein Mann daher in langsamen, gleichmäßigen Schritten, wie einer, dem es nicht sonderlich eilt. Es ist eine hohe Gestalt mit langherabwallendem, blonden Bart und kühn geschnittenem Gesicht. Seine einfache dunkle Kleidung verleiht ihm beinahe das Aussehen eines Priesters.
»Gebenedeit sei der Herr Jesus Christus!« grüßt er laut, als er den Schnittern nahe ist.
Die Mädchen kichern und die Männer wenden sich verdrossen ab, nur ein alter Mann erwidert mürrisch den Gruß und sagt:
»Von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen!«
Der Vogt, der von dem Schalle der Stimmen erwacht ist, fährt scheltend empor.
»Stört der Ketzer, der Tagedieb uns noch in der Arbeit?« dann folgt dem ruhig Weiterschreitenden eine Flut von Schimpfworten nach, vermischt mit dem schadenfrohen Lachen der anderen.
Der Gehöhnte findet kein Wort der Erwiderung, aber in seinem Gesicht liegt der Ausdruck tiefer Bitterkeit und seine grauen Augen streifen mit wehmütigem Blick die schimmernde Welt um ihn her.
»Immer das alte Lied,« murmelte er. »Haß und Mißgunst auf jedem Schritt,« und dann hebt er plötzlich mit bittender Geberde die Arme zum Himmel empor:
»Oh, mein Gott, hilf mir zum Frieden, gieb mir die Kraft dazu, den Kampf zu bestehen!« Wie eine Bitte und Forderung zugleich, ringen sich die Worte von seinen Lippen.
Vor dem Wanderer taucht endlich ein Dorf auf, kleine mit Stroh gedeckte Hütten, hin und wieder ein Haus aus roten Ziegeln, aber nirgends ein Gärtchen davor, selten nur als Schmuck eine Staude leuchtender Sonnenblumen oder bunter Malven. Hinter den erblindeten Fenstern kein Vorhang, höchstens ein Rosmarintopf.
Die Straße, die das Dorf durchschneidet, zeigt Wellenlinien, tief ausgefahrene Gleise, ab und zu ein großer Stein darin, den aus dem Wege zu schaffen, sich niemand die Mühe nimmt. — Gänse und kleine Kinder vollführen einen hellen Lärm, Schmutz, wohin man sieht, aber alles überflutet von der leuchtenden Sonne.
Vor seinem Hause sitzt Wolf Schmul; ein Schild über der Thür verkündet, daß es hier Schnaps, Bier, Seife, Zwirn, Zucker, Heringe und dergleichen mehr zu kaufen giebt. Er dreht die Daumen und rechnet, den Gruß des vorübergehenden Mannes erwidert er durch ein verstohlenes Nicken.
»Der Michael Wisniewski braucht nichts von ihm, warum soll er, Wolf Schmul, da höflich sein? Aber unhöflich auch nicht, denn der Michael könnte doch einmal mit ihm ein Geschäft machen,« darum erwidert er seinen Gruß, es sieht's ja keiner.
In dem Pfarrhause sind die grünen Fensterläden geschlossen, der Wanderer zögert, wirft einen halb sehnsüchtigen, halb trotzigen Blick hinüber, dann geht er weiter. Hinter ihm tönt das Gejohle der Kinder und in angemessener Entfernung folgt ihm die kleine Herde nach.
Endlich sein Heim, er atmet auf!
Von einem Garten umgeben, in dem es blüht in allen Farben, steht ein kleines, rotes Ziegelhaus, das sich von den anderen nur dadurch unterscheidet, daß hier spiegelnde Sauberkeit herrscht. Die Thür schließt sich hinter ihm, aber noch immer ertönt von draußen Geschrei, und häßliche Schimpfworte fliegen ihm nach, bis eine mächtige Dogge aus dem Hause tritt und ihr tiefes, zorniges Gebell die Kinderschar von dannen scheucht.
Der Mann ist über den halbdunklen Flur geschritten und betritt ein großes Zimmer, das behaglich eingerichtet, nicht den Eindruck einer Bauernstube macht. Er läßt sich auf einer Bank am Ofen nieder, seine Züge sprechen von seelischer Ermüdung und wie er so vor sich niederstarrt, graben sich die Falten auf seiner Stirn immer tiefer ein.
Da wird draußen auf den Fliesen des Flures ein schlürfender Schritt hörbar, die Thür des Zimmers öffnet sich und ein Mann tritt herein; der Kopf eines Fanatikers auf einem kleinen, verwachsenen Körper. Er schreitet auf den am Ofen Sitzenden zu und legt seine Hand auf dessen Schulter.
»Michael, Michael!« Dieser sieht auf mit leerem, trostlosem Blick.
»Benjamin, hast Du es wieder gehört, wie sie mich verfolgten, wie sie mich höhnten, mich, den Ketzer, den Ausgestoßenen?«
»Ha, ha!« mit schrillem Lachen sprang er auf, »lache doch mit, Benjamin, lache doch über mich Thoren, der hier sitzt in der alten Heimat, der um sie wirbt, wie um eine spröde Schöne. Lache doch mit mir, Benjamin, über diese Thorheit, über meinen Wahnwitz, daß ich mir einbilde, ich könne den Leuten hier helfen, sie herausholen aus diesem Dunst von Aberglauben, Dummheit und Branntwein. Ein Prophet wollte ich ihnen sein, wollte ihnen den Bann zeigen, in dem sie leben, wollte sie los lösen aus — — ach, was wollte ich nicht alles und was habe ich erreicht? Was bin ich ihnen? Ein Ketzer, ein Fremdling in der Heimat, ein Thor, ein rechter Thor,« und er sank wieder auf die Bank und barg das blonde Haupt in den Händen.
»Fort möchte ich, fort zu dem stillen Frieden des Sanddorfes hinauf, zu Tabea zurück,« stöhnte Michael.
Es schien, als wachse die Gestalt des Kleinen, ein Ausdruck finsteren Hasses trat in sein Gesicht, die Augen wurden fast schwarz vor Erregung.
»Fort willst Du, Michael, das begonnene Werk feige im Stich lassen? Du, ein Auserwählter, reut Dich so schnell der geleistete Schwur? Wehe Dir, Michael, wenn Du auf halbem Wege umkehrst!« Seine schmale, knöcherne Hand faßte mit eisernem Druck die Schultern des anderen und schüttelte ihn:
»Hörst Du, Michael, Du darfst nicht umkehren, darfst dem großen Werke nicht untreu werden!«
Langsam glitten die Hände von dem Gesicht Michaels und mit finsterem Blick streifte er den Kleinen. Ein leiser Schauer lief durch seine Glieder.
»Denkst Du nicht daran, Benjamin, was Vater Abraham sagte von der Duldung des einen gegen den anderen?«
Dieser schüttelte das Haupt und sagte:
»Vater Abraham ist ein alter Mann, wir sind jung; als ich draußen in der Welt war, habe ich Spott und Hohn erdulden müssen um meines Bekenntnisses willen. Da habe ich gelernt, daß nicht die Duldung zum Ziele führt, nein, der Kampf allein, und ich will kämpfen für meinen Glauben! Nicht weltfern und verspottet will ich leben, frei vor den Menschen unsere Lehre bekennen; wie eine Flut, die alles mit sich reißt, soll sie die Welt überströmen. Wir dürfen nicht nachlassen, weiter, immer weiter vorwärts schreiten und Du mußt mit, es giebt kein Zurück, Du mußt Dein Wort halten, hörst Du es!«
Beinahe schreiend stieß der Kleine die letzten Worte hervor, wie eiserne Klammern gruben sich seine Finger in den Arm des anderen, der diesen leidenschaftlichen Ausbruch stumm über sich ergehen ließ.
Seine Augen schweiften mit traurigem Ausdruck nach der Ecke des Zimmers. Dort erhob sich, ein seltener Schmuck in einem Bauernhause, in weißer, reiner Schönheit eine Kopie von Thorwalsens unvergleichlicher Christusstatue. Ging's nicht wie ein Hauch seelischen Friedens von der weißen Gestalt aus? Sehnend streckte Michael seine Arme darnach hin, da traf Benjamins Blick mit dem seinen zusammen und dieser sagte, den Freund verstehend, mit schwankender Stimme:
»Wir müssen doch kämpfen, Michael, wenn wir siegen wollen.«
Michael Wisniewski war ein Kind des Dorfes, sein Vater Vogt bei Herrn von Leninski auf Lochowo. Seine Mutter entstammte einer deutschen Familie, sie hatte lange Jahre bei einem reichen alten Fräulein in der Kreisstadt gedient, die ihr, wie ihr Mann oft sagte, nur Raupen in den Kopf gesetzt hatte. Sie hatte von ihrer Herrin vieles gelernt, vieles, was in ihrem Heimatsdorfe wenig Verständnis fand. Nach dem Tode ihrer Gönnerin kam sie auf das Gut zu Herrn von Leninski und heiratete dort bald darauf den Vogt, einen äußerlich stattlichen Mann.
Die stille, sinnige Frau litt schwer unter der rohen Herrschsucht ihres Gatten, der sich bald nach ihrer Verheiratung dem Trunke ergab.
Es waren wüste Scenen, die Michael aus seiner Kindheit in der Erinnerung geblieben. Polternd und fluchend kam der Vater oft heim und es geschah nicht selten, daß er sich dann an Weib und Kind vergriff. Schweigend ertrug die Mutter alles, sie fand nie ein Wort der Erwiderung auf die rohen Schimpfreden des Mannes. Michael erinnerte sich, wie sie sich nach solchen Auftritten oft mit ihm in eine Ecke geflüchtet hatte und wie dann die heißen Mutterthränen sein Haupt überströmten. —
Eines Tages fand man sie bewußtlos am Boden liegend, schreiend warf sich der Knabe über sie und versuchte, sie durch Liebkosungen zu erwecken. Noch einmal schlug sie die scheuen Dulderaugen auf und »Friede, ach Friede, der Propst soll kommen,« murmelten die Lippen und ihr Kind traf ein Blick so herzzerreißend in seinem Jammer, seiner Liebe, daß er sich dem Knaben unvergeßlich einprägte; dann ging ein Recken durch den Körper und sie war tot.
Aus der Schenke holten sie den Mann, der fluchend sein Weib noch im Tode schmähte, bis er endlich einschlief. Neben der toten Mutter und dem seinen Rausch ausschlafenden Vater saß der Knabe und hielt Totenwache und grübelte über die letzten Worte der Mutter nach, bis sich ihm eine Hand auf die Schulter legte und eine ernstfreundliche Stimme sprach: »Armes, armes Kind!«
Der Knabe sah auf und blickte in das Gesicht des Propstes Ryback, dem Geistlichen des Dorfes, in dessen Zügen ein eigener, liebevoller Ausdruck lag. Da vergaß Michael die ehrfürchtige Scheu, die er stets vor dem Geistlichen gehegt; er legte seinen Kopf an dessen Brust und weinte seinen heißen, jungen Schmerz an dem Herzen des Priesters aus.
»Ich habe Deiner Mutter gelobt, Dich zu hüten, für Dich zu sorgen,« sagte der geistliche Herr, mit der Hand das Haupt des schluchzenden Knaben streichelnd. »Vertraue mir, ich verlasse Dich nicht, und der Segen Deiner Mutter ist mit Dir.«
Von jener Stunde an war Michael der Schützling des Propstes, sein Vater hatte schnell eingewilligt, daß dieser die Erziehung des Knaben leiten sollte. Sonderbarer Weise ging der Vogt seinem Sohne aus dem Wege und es kam nicht mehr vor, daß er sich an dem Jungen vergriff.
Schon da die Mutter noch am Leben war, hatte Michael wenig mit den anderen Knaben verkehrt, nun er aber der Schützling des Propstes geworden, nahm er eine ganz besondere Stellung im Dorfe ein.
»Er wird ein Propst«, dies Wort gab ihm einen höheren Rang vor den anderen, es schützte ihn, isolierte ihn aber auch. Das kleine, verwaiste, sich nach Liebe sehnende Herz des Knaben schloß sich nun ganz in schrankenloser Hingabe seinem Lehrer an, und es war, als würde auch der Propst in Gegenwart des Knaben ein anderer.
Kalt und streng, beinahe nie ein Lächeln auf dem schmalen, scharf geschnittenen Gesicht seiner Gemeinde gegenüber, war er für Michael immer ein gütiger, teilnehmender Freund.
Nichts gab es auch, das dieser dem vergötterten Lehrer verschwieg, und freundlich mußte er oft der großen Liebe und Anbetung des Knaben steuern.
Brennend war Michaels Wunsch, dereinst auch ein Priester zu werden, ihm war es Gewißheit, daß die letzten Worte der sterbenden Mutter denselben Wunsch bedeuteten.
Seltsam, der Propst sträubte sich anfangs dagegen, aber da er sah, wie der heranwachsende Knabe keinen anderen Wunsch hegte, gab er nach und bereitete ihn für das Priesterseminar vor, auf das er ihn nach einigen Jahren brachte. Einsam blieb Michael auch dort, ein Fremdling unter seinen Genossen, dabei einer der fleißigsten Schüler, nur von dem Gedanken erfüllt, seinem väterlichen Freund durch treueste Pflichterfüllung zu danken.
Es war ein Frühsommertag. In ewig junger Schönheit hatte die Erde sich geschmückt. Michael Wisniewski, der seit wenigen Tagen aus dem Priesterseminar zu den Ferien heimgekehrt war, genoß mit frohem Herzen den Reiz der heimatlichen Erde. Wohl hatte er gelesen, daß es fremde Länder, andere Gegenden gäbe, die herrlicher anzuschauen wären; vielleicht wie das arme Aschenbrödel gegen juwelengeschmückte Königstöchter, verglich er, sich eines deutschen Märchens erinnernd, welches seine Mutter ihm einst erzählt hatte. Trotzdem aber dünkte ihm dies Stück flachen Landes schön, wie kein anderes, und in vollen Zügen atmete er die warme Sommerluft ein.
Am Morgen hatte er in des Propstes Studierstube gestanden und den Worten des geistlichen Freundes gelauscht. In dem kühlen Zimmer mit den langen Bücherreihen an der Wand, die dem blöden Dorfjungen einst so gewaltigen Respekt eingeflößt hatten, bis sie ihre goldene Weisheit auch vor ihm aufthaten und er die stummen Freunde lieb gewann.
Noch klangen ihm die Worte des Priesters im Ohr:
»Überlege reiflich, mein Sohn, es ist ein schöner, aber auch ein schwerer Beruf, den Du erstrebst. Fesselt Dich kein Gedanke, kein Wunsch ans Weltliche? Kannst Du ein Priester sein aus innerem Herzensdrang, wohl Dir, aber wehe, Michael, wenn Du das Gelübde, das Heilige, verletzt! — Nur noch kurze Zeit, dann sollst Du die Weihe empfangen, darum prüfe Dich selbst. Gehe in Deine stille Kammer oder gehe hinaus in die herrliche, freie Gottesnatur, erforsche und erfrage Dein Herz, ob es nichts in der Welt giebt, das Dir begehrenswerter dünkt, ob es voll und ganz Deinem künftigen Berufe gehört?«
Michael that, wie der Priester ihm geraten. Er fand aber keinen Gedanken, der ihn von der heiligen Weihe zurückhalten konnte. Vor dem Muttergottesbilde, das am Wege stand, lag er auf den Knieen und betete in heißer Inbrunst, bis der Abend herniedersank. Dann schlug er den Weg nach dem Dorfe wieder ein. Die Seele war ihm erfüllt von heiligen Schauern, aber mit leuchtenden Augen, wie ein Sieger, schritt er dahin.
Tief senkte sich die Dämmerung schon nieder, als er die Dorfstraße erreichte. Vor den niedrigen Hütten saßen die Frauen schwatzend beisammen; in einer großen Pfütze mitten auf der Straße patschten die nur halb bekleideten Kinder umher, und ihr Lachen und Schreien erfüllte die Luft.
Aus dem Kruge aber drang wüster Lärm, und Michael hastete, schnell daran vorbeizukommen, ihm war in seiner weihevollen Stimmung mehr denn je das tierische Brüllen der Betrunkenen zuwider.
Zwei Männer kamen gerade über die ausgetretene Schwelle des Wirtshauses gestolpert, und mit jähem Schreck erkannte Michael in dem einen seinen Vater. Auch der Betrunkene hatte ihn bemerkt und lallte:
»Michael, Goldsohn! kommst gerade recht, wir haben auf den künftigen, gnädigen Herrn Propst getrunken.« Dabei machte er eine Bewegung, als wolle er des Sohnes Rock küssen, verlor aber das Gleichgewicht und taumelte ihm in die Arme. Sein heißer, nach Fusel riechender Atem schlug demselben ins Gesicht. Blitzschnell tauchte da ein Bild vor des Sohnes Augen auf, die Mutter klaglos des Vaters Mißhandlungen erduldend.
Zorn und Ekel stiegen siedend heiß in ihm auf, es flimmerte vor seinen Augen; dieser Niederschlag war zu plötzlich auf die Hochflut seiner Gefühle gekommen.
»Weg,« keuchte er, dem Trunkenen einen Stoß versetzend, daß er rücklings zu Boden fiel.
Michael achtete nicht darauf, er eilte davon, denselben Weg, den er gekommen war, bis er wieder vor dem Muttergottesbilde anlangte und hier bitterlich weinend niedersank. Er umklammerte das hölzerne Bildwerk und flehte und klagte, warum, er wußte es selbst kaum, ihm war nur, als müßte er sich retten vor dem Schmutz, den er soeben geschaut.
Wie lange er so gelegen, er wußte es nicht, mit schmerzender Stirn erhob er sich endlich und schlug langsam, mit schweren Schritten, den Weg nach dem Dorfe wieder ein.
Je näher er dem Vaterhause kam, desto schwerer erfaßte ein unnennbares Angstgefühl seine Seele. Es war eine klare Mondscheinnacht und in dem zitternden, silbernen Licht lag der Weg hell vor ihm, und in diesem weißen Licht konnte er deutlich sehen, daß Menschen vor dem kleinen Hause standen. Als er näher kam, sah er auch, wie sie vor ihm zurückwichen, die Weiber sich bekreuzigten und die Männer ihn mit finsteren Blicken maßen. Es hätte kaum der rötlich brennenden Wachskerzen bedurft, das Mondlicht zeigte es ihm schon; da drinnen in der Stube das Lager, auf diesem der Mann, den er Vater nannte, die Hände über der Brust zusammengefaltet, die Augen offen, mit stierem Blick auf den Sohn gerichtet, die starre Ruhe des Todes über der Gestalt.
Ein einziger Laut kam über die Lippen des Jünglings, ein Schrei voll namenloser Qual. Eine Weile noch stand er, mit entsetztem Blicke nach dem Toten starrend, dann brach er zusammen; ob er es wohl noch hörte, wie die alte Anuszka aufkreischte:
»Heilige Jungfrau! stehe mir bei, da ist der Mörder!« —
»Der Woiciech Wisniewski ist am Herzschlag gestorben,« erklärte der dicke Kreisphysikus, der am anderen Tage so gegen Mittag ankam; früher zu kommen war ihm nicht möglich gewesen.