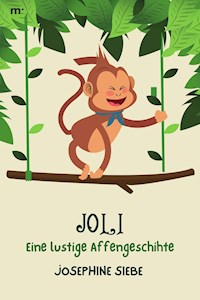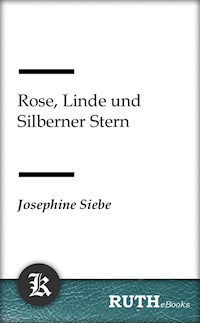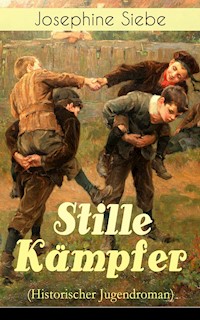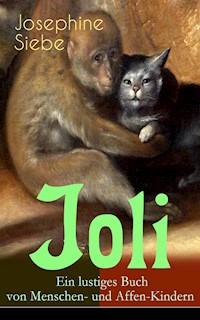Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Kleinstadtkinder: Buben & Mädelgeschichten" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "In jener Zeit nun, so berichtete die Sage, hätten die Bürger einen großen Schatz vergraben, viel Geld, edle Steine und silberne und goldene Prunkgefäße. Die aber, die den Schatz vergraben hatten, wurden nachher, als die Feinde die Stadt einnahmen, getötet, und darum wußte später niemand mehr, wo eigentlich der Schatz vergraben lag. Von diesem Schatz nun wurde in Neustadt in den Zeiten, die kamen und gingen, viel gesprochen. Die Geschichte von dem Schatz wurde zu einem Märchen, das den Kindern erzählt wurde, und mancher Bube dachte wohl, wenn ich groß bin, suche ich den Schatz; wuchs er heran, dann vergaß er gewöhnlich sein Vorhaben." Josephine Siebe (1870-1941) war eine deutsche Redakteurin und Kinderbuchautorin. Sie verfasste zwischen 1900 und 1940 fast 70 Bücher für Kinder und heranwachsende Mädchen, daneben eine Vielzahl von Beiträgen in Jahres- und Sammelbänden. Inhalt: Ankunft in Neustadt Die fünf Schatzgräber Gertrudis. Eine Geschichte aus alten Zeiten Weihnachtsaugen Ein Fastnachtsspiel Durch der Schneekönigin Reich Osterwasser Der goldene Groschen In der fröhlichen Einkehr Christoffel will ein König werden! Mohrchen O diese Bäckerbuben Die Schatzgräber finden einen Schatz Eine Geschichte, die traurig anfängt und fröhlich endet
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kleinstadtkinder: Buben & Mädelgeschichten
Inhaltsverzeichnis
Ankunft in Neustadt.
„Neustadt,“ schrie der Schaffner und lief den Zug entlang; „Neustadt, ausstei...gen!“
Einige Passagiere guckten zu den Kupeefenstern heraus. „So’n Nest,“ sagte der eine, und ein anderer gähnte, während ein dritter rief: „Fenster zu! S’ist ja so kalt!“
„Neustadt, abfahren,“ schrie der Schaffner noch einmal. „Es steigt doch niemand aus, hier steigt nie jemand aus,“ dachte er.
Aber da — schon pfiff die Lokomotive — da wurde noch hastig eine Kupeetüre geöffnet, ein Fuß wurde sichtbar, eine braune Ledertasche und — platsch lag mit Koffer und Plaid ein nicht zu großer, nicht zu kleiner, nicht zu dicker und nicht zu dünner Herr, so lang er war, auf dem Bahnhof.
„Na, der hat’s aber eilig, hat wohl geschlafen,“ murmelte der Schaffner und sprang rasch auf, denn der Zug setzte sich pustend in Bewegung.
Zwei Bahnbeamte eilten herbei und halfen dem Herrn wieder auf die Beine, gebrochen hatte der sich glücklicherweise nichts. Er brummelte etwas von gefrorenen Stufen, ausgerutscht sein, und braun und blau geschlagen, dann nahm er seine Sachen, dankte höflich und verließ den Bahnhof.
„Da wäre ich,“ dachte er, „eine nette Ankunft in dem Nest, wie konnte ich auch nur so fest einschlafen, beinahe hätte ich Neustadt verschlafen, brrrrrr, wird gewiß ein erzlangweiliges Nest sein.“
Er trat aus dem Bahnhofsgebäude heraus, ging über einen kleinen, von Bäumen umstandenen Platz, und gelangte an eine Straße, die etwas bergab führte; hier sah er plötzlich das Städtchen mit all seinen Häusern und Türmen und seinem Hintergrund von bewaldeten Höhen liegen. Der Fremde vergaß über diesem Anblick seinen Fall auf dem Bahnhof, und sein vorhin so mißmutiges Gesicht hellte sich auf. Ja, dies war aber auch schon ein Anblick, der sich lohnte. In der geräuschvollen Großstadt, aus der der Fremde kam, sah man selten so eine weiße, schimmernde Winterpracht. Dort fiel der Schnee schon grau vom Himmel, und nach wenigen Stunden war er eine breiige, schmutzige Masse. Hier aber war das ganze Städtlein in ein weißes Feierkleid gehüllt. Die Türme von St. Marien ragten steil und schlank in die Luft, wie Königstöchter sahen sie aus im Schmuck weißer Hermelinmäntel, und nicht weit davon erhob sich der dicke, runde Schloßturm mit weißer Kappe, behäbig wie ein biederer Bäckermeister schaute er drein. Und das Schloß selbst auf der Höhe mit seinen vielen kleinen Fenstern und seinen altersgrauen Mauern war überzuckert von oben bis unten, es glich einer guten Gluckhenne, und all die überschneiten Häuser und Häuschen waren ihre Küchlein. Im Rauhreif standen Büsche und Bäume, und die Sonne, die gerade noch einen Abschiedsblick auf das Städtchen warf, ehe sie in ihr Wolkenbett rutschte, überstrahlte alles mit einem zarten Rosenschimmer. Die fernen Berge verschwanden schon in blaugrauem Dunst, als wollten sie sagen: „Schau dir nur erst das Städtchen an, es lohnt sich schon, zu uns kommst du später.“
„Ja, du lieber Himmel, es lohnt sich wirklich,“ dachte Doktor Theobald Fröhlich; er guckte rechts und links und gerade aus und meinte, er könnte sich nicht satt sehen an dem hübschen Stadtbild. Und dies kleine Städtchen sollte nun für immer seine Heimat werden, das erschien ihm auf einmal gar nicht mehr so schrecklich.
Während so der Doktor Theobald Fröhlich oben am Bahnhofsplatz stand und Neustadt bewunderte, stand unten in der Stadt vor der Türe eines stattlichen, altmodischen Hauses eine alte Frau. Sie hatte ihre Hände fest in ihre Schürze eingewickelt und guckte eifrig geradeaus, denn wer vom Bahnhof kam, mußte die Straße herunterkommen, an deren Ende das Haus lag. Die Straßen von Neustadt gingen alle bergauf und bergab; die Bürger behaupteten, ob es stimmt weiß freilich niemand, ihr Nestlein sei gerade wie das große, gewaltige Rom auf sieben Hügeln erbaut.
„Nun muß er doch bald kommen,“ murmelte die Alte, „wo er nur bleibt!“
Sie wartete auf niemand anders als auf den Doktor Theobald Fröhlich, der von nun an in dem stattlichen Hause wohnen sollte. Das Haus hatte er von einer alten Tante geerbt, mit der Bedingung, daß er darinnen wohnen mußte, sonst sollte das Haus an entfernte Verwandte fallen. „Wer mein Haus besitzt, der soll es auch lieb haben und gern darin wohnen“, hatte die Tante immer gesagt. Der Doktor Theobald Fröhlich war arm, er hatte auch noch eine Schwester, die in England als Erzieherin sich ihr Brot verdiente, da dachte er, eine richtige Heimat haben mit der Schwester zusammen, und sei es auch in Neustadt, sei schließlich besser, als in Berlin einsam zu leben.
Zu der alten Frau, die die Dienerin der ehemaligen Herrin des Hauses gewesen war, gesellte sich die Bäckermeisterin Gutgesell, die gegenüber an der Ecke der Marienstraße wohnte.
„Wo er nur bleibt, der neue Herr?“ sagte sie und schaute ebenso eifrig wie die alte Dorothee die Straße hinauf.
„Ja eben, ’s dauert so lange,“ brummelte Jungfer Dorothee, „vielleicht kommt er garnicht, nämlich Frau Nachbarin, er ist ’n Dichter, und die sollen doch was komisch sein.“
„Ih nee, ’n richtiger, leibhaftiger Dichter! So was haben wir doch nie in Neustadt gehabt!“ schrie die Bäckermeisterin und schlug die Hände zusammen.
Und die alte Dorothee reckte sich stolz und belehrte die Nachbarin, was ein Dichter sei, und daß ihr neuer Herr vielleicht mal sehr berühmt würde, hätte die Frau Stadträtin Müller gesagt, noch sei er es freilich nicht. —
Doktor Theobald Fröhlich hatte sich unterdessen das Städtlein genau angesehen, dann hatte er einen Mann nach dem Weg gefragt und hatte erfahren, daß er erst die Straße hinunter gehen müßte, dann links herum, dann käme die Marienstraße, die ging steil bergab, und am Kirchplatz stände das Haus, das er suchte. Der Doktor fand denn auch die Marienstraße und schickte sich an, sie hinab zu gehen. Wie er einige Schritte gegangen war, hörte er plötzlich ein wildes Geschrei hinter sich, und eine Schar Buben und Mädels kamen mit ihren Schlitten angefahren. „Rechts“, schrie ein langer Bengel, „links“, rief ein anderer, und auf einmal gab es ein Purzeln und Fallen, zwei Schlitten waren zusammengefahren, ihre Besitzer plumpsten in den Schnee.
„Na, solche Wildfänge,“ dachte Doktor Fröhlich gerade, als ein leerer Schlitten ihm zwischen die Beine fuhr. Er verlor das Gleichgewicht, rutschte aus und saß auf einmal auf dem Schlitten und heidi ging es bergab. Sein Plaid fiel rechts herunter, seine Reisetasche links, er sah nichts und hörte nichts, er hielt sich nur krampfhaft fest, und dann gab es einen Ruck, ein Zetergeschrei, und der Doktor Theobald Fröhlich lag im Schnee, und auf der einen Seite saß die alte Dorothee und auf der anderen die Frau Bäckermeisterin, und beide schalten und lachten durcheinander, denn der fremde Herr hatte sie beide umgerissen.
„Verzeihung,“ murmelte der Doktor, „mein Name ist Dr. Theobald Fröhlich — ich“
„Du meine Güte, so was, das ist ja mein neuer Herr!“ schrie Jungfer Dorothee und verbeugte sich so eilig, daß sie mit der Nase beinahe in den Schnee stippte. Die lustige Frau Bäckermeisterin lachte hell auf, und nun kamen auch die übrigen Schlittenfahrer und zwei Buben mit Reisetasche und Plaid herbei. Es gab ein Hin-und-her von Fragen und Erklärungen. Der Doktor meinte, so schnell ginge es in Berlin beinahe nicht mit einem Vorortszug wie in Neustadt mit dem Schlitten.
Die alte Dorothee schalt auf die Buben, die verteidigten sich, sie hätten nichts dafür gekonnt, die Bäckermeisterin lachte, und der Doktor fand seine Ankunft in Neustadt höchst wunderlich. Er war herzlich froh, als er endlich in seinem Hause in einem behaglichen Zimmer saß und Dorothee ihm heißen Kaffee und selbstgebackenen Kuchen brachte.
Heisa das schmeckte, und wie behaglich das Zimmer war mit den altmodischen, grünen Samtmöbeln und den schönen Bildern an den Wänden! Später zeigte ihm Dorothee das ganze Haus von oben bis unten. Da gab es viele uralte Möbel, viel alten, schönen Hausrat; ein Zimmer gab es, das war ganz mit steifen, weißen Möbeln angefüllt, es führte auf eine breite Terrasse, vor der sich ein großer Garten ausbreitete. „Der gehört zum Hause,“ sagte die alte Frau stolz, „so schönes Obst hat niemand in Neustadt wie in dem Garten wächst, ’s ist ein Staat!“
Still war es freilich in dem Hause, und still war es auch in dem Städtchen, das sich der Doktor Fröhlich am nächsten Morgen gründlich anschaute. Still, ja, aber heimlich und traut. Und als er gerade zur Mittagsstunde über den Schulplatz ging, und aus einem alten ehemaligen Klostergebäude rechts Buben und links Mädchen herauskamen, da war es vorbei mit der Stille, potztausend ja konnte die Gesellschaft schreien und lachen! Und am Nachmittag sagte die alte Dorothee: „Morgen ist Nikolaustag.“
„Nikolaustag, was ist denn das?“ fragte der Doktor erstaunt.
„Je, du meine Güte, das weiß der Herr nicht?“ rief die Alte erstaunt. „Na, Nikolaustag ist halt Nikolaustag, und die selige gnädige Frau hat immer am Nikolaustag allen Kindern, die in der Marienstraße und hier auf dem Kirchplatz wohnen, Pfefferkuchen, Äpfel und Nüsse geschenkt. Der Herr Doktor kann’s mir glauben, die kommen auch in diesem Jahre. Äpfel und Nüsse sind da, soll ich noch die Pfefferkuchen holen?“
„Freilich, freilich,“ sagte der Doktor Fröhlich, beschämt, daß er nichts vom Nikolaustage wußte. Er ging dann in ein Zimmer, in dem viele Bücher standen, dort sah er in einem großen Lexikon nach, was es mit dem Nikolaustag für eine Bewandtnis habe.
Er hatte nie eine rechte Heimat gekannt. Als er fünf Jahre alt war und seine Schwester nur erst wenige Monate zählte, waren Vater und Mutter rasch hintereinander gestorben; die beiden Kinder wuchsen bei fremden Leuten auf. Eins hier, das andere dort. Der Knabe kam bald in eine Erziehungsanstalt; waren Ferien und seine Kameraden fuhren heim, dann blieb er allein in der Anstalt. An seine traurige Jugend und an seine ferne Schwester mußte er denken, als am nächsten Tage Buben und Mädels angelaufen kamen, um sich ihre Nikolausgaben zu holen. Eine lustige Gesellschaft war es, die da herantrappelte, wie strahlten die Augen, wie blitzten die weißen Zähne, wenn jedes seinen Teil bekam. Einmal kamen fünf zusammen, zwei Mädels und drei Buben.
„Na, das sind die rechten Schelme,“ sagte die alte Dorothee lachend, „Schatzgräber ihr, gelt, ihr habt gerade den rechten Pfefferkuchenhunger?“ „Ja,“ riefen die fünf, und ein Bube, der braune, krause Haare hatte und Augen rund und dunkel wie zwei Herzkirschen, aber so unnütz wie ein paar Spatzenaugen, rief: „Es könnte jede Woche Nikolaustag sein, das wär mal fein!“
„So fein wie Schatzgraben, gelt?“ rief die Alte, da wurden alle fünf rot wie reife Erdbeeren und lachend liefen sie davon.
„Wer waren die fünf, und warum werden sie Schatzgräber genannt?“ fragte Doktor Fröhlich.
„Die fünf sind dicke Freunde; es sind Nachbarskinder und ihren Namen haben sie von einem dummen Streich, den sie unlängst ausgeführt haben. Ich will dem Herrn gern die Geschichte erzählen, wenn es recht ist.“
Am Abend des Nikolaustages schrieb der Doktor Fröhlich an seine Schwester: „Komm bald zu mir, hier wird es dir gefallen. Komm noch vor Weihnachten, damit wir das erstemal das Fest im eigenen Heim, in unserer neuen Heimat, feiern können!“
Und dann, als das Abendessen abgetragen war, erzählte die alte Dorothee die Geschichte von den fünf Schatzgräbern. Die gefiel dem Doktor Fröhlich so gut, daß er sie gleich in ein Buch schrieb. Dahinein schrieb er im Laufe der Zeit noch manche Geschichte von den Neustädter Kindern, manche, die ihm erzählt wurde, und manche, die er selbst sah und hörte. Auch zwei Märlein kamen dazu und eine Geschichte aus vergangenen Tagen.
Und so stehen denn die Geschichten in diesem Buch, eine nach der anderen, so wie sie der Doktor gehört, sie erlebt und niedergeschrieben hat.
Die fünf Schatzgräber.
In früheren Zeiten, in denen die Städte noch nicht so gewaltig groß wie heutzutage zu sein brauchten um mächtig zu sein, war auch Neustadt eine gar angesehene Stadt im deutschen Reiche gewesen. Wohlstand herrschte, und die Bürger wußten sich gut in mancher Fehde zu verteidigen. Der dreißigjährige Krieg aber, der so vieles in Deutschland vernichtete, zog auch verheerend über Neustadt hin, die Stadt wurde zum Teil zerstört, geplündert, und seitdem gelang es ihr nie wieder, sich zu einstiger Größe emporzuschwingen. In jener Zeit nun, so berichtete die Sage, hätten die Bürger einen großen Schatz vergraben, viel Geld, edle Steine und silberne und goldene Prunkgefäße. Die aber, die den Schatz vergraben hatten, wurden nachher, als die Feinde die Stadt einnahmen, getötet, und darum wußte später niemand mehr, wo eigentlich der Schatz vergraben lag.
Von diesem Schatz nun wurde in Neustadt in den Zeiten, die kamen und gingen, viel gesprochen. Früher hatte wohl mancher in aller Heimlichkeit sein Gärtlein umgegraben, und wurde ein Grundstein zu einem neuen Hause gelegt oder ein altes, baufälliges Haus eingerissen, immer gab es etliche, die hofften, der Schatz sollte sich schon finden. Er fand sich aber nicht, und zuletzt suchte niemand mehr so recht ernsthaft danach. Die Geschichte von dem Schatz wurde zu einem Märchen, das den Kindern erzählt wurde, und mancher Bube dachte wohl, wenn ich groß bin, suche ich den Schatz; wuchs er heran, dann vergaß er gewöhnlich sein Vorhaben.
Von dem vergrabenen Schatz nun sprachen an einem sonnenhellen Herbsttag fünf Kinder, die einträchtiglich, wie Schwälbchen auf dem Dachfirst, auf der alten Stadtmauer saßen. Dieses letzte Stück der einst so trutzigen Stadtmauer zog sich jetzt als Grenze zwischen einer engen Gasse und hübschen, schattigen Anlagen hin. Am Ende dieses Mauerrestes stand ein runder Turm, es war dies der letzte der acht Wachttürme, die Neustadt einst besessen hatte. In dem Turm, der noch fest und unversehrt dastand, wohnte nicht mehr wie einst eine Schar eisenbewehrter Wächter, sondern ein Pantoffelmacher, Klaus Hippel genannt. Und kriegerisch sah der ganze Turm auch nicht mehr aus, statt der Feuerbüchsen früherer Zeiten hingen an schönen Tagen zu den kleinen Fenstern des Turmes bunte Pantoffel heraus, und auf schwankendem Blumenbrettlein blühten Rosen, Geranien und lichtrote Kapuzinerkresse. Und Klaus Hippel selbst konnte keiner Fliege etwas zu Leide tun, er hantierte allzeit fröhlich mit seinem Handwerkszeug herum, fertigte wunderschöne, warme, weiche Pantoffel und war gut Freund mit allen Kindern, die sich die Anlagen an der Stadtmauer zum Spielplatz erkoren hatten.
Auf der alten Stadtmauer zu sitzen war eigentlich von Rats wegen verboten, aber von Pantoffelmachers wegen durften die Kinder darauf sitzen so viel sie wollten, sie taten es auch, und niemand kümmerte sich weiter darum. Vom Turmtor aus führte ein eisernes Wendeltreppchen auf die Stadtmauer hinauf, und Klaus Hippel lachte nur gutmütig, wenn er die Kinder das Treppchen hinaufklettern sah. Er selbst saß in seinem Stübchen hinter dem Blumenbrett bei seiner Arbeit, und seine ebenso fröhliche, wie gutmütige Frau Pauline wirtschaftete eifrig in ihrem kleinen Reich herum, und wenn die beiden alten Leutchen lachten, dann pfiff Mausel, der Dompfaff, vergnügt: „O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter!“
Oben im Turm war ein kleines Museum, da hingen allerlei Waffen und Rüstungen, auch ein paar alte Möbel gab es zu sehen; das Schönste aber war die Aussicht von oben, über das weite Land hin bis zum fernen Gebirge. Paulinchen Pantoffelmacher, wie die lustige kleine Frau im Städtchen genannt wurde, brauchte zwar selten das Turmgemach aufzuschließen, weil selten genug Fremde sich nach Neustadt verirrten. Kam wirklich mal jemand, dann rief Klaus Hippel: „Aufgepaßt, ein weißer Spatz fliegt in den Turm.“
Die fünf Kinder nun, die an diesem hellen Herbsttag auf der Stadtmauer saßen und von dem Schatz sprachen, waren Pantoffelmachers besondere Freunde. Im zierlichen, weißen Kleidchen saß in der Mitte Brigittchen Schön; so ganz unrecht trug die Kleine ihren Namen nicht, sie war wirklich sehr lieblich, hatte lockiges, dunkelblondes Haar, ein zartes, feines Gesicht und Augen so blau wie zwei Veilchen. Brigittchen war das einzige Kind eines wohlhabenden Kaufmannes. Reich war der Herr Schön, dabei aber doch arm, ihm waren vor wenigen Jahren sein liebes Weib und sein kleiner Sohn gestorben, und nur Brigittchen war übrig geblieben. Eine ältere Verwandte, Fräulein Mathilde, hütete das Haus; sie meinte, es sei genug wenn sie dafür sorgte, daß die Kleine immer weiß wie ein Maiglöckchen angezogen sei. Daß ein Kind recht viel Liebe braucht, gerade so wie eine Blume den Sonnenschein, daran dachte sie nicht, und wenn der Vater verreist war, was oft geschah, dann wäre Brigittchen recht verlassen gewesen, wenn es nicht so gute Freunde gehabt hätte. Freunde hatte nun freilich die Kleine, wie man sie sich nicht besser wünschen kann, Freunde, die, wenn es darauf angekommen wäre, für sie durch Feuer und Wasser gegangen wären. Auch heute saßen ihre Freunde mit ihr zusammen auf der Stadtmauer. Da war zuerst ihre allerallerbeste Freundin Anne-Marte Fabian und deren Bruder Jörgel. Der Vater der Kinder war ein tüchtiger und beliebter Arzt im Städtchen, und das Doktorhaus lag am Kirchplatz, dicht neben Brigittchens Vaterhaus. Dann waren auch noch die beiden Bäckerbuben Wendelin und Severin Gutgesell da, die in der Marienstraße wohnten, und die dem Brigittchen so treu ergeben waren, daß sie mit Vergnügen die schönsten Prügel eingeheimst hätten, wenn sie damit der Kleinen einen Gefallen getan hätten. Das verlangte Brigittchen nun freilich nicht, ja, wenn ihren Freunden nur ein geringes Leid geschah, so weinte sie so bitterlich, daß es beinahe eine Überschwemmung gab. Und dem Weinen nahe war die Kleine auch an diesem Herbsttage; überhaupt sahen alle fünf Freunde so aus, als sei ihnen die Petersilie verhagelt, und trotzdem war es doch der erste Tag der Herbstferien und acht schulfreie wundervolle Tage lagen vor ihnen. Sie waren auch am Morgen in seliger Lust ausgezogen, um allerlei Vergnügliches zu unternehmen; der erste Besuch sollte Pantoffelmachers gelten, Frau Paulinchen hatte versprochen, ihnen wieder mal das kleine Museum recht gründlich zu zeigen, und Klaus Hippel wollte ihnen eine Geschichte aus seinem Lieblingsbuch vorlesen; dies war eine alte Chronik der Stadt Neustadt. Aber ach, die erhofften Freuden wurden bald zu Wasser. Statt sie wie sonst mit Singen, Pfeifen und schalkhaften Worten zu begrüßen, murmelte der Pantoffelmacher an diesem hellen Morgen nur verdrießlich: „Na, seid ihr da?“ Und tief seufzend nähte er so emsig an seinem Pantoffel weiter, als stände jemand barfuß neben ihm und schrie: „Eil dich doch, ich friere ja an meine Füße!“
An dem Kachelofen aber saß Frau Paulinchen und weinte herzbrechend, und weil Brigittchen nun mal niemand weinen sehen konnte, ohne mit zu weinen, flossen auch gleich ihre Tränen, und wenn die Freundin weinte, mußte Anne-Marte auch weinen, und so schluchzten denn die Mädels jämmerlich los. Den Buben wurde es ungemütlich, Tränen waren ihnen ein Greuel, Severin, der blonde Bäckerbube, riß krampfhaft die Augen auf, und Wendelin, der Schwarzkopf, knipste sie fest zu. Nur nicht etwa mitheulen! Jörgel zupfte seine Schwester und brummte: „Heul’ man nicht so, es ist ja schrecklich!“
Die Ermahnung half nicht viel, und so trat Jörgel dicht an den alten Klaus heran und fragte: „Was ist denn los?“
„Was nicht angebunden ist,“ brummte der Pantoffelmacher, „potzwetter ja, hört doch auf mit dem Geflenne!“
Dabei aber rollten dem alten Mann selbst langsam zwei schwere Tränen über das runzelige Gesicht, er sah so traurig aus, daß die Kinder fühlten, hier war ein rechtes Leid eingekehrt.
Sie hätten es aber wohl so bald nicht erfahren, was geschehen war, wenn nicht urplötzlich der Schneidermeister Langbein, der trotz seines Namens so kurz war wie der kürzeste Tag im Jahre, in die Stube geflitzt wäre: „Nachbar, Nachbar,“ schrie er aufgeregt, „ist’s wahr, daß euer Schwiegersohn so viel Geld verloren hat?“
Ja, es war so. Mutter Paulinchen rang jammernd die Hände, und ihr Mann erzählte dem Schneidermeister die ganze traurige Geschichte. Der Schwiegersohn der alten Leute, Friedrich Lange, war ein braver, rechtlicher Mann, er war als Kassenbote in dem größten Bankgeschäft angestellt. Am vergangenen Tag hatte er Geld austragen sollen, er war schon seit einigen Tagen krank gewesen, hatte aber seinen Dienst nicht versäumen wollen. An diesem Nachmittag nun wurde ihm auf einmal schwindelig, gerade als er durch den Stadtwald ging, da hatte er sich zum Ausruhen ein Weilchen auf eine Bank gesetzt, dann war er weiter gegangen. Plötzlich aber hatte er seine Geldtasche vermißt. Hatte er sie verloren, war sie ihm gestohlen worden? Er wußte es nicht, er war gleich umgekehrt und hatte gesucht, vergeblich, nirgends war die Tasche zu finden gewesen. Stundenlang hatte er noch gesucht, war auf die Polizei gelaufen, den Verlust zu melden, alles vergeblich. Der Direktor der Bank war, als ihm die Sache erzählt wurde, so zornig gewesen, daß er den armen Mann gleich entlassen und ihm gedroht hatte, er würde ihn anzeigen, wenn er nicht binnen drei Tagen das Geld herbeischaffte. „Und wenn wir zusammen alle unsere ersparten Groschen hergeben,“ klagte der alte Klaus, „dann reicht es noch nicht einmal, und die gute Stellung hat mein Schwiegersohn auch verloren, wo wird er nun Arbeit finden.“
Es war wirklich sehr trübselig in dem alten Turm gewesen, bedrückt waren die Kinder von dannen geschlichen, und niedergeschlagen saßen sie nun auf der Stadtmauer und überlegten, wie dem Pantoffelmacher zu helfen sei. Ach, in ihren Sparbüchsen war auch nicht viel Geld. Jörgel sagte verächtlich, als Brigittchen davon sprach: „Das nutzt gar nichts, viel mehr Geld müssen wir haben.“
„Wenn wir den Schatz fänden,“ sagte Wendelin plötzlich sinnend.
„Ja wenn, wo liegt er denn, wenn wir das nur wüßten?“ brummte Severin.
„Im ehemaligen Klostergarten, Heine hat’s gesagt,“ murmelte Wendelin halblaut, als fürchtete er, jemand könnte das große Geheimnis hören.
Heine war ein Bäckergeselle, der für die beiden Bäckerbuben ein Orakel war. Sie fragten Heine nach allen möglichen Dingen, und wenn Heine etwas sagte, stimmte es sicher.
„Im Klostergarten?“ rief Jörgel, „das könnte schon sein, Klaus hat auch einmal gesagt, das Kloster sei einst reich und mächtig gewesen?“
„Wir wollen den Schatz suchen,“ sagte Brigittchen eifrig. „Paßt auf, wir werden ihn finden, dann helfen wir Klaus und schenken allen Leuten was zu Weihnachten!“
„Fein,“ schrie Anne-Marte und baumelte vor Vergnügen so mit ihren Beinchen, daß der Mörtel von der alten Stadtmauer herabrieselte.
„Fein wär’s schon,“ meinte auch Wendelin, und Severin und Jörgel riefen wie aus einem Munde: „Wir können ja mal suchen!“
„Einen Schatz graben soll aber gefährlich sein,“ flüsterte Wendelin; Brigittchen und Anne-Marte quiekten graulich: „Nein, nein, wir fürchten uns!“
„Vor was denn, ihr Mauerschwalben?“ fragte eine Männerstimme. Unten auf dem Promenadenweg stand ein Herr, der lachend die fünf auf der Mauer betrachtete. Jörgel erkannte seinen Onkel, Stadtrat Weber, in dem Spaziergänger und dachte, nun würde es Schelte geben, weil er auf der Mauer saß, doch der Onkel nickte ihm nur freundlich zu und ging weiter. Die fünf aber steckten die Köpfe zusammen und tuschelten und wisperten, große Pläne waren es, die sie schmiedeten, sie bekamen leuchtende Augen und heiße Wangen und beinahe wären sie zu spät zum Essen gekommen, so eifrig hatten sie miteinander beraten.
An diesem Nachmittag suchten Wendelin und Severin den Bäckergesellen Heine in der Backstube auf. Der war gerade aufgestanden, denn so ein armer Bäcker muß die Nacht zum Tage machen und umgekehrt. Ein bißchen knurrig und verschlafen sah Heine daher den Buben entgegen, kaum hatte er aber gehört, was sie wollten, da wurde er gleich putzmunter. An den vergrabenen Schatz hatte er nämlich schon lange gedacht, er meinte, etwas Wahres würde schon an der Geschichte sein, weil er sich aber nicht auslachen lassen mochte, hatte er noch mit niemand ernstlich darüber geredet. Auch war er recht furchtsam und meinte, ohne ein Gespenst könnte es beim Schatzgraben sicher nicht abgehen. „Heisa,“ dachte er nun, „vielleicht finden die Kinder wirklich den Schatz, dann bekommst du auch deinen Teil, und finden sie ihn nicht, na, dann bist du wenigstens nicht der Ausgelachte und geschehen kann dir auch nichts.“ Er gab also den beiden bereitwilligst Auskunft. „Der Schatz liegt sicher unter dem sogenannten Schwedenstein auf dem alten Klosterhof,“ sagte er, „dort grabt ihr einfach morgen, wenn es dunkel ist, ihr müßt halt so lange graben, bis ihr den Schatz findet!“
Wendelin und Severin nickten. Ja, das war schon recht einfach, wenn nur die Dunkelheit nicht gewesen wäre. Das Graben selbst beunruhigte sie nicht weiter, denn das Stück vom Klosterhof, auf dem sich der Schwedenstein befand — ein altes Steindenkmal, dessen Inschrift niemand mehr lesen konnte — war den Buben recht gut bekannt. Es war der Grasgarten, der an die Bäckerei stieß, ein stiller, verlorener Winkel, der auf der einen Seite vom Kreuzgang der Marienkirche begrenzt wurde. Obstbäume standen jetzt da, wo vor langen Zeiten fromme Mönche gewandelt waren, und die Frau Bäckermeisterin Gutgesell trocknete ihre Wäsche auf dem Platz.
Einen richtigen, wohlgepflegten Garten anzulegen, dazu hatte niemand recht Zeit im Bäckerhause; der Vater meinte, ein Grasgarten sei für die Buben gerade ein rechter Spielplatz, und an warmen Sommerabenden saß die Familie gern in der grünen Wildnis, es vermißte niemand gepflegte Wege und zierliche Blumenbeete.
„Warum nur abends, am Tage können wir doch gerade so gut graben?“ murrte Wendelin.
„Nee, das geht und geht nicht; wer einen Schatz graben will, der muß es in der Dunkelheit tun, sonst findet er ihn nicht, und der Mond muß scheinen, und der scheint morgen gerade, also ist’s recht,“ beharrte Heine. Der gute Heine war nämlich nicht allein furchtsam, sondern auch noch schrecklich abergläubisch, „es geht schon über die Hutschnur, wie sehr,“ pflegte der Altgeselle Martin zu sagen.
Wie töricht eigentlich der gute Heine mit all seinem Aberglauben war, das merkten freilich die Buben nicht, und sie glaubten ihm auf’s Wort. Sie seufzten zwar sehr, und der Gedanke an das nächtliche Schatzgraben legte sich ihnen wie eine Zentnerlast auf das Herz. „Uff,“ ächzte Wendelin, „das wird graulich,“ und Severin stöhnte herzbrechend.
Auch Jörgel, Anne-Marte und Brigittchen fanden die Sache sehr bedenklich. Zwei Tage lang gingen alle fünf mit sorgenvollen Gesichtern herum. Als aber am dritten Tage Tante Mathilde erzählte, man habe den Schwiegersohn vom alten Turmwärter Hippel ins Gefängnis gesteckt, da schluchzte Brigittchen bitterlich, und weinend sagte sie zu ihren Freunden: „Wir müssen den Schatz holen!“
Es traf sich, daß am nächsten Tage Doktor Fabian mit seiner Frau über Land fuhr, Brigittchens Vater war wieder verreist, so konnten die Kinder noch nach dem Abendessen in das Bäckerhaus eilen, ohne daß es jemand recht beachtete. „Komm rechtzeitig wieder,“ sagte Tante Mathilde zu Brigittchen, dann vertiefte sie sich in ein Buch und vergaß darüber die Zeit. Die Köchin Marie bei Doktor Fabian aber saß in der Küche und strickte, schlief darüber ein und merkte es auch nicht, daß die Kinder gar nicht heim kamen. Im Bäckerhause war an diesem Abend besonders viel zu tun; in Neustadt sollte am nächsten Tage ein Turnfest gefeiert werden, dazu waren viele große Apfel- und Pflaumenkuchen bei Meister Gutgesell bestellt worden, es hieß also fleißig bei der Arbeit sein.
„Geht zu Bett,“ sagte die Meisterin zu ihren Buben, und weil diese, so viele dumme Streiche sie auch machten, doch folgsam waren, meinte sie, ihr Befehl sei ausgeführt und die Buben wären ins Bett gegangen.
Die aber saßen mit ihren Freunden zitternd und zagend in ihrer Schlafkammer, und je später es wurde, je graulicher wurde ihnen zu Mute. Zur Aufmunterung erzählten sie sich noch allerlei Schauergeschichten, lauter dummes, unwahres Zeug, und je mehr sie sich erzählten, je ängstlicher wurden sie.
Auf einmal klopfte es leise an der Türe, Heine erschien mit einer großen Stallaterne und drei Spaten. „Jetzt laß ich euch zur Hintertüre hinaus, s’ist gerade Zehn, und der Mond wird gleich zum Vorschein kommen; nun macht eure Sache gut. Wenn ihr fertig seid, dann klettert ihr die Leiter hinauf, die am Fenster der zweiten Backstube steht, und pfeift, ich mache euch dann die Türe wieder auf und laß’ euch herein! Laßt euch man nicht von ’n Gespenst oder so was erwischen, weil’s nämlich mit dem Schatzgraben manchmal bedenklich ist,“ ermahnte er noch. Diese Worte trugen gerade nicht dazu bei, den Mut der Kinder sonderlich zu stärken.
„Es ist schrecklich gruslich!“ wimmerte Anne-Marte. Brigittchen schluckte krampfhaft die Tränen herunter; sie dachte an den alten, guten Klaus Hippel und daß sie ihm so gern helfen wollte. Ganz mutig tappte sie also hinter den Buben drein; auch Anne-Marte folgte, als sie die Freundin so beherzt sah.
Als sich aber die Haustüre hinter den Fünfen schloß und sie so allein in dem einsamen Grasgarten standen, fing es allen an sehr unheimlich zu werden. „Pah, s’ist gar nichts, nur los,“ rief Jörgel patzig; er guckte dabei rechts und links, ob sich auch niemand blicken ließ.
„Wir sind doch schon oft so spät draußen gewesen,“ prahlten Severin und Wendelin, und dabei war es, als ob ihnen die Füße am Boden festklebten. Endlich aber faßten sie sich alle an und marschierten tapfer auf den alten Stein los, der in einer Ecke des Grasgartens stand.