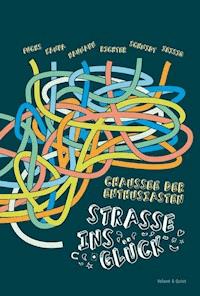7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Angst des Eisbergs vor dem Untergang Eine junge Frau – Sozialhilfeempfängerin – verliebt sich in einen nicht mehr jungen Mann, ihren Sachbearbeiter. Daraus folgt, heftige Funken sprühend, die Kollision zweier Welten und Wahrnehmungen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Natürlich droht ein Unglück, denn sie ist die Titanic, und er heißt: Herr Berg … «Aus Kirsten Fuchs´ Text möchte man ständig Sätze wie Münzen in der Tasche hin und her wenden: Sätze mit Gebrauchswert, die nützlich sind und dennoch schön.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) «Dieser Roman vollzieht eine schnelle und intensive Beziehungstrauerarbeit … ganz lässig und herrlich sprachmanschettenlos.» (taz) «Hut ab. Selten jemanden gelesen, der so frei mit der deutschen Sprache umgehen kann.» (Frankfurter Rundschau) «Ein extravagantes Gemisch aus unverblümter Drastik, trockenem Witz und rasender Zärtlichkeit. … Kirsten Fuchs weiß, wo und wie man Leser packen muss: mit mädchenhaft verspieltem Griff unter die Gürtellinie.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) «Die Geschichte einer amour fou, wie sie dreister und romantischer, realer und surrealer, alltäglicher und allnächtlicher schon lange nicht mehr erzählt wurde.» (Süddeutsche Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Kirsten Fuchs
Die Titanic und Herr Berg
Roman
eins
Dies ist keine Leidensgeschichte. Meine Geschichte ist keine Leidensgeschichte, nur meine. Ich mache mir einen schönen Tag nach dem anderen. Ich mache was aus Zutaten, die alle einzeln gut schmecken und zusammen auch. Das ergibt Essen. Ich mache mir eine Freude. Ich mache es mir mit der Hand und zünde vorher eine Kerze an. Frauen, die Dildos benutzen, verstehe ich nicht. Frauen, die Mohrrüben benutzen, verstehe ich nicht. Frauen, die Kerzen benutzen, aber sich dabei keine Kerze anzünden, verstehe ich einfach nicht. Bald ist Weihnachten, das passt doch. Ich würde es mir auch mit einer angezündeten Kerze machen. Das Ende mit dem brennenden Docht würde ich draußen lassen. Das könnte doch hübsch aussehen. Das könnte aber auch die Schamhaare anzünden. Die angeschmorten Locken. Ich habs schon probiert, einmal. Es hat nicht gut gerochen, überhaupt nicht. Ich mache es mir mit der Hand, mit beiden Händen. Ich weiß was mit meinen beiden Händen anzufangen. Sicherlich hätte ich Goldschmiedin werden können. Oder Zahnärztin. Alles eigentlich. Eigentlich alles.
Weil ich nicht rauche, esse ich danach Schokolade. Ich lege mich aufs Bett und warte darauf, dass ich wieder Lust habe. Dann fange ich von vorne an, dann esse ich Schokolade, dann gehe ich mir die Zähne putzen und puste die Kerze aus. Ich mag saubere Zähne, saubere Zähne sind das A und O.
Ich habe am häufigsten in meinem Leben das Wort «ich» gesagt und das Wort «und». Ich sage sehr oft «ich». Das ist mein Lieblingssatzanfang. Ich, ich, ich bin nicht eloquent. Ich bin der Mittelpunkt meines Mittelpunktes und definiere an mir angepflockt wie eine Ziege einen kleinen Radius um mich herum. Alles andere ist mir und läuft mir zuwider. Ich habe meine eigenen Probleme, die nicht so klein sind, dass man ihnen einen Party-Hut aufsetzen kann und dann sehen sie niedlich aus, so wie man es mit behinderten Kindern macht, Stimmung, Konfetti, Trillerpfeife. Heute muss ich das Aquarium reinigen, sonst sehen die Fische nicht, was ich treibe, wenn ich zu Hause bin. Das sind Probleme, denn das sind Liter. Die Fische reden nicht mit mir, und ich bin aufrichtig froh darüber, denn den ganzen Tag will mir wer was über zu wenig erzählen. Die Fische haben ganz klar zu wenig Durchblick, Kloßbrühe halt. Wenn ich dieses Wasser mit diesem Schlauch absauge, bekomme ich jedes Mal diese Dreckbrühe in diesen Mund. Das sind meine Probleme. Und mehr interessiert mich nicht, nicht mal das so richtig. Ich bin genauso eine Lusche wie alle anderen. Warum sollte mich ein fremder Weg zum Luschigsein interessieren? Ja ja, von wegen nur mal ausreden, nur mal zuhören, nur weil ich Ohren habe und dafür bezahlt werde. Die Fische sind ratlos, weil ihr Himmel aus Flüssigkeit auf sie heruntersinkt. Man kann ihnen ansehen, dass sie bekloppt sind. Ich mag das. Sie schwimmen schlicht nur hin und her. Mir kommt das genauso sinnvoll vor wie alles andere: Geld fürs Brot verdienen, noch mehr Geld für den Brotaufstrich verdienen, Zeit verbringen, indem man das Brot mit dem Brotaufstrich zu sich nimmt, und dieselbe Zeit nutzen, indem man dabei die Abendnachrichten sieht. Was ist passiert? Was ist wo passiert, während ich an der Ampel gepopelt habe? Mein Gott – kann man sich das vorstellen, das ist echt passiert. Ich habs doch im Fernsehen gesehen. Mit eigenen Augen im Fernsehen gesehen. Dass ich nicht lache – eben, dass ich nicht lache. Da lache ich nicht.
Heute habe ich meine Pflanzen an Fleischerhaken an die Decke gehängt, weil meine Wohnung klein ist. Sie ist nicht zu klein, nur klein. Ich bin auch nicht zu glücklich, nur glücklich. Zum Gießen muss ich in Zukunft auf die Leiter steigen. Ich habe heute Fleischerhaken und eine Leiter gekauft. Ich will in jedem Raum eine Leiter haben. Da kann ich drauf steigen und runterkucken. Dann habe ich einen Überblick, über mein Reich und Reichtum. Im Flur ist kein Fenster, darum habe ich dort Kunstblumen an die Fleischerhaken gehängt. Die Kunstblumen habe ich auch heute gekauft. Eigentlich sind das keine Blumen, aber wenn man ein Herz malt, ist es auch ein Herz und ich sage Herz dazu, also Blumen. Sie stellen etwas dar, und dann ist es wahr, ja. Ich steige im Flur auf die Leiter, um die Spinnen zu entfernen. Die Leiter macht neue Geräusche in der Wohnung. Alle anderen Geräusche kenne ich schon, aber jetzt machen ich und die Leiter zusammen ein neues, Geklapper. Die Leiter ist nicht aus Eisen, sondern aus Aluminium. Immer sind Spinnen in Zimmerecken, oben und unten, immer. Unten komme ich schon immer ran, aber oben komme ich erst jetzt ran. Ich mache die weg. Ich mache die tot. Vor allem, falls ich Besuch bekomme. Viele Menschen haben Angst vor Spinnen, nicht nur Frauen. Auch Männer haben Angst vor Spinnen und vor Frauen, darum bin ich ein Mädchen. Ich habe alles in klein, aber nicht zu klein. Ich habe wenige Narben, Kindheitsnarben, die mit Bäumen zu tun haben, mit Bäumen und Fahrrädern und Leitern.
Nachdem das Aquarium sauber ist, winke ich den Fischen eine gute Nacht, schön die Glubschaugen offen halten. Dann ziehe ich mich in mein Schlafzimmer zurück, in dem ich unbeobachtet bin. Da sind Vorhänge und keine Fische und auch keine Frau. Ich wichse meistens vor dem Einschlafen. Ich versuche dabei, an nichts zu denken. «Wichsen» und «nichts», die Wörter haben vier Buchstaben Übereinstimmung. Mehr als «Wichsen» und «Frieden». Aber die Wörter «Frieden» und «Frauen» haben seltsamerweise auch vier gleiche Buchstaben. Ich denke an nichts. Wenn ich an Frauen denke, die mir tagsüber begegnet sind, so mittelgescheitelte Frauen mit Augen wie Schraubenzieher, die mich reparieren wollen – hier was festziehen, dort was lockern–, dann will mein Schwanz nicht so, wie ich wohl will. Die Frauen sagen: «Warum bist du so und nicht anders oder ganz anders oder ganz ganz anders?» Und wenn ich an dumme Frauen denke, sagen die noch dümmere Sachen. Esoterische Scheiße, und was Schlimmeres gibts ja wohl kaum. Dann wird mein Schwanz so schlaff wie der Rest an mir. Die schlaffen Arme, das müde Gesicht, welches ich mein Eigen nenne und durch die Stadt trage, sodass jeder sieht: «Das ist doch wohl ganz deutlich ein müdes Gesicht.» Ich habe keine Muskeln. Ich bin ein dürres Gerüst mit Haut drüber gezogen, weil sonst die Nerven blank liegen. Vor allem im Gesicht ist nix los. Mimik ist doch Quatsch. Auf Brücken zwischen Menschen kann ich verzichten. Wenn man wieder auseinander geht, stürzt das Bauwerk zusammen, die Steine fallen auf den Bürgersteig zwischen die Bürger und mir hängt das Brückengeländer noch am Mundwinkel wie ein Speichelfaden. Ich denke beim Wichsen an nichts. Ich will auch nicht, dass irgendwer beim Wichsen an mich denkt. So weit kommts noch. Ich komme nicht, wenn ich an jemanden denke. Mir sind zwei Ehen gescheitert und zwei Kinder passiert. Ich wichse ins Nichts.
Ich war heute im Sozialamt, nachdem ich im Baumarkt war, und im Sozialamt habe ich meine Kontolage dargestellt, die sich geändert hatte, weil ich im Baumarkt war. Ich habe meine Kontolage nicht schauspielerisch dargestellt, wie denn auch? Ich müsste mich nackt ausziehen und meine Backen nach außen krempeln. Ich müsste mich zeigen wie ich bin, nackt, und was ich habe, nichts, mich. Ich habe nichts in den Backen gehamstert, keine Vorräte, und wenn ich keine Unterstützung bekomme, verhunger ich im Winter. Ich bin doch dünn wie ein Faden, der von einer Maus abgebissen wird, dünn wie die Maus, die Hunger hat, aber nur einen Faden findet. Ein Faden macht nicht satt, nein. Herr Sachbearbeiter, ich verstecke nichts, denn ich besitze nichts, mich. Würde ich etwas besitzen, ich würde es Ihnen schenken, denn ich brauche nichts. Sie sehen traurig aus, ich doch aber nicht. Dies ist keine Leidensgeschichte, denn leiden geht anders. Leiden geht so, dass man, kann sein, niemanden lieb haben kann. Ich kann das aber. Ich gehe morgens zum Spiegel und lache mir eine Einschulungstüte mit einer Puppe drin, der man die Haare schneiden kann, auch wenn sie nicht nachwachsen, nie wieder. Ich kann das. Ich mache das, Haare schneiden, Lachen. Das habe ich gelernt von lieben Eltern, ich habe es in Großpackungen geschenkt bekommen, Weihnachten. Ich habe deshalb ein Händchen für Menschen, den rosafarbenen Daumen. Mir gehen Menschen nicht ein. Immer schön düngen. Ich kann das, und mit dem Internet kann ich auch umgehen.
Nachdem ich fertig gewichst habe, setze ich mich kurz zum Rauchen im Bett auf. Die Hand brauche ich danach nicht zu waschen. Ich wichse mit einem Taschentuch. Ich wichse sogar jedes Mal mit einem anderen Taschentuch, Zellstoff, Wunder des Fortschrittes. Ich sitze im Bett und rauche mich müde. Ich rauche so schnell, dass ich gar keinen Sauerstoff mehr bekomme. Ein kleines Zimmer in meinem Gehirn stirbt ab und wird eine Raucherecke. Manchmal werde ich geradezu taumelig davon, viel besoffener als besoffen. In ein paar Jahren ist mein ganzer Kopf eine Raucherecke mit gestreifter Tapete und einem Kunstledersofa. «Ikebakenoleum» hat meine erste Frau zu Kunstleder gesagt. Ich will jetzt nicht an Sylvia denken. Sie hat mich nicht geändert. Wir haben uns gelassen, wie wir sind, und dann ganz gelassen. Wir haben uns nichts getan im Guten und im Schlechten. Was haben wir eigentlich jahrelang getan? Ach ja, die Kinder. An die Kinder will ich jetzt auch nicht denken. Die sind so groß, dass ich keine Striche mehr an die Türrahmen male. Früher war es so einfach festzustellen, wie sie sich verändern. Ich schiebe jeden Tag Akten hin und her, um den Unterhalt zu bezahlen. Sebastian macht Abi und will danach studieren. Und Linda weiß noch nicht, ob sie Abi machen will. Ich werde noch ewig und dreihundert Tage Akten hin und her schieben und mir Leidensgeschichten anhören. Mich hats ins Sozialamt verschlagen, aber nicht als Antragsteller, wenigstens das nicht. Ein müdes, ein sehr, sehr müdes Jippi.
Heute im Sozialamt habe ich eine Stunde gewartet. Ich warte gerne. Ich warte immer. Jeden Tag passiert etwas, auf das ich gewartet habe. Heute hat es geschneit, ganz kurz. Heute hatten sie mein Haarfärbemittel nicht in der Drogerie, ein Dunkelbraun. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich erkenne die Frau auf der Verpackung. Sie erinnert mich an meine Grundschullehrerin, die mir wenig beigebracht hat. Ich mache ihr keine Vorwürfe, sie hatte eine schöne Haarfarbe, ein Dunkelbraun. Ich habe darauf gewartet, dass sie die Farbe nicht mehr haben, denn immer, wenn ich etwas mag, wird es vom Markt genommen. Ich hatte einen Lieblingsjoghurt mit Birnen und Körnern, dann wurde er vom Markt genommen, weg. Der liebe Gott nimmt Produkte vom Markt, damit wir uns nicht zu sehr an etwas gewöhnen. Er lässt Menschen sterben, damit wir uns andere suchen. Es sind ja genug da. Nicht drängeln, für jeden ist ein Freund da. Ich werde mir die Haare mit einem anderen Mittel färben. Der liebe Gott will, dass ich darunter leide, dass es diesen Joghurt nicht mehr gibt. Da hat er sich geschnitten. Ich schneide mir Birnenstückchen in den Joghurt und Körner mache ich auch dazu. Aber im Moment gibt es keine Birnen. Ich muss warten, bis sie reif sind. Ich mache das gerne. Ohne Zeit macht Warten keinen Spaß, aber ich habe Zeit wie Sand und mehr. Im Sozialamt haben alle Zeit, die 397 und die 402.Drei Leute haben gelesen und der Rest hat sich auch beschäftigt, Fingernägel, Nase, Kinn und Ohren – alles wieder sauber. Ich übte meinen Text: «Überall habe ich mich beworben, überall in ganz Berlin, aber keiner braucht mich. Ich bin verzweifelt. Das können Sie sich vorstellen. Ich weiß gar nicht, was ich falsch mache. Schöne Bewerbungen habe ich geschrieben, Foto und alles. Und Briefmarken.» Und dann war da mein neuer Sachbearbeiter. Den wollte ich gar nicht anlügen. Den wollte ich mir in den Schlüpfer stecken, damit er sich aufwärmen kann.
Ich habe die Arbeit bis ganz oben. Weil morgen ein neuer Tag ist, könnt ich vor Freude kaputt gehen, aber ich werd einfach nur hingehen. Ich kann mich ja alleine gar nicht beschäftigen. Das Aquarium ist sauber. Ich habe gar nichts zu tun. Ich rauche, bis das Telefon klingelt, tut es aber nicht. Wenn es tatsächlich klingeln würde, bekäme ich stante pede einen Herzinfarkt. Das Schöne an Ruhe ist ja, dass sie nichts mit Vorwürfen zu tun hat. Es ist so still, wenn es ruhig ist. Da kommen so Gedanken kurz vorm Schlafen. Ich asche in einen Kronkorken, und das ist nicht so übel wie um Mitternacht schon schlafen zu gehen. Was könnte man treiben, um nicht nachzudenken? Andere haben Hobbys. Sammeln, Tauschen, Tauchen, Ablenkung mit Gegenständen. Ich habe Zigaretten. Sylvia hat gerne gekocht. Ich will nicht an meine erste Frau denken, nicht an die Kinder und nicht an die zweite Frau. Wer denkt schon gerne an eine Ursel? Wie kann man eine Ursel heiraten? Wollen Sie die hier anwesende Ursel urseln? Urst gern! Ursel war aus dem Osten. Ich hab Feierabend. Ich will nicht an die Arbeit denken. Ich bin bis auf Weiteres zuständig für die Buchstaben H bis N.Nicht mehr für A bis G.Eine Kollegin muss, und will anscheinend auch, ein Kind bekommen, während die andere Kollegin, die sie ersetzen soll, das schon hinter sich hat, aber noch ein bisschen das Eijapopeia schaukeln muss, bis sie wieder ins Berufsleben zurückkehrt. Kinder, Kinder, bis dahin bin ich der Amtspapa für H bis N.H bis N sagt genau dasselbe wie A bis G.Verstehen Sie doch. Verstehen Sie doch bitte. Auch mit Bitte nicht. Bin ich das Sozialamt? Ich lehne ab und lehne mich zurück. Nächster bitte.
Dann kam das Mädchen und sagte: «Das können Sie sich doch vorstellen.» Ich konnte mir ganz andere Sachen mit ihr vorstellen. Sie wirkte sehr jung. Danach habe ich in den Akten gesehen, dass sie älter ist, als sie wirkt. Ich sagte ihr, dass ich kaum was tun könnte, aber sie saß wie angeleimt. Sie schaute zu meiner Kollegin, Frau Kobow, die störte sie irgendwie. Das Mädchen schaute verschwörerisch oder verführerisch oder verrückt. Frau Kobow verließ den Raum, mir wäre auch kein Grund eingefallen, sie wegzuschicken. Sie ging ein Irgendwas holen. Ich hab ihr nicht zugehört. Das Mädchen atmete auf, als wären wir endlich allein. Wir waren allein, aber doch nicht endlich.
Er sieht aus wie ein Vogel, der aus dem Nest gefallen ist, verloren. Er ist als Ei aus dem Nest gefallen und ein Hund hat auf ihn ein Häufchen gemacht. Diese Wärme hat ihn ausgebrütet. Jetzt fällt er jeden Tag wieder aus dem Nest.
Sie sieht aus wie tausend andere Mädchen. Haare irgendwas. Offen. Augen irgendwas. Offen. Ihre Hände legte sie auf die Tischkante, als sollte ich ihr die Fingerkuppen abhacken.
Ich wusste, dass er mich versteht, ohne dass ich etwas sage, also sagte ich nichts, nichts.
Sie sagte nichts. Ich gab ihr einen Besuchstermin in zwei Tagen. Ich schrieb etwas auf einen Notizzettel. Das sah nicht offiziell aus, und das ist es ja auch nicht.
Übermorgen kommt er zu mir. Ich werde mit ihm schlafen, weil er es so will. Ich habe nichts dagegen. Ich mache das nicht aus Mitleid. Ich arbeite ja nicht beim Sozialamt.
zwei
Morgens sitze ich mein Aufwachen aus, bis das Meerschweinchen fiept. «Still!», sage ich zu dem Meerschweinchen, aber es fiept. «Sitz!», sage ich zu dem Meerschweinchen, aber es fiept. «Sag mir mal deinen Namen, Vieh!», fordere ich das Meerschweinchen auf, aber da ist es plötzlich ruhig. Das Meerschweinchen hat einen Namen. Ich weiß den Namen gerade nicht. Es ist das Haustier meiner Tochter und wurde gestern im Hotel Papa eingecheckt. Angeblich sind alle anderen zu krank, um das Tierchen zu versorgen, ohne es anzustecken. Dass ich eigentlich immer krank bin, interessiert nicht. Meine Tochter hat übrigens auch einen Namen, aber ich war für einen anderen. Ich mag den Namen Linda nicht. Ich war für Anton, denn ich wollte noch einen Sohn. Jungs sind gut. Jungs sind keine Mädchen. Mädchen sind aber auch gut. Mädchen sind keine Jungs. Ich nenne das Meerschweinchen Anton. So heißt ein Freund von mir. Ich füttere Anton, da fiept er wieder, dann füttere ich mich, dann rauche ich. Mir ist nicht gleich nach dem Aufstehen nach Rauchen. Daran erkennt man wohl einen Raucher. Er will gleich nach dem Aufstehen sofort rauchen. Ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat. Ist es besorgniserregender, dass man nicht weiß, wer einem was erzählt hat oder dass man immer genau weiß, wem man selbst was erzählt hat, weil man so wenig erzählt? Ich rauche seit dreizehn Jahren. Natürlich bin ich ein Raucher. Ich will morgens nur vorher einen Toast mit Käse. Dann erst rauche ich und dann übergebe ich mich der Welt. Der Weg zum Auto ist kurz, reicht aber, damit mir der Pappschnee eine dicke Sohle unter die Schuhe pappt. Die ganze Stadt ist voller Yetis. Es gibt sie doch. Sie haben Mützen auf und laufen, als hätte der Pappschnee ihnen eine hohe Sohle unter die Schuhe gepappt, und so ist es ja auch, so schauts. Im Amt tauen mir die vier Zentimeter Erhöhung weg, und ich bin wieder europäischer Durchschnitt. Nur mein Schwanz ist größer als europäischer Durchschnitt. Was ich mir darauf einbilde, ist so groß wie eine Zwirnrolle – europäischer Durchschnitt natürlich. Ich arbeite, bis ich stumpf bin, dann stehen die Hausbesuche an: eine Frau, die einen Kinderwagen beantragt hat, ein Türke, der alles Mögliche braucht, und ein Mädchen, das mit mir schlafen will.
Ich soll den Azubi auf meinen Trip mitnehmen, damit er was Ekliges lernt und heute in sein Berichtsheft schreiben kann: Zwischen Theorie und Praxis gebricht es mir, würg. Der Azubi ist ganz patent, denn er ist zu schüchtern, um einen Plausch anzufangen. Ich bin auch gar nicht für ihn zuständig, und für was ich nicht zuständig bin, damit plausch ich auch nicht. Mit meinen Frauen habe ich immer geredet, und mit den Kindern rede ich auch, wie gehts, wie stehts? So was eben. Jedenfalls soll ich den Bub heute mitnehmen. Ich muss eh jemand mitnehmen. Ich habe die Wahl zwischen Männern, die ihr Gehirn in Alkohol eingelegt haben, und dem Bub, der damit erst anfangen wird. Er heißt Lukas und ist einen Kopf größer als ich. Er ist massig und hat eine zu kleine Brille, an der er sich die Augen stößt. Ich weiß gar nicht, ob der in mein Auto passt. Er steigt hinten ein, okay, bin ich eben sein Taxi.
«Du weißt, warum wir immer zu zweit gehen müssen?»
«Ja», sagt er.
Damit habe ich nichts weiter zu sagen, er weiß es schon. Ich reiche ihm die Anträge hinter und auch die Protokolle, damit er schon mal das Datum drauf schreiben kann.
«21.November», sage ich ihm. Er schreibt auf seinen Knien.
Ich schalte das Radio ein und suche den Sender, der mir mehr auf den Geist geht als alle anderen Radiosender, die mir auf den Geist gehen, aber er bringt keine Straßenverkehrsmeldungen, die mir noch mehr auf den Geist gehen als alles andere, was mir auf den Geist geht.
Vor dem Haus der Frau fragt mich Lukas, ob wir bei ihr angemeldet sind. Die Frage scheint ihn unter der Mütze zu jucken. Er kratzt sich die Stirn. Er sieht verschwitzt aus, weil er im Auto die ganze Montur angelassen hat. Das ist schlecht für die Haut, und schlechte Haut ist schlecht für Mädchenbekanntschaften, und keine Mädchenbekanntschaften sind schlecht fürs Selbstwertgefühl und dazu noch dieser Beruf.
«Ich ruf immer vorher an», erkläre ich ihm und hoffe, dass er sich das merkt, merk dir das, schreibs in dein Berichtsheft. Ich lasse Lukas klingeln. So, jetzt weiß er, wie man klingelt, mit dem Daumen, so schauts.
Die Frau, die den Kinderwagen will, duzt Lukas. Ich sieze ihn deshalb extra.
Ich gehe durch die Wohnung wie durch ein modernes Museum. Was wollte der Künstler uns damit sagen? Es ist eine kackbeschissene Welt? Die Ironie liegt im Abwasch? Das erste Kind sitzt mit einer Beule auf dem Kühlschrank als Symbol für was Kaltes? Die soziale Kälte im Eisfach neben dem Spinat? Weil ich gar nicht schlechte Laune habe, sage ich: «Hübsch ham Sies hier!» Die Frau glubscht, wie unten abgeschnürt und oben quillt es raus. So sieht auch ihr Busen aus. Noch nie was von in Würde altern gehört. Sie pult sich ratlos am Kinn. Dort ist Schorf und dann nicht mehr. Selbstvergessen isst sie den Schorf.
«Bei mir zu Hause sieht es fast genauso aus», sage ich. Das ist das Einzige, was ich für sie tun kann. Ich kann ihr den Glauben geben, dass es Beamten, die Alimente statt Lohn bekommen, also quasi Kindern des Staates, auch nicht besser geht. Mir nicht und dem kleinen Lokomotivführer Lukas, tuff tuff, auch nicht. Der steht neben mir und hält mit beiden Händen die Zettel vor seine Michelinmännchenjacke, außer wenn er kurz eine Hand braucht, um unter seiner Mütze zu kratzen. Klar sieht es bei mir schöner aus – aber was solls?–, sie lügt mich an, und ich lüge zurück. Mehr ist nicht drin, denn in ihr ist auch nicht mehr drin als die übliche leere Gebärmutter. Sie kann nicht beweisen, dass sie schwanger ist. Der Arzt dieses und der Vater jenes und Geld tralala. Heul doch! Dann heult sie. Ihr Kind hüpft vom Kühlschrank und sagt: «Ich geh runter!»
«Aber es ist doch so kalt», weint die Mutter. Das Kind zuckt die Schultern. Ich zucke auch die Schultern. Kinder, man kann nicht mit sie und man kann nicht mit sie. Was will die Frau mit einem Kinderwagen, wenn sie nicht schwanger ist? Kann man im Kinderwagen besser Zigaretten schmuggeln? Auf dem Küchentisch steht ein nicht beendetes Mittagessen. Die Gläser sind nicht ausgetrunken und die Teller stehen mit aussortierten Resten am Tellerrand am Tischrand. Die Decke ist bekleckert. «Freigegeben», hat meine erste Frau dazu gesagt. Freigegeben, um weiter drauf zu kleckern, muss sowieso in die Wäsche. Ich will nicht an Sylvia denken.
«Melden Sie sich, wenn Sie ein Attest haben.»
«Ich habe doch schon ein Attest.»
Ich sage: «Na gut, dann reichen Sie den Antrag nochmal ein.»
«Ich habe den Attest verbummelt.» Sie heult immer noch. Als wäre das eine ausweglose Situation. Ist es nicht. Es ist Kleinkram gegen den Großkram. Ich zucke die Achseln. Der Sohn winkt mit einem Basecap in die Küche. Ein Basecap ist nicht wirklich eine warme Mütze. Die Ohren frieren drunter hervor. Es sind nicht meine Ohren. Es sind nicht die Ohren meines Sohnes. Und der Bub, für den ich heute zuständig bin, der hat ja eine warme Mütze und darum ein fettig glänzendes Gesicht. Sie hat das Attest also verbummelt. Wenn wir ihr den Kinderwagen genehmigen, kommt sie und bringt ihn zurück, weil sie das Kind verbummelt hat. Wir lassen uns zur Tür bringen und geben der Frau die Hand. So gibt man die Hand, Lukas, schreibs in dein Berichtsheft.
Kaum sind wir im Auto, sage ich zu dem Stift: «Und darum müssen wir zu zweit gehen», und erkläre das nicht weiter. Ich drehe mich zu ihm um, wie er dahinten sitzt, wie ein Kaugummi. Ich lächle ihn an und fahre dann los. Er muss nicht nur bezeugen, dass die Frau freiwillig geheult hat, ohne dass ich ihr ein Leid getan habe, vor allem müssen wir uns an den Händchen halten bei diesen Wohnungseinbrüchen.
Ich habe mein Mitleid verbummelt. Ist mir in den Gully gefallen und unter den Teppich gerutscht. Vielleicht hab ich es einer Frau geborgt und nicht wiederbekommen. Es hat aufgehört zu schneien. Ich denke an das Mädchen. Ich will erst bei ihr sein, wenn es dunkel ist. Sie sieht mir aus wie eine, die sehen will, wie ich aussehe, wenn ich komme. Und gehe. Um vier wird es dunkel. Eine Stunde noch. Erst der Türke.
Lukas findet, dass Herr Güler ganz schön viele Anträge eingereicht hat. Da klingt mir ja schon der perfekte Sachbearbeiter durch. Was denn? Was denn? Sie wollen für jedes Kind einen Stuhl? Und neue Gardinen? Rauchen Sie doch mehr, dann vergilben die Fenster.
Eine Stunde geht bei einer türkischen Familie schnell herum: Kaffee und was kosten. Herr Güler hat keinen Kaffee, er hat Tee. Lukas will keinen, vielleicht, weil er dann die Mütze absetzen müsste. Renovierungsbedarf besteht, Waschmaschine ist kaputt, ein Fernseher ist schon da, aber «es ist der vom Nachbar seiner», so sagt man mir wörtlich. Herr Güler erzählt mir was vom Pferd, vom anatolischen Pferd, auf dem seine Neffen sitzen, die Schulgeld brauchen. Da soll sich das türkische Sozialamt drum kümmern, wenn es fertig gebaut ist und nicht durch eine Kombination aus Erdbeben und Schlamperei am Bau einstürzt. Schulgeld. Fernseher. Nein!
Lukas füllt die Formulare fein aus und sieht mir nicht dabei zu, wie ich mich umsehe. Es gibt ja auch nicht so viel zu sehen, wenn ich mich umsehe, aber was ich für eine Show abziehen könnte, will ich ihm gar nicht zeigen, merk dir das. Ich darf ins Schlafzimmer und das Bett befühlen, das angeblich sehr alt ist. Ich will nicht das Bett befühlen, auf dem die Prinzen Erhan, Ayhan, Erkan und Orkan gezeugt wurden. Außerdem besteht wohl Bedarf an Winterkleidung, und das glaube ich, ohne mit Lukas in den Schrank zu krauchen und alle Schleier der Frau anzuprobieren, ob sie warm genug sind für den Winter. Ich werde auch keine Gutscheine bewilligen, sondern Geld, richtiges echtes Deutschgeld, Ausländermann, da freust du dich. Ich trinke meinen Tee und sage, dass ich die Arbeit mag, weil man mit Menschen zu tun hat.
«Menschen sind nett!», sagt die türkische Frau. Wenn ich den Satz im Kopf wiederhole, bekomme ich Krissel hinter der Stirn. Menschen sind nett. Und Essen schmeckt gut. Zeit macht alt, und der Arsch ist rund und besteht aus zwei Halbseiten.
«Gut, Herr Güler!», sage ich, und falsch ist das nicht, irgendwas wird schon gut sein. Der Tee zum Beispiel war wirklich gut.
Lukas steht von der Stuhlecke auf, die er besetzt hat, als wäre er ein schlankes Mädchen. Er sagt nichts mehr, außer «Wiedersehn», als ich ihn Schlesisches Tor rauslasse. So sind Hausbesuche, schreibs in dein Berichtsheft.
Mein Kopf will Ruhe. Ein stilles Mädchen auf den Feierabend und ein Bier. Ich kaufe zwei Flaschen. Vielleicht freut sie sich. Sie freut sich über die dritte Flasche, über mich. Ihre Wohnung ist niedlich. Überall bammelt was von der Decke. Aber keine Traumfänger und Windspiele. Ich schlender herum auf Socken.
«Und?», fragt sie.
«Niedlich!», sag ich.
Sie freut sich.
Ich könnte sie fragen, was sie beantragen will. «Willst du ein Bier?» Sie will kein Bier. Ich trinke beide Flaschen aus, und wir nicken uns an. Ich kann nicht sagen, dass es mir unangenehm ist. Ich wünschte bloß, ich könnte es mit irgendwas vergleichen. Das ist wie mit Heike oder das ist ja ganz anders als mit Heike. Aber es ist irgendwie. Sie ist auch irgendwie, wie sie auf dem Boden sitzt und mit dem Oberkörper wippt. Sie ist eine Dorfschönheit, eines gar nicht so kleinen Dorfes. Alle Jungs würden bei ihrem Vater für die Rolle des Schwiegersohns vorsprechen. Sie ist schön. Auf ihre Art, wie man so sagt.
Inzwischen ist es fast dunkel. Sie will wissen, wann ich Feierabend habe.
«In einer Viertelstunde», sage ich.
«Gut, dann warten wir noch», beschließt sie und kocht Kaffee. Sie kocht guten Kaffee. Dann ist die Viertelstunde rum, und ich weiß, dass sie eine glückliche Kindheit hatte. Ich sage, ich hätte keine gehabt. Das tut ihr Leid. Sie will Erinnerungen von mir. Ich weiß, wie ich mit fünf Jahren auf dem Dachboden stand. Das nimmt sie so hin. Dachboden klingt gut. Haus, Dachboden, Lederhose, Wäsche aufhängen. Wir nicken einander zu, und sie zündet eine Kerze an. «Jetzt!», sagt mein Schwanz, «jetzt also!», und quetscht sich in der Unterhose nach oben, bildet ’nen Henkel wie an einer Tasse. Jeder zieht sich selber aus. Wir sehen uns dabei an, als wüssten wir schon, was dabei rauskommt, wenn die Hosen wegfallen. Theoretisch unterschiedliche Schritte. Es ist nicht wie mit Heike. Aber anders ginge es nicht. Sich gegenseitig ausziehen ist verliebter oder lüsterner. Wir treiben hier weder noch und treffen uns auf ihrer Matratze. Sie beißt in meine Arme, während ich still halte.
«Willst du überhaupt mit mir schlafen?», fragt sie.
«Das sieht man doch!» Ich schaue auf meinen Schwanz.
«Schön!», sagt sie, der Schwanz oder dass ich mit ihr schlafen will. Ich mag ihre Brüste. Sie sind vorne spitz wie Eistüten. Da kann man sich die Augen ausstechen oder Essensreste aus den Zähnen pulen. Ich streiche vage drüber, wie ein Oberflächenprüfer– Eins A weich. Ich hole das Kondom, das ich seit einem Jahr im Portemonnaie habe, die nackten Sohlen in ihrem kalten Flur kommen klatschend auf, und der Winter zeigt sich von der Seite, die einem zum Nölen bringt. Der Boden ist kalt. Überall ist es kalt. Ihre Oberschenkel sind warm. Sie scheint ein bisschen enttäuscht zu sein, dass ich ein Kondom benutze. Dann zieht sie mich zu sich. Ich dringe ein, herein, herein, sie ist nass, sehr nass. Ich lege meinen Kopf neben ihren, meine Stirn auf ihr Laken. Ich atme feuchte Stellen an ihren Hals. Ihr Oberkörper stemmt sich gegen mich, als solle ich mich aufrichten und sie ansehen. Ich sehe sie an.
«Was ist?», fragt sie. Ihre Hände kneten meine Schultern wie Brot. «Gefällts dir nicht?» Weil ich nicht stöhne, sagt sie. Brot. Also stöhne ich. Ich stöhne zufällig die Kerze aus. Warmes Weißbrot. Dann komme ich ein bisschen, aber viel zu überraschend, nicht so überraschend, wie es wäre, beim Zahnarzt zu kommen, der gerade die Plombe auswechselt, aber doch recht schnell. Dieses «Gleich, gleich, gleich» fällt weg. Auf einmal ist es vorbei. Ihre Haare hängen über den Matratzenrand. Wir haben uns an den Abgrund gevögelt. Das klingt viel schöner als es ist. So ein Matratzenabgrund ist nicht hoch. Da fällt man nicht tief. Ihre Haare sind braun. Sie hat geschrien wie wild und liegt jetzt da. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir uns besser kennen als vorher. Ich frage sie, ob ich ihr wehgetan habe.
Sie schaut mich an, als wäre das abwegig. «Quatsch!», sagt sie und will wissen, ob ich gekommen bin. Normalerweise fragt man das Männer nicht. Ich sage nein. Enttäuscht ruckelt sie sich unter mir hervor und bläst mir einen. Ich kann mich nicht entspannen. «Hauptsache, du bist gekommen», sage ich zu ihr. Sie schüttelt den Kopf und meint, dass das aber okay so wäre.
Ich küsse ihre Schulter. Dafür hat sie aber ganz schön Krach geschlagen. Ich schicke sie auf die Leiter, die einfach in ihrer Stube steht, wie eine Leiter eben in einer Stube steht. Ich habe schon ganz andere Sachen gesehen. Sie sitzt auf der fünften Stufe. Die Leiter kann man abwaschen. Ich lecke sie, bis ich ganz stolz bin, dass ich sie so lange lecke. Sie leitet mich nicht an, sie sagt irgendwann: «Ist okay!» Wir liegen danach noch ein wenig herum, zusammengeknüllt wie Essensreste und Verpackung. Ich knete ihren Arm und sie ziept in meinen Brusthaaren. Ob ich sie richtig küssen soll, frage ich. Wenn sie wieder: «Ist okay!» sagt, muss ich unwillig brummen.
Sie sagt: «Können wir auch nächstes Mal machen.»
«Ist okay!», sage ich.
Morgens habe ich gute Laune, und danach wird sie noch besser, sie steigert sich hochkant. Es schneit wie ausgedacht, leise und weich und ganz langsam. Ich borge mir ein Kind von einer Nachbarin und tobe im Hof herum. Das Kind will nach oben, aber ich behaupte, kann sein, es wird nie wieder so schön wie heute. Das Kind sieht das nicht ein. Es hat kalte Hände. Ich biete Kakao an, wenn es mir hilft, einen Schneemann zu bauen. Wir stehen vor dem Schneemann, ein trauriger dünner Mann, ich freue mich unwahrscheinlich auf ihn.
Das Kind findet den Schneemann verunglückt, «krüpplich», sagt es, und es kann ja finden, was es will. Nur weil wir in einem Haus wohnen und den Fahrradkeller zusammen benutzen, muss es meinen neuen Freund nicht mögen. Ich stecke dem Schneemann eine Astgabel in die kalte Faust, wie eine Wünschelrute, mit der er suchen kann, wo es warm ist. Wärme wäre für einen Schneemann gar nicht gut, nein. Bis er kommt, muss ich noch meine Wohnung aufräumen und meine Hände müssen wieder warm werden. Davor muss ich den versprochenen Kakao machen, für das Kind. Das Kind sitzt auf der Leiter, auf der dritten Stufe und fragt mich, was ich mache.
«Kakao» sage ich, aber das Kind meint, allgemein. Was ich mache, wenn ich nicht Kakao mache. Kaffee? Ich verstehe schon, natürlich, aber ich will nicht antworten, warum auch? Das Kind ist sechs Jahre alt, und schon morgen ist die Welt eine andere, ganz anders, kann sein ohne Schnee, und schon in zwei Jahren wird es nicht mehr wissen, was ich ihm erzählt habe. Also sage ich, ich wäre in einer Umschulung. Umschulung muss ich erklären. Das Kind will alles wissen. Das Kind kann gar nicht alles wissen wollen. Es gibt sehr viele Sprachen und sehr viel Grammatik dazu. Niemand weiß das alles. Konzentrationslager und Mathe. Ich will das nicht wissen. Das Kind trinkt den Kakao und wir reden über Kleingärten. Die Eltern des Kindes haben einen in Straußberg. Meine Tante hatte einen Garten. Wir finden Gärten schön, beide.
Dann geht das Kind nach Hause, um etwas im Fernsehen zu sehen, was ein Kind eben macht, wenn es krankgeschrieben ist, Ohrensausen. Ich räume auf. Ich schiebe eine ganze Stunde den Papierkram unter den Teppich, so, dass keine allzu große Beule entsteht. Den Zettel für die Krankenversicherung muss ich noch ausfüllen, für die GEZ muss ich noch bestreiten, dass ich ein Radio habe, fürs Wohngeld muss ich noch was nachreichen. Dann gieße ich meine Pflanzen und überlege, ob sie Namen brauchen. Aber wozu? Wenn ich sie rufe, kommen sie nicht.
Es ist Donnerstag, und ich sitze auf meinen Händen, damit sie warm sind für meinen neuen Mann. Ich sitze auf meinen Händen, und darum kann ich nichts machen. Ich warte auf ihn, weil ich immer schon auf ihn gewartet habe. Ich liebe solche Sätze. Ich habe schon immer auf ihn gewartet, schon immer. Er ist alle meine Männer zusammen, alle. Die waren verschieden, und darum ist er Durchschnitt. Unterm Strich ist er alle. Alle Haarfarben gemischt ergibt dunkle Haare. Ich warte mit angespannten Muskeln und geschlossenen Augen. Das ist schöner als eine Ausbildung zur Floristin. Die Ausbildungsstelle habe ich letzte Woche abgelehnt, weil das keinen Sinn macht. Im Winter noch dazu. Blumen im Winter. Zimt im Sommer. Aber irgendwas musste ich dem Arbeitsamt ja sagen, damit ich dem Sozialamt sagen kann, dass ich dem Arbeitsamt was gesagt habe. Da sage ich immer wieder Pflanzen, Blumen.
Ich sitze auf meiner Truhe und habe Zeit für alles, was ich will, alles. Ich will auf ihn warten. Ich will, dass er zu mir kommt an einem verschneiten Tag und über den Winter bleibt. Im Sommer fahren wir an die Ostsee. Irgendwer muss seine Frau sein. Dann mache ich das. Da muss doch ein Mensch in dem Mantel sein und im Oberhemd ein Mann, meiner. Ich sitze aufrecht. Ich konzentriere mich darauf, dass er bald da ist, und nach einer Stunde klingelt es, er, da, hier.
Durch seine nassen Sachen kann ich seine Rippen sehen. Alle da. Wir sind alle da. Ich und er jetzt auch, hier. Er zieht die Schuhe aus. Er mag meine Wohnung. Er liebt mich. Ich liebe ihn. Das ist klar. Ich war in Mathe immer schlecht, aber Haare schneiden kann ich und blasen, und ich weiß was mit meinen Händen anzufangen. Ich kann Nägel in eine Wand schlagen und wieder herausziehen. Ich kann die Löcher zuspachteln und hüpfen, bis ich müde bin. Er ist müde. Arbeit macht müde. Ich mache ihm Kaffee. Er trommelt mit den Fingern auf meinen Tisch, sitzt wie auf einem Stuhl, der schon mal unter ihm zusammen gebrochen ist. Er misstraut Stühlen. Wer aus dem Nest gefallen ist, misstraut Stühlen. Ich hoffe, er macht nicht Liebe, als wäre eine Frau schon mal unter ihm zusammengebrochen. Selbst wenn, das macht nichts, ich bin sein Gegenteil, er wird lernen, viel. Während er Kaffee trinkt, schaut er sich um. Schau dich um! So sehe ich innen aus, gemütlich und begrünt, Pflanzen, Blumen.
Wir reden über unsere Kindheit, weil ich wissen will, wo mein Mann herkommt. Er kommt aus einer Lederhose, von einem Dachboden. Von weit her also, aber er hat zu mir gefunden, hier. Als er die Fotos an der Tür betrachtet, machen meine Augen eine Wanderung über seine Schultern, dünne Kleiderbügel. Seine Arme hängen, weil er Koffer mit Lasten trägt. Weil ich Lasten leicht nehme, kann ich mehr Lasten tragen, die von anderen, und länger.
«Gib her!», sage ich und nehme ihm die leere Kaffeetasse ab. Gib her, alles, ich ertrage das. Er fragt mich, ob das mein Freund sei, und zeigt auf Fotos von Mario, Frank und Holger. «Das ist mein Freund», sage ich. Mario, Frank und Holger sehen sich ähnlich. Mein Jagdschema, hat eine Freundin gesagt. Sie heißt Ina. Ich habe auch Freundinnen. Die sehen sich nicht ähnlich. Ina sieht nicht aus wie Gesine, und Gesine sieht nicht aus wie Katrin, mit der ich auch nicht befreundet bin, weil sie meine Schwester ist. Ich sehe Katrin nie, nur etwas ähnlich. Aber Holger sieht aus wie Mario und Mario wie Frank. Jagdschema, als wäre ich ein Tier. Ich mag Tiere, aber sie mögen mich nicht. Sie bellen und kratzen und pinkeln auf mein Fahrrad. Jagdschema, als wäre ich auf der Jagd. Dabei laufen mir die Männer zu. Sie sind zahm, und ich habe viel Zeit. Ich nehme die Pille, und Sex schändet nicht, und ich stelle viele Fragen, weil ich viel wissen will. Lieblingsfarbe und Lieblingsbuch. Mein Sachbearbeiter zuckt die Schultern. Er hat sich über nichts einen Kopf gemacht.
«Gelb und Dorian Gray», sage ich. Er mag alles auf dieselbe Weise nicht. Mich mag er, weil er da ist. Er heißt Peter. Das macht nichts.
«Peter!», sage ich. Dann warten wir noch eine halbe Stunde. Ich ziehe mich für ihn aus. Er zieht sich für mich aus. Wir krauchen zusammen. Die ersten Berührungen sind langsam und langweilig, weil die Geschlechtsteile noch außen vor bleiben, draußen. Sein Schwanz streckt sich, groß. Die Decke strampel ich vom Bett. Er ist lecker, er riecht gut, überall, gut. Wir machen so was wie ein Vorspiel. Das brauch ich nicht, weil ich schon immer auf ihn gewartet habe, schon immer. Dass er ein Kondom holt, macht nichts. Nichts macht was. Wir machen es, drinnen. Der Rhythmus ist wie ein frühes Beatles-Lied, Help. Das gefällt mir, wie schön eingepackte Geschenke, und dann das Geschenkpapier zusammenfalten und aufheben. Sein Rücken ist warm. Sein Gesicht gefällt mir. Ich versuche ihn anzusehen, aber er kuckt in sich, das will ich auch, in ihn kucken. Seine Augen sind wie eine mit Wasser gefüllte Badewanne. Das Wasser ist kalt, aber mir ist ja warm. Alles ist gut. Unsere Körper reden ein wenig aneinander vorbei, aber das wird noch. Wir sagen nichts, aber das wird noch. Ich will nicht, dass er so was sagt wie: «Das sieht man doch», wenn ich ihn frage, ob er mit mir schlafen will. Sag Ja! Er ist nicht gut im Jasagen, aber das wird noch. Ich will seinen Namen nicht flüstern. Peter. Daran muss ich mich gewöhnen. Es dauert alles nicht lange. Immer wieder fühle ich etwas in mir aufsteigen, was mich an ein Zirkuszelt erinnert. Mir gefällt der Sex sehr gut, darum der Zirkus, darum das Zelt. Als er seinen Schwanz aus mir zieht, bin ich traurig, weil er geht. Aber er bleibt auf mir liegen und belastet mich. Ich mag das, schön. Schwer und warm, eine gute Zudecke. Bleib den ganzen Winter, Peter. Das Kondom bleibt drin. Er fischt danach mit schrägem Kopf, selbstverständlich, als ob das immer mal passiert. Ist mir noch nie passiert, aber irgendwann ist immer das erste Mal. Unser erstes Mal. Unser, wir, zwei Schwäne auf einem Baggersee. Die Schwäne werden zur Zucht zusammen gehalten, und sie sollen sich paaren und fortpflanzen. Ich halte nicht viel von Romantik. Das brauche ich nicht. Wir haben Intimität, und Romantik ist das Gegenteil davon, ja.
«Ich habs», sagt er, als er das Kondom hat. Ich finde das lustig, aber er kuckt wie vorher. Sein Gesicht verändert sich nicht für mich. Ich blase ihm einen. Er schiebt sich das Kissen unter den Kopf, um zusehen zu können. Dann bin ich dran. Ich kann das nicht auf der kalten Leiter. Kurz bevor ich kommen könnte, zittern mir die Füße. Wenn, dann im Sommer, da werden wir uns auch schon länger kennen, ewig.
Er geht weg, nachdem wir noch eine halbe Stunde herumgelegen haben, summend ich und wegnickend er. Die Heizung rauscht, und er muss das Meerschweinchen füttern. Er hat ein Meerschweinchen, und ich hab keins. Wir passen gut zueinander.
Er ist gegangen und hat nur Dreck in der Wohnung hinterlassen, Dreck aus getautem Schnee in meinem Flur. Ich lasse den Dreck liegen, weil ich es schön finde, dass er was gemacht hat. Kann sein, ich bin doch romantisch. Da muss ich erst mal zum Spiegel gehen, um zu kucken, wie ein romantisches Mädchen aussieht. Gar nicht schlimm, rot im Gesicht. Er hat sogar das Kondom mitgenommen, als könnte ich damit was basteln, was ihm nicht passt. Er will noch kein Kind mit mir. Das ist nicht so schlimm. Ich hab schon eins.
Ich liege auf dem Bett und denke an sein Gesicht über mir. Ich stelle es mir unter mir vor, aber seine Züge sind schwer scharf zu stellen. Er ist kein Mann, den man nicht vergessen könnte. Er sollte für den Geheimdienst arbeiten. Keiner würde ihn wieder erkennen. Keiner könnte später sagen, wie mein Peter aussieht, meiner. Ich kann das auch nicht, groß und schlank, fein und eckig. Sein Gesicht fasst sich weich an und vergisst sich gut. Nächstes Mal muss ich ihn neben die Augen küssen, beide. Ich muss ihn fragen, seit wann er allein ist, warum er mich liebt, ob er manchmal gemeine Sachen denkt und wofür er kämpft, was er glaubt, wie ich mit kurzen Haaren aussehe. Ich befriedige mich, nur mit den Händen, weil er außer Dreck und zwei leeren Bierflaschen nichts dagelassen hat und ich mit seinen Resten nichts machen kann. Dreck hat im Schritt nichts zu suchen und Flaschen soll man nicht einführen, weil ein Unterdruck entstehen kann und die Flasche sich ansaugt, ja.
Ich befriedige mich mit den Händen. Ein bisschen Geruch hat er dagelassen, den atme ich weg, als ich komme. Ich werde jetzt immer an ihn denken, wenn ich es mir mache. In meinem Geburtsort gab es ein Eiscafé, das hieß «Petermännchen».
drei
Es ist so dunkel morgens, dass ich den Lichtschalter nicht finden kann. In dem Satz steckt viel mehr drin, als mein Räucherkäsehirn begreift. Dabei ist es sonst ein Superhirn, nichts zu klagen. Mein Herz ist nur ein Herz, es denkt «Bumm Bumm» wie ein Tekknokloppi. Es pumpt, und die Herzklappen gehen auf und zu, zuverlässig, und ich bin auch dankbar, aber was leistet es sonst schon? Es schlägt für mich, toll, toll aber auch. Herzen schlagen nie für andere, erst nach der Organspende. Sie schlagen sich wacker, verlieren aber jedes Duell, mit fast allem, was existiert. Ein Traktor ist größer als ein Herz. Ein Chicorée schmeckt besser als ein Herz, und in einen Leinensack passt mehr rein. Ein Herz findet nicht mal einen Lichtschalter im Dunkeln.
Ich lasse das Licht aus und gehe in die Küche. Es ist halb acht, und ich habe keinen Grund, wach zu sein, denn es ist Sonnabend. Heute ist dem Sozialamt alles Elend egal. Heute gibts kein Geld für Kohle und keine Kohle für Sanitärbedarf. Am Wochenende sollen die Armen sich selber beschäftigen. Sie können zu Fuß ihre Freunde besuchen gehen und darüber reden, dass sie eine Ich-AG gründen wollen. Sie können Schach spielen mit Figuren aus Brotteig, die sie aufessen, wenn der Hunger sie quält. Ich kann nicht mehr schlafen, weil mein Knie wehtut. Licht an. Hose an. Scheiß Knie. Es tut vom Rumsitzen weh, nicht vom Krieg, nicht mal vom Fußballspielen. Mein Amtsknie, Herr Doktor. Sie wissen, immer diese Belastung, dem Land so ins Jauchebecken zu starren. Da schwimmen die Loser und haben Streit, wer aus dem größten Haufen Scheiße ein Floß bauen darf.
Ich will Brötchen kaufen und muss Zigaretten kaufen. An der Klinke meiner Wohnungstür klemmt außen die dicke Wochenendausgabe der Zeitung, mit der Sonderbeilage über jeden erdenklichen kulturellen Pups, der aus satten Künstlermägen entweicht. Der Weihnachtsmarktsonderfluchtplan und alle Texte zum Mitsingen. Klingeling. Die Zeitung ist so dick, dass ich von innen den Drehknauf nicht drehen kann. Es klemmt richtig clever. Das passiert nicht zum ersten Mal. Ich bin eingesperrt, weil die Welt so viele Nachrichten produziert. Ich sitze fest, rüttel lustlos an der Tür und gebe zu schnell auf. In drei Stunden kann ich den Hausmeister anrufen, damit er den Zeitungsriegel von außen entfernt und mich befreit. Zum vierten Mal. Bald muss ich nur noch «Hilfe!» in den Hörer schreien, und er weiß Bescheid. Warum passiert das nicht in der Woche? Vorgesetzter, Abteilungsleiterchen, Arschloch, ich konnte nicht zur Arbeit kommen, weil ich eingesperrt war, echt wahr, und Bock hatte ich auch nicht.
Mein Hausmeister ist ein Mann, der sich zum Kreis entwickelt. Er trägt riesige Schuhe und geht gebeugt. Wenn er ein Greis ist, ist er ein Kreis. Küss die Füße. Ich sehe ihm jedes Mal an, wie wichtig ihm jede kleine Aufgabe seiner Latzhosenexistenz ist. Er schaut ernsthaft, die Augen sind gerahmt von Falten wie getrockneter, rissiger Schlamm. Er hat mehr als eine hohe Stirn. Seine Stirn reicht bis zum Nacken und über den Ohren strubbeln sich die restlichen Haare zu Uhupuscheln, damit man ihm gleich ansehen kann, dass er ein komischer Kauz ist. Ich frage mich, Peter, frage ich mich, wenn du eine Frau wärst, versuch es dir vorzustellen, Titten, Mumu, alles da, ein Herz aus Sahne, nur rosa Würfelchen kacken, eine richtige Frau, und du wärst Single, kannst dir schmerzfrei Ally McBeal ansehen den ganzen Tag, arbeitest was Soziales mit behinderten Tierkindern… könntest du so einen Mann begehren? Herr Fehrmann heißt er. Herr Fehrmann kommt zu dir, weil Sat1 schneit, deine Raschelmöse ist fast zugewachsen, du kannst dich erinnern, dass es geil ist, wenn ein Mann sein Schwert reinschiebt und dabei aussieht, als ob er ein ganzes Land erobert, und dein Kissen bringts nicht mehr… könntest du diesen Mann anfassen, dich anfassen lassen, ohne dass es dich schüttelt, als ob du an einem Scheuerlappen aus einer Ausnüchterungszelle riechst? Ich könnte einfach nicht in seine gelblichen Augen sehen. Er hat Raucheraugen. Mit mir selber würde ich auch nicht schlafen. Meine Augenbrauen sehen aus wie Ameisenfühler, als ob sie jemanden angreifen wollen. Ich kann sie glatt streichen, aber sie stellen sich immer wieder auf. Das wird immer schlimmer, je älter ich werde.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: